Leseprobe
Inhalt
Einleitung
I. „Daß ich nur schreibend über die Dinge komme!“
Prozess 1 - Das Interview als Fortführung offener, prozessualer Textpraxis 16
Prozess 2 - Das fremde Material oder: der Dialog mit den Toten
Prozess 3 - Selbstbearbeitung
Prozess 4 - Der Widerspruch ungebrochen auf die Bühne geworfen
II. Ehrlos ehrlich - Ehrabschneider?
1. DDR als Material
2. Die „kritische Solidarität“ mit der DDR
3. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
III. Geschichte
1. Der historisch-materialistische Gemischtwarenladen: Karl Marx
2. Der eilige Kunde: Die DDR
Exkurs: Heiner Müller als Marxist wider Willen
3. Der unzufriedene Lehrling: Müller oder: Die Reklamation
(I) Geschichte als Katastrophe oder Ein Trümmerhaufen
(II) Gegen den Starrsinn
(III) Der (alternative) historische Materialismus oder Konstruktives Eingedenken
Einschub: Posthistoire und Stillstand
(IV) Der Messianismus des historischen Materialismus und die Utopie
(V) Die utopischste Kunst - das Theater
Exkurs: Gespenster
IV. Mythos
1. Mythos als diskursive gesellschaftliche Praxis
2. Zur Tradierung des Mythos in der Literatur
3. Die Mythenrezeption in der DDR im Anschluss an Karl Marx
4. Zu Heiner Müllers Mythenrezeption
V. „Philoktet“
1. Die Forschung
2. Vorgänger und Verhältniss
3. Der lange Weg durch die Produktion
4. Figuren(potenziale)
(I) Neoptolemos
(II) Philoktet
(III) Odysseus
VI. Die Frage nach der Tragödie nach der Tragödie - Fazit
Literatur & Bildnachweis
Einleitung
Frage: Was ist das Gegenteil von Glaube ?
Nicht Unglaube. Zu endgültig, gewiß, hermetisch. Selbst eine Art Glaube. Zweifel .
Salman Rushdie, Die satanischen Verse2
Die erste Frage ist die nach der richtigen Frage. Heiner Müller, „Philoktet“. Warum? An wen diese Frage: an den Leser/Zuschauer; an Heiner Müller? Die Antwort ist wohl bei beiden die gleiche: Weil man damit nicht fertig wird. Dabei ist die Antwort ebenso vielschichtig wie die Frage. Der Stoff, den Müller wählte, war nicht bewältigt, die Form nicht und die Situation, in de- ren Kontext „Philoktet“ entstand, ohnehin nicht. In nahezu notwendiger Konsequenz ist auch die Rezeption des Stückes - trotz einiger eindrucksvoller Versuche - bisher nicht zu einem Ver- ständnis des Dramas gelangt, das es erlaubte, „Philoktet“ in die beruhigende Mottenkiste eines still gestellten Kanons einzulagern. Auch wenn Heiner Müller ohnehin zu den meistdiskutierten deutschsprachigen Autoren gehört,3 scheint man doch bezüglich der meisten seiner Stücke in- zwischen zu befriedigenden Interpretationen gelangt, die sich nach und nach als literaturwissen- schaftliche Gemeinplätze durchsetzen. Einzig ideologisch problematische Stücke wie „Mauser“ und „Der Horatier“ sind noch ernsthaft umstritten - und „Philoktet“. Die dringlichste von allen Fragen, die dieser Arbeit Motor und zugleich oberste Instanz sein soll lautet: Was wollen wir heute mit diesem Text? Und: was können wir mit ihm (tun/wollen)? Denn angesichts der offen- sichtlichen zeitlichen und ideologischen Distanz, die er mitbringt, muss er sich, gerade als Thea- tertext, auf seine Aktualität hin befragen lassen. Der Verfasser dieser Arbeit stellt diese Frage nicht ohne die Hoffnung, eine grundlegende Anschlussfähigkeit des Textes festzustellen. Des- halb ist die 2004 in Berlin durchgeführte „Werkstatt Philoktet“ (Vgl. Die Lücke im System (2005)) wichtiges Indiz, dass sich die formale Verfasstheit des Stückes (und durchaus auch der Stoff selbst) über ideologische und historische Bedingtheiten hinwegsetzt und mediale Qualitä- ten des Theaters heraustreibt, die in dieser Weise für Müllers Theater grundlegend, für seinen Entstehungszeitraum revolutionär und noch heute richtungweisend ist.
Nicht unerheblichen Anteil an der nicht abgerissenen Debatte um „Philoktet“ hat Heiner Müller selbst. Wie Jan-Christoph Hauschild zeigt, stellte der Autor innerhalb von 20 Jahren nach der Erstveröffentlichung seines Stücks in Sinn und Form 1965 „Philoktet“ in vier einander z.T. aus- schließende Bedeutungskontexte.4 Wie der Abschnitt zu den Eigendeutungen Müllers (V.3) zei- gen wird, waren es tatsächlich noch einige mehr. Wichtig dabei ist, dass er dabei keinesfalls die vorherigen Deutungen zurücknahm, sondern zumeist auf ihnen als verschiedene, je mögliche Lesarten bestand. In einem Interview5 von 1992 etwa sprach er über zwei völlig konträre Inter- pretationen des Dramas - als Modell für „Vorgeschichte“ auf der einen und „Stalinismus“ auf der anderen Seite - und meinte dazu: „Einer der ersten Aufsätze über PHILOKTET bezeichnete das Stück als einen Text über den Stalinismus. Das war mir damals völlig neu. Heute sehe ich, es ist auch ein Stück über den Stalinismus.“6 Grundlage für diese Vieldeutigkeit ist Müllers Text- verständnis. Im direkten Umfeld der eben zitierten Stelle treten die wesentlichen Züge im Ansatz hervor. Erstens sieht er den Prozess der Textproduktion mit dem Erfahrungshintergrund und konkreten -kontext des Autors unlösbar verbunden. (Vgl. GI3, S. 161, 1992) Die Grundlage, der Schreibimpuls erscheint als ungerichtete Bewegung, Schreiben ist eine „Erfahrung“ (GI2, S. 101, 1982), die „blind“ (GI3, S. 16, 1989) ist. Entscheidend hierbei ist, dass er den Text und seine Entstehung scharf vor politisch-funktionalisierenden Indienstnahmen - auch durch sich selbst - in Schutz nimmt: „Die Autorität ist der Text, nicht der Autor.“ (GI3, S. 161, 1992) Dieser zweite Zug des Müllerschen Textbegriffs begründet die Modellhaftigkeit seiner Texte7 - jeder Text stellt eine bestimmte Verarbeitung von Wirklichkeit dar, die in seiner Unabhängigkeit vom Au- tor dem Rezipienten zur produktiven Aneignung überantwortet wird. Der prozessuale Textbeg- riff, dessen sich Müller hier bedient, integriert somit - drittens - die Rezeptionsleistung des Le- sers/Zuschauers.
Ein Text entsteht stets aus einer historischen Situation heraus, im Mindesten den subjektiven Er- lebnissen des Autors - so auch „Philoktet“.8 Diesen historischen Gegebenheiten ist er als Text untrennbar verbunden. Doch Theater ist aus seiner historisch-ästhetischen Tradition heraus - noch immer9 - ein Umgang mit Texten. Jede Inszenierung eines Dramentextes verkörpert Mül- lers Textbegriff entsprechend eine je unterschiedliche Verarbeitung eines Textes als Angebot, die wiederum den historischen Erfahrungshintergrund der Darsteller/Zuschauer10 integriert. Aus diesem Grund stellt ein Text, der diesem Umstand Rechnung trägt, viele Möglichkeiten des produktiven Umgangs mit ihm zur Verfügung.11
Daraus folgt die zentrale These der vorliegenden Arbeit, dass die Modellhaftigkeit des Dramas „Philoktet“ sich auf die inhaltliche Ebene ebenso bezieht wie auf die formale.12 Sowohl die grundlegend aktualisierende Lesart des mythischen Modells, auf dem das Stück beruht, als auch die verarbeitete Tragödienform stellen heuristische (Kunst- und Denk-)Modelle dar, die einen produktiven Umgang mit Erfahrungen ermöglichen sollen. Damit sind einige Aspekte einer The- aterästhetik Heiner Müllers benannt, die für ihn trotz einer weitreichenden Entwicklung während seines Schaffens in ihren Grundzügen Gültigkeit behielt: ein offenes Text- und Spielmodell, das beharrlich gegenwärtige Konfliktkonstellationen mit unverarbeiteter Vergangenheit konfrontiert und auf einer aktiven Rolle des Zuschauers als Ko-Produzenten besteht. Einige Grundzüge dieser Theaterästhetik - ihr Ursprung aus einem prozessualen Textverständnis und Müllers Verhältnis zur Geschichte sowie die doppelte Bedeutung des Mythos als Denkmodus und Konfliktmodell - sollen die „Philoktet“-Analyse umschließen, um den Wert und die Position des Stücks innerhalb von Heiner Müllers Schaffen aufzuzeigen.
Den beiden genannten Ebenen - der stofflich-inhaltlichen und der ästhetisch-formalen - entspre- chend wurden in der Sekundärliteratur um „Philoktet“ im Wesentlichen zwei Debatten geführt, die auch hier Beachtung finden werden. Die eine, weit umfangreicher an Beiträgen und somit scheinbar auch an Bedeutung, versuchte eine inhaltliche Bestimmung vorzunehmen, die zweite beleuchtete die formale Gestaltung des Stücks - die verschiedentlich zwischen Tragödie und Lehrstück veranschlagt wurde.
Innerhalb des ersten Diskurses ging es maßgeblich um die Identifizierung der Reichweite und Beschaffenheit der Handlung als geschichtsphilosophisches Modell. Kurz gesagt: Für welche Gesellschaft wäre der dargestellte Konflikt denkbar und wie charakterisiert ihn Müller. Das Gros der Interpretationen ist dabei bemüht, ein bestimmtes Interpretationsmodell als ausschließlich gültiges zu etablieren. Nahezu allen ist eigen, dass sie, da es sich um einen zur Inszenierung be- stimmten Dramentext handelt, diese Deutung an eine entsprechende Wirkabsicht koppeln, die sie Müller unterstellen. In diesen inhaltlichen oder geschichtsphilosophischen Diskurs mischt sich Heiner Müller von Beginn an ein. Die wichtigen Fragen hier lauten: Warum interpretiert er seinen Text und vor allem warum tut er es so häufig?13 Eine Antwort findet sich bei Ulrich Profitlich, der schon 1980, als die Kette von „Philoktet“-Deutungen durch Müller noch in vollem Gange war, den Antrieb dieses Gestus’ offen legte: „Was er liefert, sind Adaptionen, die durch aktuelle Zwecke bestimmt sind -, etwa 1965/66 vom Wunsch, eine Aufführung zu erreichen - vor allem aber durch die sich verändernde Situation der Gesellschaft und des Publikums.“14 Es sind ganz konkret „Vorschläge zu dessen [das Stück, M.Z.] Nutzbarmachung“15, so Profitlich. Der Theatertext, für die Realisierung auf der Bühne bestimmt, muss ebenso wie die antike Vorlage 1964 aktualisiert werden, um für das Theater brauchbar zu sein.
Müllers Deutungsroulette hat jedoch nicht nur die Funktion eines konkreten Spielangebots in Zeiten günstiger Repertoirepläne, die vielleicht eine Inszenierung ermöglichten, wäre das Stück nur wieder up to date. Vielmehr handelt es sich bei der Relativierung, Entgegensetzung und Ver- vielfältigung der Interpretationen um eine Art „Bedeutungsguerilla“. Das immer neue Aufbre- chen der Textbedeutung soll verhindern, dass die „intendierte Ablösung des Werks von seinem Autor und eine weitgehende […] Verselbständigung seiner Potentialitäten im Rezeptionsprozeß“ durch die eifrige Aufnahme und Fixierung seiner eigenen Spielangebote in Kritik und Literatur- wissenschaft wieder stillgestellt wird. Es kann indes in der Untersuchung des Stückes und seiner Deutungsgeschichte nicht darum gehen nachzuweisen, dass Müller all die später hinzugefügten Lesarten des Stückes nicht schon beim Abfassen 1964 angelegt haben konnte. Der Text „Philok- tet“ unterscheidet sich grundlegend von den Deutungen, die Müller selbst an ihnen später vor- nimmt. Jede Deutung muss verstanden werden als Weiterführung der Textproduktion und zugleich als ein erneuter Abschluss des Textes - eine Einhegung der Bedeutungspotentiale im Zusammenhang einer Inszenierung, die wie eine Lektüre durch einen Leser eine Sinnkonstruktion vornimmt. Dadurch ist jede Deutung zugleich der Ausschluss aller anderen möglichen Lesarten. Die grundlegende Qualität des eigentlichen Textes, die sich als genuin politische Eigenschaft des Theaters (im Umgang mit dem Textmaterial) herauskristallisiert, liegt in seiner prinzipiellen Offenheit, der Anschlussfähigkeit an aktuelle Diskurse.
Dennoch ist es notwendig, die von Müller vorgenommenen Deutungen in eine Untersuchung „Philoktets“ aufzunehmen. Die Bedeutung der beiden oben eingeführten Debatten (inhal- tich/formal) für Müllers Selbstverständnis des Stücks ist daran ansatzweise ablesbar. Zum einen lässt sich an den variierenden Umsetzungsvorschlägen die Entwicklung von Müllers Theaterästhetik festmachen, die, da Müllers Dramentexte alle zur Aufführung bestimmt waren, stets in dieser Arbeit latenter Gegenstand ist. Letztlich soll sich im Lichte der „Philoktet“-Deutungen Müllers zeigen, dass dieser einen Dramentext zugleich als einen Entwurf eines Theaters ansah, v.a. als das Material, an welchem es sich abarbeiten und die zentralen Konflikte - vor allem in Auseinandersetzung mit ihm - auf die Bühne bringen soll.16
Zum anderen lässt die andauernde Beschäftigung Müllers mit eigentlich abgeschlossenen Texten erkennen, dass sein prozessualer Textbegriff nicht nur „nach vorn“ (auf eine zukünftige Rezepti- on), sondern auch „nach hinten“ geöffnet war. Wie Hauschild in seiner Heiner Müller- Biographie über dessen Textproduktion notierte, „kam es ihm auf die Geräumigkeit, die Mehr- deutigkeit des Textes an“17. Diese Mehrdeutigkeit beruht nicht allein auf der strukturellen Be- schaffenheit der Texte und Textmittel, sondern vor allem auf den Materialien, die Müller für sei- ne Stücke wählte - nahezu alle Texte stellen Bearbeitungen einer Vorlage dar: Von der nur mi- nimal abweichenden Übersetzung bis zur reinen Motivübernahme ist alles vertreten. Diese Ar- beitsweise entwickelte Müller erst im Laufe seines Schaffens (aus).18 Was jedoch über alle Dis- tanzen hinweg etwa den „Lohndrücker“ und die „Hamletmaschine“ verbindet, ist ihr Zitatcha- rakter. Als Stoff, historische Situation, Motiv, Figur, wörtliches Zitat oder Textformation - Mül- lers Texte sind Wiedergänger. Ihre Wiederaufnahme ist die Öffnung des Textes zur Vergangen- heit hin, die nicht aus rein melancholischer Affinität zum Verlorenen entsteht. Müller sieht in der Rückwendung auf die Geschichte die Hauptaufgabe der Kunst: „Die Kunstwerke sind das Ge- dächtnis der Menschheit […].“ (GI3, S. 122, 1990) Dabei ist das Verhältnis Müllers zur Ge- schichte - ebenso wie die oben bereits angedeutete Position zur Gegenwart und Zukunft sowohl als individuelle als auch gesellschaftlich-historische - produktiv gedacht. Es geht ihm um die Aneignung von Vergangenheit unter Bezugnahme auf gegenwärtige Erfahrungen - und zugleich einer Öffnung auf eine Zukunft hin. Theater ist für Heiner Müller mehr als jede andere Kunst- form dazu prädestiniert, diese Übersetzungsleistung mehrer Zeitebenen ineinander zu ermögli- chen: „Theater muß auf seiner Übersetzungsqualität bestehen. Übersetzung in andere Zeiteinheit, in anderen Raum. Geschichte auf dem Theater ist nur darstellbar als Gleichzeitigkeit von Ver- gangenheit, Gegenwart und Zukunft, dadurch wird sie überschaubar.“( GI2, S. 63, 1986) Diese Funktion von Kunst im Allgemeinen und Theater im Besonderen beruht auf der Geschichtsauf- fassung Heiner Müllers, die in der kurzen Formel der „Wiederkehr des Gleichen als das Andere“ einen zyklisch-spiraligen Verlauf behauptet, und innerhalb dessen Vergangenes nicht zugleich als Bewältigtes erscheint. Vielmehr muss für den beharrlichen Dramaturgen deutscher Befind- lichkeiten das Unbewältigte der Geschichte in aktivierender Erinnerung wiedergekäut und prä- sent gehalten werden. Die Vorstellung des Theaters als (konstruktiv-produktiver) Erinnerung soll als Ableitung von Müllers Geschichtsvorstellung gezeigt werden, die in Auseinandersetzung mit Karl Marx und Walter Benjamin geschult ist und in einem schwierigen Verhältnis zur in der DDR weithin (und lange) dominanten Fortschrittsdoktirn steht.
Eine besonders delikate Frage im Zusammenhang mit Heiner Müllers Vorstellung von Kultur als „Dialog mit den Toten“ ist die nach dem Wesen und der Erscheinung(sformen) der Gespenster, die als Wiedergänger unbewältigter Geschichte in der Gegenwart umtriebig sind, sowie jene nach der (richtigen) Art und dem Ziel des Umgangs mit ihnen. Die Gespenster, denen etwa Jacques Derrida (2001) - in Auseinandersetzung mit Karl Marx - ein eigenes Buch gewidmet hat und welches den eingeschobenen Gespensterdiskurs der vorliegenden Arbeit theoretisch fun- dieren soll, befinden sich an zwei wichtigen Schnittstellen: 1. Zum einen sind sie die Figuren der eingeforderten Präsenz der Vergangenheit - und somit die „Wappenzeichen“ von Müllers Ge- schichtskonzept. Der Blick auf die Geschichte der phänomenologischen, philosophischen und li- terarischen Geisterkunde offenbart jedoch, dass die Frage nach dem richtigen Umgang mit Ges- penstern - Exorzismus oder, wie Derrida es fordert, rückhaltloses Willkommenheißen - stets auch Gradmesser für die „Vergangenheitsarbeit“ war und ist. 2. Gerade die letzte dieser beiden Forderungen (Vergangenheit präsent halten (1) UND eine angemessene Form des Umgangs mit ihr zu finden (2)) verweist auf den zweiten Schnittpunkt hin, als welcher die Gespenster fungie- ren. Denn zum anderen leiten die Gespenster, sowohl im Verhältnis der beiden um „Philoktet“ kreisenden „Hauptdiskurse“ als auch innerhalb dieser Arbeit, über zum mythischen Stoff und der Bearbeitungsform des Mythos: der Tragödie - sowie Müllers Auseinandersetzung mit ihr. Der zweite (formale) Diskurs, der um „Philoktet“ kreist, nimmt sich der Frage an, ob es sich bei dem Text - als Adaption der sophokleischen tragischen Vorlage - tatsächlich um eine Tragödie handelt, bzw. in welchem Verhältnis das Stück zur Tragödie steht. Er wird, wenn überhaupt, zu- meist nur an den ersten angegliedert behandelt. Bei den wenigsten steht er als ästhetischer im Zentrum der Untersuchung, wie in der Studie „Mythologische Genauigkeit“ von Michael Ostheimer (2002) oder am Rande des Tragödien-Diskurses Christoph Menkes (2005). Doch auch diesen geht es eher darum, die Wurzeln von Müllers Tragödienkommentaren offen zu legen (Ostheimer) oder das Stück - für ein philosophisches Projekt (Menke) - im Gefolge einer der Müllerschen Deutungen zu vereindeutigen.19
Heiner Müller hat nie eines seiner Stücke Tragödie genannt. Dennoch wurde er schon Mitte der 60er Jahre als Tragiker und später seine Stücke als Tragödien des 20. Jahrhunderts (im doppelten Sinne: als die Tragödie des 20. Jahrhunderts verhandelnde und als die beste Adaption der Gattung Tragödie im 20. Jahrhundert) gefeiert.
Das wäre weniger verwunderlich - ein Meister seines Fachs bemühte sich um die Wiederbele- bung einer tot geglaubten literarischen Form -, ließe man die Umstände außer Acht. Doch Mül- ler war erklärter, wenn auch kritischer Kommunist20 und zu seiner Zeit galt das - vereinfachte - Marxsche Diktum vom Mythos als „Naturmythos“ einer gattungsgeschichtlichen Kindheit. Die Tragödie des Schicksals war den Notwendigkeiten der Geschichte gewichen, und Brecht, in des- sen produktiver Nachfolge sich Müller bewegte, hatte die aristotelischen Kunstgesetze ad acta gelegt. Warum also die Beschäftigung mit einem unzeitgemäßen Sujet, einer unproduktiven Form?
Vom umfangreichen Oeuvre Müllers eignen sich besonders seine Antike-Adaptionen als Unter- suchungsgegenstand für diese Frage, auch wenn die „Germania“-Texte nicht minder dem Tragö- dienfeld zugeschlagen wurden. Denn erstere halten sich sowohl thematisch als auch formal strenger an die antiken Vorgaben, was die gestellte Frage klarer erscheinen lässt. Die Tatsache, dass sowohl Heiner Müller selbst, als auch Regisseure und Interpreten den Text „Philoktet“ von 1964 als den zugleich klassischsten und modernsten sowie denjenigen bezeichnen, der das „höchste technische Niveau“21 erreicht hätte, lässt die Wahl des Untersuchungsgegenstandes leicht erscheinen.
Heiner Müllers Brief an den Regisseur der bulgarischen Uraufführung, die er 14 Jahre nach der Erstumsetzung von „Philoktet“ als die eigentlich erstmals gelungene Inszenierung bezeichnete, zeigt deutlich, dass die Auseinandersetzung mit Sophokles’ Vorlage des Stücks sowie die theore- tischen Erörterungen Hölderlins, Nietzsches und Hegels den Hintergrund des Textes bilden. Die eigentliche Frage jedoch ist die nach dem Kern des tragischen Konflikts (oder danach, wo er sich lokalisieren lässt) und seiner Lösbarkeit. Gerade in der Verneinung (tragischer Erlösung) sieht Müller den Grund für die ungebrochene Gültigkeit der Tragödie - und die Anschlussmöglichkeit an sein Geschichtsbild -, die zum einen in ihrer kulturell-gesellschaftlichen Funktion bedeutsam ist und zum anderen für Müller Manifestation einer Schwellensituation ist, in der er auch seine Gesellschaft analog befindlich sieht.
Doch über alle konkret historischen Verbindungen hinweg entdeckt Heiner Müller sowohl im Stoff als auch dem Widerstreit der Tragödie einen aufgebrochenen Konflikt, der ihm als grund- legend für die Gesellschaft des Abendlandes gilt, und welcher sich ungelöst durch die Zeiten mahlt. Diesen wirft er, als Grundformation seines Theaters wirksam, in „Philoktet“ exemplarisch auf die Bühne; die vielfach formulierbare Dialektik aus Körper und Idee, Natur und Kultur, Indi- viduum und Gesellschaft. Dabei ist für Müller evident, dass diese Einsicht sich nicht ohne weite- res reflexiv - über den Weg der gewissermaßen „parteiischen“ Sprache, dem Text im Theater - erschließt, sondern (auch u.v.a. im Konflikt mir ihr) erfahrbar gemacht werden muss. Hier trifft sich Müller mit einem Kernanliegen des postmodernen Theaters, dessen Theorie Hans-Thies Lehmann erstmals formuliert hat und welches für die Anschlussfähigkeit von „Philoktet“ Pate steht.
Dabei ist die Frage nach der Tragödie eigentlich zuvorderst eine Frage nach dem Mythos, der nicht nur als Gegenstand der Tragödie von Belang, sondern Bestandteil einer Debatte um ver- schiedene diskursive Praktiken ist. Der Mythos und seine (literarische) Tradierung, Wandlung und das Verständnis von sowie die Kritik an ihm im Laufe der Geschichte sind für die Arbeit in- sofern bedeutsam, als dass er aufzeigt, dass Heiner Müller die griechische Tragödie und ihren mythischen Stoff nicht nur als analoges Konfliktmodell zur Verdeutlichung geschichtlicher Stagnation aufgriff. Denn Müllers Anknüpfen an die griechische Tragödie ist zudem, entgegen einer jahrhundertelangen Tradition der (einseitig verurteilenden) Mythenkritik, als ein Anschluss an ein „mythisches Denken“ erkennbar, welches v.a. diskursiv, kollektiv und gesellschaftsbil- dend zu beschreiben ist und das zuletzt in der Mythen rezipierenden Tragödie Widerhall fand. In bester Tradition seines Übervaters Brecht gelangt in Müllers Arbeit nicht nur historisches Ma- terial zur Wiederaufnahme und Verarbeitung, sondern auch stets die eigenen früheren Textent- würfe, die an aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen gemessen, gerieben und überarbeitet werden.22 Diese Korrektur des Textes findet jedoch - bei Müller ganz anders als bei Brecht23 - auf der Ebene der Realisierung für die Bühne statt, in der Auseinandersetzung mit der Vorlage, die so die ihr eingeschriebenen Erfahrungen mit einbringt: „Die erste Wirklichkeit des Theaters ist der Text, nicht der Stoff. Im Prozeß der Aufführung, in der ‚Tateinheit’ mit der Realität der Produzenten, zu denen die Zuschauer gehören, entsteht der Gegenentwurf.“ (GI2, S. 63, 1986) In (zunehmend kritischer) Verhältnis zu Brechts Lehrstücktheorie ist dieses Theaterkonzept Müllers eines, das sich an das Publikum richtet - ohne jedoch zu richten. Im Unterschied zum großen Meister des dialektischen Lehrspiels versagt Müller seinen Figuren, Darstellern und Zuschauern die Lehre auf inhaltlicher Ebene und wirft sie mit dem unbewältigten Konflikt in der Tasche und im Kopf wieder auf die Strasse.
Diese Verlagerung des Konflikts in einen Raum, der die Szene zwischen Bühne und Zuschauern aufspannt, zeigt die abschließende Stoßrichtung der Arbeit an. Die erwähnte Lesart des „Philok- tet“ von Christoph Menke in seinem Buch „Die Gegenwart der Tragödie“ lässt den Text in Nachfolge der Brechtschen Lehrstücke als eine „Spiel der Tragödie“ an seiner Lehrintention fehlgehen - die Tragödie, die in ihrer Freiheit des Theaters den Ablauf („im Labor“) erprobt um so den Zuschauer zur experimentell gesinnten Grundhaltung gegenüber der realen Praxis zu be- wegen, scheitert an den Grundregeln des Spiels: nie ernst und nie notwendig. Das Problem der (theater- und damit auch wirkungsästhetischen) Gebundenheit des Stücks gilt es somit abschlie- ßend am Beispiel der Lesart zu diskutieren. Kann „Philoktet“ sich der von Menke entworfenen Alternative der „Tragödie des Spiels“ zuschlagen oder bleibt es unlösbar einer ideologische Grundposition verhaftet, der es einigen Interpreten zufolge entstammt?
Doch wird es nicht so sehr ausschlaggebend sein zu entscheiden, ob es sich bei „Philoktet“ - als dramatischem Text - tatsächlich um eine („waschechte“) Tragödie handelt oder nicht, sondern welche Formen- und Stoffbezüge im Stück exemplifiziert und welche darüber hinaus angelegt sind und wie man sie nutzbar machen kann. Dabei richtet sich das Augenmerk im Besonderen darauf, inwieweit diese Möglichkeiten das Verdienst einer Theaterform - der Tragödie - ist, die nicht nur als Grundlage eines dramatischen Textes, sondern vor allem als Paradigma einer Theaterform heute produktiv gemacht werden kann.24
der „Korrektur“, jedoch auch das quasi auf Anweisung „von oben“. (Nichtsdestotrotz war auch Müller ein unermüdlicher „Selbstbearbeiter“. Viele über Jahrzehnte unbeendete Texte fanden Eingang in spätere Projekte.) Das spricht jedoch nicht, wie man annehmen könnte, für die Position eines autoritativen Autorverständnisses. Eher lässt sich daran die Differenz der Theaterästhetik zwischen Brecht und Müller bestimmen. Während für Brecht der Text die Autorität auch noch in der Inszenierung darstellt, verschiebt sich diese bei Müller zu Gunsten der Inszenierung. (Diese Pauschalisierung kann nicht für die gesamte Schaffenszeit Müllers behauptet werden, sondern bezeichnet eine Tendenz, die sich im Laufe der Zeit verstärkte.) Beim Verhältnis Müller-Brecht, die später beispielhaft über das Lehrstück erfolgen soll, wird darauf zurückzukommen sein.
Was bis hierher deutlich geworden ist: Die zentralen Begriffe in Müllers Theater - denn nichts anderes sind seine Texte, selbst, wenn sie nur gelesen werden - bilden ein unlösbares Geflecht, das sich nur in wechselseitiger Erhellung knüpfen und auch entwirren lässt. Die sechs Teile (plus ein Exkurs) der vorliegenden Arbeit wollen diesem Umstand Rechnung tragen. Daher werden die Kapitel I. bis IV. (und der Exkurs), obwohl sie keine ausschließliche Beschäftigung mit dem Stück „Philoktet“ darstellen, jene wichtigen (oben genannten) Eckpunkte des Theaters Heiner Müllers zu erarbeiten versuchen, um einen Denkraum für die tatsächliche Beschäftigung mit dem „Stück“ zu schaffen. Die ersten vier Kapitel sollen gewissermaßen das Handwerkszeug zur Be- trachtung „Philoktets“ liefern.
Im Text, und mehr noch in der daraus hervorgehenden Inszenierung, überschneiden sich eine Vielzahl von Zeiten, die je historische Erfahrungen reflektieren - wenigstens die Zeit des Stoffs (für „Philoktet“ sowohl die des Mythos als auch die des sophokleischen „Philoktet“), die der Entstehung des Stücks (Heiner Müllers Erfahrungen bis zum Jahr 1964) und schließlich der je- weilige Inszenierungskontext (der zugleich die Inszenierungsgeschichte mit zitiert). Dies bedeutet, dass jede abschließende Lesart und Interpretation des Stückes den Text eindimen- sional macht und ihn um Realisierungsmöglichkeiten bringt, die er offensichtlich bereithält. Da- her will die Arbeit in der Besprechung aller noch so abseitigen themenkomplexe um das Stück kreisen und dadurch den sich langsam schließenden Ring der Deutungen wieder öffnen. Dafür soll im ersten Kapitel (I.) Heiner Müllers Textproduktion untersucht werden. Ein besonderes Augenmerk richtet sich dabei auf die Form seiner Deutungen in Interviews, die nicht nur in Be- zug auf „Philoktet“ von einer grundlegenden Widersprüchlichkeit geprägt sind. Der zweite Ab- schnitt (II.) beleuchtet Müllers Verhältnis zur DDR. Hier kann es nicht um eine vollständige (po- litische) Standortbestimmung des Weltenbummlers Müller gehen. Wichtig ist der Abschnitt v.a., weil sich aus dieser wechselvollen Verbindung sowohl Müllers Funktionsbestimmung von Thea- ter ableiten lässt, als auch das Verhältnis zu seinem Material und Schreibanlass. Das dritte Kapi- tel (III.) versucht zu klären, in welcher Weise sich Müllers Arbeit um Geschichte dreht und in welchem Verhältnis er sich dabei zur marxistischen Geschichtsphilosophie sowie deren „Korrek- tur“ durch Benjamin befindet. Diese Beziehungen bleiben auch im Weiteren insofern relevant, als dass sich Müller mit „Philoktet“ eines Stoffs annimmt, der durch Marx als Mythos der - ei- gentlich längst abgearbeiteten - Vorgeschichte der Menschheit zugeordnet wurde. Daher wird die besondere Position des Mythos, ausgehend von seiner Funktion zur Entstehungszeit „Philok- tets“ über die Rezeption durch die europäische Aufklärung (und folgender Epochen), Karl Marx sowie Walter Benjamin bis zur Adaption durch Müller, im vierten Kapitel (IV.) im Zentrum ste- hen. Dazwischen wird ein kurzer Exkurs sich der aufschlussreichen Figur des Gespensts anneh- men und versuchen, die Potenziale aufzuzeigen, die es für die Beschreibung von Heiner Müllers Theater bereithält. Schließlich bearbeitet das fünfte Kapitel (V.) die Hintergründe, Entstehung und wechselvolle Deutungs- und Rezeptionsgeschichte von „Philoktet“. Eine eingehende Analyse der Figuren als Träger der Konflikte und Potenziale des Stücks soll das ausschließlich „Philoktet“ bearbeitende Kapitel vervollständigen. Schließlich wird ein kurzer Ausblick (VI.) auf eine mögliche umfangreiche Analyse des Verhältnisses von Müllers „Philoktet“ zur Geschichte der Theorie und Praxis der Tragödie seit ihrer antiken Form die Arbeit abschließen und versuchen, in aller Kürze einige Fäden wieder zusammenzuführen.
I. „Daß ich nur schreibend über die Dinge komme!“
25 Alle Geschichten werden heimgesucht von den Ges- penstern der Geschichten, die sie hätten sein können. Salman Rushdie, Scham und Schande26
Dieses Kapitel versucht, einige Thesen zu Heiner Müllers prozessualem Textverständnis aufzu- stellen und sie im Ansatz zu belegen. Neben einigen Untersuchungen zu diesem Thema geben vor allem Müllers eigene Aussagen zu seinem Schreiben Aufschluss darüber.27 Bestandteil die- ser Beweisführung soll es daher auch sein, auf die besondere Bedeutung der Interviews einzuge- hen, die Heiner Müller seit Ende der 70er, überwiegend jedoch in den 80er Jahren in steigender Zahl gab. Dabei soll gezeigt werden, dass die Interviews, die immer wieder als Ersatz für die fehlende Verschriftlichung von Müllers Theorien herangezogen werden, einen eigenen Stellenwert innerhalb Müllers Oeuvre beanspruchen können und nicht nur tagesjournalistisches Geklapper sind. Die - oft behauptete - Bedeutung der Gespräche als Theorieersatz kann nicht gänzlich zurückgewiesen werden - schließlich wird hier selbst versucht, eine bestimmte Form des Schaffensprozesses aufgrund der Eigenaussagen des Dramatikers zu skizzieren. Allerdings kann auf diesem Wege die selektiv-isolierende und damit vereinseitigende Zitierweise von Müllers Aussagen in der Sekundärliteratur relativiert werden, indem die offene und (intendiert) widersprüchliche Beschaffenheit dieses Gesprächsarchivs dargelegt wird.28
Ein grundlegender Nachteil für die vorliegende Arbeit besteht darin, dass die Selbstaussagen Heiner Müllers alle ausnahmslos nach der Zeit datiert sind, in der das hier im Zentrum verhan- delte dramatische Werk entstand.29 Einzig die erste offizielle Stellungnahme Müllers zu „Philok- tet“, die 1966 in „Sinn und Form“ als Gespräch mit dem Herausgeber Wilhelm Girnus, Werner Mittenzwei und Rudolf Münz lanciert wurde- im Anschluss an den Erstabdruckes des Stückes 1965 an gleicher Stelle -, steht aus den 60ern zur Verfügung. Dieses Manko wird zum einen dadurch wettgemacht, dass bestimmte Tendenzen, die anhand der Aussagen Müllers kenntlich gemacht werden sollen, ohnehin an den (Theater-)Texten bereits zu Tage treten.30 Andere, nicht so offensichtliche Züge können mit Hilfe bereits vorliegender (und eigener) Untersuchungen zu Müllers Texten auch für eine frühe Phase seines Schaffens nachgewiesen werden. Bei jenen Zügen der Textproduktion Heiner Müllers, für die sich keine Existenz zu einem früheren Zeitpunkt als dem seiner Benennung durch Müller in einem Interview nachweisen lässt, soll das auch nicht behauptet werden. In der Tat geht es dort eher darum, (im Ansatz) eine Entwicklung aufzuzeigen, die in Müllers Verständnis eines (Dramen)Texts - seiner Ursprünge, Entstehung, Konsistenz, Funktion und Umsetzung (auf der Bühne) - sich vollzog.31
Auf der Grundlage der hier gewonnen Erkenntnisse wird später der heuristische Wert der Kommentare Müllers zu „Philoktet“, mit denen er eben über mehrere Jahrzehnte verteilt das Stück neu interpretierte, und damit auch im Rahmen seiner Text- und Theatertheorie produktiv zu machen versuchte, besser zu bemessen sein.32
Sinn und Form von 1966 (Müller, Heiner (2005c)) sowie eines der letzten Arbeitsgespräche Müllers aus dem „Kalk- fell“-Arbeitsbuch (Müller, Heiner (1996a)). Die drei Bände „Gespräche“ aus der Werkausgabe des Suhrkamp- Verlages, die Alexander Ernst in seinem Artikel „Heiner Müllers Theater der Schrift oder: Der Interviewkünstler im Spiegelbild seines Schreibprozesses“ (http://www.perspektive89.com/2006/06/29/heiner_mullers_theater_der _schrift_oder_der_interviewkunstler_im_spiegelbild_seines_schreibprozesses) verwendet, sind bislang noch unver- öffentlicht und standen daher nicht zur Verfügung. Außerdem verdeutlicht der Untertitel des ersten Bandes dieser Reihe (Gespräche 1 (1965-1987)), der die frühesten Gespräche beinhaltet, dass von vor 1965 keine nennenswerten Selbstaussagen Müllers verfügbar sind. Doch auch so spricht das Verhältnis der Texte eine deutliche Sprache: Nur ein Text aus den 60er und vier aus den 70er Jahren liegen vor, wohingegen 28 Gespräche aus den 80er Jahren sowie 19 aus den ersten fünf Jahren der 90er vorhanden sind. Wenn man berücksichtigt, dass die Zahl der angefragten Interviews bedingt durch Müllers steigende Popularität im Laufe der Zeit ohnehin zunahm, lässt sich dennoch konstatieren, dass er sich dieser Form der (hier v.a. relevant: poetologischen) Selbstdarstellung und -verständigung in zunehmendem Maße bediente. Die verwendeten schriftlichen Texte des „Material“-Bandes stammen überwiegend aus den 70er (sechs) und 80er Jahren (fünf), nur der viel zitierte „Glücklose Engel“ (1958) und die für die „Philoktet“Untersuchung wichtigen „3 Punkte zu PHILOKTET“ (1968) sind älter.
Prozess 1 - Das Interview als Fortführung offener, prozessualer Textpraxis
Einen Autor, der nichts ernster nimmt, als seine Texte, muss man zwangsläufig fragen, warum er diesen nicht ein theoretisches Beiwerk zugesellt, um sie im richtigen Licht verstanden zu wissen. Zumal, da es sich um Dramentexte handelt, die mehr noch als Prosa - durch die Notwendigkeit, sie auf einer Bühne umzusetzen - unter einer Missinterpretation als Verunstaltung zu leiden ha- ben. Die Antwort Müllers33 erscheint deutlich: „Die Autorität ist der Text […].“ Doch gegenüber was? Das Zitat geht weiter: „ […] nicht der Autor“. (GI3, S. 161, 1992) Die Autorität eines Tex- tes ist Müller „heilig“, auch gegenüber seinen eigenen Intentionen. Diese bezeichnen zweierlei: Zum einen (A) die Ideen, Intentionen oder Strategien, die er beim Schreiben gehabt haben könn- te. Und zum anderen (B) die Deutungen und Lesarten, die im Nachhinein an seine Stücke heran- getragen werden.34
Die Vorbehalte gegenüber der Bedeutung eigener, der Textentstehung zu Grunde liegenden Wirkabsichten („Ideen“, A) hat wiederum mehrere Ursachen, die im Laufe der Jahre immer ver- zweigter werden. Spätestens seit den 80er Jahren behauptet Müller hartnäckig die „Willkür“ (GI2, S. 146, 1988)35 in der Bearbeitung seines Materials. Ursprung des Schreibens seien „weni- ger Strategien als Bedürfnisse“ (GI2, S. 146, 1988), bereits kurz zuvor nannte er „Schreiben […] eine absolut verantwortungslose Tätigkeit“ (GI2, S. 89, 1987) und gipfelt in der Absage an die politische Instrumentalisierbarkeit - Kunst als „Zerstörung von Ideologie“ (GI2, S. 102, 1987).36 Vier Gründe (A1-4) sind hierfür denkbar, die miteinander in Verbindung stehen und sich im Laufe der Zeit eher ergänzen als ablösen.
(A1) Jeder Text entsteht vor dem Erfahrungshintergrund seines Autors, der sich - mit oder gegen seinen Willen - in den Text einschreibt. Das bezieht sich sowohl auf den Lebenshorizont - „Ge- schichte als persönliche Erfahrung“ (GI1, S. 96, 1982)37 - als auch die konkreten Erfahrungen während des Schreibens: „ […] was während des Schreibens passiert, gehört zum Text“. (GI2, S. 147, 1988)38 Dies macht das Schreiben zu einem nicht kalkulierbaren Prozess - „Schreiben ist ein Lebensausdruck“ (GI2, S. 102, 1987) - und verhindert damit die unproblematische (ideolo- gisch-politische) Instrumentalisierung des Produkts: „Je mehr man es kalkuliert, desto wirkungs- loser wird es, selbst politisch.“ (Ebd.)39 Der Text wird durch den in ihn eingeschriebenen Erfah- rungskommentar des Autors ideologisch verdächtig, subversiv. In der Überlagerung verschiede- ner Erfahrungs- und Zeitebenen innerhalb eines Textes gestaltet Müller zugleich sein Verständ- nis eines produktiven Verhältnisses von Kunst und Wirklichkeit, das er an vielen Stellen zum Ausdruck bringt - etwa indem er den „Text eine Übersetzung von Wirklichkeit […] und keine Abbildung“ (GI2, S. 83, 1987) nennt.40
Der Verweis auf unwillkürliche Einflüsse auf den Schreibprozess betont nicht nur mögliche An- schlussmöglichkeiten, die der Autor beim Schreiben nicht intendierte, sondern widerspricht zugleich schon dem Versuch, eine bestimmte Verwendung des Textes in diesen einzuschreiben. Seine „Absicht und der Text sind zwei völlig verschiedene Dinge“ (GI2, S. 99, 1987). Anstatt der Einschreibung bestimmter Ideen in den Text besteht Müller auf ihrer Verarbeitung durch die- sen. Seine bevorzugte Formulierung für diesen Vorgang lautet: „Das Schreiben verbrennt die In- tentionen.“ (GI2, S. 132, 1988)41 Die zentrale Funktion dieses Vorgangs könnte man als Selbst- therapie des Autors bezeichnen, der Versuch, um mit Christa Wolf zu sprechen, „schreibend ü- ber die Dinge [zu] komme[n]“42. Müller nennt daher den Hauptimpuls seines Schreibens „Dinge zu zerstören […], diese Obsession [die deutsche Geschichte, M.Z.] zu zerstören“ (GI1, S. 102, chung von „Verkommenes Ufer“, präsent: „Die jeweilige Gegenwärtigkeit des Arbeitsprozesses bezieht die eigene Geschichtlichkeit auch als kollektiv lesbare mit ein […].“ (Meister, Monika (1989), S. 68) 1982) und „das Auslöschen von Bildern“ (GI2, S. 142, 1988).43 Der fertige Text ist für Müller selbst daher (scheinbar) nur mehr von mittelbarem Interesse - über ihn zu sprechen „ist, als ob man von einer Leiche redet, einem toten Körper“ (GI1, S. 95, 1982).44 Wer ihm bis hierher folgt, fragt sich: Warum dann noch über die Texte reden?
Die Antwort findet sich wieder bei Müller selbst: „Außerdem hatte ich 1956 noch keinen Zwei- fel daran, daß das, was ich schrieb, auch gleich auf die Bühne kommt.“ (GI2, S. 96, 1987)45 Die- ser Grundgestus, Texte für ein Publikum zu schreiben, ist es, den Heiner Müller nie abgelegt hat: „Man schreibt immer für ein Publikum, auch wenn man es gar nicht weiß. […] Auch in der Schublade ist das Publikum in irgendeiner Weise anwesend.“ (GI1, S. 11f., 1974) An dieser Stel- le ist es Zeit, den Trumpf einer der wenigen Aussagen des frühen, im Kontext von „Philoktet“ entstandenen Interviews auszuspielen, um die bisherige Untersuchung auf den Gegenstand der Arbeit hin zu lenken und einen konstanten Anspruch Müllerschen Schaffens zu behaupten, um den die Variationen konzentrisch zu kreisen scheinen. In dem „Philoktet“-Gespräch von 1966 verwies Müller darauf, dass der Abdruck des Stücks „eine Arbeitsfassung [sei], nicht gedacht als endgültig“46. Eingedenk der Tatsache, dass er, wie oben erwähnt, nur einmal tatsächlich ein Stück mehr oder weniger komplett änderte („Korrektur“), ist der anschließende Satz von größter Bedeutung: „Ein Stück kann nie fertig sein vor der Aufführung.“ In den darauf folgenden Ein- zelkritiken bestimmter Elemente des Dramas verweist Müller mehrmals auf die Verantwortung und (im positiven Sinne) aufgeklärte Position des (DDR-)Publikums.47 Die besondere Funktion des Theaters und des Künstlers in der DDR, sollen im nächsten Kapitel besprochen werden. Hier geht es nur um die Feststellung, dass Müller mehr oder weniger von Beginn an einen Textbegriff vertritt, der - für Theatertexte noch ausdrücklicher - prozessual nicht nur im Abschnitt der Pro- duktion durch den Autor angelegt ist, sondern auch in der Rezeption als Weiterarbeit am Text:
„Drama entsteht nur zwischen Bühne und Zuschauerraum, und nicht auf der Bühne.“ (GI1, S. 39, 1976) Diese Formel zieht sich als Konstante durch alle Kommentare Heiner Müllers. Die Viel- falt, die sie dabei annimmt, verleiht der Beharrlichkeit der Forderung nur umso mehr Ausdruck. Dass sie in Momenten, in denen sie unerreichbar scheint, am heftigsten vertreten wird - „Man muß es [das Publikum, M.Z.] im Theater bekämpfen - sonst versteht es nichts“ (GI1, S. 89, 1982), offenbart den Standpunkt Müllers als beharrlichen Rückzugspunkt seines Schaffens, das auf den produktiven Kontakt zum Ko-Produzenten Zuschauer besteht. Noch 1989 entlarvt er sich als Utopisten eines „eingreifenden“48 Theaters, wenn er (sicher nicht ohne Selbstironie) schreibt: „[…] Traum eines Theaterautors: das Publikum zeigt Wirkung.“ (GI3, S. 34, 1989) Eine Wende brachten für das von Müller veranschlagte notwendige Verhältnis von Zuschauer und Bühne wohl die 70er, v.a. das Jahr 1977. Nicht nur verabschiedet er sich Anfang 1977 offiziell - per Brief an den Brecht-Experten Reiner Steinweg - vom Lehrstück: einer der bislang (in der DDR) als am progressivsten geltenden und auf die Teilhabe des Zuschauers pochenden Theaterform. In den 70ern häufen sich zudem seine Bemerkungen über die (mangelhafte) Qualität der DDR- Bühne: „Theater, so betrieben, wird Mausoleum für Literatur statt Laboratorium sozialer Fanta- sie, Konservierungsmittel für abgelebte Zustände statt Instrument von Fortschritt.“49 Diese er- nüchterte Bestandsaufnahme mündet schließlich in der Postulierung der vorübergehenden „Grab- legung“ des Lehrstücks. Darin manifestiert sich schließlich der von vielen Exegeten diagnosti- zierte Rückzug Müllers von der sozialen Funktion des Theaters auf eine rein provokative.50 Dem dargestellten Konzept tut das keinen Abbruch. Was hier behauptet wird, ist - als heuristi- sches Modell - folgendes: Müller sieht den Theatertext als Produkt zweier Entstehungsphasen. Die erste Phase, das Schreiben des Textes durch den Autor, sichert dem Geschriebenen durch seine unhintergehbare Bindung an die Erfahrung des Schreibenden die Autonomie - keine (be- stimmte) Bedeutung, keine (feste) Idee oder Intention verbirgt sich im Text selbst, sie wurden al- lesamt während des Schreibens „verbrannt“. Als solcher ist er aber auch erledigt, uninteressant, unproduktiv - „eine Leiche“. Erst die zweite Phase, die Inszenierung des Textes in einem Thea- ter vor bzw. mit einem Publikum öffnet ihn - auf einer neuen Ebene, die sich zwischen Text, Bühne und Zuschauerraum aufspannt51 - wieder für die Weiterbearbeitung vor einem neuen Er- fahrungshintergrund. An dieser Stelle kommt die Interviewform ins Spiel.
Die Gründe A2-3 für die Ablehnung einer textimmanenten Idee seien hier kurz abgehandelt, zum einen weil sie wesentlich aus A1 hervorgehen, daher gewissermaßen als dessen Ausdifferenzierungen betrachtet werden können, und zum anderen, weil sie auch erst später in der Arbeit eine Rolle spielen werden.
A2. In den 70er Jahren bindet Müller die Gründung seiner Textproduktion auf Erfahrung in den aufklärungskritischen Diskurs ein, der in der DDR an Boden gewinnt. Die Romantikrezeption, die beginnende Rehabilitation der Mythen und die Kritik am technologiezentrierten Wirtschafts- programm der DDR verlagerten das Utopiepotenzial in den Bereich der bedeutungsfreien Erfah- rung. Texte, denen - per definitionem - keine (aufklärerischen) Ideen beigelegt waren, konnten auch nicht von einer vereinseitigenden, instrumentellen, „kalkulierenden Vernunft“52 (Adorno) missbraucht werden und besaßen damit ein widerständiges Potenzial, mit dem verdeckte Unter- drückungsmechanismen enthüllt werden konnten und die auf die Suche nach der verschollenen menschlichen Natur gingen: „Bisher sind meine Texte deshalb alle so schlecht, so falsch insze- niert worden, weil sie mit dieser penetrant aufklärerischen Haltung präsentiert wurden.“ (GI1, S. 119, 1982)53
A3. Irgendwo zwischen A1 und A2 schließt Heiner Müller an die westeuropäische Theater- avantgarde an, die spätestens seit den 60er Jahren einen Theaterbegriff prägte, der von der unhin- tergehbaren Präsenz des menschlichen Körpers ausging und diesen zum Schauplatz - der Bühne auf der Bühne - werden ließ. Eine zentrale Rolle spielte hierbei die Rezeption des Werks von Antonin Artaud, dessen Schlagwort des „Theaters der Grausamkeit“54 auch für Müller interes- sant wurde: „Wichtig ist bei Artaud, daß er eine große Störung ist. […] Artaud ging nie aus von einer Trennung von Zuschauerraum und Bühne, in seinen Vorstellungen jedenfalls; er versuchte dem Theater wieder eine vitale Funktion zu geben […].“ (GI1, S. 45f., 1976)55 Müllers Betonung der vitalen Funktion des Schreibprozesses findet darin seine Entsprechung für das „Weiter- schreiben“ des Texts im Theater. Ausgehend von seiner Bemerkung, „Drama kann man nicht im Sitzen schreiben“, weil es „mehr Körpersprache“ sei, (GI1, S. 101, 1982) entwirft Müller ein Theater der Erfahrung, das vor jedem Deuten und Verstehen ein sinnliches Erleben - der Kon- flikte, vor allem aber des Textes - setzt.56 Entscheidend für die vorliegende Untersuchung ist, dass trotz aller Aufwertung der taktilen Theaterelemente der Text im Zentrum von Müllers Thea- terästhetik bestehen bleibt, er ist neben Ausrichtung auf ein Publikum seine zweite Konstante. A4. Die vierte Begründung geht im Wesentlichen aus der dritten hervor; sie ist eigentlich wie- derum der Rückzug auf eine Minimalposition der Theaterbestimmung und der dazugehörigen Texte. Im Grunde ist sie schwer von A2 und A3 zu trennen, besteht jedoch noch stärker auf der (fast monadischen) Autonomie der Texte, und leitet daraus das produktive Movens des Theaters als die Fähigkeit, Störung des Normalen, Verstehbaren zu sein, ab. Entsprechend äußert sich Müller in einem seiner letzten Gespräche von 1995: „Theater ist Krise.“57 Diese Position ist si- cher an verschiedenen früheren Äußerungen Müllers nachweisbar, findet sich jedoch massiv erst nach 1989. Sie scheint eng verbunden mit dem Rückzug Müllers von allen ideologisch verdäch- tigen Positionen, der viel weniger dem Versuch geschuldet war, seine eigene Position unverfäng- lich zu halten,58 als dem, seine Texte vor einer Verurteilung - die gemeinsam mit der Abrech- nung der DDR und den in ihr/für sie engagierten Schriftsteller erfolgen musste - in Schutz zu nehmen.59 In diesem Zusammenhang erhielt sein Standpunkt, „Politik ist ein Material, genau wie alles andere“ (GI3, S. 94, 1990), neben der bisher gültigen ideologiekritischen Bedeutungsebene noch eine der ideologischen Standortlosigkeit (der Texte).
Letztlich sind diese vier (Begründungs)Ebenen nur artifiziell voneinander zu trennen, wie es hier geschehen ist, um auf die Verschiebungen in Müllers Konzept hinzuweisen, die um so besser dessen Konstanten hervortreten lassen: einen offenen, prozessualen Textbegriff und die Integrierung der produktiven Rezeptionsleistung in diesen.
Diese Differenzierung begründet auch die seltsam anmutende (Selbst-)Abwertung eigener Deu- tungen seiner Texte (B). Der Text - als Ergebnis ursprünglicher Wirklichkeitsverarbeitung - be- wahrt seine Qualitäten unabhängig von den ihm später „eingedeuteten“ Intentionen. Diese müs- sen auf der nächsten Bearbeitungsstufe, der inszenatorischen Realisierung, integriert und erst realisiert werden.
Auf der Ebene der Aktualisierung des Textes im Rahmen der Aufführung ist ein produktiver Umgang mit dem Material (Text) jedoch geradezu notwendig für Müller. Sein Beitrag zu dieser Aktualisierung sind die Deutungsangebote - die einen Rahmen für dargestellte Konflikte präsentieren -, die er in seinen Interviews immer wieder vorschlägt.60 Geboren aus der Notwendigkeit, zu seinen Stücken Stellung zu beziehen,61 immer in der Hoffnung, ein entsprechender Kommentar würde eine Aufführung begünstigen,62 entwickelte Heiner Müller daraus „eine eigene Textgattung“63. Wie Alexander Ernst in seinem Text betont, ist diese bisher zu Unrecht „als Peripherie der zugehörigen Werke“64 eingestuft worden.
Die Sekundärliteratur schien sich lange relativ einig darüber, dass die zunehmende Häufung der Interviews, die Müller in den 80ern und 90ern gab, nur aus der Stagnation seines Schaffens her- rührte.65 Die scheinbare Austauschbarkeit der Themen und eben auch Positionen versah ihn, so Frauke Meyer-Gosau 1997, mit der „‚Kälte’-Maske des postmodernen Intellektuellen“66 - ein „Medienkünstler“, der durch seinen „provokative[n] Gestus zum „empty screen“ wurde, der alle Diskurse spielend leicht und offenbar schadlos reflektierte67 -, unter der allerdings nach dem Ende der DDR Stück für Stück „die verhärteten Züge des Ideologen“68 zum Vorschein kamen. Die in den Interviews vertretenen (politischen) Positionen sollen hier allerdings keine zentrale Rolle spielen, vielmehr der Denkgestus, der diesen Gesprächen zu Grunde liegt. Sascha Löschner spricht in seiner erst 2002 erschienen Untersuchung zu Müllers Interviews davon, dass sie für Müller „Skizzenblöcke“69 gewesen seien. Müller hat mehrere Male auf den Vorteil der Gespräche hingewiesen, „daß man in Gesprächen etwas leichtfertiger formulieren kann, als wenn man schreibt. Man ist ja nicht so sehr in die Pflicht genommen. Man kann am nächsten Tag das Gegenteil sagen.“ (GI1, S. 155, 1985) Diese Kleistsche Art der „Verfertigung der Gedanken beim Reden“70 besaß einen schillernden Charakter, in dem auch Kritiker die Ursache für die „Narrenfreiheit“ sehen, die Müller dabei genoss. Doch die theatralische Form der Interviews - Müllers selbst bezeichnete sie als „Performances“ (GI1, S. 155, 1985) brachte es mit sich, dass der Verlauf und Ausgang der Gespräche ebenso stark von Müllers Gegenüber (seinen Fragen, Verhalten, Reaktionen) wie von der „Tagesform“ des Dramatikers selbst abhing.71 Auf diese Weise entwickelte Müller seine „theatralischen Theoreme“ immer in Kontakt zu den an ihn he- rangetragenen Ansprüchen, Kritiken, Wirklichkeitsauffassungen oder Meinungen - also stets in der Arbeit am Material.
Das vorrangige Material blieben jedoch - nicht zuletzt auch in den Fragen der Interviewer - sei- ne Stücke. Wie Profitlich für „Philoktet“ zu zeigen versucht, zielten die frühen Aussagen über das Stück darauf ab, ein produktives Umfeld für eine mögliche Inszenierung zu schaffen und „den Text für die Erfordernisse gegebener Situationen nutzbar zu machen“72. Diese, als temporäre Arbeitsvorlagen gedachten Deutungen wurden freilich ständig „zur Unter- malung oder Bekräftigung von Interpretationen“73 zitiert. So brachte diese „Dingfestmachung“ nicht nur eine wiedererstarkende Autorposition mit sich, die Müller gerade aus dem Rezeptions- prozess auszuklammern versuchte, sondern sorgte überdies dafür, dass die Texte auf die getrof- fenen Deutungen hin verpflichtet wurden.74 Aus diesem Grund zeigte Müller sich „froh über jede falsche Interpretation. Weil die eine andere falsche Interpretation nach sich zieht.“ (GI1, S. 127, 1982) Auf diese Weise kommt der Text durch die Ambiguität der angestrebten Offenheit und damit Adaptierbarkeit wieder näher. Nichtsdestotrotz wertete Müller (seine) Deutungen gegen- über den Texten selbst radikal als „größten Blödsinn“ (GI3, S. 159, 1992) ab: „Ich habe mit mei- nen Kommentaren nie das Niveau meiner Stücke erreicht.“ (GI3, S. 157, 1992)75 Diese berechnende Bescheidenheit kann die faktische Bedeutung der Interviews nicht verschlei- ern. Gezielt (wie auch spontan) setzte Müller einander widersprechende Aussagen ein, um die Festschreibung der Textbedeutungen zu verhindern, ihren „fragende[n] […]Gestus“76 zu erhal- ten. Dabei entwickelte er in seiner Gesprächsführung selbst die Mehrdeutigkeit und Wider- sprüchlichkeit, die für seine Texte längst zum Markenzeichen geworden waren. Der prozessuale Zug in Müllers Schaffen erstreckt sich noch auf drei weitere zentrale Elemente, die hier jedoch nur kurz angerissen werden können, um dann im weiteren Verlauf auf sie zu- rückgreifen zu können.
Prozess 2 - Das fremde Material oder: der Dialog mit den Toten
Müllers Textkonzept ist in seiner radikal gedachten Offenheit hochgradig intertextuell: „Man schreibt nicht voraussetzungslos, sondern im Dialog mit Geschriebenem.“ (GI2, S. 67, 1986) Schreiben, so verstanden als „endloses Weiterschreiben des schon Existierenden“77, vollzieht in seiner konsequentesten Form den direkten Anschluss an seine literarischen Vorgänger - und ent- steht in Auseinandersetzung mit ihnen. Nicht allein weil das überwältigende Gros vorangegan- gener Literaten bereits tot ist, ist Kultur für Müller „immer auf Geschichte, auf die Toten bezo- gen“78. Der Stoff (engagierten) kulturellen Schaffens speist sich stets aus dem Reservoir unbe- wältigter Konflikte früherer Epochen, die geisterhaft durch die bestehende Gesellschaft spuken.79 Müllers Arbeitsweise war demzufolge gekennzeichnet durch eine radikale Aneignung stofflicher Vorlagen - literarischen Werken, Anekdoten, Gesprächen, Protokollen von DDR-Betrieben, etc.80 Doch nicht nur stofflich suchte Müller die Auseinandersetzung mit vorhandenem Material, sondern auch formal. Als Theaterautor war dies für ihn ebenso zwingend wie traditionell: Thea- ter ist laut Müller als „Spätprodukt“ (GI1, S. 148, 1985) auf „eine gewisse Anzahl von dramati- schen Grundsituationen“81 angewiesen. Besonders prekär ist dieser Umstand für die Tragödie.
„Tragische Konflikte kann man“, laut Müller, der sich damit auf Carl Schmitt beruft, „nicht erfinden, die kann man nur übernehmen und variieren.“ (GI1, S. 138, 1983) Die Bezugspunkte von Müllers Theaterästhetik sind weit gestreut - von den antiken Tragikern über Shakespeare, Büchner, Brecht, Artaud bis zu Beckett und Wilson, um nur die prominentesten zu nennen.
Prozess 3 - Selbstbearbeitung
Das Kreisen um die eigenen Stücke in den Gesprächen deutet es bereits an: Heiner Müller war sich selbst sein erstes Material. Spätestens seit den 80er Jahren wurde die Textproduktion Heiner Müllers in kleine, handliche Häppchen - Phasen - eingeteilt: Produktionsstücke, Antike-Stücke, Deutschland-Stück, etc. Diese Periodisierung hat Heiner Müller mit dem Hinweis auf seine dia- chrone Arbeitsweise als „komplette[n] Unfug“ (GI2, S. 96, 1987, vgl. auch: GI2, S. 22) zurück- gewiesen. Im Gegenzug schlug er vor, seine „Textgeschichte als eine Spirale“ anzusehen, in der unterschiedliche Stücke mit verschiedenen Themen auf einen „Nullpunkt“ zuarbeiten. (GI1, S. 184, 1986)82 Außerdem hat er selbst immer wieder darauf verwiesen, dass verschiedene seiner Stücke Collagen aus Versatzstücken eigener Arbeiten aus verschiedensten Zeiträumen darstel- len.83 Die Untersuchung von Marianne Streisand hat zugleich (für den Zeitraum der Entstehung von „Philoktet“!) nachgewiesen, dass Müller zur selben Zeit an derart verschiedenen Projekten arbeitete und synchron entstandene Texte Müllers so differenziert strukturiert sind, dass ihre „Strategien und Schreibpraxen […] miteinander zu konkurrieren […] scheinen“84. Dieses „no- madisierende Denken“, welches sich das „Recht auf Sinnwidrigkeit […] nimmt“, widerspricht jeder vorschnellen Einordnung in eine Periode und entzieht sich so „jeder ideologischen, politi- schen oder ästhetischen Rubrizierung“.85 In den Gesprächen führt Müller diesen Prozess des Selbstbezugs nun wie selbstverständlich fort - allerdings mit dem Unterschied, dass die Dramen für ihn nicht in ihrer Textform zur Bearbeitung herangezogen werden, sondern in ihrer Brauch- barkeit für das Theater. Soll heißen: Jeder (deutende) Bezug auf die Texte gilt nur im Hinblick auf ihre Realisierung. Damit besteht Müller auf einem Modus des Textbezugs, den er beispiels- weise für Brecht verhängnisvoll unterbrochen sieht: „Das Verhängnis ist, daß man nicht mehr darüber nachdenkt, seine Methode auch auf seine Arbeitsresultate anzuwenden.“ (GI2, S. 26, 1983)86
Prozess 4 - Der Widerspruch ungebrochen auf die Bühne geworfen
Es ist nur folgerichtig, wenn Müller darauf besteht, die Konflikte, die er mit dem Material - im Dialog mit den Toten - aufgenommen und denen er vor dem Hintergrund eigener Wirklichkeitserfahrung eine aktualisierte Form gegeben hat, in ihrer Ungelöstheit an das Publikum zur Bearbeitung zu übergeben. Ungelöst bedeutet in diesem Fall: uninterpretiert: „Die Interpretation ist die Aufgabe des Zuschauers, die darf nicht auf der Bühne stattfinden. Dem Zuschauer darf diese Arbeit nicht abgenommen werden.“ (GI1, S. 153, 1985)87
Die Fragen, die hier noch offen bleiben müssen, sind jene: Welche Lösung imaginiert Heiner Müller für die Konflikte? Wie verschwinden die Widersprüche, einmal auf der Bühne (in den Köpfen) präsent? Die Beschwörung der Geister im „Dialog mit den Toten“ - sind sie gerufen, um sie erneut zu begraben oder auf ewig in unserer Mitte zu behalten? Ist die Beschwörung eine Willkommensgruß oder der Auftakt eines Exorzismus?
II. Ehrlos ehrlich - Ehrabschneider?
88 „Die Aufgabe des Dichters“, antwortete er. „Das Unnennbare zu nennen, Betrug aufzudecken, Stellung zu beziehen, Auseinandersetzungen in Gang zu bringen, die Welt zu gestalten und sie am Einschlafen zu hindern.“ Salman Rushdie, Die satanischen Verse89
Einer von Heiner Müller selbst vorgetragenen Anekdote zufolge entspringt sein Schaffen der Er- fahrung eines Verrats. Als Vierjähriger hatte er 1933 in der „erste[n] Szene [s]eines Theaters“ seine Zeugenschaft verleugnet, während im Nebenzimmer die SA seinen Vater verhaftete: „Das ist meine Schuld. Ich habe mich schlafend gestellt.“ (GI1, S. 90, 1982) Als dieser 1951 in den Westen ging, weil er „Schwierigkeiten mit dem Stalinismus hier“ hatte, blieb Müller. Die Grün- de, die er dafür angibt, sind geradezu konträr. Auf der einen Seite: „Vielleicht identifizierte ich mich mehr mit dem ostberliner oder dem russischen System als er.“ Und auf der anderen: „Im Grunde wollte ich allein sein. Ich denke, es war eine gute Art, seine Eltern loszuwerden.“ (GI1, S. 91, 1982) Fakt ist: Er blieb bis zu ihrem Ende und er schrieb. Das folgende Kapitel stellt kom- pakt das schwierige Verhältnis Heiner Müllers zur DDR und der Funktion(sweise) des Theaters in ihr dar. Drei Punkte spielen dabei die zentralen Rollen: 1. Die DDR als widersprüchliches Ma- terial als Grundvoraussetzung für (Müllers) dramatisches Schaffen, 2. Müllers kritische Solidari- tät mit der DDR und 3. Anspruch und Wirklichkeit des DDR-Theaters und Müllers Position dar- in.90
1. DDR als Material
Weiter oben wurde bereits gezeigt, dass Müllers Antrieb, für das Theater zu schreiben, der Kon- flikt war. Aus der Notwendigkeit für den Schriftsteller Heiner Müller, im Schreiben eigene Er- fahrungen zu verarbeiten, ergibt sich die Notwendigkeit, sich im Umfeld von bestehenden Kon- flikten aufzuhalten. In dieser Beziehung befand er nachträglich die DDR als eine „glückliche Ära fürs Drama. Stalin gab mehr her fürs Drama als Kohl.“ (GI3, S. 81, 1990)91 Schon seit den 80er Jahren behauptete Müller als Grundimpuls des Schreibens eine gewisse „Lust an Zerstörung und an Sachen, die kaputt gehen. […] Der eigentliche Spaß am Schreiben ist doch die Lust an der Katastrophe.“ (GI1, S. 55, 1980)92 Liegt der Grund für den „Aufenthalt in der DDR […] als Auf- enthalt in einem Material“93 also tatsächlich in dem „‚interesselosen Wohlgefallen’ des Schrift- stellers an Realitätserfahrung, die für das Werk verwertbar ist“94 ? Müller als der unbeteiligte Zuschauer?
2. Die „kritische Solidarität“ mit der DDR
Wohl kaum. Welcher Künstler bliebe in einem Land, in dem er im Schnitt 15 Jahre auf die Auf- führung seiner Stücke warten muss und über 20 Jahre „auf Pump“ lebt,95 ohne tieferen Grund: das „Versprechen auf die Zukunft, einen versprochenen Staat“96 ? Bei den wenigsten aktuelleren Interpreten von Müllers Werken wird dessen persönliches Engagement für den aufzubauenden kommunistischen Staat ernsthaft in Zweifel gezogen. Diskutiert werden eher die Fragen, wann Müller sich wie und auf welche Weise für die Verwirklichung dieses Traumes einsetzte - und wie nah zu/fern von diesem er die DDR einschätzte. Von diesen Faktoren hing das Verhältnis von Distanzierung und formulierter Verbundenheit ab, welches in dem fragilen Terminus der „kritischen Solidarität“97 Müllers gegenüber dem „per Kaiserschnitt“98 geborenen Staat seinen prominentesten Ausdruck gefunden hat. Der Schwerpunkt der 50er Jahre lag auf der Solidarität - die Produktionsstücke waren eine Konzession an die Forderung der Kulturpolitik nach aktuellen Stoffen. Wozu er sich nicht drängen ließ, war die Nivellierung der Widersprüche zugunsten eines verordneten Fortschrittsoptimismus: „Das versuche ich in meiner Arbeit zu tun: das Bewußtsein für Konflikte zu stärken, für Konfrontationen und Widersprüche. Einen anderen Weg gibt es nicht. Antworten und Lösungen interessieren mich nicht. Ich kann keine anbieten.“ (GI1, S. 86, 1982) Auch wenn diese Äußerung aus den 80ern stammt, so kann sie dennoch als programma- tisch für den „ganzen Müller“ gelten. Schon in seinen ersten Stücken hat Müller „auf die Kosten und Härten verwiesen, die der Wiederaufbau des zerstörten Landes und die gleichzeitige Umges- taltung aller Bereiche des gesellschaftlichen Lebens mit sich brachte“99. Seine schonungslose Aufarbeitung faschistischer Altlasten brachte ihm den Vorwurf eines „unzureichend gefestigten marxistisch-leninistischen Weltbild[s]“100 ein. Müller Ausschluss aus dem Schriftstellerverband 1961, Spielverbote für seine Stücke, so dass sie in der DDR gar nicht oder nur mit Jahren Ver- spätung aufgeführt wurden, konnten ihn nicht zum Abweichen von seiner Linie bewegen, „seine Kritik an den politischen und gesellschaftlichen Zuständen in der DDR zur Diskussion zu stel- len“101. Dabei ließ Müller nie einen Zweifel daran, dass ihm daran gelegen war, produktiv an der Gestaltung des Kommunismus mitzuwirken - betonte jedoch ebenso, dass dafür die schonungs- lose Offenlegung bestehender Widersprüche und deren kollektive Bearbeitung Grundvorausset- zung waren: „Ich rede immer nur von dem Staat, an dem ich primär interessiert bin: die DDR. Und da befinden wir uns in einer Zeit der Stagnation, wo die Geschichte auf der Stelle tritt, die Geschichte einen mit ‚Sie’ anredet.“ (GI1, S. 54, 1978)
Seine „kompromisslose dialektische Darstellungsweise“102 - die beharrliche Problematisierung gesellschaftlicher Mängel und der ständige Vergleich fehlerhafter Realisierungsstufen des Ange- strebten (und tlw. Behaupteten) mit den propagierten Zielen - bescherte ihm den Vorwurf „der Verabsolutierung der Widersprüche“ sowie „der Missachtung der Dialektik der Entwicklung“103 ein. Während es hieß, dass er „die Wahrheit der gesellschaftlichen Entwicklung […] nicht er- fasst“ habe, bestand Müller darauf, dass es keine gebe, solange nicht die „Qualitäten [die in den Figuren gestalteten Widersprüche der Gesellschaft, M.Z.] produktiv werden“104. Dabei sollte das Theater die Möglichkeiten zur gemeinsamen Aufarbeitung zur Verfügung stellen - als „Labora- torium sozialer Phantasie“105, in dem eine „andere Wirklichkeit entworfen wird als die, aus der die Zuschauer kommen“ (GI1, S. 109, 1982). Während sich die „politische Elite“ der DDR in den bestehenden Zuständen einzurichten begann, deutete Müller das Erreichte stur als „Ponton zwischen Eiszeit und Kommune“106 und forderte den fortgesetzten Kurs auf die Utopie. Was er stattdessen sah, war Stagnation allenthalben. Einer der frühesten Texte Müllers zwängt diese Enttäuschung in die Metapher des glücklosen Engels: „Dann schließt sich über ihm der Augen- blick: auf dem schnell verschütteten Stehplatz kommt der glücklose Engel zur Ruhe, wartend auf Geschichte […]“107.
Seine Stücke sollten dem Motor zu neuer Bewegung verhelfen, doch anstatt ihre Problemstellun- gen auf der Bühne zu diskutieren, wurde der Konflikt auf ihrem Rücken ausgetragen. Nicht zu- letzt diese Unterdrückung einer offenen Diskussion über die Schwierigkeiten des Weges ließ Müllers „Waage kritischer Solidarität“ sich - spätestens seit den 70er Jahren offen erkennbar - zur Seite der Kritik neigen. Dabei war Müller nicht in den Debatten über seine Person die Utopie abhanden gekommen, er verurteilte lediglich „die miserable Verwirklichung dieser Utopie“ (GI1, S. 83, 1982) in der DDR. Aus den Auseinandersetzungen um Müllers Stücke im Osten („Die Umsiedlerin“ 1961, „Der Bau“ 1965) und dessen unüberhörbarer Kritik „zogen Müllers westliche Interpreten den falschen Schluß, Müller sei ein Kritiker des totalitären Systems der DDR“108, wie Sabine Pamperrien in ihrem jüngsten Müller-Verriss bilanziert. Während Müllers Kritik in seinen tagespolitischen Äußerungen mitunter deutliche Formen annahm, gestaltete er von den 70ern an in seinen Dramen einen „konstruktiven Defätismus“109, der als „Untergangs- dramatik“ für Furore sorgte und Müller den Ruf eines „Dichters der Apokalypse“ verschaffte. Also doch der Abfall vom kommunitären Gott?
Ausgerechnet seine Kritiker entdeckten in Heiner Müllers Stücken der 70er und 80er Jahre den „nicht angekränkelten Helden der Arbeit im Auftrag der Utopie“110. Mit den Chancen auf die Realisierung der kommunistischen Vision im Arbeiter- und Bauernstaat schrumpfte auch die U- topie auf ein Minimalziel zusammen - „von einem Ziel zu einem Weg, nach vorne offen“111. Was ihm - und anderen DDR-Intellektuellen - auf diesem Wege jedoch v.a. vorgeworfen wurde, war die Unterstützung des alternativen Staaten-Entwurfs auch in den Zeiten offensichtlicher machtpolitischer Willkür. Domdey etwa legt dar, wie die Intellektuellen der DDR ihren politi- schen Machthabern gerade in den Krisen, die in totalitärer Manier gelöst wurden, ihr Vertrauen aussprachen.112 Müller selbst begrüßte u.a. die mit dem Mauerbau 1961 neu entstandene Situati- on. Ebenso reaktivierte er nach dem Machtantritt Gorbatschows 1985 die engagierte Lehrstück- form und - obwohl er der Perestroika nur wenig später seine Unterstützung wieder entzog - ver- lieh 1989 unermüdlich seiner Hoffnung Ausdruck, die DDR möge als „Alternative zur BRD“ (GI3, S. 44, 1989)113 erhalten bleiben. Die Intelligenz - geblendet und gefügig gemacht durch Privilegien114 -naiv in die Arme der Macht geschmiegt, die es vermochte, sie als Maske der Weisheit zu missbrauchen, um ihre Willkür zu verbergen?
Die Konstellation ist schwer durchschaubar. Die Bedingung dieser Autorisierung von Macht zur Machtpolitik war und blieb jedoch an den Glauben zur Reformierbarkeit des Systems gebunden - und die Überzeugung der Notwendigkeit dazu. Das Einverständnis war keines, das den beste- henden Zuständen eine Daseinsberechtigung aussprach, sondern den fortgesetzten Auftrag zu de- ren Änderung formulierte. Nur so offenbart sich Müllers unermüdliches Fragen nach den (not- wendigen) Kosten der Utopie als eine Kernfrage seines Werkes: „Welche Revolution ist welchen Preis wert?“ (GI1, S. 73, 1982)115 Es ist durchaus möglich, Müllers Theater „als die Anstrengung [zu] verstehen, am Auftrag festzuhalten“116, wie Domdey es sieht, doch muss der Zusatz gelten: nicht um jeden Preis und nicht ohne die Frage nach den Opfern - denen, die die Verwirklichung noch kosten wird und jenen, die sie bereits gekostet hat. In ihrer Verbundenheit mit dem kom- munistischen Ideal war die DDR für Heiner Müller „keineswegs nur Material […], Hoffnung ohne Alternative“117 - aber eben nur Hoffnung, nicht Realität. Als Material blieb sie unvollständig und verbesserungswürdig. Was ein Glück für den Dramatiker Müller bedeutete, war eine Pein für den Menschen Heiner.
Sein Theater war von Beginn an ein deutsches. Auch wenn die Produktionsstücke sich explizit auf eine ostdeutsche (politische) Realität gründen und an sie wenden, sieht Müller in beiden Tei- len Deutschlands dieselbe Geschichte als Urgrund der Gesellschaft am Werk. Von daher erklärt sich die Zwitterstellung Müllers zu den beiden deutschen Staaten - „mit je einem Bein auf den beiden Seiten der Mauer“. (GI1, S. 85, 1982) Die unterschiedlichen politischen Realitäten und die differierenden Möglichkeiten, die Müller in DDR und BRD für ein Theater sah, begründeten, warum „Müllers Texte […] im Westen dekonstruktiv, im Sozialismus konstruktiv wirken“118 sollten. Nicht zuletzt diesem unterschiedlichen Wirkansatz ist die Debatte darüber geschuldet, ob Müller nun Dissident oder Opportunist war.119
Dennoch vermuteten viele, dass mit der Wende Heiner Müller sein Material abhanden gekom- men war. Er selbst nährte diese Spekulationen nicht nur durch entsprechende Äußerungen in sei- nen Interviews und Gedichten,120 sondern schrieb so gut wie nichts (Dramatisches) mehr. Was mit der DDR verschwand, war nicht allein Müllers Material, die Konflikte auf der großen Bühne, sondern vielmehr die Hoffnung auf einen positiven Ausgang, sei er auch weit jenseits persönli- cher Lebenserwartung, und die Bühne, für welche es sich verarbeiten ließe: Jene, die Wirkung verspricht statt „nur“ Erfolg.121
Es erscheint allzu einfach, wie Helmut Fuhrmann anzunehmen, dass Müllers „kritische Solidari- tät“ zur DDR nur einem „verhängnisvollen ideologischen Verblendungszusammenhang“ ge- schuldet war, der sich „durch die Vergötzung des Kommunismus und die Verteufelung des Kapi- talismus“122 auszeichnete. Nicht nur die Texte selbst (sowie neuere, differenzierende Lesarten von ihnen), sondern ebenso die diskursivierende und provozierende „Interview-Prosa“ zeugt von Müllers Grundanspruch: Vorhandene Widersprüche, Brüche und Konflikte - in ihren Wurzeln und aktuellen Ausformungen - darzustellen und in einem Theater, das sich selbst als „kollekti- ver/s Entwurf/Experiment“ versteht, produktiv zu machen. Erst, als diese Möglichkeiten schwin- den - durch eine zunehmende Entfernung von politischem Anspruch und Realität sowie eine Theaterpraxis, die Müllers Anspruch nicht umsetzten konnte oder wollte, wurden seine Stücke zu Zeugnissen des „Scheitern[s] der Hoffnung auf eine gesellschaftliche Alternative“123. Doch als offene Texte, die den Anschluss an geschichtliche Erfahrung (in Texten) suchen, bilden sie selbst Formationen, die die Geschichte ihrer Entstehung (die Utopie als Hintergrund) speichern - „gleichzeitig bewahren sie die Erinnerung an diese Hoffnung auf“124 - und anschlussfähig hal- ten.
3. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
1945 war als Jahr Null nach dem Krieg zugleich die Stunde Eins für den Arbeiter- und Bauern- staat auf deutschem Boden. Doch der deutsche Traum der gelungenen Revolution und dem Land der Gleichheit entstand nicht, so lange er auch schon von den Nachfolgern Marx’ geträumt wur- de, auf Deutschlands Straßen, sondern marschierte mit sowjetischen Stiefeln in Berlin ein.125 Diese schwierigen Ausgangsbedingungen für die junge DDR - „Spätgeburt, in letzter Minute und mit fremdem Bajonett/ Der Mutter aus dem kranken Leib geschnitten“ - waren Müller nicht nur bewusst, er verzichtete auch keineswegs darauf, sie ungeschminkt darzustellen: „Der Arbei- ter hat kein Vertrauen zur Partei. Der Faschismus steckt ihm in den Knochen.“126 Derart proble- matisierende Darstellungen bestehender Widersprüche entsprachen jedoch nicht der offiziellen Kulturpolitik des neuen Staates. Heiner Müllers Stück „Die Umsiedlerin“, aus dem dieses Zitat stammt, wurde nach einer ersten Probenaufführung durch eine Studentenbühne 1961 abgesetzt - und erst 1976 (als „Die Bauern“) wieder aufgeführt -, der Autor aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen.
Für den Aufbau der DDR wurden von staatlicher Seite alle zur Verfügung stehenden Kräfte in Dienst genommen, ihren Teil dazu beizutragen. Auch die Kunst galt dabei als wichtiger „Plan- faktor“127, eine ihrer wichtigsten Funktionen: „die Entfaltung des Arbeitsenthusiasmus“128. Bei dieser Aufgabe blieb es nicht. De facto bestand eine weitere wichtige, von offizieller Seite der Kunst (dem Theater) zugedachte Aufgabe darin, „die Idee des Sozialismus zu popularisieren und ihre Verwirklichung auf dem Boden der DDR gutzuheißen“129. Da die Kunst in ihrer Grundlage auf die marxistische Lehre verpflichtet wurde, geriet der Künstler unvermittelt in die ebenso ver- antwortungsvolle wie privilegierte Position, eine „Vorbild- und Erziehungsfunktion“130
[...]
2 Rushdie, Salman (1988), S. 98. Die Literaturangabe erfolgt im weiteren Verlauf unter freiem Bezug auf die Zitierweise „Harvard“ - in den Fußnoten erscheint jeweils als Sigle der Name und das Erscheinungsjahr der Ausgabe des Textes. Genauere Angaben zu den Texten finden sich in der Bibliografie.
3 Allein innerhalb der letzten zehn Jahre verzeichnet die Bibliografie der deutschen Sprach- und Literaturwissen- schaft (Eppelsheimer-Köttelwesch) zu „Heiner Müller“ (Suchwort) annähernd 500 Beiträge. Von 1985 bis 1995 wa- ren es noch „nur“ rund 400 Texte. Vgl.: http://www.bdsl-online.de.
4 Vgl. Hauschild, Jan-Christoph (2001), S. 249ff.
5 Der hermeneutische Wert der Interviews Heiner Müllers ist dem Autor durchaus bewusst. Eine Vielzahl von Bei- trägen beschäftigt sich mit der „Medienmaschine“ (so der Titel des Textes von Töteberg, Michael (1997)) Heiner Müller, die vor allem in den späten 80er und dann 90er Jahren auf Hochtouren lief. Müller, der es stets abgelehnt hat, sich theoretisch schriftlich zu äußern, kreierte eine neue Form des kreativen Missbrauchs der journalistischen Form, indem er die Interviews zur Bühne seiner praktizierten theatralen Theorie machte. Ihr heuristischer Wert für die Arbeit soll - im Ansatz - im ersten Kapitel zu Heiner Müllers Textproduktion bestimmt werden.
6 Müller, Heiner (1994), S. 161, 1992 (Hervorhebungen im Original). Im Folgenden werden die Selbstaussagen Müllers, die aus den Bänden 1-3 der Gesprächssammlung „Gesammelte Irrtümer“ stammen, mit den Siglen GI1, GI2 und GI3 abgekürzt sowie der Seitenzahl angegeben. Außerdem wird das Entstehungsjahr angefügt. Dazu siehe FN 28.
7 Bei „Philoktet“ spielt der Begriff des Modells eine Doppelrolle, da Müller ihn auch auf stofflicher Ebene verwendet. Der erste schriftliche Kommentar zum Stück aus dem Jahre 1968 anlässlich der Uraufführung in München vermerkt: „Die Handlung ist Modell, nicht Historie.“ (Müller, Heiner (1989f), S. 60). In der Tat ist die Vielzahl der Deutungen in der Sekundärliteratur - und die Betonung, dass sie die je einzig möglichen seien - diesem Modellbegriff geschuldet. Dabei wurde dieser inhaltliche „Modell“-Komplex - verständlicherweise - stets als geschichtsphilosophisches Paradigma interpretiert. Einzig Manfred Kraus geht in seiner Deutung auch auf den formalen Modellcharakter „Philoktets“ ein (Vgl.: Kraus, Manfred (1985)).
8 Auf die Bedeutung selbst text- und stoffferner Erfahrungen für den Textprozess hat Müller oft hingewiesen. Darauf soll bei der Untersuchung des Stücks eigens eingegangen werden.
9 Vgl. Lehmann, Hans-Thies (2004a), S. 27.
10 Dasselbe Verhältnis wiederholt sich auf der Ebene einer jeden Vorstellung eines Theaterstücks, bei dem der verschiedene Erfahrungshintergrund von Darstellern und Zuschauern einen je neuen „Text“ kreiert.
11 Daher ist die Eigenschaft der Modellhaftigkeit für einen Text eine, die ihn idealerweise als offen und nicht herme- tisch charakterisiert, wie es noch für die philosophischen Systeme der idealistischen Philosophie etwa erstrebenswert galt.
12 Wobei es sich auch hier wieder um eine Verdopplung des Modells handelt, was das Stück vielleicht besonders
produktive Ansätze zur Verfügung stellen lässt: die angesprochene Prozessualität eines jeden Textes für Müller und zwei Modelle: den Mythos als Modell formulierter Erfahrung und den literarischen Mythos als Text(produktionsund rezeptions)modell.
13 Daran schließt sich eine weitere Frage an: Warum ist es möglich, dass ein Text so viele Male interpretiert, gedeutet und kontextualisiert werden kann, wie es „Philoktet“ allein schon durch Müller geschehen ist? Woher kommt die Geräumigkeit, die es dem Stück erlaubt, all die Deutungsvarianten in sich aufzunehmen, die Wandlungsfähigkeit des Konflikts, für derart viele analoge Problemstellungen Modell zu stehen?
14 Profitlich, Ulrich (1980), S. 149.
15 Ebd.
16 Diese These, die an dieser Stelle vorerst nur behauptet werden kann, setzt sich aus mehreren Elementen zusam- men: Die formale Verfasstheit eines dramatischen Textes legt zumeist einen gewissen Rahmen für eine inszenatori- sche Umsetzung bereit, die man gemeinhin als werktreue Realisierung bezeichnen würde. Im besten Falle fügt ein Autor durch die Regieanweisungen seine Theaterästhetik skelettartig an den Text an. Bei Heiner Müller nimmt der Gebrauch dieses Mittels im Laufe der Jahre ab, nahezu parallel zur viel beschworenen zunehmenden Fragmentari- sierung seiner Texte. Dies deutet auf die bereits angeführte prinzipielle Anschlussfähigkeit der Texte - jede neue In- szenierung bedarf quasi neuer Regieanweisungen, um die Realisierung des Textes als Aktualisierung zu bewerkstel- ligen. In diesem Sinne kann man die Interviewdeutungen seiner Stücke durch Heiner Müller als Regieanweisungen für ihre Umsetzung interpretieren. Dies soll u.a. im Analyseabschnitt zu „Philoktet“ der Arbeit geschehen.
17 Hauschild, Jan-Christoph (2001), S. 10.
18 Gerade seine ersten Stücke sind noch viel stärker strukturell an ein Wirkziel (didaktisches Theater) oder einen his- torisch konkreten Grundgestus (Aufbau des Sozialismus) gekoppelt. Was ihren Eigenwert nicht schmälert. Zum ei- nen hat man in ihnen die deutlichste Ausprägung der von Müller immer wieder behaupteten Komik seines Werks entdeckt. Zum anderen enthalten auch sie grundlegende gesellschaftliche Konflikte, so dass zumindest Müller selbst 1988 Lohndrücker als „das zur Zeit aktuellste Stück von mir in der DDR“ (GI2, S. 151, 1988) bezeichnen konnte. Darüber hinaus ist etwa auch den Produktionsstücken schon die sprachliche Brillanz eigen, die Müller spätestens mit „Philoktet“ berühmt machte.
19 Michael Ostheimer etwa verfolgt den Anspruch, Müllers Tragödienkonzeption, die „Philoktet“ zu Grunde liegt, maßgeblich aus der Lektüre des später zum Stück geschriebenen „Briefs“ abzuleiten. Christoph Menke (2005) hin- gegen interpretiert das Stück allein als Lehrstück. Dennoch ist Menkes Ansatz für die vorliegende Arbeit wichtig, v.a. wegen der tragödientheoretischen Überlegungen, die auch die produktiven Aspekte der Tragödie genauestens untersuchen.
20 Dies lässt sich für den Entstehungszeitraum des Stücks noch unzweifelhafter sagen als etwa die 70er oder 80er Jahre. Dennoch spielt sein Verhältnis zur DDR - und damit auch der marxistischen Theorie sowie deren Auslegung - eine nicht unerhebliche Rolle bei der Entstehung und Selbstdeutung „Philoktets“. Daher wird sich das dritte Kapitel damit eingehender beschäftigen.
21 Langhoff, Matthias (2005), S. 187.
22 Müller über Brecht: „Warum - vom Wortlaut bis zur Struktur - immer wieder der Rückgriff? Noch in der Courage wird die Hauspostille zitiert. Brecht macht sich zum Gegenstand der Darstellung, indem er seine Texte, fertige und nicht fertige, immer wieder auf den Prüfstand zerrt.“ (GI2, S. 62, 1986).
23 Während bei Brecht von vielen Stücken etliche Versionen aus sehr weit auseinander liegen Zeiten existieren, die davon zeugen, dass er sie stets auf eine andere Inszenierungsform und -absicht hin überarbeitete, ist das bei Müller nicht der Fall. Einmal veröffentlichte Texte änderte Müller - als Text - nur in [meines Wissens, M.Z.] einem Fall,
24 Einen Ansatz in diesem Sinne stellt das Buch zur „Philoktet“-Werkstatt dar, in dessen Vorwort Wolfgang Storch (2005) schreibt: „Heiner Müller erreichte die Rückkehr der Tragödie als Form der öffentlichen Verständigung über die Macht gegenüber den psychischen Zerstörungen, die sie bewirkt. Die Tragödie öffnet die Wunde.“ (S. 24)
25 Wolf, Christa (1975), S. 40.
26 Rushdie, Salman (1996) S. 161.
27 Die wenigen schriftlichen theoretischen oder entfernt poetologischen Texte Heiner Müllers, die nahezu komplett in dem „Material“-Band versammelt sind, sollen dabei nicht fehlen. Zentrale Kernaussagen der Texte tauchen dabei später in den Interviews wieder auf.
28 Ein Problem bleibt allerdings bestehen, so sehr man es zu vermeiden suchte: Alle Aussagen wurden in bestimm- ten Interviews, gegenüber unterschiedlichen Interviewern und im Rahmen je verschiedener sowohl historischer als auch konkreter Umstände getroffen. Keine noch so genaue Rekonstruktion all dieser Faktoren würde die Aussagen in ein Licht rücken, das sie vollends vergleichbar werden ließe. Daher wird sich diese Arbeit darauf beschränken, auf wichtigere bekannte Kontexte hinzuweisen, um auffällige Aussagen einzuordnen und unklarere aufzuhellen. Außerdem soll es v.a. darum gehen, auf Tendenzen hinzudeuten, die sich durch gehäufte und konstant wiederholte Aussagen Müllers beschreiben lassen, wohingegen die Sekundärliteratur gemeinhin dazu neigt, seine pointiert kont- rastiven, provozierenden Statements ins Rampenlicht zu rücken. Um diese Entwicklung kenntlich zu machen, wird allen Aussagen das Jahr ihrer Entstehung hinzugefügt, um dann bei einigen Beispielen exemplarisch auf Konstanten oder Verschiebungen hinweisen zu können. Wenn selbst zuweilen Aussagen oder gar nur Gesprächsbestandteile zi- tiert werden, sodann mit schlechtem Gewissen und nur an Stellen, wo durch eine Vielzahl ähnlicher oder identischer Aussagen Beispielhaftigkeit nachgewiesen werden könnte. Wenn dies nicht vollständig geschieht, so aus Platzgrün- den.
29 Die Grundlage der Analyse bilden die drei Bände „Gesammelte Irrtümer“(GI1-3) sowie die Gesprächssammlun- gen „Jenseits der Nation“ (Müller, Heiner (1991)) und „Ich schulde der Welt einen Toten“ (Müller, Heiner (1996b)). Ergänzt werden sie durch die Texte des „Material“-Bandes (Heiner Müller (1989)), das Interview zu „Philoktet“ aus
30 Daher erweist die Untermauerung dieser Text- und Schreibcharakteristika durch Müllers eigene Reflexionen den Dramatiker zusätzlich als selbstreflexiv und -kritisch.
31 Dies findet hier als (relativ) allgemeine Untersuchung statt, um zum einen die Züge dieses Textverständnisses kla- rer herauszustellen und zum anderen den heuristischen Wert der Aussagen, die Müller selbst trifft, einschätzen zu können.
32 Gleiches gilt auch für die Verwendung von Müllers Selbstaussagen in allen anderen Kapiteln. So wird sich bei- spielsweise zeigen, dass Müller zwar von Beginn an eine intuitiv-willkürliche Schreibweise für sich beansprucht, diese aber im Zuge des aufklärungskritischen Diskurses der 70er Jahre stärker in Dienst nimmt - um einen solchen rationalismuskritischen Grundgestus bereits in der Produktion seiner Texte zu behaupten. (Die Aufnahme eines mythischen Stoffes durch „Philoktet“- des vermeintlich vernunftfeindlichen Sujets schlechthin - zu einem derart frühen Zeitpunkt wie 1964 ist daher schon richtungsweisend.) Später dient dieser Zug nicht minder der Medienkri- tik. Indem er auf der authentischen Erfahrung besteht, die dem Schreiben seiner Aussage nach zu Grunde liegt, setzt er es von der „Auslöschung der Erfahrung“ (Kalkfell 1 (1996), S. 137) durch die Medien ab. Dieser Diskurs wird jedoch wiederum kompliziert, da Müller sich schon relativ früh affirmativ zur Idee des Mensch-Maschine-Komplexes äußert, der den Menschen ablösen könnte.
33 Neben der - für einen derart akribischen und daher relativ langsamen Arbeiter wie Müller einleuchtenden - Erklärung, dass es ihm „viel anstrengender [ist] […], Theoretisches auszuformulieren, also zu schreiben“ (GI1, S. 155, 1985), soll v.a. die poetologische Begründung dargestellt werden.
34 Bei beiden Dimensionen stellt er sich selbst auf eine Stufe mit all jenen, denen der Text als Geschaffenes gegenübertritt. Er sieht sich nicht in der privilegierten Position des Autors, dem das Hoheitsrecht der Interpretation über seinen Text zusteht, sondern ist im gleichen Ausmaß Rezipient eines literarischen Werks. Auf die Frage nach der Wirkabsicht seiner Texte antwortete er 1988: „Was ich will damit, ist doch völlig belanglos. Auch wenn ich irgendwelche Ideen hätte, die sind genauso belanglos wie ihre.“ (GI3, S. 160, 1992)
35 Fast identisch äußert er sich vier Jahre später über die Bedeutung der Wahl von Figuren als Platzhalter politischer Intentionen: „Das ist eine willkürliche Entscheidung. Und Willkür ist nie falsch, wenn man begabt ist.“ (GI3, S. 163, 1992)
36 Die Figur des Theaters als Ideologiezerstörer ist indes schon älter, sie findet sich bereits in einem Interview von 1977 (GI2, S. 14, 1977). Scheinbar hat er die Forderung von Bertolt Brecht übernommen, dem er sie in seinem schriftlichen Brecht-Kommentar „Fatzer±Keuner“ zuschreibt: „Im gleichen Jahr 1948 […] formulierte Brecht als die Zielstellung seiner Arbeit in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands: 20 Jahre Ideologiezertrümmerung […]“. (Müller, Heiner (1989), S. 32)
37 Aussagekräftige Zitate sind hier schwer zu finden. Heiner Müller hat jedoch nie einen Zweifel daran gelassen, dass sein Theater in hohem Maße autobiographisch ist: „Nicht an der Oberfläche, aber es steckt immer etwas sehr Persönliches darin.“ (GI2, S. 95, 1982) Die viel zitierte Ur-Szene seines eigenen Theaters, die Verhaftung seines Vaters während er sich schlafend stellte, kann hier als paradigmatisch gelten (u.a. zitiert in: GI1, S. 90f.). Vgl. Haag, Ingrid (1993). Auch in der Sekundärliteratur ist das Argument, wie hier bei Monika Meister (1989) in der Bespre-
38 Dieser Gedanke tauchte identisch bereits 1982 im berühmten Interview mit Sylvère Lotringer auf: „Es gibt eine Definition des Theaters von Gertrude Stein, die mir sehr gefällt: Für das Theater schreiben heißt, daß alles, was beim Prozeß des Schreibens vorgeht, zum Text gehört.“ (GI1, S. 101, 1982) Der Quellenbezug war 1988 freilich längst verloren gegangen. Ein Beleg dafür, dass Müller nicht nur, wie noch zu zeigen sein wird, das Material seines Schaffens borgte, um es zu bearbeiten, sondern auch seine Poetologie sich (bewusst) aus dem Fundus Vorangegan- gener speist.
39 Tatsächlich erteilt Müller der Möglichkeit einer Verbindung von (marxistischer) Politik und Kunst im selben Interview eine Absage: „Es gibt bestimmte Situationen, in denen man - um mit Majakowski zu reden - Propagandaverse für eine bestimmte politische Bewegung herstellen muß. Man stellt die Mittel seines Berufs diesem Kampf zur Verfügung, aber dazu muß man aus der Kunst heraustreten.“ (GI2, S. 101, 1987)
40 Dieses differenzierende Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit ist besonders in den 80er und 90er Jahren in Mül- lers Aussagen vertreten (sieben explizite Nennungen zw. 1981 und 1991). Allerdings kann davon ausgegangen wer- den, dass diese Vorstellung für Müller schon länger Bestand hatte. Zum einen beruht seine engagierte Theatervor- stellung auf der behaupteten, Wirklichkeit verändernden Kraft des Theaters, die ein progressives Verhalten zur Rea- lität im Theater fordert. Zum anderen bleibt selbst in der Position, auf die Müller sich im Laufe der Zeit zurückzieht, und die diesen ambitionierten Theaterbegriff tlw. aufgibt (Verabschiedung des Lehrstücks, u.ä., siehe Fuhrmann, Helmut (1997), S. 46) und sich mit dem Minimalziel Provokation zu bescheiden scheint, noch immer die Beharrung auf dem Text als verarbeitete Wirklichkeitserfahrung (siehe A1) und nicht -spiegelung.
41 So oder ähnlich bereits früher: GI2, S. 23, 1981 und GI1, S. 95, 1982.
42 Wolf, Christa (1975), S. 40. Müllers eigener vergleichbarer Slogan lautet: „Schreibend bin ich sie losgeworden.“ (GI1, S. 95, 1982)
43 Besonders der Verweis auf die eigenen Träume (im Anschluss an das zweite Zitat) und Obsessionen als das Material machen den subjektiv-therapeutischen Wert des Schreibens für Müller offensichtlich.
44 Die Rede von einer „Leiche“ und einem „toten Körper“ ist hier nicht nur Effekt haschende Rhetorik. Wie versprochen wird Müllers Bezug zu Geistern und anderen Wieder- und Grenzgängern durch den Text spuken. Wohl gemerkt: Das Schreiben versetzt das im Text Behandelte in den Status des Totseins - und macht den Text zu dessen Körper. Einen Körper, den ein Geist nicht hat, dessen Erscheinung durch eine „unkörperliche Körperlichkeit“ (Vgl. Kapitel zum Gespenst und Derrida, Jacques (2004), Kap. 5, S. 170-240) gekennzeichnet ist, die ihn also erst zu dem unheimlichen Wesen zwischen den Welten macht.
45 Die Fortsetzung des Zitats ist nicht minder bedeutungsvoll: „Erst später, als die Stücke von der Bühne ferngehal- ten wurden, entstand eine zunehmende Distanz zwischen meinem Schreiben und der Theaterpraxis.“ (GI2, S. 96, 1987) Zum einen behauptet diese Passage eine gewisse Homogenität des Schreibens - die sicher in dieser Radikali- tät bezweifelt werden darf, aber zumindest einige Konstanten vermuten lässt. Zum anderen beschreibt Müller hier selbst eine Entwicklung, in der eine textdominierte Theaterpraxis zu Gunsten eines Auseinandertretens von Text und dessen theatraler Umsetzung weicht, in dem die beiden zueinander in Beziehung treten. Diese Entwicklung ist nicht allein für Müller kennzeichnend, erlaubt es jedoch, ihn und theaterästhetische Statements wie das zitierte im Rah- men des von Hans-Thies Lehmann beschriebenen „Postdramatischen Theater“ zu betrachten.
46 Hier und folgend aus dem Gespräch: Müller, Heiner (2005c), S. 113ff, hier: S. 114.
47 Die avancierte Formel, die Müller hier gleich dreimal verwendet lautet: „Ich rechne damit, daß unser Publikum […].“ (Müller, Heiner (2005c), S. 115) Damit verlangt er von den Zuschauern das Einnehmen einer Position, die ein aufgeklärtes Bewusstsein im Sinne marxistischer Geschichtsphilosophie erfordert, v.a. um die Einordnung der Fabel als „Vorgeschichte“ (Müller, Heiner (2005c), S. 114) zu leisten und Mitleid mit Philoktet auszuschließen.
48 In einem Gespräch mit Ruth Berghaus 1987 bestimmt er die erstrebenswerte Wirkung des Theaters - im Gegensatz zum oberflächlichen Erfolg: „Wirkung ist es insofern, weil es dann wirklich ins Leben eingreift, weil es die Leute länger beschäftigt.“ (GI2, S. 92, 1987)
49 Schon 1975, in einem Brief an den Redakteur von „Theater der Zeit“ Martin Linzer macht Müller seinem Unmut über die bieder-bürgerliche Aufführungspraxis der Theater Luft, die „der Kollision mit dem Publikum ausweichen“ und daher mit seinen Stücken eben auch „gar nichts“ tun, sprich: sie nicht produktiv machen. (Müller, Heiner (1977a), S. 110)
50 Dass diese Provokation sich außerdem vorrangig an das Subjekt wendet, statt wie bisher auf die Rezeption durch ein Kollektiv zu zielen, hängt auch mit den in A2-4 beschriebenen Prozessen zusammen.
51 Dabei zeichnet sich die Theaterentwicklung, in deren Rahmen auch Müller beschrieben werden kann, dadurch aus, dass immer mehr Elemente sich in diesem Rahmen verselbständigen und eine eigene Position beanspruchen - es somit ein Vieleck wird. (Vgl. die von Hans-Thies Lehmann (1999) behandelten Elemente des postdramatischen Theaters.)
52 Adorno, Theodor W./Horkheimer, Max (1982), S. 32. Der Begriff der „instrumentellen Vernunft“, der für das Buch der beiden Hauptvertreter der Frankfurter Schule stilprägend wurde, findet in dem Buch viele „Namen“ - „Abstraktion, Werkzeug der Aufklärung“ (S. 15), „Reduktion des Denkens auf mathematische Apparatur“ (S. 27), „Versachlichung des Geistes“ (S. 28), u.v.a. - und versucht dadurch die einer Tendenz zum funktionalistisch ausgeprägten Vernunftbegriff innewohnende Einseitigkeit offen zu legen.
53 Dieser Zug findet v.a. in der Kritik Richard Herzingers (1992) Widerhall, der Müller - Flucht vor korrumpierter Wirklichkeit unterstellte. Im Kapitel zur Mythenrezeption Heiner Müllers wird darauf zurückzukommen sein.
54 Vgl. Artaud, Antonin (1993).
55 Auf die Vielfalt der theaterästhetischen Anschlüsse Müllers kann hier leider nicht näher eingegangen. Nur soviel: Wie oben behauptet, besteht Müller auf der Verbindung von Zuschauern/Bühne im Theater, unabhängig von der Veränderung der anderen Theaterelemente und ihrer Bedeutung.
56 Josef Szeiler (1996), der Regisseur der „Philoktet“-Inszenierung am Berliner Ensemble 1995 hob dies hervor: „Ich fand an Müllers Arbeitsweise interessant, daß sie etwas Fließendes hat, seine Texte sind quasi aus dem Gehen geschrieben und nicht sitzend, stundenlang vor der Schreibmaschine.“ (S. 128) Müllers Parole lautet: „Mein Text ist ein Telefonbuch, und so muß er vorgetragen werden, dann versteht ihn jeder. Denn dann ist es eine Erfahrung, die man mit einem fremden Material macht. Erfahrungen machen besteht doch darin, daß man etwas nicht sofort auf den Begriff bringen kann.“ (GI1, S. 119, 1982) Dass dieses Zitat aus der unmittelbaren Umgebung dessen stammt, das zur Belegung von A2 herangezogen wurde, ist indes kein Zufall. Letztlich sind A2 und A3 zwei Seiten dersel- ben Münze: Während A2 negativ als Kritik an aufklärerisch-vernünftiger Theatertradition ausgerichtet ist und über die Zerstörung von Bedeutungsstrukturen ein (vereindeutigendes) Verstehen unmöglich zu machen versucht, be- müht sich A3 um die positive Neubestimmung von Wirklichkeitsverarbeitung im Theater über individuelle (authentische?) Erfahrung.
57 Müller, Heiner (1996a), S. 143.
58 Aus seiner Ablehnung der Wiedervereinigung machte er ganz offensichtlich keinen Hehl. Vgl. GI3, S. 44, 1989; S. 55, 1989; S. 79, 1990.
59 Müller kritisierte dieses Vorgehen 1992: „Bedauerlich daran ist vor allem, daß die Texte dieser DDR-Autoren [Es werden keine Namen genannt, man kann aber davon ausgehen, dass Müller sich in der Antwort auch selbst meint, M.Z.] nie richtig gelesen wurden. Früher nicht und heute auch nicht. Aus verschiedenen Gründen: früher wurden sie gelesen als Beweis, daß auch in der DDR ein paar intelligente Menschen begriffen haben, daß dieses System nicht funktioniert - also als dissidentische Texte. Heute werden sie als affirmative Texte denunziert. Beides sind sie nicht, weder das eine noch das andere. Sie sind einfach Beschreibungen von Zuständen. Die Texte sind nie konkret gele- sen worden. Man hat immer nur Meinungen über die Texte gehabt, aber man hat sie nie gelesen.“ (GI3, S. 152, 1992) Genau vor der hier beschriebenen Identifizierung von Text und Interpretation fürchtete sich Müller - zum einen, weil es den Text auf eine bestimmte Aussage und damit Inszenierungsweise festlegen und zum anderen den Produktionsprozess stillstellen würde, indem man eine fertige Deutung anbietet und dadurch den Zuschauern die Möglichkeit nimmt, die eigene Wirklichkeit einzubringen.
60 Die Veränderungen des Anspruchs, mit dem diese Interpretationen präsentiert werden, spiegeln zugleich den Grad der Gebundenheit von Müllers Theaterästhetik wider - der größere Ausschließlichkeitsanspruch früherer Deutungen verweist auf das (noch) intakte Selbstverständnis des DDR-Dramatikers Heiner Müller in Bezug auf den sozialgesellschaftlichen Erziehungsauftrag des Theaters.
61 „Diese Interviews und Erklärungen sind ja zum großen Teil auch Selbstverteidigung oder auch in bestimmten Zwangslagen abgegeben.“ (GI2, S. 84, 1987)
62 Vgl. Profitlich, Ulrich (1980), S. 149.
63 Lehmann, Hans-Thies (2002g), S. 339.
64 Ernst, Alexander (2006).
65 Humble, Malcom (2000), S. 172.
66 Meyer-Gosau, Frauke (1997), S. 20.
67 Ebd., S. 13.
68 Ebd., S. 20.
69 Löschner, Sascha zit. in: Ernst, Alexander (2006). Dahinter verbirgt sich eine ungeheure Vielfalt an Möglichkeiten, „laut zu denken“: „Die Interviews/Gespräche sind Brief- und Tagebuchersatz, Selbstverständigung, Spiel mit den Medien, Performances, Bilanzierungs- und Analyseversuch, Materialsammlung und Anekdotenfundus, zuletzt Preisgabe persönlicher Erfahrungen im Scheitern und in der Verstrickung“. (Ebd.)
70 So der Titel des einschlägigen Textes von Kleist. Vgl. Töteberg, Michael (1997), S. 186.
71 „Ich bin da wahrscheinlich viel zu sehr Schauspieler und deswegen ungeheuer abhängig von dem Interviewpartner, also von dem, der mich fragt, und da gibt’s eben Leute, wo ich völlig mechanisch werde oder keine Lust habe.“ (Müller, Heiner/Kluge, Alexander (1996b), S. 52)
72 Profitlich, Ulrich (1980) S. 150. Dabei geht es weniger um „moralisierende“, als „funktionsbeschreibende Katego- rien“ (ebd.) - die Umdeutung ist keine Abweichung vom politischen Standpunkt, sondern die Anpassung eines Stückmodells an die aktuellen Erfordernisse - um die bestehenden Widersprüche auf die Bühne bringen zu können.
73 Ernst, Alexander (2006).
74 Über seine erste „Philoktet“-Deutung im Sinn & Form-Gespräch 1966 als vorgeschichtliches Modell sagte Müller später: „Sie hatten endlich einmal eine Aussage des Autors über sein Stück - also wurde das Stück auch eisern so interpretiert.“ (GI3, S. 160, 1992) Die eilfertige Identifikation von Text und Kommentar sieht Müller selbst auch als Ursache für die kritischen Untersuchungen von Richard Herzinger [Dieser macht ihm, so dort zitiert, den Vorwurf, zur politischen Rechten übergelaufen zu sein, M.Z.]: „weil er nur eine Oberflächenschicht der Texte aus der Sicht journalistischer Äußerungen interpretiert.“ (GI3, S. 193, 1993) In der Tat stützt sich ein Großteil der kritischen An- sätze zu „Philoktet“ eher auf den Brief Müllers an den Regisseur der bulgarischen Erstinszenierung Dimiter Got- scheff von 1983 als auf das Stück.
75 In einem Gespräch nur ein Jahr früher wird der von Müller veranschlagte Kategorienunterschied noch deutlicher. Auf eine kontroverse Aussage hin angesprochen, antwortet er: „Das war natürlich - ich gestehe es - ein bißchen taktisch. Das war ja kein poetischer Text, sondern ein journalistischer.“ (GI3, S. 135, 1991)
76 Schulte, Christian (2004), S. 191. Vor allem in den Gesprächen mit Alexander Kluge hat Schulte diese Praxis ausgemacht, in denen der „weitgehende Verzicht auf Intentionalität, der dieses Sprechen charakterisiert, […] unmittelbar mit der auktorialen Haltung [korrespondiert], die der Organisationsform des Materials in Müllers Traumtexten und späten Dramen“ (ebd., S. 193) zugrunde liegt.
77 Ernst, Alexander (2006).
78 Müller, Heiner (1991), S. 89. Anderswo: „Mein Umgang mit alten Stoffen und Texten ist auch ein Umgang mit einer Nachwelt. Es ist, wenn Sie so wollen, ein Dialog mit den Toten.“ (GI1, S. 138, 1983)
79 In diesem Sinne zitiert Müller Brecht: „Das Weitermachen schafft die Zerstörung, die Kontinuität schafft die Zer- störung. Die Keller sind noch nicht ausgeräumt, und schon werden Häuser drauf gebaut. Man hat sich nie die Zeit genommen, die Keller auszuräumen, weil immer neue Häuser über denselben Kellern stehen.“ (GI2, S. 32, 1983)
80 Eine relativ komplette Liste findet sich bei: Ernst, Alexander (2006).
81 Müller, Heiner, zitiert in: Ernst,Alexander (2006). Und: „Sagen Sie mir ein Stück von Shakespeare, das er erfunden hat, wo er die Geschichte erfunden hat. Es gibt keins. Es gibt auch keinen Stoff, den Sophokles erfunden hat […].“ (GI1, S. 148, 1985) sowie: „Im Theater ist immer gestohlen worden. Der größte Dieb war auch der größte Dramatiker, nämlich Shakespeare.“ (GI2, S. 135, 1988)
82 Der „Nullpunkt“ scheint dabei die Rolle der wirkungsvollsten Darstellung eines konsistenten Konfliktmodells zu spielen: „Erstmal ist es so, daß man immer am selben Stück schreibt. Das konkrete Thema ist nebensächlich. Ein chronologisches Kriterium stellt Modelle zufrieden, mit denen üblicherweise die Klassifizierung vorgenommen wird. Aber das stimmt so nicht. […] Ich habe mit PHILOKTET sehr viel früher als mit LOHNDRÜCKER begon- nen; ich habe DIE SCHLACHT angefangen, bevor ich überhaupt an DIE UMSIEDLERIN gedacht habe. Und ich habe mir Gedanken über DIE UMSIEDLERIN gemacht, bevor ich DIE SCHLACHT zuende geschrieben hatte. In der Kunst gibt es keine Evolution. Es gibt nur die Entfaltung von Mitteln.“ (GI2, S. 133, 1988)
83 Das radikalste Beispiel hierfür bietet sicherlich „Verkommenes Ufer…“, das als Zitat-Collage von Müllertexten aus drei verschiedenen Zeitabschnitten ausgewiesen wird. (Vgl. GI1, S. 130, 1983). Doch auch für „Philoktet“ lassen sich Ansätze der Verarbeitung früherer Arbeiten nachweisen. (Vgl. Müller, Heiner (2005e), S. 121)
84 Streisand, Marianne (1991), S. 504.
85 Ebd., S. 506f.
86 Und weiter: „Die Bedingungen sind heute anders. Und es sind andere Leute. Also muß man nach der Methode fragen und nicht die Resultate zum Kanon erklären.“
87 1985, im Jahr aus dem dieses Zitat stammt, nahm Müller - in der Hoffnung auf einen Neuanfang mit Gorbat- schow und „Perestroika“ - mit „Wolokolamsker Chaussee“ die erst acht Jahre zuvor verabschiedete Lehrstückform wieder auf. Mit ihr erstarkten zweifelsohne die Forderungen an das Publikum. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass selbst in Zeiten, als Müller die Distanz zwischen sich und dem Publikum als größtmöglich einschätzte, er nicht darauf verzichtete, die Widersprüche ungeschönt auf die Bühne zu bringen. Bereits im ersten Interview der „Irrtümer“-Reihe lässt er verlauten: „Ich sehe keinen Grund, die Feinde kleiner zu machen. Dadurch macht man sich selbst nicht größer.“ (GI1, S. 12, 1974)
88 Das Wort wird hier als synonyme Bedeutung des Begriffs „Denunziant“ verwendet, der sich wiederum im etymologischen Umfeld von Hetzer, Aufwiegler, Unruhestifter, Wühler, Demagoge, Volksverführer, falscher Prophet, Aufhetzer, Scharfmacher, Propagandist oder Verleumder bewegt. (Vgl. Duden Synonyme) Letztlich soll diese provokative, sprachspielerische Formulierung die Frage um die Position des Dichters Heiner Müller im (literarischpolitischen) Gefüge der DDR ausloten. Umformuliert ließe sich fragen: Steht der kompromisslos Ehrliche - anders als es die etymologische Verwandtschaft mit der „Ehre“ vermuten ließe - auf verlorenem Posten, wenn seine „Wahrheit“ nicht den offiziellen Entwürfen entspricht; mehr noch: läuft er Gefahr, den Ruf eines Denunzianten, Volksschädlings, böswilligen Unruhestifters - eben eines Ehrabschneiders - zu erhaschen?
89 Rushdie, Salman (1988), S. 103.
90 Keiner der drei Punkte kann hier auch nur annähernd erschöpfend behandelt werden. Es kann sich also bei den Darstellungen nur um Richtungsweiser handeln. Während Punkt 1 und 2 als Konstanten mit unterschiedlicher Ak- zentuierung behauptet werden, bezieht sich Punkt 3 - gerade im Hinblick auf den offiziellen kulturpolitischen An- spruch an das Theater - hauptsächlich auf die Jahre bis zur Entstehung „Philoktets“ (1945-64), da spätestens ab 1971 die kulturpolitische Entwicklung zu vielfältig wird, um sie hier auch nur entfernt darzustellen. Bei der Unter- suchung der „Philoktet“-Deutungen werden einige relevante Züge jedoch wieder eine Rolle spielen.
91 Nur wenige Wochen später antwortete er auf die Frage, warum er nie die DDR verließ: „Ich hab’ Widerstände gern. Und diese Folie der Diktatur war ja interessant für Theatermacher. Die großen Zeiten des Theaters waren schließlich nie die Zeiten der Demokratie.“ (GI3, S. 85, 1990) Vgl. auch: GI3, S. 130f., 1990 und GI3, S. 190, 1993.
92 Nur zwei Jahre später: „Ein wesentlicher Grund zum Schreiben von Stücken ist Schadenfreude. Sie ist die Quelle allen Humors; die Freude daran, daß etwas schief geht und daß man in der Lage ist, das zu beschreiben. Ich glaube, das ist ein Grundmodell von Theater und auch von Komik.“ (GI1, S. 115, 1982) 1992 gibt er Jean Genet als eine mögliche Quelle dieser Haltung zu erkennen: „Der Kern ist natürlich die Haltung Genets: Die Freude über jeden Mißstand, über die gebrechliche Einrichtung der Welt - denn das ist ein Motiv zum Schreiben.“ (GI3, S. 157, 1992) Jan-Christoph Hauschild (2001) schreibt dazu in seiner Müller-Biographie: „Freimütig bekannte er sich zur Gier des Dramatikers auf Katastrophen […].“ (S. 9)
93 Müller, Heiner (2005e), S. 113. Vgl. auch: Fuhrmann, Helmut (1997), S. 11.
94 Fuhrmann, Helmut (1997), S. 11f.
95 Zur „Wartezeit“ der Stücke vgl. Hauschild, Jan-Christoph (2001), S. 12 und Müller selbst (GI2, S. 155, 1988) so- wie zur finanziellen Zwangslage: „Die meiste Zeit habe ich eigentlich mit Schulden gelebt. So bis 1966.“ (GI2, S. 169, 1989)
96 Hauschild, Jan-Christoph (2001), S. 8.
97 Müller, Heiner, zit. in: Fuhrmann, Helmut (1997), S. 11.
98 Müller, Heiner (1989i), S. 91. Kein neuer Gedanke für Müller, der zudem in der „Umsiedlerin“ viel knapper und pointierter formuliert ist: „Die neue Zeit - die Spätgeburt, in letzter/ Minute und mit fremdem Bajonett/ Der Mutter aus dem Leib geschnitten - […].“ (Die Umsiedlerin, in: Müller, Heiner (2000b), S. 181-287, hier: S. 215f.)
99 Keller, Andreas (1992), S. 48.
100 Honecker, Erich (2005), S. 111. Kein geringerer als Erich Honecker verurteilte damit den „Bau“ und seinen Autor auf der 11. Tagung des ZK der SED 1965.
101 Keller, Andreas (1992), S. 53.
102 Keller, Andreas (1992), S. 49.
103 Honecker, Erich (2005), S. 111.
104 Müller, Heiner (2005c), S. 115.
105 Müller, Heiner (1977a), S. 110.
106 Müller, Heiner: Der Bau, in: Müller, Heiner (2000b), S. 329-396, hier: S. 393.
107 Müller, Heiner (1989c), S. 7.
108 Pamperrien, Sabine (2004), S. 585. Wie an der Schnur gezogen interpretiert sie Müllers Stücke im zehnseitigen Schnelldurchlauf als „Dogmatismus“ und „fundamentalistische[n] Antikapitalismus“ und kommt zu dem Schluss, dass sich „in seiner neurotischen Fixierung […] das Weltbild des Großdichters in nichts von demjenigen der Attentäter, die sich in diesen Tagen an unschuldigen Menschen vergehen“ unterscheidet. (S. 589)
109 Müller, Heiner (1989j), S. 40.
110 Herzinger, Richard (1992), S. 13. Allerdings sieht Richard Herzinger in Müllers Texten eine beispielhafte Form „kritisch-loyaler Literatur in der DDR“ (S. 15), die sich einer umfassenden Zivilisationskritik an den Hals wirft, um die DDR vor einer Verwestlichung zu bewahren. Soll heißen: Keine Systemkritik, sondern Verteidigung des kleine- ren Übels gegenüber der kapitalistischen Barbarei. Damit schlägt Müller laut Herzinger zwei Fliegen mit einer Klappe - die Trennung zwischen Utopie und schlechter Verwirklichung auf der einen und der Legitimierung der E- xistenznotwendigkeit der DDR - angesichts der westlichen Alternativlosigkeit - auf der anderen Seite. (Vgl. S. 16). Die existenzbedrohliche Sackgasse bezeichnete Müller 1981 als den „Alptraum, daß die Alternative Sozialismus o- der Barbarei abgelöst wird durch die Alternative Untergang oder Barbarei“. (Müller, Heiner zit. in: Domdey, Horst (1998), S. 77) Für Herzinger ist Müllers Polemik gegen die BRD nichts als die Reduzierung der Legitimierung der DDR auf die Abgrenzung vom Feind, eine Gestalt der Schmittschen Freund-Feind-Bestimmung. Getreu dem Motto: Wenn das positive Ziel in unerreichbare Ferne rückt - und damit die politische Identität zu verschwinden droht -, greif zum verlässlichsten politischen Verbündeten: dem Feind.
111 Hauschild, Jan-Christoph (2001), S. 7.
112 Vgl. Domdey, Horst (1998), Kapitel: Die Droge DDR. Wie kritisch war DDR-Literatur?, S. 195-209. Seine Bei- spiele sind Brechts nachträgliche Legitimierung der Panzer zum 17. Juni 1953, Christa Wolfs Rechtfertigung der sowjetischen Intervention in Prag 1968 und eben Müllers „kritische Solidarität“. Vgl. auch Theater in der DDR (1994), S. 259f.
113 Diese Stellungnahme Müllers zum politischen Prozess muss hier genügen, hat jedoch nur exemplarischen Wert. Vgl. dazu den Text von Slavoj Zizek (2004). Dass auch diese Medaille zwei Seiten hat - und Müller sich nicht scheute, auf jeder zu erscheinen -, zeigt sich, wenn man in Betracht zieht, dass er zu den Erstunterzeichnern des offenen Briefs von DDR-Künstlern gehörte, der sich gegen die Biermann-Ausbürgerung richtete.
114 Heiner Müller zur Privilegiendebatte, vgl. GI3, S. 77, 1990, GI3, S. 84f., 1990.
115 Bereits 1979 (Müller, Heiner (1989i), S. 91) hatte er diese Frage aufgeworfen - und „privilegiert“ genannt. Eine Zeit, die nicht mehr nur aus Notwendigkeit besteht und das Selbstopfer nicht mehr um jeden Preis braucht, muss sich die Frage nach den Opfern stellen.
116 Domdey, Horst (1998), S. 205.
117 Hauschild, Jan-Christoph (2001), S. 8.
118 Herzinger, Richard (1992), S. 10. Beinahe bewundernd stellt Jost Hermand fest, dass diese richtige Beobachtung einem Kritiker Müllers gelang (vgl. Hermand, Jost (1999), S. 159).
119 Dass diese Unterscheidung nicht nur synchron - im Westen und Osten - getroffen wurde, sondern nach der Wende auch als diachrone Bestand hatte, machte Martin Linzer (1990), S. 57 deutlich.
120 So das viel zitierte und besprochene Gedicht „Mommsens Block“.
121 Zur Differenz von Wirkung und Erfolg, vgl. GI1, S. 22, 1975, GI1, S. 125f., 1982 und GI2, S. 92, 1987. Zum Anspruch der Theaterschaffenden der DDR vgl. Theater in der DDR (1994), S. 258f.
122 Fuhrmann, Helmut (1997), S. 55.
123 Hauschild, Jan-Christoph (2001), S. 12.
124 Ebd.
125 Und sie blieben, anfangs als Besatzer, später als machterhaltende Instanz - in jedem Fall war die Durchsetzung des Sozialismus in der DDR eher eine Installation, denn ein Aufbau und wurde nur durch den politischen und militärischen Druck der sowjetischen Besatzungsmacht gewährleistet. Auch in der „Umsiedlerin“ findet sich dieser Umstand: „[…] die Rote Armee kam mit der Rechnung für vier Jahre Krieg, Menschenschinden und verbrannte Erde, aber mit Frieden auch und Bodenreform“ (in: Müller, Heiner (2000b), S. 216).
126 Ebd., S. 217f.
127 Keller, Andreas (1992), S. 50.
128 Ebd. Müller waren diese, der Kunst zugewiesenen Aufgaben wohl vertraut. Scheinbar in Anlehnung an diesen frühen Appell zur Produktionssteigerung interpretierte Müller sein erstes, 1958 uraufgeführtes Stück „Lohndrücker“ später als Versuch, „zu zeigen, wie die Disziplinierung der deutschen Arbeiterklasse durch den Faschismus produk- tiv gemacht würde für den Aufbau des Sozialismus“. (GI1, S. 112, 1982) Der Dialektiker Müller in Hochform: Der Traum der neuen Zeit wird durch den alten Menschen errichtet, die neuen Häuser - an Brecht erinnernd - auf unge- leerten Kellern gebaut. Eine verhängnisvolle Verschlingung, die sich nicht „wegideologisieren“ lässt. Genau darauf besteht Müller.
129 Theater in der DDR (1994), S. 250. Diese beiden Bestandteile, die sich schnell als ein und dasselbe lesen, sind streng zu trennen. Je weiter die beiden im Laufe der Zeit auseinander traten, um so mehr wurden die Theatermacher zum „Statthalter der Utopie“ (ebd., S. 251) - auch gegenüber ihrer mangelhaften Umsetzung in der DDR. Dass diese Folie nur durch die Verbindung an den Glauben ihrer Realisierbarkeit - eben in der DDR - gebunden blieb, macht das Verhängnis dieser Position aus, die sich folgerichtig auch im verzweifelten Ringen der Intellektuellen um den Erhalt der DDR 1989 spiegelte. (Vgl. ebd., S. 253ff.) Noch pointierter bei Hermann Kähler (1966) als „ideologische Waffe im Klassenkampf“ (S. 171).
130 Theater in der DDR (1994), S. 251.
- Arbeit zitieren
- Matthias Zimmermann (Autor:in), 2007, "Die Wunde immer noch". Zu Heiner Müllers Theater als konstruktiv-erinnerndem Umgang mit Geschichte im mythischen Erfahrungs- und Denkmodell, in Auseinandersetzung mit der Tragödie am Beispiel von "Philoktet", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/449137
Kostenlos Autor werden
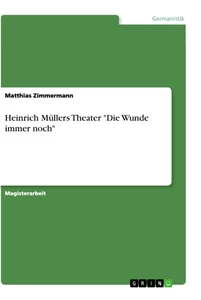


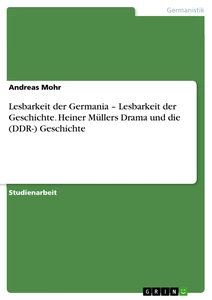





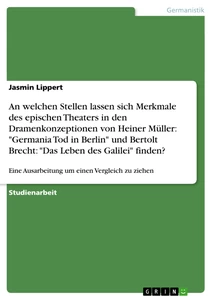










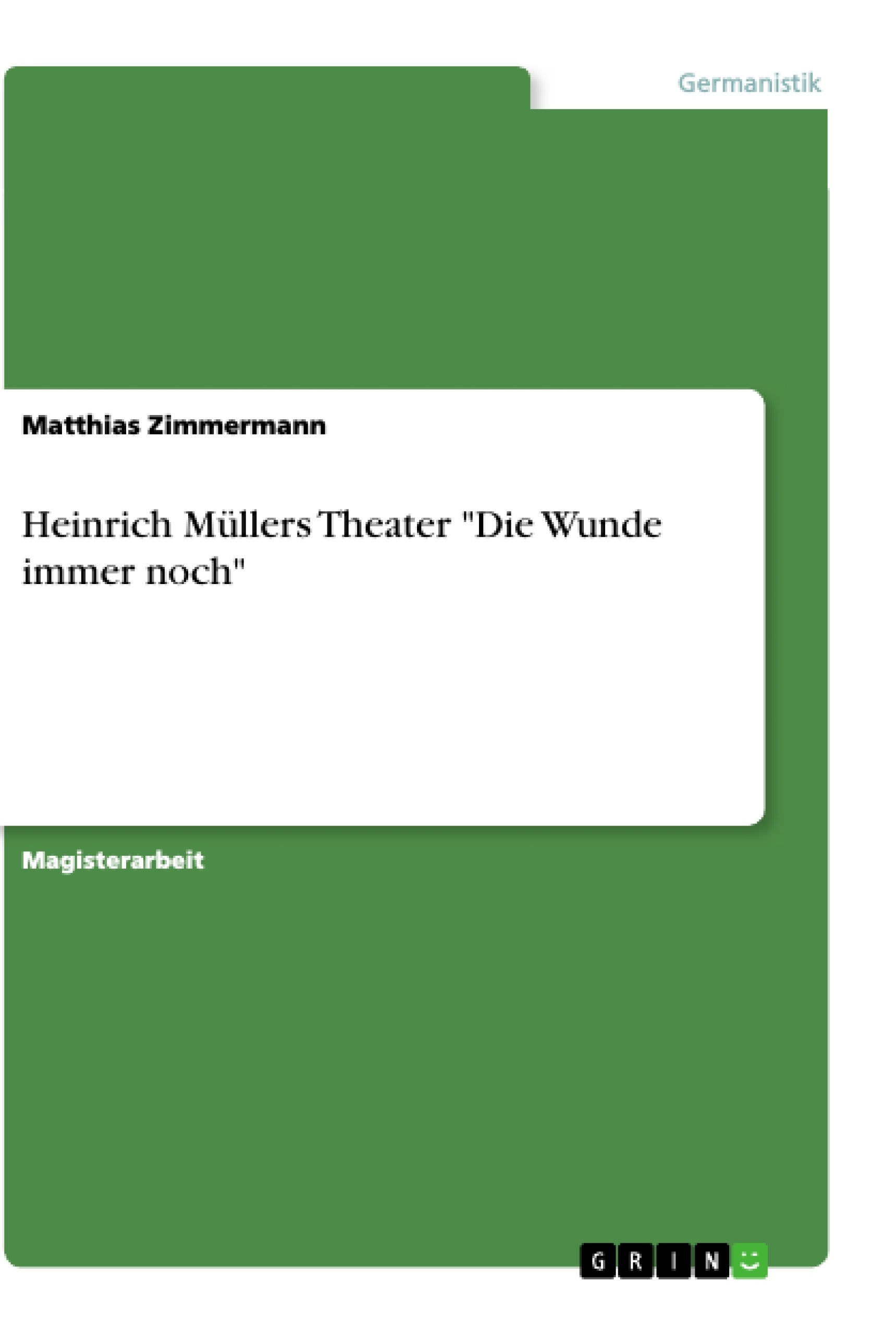

Kommentare