Leseprobe
Inhalt
Einleitung
I. Spiel
1. Zum Begriff des Spiels
2. Spieldefinitionen und Spielmerkmale
3. Spieltheorien und -klassifizierungen
3.1. Anfänge
3.2. Klassische Spieltheorien
3.3. Moderne Spieltheorien
3.3.1. Die kognitive Spieltheorie Jean Piagets
3.3.2. Psychoanalytische Spieltheorien
3.3.3. Dialektische Spieltheorie nach Brian Sutton-Smith
3.4. Ergänzende Klassifikationsmöglichkeiten
4. Spielpädagogik
5. Die Nutzbarmachung des Spiels als Medium der Friedenspädagogik
6. Korrespondierende pädagogische Handlungsbereiche
II. Frieden
1. Zum Begriff des Friedens
2. Friedensforschung
3. Friedenspädagogik / Friedenserziehung
3.1. Frühe Konzepte der Friedenspädagogik und -erziehung
3.2. Klassische Konzepte der Friedenspädagogik und -erziehung
3.2.1. Anthropologisch-personale Friedenspädagogik
3.2.2. Geisteswissenschaftlich-dialektische Friedenspädagogik
3.3. Inhalte, Prinzipien und Aufgaben heutiger Friedenserziehung
III. Friedensspiele
1. Rollenspiele
1.1. Planspiele / Simulationsspiele
1.1.1. Das NATO-Spiel
1.1.2. Soja, Kaffee oder schwarze Bohnen?
1.1.3. Krieg oder Frieden
1.1.4. Model United Nations
1.1.5. World Game
1.1.6. Zusammenfassende Bewertung
1.2. Darstellendes Spiel
1.2.1. Schwarz-Weiß-Begegnungsspiel
1.2.2. Puppentheater
1.2.3. Friedenserziehung mit allen Sinnen
1.2.4. Zusammenfassende Bewertung
2. Gesellschaftsspiele
2.1. Gruppenspiele
2.2. Brettspiele
2.3. Das Spiel für den Frieden
2.4. Zusammenfassende Bewertung
3. Sportspiele
3.1. Kooperative Sportspiele
3.2. Fremdheit in Sportspielen
3.3. Straßenfußball
3.4. Zusammenfassende Bewertung
4. Computer- und Videospiele
5. Gestaltendes Spiel
6. Spiel als Rahmenkonzept
7. Entwurf eines Bewertungssystems
Fazit und Ausblick
Literatur
Abbildungsnachweis
Anhang
Das Friedensleben muss ein jeder so gut wie möglich verbringen.
Wie ist aber die rechte Weise?
Spielend muss es gelebt werden, gewisse Spiele spielend,
opfernd und singend und tanzend, um die Götter gnädig zu stimmen.
(Platon, Gesetze, VII. 803, c-e)
Einleitung
In der medialen Berichterstattung der letzten Jahre kam die Thematik der „Friedensschaffung“ vornehmlich im Kontext militärischer Maßnahmen zur Sprache: Angefangen bei der Nato-Intervention in den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens im Jahre 1999, den bis heute andauernden Aktionen der dort stationierten UN-Truppen und dem endlos erscheinenden Konflikt im Nahen Osten mit den gerade in den heutigen Tagen wieder zunehmenden gewaltsamen Aktionen der beteiligten Parteien über den jüngsten Irak-Krieg, den eine multinationale Koalition unter der Führung der Vereinigten Staaten mit den Zielen der Entwaffnung und eines Regimewechsels führte, bis schließlich hin zu einem unklar definierten „Krieg gegen den Terror“, der global von diversen Protagonisten in den unterschiedlichsten Zusammenhängen und mit verschiedensten Rechtfertigungen und Maßnahmen vorgeblich zur Erhaltung oder Herstellung des „Friedens“ geführt wird. Die Beurteilung der tatsächlichen Bedrohung durch den internationalen Terrorismus gestaltet sich dabei äußerst schwierig – andere friedensrelevante, dringliche und ernste Probleme sowie nachhaltiges und langfristiges Engagement treten oft in den Hintergrund.
Ungeachtet jeglicher weiteren moralischen oder politischen Bewertung der geschilderten Umstände ist festzustellen, dass die Reaktionen auf die neue diffuse Gefahrenlage eine deutliche Tendenz haben. Als Schlagworte sind z.B. der hierzulande diskutierte Einsatz der Bundeswehr im Innern, die US-amerikanische Planung einer nationalen Raketenabwehr im Weltraum und weitere militärische, geheimdienstliche oder polizeiliche Maßnahmen zur Terrorabwehr zu nennen. Angesichts dieses geistigen Klimas verwundert es nicht, dass weniger spektakuläre und damit weniger medienwirksame Begebenheiten im Zusammenhang der Friedensschaffung und -erhaltung in den letzten Jahren weniger Aufmerksamkeit erhalten haben. Zu verweisen ist zum Beispiel auf die Einrichtung so genannter Gacaca-Gerichte[1] in Ruanda, in denen die Folgen des schrecklichen Völkermordes von 1994 nicht nur unter den Aspekten von Schuld und Sühne, sondern vor allem von Wiedergutmachung und Versöhnung aufgearbeitet werden, oder der sich nach fast 20 Jahren Bürgerkrieg abzeichnende Friedensprozess in Sri Lanka, zu dem eine Vielzahl zivilgesellschaftlicher Initiativen beigetragen hat. Des Weiteren gehören eine Reihe engagierter Projekte und Forschungsarbeiten religiöser, nichtstaatlicher oder staatlicher Institutionen hierher, insbesondere z.B. in der Tradition der Heidelberger Erziehungswissenschaft stehende Untersuchungen zu friedensbauenden Bildungsmaßnahmen in unterschiedlichsten Konfliktsituationen und zum Themenkomplex der human rights education insbesondere der Rechte der Kinder[2] oder, um den lokalen Bezug weiter zu wahren, die auch noch nach über 25 Jahren lebendige und sich entwickelnde Idee einer Friedensschule, nahe liegendes Beispiel ist die Internationale Gesamtschule Heidelberg, an deren Entwicklung Hermann Röhrs wesentlich beteiligt ist.[3]
In der vorliegenden Arbeit möchte ich eine weitere zivile Handlungsmöglichkeit der Friedensarbeit beleuchten: den Einsatz von Spielen als Medien im Kontext der Friedensbildung, Friedenserziehung und Friedenspädagogik. Zu diesem Zweck wird im ersten Teil vorab das Phänomen „Spiel“ erläutert. Hierbei werden zunächst verschiedene Möglichkeiten der Begriffsbestimmung dargelegt, es folgt ein Überblick über verschiedene Definitionen. Schließlich werden verschiedene Spieltheorien und Klassifikationsmöglichkeiten besprochen; den Abschluss bilden weitere Ergänzungen von Klassifikationen und Spielformen. Inhaltlich wurde bei der Bearbeitung des ersten Kapitels ein besonderer Fokus auf jene Themen gelegt, die später im erweiterten Sinnzusammenhang der zu besprechenden Spielexempel hilfreich sein werden.
Das zweite Kapitel befasst sich im weiteren Sinne mit dem Themenkomplex der Friedenspädagogik. Dazu wird zunächst auf den Begriff des Friedens eingegangen, anschließend folgt eine Differenzierung der Themen Friedensforschung, Friedenspädagogik und Friedenserziehung sowie die Erläuterung der genannten Themen im Einzelnen mit Fokus auf den Prinzipien und Zielen einer aktuellen Friedenserziehung.
Das dritte Kapitel stellt schließlich ausgewählte Beispiele für Spiele als Medien der Friedenserziehung zusammen und liefert darüber hinaus eine Analyse dieser Beispiele. Dies geschieht mit dem Ziel, eine fruchtbare Synthese der zuvor besprochenen Themengebiete zu vollziehen. Anhand unterschiedlicher Beispiele für verschiedene Ansätze soll die Funktion der jeweiligen Spiele im Kontext ihrer friedensfördernden Aufgabe deutlich gemacht werden. Bei der Suche nach entsprechenden Spielexempeln wurden neben der üblichen Recherche in den regionalen Bibliotheken, den überregionalen Verbundkatalogen und einer allgemeinen Internetsuche auch die geläufigen Datenbanken wie FIS-Bildung oder ERIC hinzugezogen. Als besonders ergiebig haben sich Fachbibliographien, wie sie z.B. das Institut für Friedenspädagogik in Tübingen zur Verfügung stellt, die direkte Anfrage bei diversen Spieleverlagen sowie die Konsultation von Spielesammlungen und Spieliotheken erwiesen.
Aus der Fülle des recherchierten Materials wurden einige besonders prägnante Beispiele ausgewählt, um ganz unterschiedliche friedenspädagogische Herangehensweisen darstellen zu können. Im Einzelnen wurden dabei Konzepte aus dem weiten Feld der Rollenspiele, insbesondere der Plan- und Simulationsspiele, sowie Beispiele für relevante Gesellschaftsspiele und Sportspiele berücksichtigt. Ergänzend wurden auch die Themengebiete Computerspiel und gestaltendes Spiel sowie der Einsatz des Spiels als Rahmenkonzept für Netzwerkarbeit in den Blick genommen.
Am Schluss steht der Versuch, ein Bewertungsraster zu entwerfen, in dem verschiedene Spielkonzepte so erfasst werden können, dass die unterschiedlichen friedenspädagogischen Zusammenhänge erkennbar werden. Ein zusammenfassendes Fazit und der Ausblick auf weitere folgende Möglichkeiten der thematischen Auseinandersetzung beschließen diese Arbeit.
I. Spiel
Der Begriff „Spiel“ wird fach- wie umgangssprachlich höchst unterschiedlich gebraucht. Wolfgang Einsiedler stellt dazu fest:
Die begriffliche Fassung des Phänomens Spiel hat die wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit ihm auseinander setzen vor beinahe unlösbare Probleme gestellt. So fällt es oft schwer, Spiel aus dem Ablauf anderer Handlungsweisen abzugrenzen und eindeutige Merkmale seines Auftretens anzugeben.[4]
Hans Scheuerl hingegen fragt, ob es für das Spiel überhaupt einen eindeutigen Begriff gebe, und verweist auf den Philosophen Ludwig Wittgenstein, der meint, wer nach eindeutigen Merkmalen suche, die allen Spielen gemeinsam seien, sei nur einer Verführung unserer Sprache verfallen, vielmehr gebe es nur ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen.[5] An anderer Stelle schreibt Scheuerl sehr bildhaft und erfrischend humorvoll:
Für alle diese Geschehnisse in ihrer phänomenalen Vielfalt eine gemeinsame abstrakte Definition oder Erklärungstheorie zu suchen, wäre so aussichtslos, als wenn man eine Theorie der Sterne zu entwerfen versuchte, die neben Himmelskörpern auch Bühnenstars und Christbaumsterne umfassen sollte.[6]
Es erscheint also sinnvoll, sich vorerst aus mehreren Perspektiven dieser Begrifflichkeit zu nähern. Im Folgenden wird daher zunächst auf die semantische Bedeutung und die Etymologie des Begriffs „Spiel“ eingegangen, es folgt eine Zusammenfassung verschiedener Spieltheorien und -kategorisierungen, die abschließend dem Ziel der Arbeit entsprechend konkretisiert und um praxisbezogene Spielformen ergänzt werden.
1. Zum Begriff des Spiels
Das Substantiv „Spiel“ kann als Abstraktum je nach kontextuellem Gebrauch eine Handlung, einen Vorgang oder einen Zustand ausdrücken, gleichzeitig lässt es sich als Gegenstandswort, als Konkretum kategorisieren. Im Plural wird es im abstrakten Sinn als Mehrheit der einzelnen Tätigkeiten oder im konkreten Sinn als Sammelbegriff benutzt. Das Wort geht in seiner Genese auf das althochdeutsche substantivische spil und das verbale spilon zurück, das auf die Zeit des Beginns der schriftlichen Überlieferungen im achten Jahrhundert datiert werden kann. In lautlicher Hinsicht bleibt spil im Mittelhochdeutschen unverändert, dagegen wandelt sich spilon zu spiln bzw. spilen, was mit „Scherz treiben, sich vergnügen, sich lebhaft bewegen, fröhlich sein, musizieren“ übersetzt werden kann. Die Ausgangsbedeutung scheint dabei „tanzen, sich tänzerisch bewegen“ zu sein. Auch die Bezeichnungen in anderen europäischen Sprachen weisen Ähnlichkeiten auf, so besteht z.B. unmittelbare Verwandtschaft mit dem substantivischen mittel- und neuniederländischen spel, dem altenglischen spilian, dem norwegischen spill, dem schwedischen spela und dem dänischen spille.[7]
Johan Huizinga hat 1938 in seiner bedeutenden Arbeit zum Spiel als Kulturerscheinung, „Homo Ludens“, unter anderem eine umfangreiche Betrachtung der Konzeption des Spielbegriffs und der sprachlichen Ausdrücke für diesen vorgelegt. Er untersucht darin die Bezeichnungen für „Spiel“ im Griechischen, Sanskrit und Chinesischen, bei den Blackfoot-Indianern, in den semitischen, romanischen und schließlich in den germanischen Sprachen. Insbesondere für die letzteren wie auch für die modernen europäischen Sprachen stellt er fest:
Es ist, als ob der Begriff Spielen nach und nach ein immer größer werdendes Feld überspannt, [...], wobei sich seine spezifische Bedeutung gewissermaßen in die einer leichten Handlung oder Bewegung überhaupt auflöst.[8]
Auch Hans Scheuerl resümiert, dass – die sprachhistorischen Quellen berücksichtigend – das Spiel als Bewegungsphänomen verstanden werden könne, wobei es sich nicht nur um die rein physikalische Bewegung handele, und erläutert:
Die Bedeutung des Wortes Spiel weist primär nicht auf eine Tätigkeit, sondern auf eine Bewegung hin.[9]
Ähnlich wie auf dem Wasser Wellen aus ganz unterschiedlichen Gründen spielen können und damit keine eindeutigen Rückschlüsse auf den Verursacher möglich sind, sei auch das Spiel als Phänomen im Ganzen von ursächlichen Kräften abstrahierbar:
Spiel ist frei, nicht weil es ursachlos ist, sondern weil es sich abhebt von seinen Ursachen, weil es phänomenal nicht getan wird, sondern geschieht.[10]
Eine weitere interessante semantische Besonderheit, die Huizinga in ähnlichem Zusammenhang feststellt, soll dabei nicht unerwähnt bleiben:
Man s p i e l t ein S p i e l. Mit anderen Worten: um die Art der Tätigkeit auszudrücken, muß der im Substantiv enthaltene Begriff wiederholt werden, um das Verbum zu bezeichnen. Das bedeutet allem Anschein nach, daß die Handlung von so besonderer und selbständiger Art ist, daß sie aus den gewöhnlichen Arten von Betätigung heraus fällt: S p i e l e n ist kein T u n im gewöhnlichen Sinne.[11]
Dem Duden zufolge können im heutigen Deutsch zwölf verschiedene semantische Bedeutungsfelder von „Spiel“ unterschieden werden, die hier sinngemäß zusammengefasst sind:[12]
1. das Spielen: Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspannung, aus Freude an ihr selbst und an ihrem Resultat ausgeübt wird;
Gesellschaftsspiel: Spiel, das nach festgelegten Regeln durchgeführt wird;
Glücksspiel: Spiel, bei dem der Erfolg vorwiegend vom Zufall abhängt und bei dem um Geld gespielt wird.
2. Art zu spielen; Spielweise (ohne Plural): z.B.: „Steffi Graf fand erst allmählich zu ihrem Spiel.“
3. einzelner Abschnitt eines längeren Spiels: z.B. „Steffi Graf hatte die ersten beiden Spiele des Satzes gewonnen.“
4. Anzahl zusammengehörender, zum Spielen bestimmter Gegenstände sowie fachsprachlich: Satz: z.B.: „ein Spiel Stricknadeln“.
5. das Spielen (ohne Plural): künstlerische Darbietung, Gestaltung einer Rolle durch einen Schauspieler; Darbietung, Interpretation eines Musikstücks.
6. Bühnenstück, Schauspiel.
7. (schweiz.) (Militär)musikkapelle, Spielmannszug.
8. das Spielen der Wellen, der Muskeln sowie im übertragenen Sinn: das Spiel der Gedanken, der Fantasie usw.
9. das Spielen: Handlungsweise, die etwas, was Ernst erfordert, leicht nimmt, z.B.: „das Spiel zu weit treiben“.
10. Bewegungsfreiheit von zwei ineinander greifenden oder nebeneinander liegenden (Maschinen)teilen; Spielraum.
11. Jägersprache: Schwanz des Birkhahns, Fasans, Auerhahns.
12. diverse metaphorische Bedeutungen im speziellen kontextuellen Zusammenhang, wie z.B.: „Spiel mit dem Feuer“, „etwas aufs Spiel setzen“ usw.
Zieht man das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm hinzu, lassen sich noch drei weitere Bedeutungsfelder hinzufügen, die schon in der etymologischen Herleitung angedeutet wurden: Die aus dem Mittel- und Neuhochdeutschen herrührende und in dieser Grundbedeutung nahezu vergessene Verwendung als Begriff des sinnlichen Vergnügens und der Freude, die Bezeichnung für die bloße körperlich-sportliche Betätigung sowie das Spiel in seiner Funktion als Los.[13]
Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass im Deutschen offenbar mit einem einzigen Wort – „Spiel“ bzw. „spielen“ – ein wesentlich größerer Bedeutungsraum ausgefüllt wird als in vielen anderen Sprachen. So wird im Lateinischen beispielsweise zwischen dem einfachen Spiel „ludus“, dem Schauspiel „spectaculum“ und dem Glücksspiel „alea“ unterschieden, die englische Sprache kennt „play“ für das einfache Kinderspiel und Schauspiel, „match“ für den Wettkampf, „game“ für das Regelspiel sowie das verbale „to act“ für den Vorgang des Schauspielens und „to gamble“ beim Glücksspielen.
2. Spieldefinitionen und Spielmerkmale
Meyers Enzyklopädisches Lexikon erklärt das Spiel als
Tätigkeit (von Tier und Mensch), die ohne bewussten Zweck, aus Vergnügen an der Tätigkeit als solcher bzw. an ihrem Gelingen vollzogen wird. Das Spiel des Menschen wird als ein durch unterschiedlichste Faktoren bestimmtes Verhalten verstanden, das im Wechselverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft eine wesentliche Vermittlerrolle einnimmt und in jeder Lebensperiode unentbehrlich ist.[14]
und verweist im Anschluss auf die Problematik der Vielzahl sich teilweise widersprechender Definitionsmöglichkeiten. Diese und weitere allgemein- und fachlexikalische Spieldefinitionen rekurrieren zum einen zumeist auf die Elemente des Spiels nach Johan Huizinga, dessen Betrachtungen zur Semantik des Spielbegriffs bereits angesprochen wurden. Huizinga resümiert in diesem Zusammenhang:
Der Form nach betrachtet, kann man das Spiel also zusammenfassend eine freie Handlung nennen, die als „nicht so gemeint“ und außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend empfunden wird und trotzdem den Spieler völlig in Beschlag nehmen kann, an die kein materielles Interesse geknüpft ist und mit der kein Nutzen erworben wird, die sich innerhalb einer eigens bestimmten Zeit und eines eigens bestimmten Raums vollzieht, die nach bestimmten Regeln ordnungsgemäß verläuft und Gemeinschaftsverbände ins Leben ruft, die ihrerseits sich gern mit einem Geheimnis umgeben oder durch Verkleidung als anders als die gewöhnliche Welt herausheben.[15]
Zum anderen beruhen Spieldefinitionen oft auf den als klassisch zu bezeichnenden phänomenologisch-anthropologisch orientierten Wesensmerkmalen des Spiels, die Hans Scheuerl beschreibt und die wie folgt dargestellt werden können:
Das Moment der Freiheit impliziert, dass das Spiel keinen außerhalb seiner selbst liegenden Zweck verfolgt und somit frei von Zielsetzungen bzw. in einer positiven Formulierung selbstzwecklich ist. Innerhalb dieser Freiheit erfüllt das Spiel das Moment der inneren Unendlichkeit. Obwohl es den Charakter der Triebhaftigkeit trägt, zielt es nicht auf Befriedigung und will diese auch nicht erreichen. Es will Ewigkeit und wird nur von außen beschränkt. Dieses Streben nach Ausdehnung in der Zeit wird mitunter durch Selbstwiederholung zu erreichen versucht. Die Freiheit vom Zwang der Realität und zur Hingabe an die innere Unendlichkeit lässt das Spiel in einer eigenen scheinhaften Ebene, einer eigenen „imaginativen Gegenstandsschicht“ existieren, die das Moment der Scheinhaftigkeit begründet und von der sonstigen Realität abgehoben ist. Dieser Schein versteht sich in einem doppelten Sinn, zum einen als im schillerschen Sinn „reiner ästhetischer Schein“, zum andern als „illusionäres Zu-Sein-Scheinen“. Ein mittlerer Spannungslevel, die Offenheit des Spielausgangs und das Verhindern von Eindeutigkeit erzeugen das Moment der Ambivalenz, welches auch als „Binnenspannung“ beschrieben werden kann. Um diese aufrechtzuerhalten, bedarf es einer Begrenzung. Diese Begrenzung beschreibt das Moment der Geschlossenheit, das sich z.B. als Regel, Ausgangskonstellation oder thematische Leitidee äußert. Schließlich nennt Scheuerl noch das Moment der Gegenwärtigkeit, das der Tatsache Rechnung trägt, dass die ambivalente Binnenspannung der Spieler an den gegenwärtigen Augenblick gekoppelt ist. Der zeitliche Spielablauf ist also derart strukturiert, dass die Zukunft offen bleibt, was zum Spannungsmoment der Ambivalenz beiträgt.[16] Es ist anzumerken, dass Scheuerl selbst diese Wesensmerkmale des Spiels ausdrücklich lediglich als eine Annäherung an das Phänomen Spiel verstanden wissen möchte.
Heinz Heckhausen beschreibt fünf Merkmale des Spiels und geht dabei vom Prinzip der Aufrechterhaltung eines mittleren Erregungsniveaus aus. Das Über- und Unterschreiten desselben werde als lustvoll empfunden, dies wird von Heckhausen als Aktivierungszirkel beschrieben. Als weitere Merkmale nennt er die undifferenzierte Zielstruktur und die unmittelbare Zeitperspektive, drittens die Zweckfreiheit des Spiels, viertens das Postulat der Quasi-Realität (welches als „So-tun-als-ob“ auch bei Einsiedler in Erscheinung tritt) und letztendlich den Handlungscharakter des Spiels.[17]
Schließlich bietet Wolfgang Einsiedler vier Hinweismerkmale an, die zur Identifizierung des Kinderspiels dienen sollen, die jedoch nicht zwangsläufig alle gleichzeitig erfüllt sein müssen, und verdichtet diese als
eine Handlung oder eine Geschehniskette oder eine Empfindung, die intrinsisch motiviert ist / durch freie Wahl zustande kommt, die stärker auf den Spielprozess als auf ein Spielereignis gerichtet ist (Mittel-vor-Zweck), die von positiven Emotionen begleitet ist und die im Sinne eines So-tun-als-ob von realen Lebensvollzügen abgesetzt ist.[18]
Einsiedler weist dabei ausdrücklich auf die Berechtigung hin, auf eine Definition mit ausschließlichen Merkmalen zu verzichten und stattdessen typische Charakteristika zu explizieren, da es sich bei Spiel um ein biologisches Phänomen handele, welches naturgemäß unscharf und mit fließenden Übergängen zu anderen Phänomenen anzutreffen sei.[19] Dementsprechend führt er aus:
Spiel ist ein gutes Beispiel für einen Begriff, der injunkt ist, d.h. nicht streng abgrenzbar, sondern mit Merkmalen zu kennzeichnen, die auch zu Nachbarphänomenen gehören.[20]
Einsiedler weist in diesem Zusammenhang auch auf die Möglichkeit hin, das Spiel als Flow-Erlebnis zu interpretieren, was hier nur sehr grob gefasst als ein Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein im Zustand der Selbstvergessenheit beschrieben werden kann.[21]
Die dargestellten Spielmerkmale erfreuen sich einer breiten Rezeption innerhalb der wissenschaftlichen Literatur und der pädagogischen Praxis, auch wenn die bereits erwähnte grundsätzliche Unschärfe der Begrifflichkeiten damit nicht abschließend gelöst ist und es durchaus Anlass zur Kritik gibt. So stellt van der Kooij fest:
Was völlig fehlt, ist ein adäquater Begriffsapparat. Bis zum heutigen Tag ist es keinem Wissenschaftler gelungen, eine unangreifbare Definition des Begriffs Spiel zu geben. Man theoretisiert bedenkenlos.[22]
Rimmert van der Kooij sieht als wesentliches Problem bei der begriffsbildenden Betrachtung des Spiels die ungenaue Unterscheidung von Verhalten und dessen Kausalität und schlägt vor, im gegebenen Zusammenhang von Spielverhalten anstelle von Spiel zu sprechen.[23]
Auch Scheuerl hält eine Differenzierung für sinnvoll und schlägt folgende Spielbegriffe vor: Spieltätigkeiten als Akte und Reaktionen, die Spielabläufe erzeugen, sowie ebendiese Spielabläufe als strukturierte Geschehnisabläufe; des Weiteren Spiele als Regelgebilde, worunter Objektivationen der Spielabläufe zu verstehen sind, die Freiraum und Begrenzung schaffen, und letztlich die spielerische Tätigkeit als eine Tätigkeit, die durch Distanzierung von ihrem Außenzweck einen spielerischen Charakter annimmt.[24]
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verschiedenen Autoren entweder Beschreibungen allgemein bekannter oder von ihnen favorisierter Merkmale geben, wie Scheuerl mehrere Spielbegriffe unterscheiden und definieren oder wie Einsiedler nur Hinweismerkmale angeben, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit und umfassende Erklärung haben. Dabei ist zu bedenken, dass in exakten Naturwissenschaften, freilich innerhalb erkenntnistheoretischer Grenzen, Merkmalsdefinitionen zwar eine hohe Objektivierbarkeit aufweisen können, bei der humanwissenschaftlichen Betrachtung der vorliegenden Definitionsproblematik jedoch unvermeidbare normative Anteile zu vermuten sind. Dennoch erscheinen die etablierten Merkmalsbeschreibungen und Definitionsansätze im jeweiligen konkreten und praktischen Anwendungszusammenhang durchaus sinnvoll nutzbar. Im Übrigen sollte es vertretbar sein, den Begriff Spiel nicht abschließend zu definieren, sondern weiterhin als injunkten Begriff zu gebrauchen.
3. Spieltheorien und -klassifizierungen
In der theologischen, philosophischen, psychologischen, soziologischen wie auch in der pädagogischen Literatur findet sich eine Fülle von Spieltheorien. Ordnungs- und Gliederungsversuche erweisen sich als äußerst vielfältig, es bieten sich dabei historische oder thematische Einordnungsversuche an. Um der Relevanz für die Ziele dieser Arbeit gerecht zu werden, soll eine Kombination beider Verfahren gewählt werden, bei der zunächst Anfänge und Klassiker der Spieltheorien angerissen werden, um dann vor allem eine psychologische und soziologische Perspektive zu wählen. Insbesondere die kognitive Spieltheorie Jean Piagets, die Vorstellungen zum Spiel aus psychoanalytischer Sicht und vor allem der integrative spieltheoretische Ansatz von Brian Sutton-Smith erweisen sich als gehaltvoll für die nachfolgend behandelte spielpädagogische Praxis und werden daher näher besprochen.[25]
3.1. Anfänge
Schon in der Antike haben sich Theologen und Philosophen in ihren Schriften mit dem Spiel beschäftigt. Zu nennen sind z.B. Platon (427-347 v. Chr.), Aristoteles (384-322 v. Chr.), Cicero (106-43 v. Chr.), Seneca (4 v. Chr.-65 n. Chr.) oder Quintilian (ca. 35-95), des Weiteren die Kirchenväter Augustinus (354-430) und Hieronymus (342-420). Sie alle verbinden zwei immer wiederkehrende Motive pädagogischen Denkens: Zum einen die Annahme, dass Spielverhalten diagnostisch auf den Charakter des Kindes hinweist und reziprok auf dessen Bildung zurückwirkt, und zum anderen die Idee, dieses Verhalten planmäßig fördern bzw. unerwünschtes Verhalten verhindern zu können.[26]
Auch wenn am Beginn des 17. Jahrhunderts der Gedanke aufkommt, das Spiel als notwendige Entwicklungsphase anzusehen, und obwohl der Spielbegriff sich später zu einem bedeutenden philosophischen Begriff entwickelt, bleiben die erwähnten antiken Motive zunächst vorherrschend. Als zentrale Figur seiner Zeit gilt der Theologe und Pädagoge Johann Amos Comenius (1592-1670), der mit „Schola Ludus“ und „Didactica Magna“ seinen Beitrag zur Pädagogisierung des Spiels in Form von Reformvorschlägen zum Schulwesen leistete.[27] Ebenfalls auf den Nutzen des Spiels weist der englische Philosoph John Locke (1632-1704) hin. Für die Zeit der Aufklärung und den Weg in eine moderne Spieltheorie ist zunächst Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) zu nennen, der den natürlich gegebenen Sinn und Nutzen des Spiels betont, das Spiel als Lernprozess an sich beschreibt und in seinem „Émile“ kreative Spielanregungen gibt.[28] Des Weiteren stehen für diese Epoche Ernst Christian Trapp (1745-1818), der Rousseaus Theorien weiterentwickelt und Parallelen von Arbeit und Spiel beschreibt, Johann Christoph Friedrich Guts-Muths (1759-1839), der als Begründer der Sportpädagogik anzusehen ist,[29] und schließlich natürlich Immanuel Kant (1724-1804), der für eine strikte Trennung von Arbeits- und Spielebene plädiert und Ansichten zum Spiel in seine Betrachtungen über die reine Vernunft einflicht.[30]
Stellvertretend für eine bedeutende Weiterentwicklung der Spieltheorien ist Friedrich Schiller (1759-1805) anzuführen, der hier mit dem wohlbekannten Wort aus seinem fünfzehnten Brief über die ästhetische Erziehung des Menschen zitiert werden soll:
Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.[31]
Schiller verlagert die Aufmerksamkeit gegenüber dem Spiel auf dessen psychologische Aspekte und führt eine Unterscheidung in die Begriffe Spieltrieb und Sinnes- und Gestaltungstrieb ein; er ordnet das Spiel dem Bereich des Ästhetischen zu. Des Weiteren gehören zu den bedeutenden frühen Spieltheoretikern Jean Paul (1763-1825), der den Fokus seiner Ausführungen auf das Thema Phantasie und Spiel legt, so wie dies auch noch heute besonders von Anthroposophen begriffen wird, Friedrich Schleiermacher (1768-1834) mit seiner Darstellung zu Moment und Zukunft im kindlichen Leben und schließlich der Begründer des Kindergartens, Friedrich Fröbel (1782-1852). Der Letztgenannte hebt deutlich die Rolle des Spiels für die spätere Persönlichkeitsentwicklung hervor, er leistet mit den „Spielgaben“ konkrete Beiträge für die Spielpraxis und lässt sich mit seinen Gedanken zum Spielen und Lernen als Wegbereiter für Piagets Theorie von Akkommodation und Assimilation bezeichnen.[32]
3.2. Klassische Spieltheorien
Inspiriert von Schiller und stark beeinflusst von Darwin formuliert der englische Philosoph Herbert Spencer (1820-1903) 1855 seine surplus energy theory.[33] Ausgehend von der Annahme, niedere Tierarten benötigten ihre ganze Energie, um ihren Fortbestand zu sichern – woraus folgt, dass höhere Tierarten durch effizienteres Funktionieren Energien für spielerische Aktivitäten freistellen können –, nimmt er an, dass das Spiel der Entladung überschüssiger Energien und aufgestauter Kraft diene. Die Theorie impliziert, dass Tiere höherer Rangordnung von Natur aus aktiv und hoch motiviert zur Interaktion mit der Umwelt seien. Einleuchtend erscheint die Verknüpfung von physischen, psychischen und sozialen Funktionen des Menschen – beim Beobachten tobender Kinder gewinnt die Theorie augenscheinlich Evidenz. Diese verliert sie jedoch wieder durch die Tatsache, dass auch müde Kinder durchaus spielen. Verinnerlichte Motivation, die spezifischen Funktionen des Spiels oder der Einfluss der jeweiligen Situation auf die Art des Spiels werden vernachlässigt.
Ebenfalls stark unter dem Einfluss Darwins stehend entwickelt G. Stanley Hall (1846-1924) 1906 seine Theorie des Spiels.[34] Danach stelle die Entwicklung des Individuums (Ontogenese) eine stark verkürzte Wiederholung der Entwicklung der Art (Phylogenese) dar. Spielverhalten entwickele sich also, vererbungsbedingt verkürzt, parallel der menschlichen Entwicklungsgeschichte. Dass Kinder in unterschiedlichen Ländern oft ähnliche Spiele, wie Räuberspiele oder Hüttenbauen, spielen, lässt sich als Beleg für diese Theorie anführen. Da erworbene Eigenschaften und Verhaltensweisen jedoch oftmals gerade nicht erblich sind, erscheint die Theorie im Ganzen nicht vollständig schlüssig.
In scharfem Gegensatz zu Spencer formuliert 1883 der Völkerpsychologe Moritz Lazarus (1824-1903) in Berlin seine Erholungstheorie.[35] Bei strenger Abgrenzung von Arbeit und Spiel wird erstere als Belastung und letzteres als Befreiung von dieser Belastung angesehen. Diametral zu Spencer wird hier also kein Energieüberschuss abgebaut, sondern ein Energiemangel aufgehoben. Lazarus impliziert eine jeweils unterschiedliche Funktion von Arbeit und Spiel sowie einen Selbstzweck und eine immanente Freude und Lust am Spiel. Diesem Ansatz entspricht in der pädagogischen Praxis der Einsatz des Spiels als Motivations-, Belohnungs- und Entspannungsmittel. Die Theorie wurde später noch um den Aspekt des menschlichen Bedürfnisses nach starken motorischen Aktivitäten erweitert (dieses Bedürfnis wird mit der Kompensation der in der Arbeitswelt vorherrschenden feinmotorischen Arbeitsabläufe motiviert). Zu Skepsis mahnt allerdings in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass auch ein stark grobmotorisch geprägter Arbeitsinhalt die Motivation zum Spiel nicht verdrängt und auch etliche Kinderspiele wie Zeichnen oder Bauen als feinmotorisch anspruchsvoll angesehen werden müssen.
Karl Groos (1861-1946) schließlich arbeitet in seinen ab 1901 veröffentlichten theoretischen Betrachtungen zum Spiel den Evolutionsgedanken noch expliziter aus als Spencer oder Hall und stützt sich dabei auf Beobachtung und Vergleich von Spiel bei Mensch und Tier.[36] Grundgedanke ist hier die Vorstellung, dass durch das Spiel ererbte, jedoch unvollständige Instinkte vervollständigt und eingeübt werden. Zum einen beschreibt Groos das Spiel als Vorübungsfunktion für das Leben und unterscheidet dabei Bewegungs- oder Instinktspiele sowie Experimentier- und Nachahmungsspiele. So übt das Jungtier seine Motorik und erlernt durch Kampf- und Jagdspiele die erforderlichen Fähigkeiten für den späteren Nahrungserwerb, analog bereiten sich Kinder durch Puppen- oder Berufsspiele auf ihre zukünftigen Rollen im Erwachsenenalter vor.
Eine besondere Rolle bei der Nachahmung spielt dabei das Einüben der Sprache, welche von Groos als die wesentliche Kulturleistung betrachtet wird. Des Weiteren schreibt Groos dem Spiel eine Ergänzungsfunktion zu. Ausgehend von der in hoch entwickelten Gesellschaften etablierten Arbeitsteilung und einer damit einhergehenden einseitigen Existenz des Menschen bietet das Spiel dem Erwachsenen eine Bereicherung dieser Existenz. So können auf spielerische Weise entweder durch eigenes Handeln oder durch das Beobachten und Miterleben des Spielens Anderer verschiedene Lebensentwürfe und Handlungsmöglichkeiten ohne ernste Konsequenzen ausprobiert werden. Groos bezeichnet dieses Miterleben als ästhetisch und vergleicht es mit dem Genuss eines Kunstwerks. Zuletzt schreibt Groos dem Spiel beim schulpflichtigen Kind und beim Erwachsenen auch eine Entspannungsfunktion zu, die es den Spielern ermöglicht, sich von der Anspannung und dem Druck der zweckgerichteten Schul- bzw. Arbeitssituation zu befreien. Einerseits besticht Groos’ Theorie durch ihren umfassenden Erklärungsanspruch, andererseits erscheint es durch die Erkenntnisse der modernen Entwicklungspsychologie zweifelhaft, ob Kinder- und Erwachsenenspiel in dieser Weise vergleichbar sind.
3.3. Moderne Spieltheorien
Die phänomenologische Spieldeutung, die zu Beginn dieses Abschnitts besprochen werden soll, hebt das Spiel als eigenständiges Urphänomen und primäre Lebenskategorie hervor. Vertreter für diese Denkweise sind unter anderem der niederländische Kulturhistoriker Johan Huizinga (1872-1945), der Erziehungswissenschaftler Hans Scheuerl (1919-2004) und der Surrealist und Soziologe Roger Caillois (1913-1978). Die Hauptleistung der phänomenologischen Spielforschung ist in ihrer definitorischen Arbeit und ihren Beiträgen zur Spielmerkmalsbestimmung zu sehen. Als eine besondere Leistung dieser Deutungsrichtung ist das Herausstellen der intrinsischen Motivation zum Spiel im Kontrast zu anderen Zielvorstellungen hervorzuheben. Nachdem die beiden zuerst genannten Autoren bereits im Rahmen der Begriffsbestimmung eingehend besprochen wurden,[37] soll an dieser Stelle ein kurzer Überblick zu Caillois’ Kategoriebildung genügen. Caillois beschreibt Spiele als Indikatoren für die Entwicklung von Gesellschaften und unterscheidet vier Haupttypen: das Schaffen künstlicher Chancengleichheit im Wettkampf, Agon; mit der ähnlichen Zielsetzung zur Chancengleichheit die Herstellung von Zufall im Zufallsspiel, Alea; das Eintauchen in eine andere Spielwelt im Maskenspiel, Mimikry, sowie eine weitere Möglichkeit der Wirklichkeitsflucht mit dem Mittel des Rausches, Ilinx.[38]
Rimmert van der Kooij nennt in seinem historischen Abriss des Weiteren als wichtige Vertreter phänomenologischer Theorien Andreas Flitner, Edith Vermeer, Frederik Buyytendijk und schließlich Jean Chateau. Als gemeinsame Ausgangspunkte der genannten Autoren verweist van der Kooij auf die These der Zielgerichtetheit, die in jedem Verhalten enthalten sei, auf die Wichtigkeit des jeweiligen Kontexts, den es zu analysieren gilt, auf den dialogischen Charakter von Mensch und Umwelt sowie auf das immer wieder auftauchende Moment der Bewegung bei der Betrachtung des Spiels.[39]
Wegen ihrer Bedeutung für die später darzustellende pädagogische Praxis wird die Spielklassifikation von Jean Chateau hier überblicksartig dargestellt. Chateau bevorzugt eine Spielkategorisierung aufgrund von Querschnitten und unterscheidet zunächst zwei Hauptgruppen: Spiele ohne Regeln sowie Spiele mit Regeln. Erstere sind vor allem bis zum Alter von sieben Jahren anzutreffen und werden von Chateau weiter klassifiziert in Spiele auf dem Niveau konkreter Intelligenz einerseits , unter die er Funktionsspiele, hedonistische Spiele, explorative Spiele und Manipulationsspiele subsumiert, und Selbstbestätigungsspiele mit den Unterordnungen Zerstörungsspiele und Entladungsspiele andererseits. Bei den Spielen mit Regeln ab einem Alter von sieben Jahren klassifiziert er zum einen Spiele mit Wirklichkeitselement mit den Unterkategorien der figurativen, objektiven und abstrakten Spiele sowie zum anderen die Gruppe der kooperativen Spiele.[40] An der beschriebenen Einteilung ist zu kritisieren, dass eine Zuordnung einzelner Spiele oft nicht eindeutig möglich ist, was die Vergleichbarkeit von Spielen untereinander erschwert und das Konzept als Ganzes als nicht vollständig plausibel erscheinen lässt. Hervorzuheben ist hingegen die explizite und selten zu findende Erwähnung kooperativer Spiele, die, wie sich später zeigen wird, für die vorliegende Arbeit besondere Relevanz haben.
Als nächstes bietet es sich an, einen Blick auf die Spieltheorie von Charlotte Bühler (1893-1974) zu werfen. Bühler unterscheidet zwei wesentliche Phasen bei der Entwicklung des Kindes. Zunächst bildet das Kind in der Phase der Funktionsformung seine sensomotorischen Fähigkeiten aus. Dies geschieht mit Hilfe des Funktionsspiels, worunter die rhythmische und regelmäßige Wiederholung von Bewegungsmustern verstanden werden kann. Nach dem Erwerb der entsprechenden Fähigkeiten kommt es zur Phase der Funktionsbetätigung, in der das Kind das in der Umwelt auffindbare Material formt und bearbeitet. Bühler leitet aus diesen Prozessen eine Definition ab und kommt zu dem Schluss:
Spiel also definieren wir als Bewegung mit intentionalem Bezug auf die Lust der Bemeisterung, und wir können nunmehr sagen, daß das Spiel der Ort ist, an dem Intention auf ein Fundamentalprinzip des Lebens gewonnen wird.[41]
Neben dem Funktionsspiel bilden sich laut Bühler im Laufe der Entwicklung weitere Spielformen heraus: das Fiktionsspiel, wie z.B. das Schlüpfen in Rollen, Rezeptionsspiele, wie Lesen oder Theaterbesuche, sowie Konstruktionsspiele, etwa das Bauen und Zeichnen. Eine besondere Bedeutung erlangen dabei zunächst die Betrachtung, Entdeckung und Interpretation der Spielschaffensprodukte, später dann das Streben nach Übereinstimmung mit der Wirklichkeit und schließlich die soziale Komponente der Spielformen. Bühlers Theorie zeigt deutlich die wichtige Rolle der Beherrschung des sensomotorischen Apparates im Zusammenhang mit dem Spielverhalten. Diese Ausrichtung bildet allerdings als allzu einseitige Perspektive auch einen Kritikpunkt, genauso wie der Umstand, dass viele Formen vermeintlichen Funktionsspiels, wie Kriechen, Laufen oder Springen, durchaus ernst, rein zweckdienlich und unspielerisch auftreten können.
Ein Ansatz, der ebenfalls stark auf die Wechselwirkung zwischen Umwelt und Spieler abstellt, ist der des österreichischen Verhaltensforschers Irenäus Eibl-Eibesfeldt (*1928).[42] Dieser legt seinen Fokus auf die Interaktion und beschreibt das Spiel als Dialog mit der Umwelt. Angetrieben von der Neugier nähern sich sowohl Mensch als auch Tier unbekannten Objekten in ihrer Umwelt, um sich mit ihnen vertraut zu machen und sich auf diese Weise angemessene Umgangsweisen und Interaktionsformen anzueignen. Damit werden die vormals unbekannten Objekte zu Spielgegenständen bzw. Spielpartnern. Das wesentlich differenziertere Spielverhalten des Menschen gegenüber dem Tier erklärt Eibl-Eibesfeldt durch die weit geringere Instinktabhängigkeit.
Wie die soeben besprochenen Theorien sind auch die nachfolgenden Entwürfe als Klassiker zu bezeichnen, jedoch sind sie für die hier besprochene Thematik von besonderer Bedeutung und werden daher ausführlicher behandelt.
3.3.1. Die kognitive Spieltheorie Jean Piagets
Der Schweizer Psychologe Jean Piaget (1896-1980) sieht die Entwicklung des Spielens parallel zu dem bekannten von ihm entwickelten kognitiven Entwicklungsmodell. Die wesentlichen Hauptbegriffe seiner Spieltheorie sind demnach die Systeme der Assimilation und Akkommodation. Diese bilden einen ständig rückkoppelnden Regelkomplex, der der Anpassung des Kindes dient und Adaption genannt wird. Während unter Assimilation die Anpassung der Umwelt an die jeweiligen eigenen geistigen Schemata verstanden wird, erklärt die Akkommodation das Anpassen eines Schemas oder einer Struktur an die jeweilige Situation oder den jeweiligen Gegenstand. Überwiegend akkommodatives Verhalten führt nach Piaget zu Imitation, während ein Übergewicht an Assimilation zu Spiel führt. Nachahmungsverhalten erfordert also zunächst die Akkommodation der Umgebung, wobei dieses Verhalten dann bei zunehmender Beherrschung des jeweiligen Materials in Assimilation übergeht und dann Spiel genannt werden kann. Spiel stellt sich somit dar
als Ausdehnung der Assimilationsfunktion über die Grenzen der aktuellen Anpassung hinaus.[43]
Piagets Stadien der Denkentwicklung lassen sich wie folgt den entsprechenden Stadien der Spielentwicklung zuordnen: Im sensomotorischen Stadium im Alter vom 2. bis zum 18. Lebensmonat überwiegt das Übungsspiel, in der kognitiven Entwicklungsstufe des verbalen und anschaulichen Denkens vom 2. bis zum 7. Lebensjahr ist das Symbolspiel die vorherrschende Spielform, es wird schließlich in der Phase der konkret operationellen Intelligenz vom 7. bis zum 11. Lebensjahr vom Regelspiel abgelöst, wobei Piaget das Symbolspiel als den „Höhepunkt des Kinderspiels“ ansieht.[44]
Beim Übungsspiel handelt es sich erstens um aus Freude an der Übung wiederholte Handlungen, die aus ihrem ursprünglich zielgerichteten Kontext herausgelöst wurden und von Piaget einfache Übungsspiele genannt werden. In einer zweiten Klasse werden Spiele zusammengefasst, die die genannten zwecklosen Handlungen kombinieren, dementsprechend ihre Bezeichnung als Kombinationen ohne Zweck. Eine dritte Gruppe bilden dann Kombinationen mit Ziel, dabei handelt es sich jedoch zunächst nur um ein spielerisches Ziel. Diese drei Klassen zweckfreier Spielübungen sind jedoch
im Wesentlichen unstabil, insofern als sie keinerlei wirkliches Interesse für den Inhalt dieses Denkens enthalten. Sobald ein solches Interesse wiederauftauchen würde, würde aus dieser zweckfreien Kombination ein Symbolspiel werden.[45]
Auch für die Kategorie des Symbolspiels unterscheidet Piaget verschiedene Stadien, Typen und Unterkategorien und belegt diese mit Beispielen.[46] Im ersten Stadium bis zum 5. Lebensjahr differenziert er drei Typen: Typ I, die Projektion von symbolischen Schemata sowie von Imitationsschemata auf neue Objekte, wie z.B. das Füttern einer Puppe; Typ II, die Assimilation von Objekten sowie die Selbstassimilation an Objekte oder Andere, wie z.B. die Imitation eines Tieres; schließlich Typ III, der die Spielarten symbolischer Kombinationen bezeichnet. Das nächste, zweite Stadium ist geprägt von zunehmender Komplexität, Ordnung und Kohärenz der Spielhandlungen und ist dem Alter zwischen dem 4. und 8. Lebensjahr zuzuordnen. Weitere Merkmale dieses Stadiums sind die exaktere Imitation der Wirklichkeit im Spiel sowie zunehmende Sozialisation durch differenziertere und präzisere Rollenübernahmen. Das letzte Stadium im Rahmen der Symbolspiele ist zwischen dem 7. und 8. sowie dem 11. und 12. Lebensjahr anzusiedeln und
ist gekennzeichnet durch einen Rückgang der Symbolik zugunsten entweder der Regelspiele oder der symbolischen Konstruktionen, die immer weniger deformierend sind und sich immer mehr und mehr der zielgerichteten und angepassten Arbeit nähern.[47]
Dieses Stadium ist also als Übergangsphase zu verstehen, in der die direkte und exakte Nachahmung der Wirklichkeit in den Vordergrund tritt. Dementsprechend führt Piaget aus:
Das Symbol ist also Wirklichkeit geworden, und dieses dient nicht mehr der Assimilation an das Ich, sondern der Adaption an die Wirklichkeit […].[48]
Unter den Regelspielen subsumiert Piaget schließlich zum einen sensomotorische Kombinationsspiele, wie Lauf- oder Ballspiele, und zum anderen intellektuelle Kombinationsspiele, wie Karten- oder Brettspiele. Als grundlegendes Charakteristikum nennt er den Wettstreit, da dieser erst eine Regelung notwendig mache. Regelspiele setzen sich auch im Erwachsenenalter fort und entwickeln sich im Rahmen zunehmender Sozialisation und Disziplin weiter.
Jean Piagets entwicklungspsychologische Sichtweise auf das Spiel ist zweifellos in vielerlei Hinsicht überzeugend, dennoch ist zu hinterfragen, dass er zum einen das Spiel vornehmlich als Funktion des Denkens anstatt als konstituierende Grundvoraussetzung für dasselbe ansieht, zum anderen scheint die dargestellte Abfolge der einzelnen Phasen zu starr, da entsprechende äußere Bedingungen durchaus Variationen erwarten lassen. Im Hinblick auf die später zu besprechenden Spiele fällt auf, dass Piaget in seiner Definition von Regelspiel den Wettkampf als zwingendes Merkmal nennt, es existieren jedoch zweifellos Spielmodelle, die zwar Regelwerken unterworfen sind, aber dennoch keinen Wettkampfcharakter tragen, wie die im dritten Teil der vorliegenden Arbeit vorgestellten Kooperationsspiele.
3.3.2. Psychoanalytische Spieltheorien
Auch Sigmund Freud (1856-1939) und seine Nachfolger innerhalb der psychoanalytischen Schule, insbesondere Erik Erikson (1902-1994), haben sich mit dem Phänomen Spiel beschäftigt. Ursprünglich ausgehend vom Lustbegriff, der sich in der freudschen Phasenlehre herausbildete, bieten sich das Lustprinzip und andere dynamische tiefenpsychologische Prozesse für die Erklärung von Spielverhalten an. Das Spiel ist demnach besonders geeignet, Unlustsituationen zu vermeiden und den angestrebten Lustgewinn zu erreichen. Dabei kann es sich um Trieb-, Phantasie-, Wunsch- oder Alternativbefriedigung handeln. Da Kinder aber offenbar auch eindeutige Unlustsituationen, wie etwa einen Arztbesuch, spielend wiederholen, muss ein weiteres Erklärungsmodell hinzugezogen werden. Hierbei handelt es sich um das Prinzip des Wiederholungszwangs. Durch diesen gelingt es, passiv Erlebtes durch zwanghaftes Wiederholen in einer nun aktiven Rolle aufzuarbeiten und doch noch zu assimilieren. In freudscher Sprache ausgedrückt fungiert der Wiederholungszwang also als Mittler zwischen dem Es und dem Ich, um dem Ich eine adäquate Verarbeitung zu ermöglichen und es zu stärken. Das Spiel ließe sich demnach auch als Mittel der Angstabwehr deuten, da durch das beschriebene Assimilationsverfahren Angst auslösende Reizüberflutungen vermieden und durch Angst angestaute Energie in Form von Bewegung abgeleitet werden kann. In „Kindheit und Gesellschaft“ beschäftigt sich Erikson neben der Lustbefriedigung und der Angstabwehr vor allem mit der bereits erwähnten Stärkung und Ausbildung des Ichs und dessen Orientierung in der Umwelt, was letztendlich zur Identitätsbildung führt.[49]
Des Weiteren erscheint für die Betrachtung des Spiels die Symboltheorie der Psychoanalyse relevant, die eine psychoanalytisch zu beschreibende Persönlichkeitsentwicklung voraussetzt. Analog zur freudschen Phasenlehre ließen sich demnach die psychosexuellen Phasen der Spielentwicklung anhand der jeweils vorherrschenden Spiele unterscheiden, nämlich Präödipale Spiele, Ödipale Spiele und Postödipale Spiele.[50]
Neben dem bereits dargestellten Doppelprinzip von Lust und Wiederholung sowie als Mittel der Angstabwehr treten in weiteren psychoanalytischen Ansätzen zusätzliche Funktionen des Spiels zu Tage, so dass dem Spiel Multifunktionalität zugeschrieben werden kann. So beschreibt Melanie Klein als Funktionen von Spiel z.B. den Abbau von Masturbationsphantasien, Sublimierung oder die Wiedergutmachung von Destruktionsakten.[51]
Bekannte grundlegende Kritikansätze gegenüber der Psychoanalyse lassen sich auch auf die hier dargestellten Denkmodelle übertragen. So sind die jeweiligen Spielinterpretationen höchst subjektiv und neigen zu polarisierten Einschätzungen und Bewertungen, weshalb vor Überinterpretationen gewarnt werden sollte.
3.3.3. Dialektische Spieltheorie nach Brian Sutton-Smith
Zusammenfassend lässt sich bis hierhin bemerken, dass sich unter den bereits vorgestellten Theorien kein Ansatz befindet, mit dem jedes Spielverhalten erklärt werden kann. Kritische Einwände wurden an der jeweiligen Stelle bereits formuliert, und es zeigt sich, dass die unterschiedlichen Theorien zum Teil auch untereinander widersprüchlich sind. Bei einem so komplexen und vielschichtigen Phänomen wie dem Spiel erscheint es jedoch angebracht, die jeweiligen spieltheoretischen Ansätze der Situation entsprechend nebeneinander einzusetzen, um in der Praxis sinnvolle Rückschlüsse und Handlungsbegründungen ziehen zu können, anstatt die spieltheoretischen Auffassungen gegeneinander zu nutzen und damit eine Synthese anzustreben, die unbefriedigend bleiben muss.
Als herausragend für die pädagogische Praxis im Allgemeinen und die Thematik dieser Arbeit im Besonderen erscheint der integrative spieltheoretische Beitrag von Brian Sutton-Smith, der daher an dieser Stelle ausführlicher behandelt werden soll. In seiner Arbeit von 1978 fasst Sutton-Smith unter anderem die Ergebnisse bereits vorher veröffentlichter Publikationen zusammen. Schon der Titel „Die Dialektik des Spiels“ weist auf den zentralen Ansatz hin, Sutton-Smith führt entsprechend in der Einleitung aus:
Das Wort „Dialektik“ soll zum Ausdruck bringen, dass Spiel am besten in den Begriffen des Konflikts verstanden werden kann. Diese Arbeit betrachtet es deshalb als eine Art der Konfliktlösung.[52]
Sutton-Smith beschäftigt sich zunächst mit den biologischen, kulturellen und psychologischen Voraussetzungen des Spiels, welche sich folgendermaßen zusammen fassen lassen: Die Wahrscheinlichkeit von Spielverhalten erscheint proportional zu einer hinausgezögerten Reifungsperiode, eine behütete und sichere Umgebung begünstigt exploratives Verhalten sowie das Auftreten mittlerer Erregungsgrade. Dies fördert komplexe Lernformen und damit flexiblere Überlebenstechniken. Kinder, die mit anregenden Stimuli versorgt werden, regen wechselwirksam ihre Eltern an, diese Stimuli zu erbringen, und werden auch später höhere Stimulationsgrade anstreben. Zunächst ausgiebiges exploratives Verhalten ist Voraussetzung für das Spiel im Allgemeinen, für das soziale Spiel müssen des Weiteren Techniken der Einflussnahme und Vertrautheit mit Anderen verfügbar sein. Als wichtigsten spielbedingenden Einzelfaktor nennt Sutton-Smith die Prägung durch Vorbilder wie Eltern oder peers, wobei die Komplexität der Spiele mit der Komplexität der Anforderungen und Anregungen von Erziehung und Umgebungskultur steigt.
Sutton-Smith geht weiterhin auf die anfangs erwähnte Hauptthese seiner Theorie ein, wonach Spielen und Spiele in einem dialektischen Bezugsrahmen beschrieben werden können, mit dem im Alltagsleben unlösbare Konflikte gelöst werden; er führt aus:
Das Spiel transzendiert die gewöhnlichen Gegensätze und stellt auf einer neuen Ebene einen neuen Gegensatz und dessen Lösungsmöglichkeit dar. [...] In der Struktur von Spielen treten dabei besonders die Gegensätze zwischen Ordnung und Unordnung, Annäherung und Zurückweisung, Erfolg und Niederlage auf.[53]
An anderer Stelle macht er außerdem die Relevanz der persönlichen Aktivität deutlich, indem er erklärt:
Zusammenfassend können wir das Spiel in seiner strukturellen Dimension definieren als ein Ereignis, das eintritt, wenn ein Individuum die gewohnte Machtverteilung umkehrt und unter lebhafter persönlicher Teilnahme eine modellhafte Erfahrung sich vorstellt oder inszeniert.[54]
Die wesentlichen Thesen zu seiner Untersuchung der dialektischen Spielstruktur lassen sich wie folgt darstellen: Spiel ist als Teil eines überzuordnenden Bereiches frei gewählten Verhaltens anzusehen. Den vorherrschenden Interaktionsbedingungen und der intrinsischen Motivation entsprechend müssen unter Umständen durch vorausgehendes Explorationsverhalten Kompetenzen herausgebildet werden, deren Erwerb begünstigt gleichzeitig die Spannung im Spiel.
Wie Sutton-Smith schon in den bereits behandelten Spielvoraussetzungen andeutet, fördert ein stimulierendes Umfeld das Auftreten von Spiel, wobei sich die Motivation zu diesem aus bereits vorhandener mittlerer Erregung speist. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Spiels im Vergleich zum vorherigen bloßen Explorationsverhalten ist die Möglichkeit des Spielenden, nach dem Halten der Erregung auf hohem Niveau diese willkürlich und plötzlich zu reduzieren, wohingegen bei der Exploration ein stetiges Abnehmen der Spannung zu verzeichnen ist. Sutton-Smith fasst schließlich zusammen:
In seiner dialektischen Struktur transzendiert das Spiel (play) die Konflikte der affektiven Erfahrung; Spiele (games) hingegen transzendieren die Konflikte der zwischenmenschlichen Erfahrung. Das Spiel verkörpert die Dynamik des dramatischen Anstiegs und Abfalls von Spannung; Spiele ordnen diese Dynamik dem Drama der interpersonellen Beziehungen unter. [...] Das Spiel ist ein Teilbereich freigewählter Verhaltensformen, die einen selektiven Mechanismus einschließen, welcher die üblichen Machtbeziehungen umkehrt und damit dem Subjekt eine kontrollierbare und dialektische Simulation maßvoll unbewältigter Erregungen und Erregungsproduktionen des täglichen Lebens in einer entweder belebenden oder euphorischen Weise ermöglicht.[55]
Nach dieser strukturellen Analyse von Spiel und Spielen widmet sich Sutton-Smith funktionalen Aspekten. Demnach kann das Spiel vor allem als Erweiterung adaptiver Verhaltensmöglichkeiten angesehen werden. So entstehen kognitive Prototypen für zukünftiges Verhalten, indem der Spielende mögliche Verhaltensmuster antizipiert. Sutton-Smith versucht schließlich eine Synthese dieser dualen Erklärungsweise, also einerseits der dialektischen Struktur und andererseits der Funktion der Erweiterung des adaptiven Verhaltenspotentials. Dazu stellt er die These auf, dass die zuvor dargestellte Dialektik des Spiels primär auf die Beherrschung reversibler Handlungsstrategien abzielt, die sich dann auch auf andere kulturelle Funktionen übertragen lassen. Spiel sei demnach
diejenige freiwillige Aktion, die eine dialektische Struktur hat und reversible Handlungen ermöglicht.[56]
Diese Definition erlaubt eine Vielzahl von Implikationen für die pädagogische Praxis, mit denen sich auch Sutton-Smith beschäftigt und auf die später in der vorliegenden Arbeit zurückgegriffen wird.
[...]
[1] Diese bezeichnen eine in der Rechtstradition Ruandas fest verwurzelte, als Instrument des Ausgleichs widerstreitender Interessen dienende, nicht verschriftlichte und auf dörflicher Ebene organisierte Form der Justiz und sind nach dem Ort ihrer Verhandlung benannt („Gacaca“ = Rasen).
[2] Vgl. Lenhart, Volker: Pädagogik der Menschenrechte. Leske & Budrich, Opladen 2003 sowie dessen aktuelle Forschungsarbeit „Friedensbauende Bildungsmaßnahmen“.
[3] Vgl. u.a. Röhrs, Hermann: Die Friedenspädagogik im Modell der Internationalen Gesamtschule. Schroedel, Hannover 1975.
[4] Einsiedler, Wolfgang: Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels. Klinkhardt, Bad Heilbrunn/Obb. 1991, S. 9.
[5] Vgl. Scheuerl, Hans: Das Spiel – Untersuchungen über sein Wesen, seine pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen. Neuausgabe. [1954] Beltz, Weinheim/Basel 1979, S. IV.
[6] Scheuerl, Hans (Hg.): Das Spiel. Band 2. Theorien des Spiels. 11., überarb. und erg. Neuausg. Beltz, Weinheim/Basel 1991, S. 221.
[7] Vgl. Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23., erw. Aufl. bearb. von Elmar Seebold. Walther de Gruyter, Berlin 1995, S. 778 sowie Pfeifer, Wolfgang (Hg.): Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Band M-Z. Akademie Verlag 1993, S. 1324.
[8] Huizinga, Johan: Homo Ludens. Pantheon Akademische Verlagsanstalt, Amsterdam 1939, S. 60.
[9] Scheuerl, Hans: Das Spiel. Untersuchungen über sein Wesen, seine pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen. Neuausgabe. [1954] Beltz, Weinheim/Basel 1979, S. 129.
[10] Ebd., S. 131.
[11] Huizinga, Johan: Homo Ludens. Pantheon Akademische Verlagsanstalt, Amsterdam 1939, S. 61 (Sperrungen im Original).
[12] Vgl. Dudenredaktion (Hg.): Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 8. Dudenverlag, Mannheim 1999, S. 3644ff.
[13] Vgl. Grimm, Jacob / Grimm, Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. Band 16. dtv, München 1984, S. 2275ff.
[14] Bibliographisches Institut (Hg.): Meyers Enzyklopädisches Lexikon. Band 22. Bibliographisches Institut, Mannheim 1979, S. 286.
[15] Huizinga, Johan: Homo Ludens. Pantheon Akademische Verlagsanstalt, Amsterdam 1939, S. 21.
[16] Vgl. Scheuerl, Hans: Das Spiel. Untersuchungen über sein Wesen, seine pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen. Neuausgabe. [1954] Beltz, Weinheim/Basel 1979, S. 68f.
[17] Vgl. Hering, Wolfgang: Spieltheorie und pädagogische Praxis. Zur Bedeutung des kindlichen Spiels. Schwann, Düsseldorf 1979, S. 41f.
[18] Einsiedler, Wolfgang: Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels. Klinkhardt, Bad Heilbrunn/Obb. 1991, S. 17.
[19] Vgl. Einsiedler, Wolfgang: Spiel. In: Hierdeis, Helmwart / Hug, Theo (Hg.): Taschenbuch der Pädagogik Band 4. 4., vollst. überarb. und erw. Aufl. Schneider-Verlag, Hohengehren 1996, S. 1413-1422, hier: S. 1413.
[20] Ebd.
[21] Vgl. Csikszentmihalyi, Mihaly: Das Flow-Erlebnis. Klett-Cotta, Stuttgart 1985.
[22] Van der Kooij, Rimmert: Die psychologischen Theorien des Spiels. In: Kreuzer, Karl Josef (Hg.): Handbuch der Spielpädagogik. Band 1. Schwann, Düsseldorf 1983, S. 297-336, hier: S. 302.
[23] Vgl. Van der Kooij, Rimmert: Die psychologischen Theorien des Spiels. In: Kreuzer, Karl Josef (Hg.): Handbuch der Spielpädagogik. Band 1. Schwann, Düsseldorf 1983, S. 297-336, hier: S. 302f.
[24] Vgl. Scheuerl, Hans: Zur Begriffsbestimmung von „Spiel“ und „spielen“. In: Röhrs, Hermann (Hg.): Das Spiel, ein Urphänomen des Lebens. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden 1981, S. 41-49, hier: S. 46.
[25] Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass der Terminus „Spieltheorie“ des Weiteren eine Theorie innerhalb der Mathematik bzw. Wirtschaftslehre bezeichnet, mit der man unter Zuhilfenahme mathematischer und kybernetischer Techniken Situationen analysiert, die Entscheidungsprobleme beinhalten. Vgl. Fuchs-Heinritz, Werner (Hrsg.): Lexikon zur Soziologie. Westdeutscher Verlag, Opladen 1994, S. 633f.
[26] Vgl. Scheuerl, Hans: Beiträge zur Theorie des Spieles. Bearbeitet von Hans Scheuerl. [1955] Beltz, Weinheim/Berlin/Basel 1969, S. 6f.
[27] Vgl. Kreuzer, Karl Josef: Zur Geschichte der pädagogischen Betrachtung des Spielens und der Spiele. In: Kreuzer, Karl Josef (Hg.): Handbuch der Spielpädagogik. Band 1. Schwann, Düsseldorf 1983, S. 229-280, hier: S. 237 sowie Goßmann, Klaus (Hg.): Auf den Spuren des Comenius. Vandenhoek und Ruprecht, Göttingen 1992.
[28] Vgl. Rousseau, Jean-Jacques: Emil oder über die Erziehung. [1762] Schöningh Verlag, Paderborn 1998.
[29] Vgl. Guts-Muths, Johann C.F.: Gymnastik für Jugend. Nach der Originalausgabe von 1793. Limpert, Dresden 1928.
[30] Vgl. Kant, Immanuel: Über Pädagogik. [1803] Klinkhardt, Bad Heilbrunn/Obb. 1960.
[31] Schiller, Friedrich: Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Fassung von 1801. Klinkhardt, Bad Heilbrunn/Obb. 1960, S. 41.
[32] Vgl. Fröbel, Friedrich: Ausgewählte Schriften. Zweiter Band. Die Menschenerziehung. [1826] Klett-Cotta, Stuttgart 1982.
[33] Vgl. Spencer, Herbert: The Principles of Psychology. [1897] Gregg, Westmead 1970.
[34] Vgl. Hall, G. Stanley: Adolescence. Appleton, New York 1897.
[35] Vgl. Köhnke, Klaus Christian (Hg.): Grundzüge der Völkerpsychologie und Kulturwissenschaft. Moritz Lazarus. Meiner, Hamburg 2003.
[36] Vgl. Groos, Karl: Die Spiele der Tiere. Fischer, Jena 1896 sowie Groos, Karl: Die Spiele des Menschen. Fischer, Jena 1899.
[37] Vgl. Kap. I. 2.
[38] Vgl. Caillois, Roger: Die Spiele und die Menschen. Maske und Rausch. [1958] Ullstein, Berlin 1982.
[39] Vgl. van der Kooij, Rimmert: Die psychologischen Theorien des Spiels. In: Kreuzer, Karl Josef (Hg.): Handbuch der Spielpädagogik. Band 1. Schwann, Düsseldorf 1983, S. 297-336, hier: S. 304f.
[40] Vgl. Chateau, Jean: Das Spiel des Kindes. Natur und Disziplin des Spielens nach dem dritten Lebensjahr. Schöningh, Paderborn 1969.
[41] Bühler, Charlotte: Kindheit und Jugend Genese des Bewusstseins. 3., umg. und erw. Aufl. Hirzel, Leipzig 1931, S. 71.
[42] Vgl. Eibl-Eibesfeldt, Irenäus: Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung. Ethologie. 8., überarbeitete Auflage. Piper, München/Zürich 1999.
[43] Piaget, Jean: Nachahmung, Spiel und Traum. Die Entwicklung der Symbolfunktion beim Kinde. Gesammelte Werke 5. Studienausgabe. Klett, Stuttgart 1975, S. 127.
[44] Vgl. Piaget, Jean / Inhälder, Bärbel: Das symbolische Spiel. In: Flitner, Andreas (Hg.): Das Kinderspiel. Piper, München 1988, S. 130-132, hier: S. 130.
[45] Piaget, Jean: Nachahmung, Spiel und Traum. Die Entwicklung der Symbolfunktion beim Kinde. Gesammelte Werke 5. Studienausgabe. Klett, Stuttgart 1975, S. 156.
[46] Vgl. ebd., S. 157-183.
[47] Ebd., S. 181.
[48] Ebd., S. 183.
[49] Vgl. Erikson, Erik H.: Kindheit und Gesellschaft. Pan-Verlag, Zürich 1957.
[50] Vgl. Geckle, Roland: Spieltätigkeit und Spieldialektik. Dissertation. Psychologisches Institut der Freien Universität Berlin, Berlin 1994, S. 69ff.
[51] Vgl. Klein, Melanie: Die Psychoanalyse des Kindes. 2. Aufl. Reinhardt, München/Basel 1971, S. 21ff, 119ff.
[52] Sutton-Smith, Brian: Die Dialektik des Spiels – Eine Theorie des Spielens, der Spiele und des Sports. Karl Hofmann, Schorndorf 1978, S. 11.
[53] Ebd., S. 43.
[54] Sutton-Smith, Brian: Spiel und Sport als Potential der Erneuerung. In: Flitner, Andreas (Hg.): Das Kinderspiel. Neuausgabe. Piper, München 1988, S. 62-72, hier: S. 67.
[55] Sutton-Smith, Brian: Die Dialektik des Spiels. Eine Theorie des Spielens, der Spiele und des Sports. Karl Hofmann, Schorndorf 1978, S. 64.
[56] Ebd., S. 98.
- Arbeit zitieren
- M.A. Stephan Schmutz (Autor:in), 2004, Spiele als Medien der Friedenspädagogik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44904
Kostenlos Autor werden



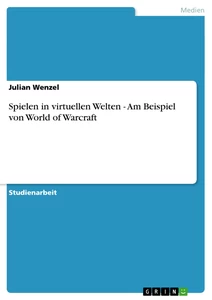

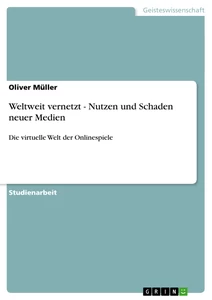


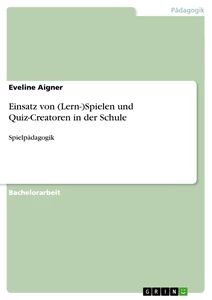







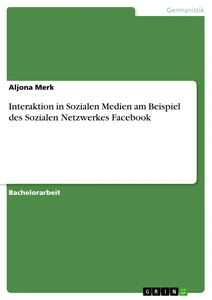



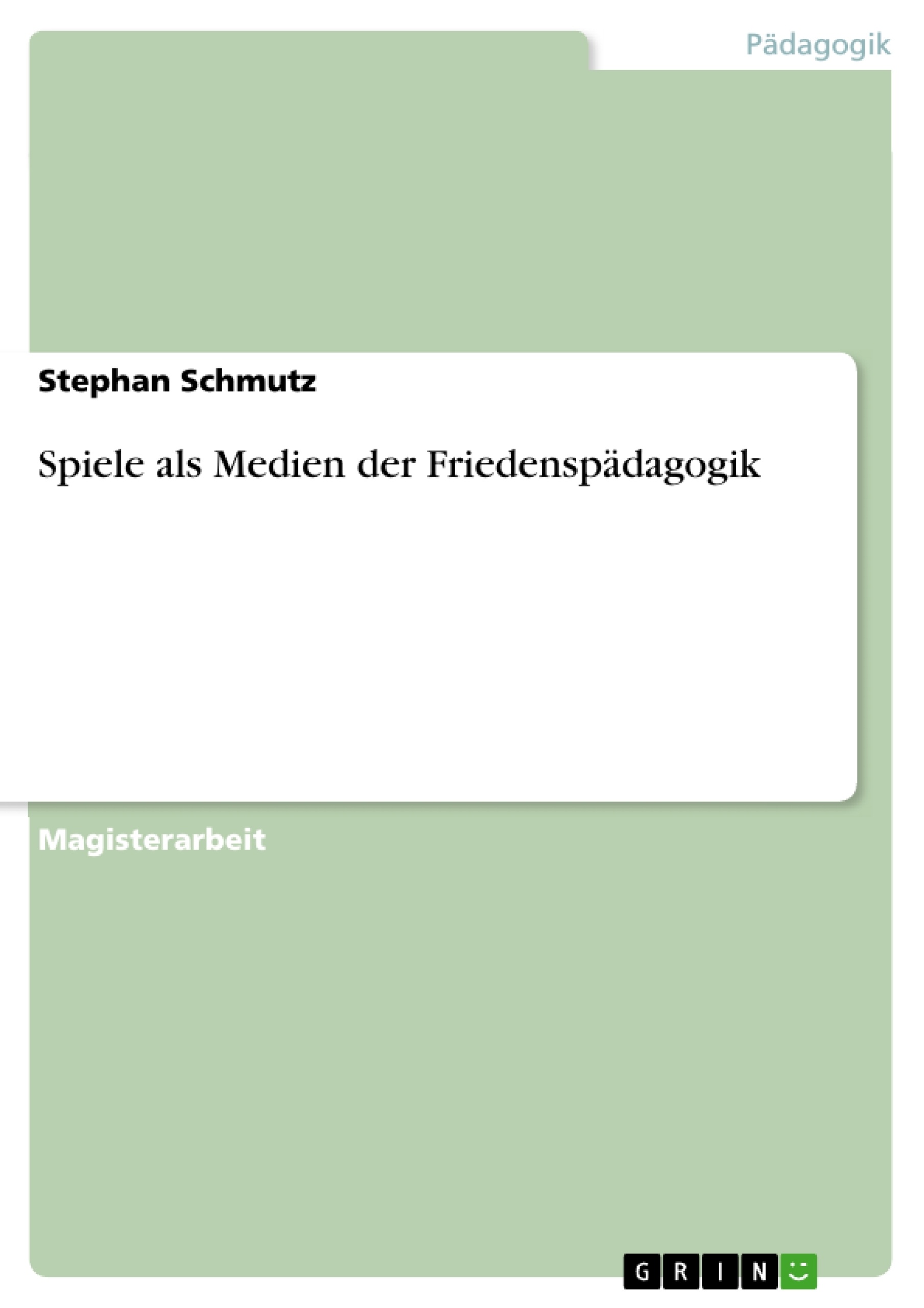

Kommentare