Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Forschungsstand
1.3 Vorgehen
2. Der Schmerz
2.1 Akuter versus chronischer Schmerz
2.2 Der chronische Rückenschmerz
3. Iatrogene F aktoren
3.1 Überdiagnostik
3.2 Informationsmängel
3.3 Vernachlässigung psychosozialer Faktoren
4. Zwischenfazit
5. Multimodale Schmerztherapie
5.1 Hintergrund
5.2 Anamnese
5.2.1 Fragebögen
5.2.2 Belastungstests
5.3 Körperliche Ebene
5.3.1 Graded Activity
5.3.2 Work Hardening
5.4 Psychologische Ebene
5.4.1 Entspannungsverfahren
5.4.2 Schmerztagebücher
5.5 Multimodale Interventionsprogramme im Vergleich
5.5.1 Göttinger Rücken-Intensiv-Programm
5.5.2 Münchner Rücken-Intensiv-Programm
5.5.3 Rückenfit-Programm
6. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichni S
Anhang A
Anhang В
Anmerkung: In der vorliegenden Bachelorthesis wird aufgrund der leichteren Lesbarkeit die allgemein bekannte männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen benutzt. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts impliziert und lediglich im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral aufzufassen ist.
1. Einleitung
Der Rückenschmerz wird inzwischen von Vielen als Epidemie (Raspe & Kohlmann, 1993, S. 2920), medizinisches Desaster (Waddell, 2004, S. 1) oder Volkskrankheit (Rendenbach, 2007, S. 101) bezeichnet. Bis vor 100 Jahren existierte kaum bis wenig Literatur über das Thema „Rückenschmerz“. Vor allem der Lebenswandel in den Industrieländern; darunter Rauchen, Bewegungsmangel und Übergewicht sind eines der Gründe, weshalb Krankheiten der Wirbelsäule stetig zugenommen haben (Den- ner, 1997, S. 214), aber auch Sozialsysteme müssen laut Strohmeier (2011, S. 263) als Faktor betrachtet werden. Das Ausmaß dieser „Volkskrankheit“ wird auch in den Zahlen etlicher Studien deutlich. In der Literatur gibt es mehrere Quellen, die Zahlen zur Häufigkeit von Rückenschmerzen in Deutschland angeben, sie zeigen jedoch alle eine übereinstimmende hohe Prävalenz (Rendenbach, 2007, S. 101), (Fahland, Kohlmann & Schmidt, 2016, S. 6). Laut der Gesundheitsberichterstattung des Bundes liegt die Punktprävalenz von Rückenschmerzen bei 30-40 %, während es in einem Zeitraum von 12 Monaten schon ca. 60-76 % betrifft. Eine noch größere Anzahl wird in Bezug auf die Lebenszeitprävalenz erreicht, hier sind es 74-85 % der Bevölkerung, die mindestens einmal in ihrem Leben an Rückenschmerzen leiden (Raspe, 2012, S. 12-13). Auch die entstehenden Kosten zeigen seit Jahren einen deutlichen Anstieg. So betrugen die Gesamtkosten für Rückenschmerzen in Deutschland in den letzten Jahren ca. 40 Milliarden Euro pro Jahr, was zur Verdeutlichung des Problems etwa 2.2 % des Bruttoinlandprodukts ausmacht. Rückenschmerzen stellen in unserer heutigen Gesellschaft somit eine gesundheitspolitische, aber auch sozioökonomische Herausforderung dar. Bei Rückenschmerzen muss zwischen zwei Arten unterschieden werden: dem akuten und dem chronischen Rückenschmerz. Der größere Teil der Kosten ist auf den chronischen Rückenschmerz zurückzuführen. Dabei wird der Hauptanteil der Kosten nicht durch die medizinische Versorgung verursacht, sondern durch volkswirtschaftliche Kosten, z. B. aufgrund vorzeitiger Berentungsfälle. Der Anteil der Behandlungskosten beträgt lediglich um die neun Milliarden Euro (15 %) (Bundesregierung, 2015, Abs. 3).
1.1 Problemstellung
Inzwischen wird davon ausgegangen, dass am Anfang der kausalen Kette von Rückenproblemen vor allem somatische Prozesse Stehen, während im späteren Verlauf andere Faktoren an Bedeutung gewinnen und den Prozess der Chronifizierung beeinflussen. Neben den psychosozialen Faktoren, für dessen Einfluss es inzwischen hinreichend Belege gibt, kommen iatrogene Faktoren hinzu (Waddell, 2004, S. 85). Braun (2017, Abs. 1) definiert iatrogen als „durch den Arzt verursacht“, genauer gesagt alle diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen, aber auch Aussagen von Medizinern, die zu Schädigungen führen. Ein iatrogener Schaden ist somit kein Effekt eines bereits bestehenden Krankheitsverlaufs, sondern ein eigenes Krankheitsbild (Braun, 2017, Abs. 1). Davon ausgehend kann auch im Stadion der Chronifizierung von einem eigenen Krankheitsbild ausgegangen werden, das nicht mehr nur auf somatische Ursachen zurückzuführen ist, sondern weitere ebenso, ja sogar einflussreichere Komponenten aufweist. Pither & Nicholas (1991, S. 588) untersuchten 89 Schmerzpatienten, während eines Schmerzprogramms und fanden heraus, dass 66 % der Teilnehmer unzweckmäßige Schmerzmittel und 54 % unangemessen Beruhigungsmittel verschrieben wurde. Bei 60 % konnte außerdem ein Übermaß an Diagnostik festgestellt werden, 70 % wurden falsche Informationen bezüglich ihres Schmerzes gegeben und 40 % der Schmerzpatienten wurden an einen Psychiater weiter verwiesen (Justins, 1995, S. 588). Ärzte und Therapeuten scheinen mit dem Phänomen Rückenschmerz immer noch überfordert zu sein. Es besteht eine Vielzahl an diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, die häufig unkontrolliert zur Anwendung kommen und Beschwerden nicht immer lindern, sondern auch verschlimmern können (Deemter, 2012, S. 16).
1.2 Zielsetzung und Forschungsstand
Pither & Nicholas haben bereits 1991 in ihrem Artikel „The identification of iatrogenic factors in the development of chronic pain syndromes - abnormal treatment behavior“ auf die Überforderung des medizinischen Systems, geeignete Maßnahmen für chronische Rückenschmerzpatienten zu finden, aufmerksam gemacht. Behandlerund Systemfaktoren, die zur Chronifizierung von Rückenschmerzen führen können, wurde in der Literatur bis heute wenig Beachtung geschenkt (Hasenbring & Pfingsten, 2007, S. 110). Es ist relevant neben der Patientenebene auch der Therapeuten- ebene die Aufmerksamkeit zu widmen, um das Ausmaß der Problematik zu verstehen und Betroffene aufzuklären. Diese Arbeit möchte in erster Linie auf die Existenz und die Folgen medizinischer Systemfehler bei der Behandlung von Rückenschmerzen hinweisen und auf die Problematik falscher Behandlungsansätze bei chronischen Rückenschmerzen hinweisen. Aus der diesbezüglichen Zielsetzung ergibt sich für diese Arbeit folgende Forschungsfrage:
Welche Rolle spielen iatrogene Faktoren bei der Chronifizierung von Rückenschmerzen und welche Interventionsmaßnahmen sind geeignet?
1.3 Vorgehen
Zu Beginn wird der Fachbegriff „Schmerz“ definiert und dessen Funktion und Dimension anhand der Gate-Control-Theorie und des bio-psycho-sozialen Modells näher beschrieben, bevor eine Abgrenzung zwischen dem akuten und dem chronischen Schmerz vorgenommen wird. Das Kapitel „Begriffsbestimmungen“ wird schließlich mit einer Eingrenzung des Fachbegriffs „Rücken“ und einer näheren Beschreibung des Phänomens „Chronischer Rückenschmerz“ abgeschlossen.
Im darauffolgenden Kapitel wird auf den ersten Teil der Forschungsfrage eingegangen. Dafür werden diverse Schwachstellen im medizinischen System dargelegt, die durch die Verursachung iatrogener Schäden Einfluss auf die Entstehung und Aufrechterhaltung der chronischen Rückenschmerzen nehmen. Das Kapitel „Iatrogene Faktoren“ legt den Fokus dabei auf die Punkte „Überdiagnostik“, „Informationsmangel“, sowie der „Vernachlässigung psychosozialer Faktoren“. Ein Zwischenfazit fasst daraufhin noch einmal die wichtigsten Punkte des vorangegangenen Inhalts zusammen und weist auf die Relevanz des darauffolgenden Kapitels zur Beantwortung des zweiten Teils der Forschungsfrage hin. Im Abschnitt zur „Multimodalen Intervention“ wird zunächst die Bedeutung eines multimodalen Konzepts für den Erfolg einer Therapie für chronische Rückenschmerzpatienten hervorgehoben, bevor anschließend unterschiedliche Behandlungsmaßnahmen vorgestellt werden, die dem bio- psycho-sozialen Gesamtkonstrukt gerecht werden. Der letzte Abschnitt des Kapitels stellt drei verschiedene multimodale Interventionsprogramme vor, die in Deutschland angeboten werden und sich durch einen hohen Wirkungsgrad bewiesen haben. Die Thesis endet mit einem Fazit, dass alle wesentlichen Ergebnisse für die Beantwortung der Forschungsfrage zusammenfasst und mit einem Ausblick abschließt.
2. Der Schmerz
Wird von der frühen Entwicklung der Menschen ausgegangen, so gehört der Schmerz zu den geläufigsten und stärksten Erfahrungen eines jeden Individuums (Kröner-Herwig, 2007, S. 7). Ob kurz und scharf, wenn das Papier eine Wunde in die Haut schneidet, dumpf und andauernd, aufgrund eines Lochs im Zahn, pochende Kopfschmerzen nach einem anstrengenden Arbeitstag oder ein drückendes Bauchgefühl nach einem „schmerzhaften“ Verlust. Jeder Mensch weiß aus eigener Erfahrung, was Schmerz ist, hat ihn schon einmal erlebt. Doch Schmerz zu definieren ist kompliziert, denn „Pain is always subjective“ (International Association for the Study of Pain, 2017, Abs. 3). Es existieren viele verschiedene Definitionen, doch die aktuell am häufigsten zitierte und weltweit anerkannte ist die der Weltschmerzorganisation IASP (2017, Abs. 3):
“Pain is an unpleasant sensory and emotional experience with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage“. An dieser Definition wird deutlich, dass Schmerz neben einer reinen Reizwahrnehmung noch viel mehr sein kann, nämlich ebenso ein unangenehmes Gefühlserlebnis, womit auch der emotionalen Komponente Aufmerksamkeit geschenkt wird. Schmerz darf nicht auf den somatischen Aspekt reduziert werden, vielmehr ist er als multifaktorielles Bedingungsgefüge zu verstehen (Sandner-Kiesling et ak, 2006, S. 52).
Dem uralten Phänomen Schmerz kommt eine überlebenswichtige Bedeutung zu, Glier (2002, S. 13) beschreibt das Schmerzsystem als eine „innere, hauseigene Alarmanlage“, die uns warnt, sobald der Sollbereich verlassen wird und uns antreibt, das Problem ausfindig zu machen und „ausschaltet“.
Laut Kröner-Herwig (2007, S. 8) weist die Definition der IASP allerdings auch Schwächen in zwei Punkten auf: es wird einerseits nicht zwischen chronischem und akutem Schmerz unterschieden und andererseits wird der Schmerz auf das Erleben beschränkt. Auch die beliebteste Definition von Schmerz ist somit noch zu knapp beschrieben. Besonders die Differenzierung von akutem und chronischem Schmerz ist für diese Arbeit von großer Bedeutung, weshalb im nächsten Kapitel näher darauf eingegangen wird.
Um ein modernes Verständnis für das Phänomen Schmerz zu vermitteln, wird im Folgenden auf die Gate-Control-Theorie von Melzack und Wall, sowie das biopsy cho-sozi ale Schmerzmodell eingegangen.
In der Theorie wird davon ausgegangen, dass das substantia gelatinosa im Hinterhorn des Rückenmarks wie eine Art Tor (engl.: gate) funktioniert. Bevor ein Schmerzreiz an das Gehirn weitergeleitet wird, muss dieser durch das Tor hindurch. Das Tor steht offen, wenn die Hinterhornneuronen durch die dünnen vegetativen Nervenfasern, die sogenannten А-delta- und C-Fasern erregt werden und die substantia gelatinosa nicht mehr in der Lage ist die Schmerzweiterleitung zu hemmen. Werden die Hinter- homneuronen durch die dicken somatischen Nervenfasern, die sogenannten A-beta- Fasern erregt, so folgt eine präsynaptische Hemmung der Schmerzleitung und das Tor bleibt geschlossen (Saha, 2006, S. 412). Häufig rufen Gefühle, Gedanken und Emotionen, wie Anspannung, Angst, Hoffnungslosigkeit oder Stress eine Öffnung des Tors hervor. Wiederum können Stress- und Schmerzbewältigungsstrategien das Tor schließen und die Schmerzweiterleitung hemmen (Glier, 2002, S.67). Somit geht die Gate-Control-Theorie davon aus, dass es einen Mechanismus gibt, der die Schmerzweiterleitung zum Gehirn verringern oder aufhalten kann, wodurch der Schmerz nicht wahrgenommen wird. Hinzukommt, dass psychologische Vorgänge, wie Emotionen, Erinnerungen oder Aufmerksamkeit, den Prozess und das sensorische Input maßgeblich beeinflussen. Die Schmerztherapie zielt darauf, dünne Fasern zu hemmen und dicke Fasern zu aktivieren, um das Tor zu schließen (Saha, 2006, S. 412). Betroffene können somit durch gezielte Schmerzbewältigungsstrategien und Übung zum eigenen Lenker des Tors werden. Die Gate-Control-Theorie hat sich, trotz kritischer Bemerkungen in den letzten Jahren, als multidimensionales Schmerzkonzept, das die Komplexität der multifaktoriellen Schmerzverarbeitung mit seinen physiologischen, psychologischen und soziokulturellen Komponenten in einen verständlichen Kontext fügt, bewiesen (Egle & Hoffmann, 1993, zitiert nach Sandner- Kiesling et ak, 2006, S. 52).
Ein weiteres Schmerzmodell, das in der wissenschaftlichen Literatur an großer Beliebtheit gewonnen hat und leicht verständlich ist, ist das bio-psycho-soziale Schmerzmodell, auf das im Folgenden kurz eingegangen wird.
Das bio-psycho-soziale Schmerzmodell ist ein multidimensionales Modell, das sich zur Erklärung chronischer Schmerzen als besonders geeignet erwiesen hat. Im Gegensatz zur Gate-Control-Theorie, wird hier neben der biologisch-physiologischen (Gewebsverletzung, Muskeldysbalancen, Übergewicht etc.) und psychischen Komponente (Stress, Angst, Hilflosigkeit, Depression etc.), auch eine soziale Komponente (interpersonelle Faktoren, Belastungen am Arbeitsplatz/in der Familie, Existenzsorgen, Verluste, schlechte Patient-Therapeut-Interaktion etc.) zur Erklärung von Schmerzen mit einbezogen (Egger, 2005, S. 3-4). Das Modell geht davon aus, dass eine individuelle Wechselwirkung zwischen allen drei Dimensionen herrscht und eher als dynamischer Verlauf, als ein Zustand gesehen werden kann, der zur Entstehung und Aufrechterhaltung einer Störung beiträgt (siehe Abbildung 1). Elmwelt und Organismus bilden dabei ein ganzheitliches dynamisches System. Der chronische Schmerz ist nie entweder somatisch oder psychisch, vielmehr geht es um das Zusammenspiel und Ausmaß der verschiedenen beteiligten Faktoren, die bei jedem Einzelnen anders verteilt sind (Sandner-Kiesling et ab, 2006, S. 54). Das bio-psychosoziale Modell beinhaltet ein modernes Menschenbild, dessen Integrität in die medizinische Diagnostik und Therapie jedoch noch nicht vollkommen gelungen ist (Wüchse & Bach, 2011, S. 411-412).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1.: Muffel, o. J.: Bildliche Darstellung des bio-psycho-sozialen Modells
2.1 Akuter versus chronischer Schmerz
Der Schmerz wird im vorherigen Kapitel als eine Art hauseigene Alarmanlage beschrieben, die in ihrer Warn- und Schutzfunktion einen bedeutenden Sinn und Zweck für die Gesundheit erfüllt. Nach dem „ausschalten“ dieser Alarmanlage ist der Schmerz im Normalfall verschwunden und das Problem gelöst. Dieser Fall beschreibt den so genannten akuten Schmerz. Dieser wird meist durch klar feststellbare innere/äußere Verletzungen oder Entzündungen hervorgerufen und hat somit die Aufgabe, eine aktuelle oder potentielle Gewebsschädigung zu identifizieren. Neben der Warn- und Schutzfunktion besitzt der akute Schmerz eine Rehabilitationsfunktion, die bei schweren Erkrankungen heilungsförderndes Verhalten auslösen kann. Die Rehabilitationsfunktion signalisiert dem Körper, dass dieser Ruhe und Schonung benötigt, um die Funktionsfähigkeit des Organismus wieder vollkommen herzustellen (Glier, 2002, S. 13-14). Ein akuter Schmerz dauert Sekunden oder maximal einige Wochen an und legt sich, sobald keine exogenen Reize oder endogenen Störungen, das heißt, z. B. körperliche Erkrankungen oder Entzündungen, mehr vorhanden sind. Dauern die Schmerzen weiterhin über einen langen Zeitraum an oder nehmen im schlimmsten Fall gar kein Ende mehr, wird vom chronischen Schmerz gesprochen. John J. Bonica (1954, zitiert nach Kröner-Herwig, 2007, S. 8) definiert den chronischen Schmerz als den Zeitpunkt „persists past the normal time of healing“. Genauer gesagt gelten Schmerzen laut Bonica dann als chronisch, wenn die Schmerzen nach der Genesungsphase noch mehr als vier Wochen andauem (Lenz, Casey, Jones & Willis, 2010, S. 541). Da Bonicas Aussage über den Zeitraum allerdings nicht klar erkennbar ist, wurde ein bestimmtes Zeitfenster festgelegt. In der Literatur wird ab einem Zeitraum zwischen drei und sechs Monaten von einer Chronifizierung gesprochen. Da sich eine Chronifizierung allerdings erst mit der Zeit allmählich entwickelt und nicht von heute auf morgen stattfindet, wird Chronifizierung als eine Phase des Übergangs („transition“), und zwar von einem akuten zu einem chronischpersistierenden (langandauernd, anhaltend) oder chronisch-rezidivierenden (langandauernd-schubförmig) Schmerz, bezeichnet (Turk, 1996, zitiert nach Hasenbring & Pfingsten, 2007, S. 104). Anders als beim akuten Schmerz, der in der Regel auf die Stelle der Verletzung begrenzt und somit gut lokalisierbar ist, ist die Lokalisation des chronischen Schmerzes nicht eindeutig lokalisierbar und diffus (Fishman, Ball- antyne & Rathmell, 2010, S. 699). Daneben besitzt der chronische Schmerz keine Warn-, Schutz- und Rehabilitationsfunktion mehr. Ab dem Zeitpunkt, in dem der Schmerz diese Funktionen verliert, wird häufig von einer eigenständigen Schmerzkrankheit gesprochen (Striebel, 1999, S. 1). Ob eine Chronifizierung und in welchem Ausmaß sie bereits vorliegt, lässt sich allerdings nicht allein durch den zeitlichen Aspekt erkennen, vor allem, weil die zeitliche Dimension von Individuum zu Individuum ganz unterschiedliche Ausmaße annimmt. So können Symptome für eine Chronifizierung bei Betroffenen bereits nach einigen Wochen auftreten, während bei einem anderen Patienten nach über sechs Monaten Schmerzerfahrung keiner dieser Symptome zu erkennen sind (Casser, 2011, S. 1). Ein in Deutschland weit verbreitetes Modell zur Erfassung der Chronifizierung, ist das „Mainzer Stadienmodell der Schmerz-Chronifizierung“ (MPSS) von Gerbershagen. Dieses diagnoseunabhängige Klassifikationsmodell bildet neben der zeitlichen auch eine räumliche Komponente, sowie das Medikamenteneinnahmeverhalten und den Patientenverlauf ab. Für alle vier Achsen existieren verschiedene anamnestische Beobachtungsmerkmale, die nach der Erfassung zu einem so genannten Achsensummenwert addiert werden. Die Höhe des Endwerts entspricht dann dem Stadium I, II oder III und lässt die Schwere des Chronifizierungsverlaufs erkennen (Hasenbring & Pfingsten, 2007, S. 118).
Im Falle eines hohen Chronifizierungsgrades ist der Schmerz konstant präsent und die Intensität des Schmerzes schwankt kaum oder nur noch gering (Striebel, 1999, S. 56). Ebenso typisch ist eine unklare Lokalisation des Schmerzes (Hasenbring & Pfingsten, 2007, S. 118). Betroffene Patienten haben deshalb schon in aller Regel mehrere Arztwechsel, Krankenhausaufenthalte, Rehabilitationsmaßnahmen oder Operationen hinter sich (Striebel, 1999, S. 56). Dass zahlreiche Arztbesuche und herkömmliche Therapien für den Patienten mit chronischen Schmerzen oft nicht zum gewünschten Erfolg führen, ist nicht ungewöhnlich, denn der Schmerz wird zum Zeitpunkt der bereits eingetretenen Chronifizierung kaum mehr durch körperliche Schäden verursacht. Viel eher wird der Schmerz in dieser Phase von kognitiven und emotionalen Faktoren, sowie Verhaltensaspekten im Zusammenhang mit der Schmerzverarbeitung und -bewältigung, beherrscht (Hasenbring & Pfingsten, 2007, S. 103). Nicht zuletzt ist ein Chronifizierungsverlauf in den meisten Fällen von einer Beeinträchtigung der Lebensqualität gekennzeichnet (Striebel, 1999, S 56). Depressive Stimmungslagen, ein negatives emotionales und kognitives Schmerzverarbeitungsverhalten sind dabei typisch und führen schnell zu sozialen und beruflichen Konflikten. Studien, die mit dem Mainzer Stadienmodell gearbeitet haben, geben an, dass eine psychische Belastung mit einem höheren Chronifizierungstadium korreliert (Haldorsen, 2002, zitiert nachNilges, 2010, S. 40).
2.2 Der chronische Rückenschmerz
Wenn ein Patient über Rückenschmerzen klagt, so stellt dieser noch keine medizinische Diagnose oder Krankheit dar, sondern ist in erster Linie immer ein Symptom, das viele verschiedene Ursachen haben kann (Pfingsten & Hildebrandt, 2007, S.405). In der Literatur herrscht keine eindeutige Definition von dem Begriff Rückenschmerz, er wird lediglich nach seiner Lokalisation und Ursache beschrieben. In der Anatomie umfasst der Rückenschmerz zum einen den Kreuzschmerz, der unterhalb des unteren Rückenbogens bis zu den Glutäalfalten, definiert wird und zum anderen den oberen Rückenschmerz, der im Bereich der Brustwirbelsäule bis zum Nacken lokalisiert wird (Casser, 2011, S. 1). In der klinischen Schmerzforschung liegen bisher vorrangig empirische Informationen im Bereich von Chronifizierungsprozessen bei Rückenschmerzen vor (Hasenbring & Pfingsten, 2007, S. 104). Neben Gelenkschmerzen, stellt der Rückenschmerz die häufigste Beschwerde dar (Kröner-Herwig, 2007, S. 17). Wird ein Blick auf die neuesten Studien geworfen, so wird im Bereich der Lokalisation von chronischen Schmerzen ebenfalls der Rückenschmerz am häufigsten genannt. Die Region, die am häufigsten betroffen ist, ist die der Brust- und Lendenwirbelsäule mit 42 %, woraufhin die Brust- und Halswirbelsäule mit 13 % folgen (Casser, 2011, S. 1).
Neben der Unterscheidung zwischen akuten und chronischen Schmerzen, kann ebenfalls zwischen spezifischen und unspezifischen Schmerzen unterschieden werden. Spezifische Rückenschmerzen sind gut lokalisierbar und besitzen meist eine klare Ursache. Im Bereich der spezifischen Rückenschmerzen handelt es sich dabei meist um Erkrankungen rund um das Rückenmark oder der Nervenwurzeln (z. B. enger Spinalkanal oder Deformation der Wirbelsäule). Aufgrund einer eindeutig abgrenz- baren Diagnose, können bei spezifischen Schmerzen schnell geeignete Schmerztherapien gefunden werden, sodass die Schmerzen nach kurzer Zeit wieder abklingen. Nur etwa 20 % der Patienten gehören zu der Gruppe mit spezifischen Rückenschmerzen. Die restlichen 80 % erweisen sich als Patienten mit unspezifische Rückenschmerzen (Diemer & Sutor, 2011, S. 114). Laut der Kassenärztlichen Bundes- Vereinigung (2017, Abs. 4) sind unspezifische Rückenschmerzen in der Regel unbedenklich. Etwa 7 von 100 Patienten mit unspezifischen Beschwerden leiden jedoch unter dem sogenannten chronischen Rückenschmerz. Nachemson (1998, zitiert nach Hasenbring & Pfingsten, 2004, S. 116) erläutert: „Pain is not the problem but chroni- city“. Da der unspezifische Schmerz, auf Grund fehlender evidenzbasierter Befunde, keiner Ursache zugeordnet werden kann, steht hier die Frage nach geeigneten Behandlungsmaßnahmen im Raum.
3. Iatrogene Faktoren
Die Medizin hat in den letzten Jahren einen enormen Fortschritt gemacht. Dass chronische Schmerzen nicht nur durch rein somatische Ursachen begründet werden können, sondern auch psychologische und soziale Aspekte eine ebenso bedeutsame Rolle spielen, hat den Stand des ärztlichen Wissens erreicht. Trotz dessen werden diese Erkenntnisse der psychosomatischen Schmerzforschung heutzutage immer noch viel zu selten beachtet (Heger, 1999, S. 226). Das psychologische Phänomen tritt besonders beim chronischen Schmerz stark in Erscheinung, schon an der Brücke zwischen akutem und chronischem Schmerz nimmt der psychologische Faktor einen beeinflussenden Platz am Prozess ein. Letztendlich wächst die Bedeutung psychologischer Prozesse im weiteren Verlauf der Chronifizierung immer mehr, während der somatische Faktor in der Regel nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Die psychologischen Prozesse sind von vielfältigen Verursachungs- und Aufrechterhaltungsbedingungen geprägt, die an dem Chronifizierungsverlauf maßgeblich mitbestimmen. Zu den Faktoren, die an diesen Vorgängen beteiligt sind, gehören vor allem verhaltenssteuernde Prozesse der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, kognitive Bewertungen, sowie emotionale Befindlichkeiten. Behandelnde Ärzte und Therapeuten gehören mit zu den Faktoren, die die Wahrnehmungen und überzeugen der Patienten stark beeinflussen. Somit ist auch das medizinische System und dessen iatrogene Einflussnahme, ein Lenker des chronischen Verlaufs. Klinische Erfahrungen bestätigen, dass Patienten, die ähnliche Befunde oder vergleichbare Operationen hinter sich haben, unterschiedliche Schmerzerfahrungen aufweisen und sich auch der Umgang mit dem Schmerz deutlich unterscheidet (Pfingsten, 2011, S. 46-47). Im folgenden Kapitel wird der Versuch unternommen zu klären, warum Patienten Schmerz ganz unterschiedlich wahmehmen, welche Prozesse dabei beteiligt sind und welche Rollte das medizinische System dabei spielt.
3.1 Überdiagnostik
„Rückenschmerzen ohne Röntgenuntersuchung scheinen so wenig vorstellbar, wie Zahnarztbesuche ohne Bohren“ (Nilges, 2011, S. 256). Oft herrschen in den Köpfen der Ärzte und Schmerzkranken, bezogen auf die Behandlung chronischer Rückenschmerzen, immer noch veraltete Krankheitsmodelle. Derartige überholte Krankheitsverständnisse führen häufig zu mehr Schaden, mit dessen Folgen die Patienten ihr Leben lang zu kämpfen haben (Heger, 1999, S. 225).
Die erste Schwierigkeit bei der frühzeitigen Erkennung von chronischen Schmerzen liegt an der Diagnostik. In der schmerztherapeutischen Untersuchung hat die biomedizinische Diagnostik besonderen Vorrang. Es gilt in erster Linie, mögliche somatische Schmerzursachen zu analysieren. Dabei kommt nicht selten eine große Auswahl an Verfahren zur Anwendung, wie z. B. Röntgen, Kernspintomographie (MRT) oder Computertomographie. Dabei kann der Einsatz von Verfahren, wie Röntgen oder MRT, trotz fehlender Befunde für ernsthafte Schädigungen, weitreichende negative Folgen für den Patienten haben. Oft ist die Nutzung solcher Verfahren bloß eine überdiagnostische Reaktion des Behandlers, der davon überzeugt sein könnte, eine somatische Ursache übersehen zu haben (Hasenbring & Pfingsten, 2007, S. 110). Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2017 (Abs. 2,4,5) hat aufgedeckt, dass die Zahl der Rückenoperationen stark angestiegen ist. Zwischen 2007 und 2015 gab es einen Anstieg von 71 %. Besonders auffällig sind dabei die regionalen Unterschiede, denn in einigen Gebieten wurde bis zu 13-mal häufiger operiert, was deutlich macht, dass sich Diagnostik und Therapie in Deutschland regional noch immer stark unterscheiden und viele Klinikaufenthalte, bei richtiger Versorgung, vermeidbar sind. Problematisch wird es, wenn durch die Betrachtung radiologischer Befunde nichtzutreffende Ursachenzuschreibungen resultieren und aufgrund dessen anschließend falsch angelegte Behandlungsmaßnahmen herangezogen werden (Hasenbring & Pfingsten, 2007, S. 110). Eine Studie des Inselhospitals in Bern zeigt deutlich, dass es durch radiologische Bildgebungen durchaus zu fehlerhaften Ursachenzuschreibung kommen kann. Zwei Gruppen unterzogen sich eine Kernspintomographie. Die Befunde der Gruppe von Patienten, die unter starken Rückenschmerzen litten unterschieden sich dabei gering von der, hinsichtlich Alter, Geschlecht und beruflicher Belastung parallelisierten Kontrollgruppe, deren Teilnehmer nicht an Rückenschmerzen litten. In 85 % der Fälle wurden bei der Gruppe ohne Rückenschmerzen ebenfalls wesentliche Auffälligkeiten in den Bildgebungen entdeckt (Boos et ab, 1995, S. 2615-2618). Somit besteht ein Risiko, dass radiologische Befunde nicht gleich die kausale Erklärung für einen Schmerz sind und Zufallsbefunde und Normvarianten schnell überbewertet werden (Bauder & Waibel, 2009, S. 193). So zeigt eine weitere Studie von Kendrick et al. (2001, S. 400), dass aufwendige Diagnostikverfahren, wie die bloße Anwendung einer Röntgenuntersuchung negative Folgen für den weiteren Krankheitsverlauf des Patienten mit sich bringen kann. Nach der Einteilung in zwei Gruppen (n = 421) von Patienten mit unspezifischen Rückenschmerzen, wurde in einer Gruppe die Wirbelsäule geröntgt, während der anderen Gruppe dieses Verfahren erspart wurde. Untersuchungen, die drei und neun Monate später stattfanden zeigten, dass die Gruppe, die geröntgt wurde eine höhere Schmerzintensität und stärkere Behinderung empfand, sowie häufiger Arztbesuche durchlief. Nilges (2011, S. 255-256) berichtet von einer Verunsicherung des Patienten, die durch die Anwendung radiologischer und aufwändiger Verfahren entsteht. Patienten, die unter harmlosen Rückenschmerzen leiden reagieren auf aufwendige Untersuchungen oft mit Sorge und Verwirrung, da es den Anschein macht, es wäre etwas nicht in Ordnung oder es müsse etwas Ernstes vorliegen, das den Rückenschmerz verursacht. „Abnormes Verhalten der Diagnostiker führt zu abnormen Krankheitsverhalten der Patienten“ (Nachemson, 1992, zitiert nach Kröner-Herwig, 2007, S. 15), wenn aufwendige Verfahren zur Diagnose von Rückenschmerzen zu früh und zu oft zur Anwendung kommen.
Laut Nilges und Gerbershagen (1994, S. 13) werden korrelative Befunde in der Medizin meist direkt als Ursache für den Schmerz des Patienten bewertet. Tatsächlich ist es essentiell, zunächst ernsthafte Schädigungen und körperliche Erkrankungen durch eine gezielte Anamnese auszuschließen. Einen somatischen Befund oder eine monokausale Ursache bei chronischen Rückenschmerzen zu finden ist jedoch besonders problematisch, denn diese treten zu über 90 % ohne eine zu spezifizierende Ursache auf. Für die unspezifischen Rückenschmerzen werden trotz dessen häufig noch immer somatische Befunde diagnostiziert, die als Kausalfaktor für das Schmerzgeschehen geltend gemacht werden. Meist fallen dabei Bezeichnungen, wie Lumbalgie oder LWS-Syndrom, die keine wissenschaftlich erfolgreichen Diagnosen abbilden, sondern lediglich Information beinhalten die annehmen lassen, dass der Patient unter Schmerzen im unteren Bereichen des Rückens leidet (Locher, 2011, S. 261). Ein Grund für dieses Problem ist laut Kröner-Herwig & Lautenbacher (2011, S. 303) ein enormer Diagnosedruck, der auf den Ärzten lastet. Der zu diagnostizierende Arzt unterliegt hierbei einem Druck, Diagnosen, zu stellen, obwohl zum Zeitpunkt der Untersuchung keine ersichtlichen Befunde zu finden sind. Diagnosen, wie Lumbalgie oder LWS-Syndrom zeigen außerdem, dass somatische Faktoren deutlich überbewertet werden. In einem Medizinstudium geht es in ca. 95 % der Zeit um die Bedeutung der somatischen Aspekte für die Ursache von Krankheiten. Für Ärzte hat ein organischer Befund höchste Priorität und darf nicht übersehen werden, während psychische Befunde, als Ursache, selten in Betracht gezogen werden. Doch nicht nur der Arzt ist überzeugt von einem Zusammenhang zwischen dem Schmerz und einer Gewebsschädigung, auch der Schmerzpatient glaubt meist, dass der chronische Schmerz, wie der akute Schmerz eine physiologische Ursache haben muss. Berichtet der Arzt seinem Patienten von einem Befund (der im eigentlichen Sinne harmlos ist), wird die Annahme eines körperlichen Schadens bestätigt und die somatische Fixierung des Patienten verstärkt (Derra, 2002, S. 105). Ist der Patient von der Fehlinformation des Arztes überzeugt und glaubt diese, ist auch von den so genannten „Beliefs“ die Rede (Deemter, 2012, S. 33). Durch die Überzeugung einer existierenden Gewebsschädigung, bekommt der Patient, aber auch der behandelnde Arzt einen falschen Eindruck davon, wie mit chronischen Schmerzen umzugehen ist (Derra, 2002, S. 105).
3.2 Informationsmängel
Widersprüche und Ungereimtheiten gehören zu chronische Rückenschmerzen dazu, denn sie lassen sich, anders als bei akuten Schmerzen, weder einer eindeutigen physiologischen, noch psychischen Erkrankung zuordnen. Ärzte merken somit schnell, dass der Schmerzpatient in kein diagnostisches Raster hineinpasst. Aufgrund eines fehlenden eindeutigen somatischen Befundes, fallen folglich Sätze, wie „Ich habe nichts gefunden“, „Da kann man nichts machen“oder „Das muss etwas Psychisches sein!“. Der Patient stellt daraufhin seine Schmerzwahrnehmung häufig in Frage und verzweifelt. Chronische Schmerzpatienten durchlaufen oft einen langen Weg von viele Ärzten, die nur Angst, Ärger oder Irritation schüren, weil sie keine Ursache feststellen können. Oft ist das letzte Mittel eine Therapie, die auf Schmerzmedikation zurückgreift. Offensichtlich existieren in der Medizin immer noch Wissenslücken über die Schmerzentstehung, doch einen Patienten wegzuschicken, der unter anhaltenden Schmerzen leidet, darf keine Option sein (Nilges, 2011, S. 257-258).
Neben vielfältigen Untersuchungsverfahren, sind auch klassische Ratschläge des Arztes, wie „Sie brauchen erst einmal Bettruhe!“ oder „Sie sollten sich die nächsten Tage nicht zu stark belasten!“ bei Rückenschmerzen kritisch zu sehen. Auch hier kann der Patient Angst vor einer ernsthaften Erkrankung entwickeln oder seine bereits bestehende Besorgnis verstärkt werden. Häufig führen derartige ärztliche „Ratschläge“ bei Patienten zu einem Vermeidungsverhalten, zu einer Verstärkung des Krankheitsprozesses (Locher, 2011, S. 250). Wie ein Vermeidungsverhalten zu Stande kommt und sich äußert, kann das Angst-Vermeidungs-Modell (auch Fear- Avoidance-Beliefs Theorie genannt) erklären.
Das Angst-Vermeidungs-Modell ist das elaborierteste Konzept zur Entwicklung chronischer Schmerzen, die das Bewegungssystem betreffen (Pfingsten & Schöps. 2004, S. 146). Das Modell beschreibt ein gelerntes angstmotiviertes Vermeidungsverhalten. Dabei geht es um einen kognitiven Vorgang, der dazu führt, dass der Patient aus Angst vor eintretenden Beschwerden jegliche Belastung und Aktivität vermeidet. Bewegung stellt für den Schmerzkranken dabei den negativen Reiz dar, der Verletzung oder Gefahr aussendet und deshalb unterbunden wird. Bei akuten Schmerzen unterstützt eine solche Verhaltensänderung den Heilungsprozess (Hasen- bring & Pfingsten, 2007, S. 107-108). Wird dieses Verhalten nach ausreichender Zeit allerdings zur Normalität, wird der Prozess der Chronifizierung dadurch maßgeblich beeinflusst. Eine anhaltende Ruhigstellung des Körpers bringt viele negative Folgen mit sich: körperliche Inaktivität wirkt sich auf der einen Seite auf das physiologische System aus. Es findet folglich eine Verminderung der Muskelkraft, ein substanzieller Verlust von Kalzium in den Knochen und eine Verkürzung der Muskelspindel statt. Weiterhin leiden auch die koordinativen Fähigkeiten darunter, die funktionelle Leistungsfähigkeit nimmt ab und als Konsequenz darauf, tritt ein Dekonditionierungs- prozess ein. Auf der anderen Seite hat Bewegungsvermeidung auch Auswirkungen auf der psychosozialen und psychischen Ebene. Häufig fängt es mit einem Verlust der Arbeitsfähigkeit an und führt früher oder später auch zu einem Rückzug aus dem
[...]
- Arbeit zitieren
- Sarah Sebesta (Autor:in), 2018, Iatrogene Faktoren bei der Chronifizierung von Rückenschmerzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448855
Kostenlos Autor werden
















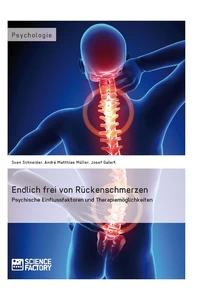



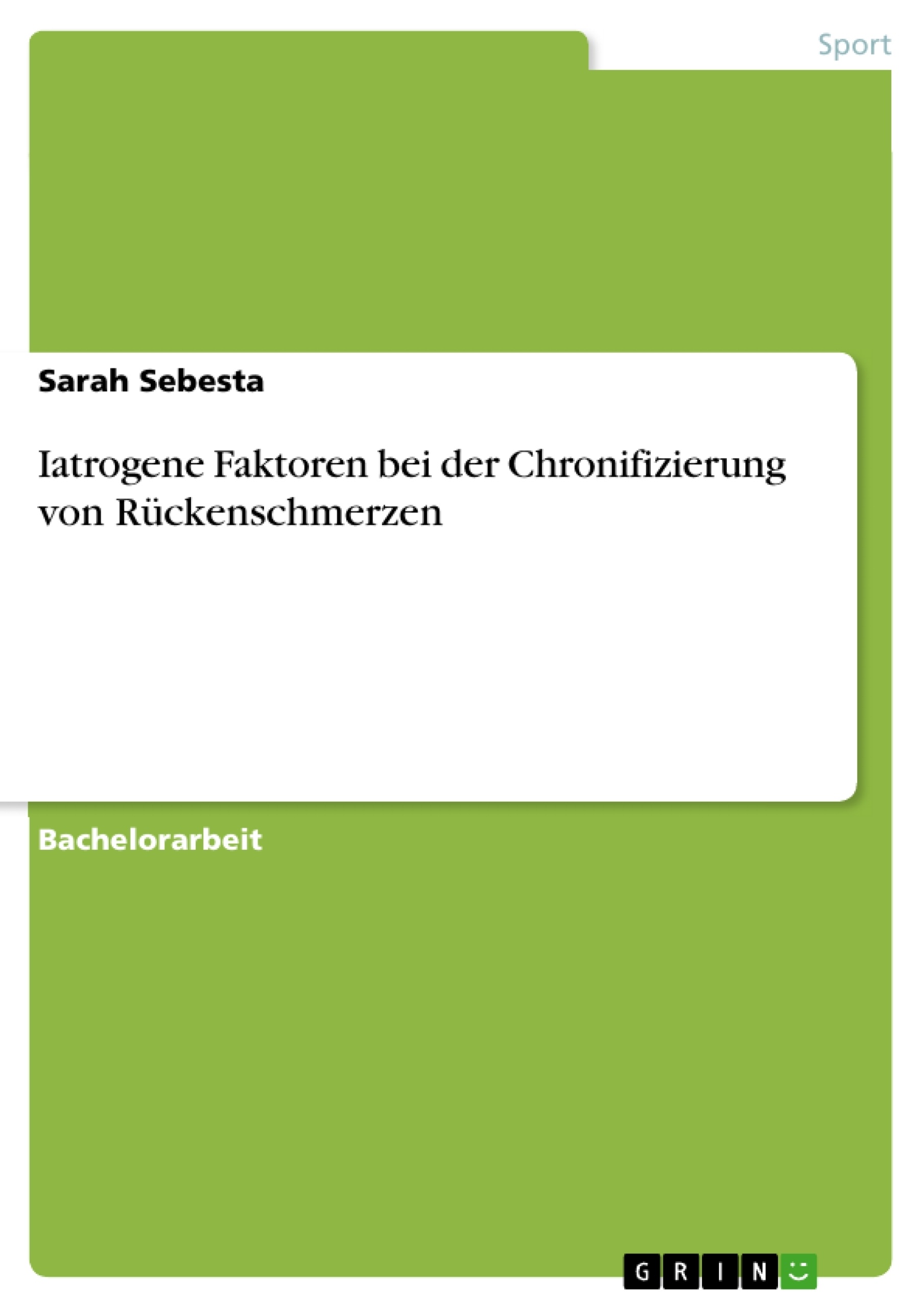

Kommentare