Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis.
Abbildungsverzeichnis.
Tabellenverzeichnis.
Vorwort.
1 Einleitung.
2 Trauma.
2.1 Trauma – eine Klärung des Begriffs.
2.2 Entstehung von Traumata und Typologie ihrer Faktoren.
2.3 Neurobiologische Mechanismen.
2.4 Verlauf psychischer Traumatisierungen.
2.5 Abwehrmechanismen und Bewältigungsstrategien (Coping).
2.6 Folgen traumatischer Erfahrungen in der Entwicklung von Kindern.
3 Sekundäre Traumatisierung.
3.1 Kernbegriffe der Sekundären Traumatisierung.
3.2 Besondere Schutz- und Belastungsfaktoren.
3.3 Stand der ST-Forschung.
3.4 ST bei Psychotherapeut_innen und anderen im beruflichen Kontext mit Traumaopfern arbeitenden Menschen
4 Pflegekinder.
4.1 Lebenswelt der Kinder.
4.2 Herkunftssysteme.
4.3 Kindeswohlgefährdung, Inobhutnahme und was folgt
5 Pflegefamilien.
5.1 Professionelle Betreuung in bewusst unprofessionellem Rahmen.
5.2 Formen der Pflege.
5.3 Besondere Herausforderungen einer Pflegeelternschaft
6 Prävention und Selbstschutz der Pflegeeltern vor ST.
6.1 Persönlicher Bezugsrahmen – Fähigkeiten im Umgang mit sich selbst
6.2 Organisationsspezifische Präventionsmöglichkeiten
6.3 Begegnung intrusiver bildlicher Vorstellungen
7 Fazit.
7.1 Kernaussagen der einzelnen Kapitel
7.2 Schlussfolgerungen und Ausblick.
Literaturliste.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Schematisierte Darstellung von Janet Metcalfe’s Begriffen „Cool System“ und „Hot System of Memory under Stress.
Abbildung 2: „Überblick über das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung“.
Abbildung 3: Überlebensstrategien – Survival Strategies.
Abbildung 4Trauma Transmission nach Charles Figley.
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Überlebensstrategien und deren Bestandteile – Survival Strategy Components.
Tabelle 2: Entwicklungsphasen und Entwicklungsaufgaben..
Tabelle 3:Unterscheidungskriterien verschiedener Konzepte zur mittelbaren Übertragung von Belastungssymptomen..
Tabelle 4: Folgen von Traumatisierungen..
Tabelle 5: Rollenkonzepte in der Familienpflege.
Tabelle 6: Fragenkatalog zur Beurteilung der Besuchskontakte.
Vorwort
Als meine Frau und ich uns vor nunmehr acht Jahren dazu entschieden haben, ein Pflegekind und gut ein Jahr später noch zwei weitere in unser Haus aufzunehmen, sahen wir uns vor dem Hintergrund des sozialarbeiterischen Studiums und der familientherapeutischen Zusatzausbildung meiner Frau und meinen Erfahrungen als Patchwork-Vater unserer mittlerweile erwachsenen Tochter gut gewappnet für die neuen Herausforderungen. Die räumlichen Verhältnisse in unserem Haus und die ländliche Umgebung unserer kleinen Westerwaldgemeinde schienen optimale Voraussetzungen zu sein für ein Leben mit Kindern, deren Verbleib in ihren belasteten und belastenden Herkunftssystemen nicht bzw. nicht mehr möglich war. Während ich weiterhin meiner selbständigen Tätigkeit als Geschäftsführer eines kleinen mittelständischen Druckereibetriebs nachgehen und in unserem Zuhause eine engagierte aber eben gewollt unprofessionelle Rolle als Familienvater ausfüllen wollte, sollte meine Frau den professionellen, pädagogischen Part übernehmen. Uns war von vorne herein klar, dass diese Aufgabe im Hinblick auf die möglichen Vorerfahrungen der Kinder keine leichte sein würde und dass viele mit unserer Tochter erprobten Erziehungsstrategien nun nicht mehr passend oder nicht mehr ausreichen sein könnten.
„Liebe allein genügt nicht“ war der Titel eines Buches von Bruno Bettelheim, in welchem er Mitte der 1950er Jahre seine innovativen pädagogischen Methoden in einem Chicagoer Kinderheim vorstellte. Die dort aufgenommenen Kinder zeigten Auffälligkeiten im Sozialverhalten, die auf traumatische Erfahrungen und andere belastende Bindungs- und Entwicklungsverläufe in ihren Herkunftssystemen zurückzuführen waren. Interessanterweise war das Scheitern der elterlichen Erziehung nur in den wenigsten Fällen auf das Fehlen elterlicher Liebe zurückzuführen, die Ursachen lagen vielmehr in unzureichenden Kompetenzen, Überforderungen und inkongruentem Verhalten der Eltern. Was außer Liebe würden wir also noch einbringen müssen, um mit den Kindern gemeinsam die richtigen Wege zu finden und eine Familie zu werden wie alle anderen Familien auch? Und wie könnten wir mit den Resultaten all dieser verstörenden Biografien umgehen, wie stark würden sie am Ende auch uns belasten?
Die von den Jugendämtern übersandten Informationen und Akten der potenziell für uns in Frage kommenden Kinder mit Beschreibungen ihrer prekären und zutiefst traumatischen Vorgeschichten verstärkten unseren Respekt vor dieser Aufgabe. Die unfassbaren Geschichten dieser Kinder berührten uns derart, dass uns die Tränen schon in den Augen standen, bevor wir sie überhaupt persönlich kennenlernen konnten. Dennoch waren wir der Überzeugung, wir würden „das Kind schon schaukeln“. Die Zeit nach der erstaunlich problemlos verlaufenden Anpassungsphase der Kinder in unserer Familie sollte dann jedoch zeigen, wie berechtigt jener anfängliche Respekt war. Unsere Kinder forderten und fordern uns auch heute noch Tag für Tag, rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr heraus. Die vor dem Hintergrund ihrer Herkunftssysteme entwickelten und für die Kinder kaum ablegbaren (Überlebens-)Strategien waren nicht nur für Außenstehende (Familie, Freunde, Nachbarschaft…) sondern auch für uns kaum nachvollziehbar, zumal der Grund hierfür doch eigentlich nicht mehr vorhanden zu sein schien. Die immer wiederkehrenden Übertragungen und Kämpfe führten uns bis an unsere Belastungsgrenze und oft auch darüber hinaus.
Meine späte berufliche Neuausrichtung war nicht von vorne herein geplant. Aber es kam Eins zum Anderen. Der Bedarf an elterlicher Präsenz, mein wachsendes Interesse und die Notwendigkeit von fundiertem pädagogischen Wissen im Alltag unserer Pflegefamilie brachten mich Anfang 2014 schließlich auf den Weg des Studiums der Sozialen Arbeit. In verschiedenen Modulen dieses Studiengangs beschäftigte ich mich mit dem Phänomen der Traumatisierung und konnte dort einen sehr nahen und praktischen Bezug zu dem Mikrokosmos meiner Pflegefamilie herstellen. Die hier vorgelegte Bachelor-Thesis ist als wissenschaftliche Arbeit konzipiert. Meine persönlichen Erfahrungen als Pflegevater werden insofern nicht thematisiert, sie schwingen jedoch im Hintergrund gleichermaßen mit und wirken sich aus auf die Auswahl von Aspekten und Schwerpunkten dieser Arbeit.
Dass die Arbeit mit einer stark belasteten Klientel auch zu einer großen Belastung für die helfenden Personen werden kann, ist sicherlich kein Spezifikum unserer Profession der Sozialen Arbeit. Auch für andere helfende Berufe (bspw. Rettungssanitäter, Seelsorger, Therapeuten) stellt dieses Phänomen eine große Herausforderung dar. Während diese Problematik in den dortigen beruflichen Kontexten allerdings unter den Bezeichnungen „Sekundäre Traumatisierung“, „Mitgefühlserschöpfung“ oder auch „Burnout-Syndrom“ spätestens seit Mitte der 1990er Jahre zunehmend erforscht und mit Methoden oder Handlungsstrategien bearbeitet wird (bspw. Supervision, Therapie und Reflexionsgesprächen), ist ein entsprechendes Problembewusstsein im Bereich der familiären Vollzeitpflege bislang jedoch nur unzureichend entwickelt. Das macht die Arbeit von Pflegeeltern nicht leichter. Ein nicht unerheblicher Teil der Pflegeverhältnisse wird, wie wir sehen werden, vorzeitig abgebrochen. Notwendige Hilfestellungen (bspw. Supervision, Urlaubs- und Krankheitsvertretungen…) werden von den zuständigen Trägern wenn überhaupt, so oftmals nur auf vehementes Nachfragen geleistet. Pflegeeltern brauchen Freiräume, damit sie ihre Leistungsfähigkeit erhalten und sich selbst und ihren Kindern unnötige Enttäuschungen und (erneute) traumatische Erfahrungen ersparen können.
Der Bedarf an Pflegefamilien ist in Deutschland nicht ansatzweise gedeckt, und es ist zu vermuten, dass sich dieser Umstand in den kommenden Jahren noch verschärft. Mit meiner hier vorgelegten Arbeit möchte ich dem entgegen wirken und dazu beitragen, dass die in vielen Fällen „beste Unterbringungsform“ von Kindern, deren Herkunftssysteme nicht mehr tragfähig oder nicht mehr zumutbar sind, gestärkt wird und die dort „arbeitenden“ Pflegeeltern eine größt mögliche Unterstützung erhalten. Nur durch ein breites Verständnis im familiären wie im professionellen Umfeld und entsprechende niederschwellige und „ehrliche“ Hilfsangebote kann es meines Erachtens gelingen, die Attraktivität des Modells einer Pflegefamilie so zu verbessern, dass sich mehr Familien zur Aufnahme eines Pflegekindes bereit erklären.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bedanken bei meiner Frau Herta mit ihrer Geduld und den Aufmunterungen in schwierigen Zeiten meiner beruflichen und auch persönlichen „Wechseljahre“, bei meinen Kindern, die mein Leben in vielerlei Hinsicht absolut bereichert haben und bei den vielen Menschen, die uns auf dem Weg unserer Pflegefamilie begleitet und unterstützt haben. „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen“ lautet ein afrikanisches Sprichwort, und ich habe erfahren wie viel Wahres darin steckt. Ohne eure Hilfe als Paten, als Berater_innen, als Zuhörer_innen und als Freund_innen kann das Modell der Pflegefamilie nicht funktionieren.
Auch bedanken möchte ich mich bei den Mitarbeiterinnen unseres Trägervereins KiFa e.V., Bonn und der Jugendämter Neuwied, Bonn und Oberhausen für eine umfassende Unterstützung und eine Form der Zusammenarbeit, wie ich sie mir für viele andere Pflegefamilien wünschen würde.
Heinrich Bellinghausen-Thomas
1 Einleitung
Die „Gretchenfragen“ gleich zu Beginn: Können Menschen traumatisiert werden allein durch die mittelbare Erfahrung einer belastenden, traumatischen Situation, ohne also selbst direkt und unmittelbar dabei gewesen zu sein? Und wenn ja, wie könnte dies geschehen? Sind Traumata etwa derart „ansteckend“, dass primär traumatisierte Personen die aus ihrem traumatisierenden Erlebnis heraus entwickelten (Belastungs-)Störungen auf Helfer_innen oder nahestehende Personen übertragen können? Vieles deutet tatsächlich darauf hin. Lange vor dem Konzept der Sekundären Traumatisierung gab es bereits erste Hinweise aus der Nachbetreuung von Kriegsversehrten des Vietnamkrieges in Militärhospitälern, wo die Pfleger_innen begannen, ähnliche, teilweise sogar identische Symptomatiken zu entwickeln wie die Kriegstraumatisierten selbst. Das gleiche Phänomen wurde einige Zeit später in verschiedenen kinderonkologischen Abteilungen beobachtet (vgl. Gies 2009: 1).
Die Konsequenzen aus einer derartigen Erkenntnis könnten brisante Bedeutung für den Umgang mit Traumaopfern haben. Wäre es den Helfer_innen etwa überhaupt noch zuzumuten, sich einem erhöhten „Infektionsrisiko“ auszusetzen? Die Frage hat eine zutiefst ethische Dimension. Sie zielt einmal mehr auf den Umgang mit einer Minderheit, die für die Ursache, die traumatisierende Situation, das schockierende Erlebnis und damit auch für das Trauma und seine vielfältigen kurz- und langfristigen Folgen in den allermeisten Fällen nicht selbst verantwortlich ist. Die Prävalenzzahlen für die Häufigkeit von Traumafolgestörungen sind abhängig von dem Kontext der Traumatisierungen. Nach Flatten et al. (2011) leiden etwa 50% aller Vergewaltigungsopfer, 25% aller Opfer anderer Gewaltverbrechen, 50% aller Kriegs-, Vertreibungs- und Folteropfer sowie 10% aller Verkehrsunfallopfer unter den Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens an PTBS erkrankt, liegt in Deutschland zwischen 1,5 und 2 % (vgl. Flatten et al. 2011). Aber wie sonst sollen wir mit den vielen Menschen umgehen, die irgendwann im Laufe ihres Lebens Traumata zu bewältigen hatten, nach denen nichts mehr so war wie vorher?
Besonders eindringlich treffen uns diese Überlegungen an Stellen, wo Kinder die (primären) Opfer sind. Als „soziale Frühgeburten“ (Huber 2012: 88) sind sie nicht nur für einen sehr langen Start ihres Lebens auf die Fürsorge, Hilfe und Unterstützung von Bezugspersonen der Erwachsenenwelt angewiesen, auch umgekehrt scheint ein stammesgeschichtlich uralter Mechanismus in dem Menschen eingepflanzt zu sein, den wir bisweilen „Schützerinstinkt“ nennen, der uns dazu veranlasst, dass wir unsere Kinder versorgen, der uns rührt, wenn Kinder etwas toll gemacht haben, der uns aber auch tief betroffen macht, wenn Kindern Unheil geschieht. Und die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden (DESTATIS) deuten auf einen anhaltend hohen Stand derartigen Unheils inmitten unserer deutschen Gesellschaft hin. 2016 stieg in Deutschland die Zahl der Verfahren zur Kindeswohlgefährdung erneut an (+ 5,7 %). Die Ursachen lagen dabei in 61,1 % der Verfahren aufgrund einer Vernachlässigung, in 28,4 % aufgrund psychischer und in 25,7 % aufgrund körperlicher Misshandlungen sowie in 4,4 % aufgrund sexueller Gewalt (vgl. DESTATIS 2017a). Parallel dazu ist die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland seit vielen Jahren steigend. Von den 2016 in Obhut genommenen 84230 Kindern und Jugendlichen waren 21722 unter 14 Jahren und 62508 zwischen 14 und 17 Jahren. Bei einigen endet die vorübergehende Inobhutnahme mit der Rückkehr zu den Sorgeberechtigten (vgl. DESTATIS 2017b). Für gut 60300 Kinder und Jugendliche (vgl. ebd., eigene Berechnungen), die fast ausnahmslos schwere oder schwerst traumatisierende Erfahrungen in ihren Elternhäusern, in ihren Herkunftsländern, auf der Flucht und nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit ihren Kinder- und Jugendhilfe-Verfahren gemacht haben, muss eine neue Bleibe gefunden werden, die den Umständen und den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen gerecht wird. Für viele dieser Kinder wird nach ihren traumatisierenden Erfahrungen und aufgrund der sich daraus entwickelten Belastungs- und Verhaltensstörungen ein Platz in einer Einrichtung der stationären Jugendhilfe die einzige Möglichkeit sein, den Neubeginn ihres Lebens zu begleiten. Da, wo die familiären Bindungen und Beziehungen noch nicht negativ überlagert werden, etwa durch in ihren Herkunftssystemen gesammelte psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt, können Pflegefamilien eine gute Option darstellen, diesen Kindern und Jugendlichen ein neues „Nest“ zu bieten und ihren Bedürfnissen von Sicherheit, Geborgenheit und von Nähe eine adäquate (Nach‑) Versorgung angedeihen zu lassen.
An dieser Stelle kehren wir wieder zur Anfangsproblematik dieser Einleitung zurück, denn die in den Pflegefamilien lebenden (und arbeitenden) Pflegeeltern sind jenen traumatischen Erlebnissen der Kinder und Jugendlichen sekundärexponiert. Es gehört zu ihrem „Alltagsgeschäft“, sich nicht nur auf die Störungsbilder der Kinder einzulassen, ihr eigenes Verhalten rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr hierauf anzupassen und mit den vielen Haupt- oder Nebenspielern in Schulen, Vereinen, Nachbarschaft, eigener Familie, Herkunftsfamilie, Jugendamt und anderen involvierten Trägern zu agieren, zu reagieren oder zu kooperieren. Sie müssen sich darüber hinaus auch mit den hinter den Symptomatiken der Kinder und Jugendlichen steckenden traumatischen Ursachen auseinandersetzen. Vieles deutet daraufhin, dass ein Transport von Störungen und Belastungen zwischen den Kindern und den Pflegeeltern stattfindet. Pflegeeltern wären demnach potenziell gefährdet für eine Sekundäre Traumatisierung (ST) und die sich daraus entwickelnden sekundären traumatischen Belastungsstörungen (STBS). Eine derartige Hypothese ist jedoch mit vielen Fragezeichen behaftet und kann nicht vorsichtig genug im Konjunktiv formuliert werden. Welche Symptome wären denn nun eindeutig einer sekundären Traumaexposition und welche vielleicht eher einem der belastenden Begleitumstände (bspw. Streit in Schulen oder Kindergärten, Auseinandersetzungen im Dreieck Familiengericht/ Jugendamt/ Herkunftsfamilie) zuzuordnen? Zwar haben zahlreiche Wissenschaftler vor allem ab Mitte der 1990er Jahre entsprechende faktorielle Zusammenhänge in verschiedenen beruflichen Kontexten erforscht, und das beobachtete Phänomen unter verschiedenen Bezeichnungen wie Compassion Fatigue (Mitgefühlserschöpfung), Secondary Traumatization (ST), Vicarious Traumatization (stellvertretende oder indirekte Traumatisierung) konzeptualisiert. Auch bereits entwickelte Konzepte wie bspw. Übertragung/Gegenübertragung oder Burnout wurden auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterscheidungen überprüft. Dennoch scheint bei näherem Hinsehen, dass alle Konzepte bislang nur sehr unvollständig und, was das ganze Spektrum der (professionellen wie ehrenamtlichen oder familiären) Helfer_innen von Traumaopfern anbelangt, nur stichpunktartig ausgeleuchtet sind.
Charles R. Figley, einer der Wegbereiter im Forschungsgebiet der Sekundären Traumatisierung beginnt den Überblick des von ihm 1995 herausgegebenen Buches „Compassion Fatigue“ mit den Worten: „There is a cost to caring“ (Figley 2015a: 1). Ein Preis des Helfens jedoch, der noch dazu von den helfenden Personen selbst zu tragen ist, würde Hilfe in ihren unterschiedlichen professionellen wie altruistischen Kontexten generell unkalkulierbar machen in Bezug auf ihre Verhältnismäßigkeit, ihre Zumutbarkeit und auch in ihrem Nutzen für die Gesellschaft.
Pflegeeltern leisten einen großartigen Dienst an unserer Gesellschaft. Mit großem Engagement geben sie Kindern und Jugendlichen nicht nur ein neues Zuhause, ihre Zuwendung, ihre Feinfühligkeit und ihre Vorbildfunktion kann den bis dahin angesammelten Defiziten in Entwicklung und Bindungsmustern der Kinder in vielfacher Hinsicht potenziell entgegenwirken. Diese wertvolle Arbeit gilt es, so gut wie möglich zu unterstützen. Gleichzeitig aber sind die engagiert und empathisch handelnden Pflegeeltern vor möglichen Gefahren für sie selbst zu schützen. Daher möchte ich den roten Faden meiner hier vorgelegten Bachelor-Thesis in Richtung folgender zentraler Fragestellungen entwickeln:
· Wie groß ist die Gefahr, dass Pflegeeltern durch eine sekundäre Traumaexposition in der Arbeit mit ihren traumatisierten Pflegekindern eigene Belastungsstörungen entwickeln?
· Welche Faktoren spielen hierbei eine verstärkende bzw. eine schützende Rolle?
Bereits die bis hierher vorgenommene Heranführung an das Thema lässt ahnen, wie komplex sich die verschiedenen Aspekte und Zusammenhänge jenes ST-Phänomens vor dem Hintergrund von Pflegefamilien-Systemen darstellen. So ist es zur Annäherung an die zentralen Fragestellungen wichtig, einen erweiterten Bogen zu schlagen, der in Anbetracht der Vorgaben zu Zeit und Umfang dieser Arbeit eine Konzentration auf bestimmte Schwerpunkte notwendig macht und die zwangsläufig die Gefahr einer gewissen Lückenhaftigkeit in sich birgt.
Zu Beginn werde ich mich im 2. Kapitel mit dem Begriff des Traumas bzw. der Traumatisierung auseinandersetzen. Sowohl für ein Verständnis der traumaspezifischen Zusammenhänge in Bezug auf Pflegekinder als auch für die Übertragung der hierin liegenden Erkenntnisse auf das Konzept der Sekundären Traumatisierung ist es zunächst wichtig, einige Definitionen von Grundbegriffen der Psycho-Traumatologie vorzunehmen und wesentliche Mechanismen und Faktoren bei der Entstehung von Traumata sowie einen kurzen Überblick über die dort stattfindenden neuronalen Prozesse vorzustellen. Anschließend beschäftige ich mich mit den Phasen des Trauma-Prozesses und seinen möglichen akuten und langfristigen Folgen, bevor ich auf diesbezügliche Besonderheiten kindlicher bzw. frühkindlicher Traumatisierungen und deren Bedeutung für die kindliche Entwicklung eingehe.
Zu Beginn des 3. Kapitels werden zunächst die wesentlichen Kernbegriffe und Konzepte der Sekundären Traumatisierung geklärt sowie gegen überschneidende, darauf folgende oder dem zugrunde liegende „verwandte“ Konzepte abgegrenzt. Die Prävalenz von ST bei Eltern in Pflegefamilien ist nach meinem derzeitigen Kenntnisstand bislang nicht erforscht worden. Daher muss ich darauf zurückgreifen, die Ergebnisse einiger Studien und Beiträge aus ähnlichen Kontexten zusammenzustellen, die dazu geeignet sein könnten, gewisse Übertragungen zur Situation in Pflegefamilien herzustellen.
Im 4. Kapitel gebe ich einen groben Überblick über die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, die im Laufe ihrer Entwicklung, aus welchem Grund auch immer, ihr Herkunftssystem verlassen müssen. Die hierfür ausschlaggebenden Kriterien für eine Kindeswohlgefährdung und Inobhutnahme durch die zuständigen Jugendämter zeichnen sich durch einen gewissen Interpretationsspielraum aus, der hinsichtlich der Anwendung in den verschiedenen Bundesländern aber auch von Region zu Region höchst unterschiedlich ausgerichtet ist.
Zu Beginn des 5. Kapitels weise ich zunächst auf das dem Konzept von Pflegefamilien immanente Dilemma hin, dass die meisten der dort untergebrachten Kinder im Grunde genommen eine professionelle Betreuung benötigen, die jedoch ganz bewusst in einem unprofessionellen Rahmen angesiedelt ist. Daran anschließend stelle ich die verschiedenen Formen von Pflegefamilien vor und kläre formaljuristische und persönliche Voraussetzungen, welche die Pflegeeltern einbringen müssen. Schließlich fasse ich die besonderen Herausforderungen einer Pflegeelternschaft zusammen, was sich im Leben der Pflegeeltern nachhaltig ändern wird, in Bezug auf Familie, Freunde, Nachbarschaft, die übernommene Verantwortung gegenüber einem neuen Familienmitglied, der Umgang mit dem Paralleluniversum der Herkunftsfamilie und natürlich mit den traumainduzierten Störungsbildern der Kinder.
Im 6. Kapitel beschreibe ich Möglichkeiten des Selbstschutzes von Pflegeeltern gegenüber Formen der Sekundären Traumatisierung, wie die protektiven Faktoren gestärkt und korrektive Faktoren so nutzbar gemacht werden, dass ggf. schon begonnene Traumaprozesse besser bewältigt werden können oder weniger schlimm verlaufen. Hierzu verwende ich Vorschläge aus der Fachliteratur, die sich hauptsächlich mit dem Selbstschutz von Therapeut_innen beschäftigen.
Das Fazit im 7. Kapitel schließlich fasst die wesentlichen Kernaussagen dieser Arbeit zusammen und enthält neben Schlussfolgerungen in Bezug auf die Leitfragen, grundsätzliche Fragen des Kinderschutzes und notwendige Konsequenzen für die Trägerlandschaft einen wissenschaftlichen Ausblick, der den großen Bedarf an Forschung für den Bereich der Sekundären Traumatisierung im Bereich der Pflegefamilien offenlegt.
In der Formulierung dieser Arbeit habe ich mich in Bezug auf die Darstellung der unterschiedlichen geschlechtlichen Identitäten zur Verwendung des Gender-Gaps entschieden. Hierbei wird durch die Einfügung eines Unterstrichs zwischen der männlichen und der weiblichen Form symbolisiert, dass neben männlichen und weiblichen Personen auch Menschen gemeint sein können, die sich keinem der beiden Geschlechter zuordnen können oder wollen. An Stellen, wo diese Schreibweise die Lesbarkeit meiner Arbeit deutlich herabgesetzt hätte, habe ich im Einzelfall jedoch darauf verzichtet. Dennoch sind auch an diesen Stellen alle anderen Identitäten mitgemeint. Gleiches gilt natürlich für die eingebauten Zitate, welche ich in der Originalformulierung belassen habe. Auch wenn die in dieser Arbeit zitierten Autor_innen vielleicht gewisse Absichten mit ihrer Formulierungsweise verfolgten, beziehen sich die dort getroffenen Aussagen im Sinne meiner Arbeit ebenso auf alle anderen ggf. nicht abgedeckten Geschlechtsidentitäten.
Ein weiterer abschließender Hinweis dieser Einleitung bezieht sich auf einige, im Sinne einer besseren Lesbarkeit vereinfacht bzw. reduziert dargestellten Bezeichnungen der thematisierten Gruppen. Wenn ich die Bezeichnung Pflegekind/Pflegekinder oder Kind/Kinder verwende, sind damit auch stets die im Rahmen der Jugendhilfe in der gleichen Kategorie zusammengefassten Jugendlichen und jungen Erwachsenen mitgemeint. Bei der Verwendung der Begriffe Pflege- und Herkunftsfamilie sowie Pflege- und Herkunftseltern sind auch alleinerziehende Elternteile oder Pflegepersonen mit inbegriffen. Die Begriffe Jugendamt und Pflegekinderdienst schließlich werden synonym verwendet.
2 Trauma
Traumatisierungen gibt es sicherlich seit Anbeginn der Menschheit. Ihnen liegen belastende Ereignisse von Katastrophen und Elend, von Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung zu Grunde, die neben rein physischen Schmerzen auch die Gefühle von Angst, Hilflosigkeit und Überforderung erzeugen. Wie Menschen auf derartige Verletzungen reagieren, wie sie damit umgehen und sie bewältigen ist jedoch höchst unterschiedlich. Während die einen in der Lage sind, auch äußerst belastende Erfahrungen gut und selbständig zu verarbeiten, leiden andere dauerhaft unter den psychischen Folgen und sind auf entsprechende Hilfen angewiesen. Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen zunächst die Klärung des Trauma-Begriffs, die Darstellung verschiedener Dispositionen und Entstehungsfaktoren sowie ein kurzer Einblick in die neuronalen Abläufe in Traumatisierungs-Prozessen. Daran anschließend werden die Phasen des Traumaverlaufs sowie mögliche Folgen und Auswirkungen traumatischer Erfahrungen beschrieben. Im Hinblick auf die vorliegende Thematik im Pflegekinder-Bereich werde ich schließlich auf spezielle Folgen für die kindliche Entwicklung, für Konflikt-, Bindungs- und Beziehungsfähigkeit sowie sich möglicherweise erst langfristig herausstellende Beeinträchtigungen hinweisen.
2.1 Trauma – eine Klärung des Begriffs
Das aus dem altgriechischen stammende Wort Trauma bezeichnet in seiner ursprünglichen Bedeutung ganz allgemein eine Wunde, eine Verletzung oder einen Schaden, der nicht ausschließlich bei Menschen sondern auch bei Dingen entsteht oder verursacht wird, bspw. im Sinne eines Lecks bei Schiffen (vgl. Seidler 2013: 32). Neben dem medizinischen Gebrauch des Begriffs allgemein als eine Verletzung des menschlichen Körpers durch eine äußere Gewalteinwirkung, etwa durch einen Schlag oder einen Stoß (bspw. Schädel-Hirn-Trauma), bedeutet Trauma im engeren psychologischen Sinne eine Verletzung der Seele (vgl. Nienstedt/Westermann 2013: 41). In Abgrenzung zum medizinischen Verständnis wird der Begriff Trauma daher oft auch mit der Präposition „Psycho“ versehen. Wenn im Folgenden von Trauma bzw. Traumata (Plural) oder Traumatisierungen die Rede ist, geschieht dies aufgrund des hier zu behandelnden Themas auch ohne entsprechende Präposition ausschließlich im Sinne des psychologischen Aspektes.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Wort „Trauma“ oft fälschlicherweise für das belastende Ereignis statt für die daraus folgende Verletzung eingesetzt (vgl. Seidler 2013: 33). Insofern ist es auch aus diesem Grund wichtig, zunächst eine genaue Definition des Begriffs festzulegen, deren subjektive und objektive Dimensionen darüber hinaus die Herausforderungen im Umgang mit einer derartigen Verletzung der Seele angemessen berücksichtigen. Nach Fischer/Riedesser (2009) ist Trauma „keine Qualität, die einem Ereignis inhärent ist noch aber einem Erlebnis als solchem. Entscheidend ist vielmehr die Relation von Ereignis und erlebendem Subjekt.“ (Fischer/Riedesser 2009: 64 – Italics im Original). Analog zu dem Bild eines Lecks im Sinne einer Verletzung zwischen einem Innen und einem Außen sind Traumata psychische Wunden oder Verletzungen, die entweder aufgrund eines einzigen tatsächlichen, extrem belastenden, äußeren Ereignisses oder aber aufgrund einer Folge von mehreren ebensolchen Ereignissen entstehen können, welche die Traumatisierten mit ihrem Reservoir bisheriger Mittel und Strategien nicht bewältigen können und welche insofern oft von einer besonderen Dynamik von außen nicht nachvollziehbarer Verhaltensweisen begleitet werden (vgl. Huber 2012: 38). Fischer/Riedesser beschreiben das Verhältnis von Ursache und Wirkung insofern als ein „vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“ (Fischer/Riedesser 2009: 84 – Italics im Original).
Einen eher technisch angelegten Definitionsversuch unternimmt Gerald Hüther (2004), indem er die bio-chemischen Vorgänge im Hirn als Kriterien eines Traumas heranzieht. Demzufolge kann ein Trauma als eine plötzlich auftretende, massive Störung der inneren Struktur und Organisation des Gehirns beschrieben werden, welche durch eine überstarke Aktivierung stress-sensitiver, kortikolimbischer Netzwerke und hypothalamischer neuroendokriner Regelkreise hervorgerufen wird und die neuronalen Verschaltungen und die hierdurch gesteuerte Hirnleistung nachhaltig modifiziert (vgl. Hüther 2004: 29 f.).
Im Zusammenhang dieser Arbeit ordnen wir dem Begriff eines Traumas / einer Traumatisierung daher folgende Merkmale zu:
Ein Trauma / eine Traumatisierung ist eine
- Verletzung oder Störung der Psyche
- mit Folgen für die innere Struktur und Organisation des Gehirns
- mit nachhaltiger Modifikation bis dahin entwickelter neuronaler Verschaltungen
- in Folge einer einzelnen, schwer belastenden Situation
- oder einer Folge mehrerer, schwer belastender Situationen,
- welche die Traumatisierten als (lebens-)bedrohlich empfinden,
- denen sie sich als hilflos und schutzlos gegenüber ausgesetzt sehen,
- deren bisherige Möglichkeiten und Strategien zur Bewältigung nicht ausreichen,
- mit deren Bewältigung sie insofern schlicht überfordert sind
- und die ihr Selbst- und Weltverständnis nachhaltig ins Wanken bringen.
2.2 Entstehung von Traumata und Typologie ihrer Faktoren
Das Spektrum äußerer Situationen, aus denen heraus ein Trauma entstehen kann, ist weit gefächert. Der Ausgangspunkt kann sowohl in einer natürlichen Katastrophe (natural disaster), bspw. durch die Folgen von Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Überschwemmungen oder Wirbelstürmen, als auch in von Menschen hervorgerufenen Katastrophen liegen (man made desasters). Hierzu zählen einerseits technisch bedingte Unfälle (bspw. Verkehrsunfälle, Großbrände oder ökologische Katastrophen) und andererseits die Erfahrung menschlicher Gewalt und Grausamkeit (bspw. durch Geiselnahme, Terrorismus, Folter, Krieg oder Genozid). Eine im Zusammenhang dieser Arbeit besonders relevante Typisierung eines „Man Made Desasters“ umfasst dabei die Katastrophen innerhalb einer Familie. Hierunter fallen etwa emotionaler, körperlicher oder sexueller Missbrauch, Vernachlässigung und das Erleben schwerer Gewalttätigkeit, aber auch bedrohlich empfundene Trennungserlebnisse (vgl. Riedesser 2015: 161).
Traumatische Erfahrungen stehen am Anfang eines Traumas. Nach Fischer/Riedesser wirken hier sowohl objektive Faktoren, welche über die äußerliche Betrachtungsweise einen Zugang zur Situation der Betroffenen ebnen (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 149-154), als auch subjektive Faktoren, welche die persönlichen Dispositionen der Betroffenen aufgrund aktueller Erwartungen oder überdauernder, psychisch, physiologisch oder sozial bestimmter Reaktionsbereitschaften widerspiegeln (vgl. ebd.: 159-164), zusammen. Im Mittelpunkt dieser Betrachtungsweise stehen also objektiv (von außen) wahrnehmbare Situationen, die aus subjektiver Perspektive (der Betroffenen) keine adäquate Reaktion zulassen (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 65).
2.2.1 Objektiver Zugang zum Trauma
Fischer/Riedesser unterscheiden im objektiven Zugang zum Trauma sechs Varianten:
1.) Schweregrad der traumatogenen Faktoren
Ob und wie stark sich ein Trauma entwickelt, hängt von dem Schweregrad der Stressoren ab. Im DSM III-R ist diesbezüglich eine sechsstufige Skala mit einigen Beispielen akuter und länger andauernder Lebensumstände angelegt. Traumatische Ereignisse werden dort als Ereignisse definiert, welche „außerhalb des normalen Erwartungsbereichs liegen und so für nahezu jeden Menschen eine schwere Belastung darstellen würden“ (Fischer/Riedesser 2009: 150). Während leichte oder mittlere Belastungsfaktoren, bspw. Auseinanderbrechen einer Freundschaft, Schulbeginn, Kind verlässt Elternhaus bzw. beengte Wohnsituation oder andauernde Familienstreitigkeiten (Code 2) sowie Trennung, Arbeitsplatzverlust, Pensionierung, Fehlgeburten bzw. permanent angelegte Probleme in der Ehe, in finanziellen Dingen oder am Arbeitsplatz (Code 3) für viele Menschen noch innerhalb des Erwartbaren stattfinden und sie aufgrund dessen in den meisten Fällen trotz eindeutig vorhandener Belastung nicht aus der Bahn geworfen werden, bedeuten extreme oder gar katastrophale Stressoren wie der Tod des Ehepartners, die Diagnose einer schweren Erkrankung, Opfer werden einer Vergewaltigung bzw. fortwährende Misshandlung oder sexueller Missbrauch (Code 5) sowie der plötzliche Tod/Selbstmord des Kindes oder Ehepartner_in bzw. Gefangenschaft als Geisel (Code 6) eine für nahezu alle Menschen unerwartbare Situation, die sie meist unvorbereitet trifft und die von daher als extremtraumatisch bezeichnet werden kann. Inwiefern kleinere, leichtere Belastungsfaktoren dennoch traumatisierenden Charakter entwickeln können, wird vor allem in Bezug auf die Folgen bei der frühkindlichen und kindlichen Entwicklung unter dem Begriff eines Mini- oder Mikrotraumas diskutiert, in denen ebenso die Grundlage für ein falsches Selbst-System gelegt werden kann, indem es sich automatisch an die Umwelt anpasst, ohne sich dabei jedoch in das eigene, wahre Selbst zu integrieren (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 149 f.).
2.) Häufung traumatischer Ereignisse und zeitliche Verlaufsstruktur
Lenore C. Terr hat eine Kategorisierung von Traumata in Typ I, als ein einmalig auftretendes und überwältigendes Ereignis („one single blow“) und in Typ II, als sich längerfristig entwickelnde Umstände vorgenommen. Analog dazu unterscheiden Fischer/Riedesser in mono- bzw. polytraumatisierende Ereignisse. Während Monotraumatisierungen dem Typ I entsprechen, wirken bei Polytraumatisierungen „verschiedene traumatische Ereignisse bzw. Umstände entweder simultan oder sukzessiv zusammen und vervielfältigen so gegenseitig die Auswirkungen auf das betroffene Subjekt“ (Fischer/Riedesser 2009: 151). Bei den sich sukzessiv aufbauenden Traumatisierungen unterscheidet die Literatur zusätzlich zwischen kumulativen Traumata, die sich während einer Folge traumatisierender Erfahrungen oft unterschwellig und langsam aufbauen, den natürlichen Erholungsprozess immer wieder unterbrechen und die restitutiven Kräfte der Betroffenen schwächen sowie sequentiellen Traumatisierungen, bei denen zeitlich auseinander liegende traumatisierende Erfahrungen (bspw. bei Opfern des NS-Regimes in den verschiedenen Verfolgungswellen) eine kohärente Verlaufsgestalt abbilden (vgl. ebd.).
3.) Betroffenheit des traumatisierten Subjekts
Dieser Zugang unterscheidet zunächst in eine unmittelbare und eine mittelbare Betroffenheit. Neben Menschen, die unmittelbar von einem traumatischen Ereignis betroffen sind oder es als Zeuge unmittelbar wahrnehmen (primäre Traumatisierung), können auch mittelbar Betroffene eine Traumatisierung erleiden. Dies können Menschen sein, die durch Berichte (bspw. aus Medien, Erzählungen, Lesen von Akten) von dem traumatischen Ereignis bspw. eines Familienmitglieds, einer anderen nahestehenden Person oder eines/einer Klient_in erfahren (sekundäre Traumatisierung) oder die durch eine trans- oder intergenerationale Weitergabe an der ursprünglichen Traumatisierung bspw. von NS-Opfern partizipieren (tertiäre Traumatisierung) (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 151 f.). Eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Sekundären Traumatisierung wird im dritten Kapitel dieser Arbeit vorgenommen.
4.) Verursachung und Verursachungsfaktoren
Über die in Punkt 1 bereits thematisierten Stressoren hinaus, die mehr oder weniger belastend auf die Betroffenen wirken, hat Arthur Green (1993) acht Faktoren beschrieben, die auf die jeweilige traumatisierende Situation bezogen sind und jeweils für sich allein bereits traumatisierend wirken können. Mit überzufälliger Treffsicherheit konnte Green Folgeerscheinungen im postexpositorischen Zeitraum vorhersagen, die den jeweiligen Faktoren zuzuordnen waren. Die im Folgenden benannten Situationsfaktoren können darüber hinaus additiv zusammenwirken und besonders belastende Ergänzungsverhältnisse hervorrufen (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 152):
1. „Bedrohung für Leib und Leben.
2. Schwerer körperlicher Schaden oder Verletzung.
3. Absichtlicher Verletzung oder Schädigung ausgesetzt sein.
4. Konfrontation mit verstümmelten menschlichen Körpern („exposal to the grotesque“).
5. Gewaltsamer oder plötzlicher Verlust einer geliebten Person.
6. Beobachtung von Gewalt gegen eine geliebte Person oder Informationen darüber.
7. Die Information, dass man einem schädlichen Umweltreiz ausgesetzt ist oder war.
8. Schuld haben am Tod oder an schwerer Schädigung anderer“ (Green 1993 zit. in: Fischer/Riedesser 2009: 152).
5.) Beziehung zwischen Opfer und Täter
Steht der Täter / die Täterin in einem Vertrauensverhältnis oder in einer engen Beziehung zu dem Opfer, wirken traumatische Situationen für die Opfer wesentlich komplexer. Die Erschütterung des Urvertrauens in die Zuverlässigkeit sozialer Beziehungen wirkt hier besonders nachhaltig, indem das Selbst- und Weltverständnis der Opfer generell beeinträchtigt wird. Der von Fischer/Riedesser unter der Bezeichnung „ Beziehungstrauma“ thematisierte Effekt kann bspw. bei Kindern beobachtet werden, die von ihren eigenen Eltern, die sie ja eigentlich schützen sollten, sexuell missbraucht oder körperlich misshandelt werden. Aber auch sexuelle Übergriffe oder Gewalthandlungen von anderen Bezugspersonen (bspw. Therapeuten oder nahestehende Freunde, Bekannte oder Lebenspartner) fallen in diese Rubrik (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 152).
6.) Klinische Situationstypologie
Ochberg führt fünf „klinische Paradigmen“ auf, die situative Konstellationen in unmittelbarem Zusammenhang mit sich daraus entfaltenden Dynamiken beschreiben: 1. Negative Intimität – Erzwungene Nähe etwa durch Geiselnahme, Vergewaltigung, Folter oder bei tätlicher Bedrohung wird von den Opfern als unerwünschtes Eindringen in die Privatsphäre empfunden, was Gefühle von Beschmutzung und Ekel hervorruft. Der sich daraus entwickelnde Drang, sich übergeben zu müssen, spiegelt das Bedürfnis der Opfer, jene Beschmutzung bzw. jenen Fremdkörper wieder loszuwerden. 2. Beraubung – Mit dem Verlust einer nahestehenden Person entwickelt sich bei den Betroffenen das Gefühl, eines Stücks seines Selbst beraubt worden zu sein. Hierauf folgen Trauer und Traurigkeit. 3. Victimisierung – Aus ihrem Verständnis, Opfer zu sein, entwickeln sich bei den Betroffenen Gefühle von Erniedrigung, Beleidigung und Herabsetzung. 4. Angst und Erregung – Jene physiologischen Bestandteile der Traumareaktion lösen bei ähnlichen situativen Reizen Erinnerungen an das Trauma hervor und können gar zu generalisierten Angstzuständen und Phobien anwachsen. 5. Todesnähe – Die Erfahrung von Todesnähe in traumatisierenden Situationen erzeugt eine andauernde Erwartungshaltung und Angst, dass der Tod jederzeit bevorstehen könnte. Grundsätzlich können zu einer Traumatisierung mehrere dieser Konstellationen beitragen, die in einer späteren Therapie dann jeweils gesondert zu berücksichtigen sind (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 153 f.).
2.2.2 Subjektiver Zugang zum Trauma
Für einen subjektiven Zugang zum Trauma haben Fischer/Riedesser fünf Faktoren vorgeschlagen, welche die persönlichkeitstypische Reaktionsbereitschaft in der Wechselbeziehung zwischen Situation, Situationsdeutung und disponierter Handlung sowie deren Auswirkung auf den Verlauf von Reaktion und Prozess darstellt:
- Aktuelle Disposition – Der Erwartungshorizont in Bezug auf eine traumatisierende Erfahrung ist für jede_n Betroffene_n individuell angelegt. Mal wiegt der zeitliche Überraschungseffekt besonders schwer, in anderen Fällen ist das Diskrepanzerlebnis zwischen dem Erwartbaren und dem Ausmaß oder der Brutalität für die Betroffenen so groß, dass es als eigener traumatogener Faktor zu berücksichtigen ist (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 159).
- Überdauernde Dispositionen – Die im Laufe ihrer Lebensgeschichte gesammelten, traumatischen wie protektiven Erfahrungen haben Auswirkungen auf die Funktionsweise des vegetativen Nervensystems und somit auf die Bearbeitungsfähigkeit der Betroffenen (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 160).
- Korrektive und protektive Faktoren – Während korrektive Faktoren auf eine gute Verarbeitung von Informationen während des traumatischen Prozesses oder in der Reaktionszeit hinwirken, bspw. durch hilfreiche soziale Beziehungen oder Psychotherapie, sind protektive Faktoren bereits biographisch vordisponiert und entwickeln gewissermaßen prophylaktisch eine schützende, abwehrende Wirkung gegenüber den Gefahren von Traumatisierungen. In empirischen Untersuchungen haben Egle et al. unter anderen folgende Schutzfaktoren herausgefunden: Eine dauerhaft gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson, kompensatorische Ersatzbeziehungen bspw. zu Großeltern, überdurchschnittliche Intelligenz, aktives und kontaktfreudiges Temperament, sicheres Bindungsverhalten, soziale Förderung (bspw. in Jugendgruppen, Schule, Kirche), geringe Gesamtbelastung durch Risiken. Auch weitere Studien deuten darauf hin, dass je mehr derart schützende Faktoren vorhanden sind, desto geringer ist die Gefahr nach schweren, potenziell traumatischen Situationen tatsächlich an traumatischen Belastungsstörungen zu erkranken. Und wenn dies dennoch geschieht, desto größer sind die Chancen auf einen günstigen Therapieverlauf (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 160 f.).
- Risikofaktoren – Wie bei den zuvor beschriebenen protektiven Faktoren handelt es sich auch bei den Risikofaktoren um biographische Ereignisse und Umstände, die allerdings belastend wirken und eine psychische Störung oder Erkrankung eher begünstigen. Einige der von Egle et al. in empirischen Untersuchungen herausgefundenen Risikofaktoren beziehen sich auf einen niedrigen sozioökonomischen Status der Herkunftsfamilie, auf eine schlechte Schulbildung der Eltern, auf Kriminalität oder Dissozialität. Aber auch psychische Störungen eines Elternteils, unsicheres Bindungsverhalten nach dem 12./18. Lebensmonat, häufig wechselnde frühe Beziehungen und sexueller Missbrauch gehören zu diesen Faktoren. In Bezug auf eine genderspezifische Betrachtung, deuten weitere Studien darauf hin, dass Jungen vulnerabler sind als Mädchen. Einzelne Risikofaktoren vergrößern im Zusammenwirken mit einem anderen Risikofaktor die Wahrscheinlichkeit einer Entwicklungsstörung um den Faktor 4. Da korrektive bzw. protektive Faktoren auf der einen und Risikofaktoren auf der anderen Seite gegenläufige Wirkungen entwickeln, schlagen Fischer/Riedesser vor, jene Faktoren in einem Traumaprofil zueinander in Beziehung zu setzen. Belastungen könnten so durch das Verfügbarmachen korrektiver Ressourcen ausgeglichen werden (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 162 f.).
- Differentielle physiologische Dispositionen – Hierunter fallen in erster Linie genetische Dispositionen, welche die Bewältigung kritischer Lebenssituationen erschweren können. Forschungsergebnisse aus den 1980er Jahren legen jedoch nahe, dass jene physiologischen Dispositionen auch auf neurophysiologische Auswirkungen bereits erlebter Traumata zurückzuführen sein können. Sich auf derartige Weise modifizierende biochemische Prozesse könnten insofern eine Erklärung sein für eher überreagierende oder eher vermeidend/depressive Verarbeitungsmuster (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 163 f.).
2.3 Neurobiologische Mechanismen
Die Hirnforschung hat in den letzten Jahrzehnten wesentlich neue Erkenntnisse gewonnen hinsichtlich der Funktionsabläufe und der chemischen Prozesse im Gehirn und der Verarbeitung und Speicherung von Reizen. Eine ausführliche Darstellung jener komplexen Vorgänge führt im Rahmen dieser Arbeit sicherlich zu weit. Für ein Verständnis menschlicher Reaktionsmechanismen auf extrem belastende Reize ist es im Zusammenhang mit Traumata und deren unmittelbaren und späteren Folgen jedoch von Bedeutung, einige wesentliche Aspekte der Zusammenwirkung der verschiedenen Teile des menschlichen Gehirns zu erläutern.
Der Beurteilungsprozess, ob ein über den Thalamus aufgenommener Reiz nun als „normal“ oder als „bedrohlich“ empfunden wird, findet in einer Art parallelen Bearbeitung von Hippocampus und Amygdala statt. Während das Hippocampus-System als Archiv unseres Gedächtnisses die Ansammlung von Reizen biografisch, episodisch und narrativ in die Erinnerungen eines Menschen integriert, übernimmt die Amygdala die Funktion einer Feuerwehr, welche die ankommenden Reize auf ihre Bedrohlichkeit hin überprüft und nötigenfalls gewisse Bereiche des Hirns vor Überlastung schützt, indem sie dort bestimmte Informationswege und Funktionsfähigkeiten blockiert, die bspw. für das Sprechen, das Schmerzempfinden oder das Abspeichern von Erinnerungen verantwortlich sind. Verständlich wird die Hierarchie und die unterschiedliche Aufgabenverteilung der beiden Systeme vielleicht am ehesten durch die Tatsache, dass die Amygdala stammesgeschichtlich das wesentlich ältere System ist, dessen vordringlichste Aufgabe es ist, zu jeder Zeit auf die Optionen von Flucht und Kampf (Flight or Fight) vorbereitet zu sein. Unmittelbar nach der Geburt ist das Amygdala-System in seinen wesentlichen Funktionen einsatzbereit, während der Hippocampus erst zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr in seinen Grundfunktionen fertig entwickelt und noch viel später, erst zwischen dem zehnten und zwölften Lebensjahr ausgereift ist (vgl. Huber 2012: 46 ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Schematisierte Darstellung von Janet Metcalfe’s Begriffen „Cool System“ und „Hot System of Memory under Stress nach Michaela Huber (2012: 44-51)
Janet Metcalfe hat jene Systeme als „cool system“ (Hippocampus) und „hot system of memory under stress“ (Amygdala) bezeichnet (vgl. Huber 2012: 44), dessen Anordnung und Ablauf schematisch in der Abb. 1 dargestellt ist. Zur Identifizierung eines „heißen“ Reizes verfügt die Amygdala über eine extrem schnelle Verbindung zum Thalamus, welche sie gewissermaßen als „Temperaturfühler“ nutzt und die eingehenden Meldungen mit ihren bis dahin gesammelten Erfahrungen abgleicht. Wird ein solcher Reiz im Zuge des Abgleichs als „heiß“ im Sinne von bedrohlich, gefährlich oder stark ängstigend identifiziert, setzt das Amygdala-System einen unmittelbaren Aktivierungsprozess für neurochemische und neuroanatomische Schaltungen in Gang und steuert die Stärke der Schreck- und Verteidigungsreaktion in kürzester Zeit, noch bevor weitere hormonelle Prozesse ausgelöst werden. Die Verbindungen zwischen Thalamus, Großhirn und Hippocampus werden größtenteils blockiert und lassen nur noch bruchstückhafte Informationen durch. Am Ende des darauf folgenden hormonellen Prozesses entlang der als HPA-Achse bezeichneten Kette zwischen H ypothalamus, Hypophyse (P ituitary) und Nebennierenrinde (A drenal Glands) gelangen die Hormone Adrenalin und Noradrenalin in den Körper, die wiederum Reaktionen von Kampf und Flucht stimulieren. Das ebenfalls dort produzierte Cortisol wirkt wiederum als stresshemmend in einer rückwärtsgerichteten Schleife auf Hypophyse, Hypothalamus und Hippocampus (vgl. Huber 2012: 44 ff.).
Wie schnell und unter welchen Bedingungen das Amygdala-System eine „Notfall“-Reaktion auslöst und das Hippocampus-System und andere Funktionsbereiche des menschlichen Hirns außer Gefecht setzt, ist bei jedem Menschen individuell angelegt und richtet sich nach deren biografisch einzuordnenden Erfahrungen. Das menschliche Gehirn ist in der Lage, sich in Zeiten stressreicher Ereignisse in unterschiedlicher Weise auf eine dauerhafte „Notfall“-Meldung der Amygdala einzustellen, indem es sich daran gewöhnt und bestimmte Segmente routinierten Handelns entwickelt. Eine Polizistin bspw. mit Vorerfahrungen aus lebensbedrohlichen Situationen könnte so bei einem Einsatz mit ähnlicher Bedrohlichkeit weniger angstvoll reagieren, gleichzeitig jedoch den Handlungsverlauf dissoziiert und wie in Zeitlupe wahrnehmen. Ihr partiell zunächst außer Gefecht gesetzter Hippocampus könnte sich durch die Cortisol-Stressbremse ggf. schneller wieder erholen als bei Vergleichspersonen ohne entsprechende Vorerfahrungen (vgl. Huber 2012: 50). Aber auch gegenteilige Varianten sind möglich. So kann bspw. bei stark vorbelasteten Personen die Erregungsschwelle so stark absinken, dass sich auch bei geringen Stressbelastungen die Notfallmeldung der Amygdala in Gang setzt und Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) auslöst (vgl. ebd.).
2.4 Verlauf psychischer Traumatisierungen
Fischer/Riedesser bilden in ihrem Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung die Entwicklung der traumatischen Situation, der darauffolgenden Reaktion und des traumatischen Prozesses ab (vgl. Abb. 2). Die von ihnen entwickelte schematische Darstellung verschafft einen groben Überblick über die Abfolgen und die faktoriellen Einflussnahmen im Verlauf eines Traumas. Die antezedenten und situativen Komponenten bis zum Moment der Schocksituation sind in ihren protektiven und korrektiven wie auch in ihren traumaförderlichen Wirkungen bereits in Kapitel 2.2 beschrieben worden. Auch was die Be- und Verarbeitung der Schocksituation anbelangt, können sowohl zusätzliche Belastungen als auch schützende, protektive Faktoren die Auswirkungen und die Bewältigungsversuche positiv oder negativ beeinflussen. Jene Faktoren tragen dazu bei, ob sich der Verlauf eher Richtung traumatischem Prozess bzw. einer Chronifizierung der traumatischen Störung oder in die Richtung einer Erholung (Completion) entwickelt. Ablaufschematisch haben Fischer/Riedesser den Verlauf eines Traumas in drei Phasen unterteilt, Schockphase, Einwirkungsphase und Erholungsphase (vgl. Fischer/Riedesser 2012: 170), die im Folgenden kurz dargestellt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: „Überblick über das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung“ (Fischer/Riedesser 2012: 145)
2.4.1 Schockphase
Entwickelt sich im Zusammenspiel der antezedenten und situativen Komponenten aus einer traumatischen Situation heraus ein Schock, kann diese erste Phase des Ablaufs je nach der Konstellation zusätzlicher belastender wie schützender Faktoren zwischen einer Stunde bis hin zu maximal einer Woche andauern (Fischer/Riedesser 2012: 170). Die körperlichen Reaktionen in einer derartigen Extremsituation sind, wie im Kapitel 2.3 dargestellt, höchst komplex und rufen bei den Traumatisierten sehr unterschiedliche Reaktionen hervor. Im Zuge der hormonellen Prozesse über die HPA-Achse sorgen Adrenalin und Noradrenalin für eine Erhöhung des Blutdrucks und des Pulses. Die Muskeln werden innerhalb von wenigen Millisekunden durch eine erhöhte Durchblutung mit zusätzlichem Sauerstoff und Blutzucker versorgt und bieten den Betroffenen eine wichtige Ressource zu den beiden Reaktionsoptionen „Kampf“ oder „Flucht“(Fight or Flight). Welche dieser Optionen dann tatsächlich ausgeführt wird, liegt weniger in der Entscheidungskompetenz der betroffenen Personen, als vielmehr in neuronalen und hormonellen Prozessen des autonomen Nervensystems. Jene Flucht- oder Kampf-Reaktionen sind Relikte der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen. Das Großhirn ist an diesem Prozess zunächst nicht beteiligt, allein das Stammhirn steuert die Reaktionen. Dennoch haben auch personen- und situationsspezifische Faktoren einen Einfluss darauf, wie genau die Reaktionskette des Stammhirns abläuft. In günstiger Dispositionslage könnte jene Reaktionskette bspw. erst dann in Gang gesetzt werden, wenn sich zusätzlich zum Stammhirn auch der Präfontale Cortex eingeschaltet hat und sich so Sinneseindrücke aus der Situation angemessener in die Reaktionsentscheidung integrieren lassen. Greifen all diese Faktoren, und gestalten sich die darauf folgenden Reaktionen von „Fight“ oder „Flight“ erfolgreich, kommt es im optimalen Verlauf erst gar nicht zu einer Traumatisierung (vgl. Huber 2012: 41 f.).
In Situationen, die jedoch weder „Fight“ noch „Flight“ zulassen, entsteht eine Klemme, die Huber als die „Traumatische Zange“ (Huber 2012: 38) bezeichnet. Wenn Menschen in entsprechend stressreichen, (lebens-)bedrohlichen Situationen weder gegen eine derartige Bedrohung ankämpfen, noch vor ihr fliehen können, bleiben für sie zwei weitere Notfall-Reaktionen, die Körper und Geist vor einer Reizüberflutung schützen sollen. Diese beiden Reaktionsoptionen werden in der Traumaliteratur als „Freeze“ und „Fragment“ bezeichnet. Mit dem Einsetzen körperlicher Erstarrung und der Zersplitterung von Erfahrungen in nicht mehr geschlossen wahrnehm- und erinnerbare Fragmente ist klar, dass von diesem Moment an für die betroffenen Menschen das Ereignis als Trauma stattfindet (vgl. Huber 2012: 38 f., 43). Im Freeze- oder auch Totstell-Reflex bezeichneten Prozess ist der Körper eines Menschen wie gelähmt. Da keine Möglichkeit mehr besteht, entsprechende Bedrohungen äußerlich niederzuringen (etwa durch Fight or Flight), versucht das Gehirn genau dies nun in einem internen Prozess, der dem Organismus erlaubt, sich von dem aggressiven Reiz zu distanzieren oder ihn abzuspalten. Durch die Ausschüttung hoher Mengen von Endorphinen wird das Schmerzempfinden bekämpft, und die Produktion von Noradrenalin blockiert die Wahrnehmung in Form eines Tunnelblicks. Obwohl in einer entsprechend lebensbedrohlichen Situation Reaktionen wie Schreien oder um Hilfe rufen adäquater wären (bspw. im Hinblick auf eine Rettung), ist der Traumatisierte in dieser Phase vom Geschehen entfremdet und kann erst hinterher, oft erst nach Stunden oder Tagen (etwa mit Tränen oder Zusammenbrechen) reagieren, wenn die Sicherheit wieder hergestellt und der Alarmzustand des Gehirns wieder heruntergeschaltet ist (vgl. Huber 2012: 43). Es gibt Hinweise, dass die Copingstrategien von Fight, Flight und Freeze bereits zum angeborenen Repertoire in Bezug auf Abwehr und Verarbeitung traumatischer Reize gehören (vgl. Riedesser 2015: 167f.).
In der Reaktion des Fragmentierens wird das äußere Ereignis in kleine und kleinste Teile zerlegt. Eine geschlossene Erinnerung an die Geschehnisse ist später nur mit gezielten und besonderen Anstrengungen zu erreichen, wenn nicht gar unmöglich. Die erinnerbaren Fragmente lassen oft nicht mehr erkennen, was genau passiert ist, sondern allenfalls, dass etwas passiert ist (vgl. Huber 2012: 43f.).
Kennzeichnend für die Schockphase sind:
„Veränderungen des Zeiterlebens wie Zeitraffer oder Zeitlupe; veränderte Wahrnehmungsweisen wie Tunnelsicht; bei den dissoziativen Erlebnisformen wie Derealisierung oder Depersonalisierung zeigen sich breite intersituative und/oder interindividuelle Unterschiede in dem Sinne, dass ein höherer Belastungsgrad mit vermehrter Dissoziation einhergeht“ (Fischer/Riedesser 2009: 170).
2.4.2 Einwirkungsphase
Mit Ausklingen der Symptomatiken der Schockphase setzt die Einwirkungsphase ein, die bis zu zwei Wochen andauern kann (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 170). Abhängig von den äußeren Begleitumständen zusätzlicher Belastungen oder schützender Faktoren versuchen die Traumatisierten das Geschehen, dessen Umstände sie allenfalls bruchstückhaft erinnern können, in ihren Alltag mehr oder weniger erfolgreich zu integrieren. Weniger günstige Verläufe zeichnen sich aus durch akute Belastungsstörungen mit Symptomen von Ärger und Schuldzuweisungen gegenüber Personen des Umfelds (Familie, Kolleg_innen oder Vorgesetzte am Arbeitsplatz, Polizei, Rettungsdienst…), Selbstzweifel, depressive Stimmungen bis hin zu Gefühlen von Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Überlebensschuld und einer daraus abgeleiteten Art von Selbstanklage, das Überleben der bedrohlichen Situation nicht verdient zu haben. Weitere mögliche Symptome sind Schlaf- und Einschlafstörungen, Überwachheit, Übererregbarkeit, erhöhte Schreckhaftigkeit sowie Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen und sogenannte „Flash-Backs“ (Rückblenden aus der traumatischen Situation) (vgl. ebd.).
2.4.3 Erholungsphase
Gelingt es durch innere protektive Faktoren und/oder äußere Hilfen nicht, die Erholung (Completion) vom Trauma einzuleiten, droht der traumatische Prozess sich in einer langfristigen Belastungsstörung zu chronifizieren. Im günstigeren Fall jedoch setzt im Anschluss an die Einwirkungsphase die Erholungsphase ein, die wiederum zwischen zwei und vier Wochen andauert (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 170). Diese Phase sollte nach Fischer/Riedesser vor allem begleitet werden durch viel Ruhe und Entspannung sowie durch ein Fernhalten von der traumatischen Umgebung und den für das Trauma in ursächlichem Zusammenhang stehenden Stressoren, da die erneute Konfrontation zu einer kumulativen Wirkung jener Stressoren führen können. Ein positiver Verlauf der Erholungsphase kann darüber hinaus durch die Vermeidung von Drogen und Alkohol, die Mobilisierung sozialer Unterstützung und den kommunikativen Austausch über die traumatisierende Erfahrung mit Personen des Vertrauens und anderen von der traumatischen Situation Betroffenen gefördert werden (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 170f.).
2.4.4 Akute Belastungsstörungen und PTBS
In der zehnten Revision der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden die Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen infolge des Erlebens traumatischer Situ-ationen in akute Belastungsstörungen (F43.0) und längerfristige posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) unterschieden (F43.1). Im DSM-IV ist die Diagnose jener akuten Belastungsreaktionen an die Verursachung eines klinisch bedeutsamen Leidens oder einer Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen für einen Zeitraum von wenigstens einem Monat bis zu maximal drei Monaten geknüpft. Hält dieses Störungsbild länger an, wird eine chronische Belastungsstörung diagnostiziert, die der PTBS nach ICD-10 entspricht. Ein verzögerter Beginn liegt dann vor, wenn die Symptome frühestens sechs Monate nach dem Belastungsfaktor eintreten (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 48). In den meisten Fällen kann bei akuten wie bei chronischen Belastungsstörungen mit traumatischer Ursache eine Heilung erzielt werden, in wenigen Fällen jedoch kann die Störung auch zu einer dauerhaften Persönlichkeitsänderung (F62) führen (vgl. Dilling/Freyberger 2016: 170).
2.4.5 Integrationsformen akuter und posttraumatischer Belastungsstörungen
Das Störungsbild kann höchst unterschiedliche Erscheinungsformen annehmen, was sowohl die Diagnose als auch die Behandlung der Störung erschwert. Die Erkennung eines Zusammenhangs mit der nicht selten Jahre zurückliegenden, ursächlichen traumatisierenden Situation erfordert daher eine große Fachlichkeit und Sorgfalt bei der Anamnese des jeweiligen Falles (vgl. Seidler 2013: 37). Im Folgenden sind einige wesentliche Symptomatiken analog zum „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ der American Psychiatric Association (im DSM-IV und seit 2013 im DSM-V) und mögliche Spätfolgen zusammengefasst, die im direkten Zusammenhang mit einer traumatisierenden Situation gesehen werden.
Hyperarousel – Der am ehesten mit „Überregbarkeit“ oder „Überregtheit“ zu übersetzende Begriff bezeichnet zunächst ganz allgemein den Zustand einer „…extrem erhöhten physiologischen Aktivierung nach der Exposition an ein lebensbedrohliches Ereignis“ (Seidler 2013: 37). Im Zusammenhang mit PTBS wird dieser Begriff als Symptomcluster eingesetzt, in dem die entsprechende Diagnose an mindestens zwei der folgenden Erscheinungsformen geknüpft wird:
- Einschlaf- und Durchschlafstörungen
- Reizbarkeit oder Wutausbrüche
- Konzentrationsschwierigkeiten
- grundlose, übermäßige Wachsamkeit (Hypervigilanz)
- übermäßige Schreckreaktionen
(vgl. Fischer/Riedesser 2009: 47 f.).
Wiedererleben (Intrusion) – Intrusionen sind unerwünschte vollständige oder teilweise Erinnerungen an die traumatische Situation. Bei dem auch unter dem Begriff „Flashback“ bezeichneten Phänomen sind die Betroffenen nicht in der Lage, zwischen dem „Hier und Jetzt“ und dem „Dort und Damals“ zu unterscheiden. Die oftmals von Schlüsselreizen, sogenannten Triggern ausgelösten Intrusionen unterscheiden sich von normalen Erinnerungen, indem sie sich nicht willentlich beeinflussen lassen und ihre meist fragmentarischen Bruchstücke des Erlebten sich nicht in den Gesamtkontext der Ereignisse integrieren lassen (vgl. Scherwath/Friedrich 2016: 28 ff.). Im DSM-IV sind folgende Variationen hierfür aufgeführt:
1. „Wiederkehrende und eindringliche belastende Erinnerungen an das Ereignis, die Bilder, Gedanken oder Wahrnehmungen umfassen können. (…)
2. Wiederkehrende belastende Träume von dem Ereignis. (…)
3. Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische Ereignis wiederkehrt (beinhaltet das Gefühl, das Ereignis wiederzuerleben, Illusionen, Halluzinationen und dissoziative Flashback-Episoden, einschließlich solcher, die beim Aufwachen oder bei Intoxikationen auftreten.) (…)
4. Intensive psychische Belastung bei Konfrontation mit internalen und externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte derselben erinnern.
5. Körperliche Reaktionen bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern.“ (Fischer/Riedesser 2009: 47)
Vermeidung (Konstriktion) – Bei der Konstriktion handelt es sich sowohl um die anhaltende willentliche Vermeidung aller an die traumatische Situation erinnernden Reize, als auch um unwillkürlich erzeugte dissoziative Bewusstseinszustände, die in vielen Fällen zu sozialem Rückzug und Ausgrenzung der Betroffenen führen (vgl. Scherwath/Friedrich 2016: 31 f.). Im DSM-IV ist die PTBS-Diagnose an das Zutreffen von drei der folgenden Punkte geknüpft:
1. „Bewusstes Vermeiden von Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen,
2. bewusstes Vermeiden von Aktivitäten, Orten oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen,
3. Unfähigkeit, sich an einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern,
4. deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivitäten,
5. Gefühl der Losgelöstheit oder Entfremdung von anderen,
6. eingeschränkte Bandbreite des Affekts (z.B. Unfähigkeit, zärtliche Gefühle zu entwickeln),
7. Gefühl einer eingeschränkten Zukunft (z.B. erwartet nicht, Karriere, Ehe, Kinder oder normales Leben zu haben).“ (Fischer/Riedesser 2009: 47)
2.4.6 Weitere mögliche Folgen von PTBS
Victimisierungssyndrom – Diese Kategorie von Traumafolgen, in denen die Opferaspekte in einem oder mehreren Episoden physischer Gewalt, psychischem Missbrauch oder Nötigung zu sexueller Aktivität eine wesentliche Rolle spielt, ist in den bisher zitierten Diagnosemanuals von DSM-IV und ICD-10 noch nicht explizit enthalten. Frank Ochberg sieht aus entsprechenden Erfahrungen entwickelte Folgestörungen bei Opfern und Zeugen als Syndrom, wenn das Störungsbild mindestens einen Monat andauert und eine noch festzulegende Anzahl folgender Kriterien zutrifft (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 50f.):
1. „Ein Gefühl, den täglichen Aufgaben und Verpflichtungen nicht mehr gewachsen zu sein, welches über das Erlebnis von Ohnmacht in der speziellen traumatischen Situation hinausgeht (z.B. allgemeine Passivität, mangelnde Selbstbehauptung, oder fehlendes Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit).
2. Die Überzeugung, dass man durch die Victimisierungserfahrung dauerhaft beschädigt ist (z.B. wenn ein missbrauchtes Kind oder ein Opfer von Vergewaltigung der Überzeugung ist, dass es für andere nie mehr attraktiv sein kann).
3. Gefühle von Isolation, Unfähigkeit, anderen zu vertrauen oder mit ihnen Intimität herzustellen.
4. Übermäßige Unterdrückung oder exzessiver Ausdruck von Ärger.
5. [Un]Angemessene [sic!] Bagatellisierung von zugefügten (psychischen oder physischen) Verletzungen.
6. Amnesie des traumatischen Erlebnisses.
7. Die Überzeugung des Opfers, an dem Vorfall eher die Schuld zu tragen als der Täter.
8. Eine Neigung, sich der traumatischen Erfahrung erneut auszusetzen.
9. Übernahme des verzerrten Weltbildes des Täters in der Einschätzung von sozialangemessenem Verhalten (z.B. die Annahme, dass es in Ordnung ist, wenn Eltern sexuelle Beziehungen zu ihren Kindern unterhalten oder dass es in Ordnung ist, wenn ein Ehemann seine Frau schlägt, damit sie gehorcht).
10. Idealisierung des Täters.“
(Fischer/Riedesser 2009: 51)
Komplexe posttraumatische Belastungsstörungen – Das Störungsbild dieser Kategorie wird im ICD-10 ebenfalls noch nicht explizit im Zusammenhang mit Traumaerfahrungen benannt und ist infolge dessen eher allgemein in F62.0 einer „andauernde[n] Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung“ zuzuordnen. Zur Aufnahme in den DSM-V haben Herman/van der Kolk in der Arbeitsgruppe „Diagnosis of Extreme Stress Not Otherwise Specified“ (DESNOS) einen Kriterienkatalog mit sieben Punkten vorgeschlagen, der diesen Bezug hinsichtlich der Folgen schwerster, langanhaltender und wiederholter Traumatisierung (etwa nach Folter oder Lagerhaft und im Zusammenhang dieser Arbeit relevant: nach fortgesetzter Misshandlung bei Kindern) herstellt (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 51 f.).
Unter anderem weisen folgende Kriterien auf das Vorliegen dieses Störungsbildes hin:
1. Opfer totalitärer Systeme im sexuellen und familiären Bereich wie Überlebende familiärer Gewalt, Kindesmisshandlung und sexueller Missbrauch
2. Modifikation der Affektregulierung, andauernde dysphorische Verstimmungen, Suizidgedanken, Selbstverletzungen, extreme herausgelassene oder unterdrückte Wut, zwanghafte oder extrem gehemmte Sexualität
3. Bewusstseinsveränderung: Amnesie, Hypermnesie traumatischer Ereignisse, dissoziative Phasen, Depersonalisation/Derealisation, Intrusionen
4. Veränderung des Selbstbildes, Hilflosigkeit, Initiativverlust, Scham, Schuldgefühle, Verlust Selbstwert, Gefühl, völlig verschieden von anderen zu sein
5. Veränderung der Wahrnehmung des Täters (unrealistisch, idealisiert), Dankbarkeit gegenüber dem Täter, Übernahme/Rechtfertigung seiner Weltanschauung u. Handlungen
6. Veränderung sozialer Beziehungen, Isolation, Rückzug, Abbruch intimer Beziehungen, Suche nach einem Retter, permanentes Misstrauen, wiederholtes Versagen beim Schutz der eigenen Person
7. Veränderung der Stimmungslagen und Einstellungen, Verlust von Zuversicht, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 52)
Dissoziative Identitätsstörung – Laut Fischer/Riedesser deutet vieles darauf hin, dass traumatische Erfahrungen auch dissoziative Störungsbilder entwickeln können, welche sich in besonders extremen Varianten gar durch eine multiple Persönlichkeitsorganisation mit zwei oder mehreren unterschiedlichen Identitäten manifestiert, die wiederholt Kontrolle über das Verhalten der Persönlichkeit ausüben, oft mit der Folge, dass die Traumatisierten sich nicht mehr an wichtige persönliche Geschehnisse erinnern können (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 53).
Gefahr von Retraumatisierungen – Wie in den Unterkapiteln zum Verlauf psychischer Traumatisierungen bereits angeklungen ist, greifen Menschen mit traumatischen Vorerfahrungen auf unterschiedliche Ressourcen hinsichtlich einer zukünftigen Bewältigung von belastenden Ereignissen zurück. Je nachdem, ob sie als erfolgreiche Bewältigung wahrgenommen werden und sich in die zukünftige Biografie als stärkende Ressource integrieren lassen oder ob sie als zusätzlicher Belastungsfaktor in Zusammenwirkung mit der Verarbeitung neuer potenziell traumatisch wirkender Erfahrungen das Potenzial besitzen, alte Wunden wieder aufzureißen und den Traumaprozess erneut in Gang zu bringen, haben sie in der Zukunft einen protektiven Charakter oder sie bergen die Gefahr von Retraumatisierungen. Seidler (2013) betont, dass ein Traumaereignis immer ein Entmächtigungsgeschehen ist, bei der die Betroffenen zum Objekt und Spielball eines stärkeren, mächtigeren Etwas oder Jemandem wird (vgl. Seidler 2013: 38).
„Daraus resultiert als Leitaffekt jeder Traumatisierung ein alle Lebensbereiche durchfärbendes Ohnmachtserleben. Alles, was dieses Ohnmachtserleben wieder aktualisiert, über eine neue Ohnmachtserfahrung, eine Erfahrung, etwas oder jemanden nicht kontrollieren zu können, kann im psychotraumatologisch zutreffenden Sinn als Retraumatisierungsereignis aufgefasst werden, jede erneute Verwundung durch eine derartige erneute Ohnmachtserfahrung als Retraumatisierung.“ (ebd.)
2.5 Abwehrmechanismen und Bewältigungsstrategien (Coping)
Menschen, die mit einer potentiell traumatisierenden Situation konfrontiert werden, werden ihr Möglichstes versuchen, eine psychische Verletzung abzuwehren, und wenn sie dann doch eintritt, sie zu überwinden und das Geschehene mit dem zu Tuenden erfolgreich in Passung zu bringen. Während der Schockphase geschieht dies bereits reflexartig durch Abwehrmechanismen wie die bereits beschriebenen Fight- oder Flight-Reaktionen. Paul Valent beschreibt in seinem Beitrag zu Überlebens-Strategien neben jenen Kampf- und Fluchtreaktionen noch sechs weitere Kategorien, die als Basiskomponenten helfen können, über das Herunterbrechen immenser biologischer, psychologischer und sozialer Informationen auf bedeutsame aber einfache und logische Strukturen biopsychischer Reaktionen das Überleben zu sichern: Rettung/Befreiung (rescue), Anhängen (attachment) im Sinne von Gerettetwerden, Durchsetzungskraft/Selbstbewusstsein (assertiveness), Akzeptanz (acceptance), Wettbewerb (competition) und Kooperation (cooperation) (vgl. Valent 2015: 21-27). Einige dieser Optionen sind eher typisch für primärtraumatische Situationen (bspw. Fight oder Flight), andere wiederum legen in ihren Strategien den Einbezug anderer außenstehender Personen fest und bilden damit bereits eine Schnittstelle zum Phänomen der Sekundären Traumatisierung (bspw. Attachment).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Überlebensstrategien – Survival Strategies (Valent 2015: 28 – eigene Übersetzung)
Valents Modell (vgl. Abb. 3) jedoch isoliert zu betrachten als Überlebensstrategien für primäre oder sekundäre Belastungen würde die Übersicht gemeinsamer funktionaler wie dysfunktionaler Mechanismen erschweren. Sie werden daher bereits an dieser Stelle im Gesamtzusammenhang von Abwehr- und Copingmodellen dargestellt. Überlebensstrategien sind Reaktionen, die sich zwischen der (lebens-)bedrohlichen Situation (Stress) und der Krankheit/Störung entwickeln über kognitive Beurteilungen von Sinneswahrnehmungen, bereits gemachte Erfahrungen und Selbsteinschätzungen. Sie können sowohl angepasste als auch unangepasste Formen annehmen. Letztere rufen wiederum neue Stressreaktionen hervor, die im Falle ebenfalls schlechter bzw. fehlender Anpassungsfähigkeit zu Spannungen, Traumata, Krankheit oder gar Tod führen können. Abwehrreaktionen (bspw. Betäubung oder Fragmentierung im frühen oder Unterdrückung, Phobien oder Verdrängungen im späteren Verlauf) versuchen den Schaden des Traumas bzw. seiner Wiederholung zu minimieren (vgl. Valent 2015: 28). Krankheit sieht Valent als eine Art Notlösung, welche das Gleichgewicht nach einem Trauma wieder herstellt, indem sie gleichermaßen Aspekte des Traumas und der Abwehr dagegen enthält. In diesem Prozess wirkt die Ausstattung, wirken die Begabungen der Traumatisierten schützend gegenüber den schädlichen Effekten des Stresses, während die Verletzlichkeiten (vulnerabilities) die negativen Folgen deutlich verstärken (vgl. Valent 2015: 29).
Survival Strategies sind nach Valent gekennzeichnet durch 1) ihre evolutionäre Anpassung, 2) ihre Steuerung in stammesgeschichtlich uralten Teilen des Hirns, 3) der Integration biologischer, psychologischer und sozialer Aspekte in funktionalen Einheiten, 4) acht Varianten (vgl. Tab. 1), die sich unterschiedlich kombinieren können, 5) Anpassungsfähigkeit vs. schlechte oder keine Anpassungsfähigkeit, 6) identische oder komplementäre Effekte auf die Überlebensstrategien anderer Menschen, 7) Anpassung an die innere und äußere Bewertung der Angemessenheit, 8) Versinnbildlichung auf einer höheren Ebene in ihrer Bedeutung, in Werten der Menschlichkeit oder in anderen existenziellen Dingen (vgl. Valent 2015: 29ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Überlebensstrategien und deren Bestandteile – Survival Strategy Components (Valent 2015: 32 - eigene Übersetzung)
Die in der Übersicht der Tab. 1 dargestellten acht Survival-Varianten lassen sich als vier komplementär zueinander ausgerichtete Strategie-Paare beschreiben, denen jeweils biologische, psychologische und soziale Merkmale sowohl für die erfolgreichen/anpassungsfähigen als auch für die missglückten/unangepassten Reaktionsoptionen zugeordnet sind. Erweisen sich die Reaktionen als anpassungsfähig und erfolgreich, wird es im optimalen Fall zu keiner Traumatisierung kommen und die Betroffenen können die hier gemachten Erfahrungen gar als Ressource für ihr weiteres Leben nutzen. Die von Valent dargestellten Survival-Strategien beinhalten sowohl Abwehr als auch Bewältigungsoptionen, die Fischer/Riedesser folgendermaßen unterscheidet:
„Während Abwehrmechanismen auf die Erhaltung des inneren Gleichgewichts eines biologischen, psychischen oder sozialen Systems gerichtet sind und darüber im Konfliktfall die umgebende Realität vernachlässigen, zielt Coping ab auf „Einpassung durch Anpassung“ (Assimilation durch Akkommodation) im Rahmen des pragmatischen und/oder kommunikativen Realitätsprinzips“ (Fischer/Riedesser 2009: 384).
Für die differenzielle Psychotraumatologie sind nach Fischer/Riedesser besonders vier Copingstile von Bedeutung, welche hier kurz dargestellt werden sollen.
Instrumentelles Coping – Der instrumentelle Copingstil ist in seinem pragmatischen Bewältigungsverhalten auf die Problemlösung ausgerichtet. Das Handeln wird allein von der Logik des Erfolges bestimmt, vor allem im Umgang mit Gegenständen. Daher findet sich dieser Copingstil vor allem bei der Bewältigung von Naturkatastrophen wieder (vgl.Fischer/Riedesser 2009:165, 393).
(Gefühls-)Expressives Coping – Derart entwickeltes Bewältigungsverhalten ist hingegen an einem kommunikativen Realitätsprinzip orientiert und entfaltet sich folglich vor allem in der Bewältigung sozialer Traumatisierungen wieder, wo ein soziales Vertrauensverhältnis erschüttert wird. Im Mittelpunkt steht die Mitteilung von Gefühlen bei gleichzeitiger Ausblendung der ursächlichen Situation, was für die Problemlösung in vielen Fällen jedoch wenig hilfreich ist. Abwehrmechanismen wie Verleugnung und Vermeidung ziehen meist Hilf- und Hoffnungslosigkeit, ein Anwachsen der Vulnerabilität und schließlich gar emotionale Anästhesie nach sich (vgl. ebd.).
Kognitive Restrukturierung – Dieser Copingstil zielt nicht auf die auf eine objektive Änderung der traumatischen Situation, sondern auf seine subjektive Bedeutung. Derart neu konstruierte Auffassungen können sich sowohl über eine realistische Deutung von Schlüsselreizen als auch im Sinne einer realitätsverzerrenden Sichtweise bilden und haben dementsprechend unterschiedliche Folgen. Entwickelt sich in der Umdeutung ein genaueres Verständnis der äußeren traumatischen Bedingungen und der inneren Erlebnissituation, können sich daraus geeignete und hilfreichere Lösungsmöglichkeiten entwickeln. Durch Verleugnung und Verzerrung der traumatischen Zusammenhänge und durch die daraus abgeleiteten neuen Handlungsweisen und Generalisierungen kann jedoch eine Problemlösung dauerhaft erschwert werden (vgl. Fischer/Riedesser 2009: 165).
Flexibles (resilient) Coping – In dieser Copingstrategie verfügen die Betroffenen über eine gewisse Auswahl an Kontrollstrategien, die veränderbare Situationsfaktoren im Hinblick auf realistische Wahrnehmung, Bewertung und mögliche Lösungen in den Fokus nehmen. Sind die Gegebenheiten jedoch unabänderlich, flexibilisieren kognitive Neu- und Umbewertungen das Handlungsspektrum (vgl. ebd.).
2.6 Folgen traumatischer Erfahrungen in der Entwicklung von Kindern
Die im Unterkapitel 2.3 dargestellten neuronalen Prozesse über die Hippocampus- und Amygdala-Systeme und die Tatsache, dass die Entwicklung des Hippocampus-Systems bei Kindern bis zum etwa zwölften Lebensjahr noch nicht abgeschlossen ist (mit all den damit verbundenen Folgen differierender Verarbeitungswege und Ressourcen), machen nachvollziehbar, warum sich Traumatisierungen bei Kindern schneller entwickeln, warum deren Folgen länger andauern und deren Auswirkungen stärker sind, als dies bei Erwachsenen der Fall ist. Neben dem im Unterkapitel 2.4 bereits dargestellten Verlaufsmodell und den verschiedenen Wirkungsweisen haben Traumata bei Kindern besondere Formen und Auswirkungen sowohl auf deren weitere Entwicklung als auch auf ihr posttraumatisches Beziehungs- und Bindungsverhalten.
2.6.1 Kindliche Hirnentwicklung
Hüther bringt die stammesgeschichtlichen Vor- und Nachteile der Neuroplastizität im menschlichen Hirn in einem Fachbeitrag auf den Punkt: „Keine andere Spezies kommt mit einem derartig offenen, lernfähigen und durch eigene Erfahrungen in seiner weiteren Entwicklung und strukturellen Ausreifung formbaren Gehirn zur Welt wie der Mensch“ (Hüther 2013: 9). Zur Entfaltung potentiell möglich werdender Kompetenzen und der dafür notwendigen Entwicklungsprozesse im Gehirn sind Kinder noch für einen langen Zeitraum nach der Geburt und in hohem Maße auf die emotionalen, sozialen und intellektuellen Kompetenzen erwachsener Bezugspersonen angewiesen (vgl. ebd.). Der Mensch wird von verschiedenen Verhaltensforschern daher gelegentlich auch als „soziale Frühgeburt“ bezeichnet (vgl. Huber 2012: 88). In einem derart sicheren Rahmen lernen Kinder in den ersten Lebensjahren, angemessen auf belastende Si-tuationen zu reagieren, erfolgreiche Strategien zu entwickeln und dass der Welt, in der sie sich befinden, ein gewisses Urvertrauen entgegengebracht werden kann. All dies geschieht über neuronale Verschaltungen im Gehirn, die von positiven, angenehmen wie negativen, stressigen Reizen getriggert werden. In dem Maße, wie die protektive Funktion einer sicheren emotionalen Bindung aus was für Gründen auch immer nicht zur Verfügung steht, steigt auch die Gefahr frühkindlicher und kindlicher Traumatisierungen, ganz besonders, wenn Kinder die fatale Erfahrung machen, dass Bezugspersonen, die normalerweise Sicherheit bieten sollten, keine Sicherheit mehr bieten (vgl. Hüther 2013: 16 ff.).
In den meisten solch problematischer Fälle entwickeln sich Traumatisierungen bei Kindern in einem schleichenden Prozess, der immer bedrohlicher wird und sich immer weiter zuspitzt. Gelingt es diesen Kindern nicht, sich während dieses Destabilisierungsprozesses ihre Denk- und Verhaltensmuster so zu reorganisieren, dass sie mit den Bedingungen der Umwelt erfolgreich kooperieren können, kommt es aus neurobiologischer Sicht über kurz oder lang zu einem Zusammenbruch ihrer integrativen neuronalen, endokrinen und immunologischen Regelmechanismen. Noch fataler können sich unmittelbar, ohne Vorwarnung auftretende traumatisierende Situationen auswirken (Typ I), da die so Traumatisierten hier keine Gelegenheit zur Reorganisation und zur Bildung neuer Verschaltungsmuster in Form von „Umgehungsstraßen“, „Verbotszonen“, „Rastplätzen“ oder „verkehrsregelnden Leiteinrichtungen“ haben; sie haben so eine wesentlich geringere Chance auf Abwehr des Traumas. Ein derartiger Destabilisierungsprozess kann irreversible Schäden vor allem am hippocampischen System über eine Degeneration von Dendriten1 und Nervenzellen hervorrufen. Aber auch wenn es gelingt, jenen lebensbedrohlichen Destabilisierungsprozess durch neue Verschaltungen zum Stoppen zu bringen, können derartige neue Bahnungsprozesse tiefgreifende und weitreichende Folgen haben, indem bspw. Erinnerungen an die traumatische Situation nicht mehr abgerufen werden können, die emotionale Reaktionsfähigkeit und die ihr zugrunde liegende Aktivität und Aktivierbarkeit der HPA-Achse unterdrückt wird und von außen betrachtet oft nicht nachvollziehbare, zwanghafte, aggressiv-destruktive Reaktionen gegenüber anderen oder sich selbst erfolgen (vgl. Hüther 2015: 101-104).
[...]
1 Zellfortsätze von Nervenzellen, die der Reizaufnahme dienen
- Arbeit zitieren
- Heinrich Bellinghausen-Thomas (Autor:in), 2019, Sekundäre Traumatisierung bei Pflegeeltern. Kann die Arbeit mit traumatisierten Pflegekindern zu eigenen Belastungsstörungen führen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445369
Kostenlos Autor werden

















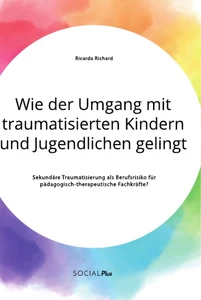




Kommentare