Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Entfremdung: Erfindung des Bildungsphilisters oder Tatsache?
KAPITEL 1: Theoretische Vorüberlegung
1.1 Zur Methode
1.1.1 Erkenntnistheorie
1.1.2 Zur Methode (des Geschichtenerzählens)
1.2 Grundbegriffe
§ 3. Entfremdung
§ 4. Welt
These
KAPITEL 2: Die Entfremdung von der Welt
2.1 Das Teleskop
2.2 Galileo Galilei
2.3 René Descartes
KAPITEL 3: Die Entfremdung vom eigenen Selbst
3.1 Die Verhöflichung des Kriegers
3.2 Das Öffentlich-Werden des Privaten, der Arbeit
3.3 Enteignung und die puritanische Angst
KAPITEL 4: Was sollen wir tun?
4.1 Zum Widerspruch zwischen dem Prinzip eines allgemeinen Fortschrittes und dem Faktum der Endlichkeit des Einzelnen
4.2 Zur Lehrbarkeit von Urteilskraft
§ 5. Der „sensus communis“ als Prinzip pädagogischen Handelns, in Praxis und Theorie
Literaturverzeichnis
Entfremdung: Erfindung des Bildungsphilisters oder Tatsache?
Gefühle auf den Begriff zu bringen, ist nicht leicht und dieses Problem mehr theoretischer Natur wurde mir zusätzlich noch dadurch erschwert, dass ich bei den zahlreichen Entfremdungstheoremen moderner Autoren, auf welche ich bei meinen Studien gestoßen bin, bis auf den heutigen Tag nur schwer sagen kann, was mich skeptischer gestimmt hat: dass mir der philisterhafte Ton unsympathisch ist, in welchen diese meistens vorgetragen werden? oder: dass ich – trotz dieser Antipathie – nicht umhin komme, ihnen in einigen Punkten zuzustimmen?
In diesem Sinn ist mein Ziel, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und der Erfahrungsbasis nachzugehen, auf welche derartige Theoreme ja letztlich auch zurückgehen müssen. „(V)om Unwesentlichen trennen“, das heißt nicht zuletzt, meine persönlichen Antipathien hintenanzustellen und von der Beschränkung durch private Interessen so gut als möglich zu abstrahieren. Doch kommt auch der ‚wissenschaftlich denkende Mensch‘ nicht um den Umstand herum, dass er keine Maschine ist, wie sich das seit der Neuzeit viele vorstellen, sondern eben ein ‚Mensch‘, der Gefühle hat und Erfahrungen macht. „(D)as Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen“, das heißt also zunächst, die gemachten Erfahrungen in der Welt, die notwendigerweise den Ausgangspunkt einer jeden Studie überhaupt darstellt, so mitzuteilen, dass sie allgemein verständlich werden. Das gelingt am besten, indem man der Frage nachgeht, was an einem Phänomen wohl von allgemeinen Interesse sein könnte.
Die diese Studie begründenden Erfahrung – und hierher kam dann auch in erster Linie mein Vorverständnis, was ein „Unbehagen in der Kultur“ meinen könnte – machte ich zunächst weniger beim Lesen obskurer Texte, als vielmehr im gegenwärtigen Universitätsbetrieb, in welchem man mehr oder minder explizit einige moderne Prinzipien lehrt und lebt, welche ich aus tiefster Überzeugung ablehne. Zum einen wird hier nach der Maxime ‚Neu ist besser, immer!“ gehandelt. Ein Phänomen, das selbst keineswegs neu ist, so predigte schon Max Weber seinen Studenten, dass sich ein jeder, der sich zur Wissenschaft berufen fühle, gewahr sein müsse, dass er spätestens „in 10, 20, 50 Jahren veraltet“ sei (Weber 1917/19, 592). Nun, die Geschichte hat ihm nicht recht gegeben, aber entscheidend ist doch, dass es im Wissenschaftsbetrieb mehr denn je geglaubt zu werden scheint. Diese Selbstgeißelung wäre aber ein Problem einiger Intellektueller, die sich selbst fragen müssten, warum sie sich so bereitwillig in einen sie verbrauchenden Prozess stürzen; würden sie nicht noch eine andere Maxime predigen, welche ihnen heute wiederrum von nahezu der ganzen Welt geglaubt zu werden scheint: ‚Nur derjenige, der sich ‚Experte‘ in einer Sache nennt, ist berechtigt, sich ein Urteil über dieselbe zu erlauben‘. Letzteres ist eine Entwicklung, die uns – da sie die Grundprinzipien von Öffentlichkeit überhaupt in Frage stellt – alle angeht. Für Hannah Arendt jedenfalls, und sie war nun wahrlich nicht leichtfertig mit derartigen Begriffen, war es nicht weniger als ein Element „totalitären Denkens“, welches sich „heute in allen freien Gesellschaften“ finden lasse (vgl. Arendt 1953, S. 111).
Ich will in dieser Arbeit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und untersuchen, woher dieser Widerwille kommt, eine für ihr Urteil verantwortliche Person zu sein, der heute so viele Leute dazu antreibt, sich als Material eines Prozesses verbrauchen zu lassen. Denn so ist es, wie Weber ebenfalls in jenem berühmten Vortrag erzählte, nicht eigentlich nur das Problem einer expertokratischen Elite von Intellektuellen, sondern gewissermaßen das von uns allen, die wir in einer entzauberten Welt leben. Es sei, so Weber weiter, unser Verhängnis, in einer rationalisierten Welt leben zu müssen, in welcher wir allenfalls „‚lebensmüde‘, aber nicht: lebensgesättigt“, sterben könnten (vgl. Weber 1917/19, S. 593f). Weber scheint mir ganz sicher kein Bildungsphilister zu sein, hier spricht vielmehr die für seine Zeit charakteristische Verzweiflung am „stahlharten Gehäuse“ des ökonomischen Rationalisierungsprozesses, der Kontemplation – das natürliche Gegengift gegen Philistertum – nahezu unmöglich macht. Ich behaupte nun, dass diese Verzweiflung, trotz der nicht allzu ähnlichen historischen Situation, in der wir uns heute befinden, von ungebrochener Aktualität ist.
Diese Behauptung will ich in dieser Arbeit begründen, indem ich die europäische Geschichte unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt auf die Ursprünge dieser Verzweiflung hin untersuche. Dieser Gesichtspunkt ergibt sich aus der eigentlichen Behauptung dieser Arbeit: der, dass Gemeinsinn noch wirklich ist. Denn so wollen wir die europäische Geschichte auf die sozialen und historischen Kräfte untersuchen, welche ihm entgegenwirken, und so ein möglicher Grund für jene auch heute noch aktuelle Verzweiflung sein könnten. Diesem Erkenntnisinteresse werden wir versuchen nachzukommen, indem wir uns im ersten Kapitel mit einigen Begriffen rüsten, um dann im zweiten die Suche nach jenen Ursprüngen in der Neuzeit zu beginnen. Haben wir hier eine heiße Spur erwischt, wird es im dritten Kapitel darum sein, ihre weitere Entwicklung zu verfolgen und zu schauen, inwiefern diese Ursrpünge in einem Verhältnis zu heute beobachtbaren Phänomenen der Entfremdung stehen. Sind wir dabei einigermaßen erfolgreich gewesen und haben ein halbwegs adäquates Verständnis davon, wo wir heute stehen, so wird es im letzten Kapitel darum sein, dies alles auf die Pädagogik zu beziehen und zu schauen, inwiefern sie Teil des Problems ist und inwiefern sie Teil der Lösung desselben sein könnte.
KAPITEL 1: Theoretische Vorüberlegung
Hier, im ersten Kapitel meiner Arbeit, suche ich also, dem Leser einleitend eine Übersicht über die wesentlichen Prinzipien und Begriffe zu geben, welche ich dieser Arbeit grundlege.
Dazu werden wir uns im ersten Teil zunächst eine soziologische Erkenntnistheorie als eine Methode zur Interpretation des kulturellen Wandels erarbeiten, um im zweiten Teil dann die einzelnen Grundbegriffe und Idealtypen für diese hermeneutische Untersuchung zu konstruieren.
1.1 Zur Methode
Kommen wir also zum genuin theoretischen Teil der Arbeit, so fürchte ich, dass ich mich schon vorab hierfür zu entschuldigen habe: eine Bachelor Arbeit zum Thema ‚Entfremdung‘ mit abstrakten, erkenntnistheoretischen Reflexionen einzuleiten, hat schon etwas Absurdes. Darüber hinaus läuft ein Unterfangen, bei welchem soweit ausgeholt wird, sicher auch Gefahr, das eigentliche Thema zu verfehlen. Dies alles berücksichtigend, weiß ich dennoch einige gute Argumente zu nennen, welche ein solches Vorgehen rechtfertigen.
Mit einem kurzen Exkurs zur theoretischen Philosophie Immanuel Kants zu beginnen, empfiehlt sich uns nun insofern, als alle weiteren Theoretiker, auf welche ich mich im weiteren wesentlich beziehen werde, sich stark auf Kant beziehen. Ein solches Vorgehen dürfte also vieles von Grund aus greifbarer machen. In inhaltlicher Hinsicht spricht für ein Voranschicken erkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Reflexionen, dass für ein Verständnis der Kulturbedeutung der Kopernikanischen Wende (welche wir im weiteren behandeln werden) ein Mindestmaß an Verständnis der Materie selbst: der modernen Wissenschaften, nötig scheint. Endlich, und dies ist als der eigentliche Grund zu nennen, ist die Darlegung der Terminologie Kants gleichsam konstitutiv, seinen Begriff von Gemeinsinn (sensus communis aesthetisus) – das Herzstück dieser Arbeit – später rezipieren zu können.
Kurzum, ich werde im folgenden zunächst die Grundzüge der kantischen Philosophie darstellen, um von dort aus deren neukantianische Rezeption Max Webers‘ auf den Begriff zu bringen und konkret mit meiner eigenen Konzeption von Verstehender Soziologie enden.
1.1.1 Erkenntnistheorie
§ 1. Grundlegung des Transzendentalen Idealismus
In erkenntnistheoretischer Hinsicht soll also der „ transzendentale Idealism “, wie er sich in der Kritik der reinen Vernunft finden lässt (vgl. Kant 1787, B 519), grundlegend für uns sein. Was das genau heißt, werde ich im folgenden kurz zu zeigen versuchen.[1]
Für dieses Vorhaben empfiehlt es sich zunächst, die wesentlichen Methodenbegriffe und Denkfiguren der kantischen Philosophie darzulegen, um dann anhand dieser nachzuvollziehen, wie Kant seine Architektonik der Instanzen menschlicher Erkenntnis überhaupt entwickelt hat. Die methodologische Unterscheidung, welche man hierfür zunächst kennen muss, ist wohl die zwischen ‚metaphysisch‘ und ‚transzendental‘. Nennt er „ein Prinzip metaphysisch, wenn es die Bedingung a priori vorstellt, unter der allein Objekte, deren Begriff empirisch gegeben sein muß, a priori weiter bestimmt werden können“; so nennt er das, „durch welches die allgemeine Bedingung a priori vorgestellt wird, unter der allein Dinge Objekte unserer Erkenntnis überhaupt werden können“, transzendental (Kant 1793, B XXIX, Herv. im Orig.). Konkret sieht das dann so aus, dass er bei der metaphysischen Erörterung zunächst eine „deutliche (wenn gleich nicht ausführliche) Vorstellung dessen, was zu einem Begriffe gehört“ (Kant 1787, B 38) gibt, indem er die entsprechende Vorstellung so in ihre einzelne Elemente zergliedert, dass eine jeweilige Instanz a priori[2] evident wird. Im nächsten Schritt, der transzendentalen Deduktion, geht es dann um die „Legitimation seiner Anmaßung“ (Kant 1793, B 132). Hier zeigt er dann, dass sich der jeweilige empirische Begriff vom Objekt überhaupt nicht denken lasse, setzt man nicht jene Instanz a priori in der exponierten Weise voraus. Kurz, verfährt Kant ‚metaphysisch‘, nennt er Bedingungen a priori zu einem empirischen Gegenstand ‚ x ‘; verfährt er ‚transzendental‘, die Bedingungen der Möglichkeit von ‚ x ‘ überhaupt.
Gehen wir hiermit also zu seiner Erkenntnistheorie über, so ist zunächst vorauszuschicken, dass für Kant Erkenntnis überhaupt nur das zum Gegenstand haben kann, was erfahrbar ist; jede Behauptung, die sich genauso gut verneinen wie bejahen lasse, sei keine ‚Erkenntnis‘, sondern ‚Spekulation‘. Doch im Gegensatz zu David Hume in seinem empirischen Skeptizismus, bleibt er bei dieser Feststellung nicht stehen, sondern sieht sie als die eigentliche Erkenntnis (mittelbar ist diese ja durchaus auf Erfahrung bezogen) seiner theoretischen Philosophie an. Diese – sie ist, im Gegensatz zu jeder empirischen Erkenntnis überhaupt, ‚a priori‘ und damit apodiktisch Gewiss – ist gleichsam der Archimedische Punkt seiner gesamten Philosophie. Wie er diese exponiert und deduziert, wollen wir im folgenden kurz skizzieren.
Beginnen wir hierzu beim basalsten Ausgangspunkt jeder Erfahrung überhaupt: der sinnlichen Affektion. Da wir diese aber selbst nicht wiederrum beobachten, sondern sie uns als ‚transzendentale Affektion‘ allenfalls vorstellen können, geht Kant also im ersten Schritt zunächst so vor, dass er jene apriorische Instanz, auf welche er das Faktum der sinnlichen Rezeptivität zurückführt, „Anschauung“ nennt. Genauer erörtert Kant diese Instanz in der Transzendentalen Ästhetik (Kant 1787, § 1-8): während uns in der empirischen Anschauung das mannigfache Material als der einzelne Inhalt unserer Vorstellung gegeben sei; sei alles, was sich mit apriorischer Allgemeinheit und Notwendigkeit darüber aussagen lasse, die Form, in welcher Inhalte uns immer schon gegeben sein müssen. So würden wir alle Gegenstände als äußere Erscheinungen immer schon als Körper im Raum und als innere Vorstellungen als Aufeinanderfolge in der Zeit koordiniert haben. Kant bestimmt also den Raum als den äußeren Sinn, die Zeit als den inneren. Mit dieser Erörterung wollen wir uns hier aber nicht weiter aufhalten, sondern zum Abschluss nur kurz schauen, wie er die Behauptung der apriorischen Instanz ‚Anschauung‘ legitimiert. Gehen wir vom Faktum aus, dass jede Erkenntnis überhaupt bestimmte Inhalte zum Gegenstand hat, so ist klar, dass der Cartesianismus, das bloße Bewusstsein des Satzes „ Ego sum, ego existo “ (Descartes 1641, II.3, Herv. im Orig.) schon für eine Erkenntnis zu halten, für Kant, aufgrund der Unbestimmtheit und Tautologie dieses Satzes, nicht in Frage kommt; er ist für ihn nichts anderes als eine Bedingung für Erkenntnis überhaupt. Wir müssen also, zusätzlich zum Bewusstsein des „ Ich denke, (welches) muß alle meine Vorstellungen begleiten können“, die „ Anschauung “ als „diejenige Vorstellung, die vor allem Denken gegeben sein kann,“ (Kant 1787, § 16, Herv. im Orig.) voraussetzen. In anderen Worten: die Gegenstände der Erfahrung setzten sich, als das Substrat aller Erkenntnis überhaupt, aus dem Material der empirischen Anschauung, den Sinnes data, einerseits und den intelligiblen Begriffen des Verstandes andererseits zusammen.
Gehen wir an dieser Stelle also von der Anschauung – der Instanz, welche unsere Vorstellungen als Einzelheiten immer schon in Raum und Zeit koordiniert hat und von Kant als reine Passivität charakterisiert ist[3] – über zum rein aktiven Verstand, welcher diese Einzelheiten in ihrer Allgemeinheit denkt, indem er sie unter Begriffe subordiniert. Im Ersten Buch der Transzendentalen Logik, Die Analytik der Begriffe, (Kant 1781, A 66-130) charakterisiert Kant den Verstand als das „ Vermögen der Regeln “ (a.a.O., A 126f). Schauen wir auch hier wieder, wie er auf diese Charakterisierung gekommen ist. Wir sahen bereits, dass jedes Objekt einer Erkenntnis notwendig zwei apriorische Instanzen voraussetzt: die Vorstellung einer sinnlichen Affektion einerseits, die der Einheit des ‚Ich denke‘ andererseits. Es ist ein herkömmlicher Fehler der Kantinterpretation, jenes ‚Ich denke‘ selbst für die Vernunft und damit für das Prinzip zu halten, aus welchem Kant seine gesamte Philosophie deduziert. Tatsächlich ist jenes ‚Ich denke‘ nicht viel mehr als ein Paradigma für Einheit überhaupt; der „Verstand“ im speziellen ist nun die Instanz a priori, auf welche Kant das Faktum der synthetischen Einheit von bestimmten Erfahrungsinhalten einerseits und dem unbestimmten Bewusstsein andererseits zurückführt (vgl. Kant 1787, § 15f). So führt er bereits eingangs der Analytik aus, dass der menschliche Verstand sich von der Anschauung dadurch unterscheide, dass diese eine Erkenntnisinstanz qua Intuition sei, jener eine qua diskursiver Begriff. („Begriffe“ sind für Kant als „Funktionen“ definiert. Der Begriff sei die „Einheit der Handlungen, verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen“ (a.a.O., B 93f).) Aus dem Faktum des Selbstbewusstseins deduziert Kant also nicht seine Philosophie, sondern andersherum wird ein Schuh draus: mit der Tatsache, dass wir zu jeder Handlung, die wir tun, sagen können: ‚Ich bin das, der das macht‘, begründet er seine Konzeption der „Spontaneität des Denkens“ (a.a.O.): also von Verstand und Vernunft. Denn würden wir nicht voraussetzen, dass derartige Vermögen der Begriffe, welche das mannigfache Material in Raum und Zeit – in bewusster und geordneter Weise – unter eine Einheit bringen, wirklich seien, wäre die Vorstellung von unserem eigenen Denken wie Sprache unmöglich und wir hätten das sensomotorische Stadium nie überschritten, würden also aus dem Reiz/Reaktions-Schema nie herausgetreten sein.[4]
Die Frage, welche sich nun stellt, ist, worin sich jene beiden begrifflichen Erkenntnisvermögen unterscheiden, worin Kant den Unterschied zwischen „Vernunft“ und „Verstand“ macht. Wir erhalten hierauf eine Antwort, fragen wir uns, welche Instanz eigentliche die „Kritik der reinen Vernunft“ schreibt. – Die Antwort liegt auf der Hand: die Vernunft befragt sich selbst, was sie wissen kann und was nicht (‚Kopernikanische Wende‘). Nannten wir die Anschauung ‚koordinativ‘, den Verstand ‚subordinativ‘, so nennt Kant selbst die Vernunft ‚spekulativ‘; ich würde aber vorschlagen, den Schwerpunkt darauf zu legen, dass sie gleichsam ‚reflexiv‘ und ‚deduktiv‘ ist.
Kant unterscheidet Verstand und Vernunft nun dadurch, dass ersterer die „Erkenntnis des Allgemeinen (Regeln)“, letztere die des „Besondere(n) durch das Allgemeine (der Ableitung von Prinzipien)“ darstellt (Kant 1790, H 7f). Da er die Vernunft also als dasjenige Vermögen bestimmt, welches den Verstand und damit nur Begriffe zum Gegenstand hat, muss er es entsprechend auch als „ Vermögen der Prinzipien “ charakterisieren (vgl. Kant 1787, B 354-359, Herv. im Orig.). Der Zugang der Vernunft zur Empirie ist also – sie geht immer schon von der Allgemeinheit des Begriffs aus – kein anderer als ein deduktiver. Eine „Legitimation seiner Anmaßung“, die Vernunft so zu exponieren, findet sich meines Wissens nach im Werk Kants nicht wirklich. Das mag in der Hauptsache zwei Gründe haben: zum einen, dass es sich nicht ausgehen würde, das Vermögen der Deduktion selbst zu deduzieren; zum anderen, und das scheint mir der eigentliche Grund, dass die Vernunftbegriffe nicht konstitutiv für empirische Gegenstände sind. Kommen wir also zu Kants Konzeption der Vernunftbegriffe (sie ist von übergeordneter Bedeutung für uns!). Während der Gegenstand überhaupt durch das Material der empirischen Anschauung einerseits und durch die begrenzende Ordnung des Verstandes wie dessen Einheit überhaupt andererseits konstituiert[5] ist, erfüllt die Vernunft als „die höchste Einheit des Denkens“ eine andere Funktion: sie gibt „den mannigfachen Erkenntnissen“ des Verstandes eine „Einheit a priori durch Begriffe“ (a.a.O., B 359). Vernunftbegriffe sind also nicht konstitutiv für Erkenntnis überhaupt, sondern regulieren diese bloß. Diese regulativen Vernunftbegriffe nun nennt Kant mit Bezug auf Platon „Ideen“. Veranschaulichen wir uns kurz, wie sich Ideen in ihrer Funktion konkret vorzustellen sind. Die Vernunft hat also den Verstand samt seiner mannigfachen Erkenntnisse zum Gegenstand und sucht Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Hierzu fragt sie sich etwa, was die letzten Bedingungen der Möglichkeit einer Erkenntnis überhaupt sind und kommt letztlich auf drei Antworten: Seele, Welt und Gott. Dies sind also die drei reinen Vernunftbegriffe: die „transzendentalen Ideen“. Diese würden, genauer betrachtet, dadurch zustande kommen, dass die Vernunft von einer gegebenen Bedingung auf das Unbedingte dahinter, verstanden als Totalität der Reihe der Bedingungen zu jener Bedingung, gehen würden (vgl. a.a.O. B 380). So geht die Vernunft vom Faktum aus, dass sich bei einer Erkenntnis deren Subjekt wie Objekt immer wechselseitig bedingen, und schließt auf deren jeweiliges unbedingtes Korrelat im ‚An-sich-Sein‘: auf die Seele[6] einerseits und die Welt andererseits.
In der Transzendentalen Dialektik (a.a.O., B 350-732) zeigt uns Kant auch, warum diese Operation der Vernunft notwendig und inwieweit sie legitim ist. Um es kurz zu machen: sie ist so lange berechtigt, als die Vernunft hierbei Erscheinungen und deren unbedingtes Korrelat, das An-sich-Sein, auseinanderhält und einsieht, dass sie nur das berechtigt eine ‚Erkenntnis‘ nennen kann, was uns in Raum und Zeit erscheint. Dass wir mittelbar über das unbedingte Korrelat einer Erscheinung, das „Ding an sich selbst“, Aussagen machen und es voraussetzen (wie bspw. in den metaphysischen Expositionen von Anschauung und Verstand geschehen), ist nicht nur legitim, sondern notwendig. Alles, was über diese mittelbaren Bestimmungen von Dingen an sich – die ihren Ausgangspunkt immer bei einem empirisch-immanenten Problem haben müssen! – hinausgeht, ist eine „dogmatische Anmaßung“ der Vernunft.
Kommen wir also zur letzten transzendentalen Idee: der theologischen Idee von Gott. Im 3. Hauptstück der Dialektik, Das Ideal der reinen Vernunft (B 596-658), zeigt Kant die Unmöglichkeit der hergebrachten Gottesbeweise. Hierzu soll aber nur soviel gesagt werden: Dass die theologische Idee als diejenige, welche die Vermittlung von Subjekt und Objekt der Erkenntnis zum Gegenstand hat, angeführt wird, ist Ergebnis einer auf René Descartes zurückgehenden Tradition, mit Gottesbeweis und Theodizee das Leib-Seele-Problem zu lösen (vgl. Descartes 1641, VI.10f): des Okkasionalismus. Kant übernimmt diese Konzeption letztlich nur, um aufzuzeigen, wie wir vom Faktum der Vermittlung aus, dem Begriff, auf ein unbedingtes Korrelat im An-sich-Sein in anthropomorphisierender Weise schließen würden: die transzendentale Idee eines schlechthin vollkommenen Wesens, Gott. Da sich in Kants theoretischer Philosophie das Leib-Seele-Problem gar nicht stellt, bezieht er sich auf den Okkasionalismus wirklich nur, um zu zeigen, wie Ideen funktionieren.
Entscheidend für uns ist, hier zum Abschluss festzuhalten, dass Ideen überhaupt in theoretischer Hinsicht (d.i. der gesamte Gegenstandesbereich dessen, was man ‚wissen‘ kann) transzendent sind. Dergleichen Vernunftbegriffen, welche aufs Absolute gehen, kann in der empirischen Wirklichkeit unmöglich ein Gegenstand adäquat sein (alles, was uns erscheint, ist durch unsere Anschauung bedingt). Sie geben uns ‚ Wissen schaftlern‘ also nicht mehr (aber auch nicht weniger!) als mögliche Einheiten an die Hand, nach welchen wir unsere Erkenntnisse teleologisch ausrichten können. ‚Ideen‘ sind letztlich nichts anderes als die Art von Begriffen, welche Prinzipien zugrunde liegen.
§ 2. Grundlegung einer Verstehenden Soziologie
Wäre ich nicht hoffnungslos ‚antiquiert‘ und hätte nicht diese Schwäche für ‚Klassiker‘, die auch ich für gut befunden habe, hätten wir jetzt die nötige Vorkenntnis für eine empirische Sozialwissenschaft, die makrosoziale Phänomene vollkommen zu Recht als Naturphänomene behandelt, und könnten einen Schritt weitergehen. – Allerdings (und ganz abgesehen davon, dass wir in einem solchen Fall wohl kaum Kants Erkenntnistheorie als Grundlage akzeptieren dürften, da wir ja als einziges Prinzip den ‚Fortschritt‘ gelten lassen würden, und Kants Transzendentalphilosophie ja bekanntlich so veraltet ist, wie die Klassische Mechanik Newtons‘, die ihm das Paradigma seiner Philosophie gewesen sei (vgl. Apel 1976, S. 220f))[7] erscheint mir das angesichts unseres Gegenstandes wenig sinnvoll. Es wäre in der Tat eine Ungereimtheit sondergleichen, eine Arbeit über Entfremdung schreiben zu wollen, und dafür nicht den handelnden Menschen ins Zentrum unserer Untersuchung zu stellen; sondern von ihm als Materie der Form ‚Kommunikation‘ zu abstrahieren. Zusätzlich zu unserer Erkenntnistheorie, bedürfen wir also noch einer Theorie der Hermeneutik.
Machen wir hierzu weiter, wo wir aufgehört haben: bei der Frage nach Bedeutung wie Funktion von Ideen. Sahen wir mit Kant bereits, dass diese theoretisch transzendent sind; sagt uns dieser doch auch im selben Werk noch, dass Ideen als „Prinzipien der reinen Vernunft“ in praktischer Hinsicht „objektive Realität“ zukomme (vgl. Kant 1787, B 836f). Hierzu müssen wir zunächst wissen, was Kant meint, wenn er ‚praktisch‘ sagt. Die einfache Antwort hierauf lautet: „Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist“ (a.a.O., B 828). In unserem Zusammenhang ist es nicht unwesentlich, zu betonen, dass Kant das nicht nach Gutdünken so definiert hat; sondern dass sich diese Definition gewissermaßen aus der Etymologie des Wortes ‚praxis‘ ergibt: die Hellenen verstanden hierunter all diejenigen Tätigkeiten, welche aus Freiheit heraus getan werden und ihren Zweck in der Aktualität ihres Vollzugs selbst haben: das Handeln. In praktischer Hinsicht sind Ideen nun insofern konstitutiv (wir erinnern uns: in theoretischer sind sie nur regulativ), als man ohne die Idee der Freiheit vorauszusetzen gar nicht von Handeln, von ‚Praxis‘, sprechen kann. In diesem Sinn müssen wir also die Idee von Freiheit als Faktum vorauszusetzen (womit wir letztlich nicht mehr tun als jeder Richter, der davon ausgeht, dass Personen verantwortlich sind für das, was sie tun).
Wir wollen hier aber Handlungen weniger beurteilen, als wir uns ein adäquates Verständnis bestimmter Handlungen erarbeiten wollen. Hierzu empfiehlt es sich zunächst zu definieren, was uns im folgenden ‚Handlung‘ überhaupt heißen soll. Ich werde im folgenden jede Tätigkeit, bei deren Vollzug sich der Akteur an einer Idee orientiert, ‚Handeln‘ nennen; und grenze sie vom ‚bloßen Verhalten‘ ab, dem eine solche Orientierung gänzlich abgeht. Weiter wollen wir unseren Gegenstandsbereich auf eine bestimmte Art des Handelns beschränken: Handeln in Gruppen. Dazu nun, wie wir mit den Ideen von Personen und ihren beobachtbaren Wirkungen in Raum und Zeit wissenschaftlich-professionell umzugehen haben, werden wir in der Handlungstheorie Max Webers, der Verstehenden Soziologie, fündig.
Auch er nannte es die „Transzendentale Voraussetzung jeder Kulturwissenschaft “, dass „wir Kultur menschen s ind, begabt mit der Fähigkeit und dem Willen, bewußt zur Welt Stellung zu nehmen und ihr einen Sinn zu verleihen“ (Weber 1904, S. 180, Herv. im. Org.). Mehr noch als dieses Zitat – das uns schon den Weg weist: wir werden uns weitgehend auf das kulturelle Feld als unseren Gegenstandsbereich beschränken – ist die Definition seiner Verstehenden Soziologie für uns von Interesse:
„Soziologie (…) soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen (Herv. JM) und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. ‚Handeln‘ soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. ‚Soziales‘ Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handlenden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.“ (Weber 1921, § 1, S. 1).
Wir wollen uns zunächst mit einem bestimmten Aspekt der Sache auseinanderzusetzen: Was heißt „deutendes Verstehen“? Es sollte nach dem bisher ausgeführten klar sein, dass uns die regulative Idee, welche den „subjektiv gemeinten Sinns“ gleichsam konstituiert, nicht Gegenstand einer sicheren Erkenntnis sein kann (sie transzendiert jeder Anschauung in Raum und Zeit). Alles, was wir beobachten können, ist das empirische Verhalten einer Person in Raum und Zeit. Weist dieses gewisse Regelmäßigkeiten auf, können wir mittelbar auf eine Idee dahinter schließen, welche dem Akteur vermutlich als das Prinzip seines Handelns gegolten hat. Allerdings nur – und das ist entscheidend – haben wir als Beobachter dieselbe Idee und unterstellen dem empirischen Akteur, dass sie das Prinzip seines Handelns darstellt. Die Idee mag nun verwerflich sein, wie sie wolle, entscheidend bleibt, dass wir ‚Handeln‘, im hier verstandenen Sinne, nur wahrnehmen können, ist uns die entsprechende Idee ein Begriff (was nicht heißt, dass sie uns ebenfalls als das Prinzip unseres Handelns gilt!).
Wir können nicht wissen, was ein Akteur wirklich denkt; wir können bestenfalls wissen, was er vorgab zu denken. Wir wollen also gar nicht den Anschein erwecken, als sei die kulturwissenschaftliche Interpretation in irgendeiner Form vergleichbar mit naturwissenschaftlicher Erkenntnis: interpretieren tut man immer dann, wenn ein sicheres Wissen nicht möglich ist. Ebenso wenig wollen wir aber die prinzipielle Transzendenz des Anderen zum Anlass nehmen, eine esoterische Mystik zu lehren (wie das in den Kulturwissenschaften ganz gern gemacht wird). Wir wollen hier eine Methode finden, die für jeden nachvollziehbar macht, wie wir auf unsere Interpretationen gekommen sind. Der erste Schritt hierfür ist, sich nach bereits erarbeiteten Methoden umzuschauen, wie man in wissenschaftlich-professioneller[8] Weise den subjektiv gemeinten Sinn interpretieren kann.
Eine solche Methode finden wir in der Schrift Webers, welche er anlässlich des sogenannten ‚Werturteilstreits‘ im frühen 20. Jahrhundert veröffentlichte: Die ‚Objektivität‘ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. Denn hier exponiert er, ausgehend vom Problem: Wie ist eine objektive, wertfreie Wissenschaft möglich, die selbst Werte zum Gegenstand hat (vgl. Weber 1904, S. 147)? in wesentlichen Zügen seine erkenntnistheoretische Methode für kulturwissenschaftliche Untersuchungen überhaupt.
Diese Methode nun zeichnet sich besonders durch das Postulat einer äußerst strengen ‚Sein-Sollen-Differenz‘ aus, welche wir in dieser Form auch übernehmen werden. Praktisch bedeutet das zunächst, dass wir klar und deutlich kenntlich zu machen haben, „ wo der wissenschaftlich denkende Forscher aufhört und der wollende Mensch anfängt“ (a.a.O., S. 157). Um dies hier in die Tat umzusetzen, ist zunächst zu berücksichtigen, dass jede kulturwissenschaftliche Analyse notwendig zwei Arten des Werturteils voraussetzt: die jeweilige Wahl für ein bestimmtes Kulturphänomen als Forschungsgegenstand zum einen und die für die entsprechende Analyse dieses Gegenstandes konstruierten Idealtypen zum anderen. Die Analyse als solche hingegen habe nach Weber gemäß basaler wissenschaftlicher Prinzipien (das heißt in erster Linie gemäß der formalen Logik) zu verlaufen und sei dementsprechend ‚ objektiv‘ in dem Sinn, dass sie auch noch für einen Chinesen, welchem das jeweilige Weltbild gänzlich fremd ist, noch theoretisch nachvollziehbar zu sein habe (vgl. a.a.O., 155f). Soziologie hat nach dem Verständnis Webers also wesentlich Kritik von bestimmten Kultursystemen zu sein. Genauer heißt dies, dass alle historischen Weltbilder, Ideale und sonstige Arten von Kultur ausnahmslos – „die Prostitution so gut wie die Religion“ (a.a.O., S. 181) – so in ihre einzelnen Elemente zu zergliedern seien, dass ihre „letzten Axiome“ evident werden.
Wichtiger noch als der Perspektivismus, welche sich an dieser Stelle bereits andeutet, ist für uns zunächst, wie wir nach Weber Begriffe konstruieren können, die es ermöglichen, Kulturphänomene zu bestimmen, und uns entsprechend ein Kriterium dafür geben, wann wir auf die besagten „letzten Axiome“ gestoßen sind.
Solch ein Begriff ist nach Weber, wie bereits angedeutet, der „Idealtypus“. Dieser ist nun insofern ein typologischer Begriff, als er dem Gattungsbegriff entgegengesetzt ist; was bedeutet, dass wir bei einer Analyse mit idealtypischen Begriffen von allen häufig vorkommenden Klassenmerkmalen einer bestimmten Erscheinung abstrahieren, um so das Unwahrscheinliche an ihr zu erhalten: ihre Eigenart. Auf unseren Gegenstandsbereich bezogen heißt das, dass wir von Verhalten und Gesetzmäßigkeiten historischer Kulturphänomene abstrahieren, um entsprechend das Außergewöhnliche an denselben zu erhalten: Handlungen und Ereignisse (vgl. a.a.O., S. 201f). Um aber nicht planlos drauflos zu abstrahieren, ist es zunächst nötig, einerseits eine übergeordnete Gattung zu bestimmen (eine historische Kultur oder Vergesellschaftungsform) und andererseits ein Problem zu formulieren (unseren Entfremdungsbegriff), auf welches hin die Abstraktionsleistung hier erbracht werden soll.[9] Bedeutender wohl noch als der typologische Aspekt, ist wohl, dass wir es hier mit einem ‚ idealen ‘ Begriff zu tun haben. Das heißt letztlich nichts anderes, als dass der Idealtypus, den wir erhalten, wenn wir ein bestimmtes Kulturphänomen auf bestimmte Merkmale hin abstrahieren, in dieser Reinform in der empirischen Wirklichkeit schlechterdings nicht existiert. Das mag trivial klingen, es ist aber durchaus ein Gesichtspunkt, der bei der Lektüre der entsprechenden konkreten empirischen Analyse in Vergessenheit geraten kann. Wenn wir etwa den Puritaner in der Analyse als jemanden, der sich aus der bloßen Angst vor seinem Gott in die Arbeit stürzt und die Welt rationalisiert, behandeln, heißt das natürlich nicht, dass wir behaupten, alle Protestanten puritanischer Prägung seien notwendig so; sondern lediglich, dass wir eine entsprechende idealtypische Konzeption des Begriffes ‚Puritaner‘ voraussetzen.
Abschließen wollen wir diesen Exkurs zum Idealtypus-Begriff, indem wir zwei Unterscheidungen vornehmen. Zum einen, die zwischen den realen Normen einer bestimmten Epoche und dem analytischen Idealtypus, welcher jenen Zeitgeist, zu erfassen sucht: letzterer hat zwar Normen zum Gegenstand, tut dabei aber nicht mehr als sie zu beschreiben. Zum anderen, die zwischen der Operationalisierung einer solchen Epoche oder Kultur als Idealtypus und der von Akteuren: ist letzterer für seine Epoche repräsentativ, wozu mehrere Faktoren zu berücksichtigen sind (bspw. politische, ökonomische und kulturelle Bedeutung), so kann davon ausgegangen werden, dass die jeweilige soziale Ordnung insgesamt maßgeblich auf ihn zurückgeht – er könnte in einem solchen Fall auch als personifiziertes Beispiel des Zeitgeistes der Epoche genommen werden. Dieses Verhältnis kann aber auch mittelbar sein. Etwa wenn die soziale Ordnung, was in komplexen Gesellschaften soziologisch gesehen den Regelfall darstellt, Ergebnis nicht intendierter Folgen seiner Handlungen ist (Calvinismus-Kapitalismus). Dieses historisch-spezifische Verhältnis gilt es im einzelnen zu untersuchen.
Zum Abschluss will ich mich hier auf die phänomenologische Kritik an Weber beziehen, nach welcher sein Handlungsbegriff zu statisch und artifiziell sei (Alfred Schütz). Jene Artifizialität zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Weber meist mit dem Zweck/Mittel-Schema operiert, wenn er Handlungen beschreibt. Dies ist im Grunde nichts anderes als der uralte Trick, mit welchem genuines Handeln unter die Notwendigkeit des Begriffs zu bringen versucht wird. Dass wir, operieren wir mit diesem Schema, nicht von ‚Handeln‘, sondern von ‚Herstellen‘ zu sprechen haben, wird weiter unten noch zu zeigen sein. An dieser Stelle reicht es, mit Hannah Arendt festzustellen, dass Handeln, da es im „Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten“ die Person in ihrer Einzigartigkeit offenbart, unmöglich unter die Allgemeinheit und Notwendigkeit des Begriffes zu bringen ist (für Personen gibt es eine bestimmte Art von Begriff: den Eigennamen). Das einzige adäquates Mittel, das ‚Wer‘ der Handlung (im Gegensatz zum ‚Was‘ eines Naturereignisses, eines ‚Dings‘) deutend zu verstehen, ist uns demnach das kasuistische ‚Storytelling‘ (vgl. Arendt 1967, V.25). In anderen Worten: einzig der kontemplative, rückwärtsgewandte Blick des Historikers erlaubt es uns, ein halbwegs adäquates Verständnis empirischer Handlungen zu bekommen.
1.1.2 Zur Methode (des Geschichtenerzählens)
Wir wollen in dieser Arbeit nicht in der Abstraktion verharren, sondern in erster Linie von den lebensweltlichen Erfahrungen ausgehen, die man als Mitglied moderner Gesellschaften so macht, indem wir in dieser Arbeit besonders der Fragestellung nachgehen werden: wie es möglich ist, dass sich Leute heute nicht selten als ‚Funktion‘ verstehen.
Um diesem Erkenntnisinteresse nachzukommen, empfiehlt es sich, wie bei allen Phänomenen der Gegenwart überhaupt, diese in ihrem „geschichtlichen Gewordensein“ zu beschreiben. Um dabei aber vor dem verbreiteten Fehlschluss gefeit zu sein, die von uns beschriebene Geschichte als eine Kausalkette zu verstehen, deren determinierten Glieder wir wie die beschriebenen historischen Akteure sind, kommt dann unsere Handlungstheorie ins Spiel. Wir wollen hier also, zwecks Verständnis besagten Phänomens, die Geschichten des Handelns einiger Personen erzählen, welche mit der „Rationalisierung der Welt“ in engem Zusammenhang stehen. In diesem Abschnitt ist es nun darum, eine Methode für diese Erzählung zu entwickeln, die gleichsam den Rahmen absteckt, auf welchen unsere Erzählungen beschränkt bleiben soll.
Hierzu ist dann zunächst eine historische Konzeption anzustellen, wozu wir besonders die Unterscheidung Hannah Arendts zwischen Neuzeit und Moderne[10] übernehmen, wonach erstere als „kommerzielle Gesellschaft“, letztere als „Arbeits- und Konsumgesellschaft“ soziologisch bestimmt ist (vgl. Arendt 1967, IV.22). Entsprechend wird uns der Homo faber als der für den neuzeitlichen Zeitgeist repräsentative Idealtypus gelten und das Animal laborans als der für den der Moderne. Was das genau heißt, sollte im folgenden noch klarer werden.
Um den jeweiligen Zeitgeist zu veranschaulichen und genauer zu untersuchen, was dieser mit Entfremdung überhaupt zu tun hat, bediene ich mich eines Dreischritts: zunächst sind die unter unseren Gesichtspunkten bedeutenden Ereignisse einer Epoche zu nennen; um sich dann, indem wir die einschlägige Literatur jener Zeit heranziehen, der Kulturbedeutung jener Ereignisse zu widmen; haben wir diese einigermaßen verstanden, ist es endlich darum, zu interpretieren, inwiefern wir es hier mit ‚Entfremdung‘ zu tun haben. Genauer werden wir uns also im ersten Schritt den äußeren Verhältnissen der Epoche widmen, um im nächsten Schritt zu schauen, wie diese sich bei den Zeitgenossen innerlich ausgewirkt haben könnten. Im letzten Schritt werden wir dann beurteilen, ob hier, und aufgrund dieser etwaigen Kausalität, von einer bedeutenden Diskontinuität zwischen Einzelnem und Allgemeinheit, von ‚Entfremdung‘, gesprochen werden kann.
Durch diese methodische Dreiteilung bezwecke ich, dem Unterschied zwischen historischen Ereignis, regulativer Idee und analytischen Begriff gerecht zu werden. Dies erscheint mir insofern angebracht, als es gerade in akademischen Kreisen nicht selten vorkommt, dass der Stellenwert der Ideengeschichte überschätzt wird und das, was einige Wenige im stillen Kämmerlein gedacht haben, für bedeutender als die historischen Taten ganzer Völker gehalten wird. Wir wollen hier aber nicht einfach den Spieß umdrehen und entsprechend weiterhin davon ausgehen, dass wer etwas ‚tut‘, sich dabei nichts ‚denkt‘, und umgekehrt. Wir wollen die großen Denker des Abendlandes vielmehr als historische Quellen für den Zeitgeist einer Epoche heranziehen und m.E. als eine mögliche Ursache dafür, warum wir heute auf eine bestimmte Art und Weise denken und handeln, in Frage kommen lassen.
1.2 Grundbegriffe
Kommen wir also zur Konstruktion der für Schritt zwei und drei (die Analyse eines Kultursystems und deren Interpretation) wesentlichen Idealtypen. Beginnen wollen wir diesen Teil zunächst mit der Nominaldefinition eines allgemeineren Begriffes von Entfremdung, der uns im weiteren gleichsam als Leitfaden unserer Untersuchung dienen soll. Im nächsten Schritt wollen wir dann einige Begriffe, welcher dieser voraussetzt, erarbeiten, um von hier aus die These dieser Arbeit zu formulieren.
§ 3. Entfremdung
Im folgenden wollen wir davon ausgehen, dass der Einzelne – kulturell vermittelt – eine Gemeinschaft mit der Allgemeinheit bildet. Wo diese kulturelle Vermittlung nicht gegeben ist, da wollen wir von ‚Entfremdung‘ sprechen.
Nach dieser Begriffsbestimmung gibt es also zwei Arten der Entfremdung: Vereinzelung und Verallgemeinerung, d.h. Sollipsismus bzw. Egoismus und Fachidiotie bzw. Selbstlosigkeit. Jeder ist mal vorübergehend im eigenen Denken gefangen oder sucht, sich selbst zu vergessen; wir wollen aber nur da von ‚Entfremdung‘ sprechen, wo derartige Phänomene mehr sind als vorübergehende Einzelfälle, wo also jene kulturelle Vermittlung dauerhaft ausbleibt und das in soziologisch signifikanten Ausmaß.
Für dasjenige, was vermittelt, gibt es auch einen Namen: ‚Urteilskraft‘. Da dies aber noch nicht die Stelle ist, genauer hierauf einzugehen, wollen wir uns zunächst mit dem Boden beschäftigen, von welchem aus wir urteilen: der Kultur. Um diese richtig auf den Begriff zu bringen, wollen wir sie in ihrem natürlichen Umfeld darstellen: d.h. wir werden Kultur als einen Teil der Welt verstehen, welcher nicht zuletzt über sein Verhältnis zu deren anderen Teilen definiert ist.
§ 4. Welt
[11] Als ‚Welt‘ werden wir in dieser Arbeit die Gesamtheit der Bedingtheiten menschlichen Daseins in ihrem spezifischen Verhältnis zueinander bezeichnen. Bevor wir aber auf diese Bedingtheiten im einzelnen zu sprechen kommen, wollen den Begriff ‚Welt‘ zunächst von seinem Gegenbegriff ‚Umwelt‘ abgrenzen und in seine Elemente zerlegen.
Bei Hannah Arendt umfasst Welt im weitesten Sinne all das, was Menschen gemeinsam der indifferenten Dynamik aus Entstehen und Vergehen entgegensetzen (vgl. etwa Arendt 1967, S. 118). Diesen Kreislauf schon für Natur überhaupt zu halten, scheint mir aber ein grobes Missverständnis. Wir wollen dies vielmehr als einen bestimmten Aspekt der Sache nehmen (und uns weiterhin an Kants Naturbegriff halten, wonach ‚Natur‘ nichts anderes als der „Inbegriffe aller Erscheinungen“ ist (Kant 1787, B 164)). Warum Arendt ihren Weltbegriff nun genau von diesem Aspekt der Natur abgrenzt, wird klarer, beschäftigen wir uns etwas mit dem klassischen Naturbegriff der Antike. Natur war für die Alten nichts anderes als ein unendlicher Kreislauf, deren Gattungen, als Teil dieses Kreislaufes, potentiell unsterblich sind. Einzig die Gattung ‚Mensch‘ bleibt hierbei eine Ausnahme: Menschen als solche zeichnen sich über ihre Sterblichkeit aus. Nicht, dass die Menschheit als Gattung nicht auch potentiell unsterblich wäre; doch ist der einzelne Mensch mehr als Spezies einer Gattung: er ist eine Persönlichkeit. Das Leben einer solchen nicht auf ihre Gattung reduzierbaren Person verläuft eben nicht zirkulär, sondern linear: von Geburt bis Tod. (Tiere hingegen waren für die Alten nichts als Exemplare ihrer jeweiligen Gattung.) Nun verläuft aber nicht nur die Geschichte des einzelnen Menschen geradlinig, sondern die der Menschheit als Ganzes (weswegen sie auch mehr als nur eine Gattung sein kann) tut das insofern, als wir die Möglichkeit[12] haben, uns zu politischen Gemeinschaften zusammenzuschließen, deren Geschichte erzählt werden kann. (Man kann auch eine Naturgeschichte schreiben und erzählen, nur wird man in einer solchen Erzählung: ‚Und an diesem und jenen Tag ging die Sonne zu dieser und jener Uhrzeit auf…‘ schwerlich einen Sinn finden können.) Die Bedingung dafür nun, dass wir uns zu politischen Gemeinschaften zusammenschließen können, in welchen wir aus Spontaneität heraus miteinander handeln, ist nach Arendt eben, dass wir soweit über jene Dynamik aus Entstehen und Vergehen, bzw. aus Produktion und Konsumtion, Herr geworden sind, dass von ‚Spontaneität‘ zu sprechen, berechtigt erscheint. Dieses der natürlichen Bedingtheit Herr-Werden ist letztlich nichts anderes als ‚Technik‘ und so können wir das Artefakt überhaupt – dessen Spezifikum es eben ist, jener Dynamik bis zu einem gewissen Grad zu widerstehen – als die Grenze zwischen Welt und Umwelt bestimmen.
Kommen wir also zur Welt als solcher und schauen, aus welchen Elementen sie sich zusammensetzt. Hier wollen wir zwischen zwei Sphären unterscheiden, der der Privatheit und der der Öffentlichkeit.
Beginnen wir mit letzterer, sie ergibt sich gewissermaßen aus der besagten differentia specifica der Menschheit: erst dadurch, dass sich Menschen zu politischen Gemeinschaften zusammenschließen und zum ‚Zoon politikon‘ werden, entsteht der Raum, in welchem wir unsere Perspektive auf einen bestimmten Gegenstand zur Sprache bringen und mit anderen diskutieren können (vgl. Arendt 1967, II.7). Diese Vielheit der Perspektiven, von welchen aus wir über denselben Gegenstand diskutieren und urteilen, nennt Arendt das „Faktum der Pluralität“ (a.a.O., S. 17) und ich will ihr hierin auch nur insoweit widersprechen, als ich es weniger ein „Faktum“ als vielmehr ein ‚Apriori von Sprache‘ nennen würde (worauf wir an späterer Stelle wieder zu sprechen werden kommen). Wir wollen an dieser Stelle einfach festhalten, dass Öffentlichkeit nichts anderes als institutionalisierter Gemeinsinn ist.
Zugleich beschreibt der Begriff der Öffentlichkeit nach Arendt aber noch ein weiteres Phänomen: dass wir in Verbindung gesetzt sind, ohne „über- und in(zu)einanderfallen“ (a.a.O., S. 66); dass also etwas zwischen uns ist, das trennt, und so Vielheit im Unterschied zu Einheit möglich macht. Dies kann nur insoweit möglich sein, als es so etwas wie einen ‚Mangel an Öffentlichkeit‘ zwischen uns gibt: die Privatsphäre. Der Begriff des Privaten umschreibt nun den uns eigentümlichen Teil der Welt, an welchen wir uns vor dem öffentlichen Gesehen- und Beurteiltwerden flüchten können. Dies Element der Welt ist nach Arendt dadurch gekennzeichnet, dass wir uns hier unserer Leiblichkeit und den Lebensnotwendigkeiten widmen würden und umfasse demgemäß zwei Teile: das Eigentum, welches seinem ursprünglichen Sinn nach nichts anderes als jener uns eigentümliche „Ort der Welt“ bedeute (den ‚oikos‘ also, wie es die Alten mit wenig Wertschätzung nannten) (vgl. a.a.O., S. 76f); und dem Besitz, welcher wiederum nichts anderes als besagte Mittel meint, dies es uns ermöglichen, „Herr über die eigenen Lebensnotwendigkeiten“ zu werden (vgl. a.a.O., S. 79). Während wir in der Öffentlichkeit frei von allen ökonomischen Zwängen handeln, umfasst das Private also all diejenigen Tätigkeiten, welche sich jenen Zwängen der Lebensnotwendigkeiten widmen: also ‚Arbeit‘ im eigentlichen Sinne des Wortes.
Abschließend gilt es hier noch, einem naheliegenden Missverständnis vorzubeugen: zwar entspricht dem Privaten die natürliche Bedingtheit des Menschen, ein Lebewesen zu sein; dennoch ist das Private nicht eigentlich ein präöffentlicher Teil der Umwelt, sondern ein postöffentlicher Teil der Welt – sie ist eben ein ‚Mangel an Öffentlichkeit‘, was ja das Vorhandensein einer Öffentlichkeit voraussetzt. Wir wollen uns hier keinen metaphysischen Spekulationen über einen ‚Naturzustand‘ hingeben und einfach festhalten, dass das Private in weltlicher Hinsicht postöffentlich (was in tautologischer Weise evident ist), in biographischer aber präöffentlich ist. So haben wir uns nämlich aus der Geborgenheit der Familie – in der wir, ihrem Ideal nach wenigstens, bedingungslos Liebe erfahren – heraus zu trauen, um in der Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten, wo wir beurteilt werden für das, was wir tun und sagen.[13]
Es verhält sich also gewissermaßen so, dass die menschliche Institution der Familie sich von ihrem tierischen Pendant dadurch unterscheidet, dass sie immer schon wesentlich an der Faktizität der Öffentlichkeit orientiert ist; was nichts anderes besagt, als dass das der Zweck von Erziehung nicht zuletzt darin zu sehen ist, dass sie uns auf den „öffentlichen Gebrauch unserer Vernunft“ (Kant) vorbereitet.
Zivilisation und Kultur
Um unseren Begriff von Welt noch weiter auszudifferenzieren, wollen wir nun dazu übergehen, diesen ins Verhältnis zu den hergebrachten Begriffen von Zivilisation und Kultur zu setzen. Um ein adäquates Verständnis dieser beiden Begriffe zu ermöglichen, ist es zunächst nicht wenig hilfreich, zu wissen, dass sie in der deutschen Tradition in einem eher gegensätzlichen Verhältnis verstanden wurden. Dies zeigt etwa die in diesem Zusammenhang viel zitierte Stelle aus Kants kleiner Schrift Idee zu einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht recht schön:
„Wir sind im hohen Grade durch Kunst und Wissenschaft kultiviert. Wir sind zivilisiert bis zum Überlästigen zu allerlei gesellschaftlicher (Herv. JM) Artigkeit und Anständigkeit. Aber uns schon für moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel. Die Idee der Moralität gehört noch zur Kultur; der Gebrauch dieser Idee aber, welcher nur auf das Sittenähnliche in der Ehrliebe und der äußeren Anständigkeit hinausläuft, macht bloß die Zivilisierung aus.“ (Kant 1784, A 402f, Herv. Im Orig.).
Die Botschaft scheint klar: der Begriff der Zivilisation umfasst die Äußerlichkeiten, der der Kultur geht auf das Innere, er betrifft seelische Angelegenheiten. Bevor wir mit der immanenten Kritik dieser Terminologie weitermachen, ist eine soziologische Interpretation dieser Unterscheidung doch recht aufschlussreich. Nach Norbert Elias und Pierre Bourdieu sei diese „professorale Ästhetik“ (Bourdieu 1982, S. 771) des Immanuel Kants durchaus repräsentativ für das politisch ohnmächtige, kulturell aber extrem einflussreiche Bildungsbürgertum des 18. Jahrhunderts in den deutschen Ländern. In jenem Gegensatz komme nicht zuletzt, so Elias, die literarisch verarbeitete Opposition der „mittelständischen Intelligenz“ gegen die frankophile Aristokratie der deutschen Fürstentümer zum Ausdruck, welche sie, soweit sie es vermochten, konsequent von politischer Macht und ihren Gesellschaften ausschlossen (vgl. Elias 1939, S. 97f).
Um nun zu verstehen, wie Kant selbst diese Unterscheidung versteht, ist es sehr aufschlussreich, zu schauen, in welchem Kontext er dieselbe einführt. So stellt er an früherer Stelle des zitierten Werkes fest, dass den Menschen die Dialektik der „ ungeselligen Geselligkeit “ eigen sei und beschreibt diese näher als den „Hang“ der Menschen, „in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese Gesellschaft zu trennen droht, verbunden“ sei (Kant 1784, A 392, Herv. im Orig.). Wir könnten diese Dialektik, welche ein Spezifikum ‚ sozialen ‘ Handelns darzustellen scheint, auch als ‚Distinktion‘ beschreiben: das mit dem anderen in ‚Gesellschaft‘ treten, um damit einem dieser Beziehung äußerlichen Zweck zu verfolgen, das Sich-auszeichnen-Wollen.
Diese frühe Analyse des Gesellschaftsbegriffes gilt es sich im Hinterkopf zu behalten, sie wird im weiteren noch von zentraler Bedeutung sein; an dieser Stelle wollen wir es aber dabei belassen, uns der weiteren Rezeptionsgeschichte dieser Unterscheidung zu widmen. Diese finden wir der Sache nach dann etwa bei Nietzsche wieder, der diesen Gegensatz erstaunlicherweise aus genau derselben Dialektik abgeleitet hat. So führt er in Jenseits von Gut und Böse aus, dass die entsprechende innerliche Spannung entweder jene „zauberhaften (…) Rätselmenschen“ hervorbringe, welche diese für etwas Großes zu nutzen wüssten und dadurch das eigentliche Wahrzeichen einer jeden Kultur überhaupt darstellen würden, oder aber sie laufe auf bloße Zivilisiertheit hinaus: auf Menschen, die einzig nach der „beruhigenden Medizin“ streben würden (vgl. Nietzsche 1885, V.200, Herv. JM). Dies alles darf ganz im Sinne Norbert Elias und dessen Standardwerk Über den Prozeß der Zivilisation interpretiert werden, wonach Zivilisation nichts anderes als die Kontrolle und Regulierung von Affekten sei: die Polemik in der deutschen Ideengeschichte bezieht sich wohl vornehmlich darauf, dass Zivilisation an sich ethisch steril und ‚lästig‘ ist. Bei genauerem Vergleich der Polemiken fällt aber auf, dass wo Kant noch in der „gesellschaftlichen Artigkeit“ deutliche Anzeichen des Untergangs einer bestimmten Klasse sah, Nietzsche bereits die notwendige Folge einer jeden großen Kultur überhaupt sieht: die Dekadenz später Kulturen. Man wäre an dieser Stelle versucht, Kant, welcher mit seinem Fortschrittsoptimismus am Anfang des 19. Jahrhunderts steht, als eine mögliche Ursache für den Pessimismus und die Untergangsstimmung des späten 19. Jahrhundert in Frage kommen zu lassen (rein theoretisch versteht sich!). Allerdings geht die Fortschritt ideologie wie ihr natürliches Komplement, die Untergangsstimmung, maßgeblich auf einen anderen Theoretiker zurück, welchen rein zeitlich nur eine Generation von Kant trennt: Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Wir werden uns in dieser Arbeit nicht direkt auf Hegel beziehen und wollen uns auch an dieser Stelle nur auf einen typisch hegelianischen Kulturbegriff beschränken: den von Georg Simmel (vgl. Simmel 1916). Kultur in diesem Sinne meint im wesentlichen eine provisorische Entfremdung: die „Objektivation des Geistes“, zwecks der ‚Bildung‘ des eignen Selbst. Näherhin führt Simmel aus, dass der „subjektiven Seele“ eines Menschen in der Kultur notwendigerweise „objektiver Geist“ gegenüberstehe, welcher es ihr ermögliche, aus der bloßen Unmittelbarkeit des Lebensprozesses herauszutreten, sich mit der objektiven Welt zu einer höheren Einheit zu synthetisieren und damit in einer vollkommeneren Weise „zu sich selbst“ zurückzufinden. Diese synthetische Einheit von subjektiver Seele und objektiven Geist nun ist hiernach Kultur. Der objektive Geist umfasst hiernach alle substanziellen Formen, welche ein vernunftbegabtes Wesen hervorzubringen vermag. Jenen objektiven Geist, wie er einem Menschen in Gestalt der überlieferten Kultur immer schon gegenübersteht, gelte es beim „Kultivierungsprozess“ zunächst in seine Elemente zu zergliedern: in die subjektive Seele eines anderen, der sich seiner Zeit jenem objektiven Geist gegenübergestellt sah, einerseits und das materielle Substrat andererseits, um ihn in individueller Art zu einer neuen Einheit zu resynthetisieren (vgl. a.a.O., S. 129). Kurzum: Kultur ist demnach die Synthese von Ego und Alter, von Eigenem und Fremden.
Die Problematik dieses Kulturbegriffes wird deutlicher, kontrastieren wir diesen mit dem Kants, wonach Kultur „die Hervorbringung der Tauglichkeit eines vernünftigen Wesens zu beliebigen Zwecken überhaupt “ bedeute (Kant 1793, B 392f, Herv. JM). Der Vorzug dieses Kulturbegriffes besteht nun darin, dass wir uns nicht in der Verlegenheit wiederfinden, bestimmen zu müssen, ob diese oder jene Handlung die ‚Vervollkommnung des eigenen Selbst‘ bewirkt hat (und damit ein Kulturphänomen darstellt) oder nicht. Weiterhin kann mit dem hegelianischen Kulturbegriff kaum eindeutig bestimmt werden, ob wir es mit der objektiven Welt oder der subjektiven Seele zu tun haben. Um dies zu unterscheiden, scheint sich ebenfalls wieder die Terminologie Kants zu empfehlen: von welcher wir ja gesehen haben, dass sie auch Gegensätze zwischen beiden Momenten des Bildungsprozesses, zwischen äußerlicher Zivilisation einerseits und innerlicher Kultur andererseits, zu beschreiben vermag. Die spezifisch ‚zivilisierte‘ Tugend wäre nach Kant also – und diese Terminologie wollen wir auch derart übernehmen – die „Klugheit“ im Umgang mit äußeren Gegenständen: der Natur, Technik, Staat wie Gesellschaft gleichermaßen; die spezifisch ‚kultivierte‘ die „Geschicklichkeit“ bei dem mit innerlichen Gegenständen: dem Handeln und Sprechen, welches sich ja auf seelische Aspekte bezieht (vgl. Kant 1803, A 22ff).
Halten wir also fest, dass der Zivilisationsbegriff die Grenzen der Welt beschreibt; während der Kulturbegriff deren Inhalt umfasst: das politische Handeln im Öffentlichen, das pädagogische im Privaten.
Schließen wir also unsere Begriffsarbeit ab, indem wir zur Konstruktion unserer Idealtypen, welche den drei Bedingtheiten menschlicher Existenz entsprechen: der ein Lebewesen zu sein, welches um zu leben arbeitet; der in einer Zivilisation zu leben, welche stets aufs Neue wieder herzustellen und den natürlichen Verfallsprozessen entgegenzusetzen ist; der in der Öffentlichkeit sprechend und zu handelnd in Erscheinung zu treten.
(1) Animal laborans
Fangen wir also mit der natürlichen Bedingtheit menschlicher Existenz an, ein arbeitendes Lebewesen zu sein[14]: dem ‚Animal laborans‘.
Um Missverständnissen vorzubeugen: das Animal laborans ist mitnichten ein zweckrationaler Akteur (‚Homo oeconomicus‘), es ist vielmehr in seiner idealtypischen Reinform durch nichts vom Tier unterschieden und kann uns dementsprechend, um bei der Typologie Webers zu bleiben, höchstens als affektueller Akteur gelten. Um nun den Idealtypus eines Lebewesens zu erhalten, ist es zunächst nötig, die Differentia spezifika des Menschen, seine Vernunftbegabung (vgl. Anm. 4), aus diesem Begriff auszusondern. In diesem Sinn bleibt festzustellen, dass es das Animal laborans schlechterdings nicht vermag, aus der Unmittelbarkeit des Lebensprozesses (d.i. ein perfekter Kreislauf aus Produktion und Konsumtion) herauszukommen und durch diese sinnliche Unmittelbarkeit determiniert ist. Zu so etwas wie Zweck/Mittel-Kalkülen ist es insofern gar nicht befähigt, als es ohne ein reflexives Vermögen unmöglich einen Begriff davon haben kann, was es tut (es vermag bestenfalls über jene weniger abstrakten, konstitutiven Begriffe des Verstandes, welche es ihm erlauben ein Phänomen als Gegenstand wahrzunehmen: die Kategorien). Seine spezifische Form des Willens können wir demnach mit Kant als „arbitrium brutum“ bestimmen: sein Verhalten ist durch sinnliche Affektion determiniert (vgl. Kant 1787, B 562). Handeln in unserem Sinn ist ihm schlechterdings unmöglich. Die Kategorie nun, mit welcher wir das spezifische Verhalten des Animal laborans am besten verstehen können, ist ‚Notwendigkeit‘: der Zweck, auf welchen es hinstrebt, ist das bloße Überleben und aufgrund des Fehlens von Vernunft, welche dies einsehen und reflektieren würde, ist ihm dementsprechend jedes direkt verfügbare Mittel hierzu recht.[15]
Abschließend gilt es noch eine Distinktion einzuführen, die zur ‚Vita solitaria‘. Tatsächlich nämlich korrespondiert das Animal laborans der Sphäre des Privaten nur mittelbar, als der Idealtypus ihrer spezifischen Tätigkeit. Als eigentliche idealtypische Akteur des Privaten wäre schon eher der ‚ einsame Denker ‘ zu nennen, welcher sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, um den Dingen in Ruhe nachzudenken, oder auch der Patriarch, der sich bei seiner Herrschaft auf natürliche Unabänderlichkeiten beruft. Die zwingendste Art von zwischenmenschlicher Beziehung, die Eltern-Kind-Beziehung, ist in jedem Fall ein Phänomen der Privatsphäre.
(2) Homo faber
Kommen wir nun zur zivilisatorischen Bedingtheit menschlicher Existenz, ein Artefakte herstellendes Lebewesen zu sein und eine artifizielle Welt zur Heimat zu haben[16]: dem ‚Homo faber‘.
Mit diesem Idealtypus, dessen Tätigkeit auf die Formel: Produktion minus Konsumtion zu bringen wäre (dem also, was Marx den „Mehrwert“ nannte), kommen wir dem, was landläufig unter ‚Homo oeconomicus‘ verstanden wird, schon deutlich näher. Zwar ist dieser Idealtypus, verglichen mit dem vorhergehenden, die weitaus komplexere Konstruktion; dafür aber auch die um einiges greifbarere. – Er, der nicht zuletzt auch den „wissenschaftlich denkenden Forscher“ umfasst, ist gewissermaßen die ‚objektive‘ Konstruktion schlechthin. Als der Akteur, welcher uns als die Bedingung der Möglichkeit vom Artefakt überhaupt gilt, vermag dieser Idealtypus uns in der Tat ein „Höchstmaß an ‚Evidenz‘“ (Weber 1913, S. 428f) zu geben. Denn so ist das Artefakt als solches genau dasjenige, was der natürlichen Dynamik aus Entstehen und Vergehen widersteht und sich folglich, aufgrund eben dieser Beharrlichkeit, durch seine Greifbarkeit auszeichnet.
Kommen wir nun zur Analyse des Herstellungsprozesses, so sollte auch das spezifische Verhältnis Homo fabers‘ zur Öffentlichkeit deutlicher werden. Bei der Herstellung des Artefakts durchläuft Homo faber genau zwei Modi: den kontemplativen, in welchem er sich zurückzieht und nachdenkt, um den Zweck dieses Prozesses zu finden: die Idee eines Artefaktes, das Modell; hat er diese gefunden und den Zweck festgesetzt, muss er aufhören nachzudenken und im aktiven Modus in erster Linie die Mittel bemühen, welche notwendig sind, seine Idee zu verwirklichen. Zwischen beiden Phasen des Herstellungsprozesses verläuft also ein starker Bruch, denn so bedeutet ‚aktiv‘ in diesem Fall tatsächlich die Antithese von ‚kontemplativ‘. Hat nämlich Homo faber einmal den Zweck seines Schaffens gefunden, kann er es sich kaum noch erlauben, die Sache aus neuen Gesichtspunkten zu betrachten, will er nicht in den kontemplativen Modus zurückverfallen und das Ganze von neuem angehen. Hier sehen wir dann recht deutlich, dass der erste Eindruck trügt: im aktiven Modus ist Homo faber zwar in der Welt tätig, doch ist ihm da bereits die ihr eigene Vielheit der Perspektiven weitgehend gleichgültig; allein in der anfänglichen Kontemplation, die sich zwar erst in der Abgeschiedenheit von der Aktualität der Öffentlichkeit einstellt, ist er neuen Gesichtspunkten gegenüber offen eingestellt – sie geben ihm ja nichts weniger als das Kriterium, den Zweck seines Schaffens zu finden.
Entscheidender für unsere Konzeption eines Begriffes vom Homo faber ist das Zweck/Mittel-Schema, mit welchem dieser operiert. Dieses ist nichts anderes als die spezifische Differenz des Herstellens zu anderen Arten von Tätigkeiten und in diesem Sinne können wir auch das Verhältnis von Homo faber zum Homo oeconomicus bestimmen: hat dieser das Artefakt überhaupt – das heißt die Welt in ihrer Dinglichkeit – zum Gegenstand; so jener einen bestimmten Teil derselben: den Haushalt (‚oikos‘). Der Homo oeconomicus ist also nichts anderes als eine bestimmte Art des Homo fabers.
(3) Zoon politikon
Enden wir nun mit der kulturellen Bedingtheit menschlicher Existenz, ein politisches Lebewesen zu sein und in der Öffentlichkeit sprechend und handelnd in Erscheinung zu treten: dem ‚Zoon polikon‘.
Dieser Idealtypus gibt uns nun insofern den Grenzbegriff unserer genuin wissenschaftlichen Analyse an die Hand, als wir Menschen (die einzigen, welche es, so weit bekannt, vermögen zu sprechen und zu handeln) Namen geben. Damit bringen wir letztlich nichts anderes zum Ausdruck, als dass wir jeden Menschen immer schon als eine nicht weiter analysierbare Einheit: eine ‚Person‘, verstehen. Eine Person ist aber nicht nur unmöglich in Elemente zu zergliedern, sondern sie lässt sich genau so wenig unter allgemeine Begriffe subordinieren, ohne aufzuhören, ein Mensch für uns zu sein (die Praxis, Personen mit Nummern zu kennzeichnen, hat das in ihrer Geschichte auf unbeschreiblich schreckliche Weise gezeigt). Die einzige Art von Begriffen, welche wir dem Gegenstand ‚Mensch‘ für angemessen zu halten scheinen, bleiben also Eigennamen.
In § 2 hatten wir bereits das ‚Storytelling‘ als Methode des „deutenden Verstehens“ von historischen Handlungen und Ereignissen erarbeitet, hier soll es uns nun darum sein, noch einmal genauer zu schauen, was ‚Sprechen‘ und ‚Handeln‘ näherhin bedeutet, um uns in einem ganz entscheidenden Punkt von der Verstehenden Soziologie Webers‘ abzugrenzen. Hierzu wollen wir ‚Sprache‘ im wesentlichen als ein komplexes System von Begriffen verstehen, dessen wir uns nicht zuletzt bedienen, um Einzig artigkeiten (Erlebnisse, Ereignisse, Gefühle, usw.) allgemein mitteilbar zu machen. Dies ist zwar eine äußerst holzschnittartige Charakterisierung, doch wollen wir hier – für unsere Zwecke sollte sie hinreichend sein – ohnehin mehr auf das Handeln eingehen. Im vorhergehenden Abschnitt hat sich nämlich gezeigt, dass unsere Nominaldefinition aus § 2, wonach Handeln alle Tätigkeiten umfasse, welche an einer Idee orientiert sind, nicht mehr hinreichend ist. Denn so haben wir gesehen, dass dies für das Herstellen, welches an der Idee vom jeweiligen Artefakt orientiert ist, nicht weniger gilt. Den spezifischen Unterscheid zwischen beiden Tätigkeiten finden wir, vergegenwärtigen wir uns, dass man auch Dinge herstellen kann, deren Modell nicht die eigene Idee war (ja selbst Maschinen vermögen es, derart Dinge herzustellen!). Denn so würden wir ein solch stupides Reproduzieren kaum eine historische Tat, eine ‚Handlung‘ im eigentlichen Sinne, nennen wollen. Wir finden also den Unterschied zwischen den Ideen, welche den Herstellungsprozess konstituieren, und denen, welche konstitutiv für Handeln sind, in der dem Denken eigentümlichen Spontaneität: Handeln ist demnach nichts anderes als aus sich selbst heraus eine neue Kausalreihe in der Welt zu bewirken. Warum ‚ wir ‘ das können, eine neue Idee haben und uns zusammenschließen, etwas noch nie Dagewesenes anzufangen, ob es sich so verhält, wie Arendt meint: dass wir es aufgrund der Natalität vermögen (vgl. Arendt 1967, S. 217), lassen wir mal dahingestellt und setzen hier einfach voraus, dass es möglich und auch oftmals (wenn auch immer weniger) wirklich ist.
Viel entscheidender als derartige Fragen ist uns eine Folgerung, welche sich aus dieser Definition ergibt: Handeln zeichnet sich hiernach nämlich durch seine Kontingenz aus. Bezogen auf eine soziologische Handlungstheorie hieße das nämlich, dass sie empirisches Handeln, nicht unter die Notwendigkeit des Begriffes bringen kann, ohne dass es aufhört ‚Handeln‘ zu sein. Habe ich nämlich gezeigt, dass sich unter den gegebenen Bedingungen notwendig immer so verhalten werden muss, und damit das Handeln des Akteurs erklärt, habe ich es nicht eigentlich mit Handeln zu tun, sondern mit bloßem Verhalten. Wir wollen uns mit dieser Aporie nicht weiter aufhalten und es dabei belassen, auf den ersten Teil dieses Kapitels zu verweisen, in welchem wir eine Methode entwickelt haben, diesem Problem Herr zu werden; wir wollen uns an dieser Stelle vielmehr von den hergebrachten soziologischen Handlungstheorien distanzieren, indem wir ‚Handeln‘ in erster Linie als einen politischen, weniger als einen soziologischen Begriff nehmen. Wir wollen nämlich davon ausgehen, dass das Politische und das Soziale qualitativ verschiedenes sind. Denn ein ‚Animal soziale‘ zu sein und in Abhängigkeiten zu Artgenossen zu stehen, ist mitnichten eine Eigenschaft, welche den Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet (Faktum Herdentier); aus Spontaneität heraus miteinander handelnd und sprechend – was mehr ist als bloß kommunizieren – in Verbindung zu treten, schon (vgl. Arendt 1981, II.4, insbesondere S. 43f).[17]
Abschließend wollen wir uns hier, anhand dieser idealtypischen Konstruktionen, noch einmal kurz überlegen, worin nun genau der Unterschied zwischen zivilisatorischer „Klugheit“ und kultureller „Geschicklichkeit“ besteht. Kontrastieren wir Homo faber und Zoon politikon auf den Gesichtspunkt ihres öffentlichen Vernunftgebrauches – auf ihren ‚Gemeinsinn‘ – hin, so zeigt sich, dass Homo faber grundsätzlich nur einen sehr artifiziell vermittelten Begriff von Öffentlichkeit hat, während das Zoon politikon, als sprechendes Wesen, die direkte Verkörperung von Gemeinsinn darstellt. ‚Zivilisiertheit‘ in diesem Sinne heißt also nicht zuletzt, in der Welt der Dinge zurecht zu kommen und über die Lebensnotwendigkeiten weitgehend Herr zu sein, was den Raum für politisches Handeln zwar allererst schafft, an sich aber noch nichts mit ‚Handeln‘ zu tun hat; ‚Kultiviertheit‘ bedeutet hingegen besonders, dass wir es vermögen in (nicht bloß mit) der Öffentlichkeit zurecht zu kommen. Der Kultivierungs prozess als solcher ist so gesehen aber in erster Linie ein Phänomen der Privatsphäre, welche uns ja mit der ihr eigenen Kombination aus Zwang und Geborgenheit langsam dahin bringt, in der Öffentlichkeit bestehen zu können. In diesem Sinn ist dann wohl auch Kants Diktum zu verstehen, dass der Mensch „nichts (ist), als was die Erziehung aus ihm macht“ (Kant 1803, A 6ff).
These
Was also heißt uns Entfremdung nun? – Nachdem bisher ausgeführten, können wir nun genauer bestimmen, was es bedeutet, wenn die kulturelle Vermittlung zwischen Einzelnem und Allgemeinheit versagt: Zum einen ist es denkbar, dass die Öffentlichkeit problematisch wird und wir uns ins Private zurückziehen, wo wir in der Vereinzelung insofern langsam den Realitätssinn zu verlieren drohen, als uns das eigene Denken als die letzte Art von Allgemeinheit erscheint, welche uns bleibt. Zum anderen – und das ist der weitaus schlimmere Fall – könnte es auch sein, dass die Öffentlichkeit nicht zuletzt deswegen als problematisch empfunden wird, weil sie die Privatsphäre nicht respektiert. Hier würde dann die trennende Funktion des Privaten versagen und wir würden drohen, „über- und ineinander(zu)fallen“ und in einer umfassenderen Einheit: einer ‚Masse‘, unterzugehen.
Ich behaupte nun, dass ersteres, die Vereinzelung, ein für die okzidentale Neuzeit charakteristisches Phänomen ist; während letzteres, die Verlassenheit in der Masse, ein Merkmal der Moderne darstellt. Kommen wir also zum empirischen Teil der Arbeit, um die Legitimation dieser Anmaßung darzutun.
KAPITEL 2: Die Entfremdung von der Welt
[18] Zur neuzeitlichen Entfremdung
Beginnen wir unsere empirischen Untersuchungen mit dem neuzeitlichen Abendland, in welchem, schematisch gesprochen, Homo faber in besonders radikaler Weise mit der Tradition brach. Diesen Bruch gilt es – er ist, in unserem Erkenntnisinteresse, besonders einschlägig – in diesem Kapitel genauer unter die Lupe zu nehmen.
2.1 Das Teleskop
Vom Dialog über die Natur zum Handeln in die Natur
Nach Arendt ist die „Physiognomie“ der Neuzeit besonders durch drei Ereignisse bestimmt: die Entdeckung Amerikas im Jahr 1492, die Reformation und die Religionskriege etwa ab 1517 und „die Erfindung des Teleskops“ 1608 (vgl. Arendt 1967, S. 318). Weiter ist (zwar nicht als ein Ereignis, so doch als ein äußeres Verhältnis) der fortschreitende Zentralisierungsprozess zu nennen, welcher im 17. Jahrhundert in einigen Ländern Europas bereits einen bestimmten Grad erreicht hat: den Absolutismus.
In dieser Zeit allgemeinen Umbruchs und Aufruhr ereigneten sich also gleich zwei ‚Revolutionen‘ in der Sphäre des Geistigen: doch während wir auf die Reformation und die mit ihr verbundenen Religionskriege hier nur ganz am Rande eingehen können, wollen wir uns nun ausführlicher der Kopernikanischen Wende (= KW) widmen, auf welche sich ja als Gründungsmythos der modernen Welt kulturübergreifend berufen werden kann. Zwar muss es zunächst unverständlich erscheinen, über Entfremdung in der Neuzeit schreiben zu wollen und nicht die faktischen Grausamkeiten der Bürger- und Glaubenskriege dieser Zeit zu behandeln, sondern nur diese Entwicklung mehr intellektueller Natur; doch drückt sich in diesem Unverständnis nicht zuletzt der Umstand aus, dass wir heute nur schwer nachvollziehen können, welch radikalen Bruch – Kriege sind so alt wie die überlieferte Geschichte der Menschheit selbst – der Wandel vom ptolemäischen zum kopernikanischen Weltbild für die Zeitgenossen wirklich bedeutet haben muss. Um diesen Bruch besser verstehen zu können, wollen wir einen bestimmten Gründungsmythos ernst nehmen – wie das jeder Kulturhistoriker zu tun hat – und uns zunächst mit der Person beschäftigen, welche die Erfindung des Teleskops geschickt zu nutzen wusste, um mit ihm einige im Ansatz radikale theoretische Neuerungen durchzusetzen: Galileo Galilei.
Dieser ist, um nur die berühmtesten zu nennen, neben Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler, René Descartes und Isaac Newton eine der zentralen Figuren, welche die mathematische Grundlegung der Naturwissenschaften, d.h. besonders die Geometrisierung des Raumes, vorantrieben und damit für den eigentlichen Bruch verantwortlich sind. Nun verdankt Galilei seinen besonderen Ruhm wohl nicht zuletzt dem Umstand, dass ihm vom Vatikan hierfür der Prozess gemacht wurde und er von uns, trotz seines tatsächlichen Opportunismus[19], gleichsam als Märtyrer für den Fortschritt genommen werden kann. Unter unseren Gesichtspunkten ist seine Bedeutung aber auch darin zu sehen, dass er einer der ersten war, die physikalische Phänomene geometrisch beschrieben und die kopernikanischen Lehren entsprechend als Tatsachen behaupteten; mehr noch aber darin: dass er die experimentelle Methode erfunden und so den Empirismus entscheidend vorangebracht hat.[20]
Bevor wir nun dazu übergehen, die Kulturbedeutung jenes Bruches zu untersuchen, vergegenwärtigen wir uns also noch einmal kurz, was genau ein modernes naturwissenschaftliches Experiment eigentlich ist. Nach Kant, welcher die philosophischen Konsequenzen dieser „Revolution der Denkart“ Ende des 18. Jahrhunderts, als sie einigermaßen überschaubar war, auf den Begriff zu bringen suchte, sei das ‚Revolutionäre‘ an dieser Art des Experimentierens, dass sich die Vernunft der Natur gegenüber nicht mehr „in der Qualität eines Schülers (verhalte), der sich alles vorsagen läßt“; sondern von nun an als ein bestallter Richter handele, „der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt“ (Kant 1787, B XIIf). Bei dieser ihrer Emanzipation besinnt sich die Vernunft also zunächst auf sich selbst, findet in sich die Prinzipien a priori, gemäß derer sie dann das Experiment konstruiert, an die Natur herantritt, sie „nötigt, auf (ihre) Fragen zu antworten“ und entsprechend über sie urteilt. – Diese Emanzipation stellt nun insofern einen historischen Bruch dar, als man seit der klassischen Antike ein anderes Verfahren entwickelt und in der mittelalterlichen Scholastik zur wahrer Meisterschaft gebracht hatte, physikalische, philosophische und theologische Wahrheitsansprüche zu überprüfen: den Dia log. Hier wurde – mit Ausnahme von astro nomischen Phänomenen, diese wurden seit jeher geometrisch beschrieben –, im realen wie fiktiven Diskurs in These und Antithese ein Problem erörtert und schließlich nur das als wahr akzeptiert, was keinen Widerspruch erfuhr. Die empirischen Beobachtungen, auf die man sich dabei stütze, waren bestenfalls ein systematisches Hinschauen. Nun trat das logische Prinzip der Widerspruchsfreiheit mehr in den Hintergrund und man handelte vornehmlich unter instrumentellen Gesichtspunkten in die Natur hinein, um seine These zu überprüfen (vgl. Eßbach 2009/10, 13. Vorl., 1. Teil).
2.2 Galileo Galilei
Held oder Verbrecher?
Widmen wir uns nun etwas ausführlicher dem Zeitgeist jener Epoche, in welcher Homo faber der Natur seine Bedingung diktiert – d.i. die Zeit, in welcher entdeckt wurde, dass unser Verstand die Instanz ist, auf welche die „Gesetzgebung“ der Natur zurückgeht (vgl. Kant 1781, A 126f) –, und versuchen entsprechend nachzuvollziehen, was die Umstellung zunächst vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild für die Zeitgenossen bedeutet haben muss – und schließlich die zum zentrumslosen Weltbild eines unendlichen Universums bis zum heutigen Tage praktisch noch bedeutet.
Machen wir uns hierzu zunächst klar, dass das, was wir hier als ‚Kopernikanische Wende‘ bezeichnen, im wesentlichen zweierlei umfasst: zum einen die Entscheidung in der empirischen Frage, ob sich die Erde um die Sonne dreht oder andersherum; zum anderen aber das allgemeine Umdenken in der viel grundlegenderen metaphysischen Frage, welches Bezugssystem wir bei der Bestimmung von Bewegung überhaupt voraussetzen: Ist der Kosmos endlich und durch die Fix sternsphäre begrenzt? Oder gibt es so etwas wie ‚Sphären‘ überhaupt nicht? Gibt es diese aber nicht, bedeutet das, dass wir uns den Kosmos nur als unbegrenzt vorstellen müssen oder dass dieser wirklich unendlich ist? Wir wollen hier auf diese Fragen, welche letztlich alle auf die Frage nach dem Wesen des Raumes hinauslaufen, keine Antworten geben[21] ; sondern einige bedeutende Antworten hierauf herausgreifen und in ihrer praktischen Wirkung untersuchen. Hierzu wollen wir uns zunächst mit dem Leben und Wirken der Person beschäftigen, welche sich vornehmlich mit dem empirischen Aspekt der Sache auseinandersetzte: Galilei.
Dieser stellt zwar einen der wichtigsten Schritte bei der Durchsetzung der Kopernikanischen Wende dar, brachte aber noch keineswegs die Entscheidung. So widersprach Galileis Behauptung, die Erde drehe sich wirklich um Sonne, der damals verfügbaren wie auch nur denkbaren Faktenlage noch weitgehend. Genau die Frage der Denkbarkeit war dann auch die Stelle, an welcher die Erfindung des Teleskops bedeutend wurde. Nach Paul Feyerabend half es nämlich in erster Linie, das Verhältnis zwischen Anschauung und Verstand so zu verwirren, dass die gängige Interpretation der Sinnesdata fraglich wurde und neue Sachverhalte intelligibel wurden (vgl. Feyerabend, 1976, Kap. 9 u. 10).
Um besser zu verstehen, wie genau Galilei nun die kopernikanischen Lehren gegen die durch die etablierten Theorien konstituierte Faktenlage durchzusetzen suchte, ist zunächst der Gerichtsprozess, welcher ihm für diesen Versuch gemacht wurde, besonders einschlägig. In der Rechtsprechung der katholischen Kirche tritt nämlich recht klar zutage, worin der Unterschied zwischen dem Anspruch von Kopernikus und dem Galileis besteht. Es schien ganz offensichtlich als ein Unterschied prinzipieller Art wahrgenommen zu werden, nicht bloß zu heuristischen Zwecken eine Hypothese aufzustellen und zu rechnen, sondern ihre Faktizität zu behaupten. Wie konnte man also in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts auf die Idee kommen, es sei ein ‚Verbrechen‘, zu behaupten, die Erde drehe sich im physikalischen Sinne um die Sonne?
Machen wir uns klar, wie das ptolemäische Weltbild aufgebaut war und welche lebensweltliche Bedeutung es gehabt hatte: es sagte jedem Menschen, dass er in einer geschlossenen Welt lebt, deren – nicht unbedingt bedeutendes – Zentrum er als Erdenwesen darstellt. Die verschiedenen Himmelssphären bis hin zur Grenze der Welt, der Fixsternsphäre, waren nach dem Aristotelismus nicht nur Orte weit weg, sondern etwas spezifisch von der Erde (und m.E. auch untereinander) Verschiedenes: sie waren, im Gegensatz zur dem Wandel unterworfenen Erde, das Reich unwandelbarer, ewiger Gesetzmäßigkeiten. Hiernach gab es also eine Wissenschaft, den Ort, an welchem Menschen leben, zu beschreiben: die Physik; und eine qualitativ verschiedene, die Sphären zu beschreiben, von denen man lange glaubte, dass sie göttlichen Wesen als Heimat dienen: die mathematische Astro nomie.[22] Wir können heute nur schwer nachvollziehen, wie schwer es gewesen sein muss, hier umzudenken und alle Phänomene überhaupt mathematisch zu beschreiben und damit die qualitative Differenz zwischen Erde und Himmel zu negieren. Rückblickend können wir aber relativ bestimmt sagen, dass Galilei, indem er die Geometrisierung des Raumes in ganz entscheidendem Maße vorantrieb, eben das verantwortete, was Alexandre Koyré „die Zerstörung des Kosmos“ nennt (vgl. Koyré 1969, S. 8). – Die Zerstörung des Kosmos also, in welchem Gott bzw. göttliche Wesen klar lokalisierbar waren.
Wie schwer dieser Paradigmenwechsel zur Zeit Galileis zu denken und wie schwer die Zerstörung als solche zu erkennen war, zeigt doch recht deutlich der Tatbestand an, dass Galilei nicht der Ketzerei wegen für schuldig befunden, sondern nur dafür verurteilt wurde: gegen die Auflage verstoßen zu haben, die ‚ Faktizität ‘ der kopernikanischen Lehre nicht mehr öffentlich zu behaupten – sie als mathematische Hypothese zu behandeln, war ihm bezeichnenderweise erlaubt. Die katholische Kirche – sie war damals noch keineswegs wissenschaftlich ‚rückständig‘, sondern vielmehr das Zentrum der Wissenschaften selbst – hatte zu dieser Zeit also noch keine Vorstellung davon, was die Mathematisierung der Physik bedeuten sollte. Ein anderes sinnfälliges Beispiel dafür, wie schwer es für die meisten Zeitgenossen des 17. Jahrhunderts gewesen sein muss, die Geometrisierung des Raumes in all ihren Konsequenzen zu begreifen, ist Henry More, der in seiner Auseinandersetzung mit Descartes erst recht spät – über 20 Jahre nach dessen Tod, in den 70er Jahren (sic!) – verstand, was dessen ‚Materialisierung‘ des euklidischen Raumes letztlich bedeutet: zumindest eine Welt ohne Gott (vgl. a.a.O., S. 130f).
Noch interessanter als diese äußerst bezeichnenden Begriffsstutzigkeiten, ist für uns, warum das alte Weltbild wohl an Evidenz verloren haben könnte und folglich untergegangen ist. Wir sprechen hier von einem ‚Weltbild‘ und das meint wesentlich mehr, als die Theorien einiger Gelehrter. Die breite Bevölkerung konnte damals noch kaum lesen und schreiben und hatte zu derartigen Theorien, wenn überhaupt, nur einen priesterlich vermittelten Zugang. Der Aristotelismus konnte sich bis dato berechtigterweise ein ‚Weltbild‘ nennen, da er recht nah an der Alltagserfahrung blieb (das kann man von den moderneren physikalischen Theorien nun wahrlich nicht behaupten). So ist es auch heute für Kinder noch schwer, zu verstehen, dass dieselben Naturgesetze für Erde wie für Weltraum gelten sollen. Die alte und naheliegende Vorstellung, dass Erde und Himmel etwas qualitativ Verschiedenes seien, musste aber just in dem Moment an Evidenz verlieren, als man durchs Teleskop blickte und feststellte, dass der Mond nicht ein perfekter und ebenmäßiger Körper ist, wie das der Aristotelismus lehrte; sondern eine Fläche hatte, die Krater und andere Unregelmäßigkeiten aufwies: dies steht ja der Unvollkommenheit der Erde in nichts nach. Das war der Anfang vom Ende des ptolemäischen Weltbildes und da die Implikationen dieses Paradigmenwechsels die Existenz übersinnlicher Mächte in ganz grundsätzlicher Weise in Frage stellten, war es gleichermaßen auch der Anfang der Entzauberung der Welt.
So viel also zur Zerstörung des ptolemäischen Weltbildes, doch welches Weltbild haben uns die Geistesheroen des 17. Jahrhunderts eigentlich im Gegenzug angeboten? Um dieser Frage nachzugehen, wollen wir uns nun abschließend mit Descartes beschäftigen. Dieser war sich nämlich im Gegensatz zu Galilei, welcher sich durch seine Indifferenz zum metaphysischen und theologischen Aspekt der KW auszeichnet, seiner Verantwortung in unvergleichlicher Weise bewusst. Niemand hat konsequenter den Bruch, welchen der neuzeitliche Paradigmenwechsel kosmologisch bedeutet, zu Ende zu denken versucht als Descartes es tat. Kommen wir also zur Welt des René Descartes, so haben wir zunächst festzustellen, dass diese für ihn aus nichts anderem als Ausdehnung und Bewegung besteht. Ließen sich einst in der Welt überall übersinnliche Mächte finden und deuten; so will Descartes nicht mal Tieren eine Seele zuschreiben und versteht sie stattdessen als Maschinen. Alle Dinge in dieser Welt sind Körper und als solche ausschließlich über ihre äußeren Relationen bestimmt, ihnen kommen also keine Qualitäten mehr, sondern nur noch quantitative Eigenschaften (Maße, Lage, Bewegung, usw.) zu. Der gefühlte ‚ Leib ‘, der sich kaum bis gar nicht ins Verhältnis setzen lässt, starb ab und wurde zum leblose ‚ Körper ‘.
Von noch größerem Interesse für uns, als dass sich diese Materialisierung des Raumes in der weiteren Geschichte der Naturwissenschaften nicht halten ließ, ist, wie genau sich Descartes die Welt vorstellte und was er alles aus dieser Identifizierung von Raum und Materie folgerte. Descartes hatte nun die Geometrisierung des Raumes bzw. Mathematisierung der Physik so konsequent zu Ende gedacht, dass er feststellte, der Raum sei nichts anderes als Materie auf einer bestimmten Abstraktionsstufe (vgl. Descartes 1644, § 11). Typisch für seine Art ist, dass er – ein endliches Wesen, das nur über einen ebenso endlichen Verstand vermag – hieraus nicht ableitete, der Kosmos sei unendlich; sondern bloß feststellte, dass, da sich ein Ende des euklidischen Raumes nicht widerspruchsfrei denken lässt (was ja ebenso gut an seinem endlichen Verstand liegen könne), er ‚ endlos ‘ sein müsse (vgl. Koyré 1969, S. 96-118, Herv. JM). Noch charakteristischer als diese gut christliche Bescheidenheit, von der man nie so recht zu sagen weiß, ob sie nun echt und nicht bloßes Blendwerk ist, ist, dass Descartes hier ‚radikale Neuerungen‘ zu denken vorgibt und die Tradition, auf welche er sich dabei stützt, einfach unter den Tisch fallen lässt. So ist nämlich seine Charakterisierung des Kosmos als ‚endlos‘, die er dann im Folgeschritt der faktischen Unendlichkeit Gottes entgegensetzt, auch nichts anderes als die traditionelle Unterscheidung zwischen potentieller und aktualer Unendlichkeit (vgl. a.a.O., S. 102). Diese Art des Argumentierens soll uns erst später wieder beschäftigen, wir wollen uns nun vornehmlich mit besagtem Folgeschritt auseinandersetzen: dem Gottesbegriff Descartes‘.
Es verbietet sich nämlich für Descartes vornehmlich deswegen, davon auszugehen, der Kosmos sei wirklich unendlich, da Gott für ihn faktische Unendlichkeit ist (vgl. Descartes 1641, III.22. u. 27). Den materialen Kosmos als faktisch unendlich zu bestimmen, hieße also, ihn mit Gott zu identifizieren; Gott als ausgedehnt zu charakterisieren kommt für ihn aber wohl besonders deshalb nicht in Frage, da das voraussetzen würde, dass er ebenfalls teilbar wäre, was einem Mangel gleichkäme. Gott sei also nicht eine ausgedehnte, sondern eine bewusste Substanz und als solche einfach und unteilbar (vgl. a.a.O., III. 35).
Mit dem Gottesbegriff Descartes‘ sind wir sogleich auch schon bei seinem Menschenbild angelangt. Der Mensch ist bei Descartes zwischen beiden Substanzen, zwischen „res cogitans“ einerseits und „res extensa“ andererseits, verortet. Denn so ist der Mensch für Descartes nicht zuletzt ein endliches Lebewesen mit einer klaren, aber nicht deutlichen Idee (Koyré 1969, S. 101) von Unendlichkeit, von Gott (vgl. Descartes 1641, III. 36f). Hier wäre es nun zu kurz gegriffen, davon auszugehen, Descartes habe die christliche Tradition einfach übernommen; tatsächlich steht die unschöne cartesianische Gebrochenheit dem christlichen Dogma von der ‚Ebenbildlichkeit‘ in vielem nach. Das Leib/Seele-Problem, über welches wir uns heute noch die Köpfe zerbrechen, stellte sich vor Descartes gar nicht: es macht in einem magischen Weltbild – in dem davon ausgegangen wird, dass alles beseelt ist – überhaupt keinen Sinn. Im christlichen Weltbild war es vielmehr auf geschickte Weise gelungen, die Prinzipien einer ständischen Ordnung der Welt (man hatte von autonomen Individuen noch keine Vorstellung; alles, was man kannte, waren Exemplare eines Standes in einer von Gott geschaffenen Ordnung: Rolle und Akteur waren identisch), mit denen einer nur Gott gegenüber verantwortlichen Seele (diese Konzeption geht zurück auf die sokratische Erfindung des Gewissens (vgl. Georgias, 482bf), deren Stellenwert in der christlichen Rezeption man eigentlich gar nicht überschätzen kann) zu vereinbaren. Der mittelalterliche Christ glaubte sich zwar in einer sozial determinierten Welt, verneinte deswegen aber nicht seine Verantwortung für die von ihm begangenen Taten. Descartes nun durchschlug dieses dogmatische Meisterwerk und schaffte auf diesem Weg den äußerst unschönen Dualismus, der den Mensch gleichsam zwischen zwei unvereinbare Welten stellt: zwischen die der ausgedehnten Dinge und die der bewussten[23] Dinge. Seine Lösung des Problems bestand nun darin, festzustellen, dass der Mensch als das endliche Wesen, das er ist, nichts besseres tun könne, als sich seines Bewusstseins bewusst werden, um sich auf diesem Wege der Vollkommenheit Gottes anzunähern und sich von der Unvollkommenheit der materialen Endlichkeit zu entfernen – bis auf den tautologischen Charakter des Ziels, ein äußerst christliches Motiv.
Wir hatten in § 1 mit Rekurs auf Kant bereits festgestellt, dass diese Tautologie „sich seines Bewusstseins bewusst werden“ theoretisch ungenügend ist, doch es ist an dieser Stelle nicht wenig interessant, zu sehen, in welchem historischen Kontext sie als Lösung von Problemen an Attraktivität gewinnen konnte. Nach Arendt ist das nämlich so zu lesen, dass Descartes recht früh die Zerstörung des Kosmos als solche erkannt habe und der Rückzug auf das eigene Denken nichts anderes als der Versuch sei, der eigenen Verantwortung vor der Geschichte gerecht zu werden und die Probleme der Zeit zu lösen. Der Tendenz seiner Zeit, so Arendt weiter, den Archimedischen Punkt von der Erdenexistenz ‚Mensch‘ zusehends weiter weg zu verlagern (zunächst in das Weltall und endlich – und wir können getrost davon ausgehen, dass Descartes das antizipierte – in ein Nirgendwo: das ‚Universum‘), habe er nämlich entgegengewirkt, indem er ihn im denkenden Menschen selbst, dem ‚Erkenntnissubjekt‘, fand (vgl. Arendt 1967, S. 374ff). Wir können an dieser Stelle auch genauer ausmachen, wo genau er den Archimedischen Punkt lokalisiert[24] zu haben meinte: in dem Bewusstsein des Satzes „ Ego sum, ego existo “ (Descartes 1641, II.3, Herv. im Orig.), – der ja eben gerade aufgrund seines tautologischen Charakters die von Descartes gesuchte absolute Gewissheit für sein erstes Prinzip geltend machen konnte (vgl. a.a.O., II.1). Schauen wir uns aber genauer an, wie Descartes auf diese Lösung kam, so fällt auf, dass er sagt: „mag er[25] mich nun täuschen, so viel er kann, so wird er doch nie bewirken können, daß ich nicht sei, solange ich denke, ich etwas sei“ (a.a.O., II.3, Herv. JM).
Äußerst bemerkenswert ist hieran nun besonders, dass diese Art des Denkens weniger die Qualität einer passiv-kontemplativen Angelegenheit, als vielmehr die einer Tätigkeit hat (ich muss mich stets vergewissern, dass ich noch denke und folglich bin). Gewissermaßen ist die Spontaneität des Denkens ja auch die einzige Form von Aktivität in einem Kosmos, in welchem es außer Ausdehnung und Bewegung nichts gibt. Es ist auch nicht weiter verwunderlich, dass Kontemplation als solche in dieser Welt, in welcher die einzig absolute Gewissheit das Selbstbewusstsein ist, welches unter dem instrumentellen Gesichtspunkt, alles das, was nicht ‚Ich‘ bin, den eigenen Zwecken unterzuordnen in die Umwelt hineinhandelt (Experiment), zusehends an Selbstverständlichkeit verlieren musste.
2.3 René Descartes
Exemplarische Biographie der „we on“
Kommen wir nun zur Interpretation, inwiefern der neuzeitliche Paradigmenwechsel entfremdend gewirkt haben könnte, so wollen wir die These, wonach die Vita activa in der Neuzeit über die Vita contemplativa, die in den Hierarchien der abendländischen Kulturen spätestens im christlichen Mittelalter weitgehend unangefochten das Primat innehatten, gesiegt habe, sogleich auch weiter relativieren: in die Natur hinein zu handeln ist kein öffentlich-politisches Handeln; es ist nicht selten geradezu antipolitisch!
Dass dem so ist, geht wohl auch nicht zuletzt auf Platon zurück, der seine Akademie ja in bewusster Feindseligkeit gegen die Öffentlichkeit seiner Zeit, die seinen Helden zu Unrecht zum Tode verurteilt hatte, gründete. So ist es zu erklären, dass die Wissenschaften – zumindest sofern sie akademisch betrieben werden – einen exoterischen Charakter aufweisen; obwohl sie der Sache nach, sie beziehen sich auf die allen gemeinsame natürliche Vernunft, doch ein Gemeinplatz sind.[26]
Sich diese Ambivalenz bewusst zu machen, mag helfen, das folgende besser einordnen zu können. Die Akteure der KW nun zogen größtenteils bewusst gegen diese mystische Esoterik in den Wissenschaften ins Feld. Der neuzeitliche Paradigmenwechsel ist nämlich eindeutig aus dem Geiste des Renaissancehumanismus geboren, was Theoretiker wie Giordano Bruno – die mit ihrem Wirken intendierten, den Menschen wie die Welt aus den Begrenzung des einengenden ptolemäischen Weltbildes zu befreien, welches dem Menschen als Erdenwesen eine solch geringe Stellung einräumte – auch deutlich anzeigen (vgl. Koyré 1969, S. 50). Nun gehört es aber zu den Eigenarten menschlichen Handelns, dass es nie antizipieren kann, was es tatsächlich bewirken wird. Nicht selten bewirkt es geradezu das Gegenteil seiner ursprünglichen Intention und wie wir am cartesianischen Weltbild recht klar gesehen haben, sollte es bei der KW auch nicht anderes kommen.
Eine andere solche nichtintendierte Folge der KW war es, dass sie dem Menschen technische Mittel an die Hand geben sollte, die diese Hand und alles, was sie ‚tat‘, in historisch beispielloser Weise aufwerten sollte. Die nun verfügbare Technik wusste aber ein ganz anderer Akteur mit einer ganz anderen Geschichte für sich zu nutzen und mit ihr zeitweise fast die ganze Welt zu beherrschen: der Bourgeois.
Dieser Geschichte werden wir uns ausführlicher erst später widmen, hier wollen wir uns damit begnügen, die Tradition der Bourgeoisie zu der der modernen Wissenschaften ins Verhältnis zu setzen. Die Bourgeoisie geht, wie uns ja Max Weber gelehrt hat, auf die „innerweltliche Askese“ des „asketischen Protestantismus“ zurück und die KW können wir, ihre Akteure sind in erster Linie Angehörige sozial privilegierter Schichten gewesen, mit den Begrifflichkeiten Webers‘ als ein Phänomen der „weltflüchtigen Kontemplation“ soziologisch beschreiben. Beide Phänomene würden, obwohl sie so verschieden nicht sind, in praktischer Hinsicht geradezu antinomische Wirkungen zeigen: ein idealtypischer Gegensatz, der sich wohl nirgends deutlicher als darin zeigt, dass einem waschechten Puritaner jener ursprüngliche humanistische Anspruch, den Menschen und die Welt aufzuwerten, wie auch nur ein kontemplatives Leben als Selbstzweck als „blasphemische Kreaturvergötterung“ (Weber 1921a, S. 334) erscheinen müsste (vgl. a.a.O., S. 328-333). Beide, asketischer Protestantismus wie die KW, haben auf je eigene Weise entzaubernd in der Geschichte des Abendlandes gewirkt und sich dabei recht gut ergänzt. Zog ersterer gegen die magische[27] Sakramentsinstitution in der katholischen Kirche ins Feld und postulierte einen absolut allmächtigen und überweltichen – was nicht zuletzt bedeutet, dass er nicht in der Welt zu finden ist – Gott (vgl. Weber 1904a, S. 145f), dessen Beschluss seit jeher feststeht und dem man sich als frommer Puritaner bestenfalls als williges Werkzeug, das in seinem Namen die Welt rationalisiert, annähern kann (Weber 1921a, S. 325); so wirkte die „Infinitisierung des Universums“ auf ihre Weise entfremdend, indem sie ebenfalls die absolute Transzendenz Gottes‘ evident machte und die „Welt der Werte von der Welt der Fakten“ trennte (vgl. Koyré 1969, S. 12). Inwiefern die KW die Welt entzaubert hat, sollte doch aus dem Weltbild Descartes‘ klar hervorgegangen sein. Falls nicht, muss man sich einfach nur klar machen, dass das, was wir seit Hume einen ‚Sein-Sollen-Fehlschuss‘ nennen: dass man aus einem Faktum an sich noch keine Norm hervorgeht, den Menschen in einem magischen Weltbild (und eigentlichen den meisten Leuten heute noch) völlig fremd ist. Dort war man stets überzeugt, das Gute dort zu finden, wo man die höchsten göttlichen Wesen beheimatet glaubte: im Himmel und in allen Dingen auf der Welt, die im in irgendeiner Weise ähneln.
Wir wollen uns hier auf die durch die KW bewirkte Entzauberung beschränken und dementsprechend zunächst genauer untersuchen, wie genau diese nun entzaubernd gewirkt haben könnte. Hierzu empfiehlt es sich zunächst, auszuführen, was genau wir eigentlich unter „Entzauberung der Welt“ verstehen wollen. Weber selbst beschrieb es in Wissenschaft als Beruf seinen Studenten wie folgt:
„Die Zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung[28] bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas anderes: das Wissen davon oder den Glauben (Herv. JM) daran: daß man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, daß es also prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, daß man vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnung beherrschen könne. Das aber bedeutet: die Entzauberung der Welt.“ (Weber 1917/19, S. 87).
Von dieser Negation von ‚Magie‘ bzw. ‚Zauber‘ haben wir im vorhergehenden Kapitel schon eine klare und deutliche Vorstellung bekommen, doch von dem Negierten selbst problematischerweise kaum. Das hat auch seine guten Gründe: es ist durchaus nicht leicht, einen adäquaten Begriff vom ‚Magischen‘ überhaupt zu konzipieren[29]. In Anm. 27 machten wir bereits einen ersten Versuch, wir wollen hier vergleichend vorgehen und uns auf zwei Aspekte der Sache beschränken: der Gemeinsamkeit zwischen Wissenschaften und Magie einerseits und ihrem spezifischen Unterschied andererseits.
Auf die Gemeinsamkeit zwischen beiden werden wir schnell aufmerksam, schauen wir, wie Weber hier das ‚Magische‘ beschreibt: als „ geheimnisvolle unberechenbare Macht“. In ihrem exoterischen Charakter finden also Wissenschaften und Magie ihre Gemeinsamkeit, was eigentlich nicht überraschen sollte, vergegenwärtigt man sich, dass – soziogenetisch betrachtet – die Intellektuellen, als moderne Klasse aus dem Priester hervorgegangen sind[30], welcher wiederrum seinen Ursprung im Zauberer findet. Diese Genese ist so verwunderlich nicht, waren doch die Geistlichen im mittelalterlichen Abendland die einzigen Intellektuellen (die meisten Aristokraten dieser Zeit waren geradezu stolz darauf, nicht lesen zu können). Dass uns das heute alles überrascht, dürfte nicht zuletzt dem Umstand geschuldet sein, dass wir uns von den modernen Magiern haben blenden lassen und ihren Zauber fürwahr nehmen. Die modernen Zauberer an den Universitäten scheinen also erfolgreich ihre soziale Funktion zu erfüllen. Um uns von diesem Blendwerk nicht weiter blenden zu lassen, wollen wir kurz stehen bleiben und einen soziologischen Begriff vom ‚ Zauberer ‘ definieren. Nach Weber ist das niemand anders als derjenige Akteur, dem das Charisma des Außeralltäglichen als sein spezifischer Tätigkeitsbereich eignet. Die sich daraus ergebende Antinomie: Wie kann das Außeralltägliche zum eigenen Alltag gemacht werden? löse dieser erfahrungsgemäß oftmals einfach dadurch, so Weber weiter, dass er sich als der Gegensatz zum Alltagsmenschen verhalte (vgl. Weber 1921a, S. 246).
Diese Definition zeigt uns nun auch deutlich den spezifischen Unterschied zu ‚reinen‘ Wissenschaften – d.s. solche, die es vermögen von ihrer sozialen Position und ihren Klasseninteressen zu abstrahieren – an. Der Sachdimension nach, so hatten wir gesagt, zeichnet sich genuine Wissenschaft nämlich dadurch aus, dass sie sich auf die natürliche Vernunft beruft und entsprechend von jedem nachvollzogen werden können sollte. In diesem Sinn hatte bezeichnender Weise schon der Empiriker Aristoteles – und nicht sein mystischer Lehrer Platon – die Wissenschaften charakterisiert: „Überhaupt ist das Lehrenkönnen ein Merkmal des Wissens“ (Metaphysik, 981b). Einen guten Wissenschaftler können wir also von einem solchen, der sich bloß magischen Blendwerkes bedient, aber sachlich gar nichts zu bieten hat, dadurch unterscheiden, dass letzterer überhaupt keine Anstalten macht, uns über seine Prinzipien und Definitionen aufzuklären und uns bloß Fremdworte und ausschweifende Satzkonstruktionen, die gar nicht verstanden werden sollen, um die Ohren haut. Genau in diesem Gegensatz, dem zwischen Geheimnis und Wissen, finden wir auch die spezifische Entzauberung, die mit der KW – deren Akteure doch alles in allem gute und aufrichtige Wissenschaftler waren[31] – in die Welt kam.
Kommen wir hierzu wieder zu unserer soziologischen Bestimmung der KW als ein Phänomen des „vornehmen Intellektualismus“ zurück und fragen uns mit Weber weiter, inwiefern dieser ganz allgemein dazu disponiert ist, eine Entzauberung zu bewirken. Hierzu zeigt Weber in seiner Religionssoziologie eine bemerkenswerte Kausalität auf:
„Je mehr der Intellektualismus den Glauben an die Magie zurückdrängt, und so die Vorgänge der Welt ‚ entzaubert ‘ werden, ihren magischen Sinngehalt verlieren, und noch ‚sind‘ und ‚geschehen‘, aber nichts mehr ‚bedeuten‘, desto dringlicher erwächst die Forderung an die Welt und ‚Lebensführung‘ je als Ganzes, daß sie bedeutungshaft und ‚sinnvoll‘ geordnet seien.“ (Weber 1921a, S. 308, Herv. JM).
Auch den ersten Schritt haben wir im cartesianischen Weltbild schon kennen lernen dürfen: hier gibt es in der Tat keine Zeichen mehr, welche als Wirkung einer übersinnlichen Macht gedeutet werden könnten: alle Dinge in der Welt ‚bedeuten‘ nichts mehr, sondern ‚sind‘ und ‚geschehen‘ einfach nur. Um nun zu verstehen, wie es historisch zu solch einem Weltbild kommen konnte, ist der vornehme Intellektualismus zunächst insofern ein gutes Beispiel, als er eine allgemeine Tendenz, die dem Intellektualismus überhaupt inhäriert, besonders deutlich anzeigt. Denn geht man davon aus, dass allen Menschen eine natürliche Vernunft gemeinsam ist, wie wir es hier tun, so muss man folgern, dass der vornehme Intellektualismus sich vom proletaroiden nur dadurch unterscheidet, dass Angehörige sozial privilegierter Schichten, aufgrund der fehlenden ökonomischen Not, weit öfter in den Genuss kommen, in Ruhe über die Dinge nachzudenken. Die intellektualistische Entzauberungdynamik scheint also ganz offensichtlich in der Sache selbst zu liegen: dem Nachdenken.
Wir sahen bereits ansatzweise, dass das Magische nicht zuletzt von dem Charisma des Besonderen als solchen herrührt. Denke ich nun über das erlebte Besondere lange nach und finde einen allgemeinen Begriff, unter welchen es sich subsumieren lässt, habe ich es also verstanden, so hört es auf, etwas Besonderes für mich zu sein und ist seines geheimnishaften Charakters vollständig beraubt. Beziehen wir das auf die KW als historisches Phänomen, so ist eigentlich klar, wie genau sie entzaubernd gewirkt hat. Was gewissermaßen mit Kopernikus seinen Anfang nahm und sich im abendländischen Denken zunehmend durchgesetzt und verstärkt hat, war, die Perspektive des Weltalls auf die Erde und die Phänomene in ihr einzunehmen. – Warum wohl wurden astronomische Phänomene historisch zuerst geometrisch beschreiben? Ganz einfach: weil sich Himmelskörper so weit weg von uns bewegen, dass die einzelnen Variationen dieser Bewegungen für uns nicht ins Gewicht fallen. Entsprechend erscheint es uns auf der Erde, als würden sich die Himmelskörper ausnahmslos unwandelbaren Gesetzen gemäß verhalten. Nehme ich nun die Perspektive des Weltalls auf die Erde ein, kann ich in gleicher Weise alle Phänomene auf der Erde beschreiben: geometrisch. Dies mag wohl einer der Gründe dafür sein, dass der Raum überhaupt geometrisiert wurde und Descartes schließlich die Konsequenz zog, dass Qualitäten[32] nichts anderes als Täuschungen seien und allein das, was man messen kann, real sei. Als man aber dazu übergegangen war, alles zu vermessen, sollte es nicht lange dauern, dass man feststellte, dass es überhaupt nichts in der Welt gibt, dass ‚unermesslich‘ ist (vgl. Arendt 1967, S. 319-321).
Letztlich ist die moderne Überzeugung, dass alles Gegenstand einer sicheren Erkenntnis sein und damit ‚gewusst‘ werden könne, eine Vermessenheit sondergleichen und es lässt sich ohne weiteres bestimmen, was man wirklich ‚Gegenstand einer sicheren Erkenntnis‘ nennen kann: alles, was uns in Raum und Zeit erscheint. Sich von den Wissenschaftsaposteln verzaubern zu lassen und anzunehmen, es gebe nichts, was man nicht erklären und damit seiner Geheimnishaftigkeit entblößen könne, ist letztlich auch nichts anderes als ein Glaube. – Ein Glaube, von dem wir nach der zitierten Entzauberungsdynamik ziemlich genau sagen können, wo er herkommt: die intellektualistische Entzauberung durch die KW schaffte das Bedürfnis nach einer totalen Religion, die alles erklärt, selbst.
Genug davon, unser Gegenstand ist nicht eigentlich Entzauberung, sondern Entfremdung. Und auch wenn sich diese Wörter reimen, haben wir doch einen bestimmten Begriff von Entfremdung, für welchen die Entzauberung nur von mittelbarer Bedeutung ist. Abschließend wollen wir uns also fragen, inwiefern die weltflüchtige Kontemplation, welche für die KW typisch ist, eine direkte Entfremdungserscheinung darstellt.
Hierzu bringt uns zunächst der „Pathos des Neuen“ (Arendt 1967, S. 319), welchen die Akteure der KW gleichsam erfunden haben, auf die richtige Spur. So ist es nämlich für Theoretiker wie Galilei und Descartes charakteristisch, den Umstand, dass etwas ‚neu‘ ist, als ein Argument ins Feld führen.[33] Dies ist für uns insofern einschlägig, als hier die Schattenseite des modernen Fortschrittsbegriffes offenbar wird: er bedeutet eben nicht zuletzt einen Bruch und eine Missachtung all dessen, was bisher war. Der Sein-Sollen-Fehlschluss z.B. ist wohl nicht zuletzt deswegen so verbreitet, als es für den Menschen – glaubt er an so etwas wie ‚Gemeinsinn‘ oder ‚gesunden Menschenverstand‘ – doch sehr naheliegt, von dem, was schon immer so gemacht wurde, zu meinen, es müsse auch so gemacht werden. Dass ein solcher Traditionalismus in starkem Gegensatz zu jeder Art von Rationalismus steht, liegt auf der Hand; doch das moderne Prinzip: Neu ist besser, immer! ist auch nicht wirklich ‚rational‘. Es ist letztlich nicht vielmehr als eine Polemik gegen Traditionalismus als solchen.
Um in Erfahrung zu bringen, was es mit dieser Opposition auf sich hat, ist Descartes wieder recht einschlägig. Denn so scheint in seinem Fall die Pflicht, selbst zu denken, nichts anderes als die notwendige Folge daraus zu sein, dass dem bisher Gedachten überhaupt nicht mehr zu trauen ist. Machen wir uns die Bedeutung dieser These klar: wir behaupten hiermit nicht weniger, als dass das „sapere aude“ der Aufklärung weniger aus dem Geiste des Heldenmutes, als aus dem des Misstrauens geboren ist. – Demnach wären also die Aufklärer wirklich interessante Helden, nämlich tragische.
Es läge nahe, im cartesianischen Skeptizismus eine Reaktion auf die neuzeitliche Erkenntnis zu sehen, wie radikal uns unsere Sinne mitunter doch täuschen (ich kann die Sonne anstarren bis ich blind werde, sie scheint sich – trotz besseren Wissens – doch zu drehen). Tatsächlich hätte man sich bei dieser Interpretation doch sehr von Descartes blenden lassen. Fallen einem doch wenige Dinge ein, die gekünstelter als ein ‚methodischer Skeptizismus‘ sind, bei welchem man in der frommen Hoffnung zweifelt, eine letzte Wahrheit zu finden, die überbleibt. – Entweder man zweifelt oder man ist von einer Sache überzeugt; sich vorzustellen, man zweifle, ist kein echter Zweifel. Mir scheint der verzweifelte Zweifel des René Descartes aber genau an einer Stelle echt zu sein: dort, wo er an der Öffentlichkeit seiner Zeit verzweifelt.
Dies zeigt sich deutlich im 6. Teil des Discours de la Methode, in welchem er den Galilei-Prozess theoretisch verarbeitet, indem er diskutiert, was für und wider das Publizieren spricht und – die Vorzüge des der Öffentlichkeit eigenen Gemeinsinns nicht verkennend (vgl. Descartes 1637, VI.4) – zu dem Fazit kommt, dass allein ein posthumes Veröffentlichen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse den besagten Vorzug der Öffentlichkeit mit dem der Privatsphäre: der kontemplativen Ruhe, die er so liebt, zu vereinen vermag (vgl. a.a.O., VI.2. u. 4.). Historisch betrachtet war es wohl nicht nur die zunehmende Intoleranz der katholischen Kirche, die seinen in verantwortungsloser Weise mutigen Freund gerade öffentlich gedemütigt hatte, die Descartes die Öffentlichkeit seiner Zeit problematisch erscheinen ließ; sondern wohl auch der sich in Frankreich gerade konstituierende und aufs engste mit der neuen Politik des Vatikans verwobene Absolutismus, welcher sich ja – er ist in erster Linie ein Zentralisierungsphänomen – durch sein problematisches Verhältnis zu Vielheit als solcher auszeichnet.
Gewissermaßen finden wir in Descartes den Idealtypus der weltflüchtigen Kontemplation nahezu perfekt verkörpert und sehen auch schön, was Carl Schmitt an „dem eigentlichen Heroenzeitalter des okzidentalen Rationalismus“ überhaupt auszusetzen hatte: die starke Zuwendung zum Metaphysischen und Wissenschaftlichen – besonders die von Galilei geforderte Säkularisierung letzterer – war nicht zuletzt eine Flucht aus dem damals politisch umkämpften Feld des Theologischen (vgl. Schmitt 1963, S. 75f, Herv. JM). Damit wurde, so Schmitt weiter, ein Neutralisierungs- und Entpolitisierungsprozess losgetreten (vgl. a.a.O., S. 81), der schließlich zum apolitischen Liberalismus des ausgehenden 19. und 20. Jahrhunderts geführt hat, mit dem er seiner Zeit konfrontiert war. Ohne Schmitts‘ „Begriff des Politischen“ teilen zu müssen, können wir uns dieser Interpretation des 17. Jahrhunderts ohne weiteres anschließen.
Die apolitische Gesinnung Descartes‘ nun zeigt sich wohl nirgends in verdichteterer[34] Form, als an der Stelle seiner intellektuellen Autobiographie, an der er uns (nachdem er ausgeführt hat, wie ihm die ausgezeichnete Bildung, die ihm vergönnt war, auch nur gezeigt habe, was er alles nicht wisse, und er auch er in der große weiten Welt, der er sich daraufhin zugewendet habe, um die Wahrheit zu suchen, nicht fündig geworden sei) erzählt, wie ihm in einem Feldlager während des Dreißigjährigen Krieges, als ihm hier endlich die „Muße“ vergönnt war, wie gewohnt bis 12 Uhr im Bett zu bleiben und sich mit den „eigenen Gedanken zu unterhalten“ (sic!), die große Erkenntnis kam. Die, dass er die Wahrheit wohl in sich selbst finden werde, wenn er alle widersprüchlichen und bloß wahrscheinlichen Meinungen, die ihm in Öffentlichkeit wie Familie vermittelt wurden, mittels seines methodischen Skeptizismus ausmerze und nehme, was übrigbleibt (vgl. Descartes 1637, II.1).
Auch wenn diese Darstellung bezeichnender ist, als sie wohl wirklich war (diese Autobiographie ist nicht auf historische Präzision angelegt; sondern darauf, exemplarisch vorzuleben, wie man selbst denkt); finden wir hier eine für die Zeit typische Intoleranz gegen Vielheit als solche. Bei Descartes im speziellen – das ist wichtig zu wissen, um hier gerecht zu urteilen – ist sie rein theoretischer Natur und richtet sich gegen die begrenzte wissenschaftliche Öffentlichkeit seiner Zeit (ein Motiv, dass einem auch heute nicht fremd sein dürfte). Praktisch postuliert er in seiner „morale par provision“[35], die es ihm ermöglichen sollte, während seines theoretisch radikalen Zweifelns, noch handlungsfähig zu bleiben, eine gewisse Art von Konsverativismus (vgl. a.a.O., III.1-5). Das Problem mit Descartes ist nur, dass er in seine eigenen Fallen tappte und seinen starren Dualismus – von dem er eigentlich wusste, dass es ein künstliches Konstrukt ist (vgl. a.a.O., IV.7) – selbst irgendwann geglaubt hat und wirklich gedacht zu haben scheint, theoretische Gedanken könnten apolitisch sein. Wie wir heute wissen – wir leben gewissermaßen in einem cartesianisch geprägten Weltbild –, was das ein Fehlschluss. Alles, was das Licht der Öffentlichkeit erblickt, wird notwendig zu einem Gemeinplatz und damit politisch.
Festzuhalten bleibt, dass Descartes zwar von der öffentlichen Allgemeinheit entfremdet war; aber die Möglichkeit hatte, sich ins Private zu flüchten, um dort der intimen Art von Allgemeinheit zu frönen: der Unterhaltung mit seinen eigenen Gedanken.
KAPITEL 3: Die Entfremdung vom eigenen Selbst
Zur modernen Entfremdung
Gehen wir nun weiter in der Zeit und widmen uns der jüngeren europäischen Geschichte, um zu finden, wie nunmehr die Privatsphäre problematisch werden konnte und wie sich das ausgewirkt hat (und nach wie vor auch noch wirkt). Schematisch gesprochen: in der Moderne werden wir finden, wie Homo Faber, als er mit der Tradition brach, einige Prozesse losgetreten hat, deren Konsequenzen eine bestimmte Art von Reaktionsschema attraktiv machten: ein mehr instinktives, mit welchem man in arbeitender und konsumierender Indifferenz mit den modernen Umbrüchen umgeht: das Animal laborans. Der Übergang von Neuzeit zu Moderne gilt uns also, im Gegensatz zu dem von Mittelalter zu Neuzeit, weniger als Diskontinuität, als vielmehr – auch wenn hier Verbrechen begangen wurden, für welche sich in der Geschichte letztlich keine Beispiele finden lassen – als Kontinuität.
3.1 Die Verhöflichung des Kriegers
Von der höfischen Gesellschaft zur Weltgesellschaft
Hatten wir in der Neuzeit noch die Voraussetzungen mehr ideeller Natur untersucht, so wollen wir in diesem Kapitel etwas ‚materialistischer‘[36] werden und die ökonomischen Voraussetzungen der modernen Entfremdung genauer unter die Lupe nehmen. Hierzu wollen wir dann auch ausführlicher auf jenen Zentralisierungsprozess eingehen, der im vorhergehenden Kapitel nicht vielmehr als eine Fußnote dargestellt hat.
Wenn überhaupt ein Ereignis die Moderne markiert, so ist es die Französische Revolution (=FR). Hier finden wir, dass jener „Pathos des Neuen“, welcher in der Neuzeit noch ausschließlich im intellektuellen Feld gegenwärtig war, nun auch tat sächlich geworden ist, d.h. auf das Politische übergegriffen hat (vgl. Arendt 1967, S. 318f). Dass der Fortschrittsbegriff überhaupt immer einen entfremdenden Bruch mit der Tradition bedeutet, haben wir bereits deutlich bei Descartes gesehen; uns interessiert hier zunächst ein anderer Aspekt dieses Urbilds von ‚Revolution‘ überhaupt. Nämlich der, dass die FR nach Elias einen bedeutenden Grad im Zivilisationsprozess markiere: sie bedeute „einen gewaltigen und besonders spürbaren Schub auf dem Wege der Vergesellschaftung (Herv. JM) des Steuer- oder des Gewaltmonopols“ (Elias 1939a, S. 231).
Es hilft also nichts: spätestens an dieser Stelle können wir uns um eine Bestimmung[37] des obskuren Gesellschaftsbegriffes nicht länger herumdrücken; doch vorerst – und so sollte die Sache auch an Klarheit gewinnen – wollen wir den historischen Zentralisierungsprozess, der jener Revolution vorausging, etwas ausführlicher beschreiben.
Schon im Mittelalter lässt sich ein gewisser Transformationsprozess der Staatsordnung beobachten, den Elias in Über den Prozeß der Zivilisation als „Mechanismus der Monopolbildung“ (Elias 1939a, S. 153) induktiv auf den Begriff brachte und der im wesentlichen nichts anderes als den soziologischen Aspekt der historischen Entwicklung vom Feudalismus über den Absolutismus hin zum Parlamentarismus beschreibt.
Führen wir das also genauer aus: nachdem das Karolinger Reich weitgehend erschlossen war und im weiteren historischen Verlauf von den Landesherren immer weiter auf ihre kriegerische Gefolgschaft zur landwirtschaftlichen Nutzung und politischen Verwaltung aufgeteilt worden war, zeigten sich deutlich die dezentralen Tendenzen, die einer Staatsordnung drohen, welche sich ausschließlich auf eine Naturalwirtschaft stützt. – Wenn keine äußere Bedrohung durch einen Feind, welcher eine Einigung nach innen wahrscheinlich macht, gegeben ist, kommt es meist so, dass der Landesherr bald nur noch de jure Monarch ist; nicht mehr aber: de facto. Dementsprechend sah sich das Westkarolinger Reich (im Ostkarolinger hatte man weit länger eine offene Flanke nach Osten, von der aus Feinde das Reich bedrohten) schon sehr früh der dezentralen Tendenz ausgesetzt, dass sich die verschiedenen Häuser mehr und mehr von der Herrschaft des Landesherrn lossagten und um die Vorherrschaft im Inneren konkurrierten. Lassen wir die Einzelheiten dieser Kämpfe außen vor, so ist doch die entscheidende Bedeutung zu erwähnen, die dem aus den oberitalienischen Städten kommenden Wirtschaftsmedium ‚Geld‘ zukam.
Eine Geldwirtschaft ist gewissermaßen die Bedingung der Möglichkeit von einem zentralen Territorialstaat überhaupt, da erst durch das Vorhandensein einer solchen ein Steuermonopol durchgesetzt werden kann, mit welchem es möglich wird, ein Beamtentum wie ein stehendes Heer zu unterhalten. Während bei einer Naturalwirtschaft noch die kriegerische Gefolgschaft, die nötig ist, um die eigene Herrschaft zu sichern, mit Land bezahlt wird; ist es mit einer Geldwirtschaft möglich, aus diesem feudalen Teufelskreis auszubrechen und eine zentralistische Herrschaft zu institutionalisieren. Selbst wenn das eroberte Land unter der kriegerischen Gefolgschaft so aufgeteilt wird, dass letztere es nur im Namen des Monarchen regieren, so ist es ziemlich sicher, dass sie spätestens binnen Generationen dieses als ihr Eigentum betrachten und bei körperlicher Abwesenheit des Monarchen auch kaum mehr einen Grund sehen, Steuern an diesen zu zahlen. Kurzum: eine Geldwirtschaft bedeutet also nicht zuletzt eine Lösung vom Boden (ob sie deswegen auch Enteignung bedeutet, werden wir zu diskutieren haben). (vgl. a.a.O.).
Mit dem Absolutismus des 17. und 18. Jahrhunderts, der sich auf die nun gegebene Geldwirtschaft stützte, war die Zentralisierung des Staates in England und Frankreich weitgehend abgeschlossen, die weiteren politischen Kämpfe sollten sich von nun an in erster Linie um die Verfügung über den Verteilungsschlüssel drehen, der dem eigenen Stand Privilegien zu sichern vermag. Das Steuer- und Gewaltmonopol als solches bleib dabei aber weitgehend unangetastet. Ende des 18. Jahrhunderts, ab der FR (den britischen Sonderweg lassen wir hier mal außen vor), ging diese Entwicklung von der ständischen Ordnung des Absolutismus, in welcher die Person des Monarchen weitgehend nach eigenem Belieben herrschte, zum Parlamentarismus über, in welchen Parteien zwischen der Gesellschaft einerseits und dem Staat andererseits vermitteln – im 20. Jahrhundert schließlich sollte sie so weit sein, dass endlich nahezu die Gesellschaft als Ganzes herrscht.
Um unserem Erkenntnisinteresse nachzukommen, wollen wir uns hier einem bestimmten Aspekt der Sache widmen: dem Hof, von welchem aus der Kriegeradel Politik betrieb und welcher diesen derart ‚zivilisieren‘ sollte, dass schließlich kein Krieger mehr übrigblieb. In dieser Institution finden wir also gleichsam das Urbild für Gesellschaft überhaupt: die ‚ société ‘. Diese Erscheinung findet sich zwar nicht selten in Monarchien und Aristokratien verschiedenster Zeitalter; doch die Bedeutung des Gesellschaftsbegriffes lässt sich wohl nirgends deutlicher als am Beispiel des Schlosses Versailles veranschaulichen, welches Ludwig XIV. eigens errichten ließ, um den aufmüpfigen Landadel zu enteignen und unter seine Kontrolle zu bringen. Historisch gesehen ist Versailles nichts anderes als das endgültige Ineinanderfallen von Oikos und Polis, von Haushalt und Politik, die traditionellerweise streng voneinander getrennt waren (die Alten – auf die wir uns, sprechen wir von ‚Politik‘, ja berufen – gingen davon aus, dass die ‚Polis‘ durch das friedliche Aufeinandertreffen von freien Männern, die den Oikos und seine Zwänge hinter sich gelassen haben, konstituiert sei).
Hier haben wir also eine Öffentlichkeit, die allein eine Person mit Recht ihr ‚Eigentum‘ nennt und die alle beteiligten Akteure – aufgrund des Umstandes, dass hier ihre gesamte Existenz auf dem Spiel steht – nötigt, ihr Verhalten genaustens zu regulieren und Gründe wie Folgen ihrer Handlungen weitgehend zu kalkulieren (vgl. a.a.O., S. 279). Im Grunde finden wir in den höfischen Gesellschaften, in welchen die Intrige das zentrale Prinzip politischen Handelns‘ darstellt, die Geburtsstätte des zweckrationalen Akteurs, den wir heute ‚Homo oeconomicus‘ zu nennen gewohnt sind, und können an dieser Stelle vorläufig festhalten, dass Gesellschaft also wesentlich eine Enteignung der Akteure wie die Mechanisierung ihres Handelns zu bedeuten scheint.
Wie gesagt: derartige Phänomene sind keineswegs spezifisch modern, doch haben die höfischen Gesellschaften im französischen Absolutismus nicht nur eine Größenordnung erreicht, die es rechtfertigen würde, von einer ‚Vergesellschaftung der Welt‘ zu sprechen; sondern sie sind hier in einem solchen Maße vorbildlich für den Rest Europas geworden, das hier in der Tat galt, dass sich zu dieser kulturellen Hegemonie nicht nicht verhalten werden konnte. Die Salons, in welchem sich das Bürgertum die Langeweile vertrieb und des Öfteren verschworen hatte, demonstrieren nicht nur diesen Umstand, sondern zeigen auch deutlich, worin die grundsätzliche Problematik dieser Art von ‚Öffentlichkeit‘ besteht: eine Öffentlichkeit, welche sich verschwört – also Geheimnisse vor dem Rest der Welt hat –, ist nicht eigentlich eine Öffentlichkeit.
In diesem Sinne wollen damit enden, unseren Begriff von ‚Vergesellschaftung‘ vorerst als die Privatisierung der Öffentlichkeit zu bestimmen und wer denkt, dass dies ein Phänomen der Vergangenheit darstellt, der sei daran erinnert, dass Marc Zuckerberg Eigentumsrechte für eine weltweite Öffentlichkeit namens ‚Facebook‘ gelten machen kann. Dass der Begriff ‚Eigentum‘ im eigentlichen Sinne hier gar nicht mehr greift, deutet bereits ein weiteres Problem an, das mit dem Ineinanderfallen von Privatsphäre und öffentlichem Raum einhergeht: etwas, das allen ‚gehört‘, kann letztlich niemand mehr berechtigterweise sein ‚Eigentum‘ nennen.
3.2 Das Öffentlich-Werden des Privaten, der Arbeit
Als die Askese in die Welt kam
Wir haben nun gesehen, wie die Vergesellschaftung der Welt von oben durchgesetzt wurde, indem der Verhaltensstandart, zu dem eine höfische Existenz zwang, vorbildlich für weite Teile des europäischen Bürgertums wurde. Betrachten wir die Sache aber so einseitig, erklärt dies schwerlich, wie es zur Vergesellschaftung der ganzen Welt kam und warum wir heute in einer Gesellschaft leben, in der ‚Arbeit‘ als solche für das Höchste gehalten zu werden scheint, was ein Mensch tun kann. Um dies zu verstehen, wollen wir uns nun wieder dem asketischen Protestantismus widmen, um zu finden, wie die Vergesellschaftung der Welt von unten durchgesetzt und das Private öffentlich werden konnte. Weiter wollen wir dann untersuchen, wie sich das wohl auf die Welt ausgewirkt haben mag.
Es gehört mit zu den größten Rätseln, welche uns die Geschichte des Abendlandes aufgibt, wie es kam, dass die Askese, welche hinter den Mauern der Klöster praktiziert wurde, in die Welt kommen konnte und zu einem Gemeinplatz werden. Um die Antwort, die uns Weber in seiner Studie Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus gab, zu begreifen, wollen wir uns wieder dem idealtypischen Gegensatz zwischen innerweltlicher Askese und weltflüchtiger Kontemplation widmen, welchen wir schon aus 2.3 kennen, und um einen weiteren Idealtypus erweitern: die „weltablehnende Askese“.
Die Gemeinsamkeit von religiöser Askese überhaupt: das „aktive ethische Handeln “ in „dem Bewusstsein, durch Gott gelenkt zu werden“ (Weber 1921a, S. 328), und Kontemplation: der „Entleerung von allem, was irgendwie an die ‚Welt‘ (und ihre alltäglichen Zwänge) erinnert“, um sich von Gott zuständlich erfüllt zu fühlen (a.a.O., S. 330, Herv. JM), hat uns gewissermaßen das Beispiel der praktischen Weltflucht Descartes‘ gezeigt. Sie bestand gewissermaßen in der Negation der Welt als solcher und diese Gemeinsamkeit lässt sich an dieser Stelle – erinnern wir uns, wie wir das Urbild aller religiösen Akteure, den Zauberer, definiert haben – ohne weiteres erklären: religiöses Charisma wird erfahrungsgemäß meist dadurch in Anspruch zu nehmen gesucht, dass gegen die profane Alltagslogik opponiert wird. Der spezifische Unterschied zwischen religiöser Askese und Kontemplation sei, so Weber, aber vornehmlich in ihrem praktischen Aspekt zu sehen: so würde der Glaube, als Gotteswerkzeug zu wirken, ein äußerst strenges prinzipiengeleitetes Handeln, einen „ethischen Rigorismus“, zur Folge haben; während der, von Gott „zuständlich erfüllt“ zu sein, meist anomisch wirke (vgl. a.a.O., S. 333). Religiöse Kontemplation – das Gegenteil von Aktivität – macht also Handlungsunfähig.
Das im Sinne der Askese rationalisierte Leben im Abendland findet sich also zunächst hinter den Klostermauern, welche die Heilsaristokratie von der profanen Welt und ihrer kreatürlichen Gottesferne abschirmten. Die unter unseren Gesichtspunkten bedeutendste Leistung Martin Luthers‘ war es nun, gegen die Heilsaristokratie seiner Zeit ins Feld zu ziehen und das hergebrachte asketische Ideal so zu modifizieren, dass wirklich jeder ein Mönch werden konnte, ohne, dass das Abendland binnen einer Generation ausstirbt (vgl. Weber 1904a, S. 158). Er hat also viel dazu beigetragen, dass die ‚weltablehnende‘ Askese in die Welt kam und zur ‚innerweltlichen‘ Askese wurde. Doch erklärt dies allein noch nicht, warum ausgerechnet die ‚Arbeit‘ die Tätigkeit werden sollte, von welcher man glaubte, Gott greife durch sie ordnend in die Welt ein, und nicht vielmehr eine andere Tätigkeit (so lässt sich als Politiker ja sehr viel effektiver die ‚Welt‘ ordnen, man denke hier an Cromwell). Und schauen wir genauer in die mittelalterlichen Klöster, so finden wir auch, dass hier nicht zuletzt so diszipliniert gearbeitet wurde, um sich später in der sich einstellenden Erschöpfung dem Schöpfer kontemplativ anzunähern. Wir finden hier also zunächst noch wenig von der Hysterie, mit der sich heute in die der Arbeit eigene Unmittelbarkeit gestürzt wird.
Um dieses moderne Phänomen besser zu begreifen, wollen wir uns nun kurz mit der calvinistischen Prädestinationslehre und ihrem weiteren Rezeptionsverlauf beschäftigen.[38] Wie bereits angedeutet (vgl. Anm. 27), zeichnet sich nach Weber das calvinistische Postulat eines absolut allmächtigen und überweltlichen Gottes – welcher alles schon seit jeher vorherbestimmt und einige auserwählt, indem er durch ihre Hand ordnend in den Kosmos eingreift – durch seine Konsequenz aus: sie schließt magische Einflussnahme überhaupt aus (vgl. a.a.O., S. 144-147). Während für Calvin die Sache noch klar war: aus der eigenen Auserwähltheit geht ein unbedingter Glaube an Gott hervor, mehr kann man nicht ‚tun‘; konnte dies die ‚Laien‘, mit denen es die Praxis der Seelsorge bei der Popularisierung dieser Lehre notwendigerweise zu tun hatte, schwerlich zufriedenstellen. Diese würden Weber zu Folge stets nach diesseitigen Zeichen für den Gnadenstand von sich und ihren Mitmenschen trachten, über die sie auch disponieren. Paradoxerweise würden derartige Bedürfnisse umso stärker, je größer die geglaubte Macht sei (vgl. Weber 1921a, S. 317). Die Antwort, dass sie nicht mehr tun können als auf keinen Fall zu ‚zweifeln‘ und unbedingt zu ‚glauben‘, musste folglich äußerst unbefriedigend erscheinen. Das konkrete Problem der calvinistischen Priester war es näherhin, dass sie einerseits einen unmenschlichen Gott predigen sollten, der die ganze Welt „zu ewigem Tode“ (Weber 1904a, S. 142) verurteilt hat; aber gleichzeigt den Leuten zu vermitteln hatten, dass sie keine Angst haben dürften und sich ihres Gnadenstandes gewiss sein müssten. Auf der Suche nach etwas, das dem blasphemischen Zweifel entgegenwirkt, welcher sich der Natur der Sache immer einstellt, fängt man an, in Ruhe über die Dinge nachzudenken und sie von allen Seiten zu betrachten (wir sahen bereits: religiöses Charisma und Nachdenken sind antinomisch), entdeckten diese Prediger den Wert von Arbeit als solcher. Sie entdeckten, dass „rastlose Berufsarbeit“ ein „hervorragendes Mittel“ ist, den Zweifel auszuschalten, und sich darüber hinaus auch noch eignet, den eigenen Gnadenstand praktisch seinen Mitmenschen zu veranschaulichen (vgl. a.a.O., S. 149ff). Wir können also festhalten: am Anfang der Arbeitsgesellschaft stand die bloße Angst.
Schauen wir weiter, wie sich die Askese in der Welt ausgewirkt hat und ab wann hier berechtigterweise von einem ‚Öffentlichen Werden des Privaten‘ gesprochen werden kann, so finden wir, dass die Arbeit in dem Moment politisch wurde, als das vom asketisch wirtschaftenden Bourgeois angehäufte Kapital den nationalen Maßstab sprengte. Die Arbeit wurde also im Zuge des Imperialismus zum zentralen Bestimmungsgrund politischen Handelns‘.
Während bei der FR, wie schon vorher bei der Glorious Revolution, weite Teile des Volkes ihre Partizipation am Staat geltend machten; schaltete sich der asketische Protestantismus hier aus, sobald er eine Regierung vorfand, die ihm keine staatliche Einheitsreligion aufzuoktroyieren versuchte. Dieses Desinteressement an der Welt sollte zur absolut apolitischen Indifferenz verkommen, als sich dieser Akteur säkularisierte und nur noch einen gesinnungslosen Unternehmer, einen Bourgeois, darstellte. Während der Puritaner noch bereit war, für seinen Glauben einen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen; interessierte den Bourgeois schon nichts mehr als der ökonomische Profit um des reinen ‚Mehr‘ willens (hierfür hatte er dann den bisher größten Krieg vom Zaun gebrochen). Nach Arendt habe ihn diese Gesinnung genau dann zum politischen Handeln genötigt, als das von ihm angehäufte Kapital nationale Begrenzungen sprengte und Investitionen in die Kolonien zum letzten Ausweg wurden, seiner Akkumulationssucht – d.i. die säkularisierte Askese – Abhilfe zu verschaffen (vgl. Arendt 1955, S. 303). Es bedurfte nun des Exportes staatlicher Gewaltmittel, um die getätigten Investitionen im Ausland zu sichern. Das machte für den Bourgeois eine Einflussnahme auf die Staatsgeschäfte notwendig; aber auch als er gezwungenermaßen politisch tätig wurde, zeigte er die ihm eigene grenzenlose Gier (Cecil Rhodes: „ Expansion is everything, (...) I would annex the planets if I could “ (a.a.O., S. 286)). – Ein für uns nicht weniger bedeutender Aspekt der Sache: mit dem nun entstehenden internationalen Finanzmarkt wurde die Öffentlichkeit Zielobjekt korrumpierender Kampagnen (vgl. a.a.O., S. 309); ein Zustand, der sich bis heute noch wesentlich verschlimmert hat.
Begeben wir uns nun wieder auf ein höheres Abstraktionsniveau und schauen wir, was die Vergesellschaftung bzw. Ökonomisierung der Politik rein begrifflich bedeutet, indem wir uns dem Theoretiker widmen, welcher diese Entwicklung in ihrem Entstehen als Zeitzeuge beobachtet und die Mechanik eines politischen Materialismus ähnlich konsequent durchdacht hat, wie sein kontinentaler Zeitgenosse, Descartes, die eines kosmologischen: die Rede ist von Thomas Hobbes.
Nach Arendt ist der von ihm geschilderte Naturzustand „bellum omnium contra omnes“ (Hobbes 1651, I.13) mehr als die pessimistische Weltsicht eines vom Bürgerkrieg müden Flüchtlings; er sei die weitsichtige Erkenntnis eines äußerst politisch denkenden Mannes, dass, werden lebensnotwendige Güter zum Gegenstand expansiver Machtpolitik, der Größere – will er nicht selbst gefressen werden – den Kleineren notwendigerweise fressen müsse (vgl. a.a.O., S. 114). Er hat also am Beispiel der ‚Politischen Ökonomie‘ theoretisch klar erkannt, dass das Prinzip a priori von Gesellschaft überhaupt, die als solche ja immer auch auf die existenzielle Grundlage eines Menschen, das Private, geht (vgl. Kap. 3.1), nichts anderes als Konkurrenz (in der modernen Wirtschaft nennt es sich ‚Wettbewerb‘) sein kann und keinen anderen Maßstab als Erfolg kennt (vgl. Arendt 1955, S. 316-319). Der Sache nach kann er uns also als der Entdecker des Homo oeconomicus gelten.
Ganz in diesem Sinne ist dann auch die weitere Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg verlaufen: kein europäischer Staat konnte es sich lange leisten, sich aus der imperialen Expansionspolitik herauszuhalten und die im Zuge der Industrialisierung überflüssig gewordenen Arbeitnehmer nicht auf abenteuerliche Missionen ins Ausland zu schicken. Tat er das nicht, konnte er ziemlich sicher sein, dass ihn einer der wachsenden Nachbarn alsbald fressen wird. Entscheidend ist, dass sich diese Politik, so Arendt, schnell gegen Staat wie Bourgeoisie des Mutterlandes selbst richten sollte. Das sei genau zu dem Zeitpunkt der Fall gewesen, als sich in den Kolonien der Mob, welcher sich aus diesen verstoßenen Existenzen zusammensetzte, in seinem Bündnis mit dem Kapital die Führung übernahm. Von nun an sollte in politischen Angelegenheiten zunehmend rassistischen Ideologien und Gesichtspunkten der Vorzug gegenüber ökonomischen geben werden (vgl. a.a.O., S. 439-443). Derartige politische Gemeinschaften nun, welche sich auf biologische Gegebenheiten berufen, müssen sich früher oder später gegen den Staat als solchen wenden. Ist dieser doch nichts Natürliches, sondern wie letztlich jede Form von politischer Gemeinschaft überhaupt etwas künstlich den natürlichen Verfallsprozessen entgegengesetztes: ein Artefakt.
In der politischen Ideengeschichte findet sich das allgemeine Umdenken gegenüber der Bourgeoisie ziemlich deutlich wieder. Hatte Marx noch solch eine Ehrfurcht vor ihr, dass er sie gleichsam zum letzten Feind der Menschheit emporhob; wunderte sich Weber – der in seinem bejahenden Enthusiasmus für die imperialistischen Grundprinzipien Marx um nichts nachstand[39] – schon, wie solch eine hysterische Klasse hatte historisch so bedeutend werden können; bis schließlich Schmitt nach dem Ersten Weltkrieg nur noch Spott und Verachtung für sie übrig hatte und sich mit seinem Konzept eines „ totalen Staat(s)“ (Schmitt 1963, S. 23, Herv. im Orig.) dem Führer enthusiastisch in die Arme warf (er verwechselte ihn wohl mit dem Duce).
Wir werden auf den totalen Zusammenbruch von Nationalstaat und -gesellschaft im 20. Jahrhundert zurückkommen, vorerst wollen wir schauen, wie sich die Vergesellschaftung eines anderen Teils der Welt ausgewirkt hat: die der Kultur. Bereits Kant – er hatte die Société in Gestalt der bürgerlichen Salons bereits im 18. Jahrhundert aus eigener Anschauung gekannt – hatte in den bereits zitierten Ausführungen zur „ungeselligen Geselligkeit“ (vgl. § 4) Hobbes theoretische Erkenntnis aufgegriffen und neben den Folgen für die internationale Politik auch die für die Kultur aus dem apriorischen Prinzip von Gesellschaft überhaupt, Konkurrenz, deduziert. Wir erinnern uns: zwar war er relativ optimistisch ob des zivilisatorischen Fortschrittes, den diese spezifisch ‚gesellschaftliche‘ Spannung affiziert; doch den kulturellen Aspekt der Sache – und hierin war er Schüler Rousseaus – sah er skeptischer: einen moralischen Fortschritt bedeute das eher weniger. Kennt nämlich eine perfekt vergesellschaftete Politik nur noch Konkurrenz, so eine ebenso perfekt vergesellschaftete Kultur nur noch Distinktion und ist für Kant nicht mehr ‚Kultur‘ im eigentlichen Sinne, sondern nur noch überlästige ‚Zivilisiertheit‘. Bestimmen wir den entsprechenden Idealtypus als „Bildungsphilister“[40], so können wir uns eigentlich nicht des Eindrucks erwehren, dass Kant hier richtiglag: rechnet man die „Idee der Moralität (.) noch zur Kultur“, so wird man doch kaum diesen Typus, welcher derartige Ideen bloß zwecks des eigenen Aufstiegs in der Gesellschaft gebraucht, kaum einen ‚ kulturellen Akteur‘ nennen wollen.
Wollen wir dieses Phänomen besser begreifen, müssen wir uns nun dem Theoretiker widmen, welcher in den nach dem Zweiten Weltkrieg frisch restaurierten Nationalstaaten und -gesellschaften beobachtete, wie die Kultur bevorzugter Gegenstand von Vergesellschaftungsprozessen wurde und dies in seinem Hauptwerk La Distinktion 1979 weitgehend[41] auf den Begriff brachte: Pierre Bourdieu. Es ist durchaus kein Zufall, dass dieses bedeutende Werk in Frankreich geschrieben wurde und nicht etwa in Deutschland, da es sich historisch betrachtet nämlich so verhält, dass der Prozess der Vergesellschaftung der abendländischen Kulturen in den absolutistischen Höfen losgetreten wurde. Ab einem bestimmten Grad des abendländischen Zivilisationsprozesses nämlich, so Elias, habe der absolutistische Monarch dem im Aufstieg begriffenen Berufsbürgertum eine Gegnerschaft entgegengesetzt, um sich, aufgrund des sich daraus ergebenden Antagonismus, über seine Vermittlungsrolle unverzichtbar zu machen. Die Rede ist von der „höfischen Aristokratie“, deren politische Funktion in der Endphase des Absolutismus eben in nicht vielmehr bestanden habe, als darin, sich durch ‚kultivieren‘ ihres Geschmackes vom Bürgertum zu distinguieren (vgl. Elias 1939a, S. 426). Die Notwendigkeit, dass derartige Antagonismen inszeniert werden müssen, um die eigene Herrschaft als absolutistischer Monarch zu sichern, hat in der europäischen Geschichte wohl kaum einer klarer erkannt und für sich zu nutzen gewusst als Ludwig XIV. und so überrascht es wenig, dass wir in Frankreich gleichsam die erstere Körperschaft von Geschmackskritikern finden: die höfische Aristokratie.
Es liegt also auf der Hand, dass die Vergesellschaftung der Kultur ein ‚top-down‘-Phänomen darstellt; doch finden wir etwa seit 1968 den eigenartigen Tatbestand vor, dass sich jener aristokratische Ästhetizismus mit der asketischen Ethik des Berufsbürgertums vollständig synthetisiert hat, – und das nicht nur in Frankreich! Dies hat Bourdieu äußerst schön im Kapitel des zitierten Werkes Von der Pflicht zur Pflicht zum Genuß herausgearbeitet, in welchem er beschreibt, wie seit den Studentenbewegungen die Vorzeichen gewissermaßen einfach umgedreht worden sind: die „Angst vorm Genießen“ sei durch „(d)ie Angst, nicht ausreichend zu genießen“, ersetzt worden (vgl. Bourdieu 1982, S. 576). Dieser Befund, wie der Übergang von der Arbeits- zur Konsumgesellschaft tatsächlich von statten gegangen zu sein scheint, ist nur auf den ersten Blick überraschend; besinnen wir uns auf unsere Begriffsbestimmung zurück, so finden wir, dass Produktion und Konsumtion die Antithesen der bei einem Lebewesen erst mit dem Tod ein Ende findenden Dialektik darstellen: des Lebensprozesses. Dass seit den letzten Jahrzehnten die Stimmen immer lauter werden, welche fordern, dass nun mit der Spaßgesellschaft endlich mal ein Ende sein müsse und der Ernst des Lebens wieder einkehren – womit sie ja nicht zuletzt zum Ausdruck bringen, dass nun wieder weniger konsumiert und mehr produziert werden müsse –, veranschaulicht diesen Kreislauf recht deutlich. Nun lässt sich nur äußerst schwer beurteilen, was die größere Tragödie ist: Einer Gesellschaft nützlich sein zu wollen, die zusehends automatischer wird und folglich menschlicher Arbeit immer weniger bedarf? Oder doch lieber versuchen, den eigenen Gefühlen davon zu laufen, indem möglichst effektiv ‚genossen‘ wird?
Derartig dekadente Oberflächenphänomene sollen uns hier aber nicht weiter aufhalten, da es doch viel interessanter scheint, zu schauen, woher dieser unbedingte Wunsch herrührt, sich selbst zu vergessen. Woher kommt diese der modernen Welt scheinbar eigene Verängstigung?
3.3 Enteignung und die puritanische Angst
Von unserem Verhängnis, dem „stahlharten Gehäuse“
Nachdem wir uns nun einen halbwegs adäquaten Begriff von ‚Gesellschaft‘ erarbeitet haben, gibt uns das nun ein Schema, dass wir gleichsam als Leitfaden nutzen wollen, nach den Ursprüngen jener modernen Verängstigung zu suchen. Gehen wir so vor, ist uns der soziologische Blick – welcher ja per definitionem ja die Gesellschaft als solche zum Gegenstand hat – der erste Anhaltspunkt für diese Suche.
Beginnt man ein Studium der Soziologie, ist man nicht selten überrascht, dass viele Soziologen der handelnde Mensch als solcher gar nicht interessiert, da er – soziologisch gesehen – nicht vielmehr als ein Atom in einem umfassenderen System namens ‚Gesellschaft‘ darstellt. Entsprechend hat es sich in der Soziologie als zweckmäßig erwiesen, ausschließlich die Kräfte, welche in diesem System wirken, mittels des Kommunikationsbegriffes zu beschreiben und dabei von deren Materie, dem Menschen, weitgehend zu abstrahieren. Letztlich finden wir hier einen alten Bekannten wieder: den neuzeitlichen Paradigmenwechsel. – Es wird eben nicht nur auf die Erde vom Standpunkt des Weltalls aus geschaut, sondern auch auf die sie bevölkernden Menschen; ein Paradigma, das eigentlich noch schwerer zu denken ist, als dass Erde und Himmel denselben Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind. Entscheidend hierbei ist, dass man mit dieser Konzeption gut fährt, solang man sich auf genuin ‚gesellschaftliche‘ Phänomene beschränkt, die Begrenzung durch die „psychischen Systeme“ respektiert (wie etwa Luhmann das tat, als er den Begriff der „doppelten Kontingenz“ prägte (vgl. Luhmann 1987, Kap. 3)) und ‚sozial‘ nicht mit ‚politisch‘ verwechselt. Denn nach allem was wir bisher gesehen haben (Schloss Versailles), ließe es sich diskutieren, ob der Gesellschaftsbegriff nicht als diejenige Öffentlichkeit zu definieren ist, deren Akteure vollständig ökonomischen Zwängen unterworfen sind; woran auf jeden Fall so viel als sicher gelten darf, dass die Gesellschaft sich über den Determinismus auszeichnet, mit dem sie die Akteure ihren Eigengesetzlichkeiten unterwirft.
Darüber hinaus ist es äußerst bezeichnend, dass mit der fortschreitenden Vergesellschaftung der Welt und das heißt ja nicht zuletzt: dem Brüchig-werden der alten Grenze zwischen Privatsphäre und öffentlichen Raum, der Begriff der Intimität im 17. Jahrhundert von Rousseau in ganz entscheidendem Maße geprägt wurde (vgl. Arendt 1967, S. 49f, Herv. JM). Es liegt auf der Hand: bricht die Privatsphäre als der mir eigentümliche Teil der Welt – an welchen ich mich flüchten kann, will ich mich dem Gesehen- und Beurteilt-Werden in der Öffentlichkeit entziehen – weg, müssen doch das Seelische und Körperliche als die letzten Rückzugsorte erscheinen. Nun befinden wir uns mit Rousseau noch im 18. Jahrhundert, in welchem die Kultur noch nicht in dem Maße Gegenstand der Vergesellschaftungsprozesse geworden ist, wie sie das heute zu sein pflegt (erinnern wir uns: der Bildungsphilister wurde erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts beklagt (vgl. Fußnote 39)). Weiter konnte er zu diesem Zeitpunkt auch noch wenig von der Ignoranz ahnen, mit der im kommenden Jahrhundert ‚Wissenschaft‘ betreiben sollte. Meine Darstellung des Soziologischen Blicks war schon etwas naiv: als ob ein ‚echter‘ Wissenschaftler – und hiermit meine ich die modernen Wissenschaftsapostel, welche die Wissenschaft als ein totale Pseudoreligion missverstehen – sich scheuen würde, die Existenz von so etwas wie einer ‚ Seele ‘ mit Bestimmtheit zu verneinen oder aber anzunehmen, sie könne (die Seele wird bei derartigen Argumentationsmustern gerne als die Summe der Eindrücke, die eine bestimmte Person erlebt hat, konzipiert) Gegenstand einer sicheren Erkenntnis sein. Letzteres, das distanzlose psychologische ‚Verstehen‘, ist ein Phänomen, das wir besonders heute viel beobachten können. Inwiefern der Körper als ein solcher Rückzugsort in der Moderne respektiert wird, wäre eine Frage, die äußerst interessant zu diskutieren wäre; wäre die Vorstellung, man könne sich in seinen Körper zurückziehen, nicht so absurd.
Der deutsche Innerlichkeitskult (unter diesem Gesichtspunkt war Rousseau nun mal sehr deutsch) scheint aber – auf den ersten Blick – wenig mit der panischen Angst zu tun zu haben, mit welcher viele Leute sich heute in die Arbeit stürzen: hat es doch gerade den Anschein, dass sie sich – wenn sie sich sie nur noch als bloßes Werkzeuge einer höheren Macht verstehen wollen – ‚selbst‘ zu vergessen suchen. Um dem nachzugehen ist ein anderer Aspekt der europäischen Geschichte viel einschlägiger, als der moderne Gesellschaftsbegriff: das komplette Wegrechen der letzten kläglichen Bindung, die den meisten Menschen in der Moderne noch geblieben war: Mitglied einer Interessengemeinschaft zu sein. Bei unserer Interpretation des Imperialismus hatten wir uns bereits auf Arendts Beobachtung bezogen, dass die Arbeitsgesellschaft im Zuge der Industrialisierung immer mehr Menschen, deren Arbeit nun nicht mehr benötigt wurde, ausgestoßen habe (vgl. Arendt 1955, S. 340). Nachdem Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise habe man es, so Arendt weiter, nicht mehr nur mit einem brutalen Mob zu tun gehabt, welcher sich aus einigen Deklassierten allen möglichen Schichten und Klassen zusammensetze (a.a.O., S. 348) und durchaus opportunistisch agiere; sondern mit ganzen Massen, welche eine eigenartige „Selbstlosigkeit (sic!) und Desinteressiertheit am eigenen Wohlergehen“ aufweisen würden (vgl. a.a.O., S. 660). Aufgrund dieser Beobachtung spricht sie hier vom kompletten „Untergang der Klassengesellschaft“ (a.a.O., S. 657).
Wir können heute zwar innerhalb vieler ‚westlicher‘ Nationalgesellschaften den Mob wieder beobachten, doch verblasst diese Erscheinung, vergegenwärtigt man sich, dass – im globalen Maßstab – das Problem der Staatenlosigkeit und die von ihm erzeugten Massen von Heimatlosen, die ‚sans papiers‘‚ heute wieder sehr akut sind.[42] In diesem Sinne – es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass wir es hier mit Entfremdung zu tun haben – wollen wir uns nun ausführlicher mit dem Phänomen der Heimatlosigkeit beschäftigen, indem wir wieder den Idealtypus der innerweltlichen Askese heranziehen. So stellt nämlich der asketische Protestantismus, unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, einen unvergleichlich ‚modernen‘ Akteur dar.
Wir hatten bereits gesehen, inwiefern die KW, entgegen der ursprünglichen Intention einiger humanistisch gesinnter Akteure (Giordano Bruno), entzaubernd gewirkt hat: sie machte das Vorhandensein übersinnlicher Mächte überhaupt fraglich. Kommen wir nun zu der Entzauberung der Welt, welche der asketische Protestantismus bewirkt hat, so ist zunächst wiederholend festzustellen, dass dieser zwar in ähnlicher Weise entzaubernd gewirkt hat: er, Calvin, postulierte einen absolut überweltichen Gott, der jede magische Einflussnahme auf sich ausschließt; doch erfolgte die Entwertung alles Kreatürlichen überhaupt hier ungleich radikaler und mit praktisch ganz anderen Konsequenzen. So lässt sich bei diesen Akteuren, welche ausschließlich auf ihr eigenes Seelenheil bedacht und sich entsprechend vornehmlich an diesem einem absolut überweltichen Gott orientieren, oftmals eine Abwendung von der eigenen ‚kreatürlichen‘ Familie beobachten, die bis hin zu Gefühlen des Hasses reicht (vgl. Weber 1904a, II. Anm. 92). Um uns die Möglichkeit derartiger Erscheinungen zu erklären, wollen wir zunächst begrifflich-systematisch vorgehen und uns fragen, was ‚Entzauberung‘ bzw. ‚Rationalisierung‘ ganz allgemein betrachtet bedeuten. Wir hatten es bereits andeutungsweise bei Descartes, freilich nicht mit dieser Radikalität, beobachten können: rationalisierende Entzauberung bedeutet die Negation von Bindung überhaupt. Denn was ist die ‚Tradition‘, welche ‚Rationalisten‘ so gerne negieren, anderes als Bindung an die Vergangenheit?
Soziologisch gesehen, verhält es sich sogar so, dass die Familie wie jede zwischenmenschliche Bindung überhaupt traditionalisierend wirkt und entsprechend den natürlichen Gegensatz zum rationalen Handeln als solchem darstellt. Denn so hat man es in jeder intensiveren zwischenmenschlichen Begegnung mit der theoretischen Transzendenz der Seele – dem Substrat, welches dem empirischen Handeln zugrunde liegt – zu tun. Da diese eine sichere Erkenntnis und ein entsprechendes prinzipiengeleitetes ‚rationales‘ Handeln, welches sich auf die Person als solche bezieht, ausschließt[43], hat man es hier immer schon mit magisch-traditionalen[44] Handeln zu tun, welches unter bestimmten Gesichtspunkten ja durchaus eine gewisse Eigenlogik aufweist. In diesem Sinne muss man wohl auch Luhmanns Feststellung verstehen, dass aus der „doppelte(n) Kontingenz“ psychischer Systeme die Konstitution soziale Systeme folge (vgl. Luhmann 1987, S. 151f).
Doch erklären diese theoretischen Erörterungen noch nicht die Radikalität und Feindseligkeit, mit welcher in einigen calvinistischen Denominationen die weltlichen Bindungen verneint werden (nach der bisherigen Begründung würde Indifferenz doch weit weniger überraschen). Um dies zu verstehen, müssen wir nun empirischer vorgehen und uns zunächst der calvinistischen Doktrin[45] widmen.
Diese lehrt, dass der Mensch – nachdem „Fall in den Stand der Sünde“ – seinen Willen zum Guten verspielt habe und nun als versteinerte Kreatur dem ewigen Tod unterworfen sei. Genauer habe der Schöpfer in Folge dieser Ursünde nach dem „unerforschlichen Rat seines Willens“ in sein Werk, die Welt, eingegriffen und einige Menschen „bestimmt (predestinated) zu ewigem Leben und andere verordnet (foreordained) zu ewigem Tode“. Der Calvinist ist also überzeugt, dass es Gott gefalle, „alle die, welche er bestimmt hat zum Leben, und nur sie, zu der von ihm festgesetzten und passenden Zeit durch sein Wort und seinen Geist wirksam zu berufen … indem er hinwegnimmt ihr steinernes Herz und ihnen gibt ein fleichernes Herz, indem er ihren Willen erneuert und durch seine allmächtige Kraft sie für das, was gut ist, entscheidet“; während die, welche er zum ewigem Tode verordnet hat, den „Versuchungen der Welt“ unterlägen und „sich selbst verhärten“ würden – und das „durch dieselben Mittel, deren Gott sich zur Erweichung anderer bedient“. Von hier aus nun sind die Wiedererweckungs-bewegungen, welche in den Vereinigten Staaten von ungebrochener Aktualität sind (George W. Bush), ein sehr anschauliches Beispiel, den totalitären Charakter dieser Lehre zu zeigen.
Nimmt man die calvinistische Prädestinationslehre ernst, so kann in der Taufe schwerlich ein Zeichen gesehen werden, dass die eigene Prädestination hinreichend evident machen würde; als einziges hinreichendes Kriterium bleibt letztlich nur der Erfolg bei weltlichen Tätigkeiten. Nur dieser kann so gedeutet werden, dass Gott gerade ordnend in sein Werk eingreife und man selbst, als dessen auserwähltes Werkzeug, „bestimmt zu ewigen Leben“ sei. In diesem Sinne finden sich bei Anhängern der calvinistischen Prädestinationslehre nicht selten autobiographische Darstellungen, wonach man lange Zeit ein Leben in ‚kreatürlicher‘ Sünde geführt habe, bis sich eine wundersame Wende ereignet habe: die Berufung bzw. Beseelung durch den „Geist“ des Schöpfers, wonach man in geordneter Weise merklich zum Guten fortgeschritten sei. Entscheidend hierbei bleibt, und das wird im Vergleich mit dem Katholizismus recht deutlich, dass der Calvinismus Weber zu Folge nur nach dem Code: ‚Auserwählt oder nicht-auserwählt?‘ den Gnadenstand interpretiert und demgemäß die Person als Ganzes erfasse. Beim Katholizismus hingegen finde sich (wie bei eigentlich fast allen Religionen mit der Institution des Bußsakraments) eine ausgefeilte Kasuistik, welche den Menschen nicht nachdem beurteile, was er ist, sondern nach den einzelnen Taten, welche er getan hat (vgl. a.a.O., S. 153ff, Herv. JM). Während also der normale Katholik auf die Anstaltsgnade bauen kann, auf welche er sich, sollten ihn Gefühle der Sündhaftigkeit überkommen, verlassen kann; kennt der Calvinist derartige entlastende Institutionen überhaupt nicht, er ist gänzlich auf sich alleine gestellt. Er ist, angesichts der alles determinierenden Allmacht Gottes, peinlichst genau darauf bedacht (es geht um die Ewigkeit!), die Zeichen bei sich wie der Welt richtig zu deuten und zeigt dementsprechend eine extreme Intoleranz gegenüber solchen, deren Lebenswandel keinen Fortschritt zum Guten darzustellen scheint – seien es die nächsten Angehörigen. Stellt denn nicht alles, was nach seinem Code als ‚nicht-wiedererweckt‘ bzw. ‚nicht-auserwählt‘ bestimmt wurde, nichts als eine „Versuchung der Welt“ dar, welche einen Rückfall in den „ewigen Tod“ bedeuten könnte, den man gerade erst glücklicherweise entronnen ist?
Auch hier, die Feindseligkeit gegen alles Kreatürliche trifft ja nicht zuletzt auch die Zeit vor der Erweckung, sehen wir wieder recht klar, wie problematisch der moderne Fortschrittsbegriff sich doch auf individueller Ebene auswirken kann. Dies zeigt sich aber auch unter einem anderen Gesichtspunkt, welcher uns als wesentlich ‚moderner‘[46] als dieser religiöse Fundamentalismus gelten darf, und dessen Folgen bis heute noch deutlich spürbar sind, weltweit: wer überzeugt ist, durch sein Wirken in der Welt von Gottes Größe zu zeugen, der darf eigentlich nie aufhören, tätig zu sein. Der asketische Protestantismus zeichnet sich also besonders durch die Negation von „untätiger Kontemplation“ überhaupt – dem Gegensatz von „rastloser Berufsarbeit“ – aus. Hierin sah Weber das spezifisch moderne Element des asketischen Protestantismus, welches in einer direkten Kontinuität zum modernen Kapitalismus steht (vgl. a.a.O., S. 183f). Hierin finden wir auch die spezifische Differenz zur weltflüchtigen ‚Kontemplation‘ eines Descartes: liebte es dieser noch, sich in den ihn eigentümlichen Teil der Welt zurückzuziehen und hier der „Muße“ zu frönen, bis 12 Uhr im Bett liegen zu bleiben und sich mit den „eigenen Gedanken zu unterhalten“; so ist es ja, wie wir bereits deutlich gesehen haben, gerade dieser kontemplative Dialog mit den eigenen Gedanken, vor welchem sich der asketische Protestant so fürchtet. Entscheidend bleibt, dass letzterer, als er in Gottes Namen Besitz anhäufte, niemals auch nur den Anspruch hatte, den ihm eigentümlichen Teil der Welt aufzusuchen und hier den von ihm angehäuften Besitz zu konsumieren. Er brachte also das „stahlharte Gehäuse“ in die Welt, welches die Möglichkeit – wer nicht mitrennt, den fressen die Hunde – von Eigentum und der ihr entsprechenden Kontemplation zusehends ausschloss. Demgemäß sind wir heute dazu ‚verdammt‘, in derselben Rastlosigkeit weiterzurennen. In diesem Sinne schrieb Weber auch gegen Ende seiner berühmten Studie: „Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, wir müssen es“ (a.a.O., S. 200). Der Umstand, dass uns heute ‚Kontemplation‘ fast schon wie ein Anachronismus klingt, kann gewissermaßen als Beweis für diese Kausalität genommen werden.
Die entscheidende Frage nach den Ursprüngen der puritanischen wie aber auch derjenigen Angst, die sich in den Höfen finden lässt, ist nach wie vor ungelöst. Auf die richtige Spur bei unserer Suche nach Ursachen kommen wir, vergegenwärtigen wir uns, dass sich nicht nur das Wort ‚Entzauberung‘ auf ‚Entfremdung‘ reimt, sondern auch das Wort ‚Enteignung‘. Letzteres ist kein Zufall, sondern geht aus der Etymologie des Wortes selbst hervor.
Was der höfischen Angst in Frankreich wie der puritanischen Angst in England vorausgeht, ist die Konstitution des modernen Territorialstaates, welcher die alte feudale Staatsordnung ablösen sollte. Dieser Übergang vollzog sich, wie wir mit Bezug auf Elias gesehen haben, zwar über Jahrhunderte hinweg; doch war die Zentralisierung im 17. Jahrhundert so weit, dass sie sich in den Konfessionalisierungskriegen, in den Bürgerkriegen, in der Enteignung von Klöstern wie der des Landadels auf recht drastische Weise äußerte.
Für die Enteignung, mit der wir es hier zu tun haben, ist vielleicht Heinrich VIII. ein ganz anschauliches Beispiel. Er war in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts einer der ersten bedeutenden Herrscher, welche sich vom Papst lossagten, sich selbst an die Spitze einer eigenen Nationalreligion setzten und die in ihrem Herrschaftsgebiet ansässigen Klöster enteignen ließen. Nun sind Enteignungen als solche wie wirtschaftlich motivierte Kriegshandlungen nichts spezifisch Modernes; das historisch Beispiellose hieran ist aber, dass sich nicht mehr – wie noch etwa im Feudalismus – eine bestimmte Familie den geraubten Eigentum aneignete. Es gab zwar noch die Person des Königs, die enteignete; doch tat sie das schon weniger als Privatperson, als vielmehr als öffentlicher Repräsentant eines so noch nie dagewesenen Staates, des Nationalstaates. Wobei dies die Sache eigentlich noch nicht ganz trifft: die höfische Gesellschaft, die noch seinen Oikos, sein Eigentum, darstellte, war genauer besehen das Subjekt der neuzeitlichen Enteignungsprozesse. Erst in der Moderne, als sich die Vergesellschaftung des Herrschaftsmonopols ereignet hatte, gab es wirklich niemanden mehr, der an deren Spitze stand und enteignete.
Ein etwas aus dem Zusammenhang gerissenes Beispiel, um zu zeigen, dass wir heute – in Folge dieser Entwicklung – letztlich keinen Begriff von Eigentum mehr haben, ist wohl der moderne Häuserbau. Wir bauen heute unsere Häuser – das also, was eigentlich unseren Eigentum darstellen sollte (sind sie doch nichts anderes als die materiale Begrenzung unseres Teils der Welt) – gezielt so, dass sie in spätestens binnen einer Generation Schrott sind und entsprechend wieder Bedarf am Markt ist, ein neues Haus zu bauen. In derartigen ‚Sollbruchstellen‘ zeigt sich doch eines der zentralen Prinzipien, auf welchen eine Arbeitsgesellschaft basiert, recht deutlich: um viel produzieren zu können, muss vorher viel destruiert werden. Zwar sind letzterer Phase im Zyklus des Lebensprozesses der Weltgesellschaft, der konsumtiven Destruktion, in rechtstaatlichen Demokratien gewisse Grenzen gesetzt; doch bleibt es ein nach wie vor ungelöstes Problem, dass man in einer vergesellschafteten Welt keine eindeutig bestimmte Grenze zwischen Oikos und Polis, zwischen Privatsphäre und öffentlichen Raum, finden kann und folglich dazu verdammt ist, zwischen den Türen zu stehen.
Doch wirklich besorgniserregend ist, dass, global betrachtet, viel zu vielen Menschen nicht einmal mehr die Gesellschaft als Heimat bleibt. Genauer wäre das an anderer Stelle zu diskutieren, aber nach allem, was wir bisher über die Geschichte des modernen Kapitalismus erfahren haben, liegt der Gedanke sofern nicht, dass es vielleicht in der Sache selbst liegen mag, dass eine kapitalistische Wachstumsgesellschaft ‚nutzlose‘ Existenzen produziert und ausstößt.
KAPITEL 4: Was sollen wirtun?
[47] Kritik der pädagogischen Vernunft
Wir sind des Öfteren versucht, die vorgefundenen Verhältnisse in der Welt für gottgegeben zu halten. Gerade bei der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaftsordnung, der fortschreitenden Rationalisierung der Ökonomie, ist dies nicht eigentlich eine Versuchung, sondern scheint vielmehr den Tatsachen zu entsprechen (wer nicht mitrennt, den fressen die Hunde). Ich bin aber der Überzeugung, dass wir – die wir diese Welt bilden – auch die Möglichkeit haben, zusammen zu bestimmen, wie diese aussehen soll.
Wir haben bereits gesehen, wie die Taten und Worte ganz konkreter Personen die Rationalisierung der Welt mitbedingt haben; nun ist es in diesem letzten Kapitel darum, zu zeigen, worin unsere Möglichkeiten bestehen, jenes Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung dieser Welt geltend zu machen. Hierzu wollen wir über eine bloße Polemik hinausgehen und eine Kritik der erarbeiteten Gegenstände anstellen, indem wir fragen: was die Bedingungen der Möglichkeit eines Fortschrittsbegriffes sind, der mit der Menschenwürde vereinbar ist.
– Der Boden, von welchem aus diese Kritik erfolgt, ist die Pädagogik. Nicht nur, dass die ihr entsprechenden wissenschaftlichen Disziplinen sich seit neuerem kaum noch ‚Pädagogik‘, sondern mehr und mehr ‚Erziehungswissenschaft‘ nennen (die Pädagogik war in den letzten Jahrzehnten bevorzugter Gegenstand von Rationalisierungsbestrebungen); sie ist überhaupt die Institution, welche für den Fortschritt in besonderem Maße verantwortlich ist. Die Gestaltung der Welt ist zwar eindeutig nicht (!) ihr Aufgabenbereich, doch ist sie gleichsam die Bedingung der Möglichkeit, dass es so etwas wie politisch handelnde und gestaltende Menschen überhaupt gibt.
4.1 Zum Widerspruch zwischen dem Prinzip eines allgemeinen Fortschrittes und dem Faktum der Endlichkeit des Einzelnen
Im vorhergehenden Kapitel haben wir schon ansatzweise gesehen, worin die Problematik der modernen Idee einer im Fortschritt begriffenen Menschheit gesehen werden kann. Ich will diese Problematik hier noch etwas deutlicher herausarbeiten, indem ich mich erneut auf Kant beziehe, der sich gegen Ende seines Lebens und unter dem Eindruck der Französischen Revolution hierzu sehr viele Gedanken gemacht hat. So finden wir in seinem Spätwerk (ab 1790) – affiziert durch den Widerspruch, dass er die FR zwar moralisch verurteilte, aber unter einem historisch- politischen Gesichtspunkt nicht umhinkam, in ihr ein Anzeichen für etwas Großes zu sehen – etwas, das man eine ‚Kritik des Fortschritts‘ nennen könnte. Diese Kritik nun wollen wir im folgenden unter unseren Gesichtspunkten rekonstruieren, um diese seine Konzeption als Lösungsansatz für unsere Problematik fruchtbar zu machen.
Am explizitesten findet sich eine solche Kritik wohl im dritten Teil seiner kleinen Schrift Zum Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis aus dem Jahr 1793, in welchem er sich kritisch mit Moses Mendelsohns These auseinandersetzt, die Geschichte der Menschheit verlaufe kontingent und verfolge keinen höheren Zweck. Wie aus dem bisher ausgeführten wohl deutlich hervorgeht, kann ich mich mit dieser Position Mendelsohns sehr gut identifizieren. Allein, Kant hat mich hierin zum Umdenken bewegt: sein Problem mit solch einem Realismus ist nämlich, dass in praktischer Hinsicht der allgemeine Fortschritt der Menschheit eine „notwendige Voraussetzung“ (Kant 1793a, A 276f) sei: eine regulative Idee. Sei man nämlich wirklich überzeugt, dass die Geschichte ein „ewiges Einerlei“ sei, das jedes Handeln zum Guten hin vergeblich mache, so haben man – nüchtern betrachtet – eigentlich auch keinen Grund tätig zu werden und in diese Welt hinein zu handeln (vgl. a.a.O., A 273ff). Gleichzeitig – und hierin zeigt sich dann auch die Größe des Immanuel Kants: sein ‚kritisches‘ Denken – kommt er Mendelsohn auf halben Weg entgegen und stellt fest, dass das Problem mit dem modernen Fortschrittbegriff sei, dass in seiner Folge das „Urteil“ des Einzelnen über das, was er gegenwärtig ist, „in Vergleichung mit dem, was man sein sollte, mithin unser Selbsttadel immer desto strenger wird, je mehr Stufen der Sittlichkeit wir im Ganzen des uns bekannt gewordenen Weltlaufs schon erstiegen haben“ (a.a.O., A 276f). Noch deutlicher finden wir diese Einsicht an anderer Stelle, in Das Ende aller Dinge:
„Wenn wir den moralisch-physischen Zustand des Menschen hier im Leben auch auf dem besten Fuß annehmen, nämlich eines beständigen Fortschreitens und Annähern zum höchsten (ihm zum Ziel ausgesteckten) Gut: so kann er doch (selbst im Bewußtsein der Unveränderlichkeit seiner Gesinnung) mit der Aussicht in eine ewig dauernde Veränderung seines Zustandes (des sittlichen wohl als physischen) die Zufriedenheit nicht verbinden. Denn der Zustand, in welchem er itzt ist, bleibt immer doch ein Übel, vergleichungsweise gegen den bessern, in den zu treten er in Bereitschaft steht; und die Vorstellung eines unendlichen Fortschreitens zum Endzweck ist doch zugleich ein Prospekt in eine unendliche Reihe von Übeln, die, ob sie zwar von dem größern Guten überwogen werden, doch die Zufriedenheit nicht Statt finden lassen, der er sich nur dadurch, daß der Endzweck endlich einmal erreicht wird, denken kann.“ (Kant 1794, A 512f, Herv. im Original)
Das bringt eigentlich recht prägnant auf den Punkt, was wir bisher, besonders bei der innerweltlichen Askese, gesehen haben: der Fortschrittsbegriff schließt die Möglichkeit von Kontemplation fast vollständig aus. Doch mit Nietzsche (dem Theoretiker, welcher diese Problematik bis zu ihren religiösen Wurzeln, dem eschatologischen Messianismus, zurückverfolgt hat) können wir sagen, dass wir es hier mit einer Art von „Sklavenmoral“ zu tun haben: wir sind es nämlich selbst, die die Verhältnisse herstellen, an denen wir dann zu Grunde zu gehen drohen (vgl. Nietzsche 1887, besonders I.10). Wir, die wir unsere Verantwortung für die Verhältnisse in der Welt nicht verneinen wollen, müssen also fragen: Wie lässt sich die Idee von einem Fortschritt der Menschheit, ein allgemeines Prinzip, mit der Menschwürde des Menschen in seiner Einzig artigkeit zusammen widerspruchsfrei denken?
Dass dieses Problem nicht zuletzt ein pädagogisches Problem ist, versteht sich ja, wie gesagt, von selbst: ist sie doch sowohl die Institution, auf welche die Möglichkeit von so etwas wie einem ‚Fortschritt‘ (eine Generation folgt auf die nächste) zurückgeht, als auch diejenige, welche den einzelnen Menschen samt seiner je individuellen Probleme zum Gegenstand hat. Auch Kant selbst wies dieses Problem nicht nur als ein politisches (vgl. Kant 1784), sondern auch als ein pädagogisches aus. Das ergab sich für Kant wohl nicht zuletzt aus seinem kosmopolitischen Pädagogikideal, wonach „Personen von extendierten Neigungen“ bei der Erziehung von allen kontingenten Privatinteressen zu abstrahieren hätten, um das Kind im Sinne des „Weltbesten“ zu erziehen (vgl. Kant 1803, A 17-22). Wir wollen uns mit diesem Konzept – das uns heute aus mehreren Gründen doch sehr fremd ist – erst später genauer beschäftigen, vorerst wollen wir uns damit begnügen, uns mit einer Folgerung, die Kant hieraus ableitete, auseinandersetzen: der, dass der „Mechanismus der Erziehungskunst (…) in Wissenschaft verwandelt werden müsse“ (a.a.O., A 17).
Die Verwissenschaftlichung der Pädagogik überhaupt, welche wir heute erleben, geht nicht eigentlich auf Kant zurück; sondern ist ein Produkt der zunehmenden Professionalisierung und Verwissenschaftlichung pädagogischer Tätigkeiten sei den 60er Jahren, welche mit der Neoliberalen Wende weiter vorangetrieben wurde. Diese Entwicklung wird zusehends – nicht zuletzt von Erziehungswissenschaftlern selbst – ganz grundsätzlich in Frage gestellt, womit wir letztlich schon bei der Problemstellung für dieses Kapitel angelangt wären: Kann es überhaupt eine Lehre von allgemeinen Begriffen und Prinzipien für Institutionen geben, die Personen in ihrer Besonderheit behandeln sollen? Gibt es überhaupt so etwas wie spezifisch pädagogische Begriffe, welche sich in der Forschung induzieren, in der Lehre vermitteln und der Praxis anwenden ließen?
Eines kann schon vorweggenommen werden: ein rein deduktives operieren in der pädagogischen Praxis ist sicher niemals richtig und es ist offensichtlich, dass Menschen ausschließlich als Fälle allgemeiner Regeln zu behandeln, eine Entfremdungserscheinung darstellt und mithin im Widerspruch zur Menschenwürde steht, die ja a priori jeder Person als solcher zukommt. Wir wollen derartige Phänomene aber nicht weiter beschreiben (damit haben wir uns bereits genug belastet), sondern einen Begriff von einer Wissenschaft der Pädagogik in der Absicht konzipieren, derartigen Tendenzen entgegenzuwirken. Hierzu müssen wir uns dann zunächst mit dem Theorie-Praxis-Problem beschäftigen, um von dessen Lösung aus dann einen solchen Begriff zu deduzieren.
4.2 Zur Lehrbarkeit von Urteilskraft
Mein Problem ist nicht Allgemeinheit als solche, sondern eine bestimmte Art, mit derselben umzugehen: die Fachidiotie. An Begriffen und Prinzipien ist nichts verkehrt (im Gegenteil, tatsächlich ist nicht praktischer als eine gute Theorie, die mir für jeden Fall eine geeignete Art des Umgangs an die Hand gibt); nur besondere Begriffe, mit denen bestimmte parteiliche Interessen verknüpft sind, für allgemein zu nehmen, daran ist in der Tat sehr viel verwerflich. Aber am schlimmsten ist, wenn ein solches Agieren unbewusst vonstattengeht. Um hier ein bewussteres Handeln zu ermöglichen, ist es überaus nützlich, zu abstrahieren und sich über das Verhältnis zwischen empirischer Besonderheit und theoretischer Allgemeinheit Gedanken zu machen.
Das Theorie-Praxis-Problem ist gewissermaßen so alt wie die Geschichte der Philosophie selbst. Die Frage, wie ich von einem abstrakten Prinzip auf den konkreten Fall komme und andersherum, was ja beim alltäglichen Handeln immer schon funktioniert, ist ja auch eine sehr philosophische Frage. Für Kant nun war es – da es sich nicht ausgeht, für die Anwendung einer allgemeinen Regel auf den Gegenstand in seiner Besonderheit wiederrum eine allgemeine Regel anzugeben – klar, dass es sich hierbei um nichts anderes als eine „Naturgabe“ handeln könne, die man entweder ‚ hat ‘ oder nicht: die Urteilskraft (vgl. etwa Kant 1787, B 173f). Gewissermaßen ist also die Urteilskraft dasjenige, was einen guten Lehrer vom Fachidioten unterscheidet und wir finden in ihr gleichsam die natürliche Grenze gegen alle Rationalisierungsansprüche an die pädagogische Praxis: „Das Technologiedefizit der Erziehung“ (Luhmann/ Schorr 1982). Beziehen wir das nämlich auf unsere Problemstellung, so können wir bereits festhalten, dass die Forschung noch so viele Begriffe finden mag, die einen gewissen Nutzen für die pädagogische Praxis versprechen mögen; – ob der ausgebildete Pädagoge es dann wirklich vermag, Theorie und Praxis zu vermitteln, hat sie nicht in der Hand. Gewissermaßen verhält es sich sogar so, dass sich nicht mal das Gelingen der erziehungswissenschaftlichen Praxis selbst, die Vermittlung der gefundenen Begriffe an den lernenden Pädagogen, garantieren lässt. Lehre überhaupt erfordert nämlich Witz und eine gewisse Spontaneität, auf das Publikum in seiner Besonderheit einzugehen, – alles Dinge, die man eigentlich gar nicht ‚lernen‘ kann (zumindest nicht mit begrifflicher Präzision). Genau an dieser Stelle müssen letztlich alle Rationalisierungsprozesse ihr Ende finden.
Eigentlich könnten wir an dieser Stelle bereits aufhören; doch Kant wäre nicht Kant, hätte er uns nicht gezeigt, wie sich diese un lehr bare Naturgabe bilden lässt: indem wir unseren Geschmack kultivieren. Theoretisch werden wir hierzu dann in seiner dritten großen Kritik fündig: der Kritik der Urteilskraft. Hier hat er also, nachdem er die Möglichkeiten von Verstand wie Vernunft erörtert und deren Grenzen bestimmt hat, das dritte Erkenntnisvermögen gleichsam von der Leine des Begriffs genommen und heiß laufen gelassen. Hatte der Verstand als autonomes Vermögen noch die Natur zum Gegenstand, der er seine Gesetze vorschrieb, um dann hier zwischen wahr und falsch zu unterscheiden; so die Vernunft die Idee der Freiheit, weshalb ihre spezifische Unterscheidung die zwischen gut und böse ist. – Die spezifische Unterscheidung der Urteilskraft ist nun die zwischen schön und hässlich. Sie kritisiert also nicht Natur, nicht Freiheit, sondern Kunst und ist dasjenige Vermögen, welches den musischen Menschen als solchen auszeichnet.
Vergegenwärtigen wir uns nun kurz die Rolle, welche die transzendentale Urteilskraft[48] bei einer Erkenntnis spielt. Wir hatten bereits gesehen, dass für Kant der Begriff die „Einheit der Handlungen (ist), verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen“. Er ist also nichts anderes als eine bestimmte Art des Urteils: das subordinative Erkenntnisurteil. Der Gegenstand als solcher (wir erinnern uns, er ist durch Anschauungsmaterial einerseits, durch Verstandesbegriffe andererseits konstituiert) setzt also eine ihn „bestimmende Urteilskraft“ voraus.
Um diese Art der Urteilskraft geht es uns aber nicht. Denn so meinen wir, schreiben wir jemanden ein gutes Urteilsvermögen zu, mehr, als dass er den Tisch als Tisch erkannt hat; wir meinen (zumindest diejenigen, welche dem Blendwerk der Fachidiotie noch nicht vollständig unterlegen sind und nur diejenigen für urteilsfähig halten, die sich ‚Experten‘ in einer Sache schimpfen), dass er es auch ohne einen bestimmten Begriff, welcher er dem Urteil über diesen Fall vorausgesetzt hat, ein gerechtes Urteil zu fällen im Stande ist. Oder um es mit Arendt zu sagen: wir meinen jemanden, der es vermag, auch noch „ohne Geländer zu denken“ (Arendt 1955, S. 42). Diese autonome Art von Urteilskraft, welche ihre eigenen Begriffe zu bilden sucht, nennt Kant „reflektierende Urteilskraft“ (vgl. Kant 1790, H 17) und da er von ihrer Wichtigkeit so überzeugt war, widmete er ihr sein letztes großes Werk und veröffentlichte es bezeichnenderweise – hier rang selbst er um einen Begriff – nach der FR. In dieser Antwort auf die Probleme seiner Zeit: der „Operation der Reflexion“ (Kant 1793, B 158f), finden wir, die wir einen mehr unschematischen, aber nicht prinzipienlosen Weg suchen, in der pädagogischen Praxis zu handeln und zu urteilen, gleichermaßen eine Antwort. Entsprechend gilt es nun, diese Antwort ausführlicher zu behandeln.
Traditionellerweise das schwerste Feld, ein Urteil zu fällen und darum auch ein Merkmal einer guten Urteilskraft, sind Fragen des Geschmacks. Das ist lustig, da wir denjenigen, welche dieses Vermögen für sich zu monopolisieren suchen, den Technokraten, ja alles Mögliche zuzuschreiben bereit sind; – nur ganz sicher keinen Sinn fürs Schöne. Wie auch immer, bleiben wir bei dem von Kant selbst gewählten Beispiel für ein „ästhetisches Reflexionsurteil“, um uns zunächst klar zu machen, wie sich die Operation der Reflexion genauer vorzustellen ist: dem Geschmacksurteil. Bei derartigen Urteilen, wie etwa: ‚Diese Rose ist schön‘, beziehen wir uns einerseits auf ‚diese‘ Rose als konkreten Gegenstand in seiner Besonderheit; aber machen doch damit, dass wir diese Empfindung im Folgeschritt diskursiv mitteilen, merkwürdigerweise implizit eine abstrakte Allgemeinheit und Notwendigkeit geltend. Für unsere Zwecke genügt es, auf den Begriff der exemplarischen Notwendigkeit einzugehen, um anhand von diesem das Rätsel zu lösen. Bleiben wir also bei dem Beispiel der Rose: es ist in der Tat klar, dass wenn wir ‚schön‘ sagen, mehr meinen als: ‚Dieser Eindruck gefällt mir bloß zufälligerweise‘; gleichzeitig ist aber auch klar, dass wir uns nicht durch einen deduktiven Beweis überreden lassen würden, diese eine Rose schön zu finden. Kant löste diese Antinomie gewissermaßen durch diesen seinen Begriff der exemplarischen Notwendigkeit: einer „Notwendigkeit der Beistimmung aller zu einem Urteil, was wie Beispiel einer allgemeinen Regel, die man nicht angeben kann, angesehen wird“ (a.a.O., B 63f, Herv. im Orig.). Wir belassen es eben nicht bei dem bloßen Sinnenurteil, sondern reflektieren in Ruhe, wie diese Rose uns affiziert hat, und kommen – aufgrund dieses kontemplativ-reflexiven Modus – letztlich zu dem apodiktischen Urteil: ‚Diese Rose ist schön‘ bzw. ‚… ist nicht schön‘. Interessant für uns ist insbesondere, wie wir bei der Operation der Reflexion zu diesem Urteil kommen. Wir müssen uns zwar nicht unbedingt an dem wirklichen Diskurs beteiligen und darüber streiten, wie nun diese unbestimmte Regel ihre Anwendung findet; aber es lässt sich doch kaum leugnen, dass wir selbst im stillen Kämmerlein, wenn wir uns Gedanken darüber machen, ob etwas nun schön gewesen sei oder nicht, nicht umhin kommen, uns in Gedanken zu vergegenwärtigen, wie wohl andere über diesen einen Gegenstand geurteilt haben würden. – Deshalb stellte Kant in der Analytik des Schönen auch fest, dass die Bedingung einer solchen exemplarischen Notwendigkeit „die Idee eines Gemeinsinns“ sei und wies ihn als das für das ästhetischen Reflexionsurteil spezifische Prinzip a priori aus (vgl. a.a.O., § 20, B 65).
Bevor wir uns nun weiter theoretisch mit diesem Prinzip beschäftigen, wollen wir hier kurz stehen bleiben und veranschaulichen, in welcher Form sich dieses äußern kann, indem wir einen alten Bekannten wieder zu Wort kommen lassen, Descartes:
„(…) und mich denken ließen, dass ich damit fortfahren müsse, alles, was ich für irgendwie wichtig hielte, aufzuschreiben, sofern ich darin Wahrheit entdecken würde, und dass ich darauf dieselbe Sorgfalt verwenden müsse, als wollte ich es drucken lassen, einmal damit ich desto mehr Gelegenheit hätte, es genau zu prüfen – wie man zweifellos das, wovon man meint, es müsse von allen gesehen werden, stets näher betrachtet als das, was man nur für sich selbst macht (…).“ (Descartes 1637, VI.4, Herv. JM).
Es ist doch ein überzeugendes Argument für das Prinzip ‚Gemeinsinn‘, dass selbst Descartes in seiner Weltflucht und Intoleranz gegen Vielheit einen deutlichen Begriff von Gemeinsinn hatte. Genug hiervon, lassen wir nun Kant wieder zu Wort kommen, um in Erfahrung zu bringen, was genau es nun mit diesem Prinzip auf sich hat:
„Unter dem sensus communis aber muß man die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes, d.i. eines Beurteilungsvermögens verstehen, welches in seiner Reflexion auf die Vorstellungsart jedes anderen (Herv. JM) in Gedanken (a priori) Rücksicht nimmt, um gleichsam an die gesamte Menschenvernunft sein Urteil zu halten, und dadurch der Illusion zu entgehen, die aus subjektiven Privatbedingungen, welche leicht für objektiv gehalten werden können, auf das Urteil nachteiligen Einfluß haben würde. Dies geschieht nun dadurch, daß man sein Urteil an anderer, nicht sowohl wirkliche, als vielmehr bloß mögliche (Herv. JM) Urteile hält, und sich an die Stelle jedes andern versetzt, indem man bloß von den Beschränkungen, die unserer eigenen Beurteilung zufälliger Weise anhängen, abstrahiert (…).“ (Kant 1793, § 40, B 157).
Bevor wir dazu übergehen, die Konsequenzen zu ziehen, welche es für die wissenschaftlichen Disziplinen der Pädagogik praktisch bedeuten könnte, sich am Prinzip ‚Gemeinsinn‘ zu orientieren, will ich hier abschließend einige Punkte (teilweise vorwegnehmend) herausgreifen. Zuerst, in seiner Konzeption von Gemeinsinn ist Kant durchaus ergiebig für die Diskurstheorie; doch in einigen – entscheidenden – Punkten auch nicht: seine diskurstheoretischen Überlegungen laufen nicht darauf hinaus, die ideale „Kommunikationsgemeinschaft“, die wir immer schon anzuerkennen gezwungen seien, beginnen wir zu sprechen (vgl. Apel 1976,), als einen bestimmten Begriff dem Urteilen vorauszusetzen; der reale Diskurs, den wir in dieser und keiner anderen Welt vorfinden, dient hier vielmehr als der Orientierungspunkt einer reflektierenden (nicht bestimmenden!) Urteilskraft, ein freies Urteil über diesen und keinen anderen Fall zu fällen. Denn, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, es geht darum, bei der Bestandsaufnahme eines Falls „die Vorstellungsart jedes anderen“ – ganz gleich, wie fern mir diese auch sein mag – zu vergegenwärtigen, um so ein und denselben Gegenstand unter verschiedenen, möglichen Gesichtspunkten[49] zu betrachten und so zu einem dadurch begründeten eigenen Urteil über denselben zu kommen. Der ‚Gemeinsinn‘ ist also nicht das Prinzip des Urteilens selbst, sondern das seiner Vorbedingung: der kontemplativen Reflexion bei der Bestandsaufnahme eines noch unbekannten Falles. So führt Kant auch an anderer Stelle aus, dass das ästhetische Reflexionsurteil als solches ein autonomer Akt sei und es sich um Heteronomie handeln würde, sich „(f)remde Urteile (...) zum Bestimmungsgrund des seinigen zu machen“; doch könnten diese ein „Beispiel“ dafür geben, wie „die Prinzipien in sich selbst zu suchen“ sind, nach denen wir dann endlich Urteilen (Kant 1793, § 32, B 138f, Herv. JM). In diesem Sinne müssen wir dann auch Geschichte sehen: nicht als Prozess, dessen Gesetzmäßigkeiten es zu erkennen und zu nutzen gilt; sondern als Tradition von bedeutenden Beispielen, die wir uns zum Leitfaden für unser eigenes Handelns nehmen können.
Halten wir also fest: das Prinzip ‚Gemeinsinn‘ gibt uns nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Prinzip, wie wir unser vollkommen eigenständiges, begriffsloses Urteil begründen können. Es hat folglich mit der Allgemeinheit von epistemischen Begriffen, der ‚ Universalität ‘, nichts zu tun. Es ist ‚ Allgemeinheit ‘ im eigentlichen Sinne: eine Vielheit, welche auf eine bestimmte Einheit bezogen ist, also eine Vielheit von Perspektiven, die ein und denselben Fall zum Gegenstand haben.
§ 5. Der „sensus communis“ als Prinzip pädagogischen Handelns, in Praxis und Theorie
Zunächst ist doch sicher vorauszuschicken, dass hier weniger der Praktiker als der Theoretiker schreibt. Allerdings einer, der davon überzeugt ist, dass es sich hierbei herkömmlicherweise um eine äußerst künstliche Entgegensetzung handelt.
Das Wort ‚Theorie‘ kommt ursprünglich aus dem Griechischen (‚theoreîn‘ bzw. ‚theoría‘) und wurde ins Lateinische recht treffend mit ‚contemplatio‘ übersetzt. Wir haben ja jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, was das bedeuten könnte: in Ruhe über die Dinge nachdenken, indem wir diese unter möglichst vielen Gesichtspunkten betrachten, um zu einem abschließenden Urteil über dieselben zu kommen. Die Theorie nimmt also eine bestimmte Art von Allgemeinheit in Anspruch: den Gemeinsinn. Wir wollen uns in diesem Kapitel einer Institution widmen, die ursprünglich mal gegründet wurde, um die für diese Art von Allgemeinheit konstitutive Muße zu gewährleisten: der Universität (‚Akadmia‘). Allerdings einer bestimmten Fakultät mit einer bestimmten sozialen Funktion, was ja gewissermaßen ein Widerspruch zum kontemplativen Nachdenken bedeuten kann: der ‚Erziehungswissenschaft‘.
Ihre gesamtgesellschaftliche Bedeutung sollte zwar nicht unterschätzt werden, doch ist die Erziehungswissenschaft für uns in erster Linie als Beispiel für zweierlei von Interesse: zum einen für das gegenwärtige Verständnis von Pädagogik überhaupt; zum anderen für das, wie Theorie und Praxis zu vermitteln sind. Wir beschränken uns zunächst auf ersteren Aspekt.
Hierzu ist es dann zunächst nötig, das weite Feld der Pädagogik genauer zu bestimmen. Hier lassen sich, mit Kant gesprochen, zwei Teile unterscheiden: die „physische Erziehung“ und die „praktische Erziehung“. Während ersteres eindeutig ein Phänomen der Privatsphäre darstellt: diese soll den Kindern ja gerade den Schutz vor der Öffentlichkeit gewähren, der nötig ist, dass die Natur ungestört ihr Werk verrichten kann: den Wachstumsprozess; so hat eine ‚praktische‘ Erziehung doch nichts anderes zum Zweck, als dass der Zögling sprechend und handelnd an der Öffentlichkeit zu partizipieren vermag (vgl. Kant 1803, A 34ff). In diesem Sinn versteht auch Arendt die Erziehung und weist den professionellen Pädagogen als denjenigen aus, der die Ansprüche der Welt gegenüber den Jugendlichen zu vertreten habe, um sie graduell in dieselbe einzuführen (vgl. Arendt 1958, S. 270). Wir wollen ja hier eine – im weitesten Sinn – erziehungswissenschaftliche Abhandlung schreiben und werden dementsprechend – Rationalisierungsbestrebungen können sich auf natürliche Wachstumsprozesse äußerst destruktiv auswirken – die „physische Erziehung“ weitgehend ausklammern. Die Privatsphäre rechtlich zu regulieren, ist in erster Linie Sache von Politikern und Juristen: sie sind diejenigen öffentlichen Akteure, welche über Notfall und etwaige Eingriffe zu entscheiden haben. Wir wollen uns also damit begnügen, einige Grundsätze für eine professionelle Pädagogik im Namen der Öffentlichkeit herzuleiten.
Die professionelle Pädagogik hat also dafür zu sorgen, dass der Zögling es vermag, als mündiger Mensch in der Öffentlichkeit zu handeln. Hierzu kann sie aber in ethischer Hinsicht nicht vielmehr[50] leisten, als formale Prinzipien (wie etwa den Kategorischen Imperativ) zu lehren. Das Problem mit dem formalen Charakter derartiger Prinzipien ist nun, dass deren pädagogische Vermittlung notwendigerweise negativ und unbestimmt bleiben muss: hier kann nur gelehrt werden, wie man selbst bestimmt, was man tun soll und was man auf keinen Fall tun darf. Bestimmt der Pädagoge aber seinen Zöglingen darüber hinaus positive Zwecke, die sie ihrem Handeln zu setzen haben, handelt es sich zweifelsfrei um Fremdbestimmung. Etwas anderes ist, wenn eine pädagogische Institution ihren Rahmen bestimmt (‚Der Schüler soll um 7:45 Uhr pünktlich zum Unterricht erscheinen.‘); doch auch dies sollte stets die spätere Autonomie, die macht, dass eine Person in der Öffentlichkeit zurechtkommt, zum Zweck haben.
Kommen wir nun zu unserem Beispiel für eine solche institutionalisierte Rahmung von pädagogischen Handeln: der Erziehungswissenschaft, so finden wir hier den Tatbestand vor, dass diese ihre geisteswissenschaftlichen Ursprünge hinter sich zu lassen im Begriff steht und sich als empirische Sozialwissenschaft reorganisiert. Hier werden gegenwärtig nicht in erster Linie spezifisch pädagogische Begriffe, sondern vielmehr soziologische und psychologische Begriffe gelehrt. Uns interessiert hieran weniger, was diese Begriffe im einzelnen beschreiben, sondern vielmehr, wie ein professioneller Pädagoge – handelt er gemäß der Maxime der Urteilskraft, der der „ erweiterte(n) Denkungsart “ (Kant 1793, B 160) – von diesen in seiner pädagogischen Praxis Gebrauch zu machen hat.
Letztlich ist an soziologischen, psychologischen und auch biologischen Begriffen nichts auszusetzen, es kommt allein darauf an, richtig mit ihnen zu operieren. Unter einem gewissen Gesichtspunkt kann es sogar durchaus sinnvoll sein, derartige Begriffe dem pädagogischen Handeln vorauszusetzen. Denn je mehr ich als Pädagoge um gesellschaftliche, psychologische und biologische Verhältnisse und wie sie wirken weiß, desto deutlicher kann ich beobachten, wie eine bestimmte Person damit umgeht und angemessen darauf eingehen. Entscheidend bleibt dabei nur, dass ich die theoretische Transzendenz der Seele respektiere und nicht den folgenschweren Fehler begehe, die Person und ihr spontanes Handeln mit derartigen Verhältnissen zu verwechseln. Genau an dieser Stelle kommt dann die reflektierende Urteilskraft als das pädagogische Vermögen schlechthin ins Spiel: sie wirkt damit, dass sie um ein Urteil über diese Person – ohne jeden Begriff, aus welchem sie dieses ableitet – ringt, genau dieser Form von Fachidiotie entgegen. Selbstverständlich erscheint mir der Zögling wie jeder Gegenstand überhaupt in Raum und Zeit und verhält sich gemäß Naturgesetzen; doch darum geht es beim spezifisch ‚pädagogischen‘ Urteil nicht in erster Linie. Das pädagogische Reflexionsurteil ist nicht in dem Sinne ‚begriffslos‘, dass es planlos in der sinnlichen Mannigfaltigkeit herumirrt; sondern in dem, dass ein solches Urteil immer in dem Bewusstsein gefällt wird, dass es für den spezifisch ‚pädagogischen‘ Gegenstand, die Person in ihrer Einzigartigkeit, schlechterdings keinen Begriff geben kann, der es mir ersparen würde, in Spontaneität mit dieser zu interagieren. Dem pädagogischen Reflexionsurteil liegt also die Spontaneität beider Akteure, die des Pädagogen wie die des Zöglings, zugrunde. ‚Spontaneität‘ heißt in diesem Fall aber nicht ‚prinzipienlose Willkür‘, denn so ist das pädagogische Reflexionsurteil wie jedes Reflexionsurteil überhaupt ja gemäß einem bestimmten Prinzip zu fällen: gemäß des Sensus communis. Dass wir es hier nicht mit der reinen Willkür zu tun haben und dass das (erziehungs-)wissenschaftlich begründete Reflexionsurteil nur in positiver Hinsicht begriffslos ist, in negativer aber begriffliche Präzision geltend machen kann, ist offenbar. Besagte wissenschaftliche Begriffe, welche gegenwärtig in der Erziehungswissenschaft gelehrt werden, helfen uns nämlich insofern jener „Illusion zu entgehen, (…) subjektive Privatbedingungen (…) für objektiv“ zu halten, als sie uns genau die „Beschränkungen, die unserer eigenen Beurteilung zufälliger Weise anhängen,“ (gesellschaftliche Position, familiäre Prägung, Geschlecht, usw.) bestimmen, von welchen es – um den Standpunkt des unparteiischen Richters einzunehmen – zu abstrahieren gilt. Wir können an dieser Stelle also festhalten, dass Wissenschaftlichkeit nicht notwendigerweise in die Fachidiotie führen muss, sondern genauso gut gegen dieselbe gewendet werden kann.
Soweit waren uns Wissenschaften und das Prinzip ‚Gemeinsinn‘ mehr von negativen Nutzen (insofern, als sie der Fachidiotie entgegenwirkten, von äußerst nützlichem Nutzen!), werden wir nun positiv und bestimmen, wie die institutionelle Rahmung unseres Beispiels für eine pädagogische Praxis, die Erziehungswissenschaft, idealerweise auszusehen hätte, damit die Urteilskraft hier günstige klimatische Bedingungen vorfände, unter welchen sie gedeihen kann. Hierzu wollen wir uns dann zwei Momenten des ästhetischen Geschmacksurteils zuwenden, die ich bisher weitgehend unter den Tisch habe fallen lassen: dass es „ ohne alles Interesse “ (a.a.O., B 17f) und „ ohne Vorstellung eines Zwecks “ (B 62) gefällt wird. Fangen wir bei letzterem Aspekt an: selbst wenn wir so realistisch sind, uns einzugestehen, dass wir die Rationalisierung der Welt nicht ohne weiteres werden rückgängig machen können, so hindert uns doch nichts daran, dieses Problem in einen so kleinen Teil zergliedern, dessen Lösung in unserer Verantwortung liegt: d.i. für uns ganz konkret das Faktum ‚Erziehungswissenschaft‘. Dass der Rationalisierungsprozess, welcher dem Wandel von der ‚Pädagogik‘ hin zu ‚Erziehungswissenschaft‘ zugrunde liegt, in offensichtlichen Widerspruch zur Bedingung der Möglichkeit von Reflexion überhaupt, der Kontemplation, steht, sollte an dieser Stelle keiner weiteren Begründung mehr bedürfen. Es wäre zur Lösung unseres Problems ein vielversprechender erster Schritt, die Institution, welche mehr und mehr die Akteure ausbilden wird, welche der folgenden Generation – sei es im negativen oder positiven – ein Beispiel ist, so zu gestalten, dass angehende Pädagogen hier einen Ort vorfinden, welcher sie aus jener Notwendigkeit, in Zweck/Mittel-Kalkülen zu denken, und stets fragen zu müssen: ‚Wozu?‘, befreit (man möchte sagen: ‚erlöst‘). Ganz konkret würde das bedeuten, die Bologna Reform, welche Studenten zu jener instrumentellen Denkungsart geradezu konditioniert, rückgängig zu machen und sich dem humboldtschen Bildungsideal wieder anzunähern.
Während derartige Forderungen in den Erziehungswissenschaften an der Universität Frankfurt vermutlich auf wenig Widerspruch treffen werden; bin ich mir sicher, dass sich das beim nächsten Punkt schon ganz anders verhält. Aus ersterem Aspekt würde nämlich folgen, dass es sich für jede Form von professioneller Pädagogik verbietet, mit ihr bestimmte parteipolitische Interesse zu verbinden.[51] Denn so sind parteiliche Interessen per definitionem partikular und können folglich nicht den Anspruch der ganzen Öffentlichkeit an den Jugendlichen darstellen. Wir haben bereits gesehen, dass eine Wissenschaft der Ethik nicht unmöglich ist, doch dass die Lehre von bestimmten und positiven Überzeugungen insofern, als sie die Möglichkeit von Autonomie verneint, eine Unredlichkeit darstellt. Wir wollen nun ausführlicher auf diesen Punkt eingehen und uns hierzu zunächst auf Weber beziehen:
„Dem Propheten wie dem Demagogen ist gesagt: ‚Gehe hinaus auf die Gassen und rede öffentlich (Herv. JM).‘ Da, heißt das, wo Kritik möglich ist. Im Hörsaal, wo man seinen Zuhörern gegenübersitzt, haben sie zu schweigen und der Lehrer zu reden, und ich halte es für unverantwortlich, diesen Umstand, daß die Studenten um ihres Fortkommens willen das Kolleg eines Lehrers besuchen müssen, und daß dort niemand zugegen ist, der diesem mit Kritik entgegentritt, auszunützen, um den Hörern nicht, wie es sein Aufgabe ist, mit seinen Kenntnissen und wissenschaftlichen Erfahrungen nützlich zu sein, sondern sie zu stempeln nach seiner persönlichen politischen Anschauung.“ (Weber 1917/19, S. 602).
Gegenwärtig gibt es nicht wenige Lehrende in den Geistes- und Sozialwissenschaften, welche das Wertfreiheitspostulat nicht teilen und auch einen Weg gefunden zu haben vermeinen, diese Problematik, welche Weber uns hier beschreibt, aus der Welt zu schaffen: sie streuen Diskussionsrunden in ihre Vorlesungen ein und schaffen so, zumindest theoretisch, die Möglichkeit für Kritik. Doch gibt es eine simple Frage, die die Schwäche dieses Konzepts aufzeigt: ‚Bekomme ich nun eine Note von ihnen auf meine ‚Kritik‘, oder nicht?‘.
Selbst wenn es keine Benotungen in einer solchen Vorlesung gäbe, kommt der Lehrende nicht um den Umstand herum, dass eine Diskussion zwischen Professor und Student schwerlich wird jemals auf Augenhöhe stattfinden können. Darin zeigt sich deutlich, dass Pädagogik zwar die Partizipation an der Öffentlichkeit der Zöglinge zum Zweck hat, deshalb selbst aber noch keineswegs ein Phänomen derselben darstellt. Der professionelle Pädagoge, welcher gleichsam an der Schwelle zur Öffentlichkeit steht, muss noch die der Pädagogik eigene Autorität geltend machen, will er seinen Zöglingen die Ansprüche, welche die Welt an sie stellt, vermitteln. Der heute zu beobachtende Widerwille vieler professioneller Pädagogen, Autorität geltend zu machen, ist letztlich nichts anderes als das, was Arendt schon in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dazu veranlasste, von einer „Krise der Erziehung“ zu sprechen. Denn so sei es ja nicht leicht nach dem, was sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts alles so ereignet hat, noch die Verantwortung für die Welt, in welcher das möglich ist, zu übernehmen und als ihr Repräsentant zu fungieren (ein andere Quelle für die Autorität des professionellen Pädagogen gibt es nach Arendt nicht) (vgl. Arendt 1958, S. 270ff).[52]
Wir wollen nun zum Abschluss schauen, wie der professionelle Pädagoge seiner nicht ganz einfachen Aufgabe, gegenüber dem Zögling Repräsentant der Welt zu sein, wieder gerecht werden kann. Hierzu müssen wir uns zunächst wieder dem Theorie-Praxis-Problem widmen und feststellen, dass gegenwärtig Theorie und Praxis insofern als Gegensätze wahrgenommen werden, als man gemeinhin der Meinung zu sein scheint, ‚Handeln‘ hieße gedankenlos herumzuirren. Genauer scheint man die innerweltliche Askese – das rastlose Arbeiten, um ja nicht über sich selbst und die Welt nachdenken zu müssen – für die einzige Art von Aktivität zu halten, die das Attribut ‚praktisch‘ für sich in Anspruch nehmen darf. Wir wissen das besser: der Begriff der Handlung setzt den ideellen des Prinzips voraus (vgl. § 2): wer nicht denkt und einen Begriff dessen hat, was er tut, der ‚handelt‘ nicht, sondern irrt kopflos in der sinnlichen Mannigfaltigkeit umher. Das ist aber ein sehr pedantisches Argument, denn so bedeutet einen Begriff dessen zu haben, was man tut, keineswegs, dass man theoretisch in dem Sinne ist, in dem wir es hier verstehen: sich in Ruhe möglichst viele Gesichtspunkte auf einen erfahrenen Gegenstand zu Gemüte führen.
Wir stehen hier also in der Tat vor einer Antinomie: macht man wirklich ernst mit der Kontemplation und denkt nur noch über die Dinge nach, sind die vegetativen Körperfunktionen schnell das letzte, was man im weitesten Sinne noch als eine ‚Tätigkeit‘ bezeichnen könnte; handelt man nur noch im öffentlichen Miteinander, wird man schnell oberflächlich und verliert den distanzierten Blick fürs große Ganze. In politisch-weltlicher Hinsicht zeigt sich uns das Theorie-Praxis-Problem also in der Gestalt des Gegensatzes zwischen innerwelticher Askese und weltflüchtiger Kontemplation. Ein erster ‚praktischer‘ Schritt zur Auflösung dieser Antinomie besteht nun darin, nicht weiter davon auszugehen, dass Interessen als solche notwendigerweise parteilich sein müssen und Theorie wie (pädagogischer) Praxis ein gemeinsames, weitgehend unbestimmtes Interesse zu unterstellen: das am Weltbesten. Demnach gäbe es also eine Lust am Dasein von etwas[53], das zwischen uns allen ist: der Welt. Und mit dem Gemeinsinn haben wir nun auch das Prinzip, dieses zunächst recht unbestimmte Interesse näher zu bestimmen: wir versuchen von allen kontingenten Privatinteressen zu abstrahieren, indem wir uns die Perspektiven möglichst vieler andere Personen auf den Gegenstand zu Gemüte führen und fällen endlich unser eigenes Urteil, das im Sinne aller sein könnte. Der ‚Praktiker‘ mag an dieser Stelle misstrauisch werden und einwenden: ‚Abstraktion von allen Privatinteressen? Gesichtspunkte aller Menschen? Da komme ich ja nie zu Rande und werde endlich tätig!‘ Damit mag er Recht haben: ein Versuch, vielmehr ist es letztlich nicht.
Allerdings ein Versuch mit enorm praktischen Folgen: der „ exemplarische(n) Prophetie “ (Weber 1921a, S. 273). So kann nämlich der in Kontemplation reflektierende Theoretiker insofern praktisch wirken, als er ein Beispiel dafür gibt, wie man versucht, im Sinne des Weltbesten zu denken und zu handeln. In diesem – und nur in diesem – Sinne kann der Pädagoge Prophet werden und insofern, als die ältere Generation der jüngeren Generation hierin nicht mehr ist als ein mögliches Beispiel unter vielen ist, dass sie sich zum Leitfaden für ihr je eigenes Handeln im Sinne des Weltbesten nehmen können, finden wir in der exemplarischen Prophetie auch die einzig legitime Form von positiver Ethik für die Pädagogik. Legitim ist das insofern, als wir hier ein Konzept von professioneller Pädagogik haben, das bei der Lehre eines positiven Zweckes, des Weltbesten, auf jede Form von Zwang verzichtet – sogar auf deren professorale Variante: den „zwanglosen Zwang des besseren Arguments“.
Literaturverzeichnis
Primärliteratur:
Apel, Karl-Otto (1976): Transformation der Philosophie. Band 2. Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft. Suhrkamp. Frankfurt am Main.
Arendt, Hannah (1953): Verstehen und Politik. In: Dies. (2016): Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken I. Hrsg. v. Lodz U.. Piper. 4. Aufl.. Mönchen. (= VZ). S. 110-127.
Arendt, Hannah (1955): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft. Piper. 20. Aufl.. München. 2017.
Arendt, Hannah (1957): Natur und Geschichte. In: VZ. S. 80-109.
Arendt, Hannah (1958): Die Krise in der Erziehung. In: VZ. S. 255-276.
Arendt, Hannah (1958a): Kultur und Politik. In: VZ. S. 277-304.
Arendt, Hannah (1965): Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik. Piper. 11. Aufl. München. 2016
Arendt, Hannah (1967): Vita activa. oder Vom tätigen Leben. Piper. 18. Aul.. München. 2016.
Arendt, Hannah (1970): Über Kants politische Philosophie. In: Dies. (2017): Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie. Dritter Teil zu Vom Leben des Geistes. Hrsg. v. Beiner, R.. Übers. v. Ludz, U.. Piper. 4. Aufl.. München.
Arendt, Hannah (1970a). Macht und Gewalt. Aus dem Englischen von Giesela Uellenberg. Mit einem Interview von Adelbert Reif. Piper. 25. Aufl. München. 2015.
Birkhan, Helmut (2010): Magie im Mittelalter. Beck. München.
Bourdieu, Pierre (1982): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Übers. v. Schwibs, B. u. Russer, A.. Suhrkamp. 24. Aufl.. Frankfurt am Main. 2014.
Descartes, René (1637): Bericht über die Methode. Die Vernunft richtig zu führen und die Wahrheit in den Wissenschaften zu erforschen. Französisch/ Deutsch. Über. u. hrsg. v. Ostwald, H.. Reclam. Stuttgart. 2001.
Descartes, René (1641): Meditation über die Erste Philosophie. In denen die Existenz Gottes und die Verschiedenheit der menschlichen Seele vom Körper bewiesen wird. Latein/ Deutsch. Übers. u hrsg. v. Schmidt, G.. Reclam. Stuttgart. 1986.
Descartes, René (1644): Die Prinzipien der Philosophie. Übers. v. Buchenau, A.. Meiner. 8. Aufl. Hamburg. 1992.
Elias, Norbert (1939): Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische Untersuchungen. Bd. I. Wandlung des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes. Suhrkamp. Amsterdam. 1997.
Elias, Norbert (1939a): Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchung. Bd. II. Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation. Suhrkamp. 32. Aufl.. Amsterdam. 2013.
Eßbach, Wolfgang (2009/10): Grundzüge der Soziologie. URL: https://www.podcasts.uni-freiburg.de/geschichte-gesellschaft/gesellschaft/grundzuege-der-soziologie-winter-2009-2010. Abgerufen: 03.05.2018.
Feyerabend, Paul (1976): Wider den Methodenzwang. Suhrkamp. 14. Aufl.. Frankfurt am Main. 2016.
Fuchs-Heinritz, W./ Klimke, K./ Lautmann, R./ Rammstedt, O./ Stäheli, U./ Weischer, C./ Weinold, H. (2011) (Hrsg.): Lexikon zur Soziologie. VS-Verlag. 5. Aufl. Wiesbaden.
Galileo Galilei (1623): Il Saggiatore. Band 6. Edition Nazionale. Florenz. 1896.
Gorgias. In: Platon: Sämtliche Werke. Bd. I. Hrsg. v. König, B.. Übers. v. Schleiermacher, F.D.. Rowohlt. Hamburg. 1994. S. 337-452.
Hobbes, Thomas (1651): Leviatan. Übers. v. Mayer, J. P.. Reclam. Stuttgart. 1970.
Kant, Immanuel (1781/87): Kritik der reinen Vernunft. In: Immanuel Kant Werke 2/6. Hrsg. v. Weischedel, W.. WBG. Darmstadt. 1998. (= IKW x/6)
Kant, Immanuel (1784): Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. In: IKW 6/6.
Kant, Immanuel (1790/93): Kritik der Urteilskraft. In: IKW 5/6.
Kant, Immanuel (1793a): Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. In: IKW 6/6.
Kant, Immanuel (1794): Das Ende aller Dinge. In: IKW 6/6.
Kant, Immanuel (1803): Über Pädagogik. (Hrsg. v. Rink, F. T..) In: IKW 6/6.
Kuhn, Thomas S. (1976): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Zweite revidierte und um das Postskriptum von 1969 ergänzte Auflage. Suhrkamp. 24. Aufl.. Frankfurt am Main. 2014.
Koyrè, Alexandre (1969): Von der geschlossenen Welt zum unendlichen Kosmos. Übers. v. Dornbacher, R.. Suhrkamp. 3. Aufl.. Frankfurt am Main. 2017.
Luhmann, Niklas/ Schorr, Karl Eberhard (1982): Das Technologiedefizit der Erziehung und die Pädagogik. In: Ders. (Hrsg.): Zwischen Technologie und Selbstreferenz. Fragen an die Pädagogik. Suhrkamp. Berlin. S. 11-41.
Luhmann, Niklas (1987): Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Suhrkamp. 16. Aufl. Frankfurt am Main. 2015.
Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übers. u. Komm. v. Schwelger, A. Bd. 2. Fues, 1846. Nachdr. Frankfurt am Main. 1960. (= Metaphysik).
Nietzsche, Friedrich (1974): Unzeitgemäße Betrachtungen. In: Friedrich Nietzsche Werke 3/4. Hrsg. u. eingel. v. Stenzel Gerhard. Caesar. Salzburg. 1983. (=FNW x/4).
Nietzsche, Friedrich (1885): Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel von einer Philosophie der Zukunft. In: FNW 4/4
Nietzsche, Friedrich (1887): Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift. In: FNW 4/4
Schmitt, Carl (1963): Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien. Duncker & Humbolt. 9. Aufl.. Berlin. 2015.
Simmel, Georg (1916): Der Begriff und die Tragödie der Kultur. In: Georg Simmel (1987): Das individuelle Gesetz. Philosophische Exkurse. Hrsg. v. Landmann, M.. Suhrkamp. Frankfurt am Main. (=IG) S. 116-147.
UNHCR Deutschland (2001-2018): FAQ Staatenlose. URL: http://www.unhcr.org/dach/de/services/faq/faq-staatenlose. Abgerufen: 08.06.2018.
Weber, Max (1904): Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. In: Ders. (1988). Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Hrsg. v. Winckelmann, J.. Mohr. 7. Aufl.. Tübingen. (= GAW) S. 146-214.
Weber, Max (1904a): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Vollständige Ausgabe. Hrsg. v. Kaesler, D.. Beck. 4. Aufl.. München. 2013.
Weber, Max (1913): Ueber einige Kategorien der verstehenden Soziologie. In: GAW. S. 427-474.
Weber, Max (1917/1919): Wissenschaft als Beruf. GAW. S. 582-613.
Weber, Max (1921): Soziologische Grundbegriffe. In: Ders. (1980): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Hrsg. v. Winkelbaum J.. Studienausg.. Mohr. 5. Aufl.. Tübingen. (= WG) S. 1-30.
Weber, Max (1921a): Religionssoziologie. Typen religiöser Vergemeinschaftung. In: WG. S. 245-381.
Westfall, Richard S. (1996): Isaac Newton. Eine Biographie. Übers. v. Must, H.. Spektrum. Heidelberg.
Sekundärliteratur:
Arendt, Hannah (1964): Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen. Piper. 14. Aufl.. Berlin. 2011.
Brecht, Bertolt (1938/39): Leben des Galilei. Suhrkamp. 78. Aufl. Frankfurt am Main. 2017.
Kuhn, Thomas S. (1981): Die kopernikanische Revolution. Mit 59 Bildern. Vieweg & Sohn. Braunschweig.
Seichter, Sabine (2007): Pädagogische Liebe. Erfindung, Blütezeit, Verschwinden eines pädagogischen Deutungsmusters. Ferdinand Schöningh. Paderborn.
Simmel, Georg (1908): Der Fremde. In: IG. S. 63-70.
Simmel, Georg (1916): Der Konflikt der modernen Kultur. In: IG. S. 148-173
[1] Es ist selbstverständlich, dass ich hier auf ein paar Seiten die theoretische Philosophie des Immanuel Kants schwerlich werde erschöpfend und kritisch, wie es einzig ihm gerecht würde, darstellen können. Es muss also notwendig bei einer oberflächlichen und mitunter dogmatisierenden Interpretation bleiben, bei welcher ich suche, die für uns entscheidenden Prinzipien und Grundbegriffe herauszuarbeiten.
[2] „A priori“ ist gleichsam die Hardware der Erkenntnis, die Vorstellungen hingegen die Software. Um sich das an einem Beispiel klar zu machen: schaue ich Fernsehen, kann ich bevor ich diesen einschalte nicht wissen, was genau ich sehen werde; das Format, in welchem ich es sehen werde, kann ich hingegen mit Gewissheit bestimmen.
[3] Ich spreche hier bewusst von ‚Instanzen‘, was vielleicht auch nicht ganz nach „reine(r) Passivität“ klingen mag, es seiner eigentlichen Bedeutung nach (lateinisch für ‚abgeschlossene Einheit‘) aber sein kann. Kant selbst spricht von ‚Elementen‘, was ich nicht übernommen habe, um zu verdeutlichen, dass die Analyse eines Gegenstandes in seine einzelnen Elemente, wie deren Exposition, für Kant dann zu Ende ist, wenn es für eine transzendentale Deduktion, die zeigt, dass wir jene Elemente in der exponierten Weise denken müssen, hinreicht. Zur Instanz der Anschauung ist zu sagen, dass diese insofern ‚rein passiv‘ ist, als uns Anschauungsinhalte sinnlich gegeben sind; zu den Anschauungsformen hingegen, dass diese die aktive Leistung darstellen, diese Inhalte zu koordinieren. Kant konzipiert den Unterschied zwischen Anschauung und Verstand weniger als den zwischen Passivität und Aktivität, sondern vielmehr als den zwischen „Rezeptivität“ und „Spontaneität“. Beide, Rezeptivität wie Spontanität, sind eine gewisse Art von ‚Aktivität‘, doch besteht der große Unterschied darin, dass „Spontaneität“ eine bewusste Handlung meint, die über das, was sie tut, halbwegs die Kontrolle hat; ob wir die Dinge nun in Raum und Zeit koordinieren oder nicht, haben wir nicht eigentlich in der Hand. So ist es auch zu erklären, dass er die Anschauung – im Unterschied zu Verstand, Vernunft und Urteilskraft – nicht unter die ‚Erkenntnis vermögen ‘ rechnet. Dies war dann ein weiterer Grund, der mich dazu bewog, von ‚Instanzen‘ zu sprechen: unter diesen Begriff lassen sich problemlos alle Elemente der Erkenntnis subsumieren.
[4] Es mag ein evolutionärer Prozess gewesen sein, der den Menschen endlich kognitiv dazu befähigte, sich zu sich selbst ins Verhältnis zu setzen und ‚Ich‘ zu sagen; doch – dies verändert alles! – erscheint es mehr als qualitativer Unterschied, aus dem bloßen Reiz/Reaktions-Schema, in welchem man bestenfalls unreflektierte Begriffe von den Dingen hat, herausgetreten zu sein und einen Begriff vom Begriff selbst zu haben. Es ist letztlich kein geringerer Unterschied als die spezifische Differenz, welche den Menschen vom Tier unterscheidet.
[5] Genauer ist es eine bestimmte Art von Verstandesbegriffen, welche den Gegenstand als solchen konstituiert: die „ Kategorien “. So nennt Kant die „reinen Verstandesbegriffe, welche a priori auf Gegenstände der Anschauung überhaupt gehen“ und damit die Synthesis zwischen Material und der Einheit des ‚Ich denke‘ gewährleisten (vgl. a.a.O., § 10, insbesondere B 106).
[6] Ich werde in dieser Arbeit – auf die Gefahr hin, für esoterisch gehalten zu werden – von ‚Seele‘ sprechen, wenn ich mich auf das Subjekt des Denkens beziehe. Ich könnte auch, wie das in Wissenschaften, die nicht über eine Kunstsprache verfügen, üblich ist, einfach ein Fremdwort für dieselbe Sache (Seele bedeutet im Griechischen ‚Psyche‘, im Lateinischen ‚Anima‘) verwenden, um so den Anschein von Seriosität zu erwecken. Da ich es mir aber zum Ziel gesetzt habe, von den Leuten verstanden zu werden, werde ich auf derartige Fremdworte nur zurückgreifen, wo das im natürlichen Sprachgebrauch üblich ist.
[7] In diesem Sinne einen wissenschaftstheoretischen Grundsatz am Rande: später geboren zu sein, bedeutet nicht notwendig mehr recht zu haben!
[8] „(W)issenschaftlich-professionell“, das heißt seit Sokrates zu wissen, was zu wissen möglich und was zu wissen unmöglich ist (akademischer Skepsis).
[9] Genauer betrachtet sollte klar sein, dass diese Arbeit mehr als die Bestimmung eines einzelnen Idealtypus hervorbringen wird. Nicht nur Entfremdung ist als ein Idealtypus zu begreifen, sondern jedes Kulturphänomen überhaupt. Doch so wie man nicht jedes einzelne Wort, auf das in einer wissenschaftlichen Arbeit zurückgegriffen wird, extra definiert, so sieht sich auch der Forschende in den Kulturwissenschaften vor die Aufgabe gestellt, in freier Willkür das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden zu müssen.
[10] Für diese Distinktion zwischen Neuzeit und Moderne vgl. auch Arendt 1955, S. 601/ Arendt 1967, S. 318f.
[11] Bei der Konzeption dieses Weltbegriffs beziehe ich mich wesentlich auf Hannah Arendts Begriff von „Welt“, wie er sich besonders in der Vita activa finden lässt (vgl. Arendt 1967) und welcher seinerseits maßgeblich auf der „ontologischen Differenz“ Heideggers aufbaut.
[12] Es scheint mir äußerst bedeutend, hervorzuheben, dass es sich hierbei um eine Disposition und nicht um eine notwendige Bedingung des Menschseins handelt. So gibt es in der Tat einige Gruppen von Menschen, die es, etwa aufgrund widriger Umweltbedingungen, bisher kaum vermocht haben, das auszubilden, was wir gemeinhin ‚Zivilisation‘ und ‚politisches Gemeinwesen‘ nennen. Letztlich kann politisches Handeln aber potentiell überall da gegeben sein, wo Menschen im Plural über einen längeren Zeitraum hinweg relativ frei von allen ökonomischen Notwendigkeiten miteinander interagieren. – Entscheidend bleibt (und das sollte jenem westlichen Chauvinismus zu denken geben), dass ‚widrige Umweltbedingungen‘ nicht allein eine zivilisatorische Frage sind, sondern diese auch da gegeben sein können, wo eine Öffentlichkeit korrumpiert ist.
[13] Nach Arendt stellt dies gleichsam die politische Urhandlung schlechthin dar (vgl. a.a.O., S. 219f).
[14] Auch wenn es im 19. Jahrhundert und auch heute noch oftmals anders gesehen zu werden scheint, „ein arbeitendes Lebewesen zu sein“ kann schon aus rein formalen Gründen keine Definition sein: es ist nichts anderes als eine Tautologie.
[15] Es bleibt festzuhalten, dass wir es sind, vernunftbegabte Beobachter, welche diese Eigenschaften tierischen Lebewesen zuschreiben und uns dabei sicher auch irren können. Ein nicht vernunftbegabtes Tier mag sich vielleicht, wie jedes organische Leben überhaupt, gemäß eines Zweckes zu verhalten scheinen, ihn selbst einsehen, kann es aber sicher nicht. Es bleibt darüber hinaus auch noch denkbar, dass Tiere in der empirischen Wirklichkeit oftmals Entscheidungen gegen das Leben treffen. Das soll uns aber hier nicht weiter aufhalten, da wir diesen Typus bloß als analytisches Schema benötigen.
[16] „(E)in Artefakte herstellendes Lebewesen zu sein“ würde schon eher als die spezifische Differenz für eine Definition des Menschen hinreichen, allerdings rein formal. Denn so haben jüngere Studien gezeigt, dass auch einige Primaten es vermögen, Werkzeuge herzustellen und zu nutzen, um ihre Zweck zu erreichen. Wir haben es also hier mit einer graduellen Differenz zu tun.
[17] Es soll hier keineswegs geleugnet werden, dass es nicht einen großen Erkenntnisgewinn mit sich bringen kann, politische Phänomene soziologisch zu beschreiben. Das Politische unterliegt wie jedes Phänomen überhaupt natürlichen Gesetzmäßigkeiten – also auch sozialen; nur es hierauf reduzieren zu wollen, ist insofern ein Holzweg, als man so die spezifische Differenz des Politischen zu anderen Arten von Interaktion negiert: die Spontaneität. Ex negativo kann die Soziologie aber sehr nützlich sein, bestimmt sie uns doch Kräfte, die mitunter dem Politischen entgegenzuwirken drohen. Wir werden auf diesen Punkt ausführlicher in 4.3 eingehen.
[18] In diesem Kapitel beziehe ich mich besonders stark auf Arendts Begriff von „Weltentfremdung“, wie sie ihn im sechsten Kapitel der Vita activa (1967) entwickelt.
[19] „ Die Kirche zur Zeit Galileis hielt sich viel enger an die Vernunft als Galilei selber, und sie zog auch die ethischen und sozialen Folgen der Galileischen Lehren in Betracht. Ihr Urteil gegen Galilei war rational und gerecht, und seine Revision läßt sich nur politisch-opportunistisch rechtfertigen.“ (Feyerabend, 1976, S. 206, Herv. im Orig.). Weiter ist Paul Feyerabend auch darin zuzustimmen, dass diese Erzählung, Galilei sei der große Märtyrer für den Fortschritt, sehr „ungerecht“ gegenüber einem Zeitgenossen ist, der weitaus eher als ‚Märtyrer‘ bezeichnet werden kann: Giordano Bruno (dieser starb wirklich für seine Überzeugungen einen äußerst qualvollen Tod) (vgl. a.a.O., S. 208)
[20] Beide Aspekte des Werkes Galileis sind insofern historisch äußerst bedeutend, als sie die Ausdifferenzierung von Wissenschaft und Philosophie bedeuten.
[21] In § 1 haben wir hierauf bereits mit Bezug auf Kant eine Antwort gegeben: der Raum ist nichts anderes als eine Anschauungsform, in welcher uns die Dinge immer schon in äußeren Verhältnissen als Körper erscheinen und hat als solche „ empirische Realität “ und „ transzendentale Idealität “ (vgl. Kant 1787, B 44, Herv. im Orig.).
[22] Letzteres ist nicht ganz korrekt. Die Vorstellung von einem ‚Jenseits‘ setzte sich in Vorderasien und dann im Okzident nur äußerst schleppend durch. Wir haben es bei der christlichen Aristoteles-Rezeption im Mittelalter mehr mit einem Weltbild zu tun, in dem die göttlichen Wesen in einer graduellen Hierarchie stehen. In der unmittelbaren Immanenz der Erde finden sich nur äußerst gering geschätzte übersinnliche Mächte, die Bedeutung derartiger übersinnlicher Mächte bzw. Gottheiten steigt mit der Sphäre, in welcher sie verortet werden. Das heißt ja nichts anderes, als dass sie für umso bedeutender gehalten werden, als sie sich unwandelbaren Gesetzen gemäß zu verhalten scheinen.
[23] Ich übersetze hier ‚cogitans‘ nicht wie üblich mit ‚denk en ‘, da dies die Sache nicht ganz trifft; bezieht sich Descartes bei dieser Konzeption doch auf einen ganz bestimmten Aspekt des Denkens: das Bewusstsein.
[24] Sofern man hier überhaupt von ‚lokalisieren‘ sprechen kann: da Denken ja seit jeher als immateriell charakterisiert wird, wäre zu diskutieren, ob Descartes nicht selbst den Archimedischen Punkt im Nichts aufgelöst hat.
[25] Er redet hier von seinem gedankenexperimentell fingierten allmächtigen Täuschergott, genius malignus, der sogar die Realität des geometrischen Raumes zweifelhaft macht.
[26] Für Thomas S. Kuhn ist die Esoterik in den Wissenschaften nichts anderes als ein Merkmal dafür, dass eine Wissenschaft in ihrer historischen Ausdifferenzierung als eigenständige ‚Disziplin‘ so weit ist, dass in den entscheidenden Werken nicht mehr jedes Grundprinzip exponiert und gerechtfertigt werden muss, da davon ausgegangen werden kann, dass die Leserschaft in der jeweiligen Disziplin diese (aner-)kennen (vgl. Kuhn 1976, S. 33-36). Dies alles bestätigt auch nur das hier Gesagte: Akademien sind esoterische Institutionen.
[27] Nach dem Lexikon zur Soziologie werden alle „rituelle Praktiken“ als ‚ magisch ‘ bezeichnet, „mit denen übersinnliche Mächte in den Dienst des Menschen gezwungen werden“ (Fuchs-Heinritz 2011, S. 418). Die magischen Wurzeln – religiöses Handeln hat es ja der Natur der Sache nach mit „übersinnlichen Mächte(n)“ zu tun – von Religiosität überhaupt sind offensichtlich. In diesem Zusammenhang muss man nur wissen, dass Weber bei dem Versuch, eine Art universale Sozialgeschichte des religiösen Handelns zu schreiben, zwischen „Gotteszwang“ und „Gottesdienst“ unterscheidet (Weber 1921, S. 257f). In der abendländischen Geschichte, in der sich eine zunehmende Rationalisierung des Gottesbegriffes beobachten lasse, gehe die Entwicklung – mit einigen Umwegen – hin zu einer Ausschließlichkeit des Dienstes für Gott. Letzteres, was mit gleichem Recht auch die Negation von Gotteszwang überhaupt genannt werden könnte, habe der asketische Protestantismus in beispielloser Konsequenz durchgesetzt und sei damit die Perfektion der Entzauberung des Religiösen überhaupt (vgl. a.a.O.). Die Kommunikation mit der letzten übersinnlichen Macht, die dem Puritaner noch geblieben ist, gestaltet sich bei einem ausschließlichen Gottesdienst doch recht einseitig.
[28] Zwischen ‚ Intellektualismus ‘ und ‚ Rationalismus ‘ müssen wir, auch wenn das dem gesunden Menschenverstand nicht unbedingt plausibel erscheinen mag, deutlich unterscheiden. Man könnte sagen, dass dieser Unterschied letztlich auf den von Kontemplation und Askese, dessen Gegensatz wir ja bereits ausgeführt haben, hinausläuft. Wie prinzipiell dieser Gegensatz letztlich sein kann, werden wir im weiteren, besonders 3.3, noch deutlich sehen.
[29] Wer einen empirisch brauchbaren Begriff von Magie sucht, der sei auf Birkhan 2010, S. 11, verwiesen: „Aberglaube und Magie kann man in unserem Kulturkontext einfach dadurch bestimmen, daß sie im Widerspruch zur aktuellen christlichen Lehre, aber auch zum Erkenntnisstand der (Natur-)Wissenschaft und zur menschlichen Vernunft stehen“. Ich werde mich im weiteren wesentlich auf diese Begriffsbestimmung stützen.
[30] Die Figur des Psychoanalytikers veranschaulicht diesen Sachverhalt recht schön: Was macht dieser anderes als einen übersinnlichen Gegenstand, die Seele, zu deuten und Einfluss auf diesen zu nehmen?
[31] Dass ihre älteren Vertreter in der Renaissance ein ausgeprägtes Interesse an Gegenständen gezeigt haben, die wir heute als ‚magisch‘ und ‚abergläubisch‘ bezeichnen würden, ist kein Widerspruch: wer in einer magischen Welt lebt und mit übersinnlichen Mächten zu kommunizieren sucht, hat kulturwissenschaftlich gesehen gar nicht wissen können, dass er ‚zaubert‘; wer aber nur darauf bedacht ist, sich von anderen abzugrenzen, schon. Newton, dessen Interesse an Alchemie (vgl. Westfall 1996, S. 156ff) im schlechten Sinne von ‚Zauber‘ zu verstehen ist und im 18. Jahrhundert längst nicht mehr zeitgemäß war, bleibt hierin eine äußerst interessante Ausnahme.
[32] Nach der aristotelischen Physik werden Bewegungen auf der Erde als etwas Qualitatives verstanden: als eine Veränderung, einen Übergang vom Sein zum Nichtsein und andersherum.
[33] Bezeichnenderweise war es nach Koyré Niccolò Tartaglia, auf den die ‚Tradition‘ zurückgeht, in dieser Art zu argumentieren (vgl. Arendt 1967, Kap. VI, Anm. 1). Dies ist nun insofern bezeichnend, als er die Ballistik erfunden hat, welche ja auch nichts anderes tut, als physikalische Phänomene geometrisch zu beschreiben.
[34] Es ist keine Frage, Descartes war äußerst musisch und ein großer Literat. Wie ich hoffe, in dieser Arbeit zeigen zu können, muss ein weniger asketisches und mehr kontemplatives Leben den Wissenschaften nicht notwendig abträglich sein.
[35] Man behalte sich die Provisorische Moral im Kopf – besonders a.a.O., III.5 – und vergleiche das Fazit dieser Arbeit mit dieser.
[36] ‚Materialistisch‘ zu sagen und ökonomische Phänomene zu meinen, mag mal Sinn gemacht haben; in einer Finanzwirtschaft, so viel darf als sicher gelten, macht das aber keinen Sinn mehr.
[37] Ich werde mich bei dieser Analyse vornehmlich auf Arendts Gesellschaftsbegriff stützen, wonach ‚Gesellschaft‘ nicht zuletzt die Aufhebung der traditionellen Trennung zwischen Privatsphäre und dem öffentlichem Raum bedeute (vgl. Arendt 1967, S. 47f).
[38] Von dem Calvin ismus als sozialogisch signifikanten Phänomen, lässt sich spätestens ab dem Erscheinen der Westminster Confession, 1647, sprechen (vgl. a.a.O., S. 141f). Das ist bezeichnenderweise – Stichwort ‚Entzauberung‘ – in etwa auch die Zeit, in welcher der Cartesianismus in der KW bedeutend wurde.
[39] So beschreibt etwa sein Machtbegriff, wonach Macht „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen“ bedeutet (Weber 1921, § 16, Herv. JM), doch vielmehr gesellschaftlich-ökonomische als genuin politische Macht. Im Politischen handelt man nämlich nicht als ‚Ich‘ (‚ego‘), sondern als ‚Wir‘; hier kann es eigentlich auch kein „Widerstreben“ geben, da politische Macht vielmehr darin besteht, dass die Leute von einer Sache überzeugt sind. Setzt eine bestimmte Person oder Gruppe wirklich ihren Willen gegen Widerstreben durch, haben wir es nicht mehr mit Überredungskunst, also Macht, sondern Gewalt zu tun (vgl. Arendt 1970a, S. 57). Dieser Machtbegriff samt seiner guten Rezeptionsbedingungen (bis heute) – selbst bei Hobbes finden wir noch einen politischeren Begriff von Macht (vgl. Hobbes 1651, I.10) – kann als durchaus symptomatisch für die Zeit (und letztlich auch noch für unsere) interpretiert werden kann.
[40] Ich stütze mich hier auf Nietzsches‘ Prägung dieses Begriffes: „Diese Macht, diese Gattung von Menschen will ich bei Namen nennen – es sind die Bildungsphilister. Das Wort Philister ist bekanntlich dem Studentenleben entnommen und bezeichnet in seinem weiteren, doch ganz populären Sinne den Gegensatz des Musensohnes, des Künstlers, des echten Kulturmenschen. Der Bildungsphilister aber – dessen Typus zu studieren, dessen Bekenntnisse, wenn er sie macht, anzuhören jetzt zur leidigen Pflicht wird – unterscheidet sich von der allgemeinen Idee der Gattung ‚Philister‘ durch seinen Aberglauben: er wähnt, selber Musensohn und Kulturmensch zu sein (sic!)“ (Nietzsche 1874, I.2.). Hier finden wir auch recht schön, wie die ‚Intellektuellen‘ im späten 19. Jahrhundert, als moderne Klasse verstanden, die soziale Position des Zauberers monopolisierten. Die erste Amtshandlung war es gleichsam, den eigenen Bluff zu glauben. Festzuhalten bleibt aber vielmehr – nach Arendt sei das historischen Erscheinen des Begriffes‘ ‚Bildungsphilister‘ (den sie mit dem englischen „Snob“, dem amerikanischen „‚high-brow‘-Intellektuellen“ und dem französischen „bien-pensant“, letzteres scheint mir zweifelhaft, identifiziert) ein sicheres Anzeichen für die „Vergesellschaftung der Kultur“ (vgl. Arendt 1958a, S. 277) –, dass dieser Prozess, die Vergesellschaftung der Kultur, nach der Reichsgründung einen bedeutenden Grad erreicht zu haben scheint.
[41] Sein übertriebener Ökonomismus verhinderte es ihm, so scheint mir, wohl zeitlebens, einen wirklich adäquaten Begriff von Kunst und Politik zu bilden; aber das soll uns im weiteren nicht stören.
[42] Nach Schätzungen des UNHCR – und die Zahl der Staatenlosen zu bestimmen, gestaltet sich äußerst problematisch – beläuft sich die Zahl der Staatenlosen gegenwärtig auf etwa „zehn Millionen“ (UNHCR Deutschland 2001-2018). Dass das Problem der Flucht überhaupt heute größer denn je ist, sollte eigentlich keines weiteren Belegs bedürfen.
[43] Um sich zu veranschaulichen, dass genuin ‚rationales‘ Handeln etwas äußerst Unpersönliches an sich hat, muss man nur an unser Urbild für Gesellschaft denken: die Hofaristokratie und das für sie typische Verhalten.
[44] Wir gehen in diesem Kapitel also ausführlicher auf einen anderen Aspekt des ‚Magischen‘ ein: seinen Traditionalismus. ‚Magie‘ ist nun insofern eine Art von traditionalen Handeln, als man es hierbei der Sache nach mit transzendenten Gegenständen zu tun hat, welche letztlich nur mittels Analogieschlüssen begreifbar sind. Die faktische Wirkung, welche sich bei ‚magischen‘ Handeln oftmals beobachten lässt, ist, dass alle immanenten Faktoren – die Faktoren also, über welche man wirklich disponieren kann – stereotypisiert werden. In derartigen Ritualisierung kommt also deutlich zum Ausdruck, dass „das Heilige“ in einem magischen Weltbild „das spezifisch Unveränderliche“ darstellt (vgl. Weber 1921a, S. 249).
[45] Ich stütze mich hier wieder auf die Auszüge der Westminster Confession, wie sie in Die protestantische Ethik zitiert sind (vgl. a.a.O., S. 142f).
[46] Ich persönlich halte religiösen Fundamentalismus für hochmodern: derartige Begriffe machen auch nur in einer modernen, ‚rationalen‘ Kultur Sinn; für einen Menschen im ‚traditionalen‘ Mittelalter etwa wären sie schlicht undenkbar. Einzig, dass noch traditionelle Gottheiten, wie hier JHVE, Gegenstand des religiösen Handelns‘ sind, mag aus der Zeit gefallen sein; wie bereits angedeutet, wir haben heute eine neue, totale Gottheit: ‚die Wissenschaft‘.
[47] Die hier erfolgende Kant-Rezeption, bei welcher der Fokus auf sein spätes Werk gesetzt ist, ist nicht zuletzt eine durch Hannah Arendt vermittelte Lesart (vgl. Arendt 1965, S. 137-149/ Arendt 1970). Konkret heißt das, dass ich sein spätes Werk nicht für die Auswüchse eines senil werdenden Professors halte, sondern für die Vollendung der Systematik seines Gesamtwerks. Die Kantinterpretation Arendts, wonach wir in der Kritik der Urteilskraft sein nie geschriebenes politisches Werk finden würden (vgl. Arendt 2012, S. 16-21), scheint unorthodox, ist aber schlüssig begründet.
[48] Allgemein gesprochen ist sie diejenige Instanz a priori, welche immer schon zwischen Allgemeinem und Besonderem vermittelt hat. Sie ist das transzendentale Vermögen des Schematismus.
[49] Entscheidend, dass Kant schreibt: „nicht sowohl wirkliche, als vielmehr bloß mögliche“. Da wir diesen Punkt schon mehrfach behandelt haben (besonders ausführlich in § 2), wollen wir es bei einer Fußnote belassen. Wie eine bestimmte Person die Sache sieht und über diese wirklich denkt, kann ich – aufgrund der Transzendenz der Seele – unmöglich wissen. Im kontemplativ-reflexiven Modus wird also interpretiert und nicht gewusst; wer aber doch überzeugt ist, in derartigen Fragen mit Wissen auftrumpfen zu können, wird sich in diesem Modus wohl kaum lange aufhalten und entsprechend voreingenommen urteilen.
[50] Sie kann die gegebenen Gesetze in wertfreier Weise lehren, aber das soll uns hier nicht interessieren.
[51] Diese von mir antizipierte Opposition stützt sich auf gemachte Erfahrungen, welche wohl nicht zuletzt über die Tradition der Frankfurter Schule – diese suchte nach dem Zweiten Weltkrieg von der Universität Frankfurt aus das Reeducation Programm in die Tat umzusetzen – zu erklären sind. Während sich über die Berechtigung eines solchen Verständnis von Lehre zu dieser Zeit sicherlich trefflich streiten ließ, scheint es heute aus der Zeit gefallen zu sein. Selbstredend teile ich den Anspruch, dass Auschwitz nie wieder geschehe (!); nur fürchte ich, dass eine so verstandene Lehre praktisch bei ihren Zöglingen – die ab einen gewissen Alter sehr genau merken, will man ihnen etwas aufoktroyieren – nicht selten das Gegenteil ihrer eigentlichen Intentionen bewirkt: Trotz. Diese Reaktion stellt nun zwar den Fehler dar, nicht zwischen einer Sache und dem Ton, in welchem sie vermittelt wird, zu unterscheiden; doch ist sie angesichts des Umstandes, dass seit dem Historikerstreit das Thema ‚Auschwitz‘ mehr und mehr zum bloßen Dogma und Mittel verkommt, mit welchem sich nicht wenige Mitglieder der gehobenen Gesellschaft zu distinguieren suchen, nicht ganz unverständlich. Nun ist eine solche Erörterung im einzelnen wenig zielführen, allgemein gilt: rechtsstaatliche Grundsätze über die Erziehung umzusetzen, ist legitim; alles, was im weitesten Sinne als parteipolitisch bezeichnet werden kann, ganz sicher nicht.
[52] Es ist äußerst bezeichnend für vieles, dass Arendt dieses Phänomen in den 1950er Jahren nur in den Vereinigten Staaten beobachtete und es in Deutschland eindeutig jüngeren Datums ist. Es bedurfte hier allererst ein Bewusstsein für das tatsächliche Ausmaß der Verbrechen, dass in der Bundesrepublik Autorität überhaupt (die man darüber hinaus fälschlicherweise oftmals für ein Charakteristikum des Nationalsozialismus hält) problematisch erscheinen konnte.
[53] Das ist die Definition des Interessenbegriffes bei Kant: „Interesse wird das Wohlgefallen genannt, was wir mit der Vorstellung der Existenz eines Gegenstandes verbinden“ (Kant 1793, B 5f).
- Arbeit zitieren
- Johannes Marx (Autor:in), 2018, Zur Entfremdung des Menschen in der Moderne, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444280
Kostenlos Autor werden

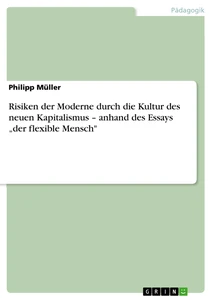

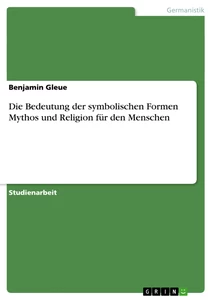








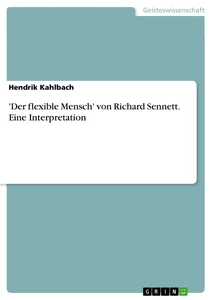









Kommentare