Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2. Besitzt die Netzwerkgesellschaft einen veränderten Bedürfnischarakter?
3. Grundlegende Konzeptualisierungen, Definitionen & deren Diskussion
3.1. Die Hierarchie
3.2. „Das Rhizom“
3.3. Gegenüberstellung: Konkurrenz oder Symbiose?
4. Was ist das „Web“ heute?
4.1. Historische Entwicklungslinien des „www“
4.1.1. CERN
4.1.2. Die Supermachtkonstellation
4.1.3. Die transnationale Integration ausgewählter Subkulturen
4.2. Normative Bedenken
4.2.1. vom moralischen Blickwinkel
4.2.2. aus demokratischer Sicht
4.2.3. in kulturkritischer Herangehensweise
4.3. Eine „futurologische“ Prognose
4.3.1. Konstruktion
4.3.2. Destruktion
5. Die Verankerung im Bereich einer Proto-Kosmopolitik
5.1. Internationaler Datenverkehr unter ökonomischen Aspekten
5.2. Der „Impact“ auf das Phänomen NGO
5.3. Globalisierung & Vernetzung – auf dem Weg zur „world democracy“?
6. Transnationale Organisierte Kriminalität
6.1. „dark networks“ - ein aktueller Lagebericht
6.1.1. „white crime“: Wirtschaftsverbrechen
6.1.2. Pornographie, Verfassungsschutz & „copyright infringement“
6.2. Die „Antwort“ der Kryptographie
6.2.1. Die „Offense/Defense-Spirale“
6.2.2. Zukunftsperspektiven
6.3. Hürden der Strafverfolgung
6.3.1. „Grauzonen“
6.3.2. Nationalstaatliche Rechtsprechung, Supranationale Vereinbarungen
7. Fazit
8. Anhang I-IV
9. Bibliographie
2. Besitzt die Netzwerkgesellschaft einen veränderten Bedürfnischarakter?
Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, die Hypothese zu überprüfen, ob es einerseits zu einem massiven Wandel der Bedürfnisstrukturen der Menschheit in ihren Teilsaspekten der sog. „westlichen Zivilisation“ kam, welcher wiederum die eigentliche Erfindung des Internets erst ermöglichen konnte, oder ob vielmehr die globale Vernetzung im kybernetischen Rückgriff auf die Triebkräfte, libidinösen und „thanatotischen“ Strukturen, selbige modifiziert hat. Denkbar wäre auch von gar keiner Veränderung auszugehen, oder eine noch stärker „autopoietische“ Wechselwirkung zugrunde zu legen. So oder so, zu welchen Ergebnissen diese Arbeit auch kommen mag, zumindest die tendenzielle Falsifizierung von drei Nullhypothesen in diesem Vierfelderschema scheint plausibel. Vorweg ist es aber vonnöten, zur begrifflichen Klarheit eine definitorische Abgrenzung des Bereiches zu unternehmen, auf dessen „Befriedigungsbilanz“, auf dessen Befriedungsfunktion eine Wirkung vermutet wird.
3. Grundlegende Konzeptualisierungen, Definitionen & deren Diskussion
3.1 Die Hierarchie
Ausgangspunkt der Diskussion muss die sogenannte Hierarchie sein, die „Pyramide“. Nicht umsonst drängt sich hier der Vergleich zu Maslow und seiner lexikalischen Ordnung der mehr oder minder notwendigen „Notwendigkeiten“ auf; wenn es Bedürfnisse in seiner Hierarchie gibt, die die allgemein hierarchische Gliederung der Gesellschaft als Ganzes weniger gut bedienen kann, als eine alternative Zusammensetzung, so müsste man hier eine mögliche Schlüsselvariable der Argumentation postulieren können. Auf der Ebene biologischer Bedürfnisse scheint sich hier kaum eine signifikante Unterscheidung anzubahnen, bestenfalls in punkto Sexualität, auf die an späterer Stelle von der Schattenseite her eingegangen werden soll. Der Boom der Partnerbörsen als u. U. positive Entwicklung könnte man nichtsdestotrotz auf der Haben-Seite eines Trends hin zum offenen Sozialgefüge verbuchen. Ein klarer Nachteil der Hierarchie zeigt sich auf der nächsten Bedürfnisebene, der Sicherheit. Wenn in einer dreistufigen Anordnung die „mittlere Etage“ aus welchem Grund auch immer wegbrechen würde, ist die Funktionsfähigkeit nicht mehr gewährleistet, ein Netz hingegen kann aufgrund seiner Redundanzen, den Ausfall einzelner „nodes“ (Knotenpunkte, Verknüpfungsstellen) meist spielend bewältigen, wenn auch die Beschädigung zentraler „server“ im realen Web z. B. Stau und Überlastung auf den Ausweichrouten erzeugen kann. Der dritte Abschnitt lautet Bindung. Die Schlussfolgerung ist hier ähnlich: von der Partnerschaft im engeren Sinne abgesehen, kann es sowohl von Vorteil sein, seinen Freundeskreis dezentral zu organisieren, um beispielsweise nicht auf einzelne „gatekeeper“ angewiesen zu sein, um zum „Rest“ Anschluss zu finden, ein allzu große, im Vorgriff auf weiter unten diskutierte Bindungslockerung, lässt allerdings schnell die Vorzüge „klassischer“ Hierarchien, wie Familie, Arbeitsumfeld, politisches Regime und dergl. erkennen, als da wären klare Verhältnisse und Schutz; die andere Seite der Sicherheit. Für Stufe Vier, das Selbstwertgefühl geht der Punkt jedoch wieder relativ eindeutig an die „networks“. Wohl kann einen der lobende Zuspruch des womöglich gar obersten Chefs einen Motivationsschub und subjektive Glücksempfindungen verschaffen, der Autor hingegen ist der Meinung, dass „wahre“ Unabhängigkeit und „echte“ Eigenverantwortlichkeit kaum zu überschätzen sind. Die kognitiven „needs“ auf der fünften Ebene scheinen zunächst keinen wirklich überzeugenden Schluss zuzulassen: die potentiellen „Info-Pfade“ der Netzstruktur wirken zwar im ersten Moment verlockender, jede Hierarchie aber, die ja in der Regel erst aufgrund ihrer Größe diese Organisationsform annimmt, produziert wie anzunehmen ist, für sich allein schon mehr Daten als vom Individuum bewältigbar. Auch vom ästhetischen Gesichtspunkt her dürfte die Hierarchie massiv Gewicht in die Waagschale legen dürfen, wobei der ausschlaggebende Faktor evtl. die eigene Verortung als eher „ordentliche“ oder „chaotische“ Natur ist. „Etage 7“ schließlich dürfte in wenn auch geringerem Maße auf der Selbstwertebene bereits vorweggenommen sein. Die achte und letzte transzendentale Versenkung entzieht sich einer Kategorisierung ohne tiefere Kontemplationen und Meditation über die vermeintlich „essentielle“ Ontologie des Kosmos als Ganzem, etwas wofür an dieser Stelle kein Platz bleibt; kreativer mutet die vernetzte Strukturierung im oberflächlichen Urteil allemal an.[1]
3.2 „Das Rhizom“
Das wird nicht zuletzt deutlich, wenn man sich exemplarisch die Ausführungen von Deleuze & Guattari zum „organischen“ Vergesellschaftungsmodell zu Gemüte führt; an dieser Stelle relevant sei aber nur die begriffliche Nähe des „Rhizoms“, des Wurzelwerks, als Alternative zum Baum als Symbol der Hierarchie. Inwiefern die Tatsache wertend zu verstehen ist, dass das undulatorische Geflecht quasi „unterirdisch“ ist und derart „minderwertiger“ als die eigentliche Krone muss offen bleiben; ohnehin lebt der sichtbare Baum ohne sein „Fundament“ auch nicht lange. In diesem Zusammenhang ist auch das „lokale“, großflächige aber flache Potential der Ausführungen der o. g. Autoren über „Gras“ zu verstehen[2], deren perfekte terminologische Synthese im basisdemokratischen „label“ der „grassroots-democracy“ gegeben ist, wiederum die unumgängliche Voraussetzung für alle höheren systemintegrativen Prozesse bis hin zur Spitze, den sogenannten INGOs, international operierenden Nichtregierungsorganisationen, doch auch dazu später mehr. Die angedeuteten Bedürfnisse nach Flexibilität und Dynamisierung machen vermutlich auch ihren Punkt für die vernetzte Sozialität.
3.3 Gegenüberstellung: Konkurrenz oder Symbiose?
Wer also summa summarum besser abschneidet ist immer noch nicht ganz so einfach zu sagen [Anhang II]. Da man die Bedeutung des „Neuen“ aufgrund seines Innovationscharakters oft nur zu gern überbewertet und sich dessen auch unbewusst bewusst ist, darüber hinaus die „status quo“-Macht per definitionem alle Vorteile zur Hand hat, wäre es angebracht noch ein paar gute Seiten des Unterlaufens von strengen Über- und Unterordnungen durch Querverbindungen aufzuzeigen. In erster Linie scheint die größere Nähe untereinander zu begrüßen zu sein, wobei auch davon ein Zuviel im Möglichkeitsbereich liegt. Der durch Positionen und Status automatisierte Respekt birgt die Gefahr von Missgriffen, Kakophonien und harmonischen Unstimmigkeiten, im Falle eines völligen Verschwindens. Andererseits: autoritas, non veritas, facit legem; der Bessergestellte und das ist eine große Quelle des allgemeinen Unbehagens in der Kultur, ist leider viel zu oft nicht der, bei dem de facto und de jure Legitimation zur Deckung kommen, während die Mittel der legalen Rechtsetzungen allein schon dieses Andenken verhindern wollen. Aus dieser Situation heraus, die wie anzunehmen ist, vielfach auch lapidar auf Missgunst basiert, wird es andererseits wieder verständlich, warum man allerorts die Gratifikationen einer weitgehend anonymen Kommunikation im Internet erkannt hat, warum man gar in zunehmendem Maße das Angebot wahrnimmt in fremde Rollen zu schlüpfen, seine Identität zu beschönigen usw. Die gestiegenen Bedürfnisse nach mehr Dynamik, mehr Flexibilität, mehr Abwechslung lassen sich auch hier wieder ableiten oder voraussetzen.[3] Wenn auch dem traditionellen Gefüge noch keine „wirkliche“ Konkurrenz zu drohen scheint, so bietet das Netz nichtsdestotrotz eine mit offenen Armen empfangene Ergänzung. Überhaupt spielt dem die Fülle an Einmaligem, Einzigartigem und immer Neuem beim „Surfen“ entgegen, denn im Unterschied zum Film, indem man freilich auch beim dritten Sehen noch ab und an überrascht wird, oder dem fertig portionierten Chart-Hit mit wenigen Wochen Halbwertszeit, gleicht im Netz kein Aufenthalt dem anderen. In einer anderen Dimension kann die netzwerkartige Organisation zwischenmenschlicher Beziehungen einen letzten, aber unheimlich wertvollen Grund für sich ins Feld führen: die gegenüber der Hierarchie extra vorhandenen Pfade addieren sich zu einer Multilinearität, die „Rom“ auf vielerlei Art und Weise erreichbar machen; zu Ende gedacht führt einen dieser Ansatz gleichermaßen zur multiplexen Beziehung, in der der Vater auch bester Kumpel sein könnte, der Postbote auch ehemaliger Tae-kwon-do-Lehrer. Ein Bedürfnis nach mit der Menge der Gemeinsamkeiten geometrisch wachsender Versatilität bzw. Vielseitigkeit ließe sich damit auch bedienen.
4. Was ist das „Web“ heute?
4.1 Historische Entwicklungslinien des „www“
4.1.1 CERN
Ganz am Anfang der weltweiten Telekommunikationsrevolution stand der Bedarf nach Wissensaustausch. Die „logistische“ Notwendigkeit eines reibungslosen Funktionierens am Arbeitsplatz wird gemeinhin als die eigentliche Initialzündung des Internets angesehen, dass dies manche bestreiten, liegt schlicht und ergreifend daran, dass dieses technologische Novum, welches aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken ist, ironischerweise ursprünglich nichts anderes als ein „Abfallprodukt“ des europäischen Teilchenbeschleunigers war, streng genommen dann nämlich auch nur ein „Intranet“ innerhalb der weitläufigen Forschungseinrichtung. Welch tragende Rolle der Wissenschaftsbetrieb dann hingegen später bei der weiteren Entfaltung eingenommen hat, wird deutlich, wenn man sich den Bedarf einer interuniversitären Vernetzung in Erinnerung ruft, eine der, wo nicht die entscheidende Triebfeder für das „www“ in seiner heutigen Form. So schleuste man ja nahezu jeden späteren Guru des Online-Zeitalters durch diese akademischen „hosts“.
4.1.2 Die Supermachtkonstellation
Nichtsdestoweniger führten die genannten Einwände dazu, dass man den Tribut für die Erfindung in vielen Fällen den US-Amerikanern und ihrem ARPANET zollt. Von dieser Warte aus betrachtet, wäre das Verlangen nach geopolitischer Stabilität und nationaler Sicherheit der substanzielle Impetus der globalen Umwälzung gewesen. In der Tat kann man hier ebenso eine Anzahl guter Gründe anführen. Hier vernetzte man zum ersten Mal wirklich weit auseinanderliegende „facilities“, traurigerweise verdanken wir also unsere gegenwärtige kommunikative Freiheit der Verschaltung dutzender von Nuklearwaffenbasen und ihren immer noch fünfstelligen Gefechtskörperzahlen. Schwierig bleibt in der abschließenden Bewertung, ob die „Erfüllung“ des Sicherheitsbedürfnisses erfolgreich war oder nicht. Hier teilen sich die Meinungen: während die einen MAD („mutual assured destruction“) für die Ursache der jahrzehntelangen einigermaßen entspannten Lage im Kalten Krieg halten und damit dieser frühen Form der Vernetzung das Gros des Verdienstes zukäme, bestreiten andere (und das zu Recht!) den Sinn jeglicher Atomwaffen.
4.1.3 Die transnationale Integration ausgewählter Subkulturen
Es lässt sich allerdings noch eine weitere Spur verfolgen, die wieder eher in die Richtung basisdemokratischen Engagements zielt. Thiedeke erwähnt hier namentlich drei „Kulturen“, drei Bewegungen, drei „Szenen“, die nachhaltig vom Internet profitiert haben sollen bzw. diesem in gewissem Maße sogar den Weg gewiesen hätten.[4] Der HipHop so sagt er, sei im Kern seines Wesen aggressiv. Diese These muss man verneinen, da es gerade ihm gelang die „kids“ von der Straße vor die Mikrofone, auf die Tanzfläche oder an die Häuserwände zu bringen, womöglich gar heutzutage vor die Computermonitore. Man mag es außerdem mit der Sachbeschädigung[5] im letzten Fall halten wie man mag, im übrigen kann man der Argumentation, die sich vor allem auf Baudrillards’ „Kool Killer – Aufstand der Zeichen“ stützt, getrost folgen. Die beim illegalen Sprayen erforderlichen Bedürfnisse nach Anonymität und Deckidentitäten seien im Web wiederzuerkennen, so wie Hacker von diesem Gedanken in ihren Aktivitäten profitieren konnten und können, so sei auch im heutigen Web ein jeder ein kleiner „HipHopper“. Da wird designt, in Foren „gebattelt“, im Wissenschaftsbetrieb sowieso, da wird neuerdings in allerlei „communitys“ um das beste Foto, den besten Auftritt gewetteifert was das Zeug hält. Unterstellt wird dem Ganzen dann die „Angst des Verschwindens“ und dessen Pendant, das Bedürfnis sich um jeden Preis zu inszenieren und in vorteilhaftes Licht setzen zu wollen. Klar, das man sich im Gegenzug dann den Vorwurf anhören muss, in den einschlägigen Kreisen hätte Form Vorrang vor Inhalt und „alles stylishe“ ginge auf Kosten der „message“, was zweifelsohne m. E. zu häufig zutrifft, gerade und vor allem auch im Web. Man denke an „Hochglanzringe“, die letztlich nichts anderes sind als Werbung, „adware“ und Endlosschleifen zur „traffic“-Gewinnung. Alles in allem ist die Bedeutung ausgerechnet dieses „Lifestyles“ für die „Digitale Revolution“ ambivalent; manchen Ansätzen möchte man zustimmen, wenn auch die pauschale Einordnung in eine Schublade immer ein Problem bleibt in einer kulturellen Richtung, die derart diffus, von Zersplitterungen und Fragmentierungen durchsetzt ist, dass man nicht weiß, ob man Ragga jetzt zu Reggae, oder alles zusammen mit Soul, Funk, weil es „schwarz“ ist, zum sog, „HipHop“ rechnet. Und wo ordnet man „Limp Bizkit“ und seinen Stilmischmasch ein, der, „weiß“, als Ausnahmeerscheinung vielleicht deswegen eher dem Punkrock zuzuschreiben ist? Evident ist, dass dieser Austausch der „local communities“, welcher Couleur und Façon auch immer, ohne Internet, P2P und WebRadio undenkbar gewesen wäre. Die nennenswerte Entwicklung am Punk ist dann wohl die, dass die Bewegung in einer Zeit entsteht, die im Zeichen der nuklearen Nachrüstung von tiefer Unsicherheit geprägt war; in letzter Instanz eine direkte Folge eines der Internetvorläufer, eine Zeit, die auch sonst von „no future“-Stimmung in Film und sonstiger Kunst durchzogen war. Wie sich hier der Bogen in umgekehrter Wirkrichtung schlagen lassen soll, leuchtet allerdings weniger ein. Höchstens über den konstruierten Topos des „Cyberpunk“[6] könnte die Überbrückung gelingen. Die allgemeine Existenzangst und Furcht vor der Zukunft (daher deren explizite Verneinung), schlägt an einem gewissen Punkt kritischer Masse in dessen radikales Gegenteil um, die totale Bejahung der Technologie mutiert den immer noch aus Protest schäbigen Zeit-„Genossen“ zum versierten Nutzer futuristischer „Devices“ und technischer Spielereien in einer kalten und rauen Maschinenwelt. Die Atmosphäre und Bühnengestaltung, wie sie aus dem „pen&paper“-Rollenspiel „ShadowRun“ stammen könnte, reflektiert den unvermittelten Einbruch der neuesten Errungenschaften der Spezies, das allgemeine Sich-Anschließen und Verkabeln kündigt den finalen Siegeszug der „Zukunft“ an. So wie das spätere MMORPG (Massive Multiplayer Online Roleplay Game) im Imaginären vorweggenommen wurde, wird der Mensch jetzt realiter zum „Cyborg“; ohnehin war er auch schon Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte davor ohne seine Tüfteleien praktisch nicht mehr lebensfähig. Die vorerst letzte Zuspitzung findet diese Herleitung des Netzes in der Elektroszene und nicht zufällig findet der „klassische“ Punk seinen logischen Gipfel in der Erfindung des Synthesizers. Man halte sich die Impressionen auf einem „Rave“ vor Augen, die einem als Außenstehendem das Gefühl vermitteln können, in einem Wust pulsierender Bits und Bytes zu stehen, mit bpm (beats per minute) die sich schon mal der 200 nähern, liegt der Vergleich zur Hochgeschwindigkeitsdatenleitung nahe. Die Buntheit, das Schrille, der Lärm, das Stroboskop und die psychedelischen Muster am Videobeamer tuen ihr Übriges, um die wenn auch konstruierte Parallele zu ziehen zum „live-streaming“ des neuesten Kinotrailers, während man gerade „voice over IP“ nutzt, zwei drei „pop-up“-Fenster bekämpft, mit einem Auge auf den Nachrichtenticker, sich am Rande die Wettervorhersage aktualisiert und eine ungeduldige Warnmeldung den soeben abgeschlossenen download absegnet. Die kybernetische Symbiose Mensch/Maschine wirkt perfekt.
4.2 Normative Bedenken
4.2.1 vom moralischen Blickwinkel
In dieser der Anschaulichkeit halber überzeichneten Momentaufnahme, zeigt sich eine erste Gefahr der bisher ja im Großen und Ganzen verheißungsvollen Entwicklung, das Problem der Orientierungslosigkeit und Überforderung. Paradoxerweise sind auch diese beiden Problematiken aus zunächst einmal gegenläufigen Ansprüchen an das Internet entstanden. Der in ihren Ausmaßen unfassbaren Informationsüberschwemmung muss zu irgendeinem Zeitpunkt, so möchte man annehmen, irgendwann einmal das Bedürfnis nach „Klarheit“ vorausgegangen sein: was man sich erhoffte war gezielte, schnelle und prägnante Auskunft zu diesem oder jenem Thema, was man bekam ist nach wie vor das genaue Gegenteil. Als vor fünf oder zehn Jahren mehr denn heute die Suchmaschinen noch äußerst inkompatibel - und das mit Absicht - waren, konnte die „Blitzrecherche“ zum einen oder anderen Wort einmal schnell zum kraft- und nervenzehrenden Marathon ausarten, nach wie vor keine Seltenheit, wenn man nicht bereit ist, 25 Cent für einen Dudeneintrag zu bezahlen. Nah damit verwandt ist die Strapaze, einen Artikel zu lesen, der einen aufgrund seiner Komplexität spätestens beim fünften Link den eigentlichen Grund der ganzen Suchaktion vergessen lässt. Es ist also durchaus fraglich, ob das Web den Wunsch nach Wissen in jedem Fall erleichtert hat, einmal ganz abgesehen davon, dass so mancher hartnäckige Gegner des Fortschritts das Vorhandensein verlässlicher, glaubwürdiger und v. a. seriöser Bildung im Web kategorisch bestritten hat, was in der Tat nicht verwundert, bei der Qualität bestimmter Seiten. Um die entsprechenden Bedürfnisse zu saturieren, muss man sich also vorher erst einmal u. U. eine ganze Palette von Kenntnissen aneignen, wenn man beim acht- und hemmungslosen „Wellenreiten“ nicht ungeniert wie ein Stein untergehen möchte. Auch die Gefahr zum Beispiel seine Kinder unbeobachtet auf dem „virtuellen Spielplatz“ tollen zu lassen ist schwerlich zu unterschätzen; natürlich gibt es auch hier Mittel und Wege mit Passwörtern, Filtern, „cyberNannies“ und nicht zuletzt vom Jugendschutz her Abhilfe zu schaffen, aber nicht jeder weiß das oder besitzt die nötige Kompetenz. Was also im Internet „hell“ ist, was „dunkel“, was gefahrlos konsumiert werden kann und was nicht, liegt sowohl im Auge des jeweiligen Betrachters, als es auch nicht verwundert, wenn an dieser Stelle Unmengen besorgter Eltern ihre Bedenken, v. a. eine Forderung nach mehr Kontrolle verlauten lassen.
4.2.2 aus demokratischer Sicht
Andererseits sollte man nicht vernachlässigen, dass es für die älteren Generationen insgesamt weniger selbstverständlich ist, einen „Multi User Dungeon“ (MUD) zur aristotelischen Katharsis zu nutzen, mit anderen Worten Triebabfuhr, Aggressionsentladung, Wutabbau [Anhang III]. Wie fadenscheinig einem diese Entschärfung auch vorkommen mag, oder ob man es gar für eine zweitklassige Ausrede erachtet, Fakt ist nun mal, dass es einen himmelweiten Unterschied gibt zwischen dem Großvater, der die Gräuel des letzten Weltkriegs so gut es geht verdrängt hat und dem fünfzehnjährigen, der sich in den Schützengräben einer simulierten Schlacht seine „Medal of Honor“ verdient. Auch ist der neuere scharf zu verdammende Trend zu Amokläufe n an Schulen, mit ziemlicher Sicherheit nicht nur ein Resultat von befriedigten Bedürfnissen nach Gewaltorgien, sondern ein bis in die Grundfesten unserer Sozialordnung reichendes gesamtgesellschaftliches Problem; Symptome eines Miteinanders an dem irgendetwas ganz gewaltig nicht stimmt. Einem Drang nach Mitsprache von Seiten der Erwachsenen sollte auf einer anderen Ebene dann vielmehr eine Kampagne der Aufklärung vorangehen, denn wer den Weg zur PC-Nutzung und damit ins Web immer noch nicht gefunden hat, kann sich nur auf dünner Grundlage anmaßen, ernsthaft zu beurteilen, was denn der Kampf einer „Zehn-Personen-Party“gegen Erzdämonen aus den tieferen Zirkeln der Hölle exakt für Auswirkungen auf die Psyche eines Jugendlichen hat. Unabhängig davon scheint das Beispiel Onlinemediennutzung dafür zu sprechen, zumindest eine grobe Differenzierung hinsichtlich der Alterspräferenzen einzuführen, wobei sich diese Grenze auch in zunehmendem Maße aufzuweichen scheint, da ja die Pionierjahrgänge ebenfalls schon langsam in die Jahre kommen. Wesentlich kritischer muss man aber aus genuin demokratischer Perspektive der Machtverteilung des Netzes gegenüberstehen. Auch hier scheint ein mutmaßliches Bestreben nach mehr Beteiligung, Eigeninitiative und Verantwortlichkeit inverse Kausalketten nach sich gezogen zu haben, stößt ein Engagement doch schnell an organisatorische und technische Hürden. Im Internet hat nämlich keineswegs derjenige das Sagen, der sich auf die Autorität und Legitimierung des Volkes stützen könnte, wenigstens in den allermeisten Fällen. Ergo braucht, wer sein Bedürfnis nach politischer Aktivität im mehr als kleinem Rahmen ausleben will, einen Experten dieses Mediums; und das kostet aller Wahrscheinlichkeit natürlich. Es gibt noch ein abschließendes diskussionswürdiges Gebiet im Einzugsbereich des „mündigen Bürgers“. Und zwar ist es die ebenso oft beschworene, wie wieder verworfene These nach der alles andere verdrängenden Spaß- & Erlebnisgesellschaft. Das Internet, so sagt man, hätte alle wirklich positiven und im wahrsten Sinne des Wortes „progressiven“ Ansätze Stück für Stück bereits wieder einem neuen alten Hedonismus geopfert, die verzehrgerechten Kulturgüter wie man sie aus dem sonstigen Medienkanon kennt, würden sich im Internet lediglich duplizieren und die eigentlichen Vorzüge des jüngsten Kommunikationsmittels zunehmenden in die Randbereiche abschieben. So kurz gegriffen, wie sie ist, lädt diese Provokation sicherlich ein zur Kontroverse, denn so unüberschaubar wie das Web auf absehbare Zeit bleiben wird, möchte man doch die vorsichtige Behauptung aufstellen, dass sich auch hier wieder die althergebrachte Polarisation zwischen dem sogenannten „mainstream“ und den Formen alternativer Nutzung anbahnt, insofern sie nicht ohnehin schon so von Beginn an gegeben war. Dagegen wiederum spricht, dass die Zugangsbarriere zur Selbstdarstellung, zum eigenen Webauftritt mit umfangreicher Website, sogar zum eigenen Laden, um Welten niedriger bleibt, als ein kontinuierliches Erscheinen in den älteren Medien. Schließlich ist aber noch die Frage offen, ob nicht eben jene enorme Erleichterung im Gegenzug wieder zentrifugale Fliehkräfte ausgelöst hat, welche die Kohäsion der Gesellschaft als Einheit gefährden. Das sozialintegrative allabendliche Fernsehritual weicht der spezifisch auf die Person zugeschnittenen Tour durchs Web, der dabei ergatterte Gesprächsstoff scheint nicht mehr auszureichen, um die Gleichung durch eine Zentripetalität zu ergänzen; der gemeinsame Erinnerungs- und Erfahrungsraum fehlt zunehmend. Auf der selben Strukturgeraden liegt konsequent zu Ende gedacht der Weg weg von der Zwangsvergemeinschaftung durch Natalität und hin zur individuellen Wahl der Sozialpartner, wenn auch laut Thiedeke empirische Befunde diesen Schluss vorerst noch nicht zulassen.[7]
[...]
[1] Zur „pyramid of necessities“, siehe Anhang I bzw. Zimbardo & Gerrig, loc. cit.
[2] Zu den beiden Begriffen: Deleuze & Guattari, loc. cit., insbesondere S. 12-42, ansonsten zum „Aufbrechen“ der Hierarchie, passim.
[3] So sei der „Geist des Informationalismus“ kein einheitlicher mehr, nötig wäre also eine „Vernetzung der Netze“. Castells, Informationszeitalter, loc. cit., S. 179 ff.
[4] Thiedeke, Medien, Kommunikation & Komplexität, loc. cit., S. 99 ff.
[5] In New Yorker „bourgoisen“ Kreisen politischer Entscheidungsträger räumte man damals ein, das Kernproblem wäre nicht die Zweckentfremdung fremden Eigentums, sondern vielmehr die Bedrohung der eigenen „gutbürgerlichen“ Kultur, der eigentliche Grund für das Verbot dieser „Schmierereien“, ein Beleg der Huntigtons’ berühmte These (hier: ein „Kampf der Kulturen“) im kleinen Maßstab unterstützt. Auch Castells, Jahrtausendwende, S. 398/99 sieht das Web vorrangig als Feld kultureller Schlachten.
[6] Dazu beispielsweise Hardt & Negri, loc. cit., passim, exemplarisch S. 222 ff.
[7] Thiedeke, Virtuelle Gruppen, loc. cit., S. 193 f.
- Arbeit zitieren
- M.A. Oliver Köller (Autor:in), 2008, Geopolitische Implikationen der Netzwerkrevolution, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442387
Kostenlos Autor werden
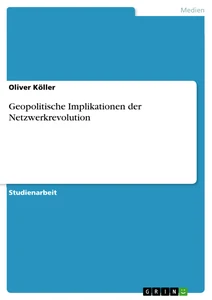

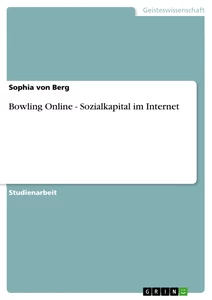

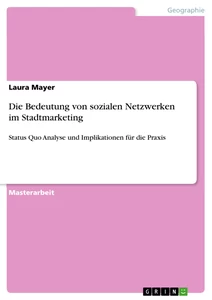

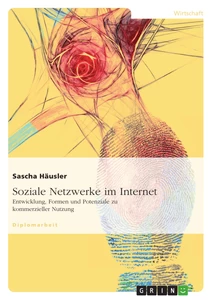



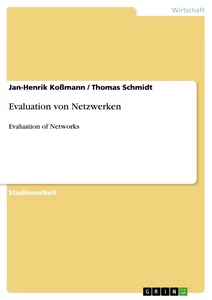
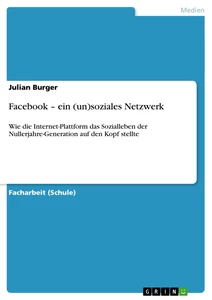








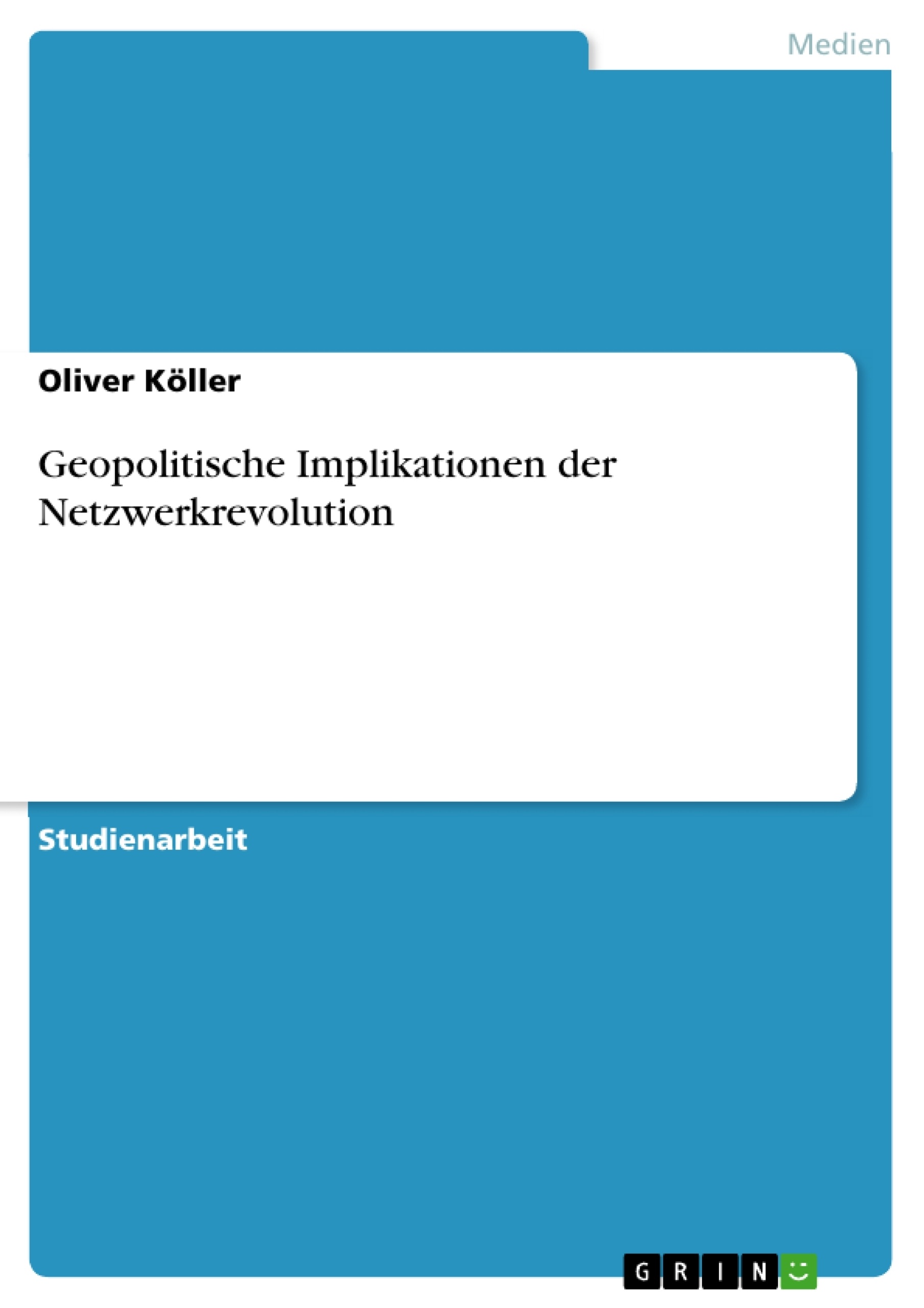

Kommentare