Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Begriff der Selbstwirksamkeit
2.2 Begriff der Depression
2.3 Epidemiologie
2.4 Diagnostik
2.5 Therapie der Depression
2.5.1 Psychotherapie
2.5.2 Pharmakotherapie
2.5.3 Nichtmedikamentöse somatische Therapieverfahren
2.6 Psychologische Testverfahren
2.6.1 Beck-Depressions-Inventar (BDI)
2.6.2 Selbstwirksamkeitserwartung nach Jerusalem und Schwarzer
3 Empirische Datenanalyse
3.1 Forschungsfrage
3.2 Beschreibung der Stichprobe
3.3 Korrelation zwischen Selbstwirksamkeit und Depression vor der Intervention
3.3.1 Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest
3.3.2 Produkt-Moment-Korrelation
3.3.3 Einfluss von Geschlecht auf die Korrelation
3.4 Prozentuale Veränderung von Depression und Selbstwirksamkeit nach der Intervention
3.5 Einfluss der sporttherapeutischen Intervention auf Depression und Selbstwirksamkeit mittels t-Test
4 Zusammenfassung und Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang 1
Anhang 2
Anhang 3
Anhang 4
Eidesstattliche Erklärung
1 Einleitung
Aufgrund ihrer Häufigkeit, den Komplikationen und ihren Folgen hat die Depression eine herausragende gesundheitspolitische und gesundheitsökonomische Bedeutung. Hierbei steht die Depression in Ländern mit mittlerem oder hohem Einkommen weltweit an erster Stelle der Krankheitslast (Müters, Hoebel & Lange, 2013, S. 1). So haben sich in Deutschland die Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aufgrund affektiver Störungen zwischen den Jahren 2000 und 2011 mehr als verdoppelt, mit einem etwas höheren Anstieg bei Frauen als bei Männern (Müters, Hoebel & Lange, 2013, S. 1).
Die Forschung der Behandlungsmöglichkeiten von Patienten mit Depressionen hat in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte gemacht, dennoch besteht in allen Bereichen der Versorgung ein Optimierungspotenzial (S-3 Leitlinie, 2015, S. 12).
Verschiedene Erhebungsinstrumente zur Erfassung psychologischer Merkmale, wie beispielsweise Persönlichkeit, Risikobereitschaft, Werte, Lebenszufriedenheit, Attraktivität, Optimismus oder Intelligenz, werden verstärkt in der Forschung eingesetzt. Auch auf das Gesundheitsverhalten und dessen Folgen haben psychologische Merkmale einen Einfluss. So können beispielsweise die Merkmale Gewissenhaftigkeit und Optimismus die physische und psychische Gesundheit, inklusive der Morbidität und Mortalität, beeinflussen. Schließlich stehen psychologische Merkmale im Zusammenhang mit der Entwicklung sowie Aufrechterhaltung psychischer Störungen, wie zum Beispiel einer Depression (Beierlein, et al. 2012, S. 5).
Aufgrund dieser vielfaltigen Beziehungen und der Nützlichkeit psychologischer Merkmale zur Verbesserung der Deskription und Prädiktion wissenschaftlich und gesellschaftlich relevanter Prozesse und Phänomene, wurden Skalen zur Erfassung psychologischer Merkmale in Untersuchungen aufgenommen. Der Bedarf an Verfahren zur Operationalisierung psychologischer Merkmale ist demnach gegeben. Problematisch ist jedoch für die Forscher, die entsprechende Merkmale erheben möchten, die Verfügbarkeit geeigneter Erhebungsinstrumente. In der psychologischen Forschung sind viele Erhebungsinstrumente bekannt, es muss bei der Auswahl jedoch auf die Gütekriterien wie Validität, Gültigkeit, Konstrukt, Reliabilität oder Messgenauigkeit geachtet werden.
In dieser Arbeit werden zunächst die psychologischen Verfahren zur Erhebung der Schwere einer depressiven Symptomatik, dem Beck-Depressions-Inventar (BDI), sowie zur Messung der Selbstwirksamkeit nach Jerusalem und Schwarzer vorgestellt. Im Anschluss erfolgt eine quantitative Datenanalyse, um zum einen den Einfluss des Geschlechtes und zum anderen einer sporttherapeutischen Intervention auf eine Depression und die Selbstwirksamkeit zu untersuchen sowie deren Zusammenhänge möglichst genau zu beschreiben und vorhersagbar zu machen.
2 Theoretischer Hintergrund
Im Folgenden werden zunächst die Begriffe der Selbstwahrnehmung und der Depression veranschaulicht. Anschließend werden einzelne Messinstrumente zur Erhebung dieser beiden Variablen skizziert.
2.1 Begriff der Selbstwirksamkeit
Der Begriff Selbstwirksamkeit (self-efficacy beliefs) bezeichnet die Erwartung bzw. die Überzeugung einer Person auf Grundlage der eigenen Kompetenz gewünschte Handlungen, schwierige Situationen und Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können.
Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung (perceived self-efficacy) wurde von Bandura (1977, 1997) als ein wesentlicher Aspekt seiner sozial-kognitiven Theorie eingeführt. Die Selbstwirksamkeitserwartung beruht dabei auf der persönlichen Einschätzung der eigenen Kompetenz. Sie bezieht sich auf alle Bereiche des täglichen Lebens, mit Schwierigkeiten und Widerständen umzugehen und kritischen Anforderungssituationen aus eigenem Antrieb erfolgreich bewältigen zu können. Die Selbstwirksamkeitserwartung stellt somit eine personale Bewältigungsressource mit effizientem Wert für das Wohlbefinden und eine konstruktive Lebensbewältigung dar (Schumacher, Klaiberg & Brähler, 2001, S. 2). Eine Förderung dieser kompetenten Selbst- und Handlungsregulation ist somit pädagogisch erstrebenswert.
Nach Bandura sind hierbei vier wesentliche Quellen für den Erwerb von Kompetenzerwartungen, die nach der Stärke ihres Einflusses in eine Rangfolge gebracht werden können, zu nennen: 1. die Handlungsergebnisse in Gestalt eigener Erfolge und Misserfolge; 2. stellvertretende Erfahrungen durch Beobachtung von Verhaltensmodellen; 3. sprachliche Überzeugungen (z.B.
Fremdbewertung oder Selbstinstruktion) und 4. die Wahrnehmung eigener Gefühlsregungen (Jerusalem & Hopf, 2002, S. 19):
Die Forschung zeigt, dass die Selbstwirksamkeit sich in vielfältiger Hinsicht positiv auf die Förderung schulischer und beruflicher Interessen, Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit, allgemeine Zufriedenheit, Lebensqualität und die Gesundheit auswirken kann. Defizite in der Selbstwirksamkeit können entsprechend zu negativen Effekten führen (Jerusalem, et al., 2009, S. 5).
Die wahrgenommene Selbstwirksamkeit einer Person ist nach Ansicht von Bandura eine wesentliche Bestimmungsgröße der Verhaltensausführung. Es wurden verstärkt Untersuchungen der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit bei dysfunktionalem Verhalten, wie beispielsweise emotionale Störungen, Panikattacken oder Phobien, durchgeführt. Hierbei konnte gezeigt werden, dass die psychologische Stressreaktion bei hoher Selbstwirksamkeit schwächer ausfällt und Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeit eher bewältigendes Verhalten aufweisen als Personen mit einer niedrigen wahrgenommenen Selbstwirksamkeit. Die Forschung wurde auf weitere Verhaltensbereiche, wie die akademische Leistung, körperliche Aktivität, Arbeitsleistung und dem Risiko- und Gesundheitsverhalten, erweitert. Es konnten die Erkenntnis gewonnen werden, dass die Höhe der Selbstwirksamkeit das Ausmaß an Anstrengung, die Ausdauer, die Art der eingesetzten Strategien und die Leistungsgüte beeinflusst (Frey & Irle, 2002, S. 285).
Nach Bandura ist von der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit eine weitere subjektive Einschätzung abzugrenzen, die Ergebniserwartung (outcome expectancy). Die Ergebniserwartung spiegelt die Erwartung einer Person wider, dass ein gezeigtes Verhalten zu angestrebten Ergebnissen führt. Die Selbstwirksamkeit und die Ergebniserwartung sind konzeptuell streng voneinander zu trennen. Da eine Person einerseits davon überzeugt sein kann, dass sein Verhalten zu einem bestimmten Ergebnis führt, sie aber andererseits das Verhalten nicht ausführen wird, wenn sie an ihrer Selbstwirksamkeit zweifelt. Die generelle, wahrgenommene Selbstwirksamkeit ist dabei als stabile und abstrakte Persönlichkeitsdisposition zu betrachten (Frey & Irle, 2002, S. 285ff).
Weiterhin ist die wahrgenommene Selbstwirksamkeit das Ergebnis eines komplexen Schlussfolgerungsprozesses. Wobei die handelnde Person neben der persönlichen Verursachung des Verhaltens ebenfalls die relativen Beiträge sozialer und situativer Einflüsse auf das Verhalten einschätzen muss. Die Selbstwirksamkeitseinschätzungen sind daher nicht unveränderbar, sondern können sich jederzeit verändern, je nachdem welche Informationen zur Verfügung stehen und wie sie in die bestehende Überzeugung über die eigene Person miteinbezogen werden kann. Es werden dazu vier verschiedene Informationsgrundlagen zur Selbstwirksamkeit unterschieden: Bewältigungserfahrungen, stellvertretende Erfahrungen, verbale Informationsvermittlung und physiologische sowie affektive Zustände (Frey & Irle, 2002, S. 288ff).
Der Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitserwartung und verhaltensregulierenden Prozessen ist durch die Selbstregulation von Motivation und Verhalten als dynamisches Zusammenspiel von selbstbezogenen Kognitionen, Handlungen sowie emotionalen Reaktionen zu verstehen. Die wahrgenommene Selbstwirksamkeit spielt dabei eine bedeutende Rolle. Dieses kommt einem Prozess der Selbstmotivation gleich, der im Wesentlichen auf einem internen Vergleich der Güte eines gezeigten Verhaltens mit einem persönlichen Standard sowie einer einhergehenden Selbstbewertung beruht. Bandura unterscheidet bezüglich der Selbstregulation von Motivation und Verhalten verschiedene intervenierende Faktoren, die sich in weitere vier Bereiche unterteilen lassen: kognitive Prozesse, Motivation, affektive Prozesse und Auswahl von Situationen (Frey & Irle, 2002, S. 291ff).
2.2 Begriff der Depression
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert die Depression als eine psychische Störung, die durch einen Zustand deutlich gedrückter Stimmung, Interesselosigkeit und Verlust an Genussfähigkeit, Schuldgefühlen und geringes Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Konzentrationsschwächen gekennzeichnet sein kann. Dieser Zustand kann über einen längeren Zeitraum anhalten oder wiederkehrend auftreten (WHO, 2017).
Die Erkrankung beeinträchtigt die Betroffenen meist in ihrer gesamten Lebensführung und hindert sie daran alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Sie leiden unter starken Selbstzweifeln, Konzentrationsstörungen und Grübelneigung. Depressionen gehen wie kaum eine andere Erkrankung mit hohem Leidensdruck einher, da diese Erkrankung in zentraler Weise das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl von Patienten beeinträchtigt (S-3 Leitlinie, 2015, S. 17).
Im internationalen Klassifizierungssystem der ICD-10 (International Classification of Diseases) werden depressive Störungen als psychopathologische Syndrome von bestimmter Dauer innerhalb der diagnostischen Kategorie der affektiven Störungen definiert. Die Hauptkategorien unterteilen sich dabei in: manische Episoden, bipolare affektive Störungen, depressive Episoden, rezidivierende depressive Störungen, anhaltende affektive Störungen, sonstige affektive Störungen und nicht näher bezeichnete affektive Störungen. Bei diesen in diagnostische Kategorien zusammengefassten Störungsbildern beziehen sich die Hauptsymptome auf eine Veränderung der Stimmung (Affektivität) bzw. des allgemeinen Aktivitätsniveaus. Die schwere Depression und die Manie bilden dabei die Pole des Gesamtspektrums. Dies kann von depressiver Niedergestimmtheit, verbunden mit gravierendem Interessenverlust und Freudlosigkeit sowie erhöhter Ermüdbarkeit bei der depressiven Episode bis zur gehobenen, expansiven oder gereizten Stimmung, verbunden mit erhöhter Aktivität bei der Manie reichen. Um eine genaue Klassifikation zu erhalten, werden weitere häufige Symptome herangezogen, deren Anzahl und Ausprägung den Schweregrad bestimmen (S-3 Leitlinie, 2015, S. 28).
2.3 Epidemiologie
Die Ergebnisse des Robert Koch-Instituts in der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1) von den Jahren 2008 bis 2011 belegen eine 12-Monats-Prävalenz diagnostizierter Depressionen bei Frauen für 8,1 % und bei Männern von 3,8 %. Der Unterschied zwischen Frauen und Männern in der Depressionsprävalenz ist hierbei als stabiles Ergebnis mehrerer Studien und Datenerhebungen zu betrachten. Frauen sind ungefähr doppelt so häufig betroffen wie Männer. Dieser Unterschied ist auch international zu beobachten (Müters, Hoebel & Lange, 2013, S. 1).
Die Unterschiede in der Häufigkeit psychischer Störungen bei Frauen und Männern beruhen auf einer Vielzahl komplexer Faktoren. Als besonders relevant werden zum einen die biologischen Ursachen, wie der Hormonstatus genannt. Hierbei können Hormonschwankungen im Zusammenhang mit reproduktiven körperlichen Vorgängen oder Reaktionen auf bestimmte Hormonspiegel bei Frauen zu depressiver Verstimmtheit im Rahmen des prämenstruellen Syndroms, postpartaler Depression oder Depressionen in der Menopause führen. Des Weiteren wird die sogenannte Artefakttheorie genannt. Diese Theorie interpretiert den Unterschied in der Depressionsprävalenz als eine künstliche Differenz aufgrund verschiedener Ursachen. Dazu zählen die unterschiedliche Beurteilung von Frauen und Männer im Rahmen eines diagnostischen Prozesses aufgrund vorhandener unterschiedlicher stereotyper Rollenzuschreibungen, was zu einer Verzerrung in der Depressionsdiagnostik führen kann. Ein weiterer relevanter Gesichtspunkt bezieht sich auf die Geschlechterunterschiede in den sozialen Lebensbedingungen und deren Wirkungen auf die psychische Gesundheit. Die wesentlichen Faktoren sind in diesem Zusammenhang die soziale Statusposition, Familie und Partnerschaft, soziale Netzwerke sowie Einflussfaktoren im Zusammenhang mit dem Erwerbsleben (Müters, Hoebel & Lange, 2013, S. 2ff).
2.4 Diagnostik
Zur Diagnosestellung kann der Einsatz einfacher und kurzer Fragebögen als diagnostische Hilfsmittel zur Früherkennung sowie zur Verlaufskontrolle einer depressiven Störung hilfreich sein. Die eingesetzten Instrumente können unter der Berücksichtigung der häufigen knappen zeitlichen und personellen Ressourcen ein adäquates Mittel sein, um schnell und effektiv das Vorliegen depressiver Beschwerden und deren Schweregrad zu Beginn und im Verlauf einer Behandlung zu erfassen. Die frühzeitige Erkennung depressiver Beschwerden ist hierbei besonders wichtig, da das Übersehen einer depressiven Störung für den Patienten schwerwiegende Folgen haben kann.
Der Einsatz der Fragebögen ist insbesondere bei Risikogruppen, wie z.B. Patienten mit persistierenden somatischen Beschwerden, bei früheren oder familiär gehäuften depressiven Episoden oder wenn aufgrund des klinischen Eindrucks der Verdacht auf eine depressive Störung besteht, sinnvoll (S-3 Leitlinie, 2015, S. 38).
Die Screeninginstrumente liefern zwar valide Hinweise auf eine mögliche depressive Störung, jedoch ist nur durch die klinische Erfassung aller Haupt- und Zusatzsymptome nach ICD-10 und der zusätzlichen Erfassung der Dauer und des Verlaufs der Symptome eine adäquate klinische Diagnosestellung möglich (S-3 Leitlinie, 2015, S. 38).
Auch wenn der Einsatz der Fragebögen sinnvoll ist, wird ein routinemäßiger Einsatz bei allen Patienten (systematisches Screening) nicht empfohlen. Der zeitliche Aufwand steht hierbei in einer ungünstigen Relation zum Nutzen (Kosten-Nutzen-Verhältnis). Dabei werden in unverhältnismäßiger Anzahl Patienten, die leichte und passagere depressive Störungen aufweisen, auffällig. Diese müssten dann wiederrum einer weitergehenden sowie umfangreichen Diagnostik zugeführt werden müssten, ohne das ein unmittelbares therapeutisches Eingreifen erforderlich ist (S-3 Leitlinie, 2015, S. 38).
2.5 Therapie der Depression
In Therapiestudien dienen zumeist die Verbesserungen auf Depressivitätsskalen als das entscheidende Remissionskriterium, jedoch sind für die Patienten auch andere Aspekte von großer Bedeutung. Über die Abwesenheit depressiver Symptome hinaus sind insbesondere eine allgemeine bejahende Lebenseinstellung (z. B. Optimismus, Vitalität, Selbstbewusstsein, Lebenswillen), die Rückkehr zum herkömmlichen psychosozialen Funktionsniveau, verbesserte Bewältigung von Alltagsstress und -verpflichtungen oder auch eine verbesserte Beziehungsqualität zu engen Bezugspersonen als weitere spezifische Therapieziele bedeutsam (S-3 Leitlinie, 2015, S. 46).
Die Behandlung einer depressiven Störung ist auf die Linderung der depressiven Symptome ausgerichtet. Die Wahl der geeigneten Behandlungsalternative richtet sich nach klinischen Faktoren, wie der Symptomschwere und dem Erkrankungsverlauf sowie der Patientenpräferenz. Grundsätzlich gibt es nachfolgende Behandlungsstrategien (S-3 Leitlinie, 2015, S. 46).
2.5.1 Psychotherapie
Die Psychotherapie hat sich in der Behandlung depressiver Erkrankungen im großen Umfang mittels unterschiedlicher Verfahren etabliert, sowohl im ambulanten, teilstationären als auch im stationären Bereich. Durch eine große Anzahl von Studien ist die psychotherapeutische Behandlung depressiver Störungen als generell wirksam belegt, wobei die Effektivität mit dem Schweregrad, der Chronizität und der Symptomausgestaltung der Depression variiert (S-3 Leitlinie, 2015, S. 96).
[...]
- Arbeit zitieren
- Christin Hoffmann (Autor:in), 2017, Untersuchung des Einflusses einer Intervention auf Depression und Selbstwirksamkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441715
Kostenlos Autor werden


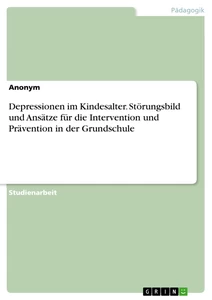

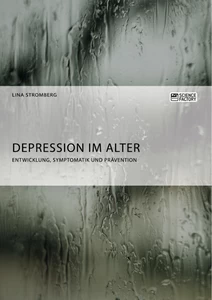
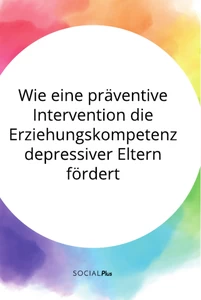

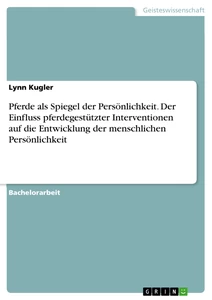




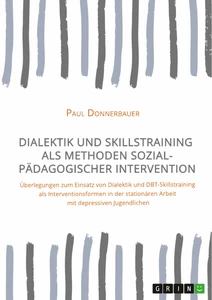
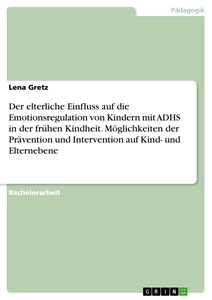
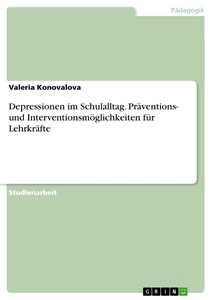







Kommentare