Leseprobe
Inhalt
1 Einleitung
2 Die Quellen
2.1 Liber ad Gebehardum von Manegold von Lautenbach
a) Das zeitliche Umfeld
b) Der Autor
c) Die Quelle
d) Die Quellenkritik
2.2 Policraticus von Johannes von Salisbury
a) Das zeitliche Umfeld
b) Der Autor
c) Die Quelle
d) Die Quellenkritik.
2.3 De regimine principum von Thomas von Aquin
a) Das zeitliche Umfeld
b) Der Autor
c) Die Quelle
d) Die Quellenkritik
3 Die mittelalterliche Rechts-, Staats- und Verfassungsvorstellung
a) Das germanisch-mittelalterliche Recht als gutes altes Recht
b) Die mittelalterliche Staatsvorstellung
c) Die Beziehung des guten alten Rechtes zum mittelalterlichen Verfassungsdenken
d) Die Aufgaben des Herrschers: Rechtsbewahrung, Rechtsbindung, Rechtsfindung
e) Das Kirchenrecht und sein Einfluss auf das mittelalterliche Recht
4 Die Lehre vom Gehorsam
a) Johannes
b) Thomas
c) Manegold
d) Resümee
5 Die Treue, die Treuepflicht und der Untertaneneid
a) Manegold
b) Johannes
c) Thomas
d) Resümee
6 ‚Volkssouveränität’ und pactum
6.1 Die Theorie der Volkssouveränität
6.2 Das pactum – der Herrschaftsvertrag
a) Manegold
b) Johannes
c) Thomas
d) Resümee
7 Schluss
8 Abkürzungsverzeichnis
9 Quellenverzeichnis
10 Literaturverzeichnis.
1 Einleitung
In der folgenden Arbeit soll das theoretisch formulierte Widerstandsrecht des Hochmittel-alters anhand von drei ausgewählten zeitgenössischen Schriften untersucht werden. Welche Ideen und Gedanken zum Widerstand gegen einen ungerechten Herrscher hatten Manegold von Lautenbach während des Investiturstreites, Johannes von Salisbury während des Konfliktes zwischen dem Erzbischof von Canterbury und dem englischen König im 12. Jahr-hundert und Thomas von Aquin während der Blütezeit der scholastischen Lehre entwickelt? Wie stellten sie sich einen legitimen Widerstand in der Theorie vor? Auf welche Grundlagen konnten sie bei der Formulierung ihrer Gedanken zurückgreifen? Als Schwerpunkte werden die Lehre vom Gehorsam, der Treuebegriff, die Theorie der Volkssouveränität und der Ver-tragsgedanke betrachtet, die in allen drei Quellen mehr oder weniger zu verorten sind. Dabei soll die Theorie dort überschritten werden, wo es um die tatsächliche Gestaltung des staat-lichen Lebens geht. Zu Beginn wird das zeitliche Umfeld, der Lebenslauf und die Quelle des jeweiligen Autors vorgestellt. Konnten Manegold, Johannes oder Thomas persönliche Erfah-rungen mit einem schlechten Herrscher sammeln und diese in ihre Schrift einfließen lassen?
2 Die Quellen
2.1 Liber ad Gebehardum von Manegold von Lautenbach
a) Das zeitliche Umfeld: Die sächsischen Fürsten[1] hatten sich gegen König Heinrich IV. (1050-1106) empört, ihn der Untreue beschuldigt und deshalb als König für abgesetzt erklärt, so dass sie in Forchheim 1077 Rudolf von Schwaben († 1080) zum Nachfolger wählten. Aber Macht und Einfluss der Fürsten reichten nicht aus, um gegen die geistige Autorität der Königsidee zu wirken. Sie konnten keine überzeugenden Argumente gegen Heinrich IV. an-führen, um ihr Handeln zu rechtfertigen. In einer Zeit tiefer religiöser Überzeugung hatten sie sich daher Papst Gregor VII. (1021-1085) als Verbündeten gesucht, um in Anlehnung an das Papsttum und in der Übernahme kirchlicher Vorstellungen ein eigenes politisches Programm zu entwickeln. Ihr Ziel war die Legitimation des Fürstentums im Allgemeinen, die Rechtferti-gung ihrer Rebellion gegen Heinrich IV. im Besonderen. Der Liber ad Gebehardum entstand in einer Zeit als Heinrich mit der Berufung Wiberts von Ravenna zum Gegenpapst Clemens III. (1080), mit dem endgültigen Sieg über Rudolf und dessen Tod (1080), mit der Einnahme Roms und der Flucht Gregors (1083), schließlich mit seiner Kaiserkrönung (1084) an poli-tischer Macht gewann und die Papstpartei dadurch an Anhänger und Einfluss verlor.
b) Der Autor: Die Quellenlage zur Person Manegold von Lautenbach[2] ist fragmentarisch und teilweise umstritten. Er wurde vermutlich zu Beginn der 1030er Jahre in Lautenbach/Elsass geboren und starb entweder am Ende des Jahres 1103 oder vor 1109/12. Nachdem er die Klosterschule in Lautenbach besucht hatte, begab er sich vermutlich als Wanderlehrer nach Frankreich. Um 1080 kehrte er in seine Heimat zurück und trat in das Benediktinerkloster in Lautenbach ein. Nach der Besetzung Lautenbachs und der Zerstörung des Klosters durch königliche Truppen 1085 fand er Zuflucht im Kloster Rottenbuch/Bayern und wurde dort zum Dekan gewählt. Im Jahr 1090 beteiligte er sich an der Gründung des Marbacher Augustiner-chorherrenstiftes, dessen erster Probst er wurde. Wegen seiner Unterstützung der Papstpartei nahm ihn Heinrich IV. 1098 eine Zeit lang in Gewahrsam. Das letzte Mal wird Manegold in einer Bulle aus dem Jahr 1103 als Propst in Marbach erwähnt. Manegold konnte aus eigener Erfahrung seine Ansichten zum Widerstandsrecht gegen einen schlechten Herrscher formulieren.
c) Die Quelle: Manegold hat den Liber ad Gebehardum zwischen 1083 und 1085 verfasst[3]. Als Anlass diente ein Schreiben Wenrichs von Trier, der im Auftrag und im Namen seines Bi-schofs Dietrich den Papst angegriffen hatte. Propst Harmann von Lautenbach wollte Wenrichs Schrift nicht unwiderlegt lassen, weil sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. Er beauftragte Manegold mit der Abfassung einer Gegenschrift, der diese dem Erzbischof Gebhard von Salzburg (ca.1010-1088) widmete[4]. Manegolds Schrift ist eine Stellungnahme im Kampf des Papsttums mit dem Königtum und gegen Wenrich im Besonderen, gegen die Königspartei im Allgemeinen gerichtet. Manegold hat darin die anmaßende Herrschaft Heinrichs IV. kritisiert. Er vertrat die Vorstellung, dass dem sacerdotium und so dem Papst das Primat in der christlichen Welt zustehe, unter dem sich das regnum unterzuordnen habe[5].
Seine Schrift umfasst 78 Kapitel. Zu Beginn hat er festgehalten, dass er nur Gedanken anderer Autoritäten zusammentragen wolle (Einleitung, S.312, Z.30f.). Neben der Verwendung der Heiligen Schrift, der Bezugnahme auf Hieronymus (LAG 29,S.365,Z.1f.) und der Übernahme des Briefes von Papst Gregor VII. an die Deutschen (31. Mai 1077) nach der Fastensynode 1076 (LAG 28,S.359,Z.14f.) diente ihm vermutlich die zwischen 1081 und 1083 geschriebene hystoria des bereits erwähnten Salzburger Erzbischofs Gebhard als Vorlage. Die hystoria ist heute nicht mehr erhalten[6]. Sie kann aber teilweise aus anderen Schriften, wie etwa aus der von Manegold, rekonstruiert werden[7]. Ebenso hat Manegold geschichtliche Beispiele aus römisch-antiker und christlicher Zeit verwendet, um seine Thesen rechtfertigen zu können.
Für unsere Fragestellung ist die Betrachtung von cap.25-30 und 47-49 entscheidend. In cap. 25-30 wird die Absetzung Heinrichs IV. behandelt. Dafür werden in cap.25-28 die politischen Ereignisse und das Verhältnis zwischen Papst und König geschildert, darauf folgt in cap.29 und 30 eine Bewertung der einzelnen Handlungen. In cap.47-49 wird die päpstliche Lösung der Treueide besprochen. Manegold hat sich vor allem darauf konzentriert, die Handlungen Gregors VII. gegen Heinrich IV. zu rechtfertigen. Der Konflikt Heinrichs mit den sächsischen Fürsten liegt ihm dabei nicht unmittelbar im Blickfeld[8].
d) Die Quellenkritik: Aus heutiger Sicht wird der Liber ad Gebehardum kritisch beurteilt. So schreibt Koch[9], „diese Schrift, als ganze vielleicht unerquicklicher und langweiliger als alle anderen, erregt in den Kapiteln, die sich mit der Absetzung Heinrichs beschäftigen, hohes Interesse durch ihre radikale politische Theorie. […] [Doch] die Gedanken sind oft unklar, das Ganze ist voll von Widersprüchen. Aber gerade dadurch wird sie dem Historiker wertvoll als ein Versuch, auf einer germanischem Denken teilweise ungewohnten Grundlage eine Staatslehre aufzubauen, unsicher und tastend, hier und dort einen Gedanken aufgreifend, ohne die Fähigkeit, das Heterogene zu einem einheitlichen System zu verschmelzen.“ Manegold ist weniger an strenger Sachlichkeit als an der Überwindung seines Gegners interessiert, so dass er vermutlich bewusst an Unwahrheiten festhielt, in jedem Fall aber „nicht ängstlich prüft[10] “.
Neben den kirchlich-religiösen Argumenten traten die rein politischen Gedanken der Fürsten zurück, weil solche als schlagkräftige Argumente gegen einen schlechten Herrscher bis dato zu wenig bearbeitet und für eine wirksame literarische Verwendung vorbereitet worden waren. Manegolds Schrift ist vermutlich „das einzige Werk der erhaltenen Schriften-Litteratur, das die Fürstenrevolution auch mit Erwägungen staatsrechtlicher Art zu rechtfertigen sucht[11].“ Deshalb hat sie vielleicht „unmittelbar nach ihrem Bekanntwerden auf beiden Seiten eine starke Beachtung gefunden […], während im Laufe der Jahre das Interesse an ihr nachlassen musste“, weil Manegolds Forderungen und Ansichten stark von den zeitlichen Ereignissen beeinflusst waren, die später „eine andere Beurteilung[12] “ erfuhren.
2.2 Policraticus von Johannes von Salisbury
a) Das zeitliche Umfeld: Nachdem der ‚tyrannische’ König Stefan von Blois (ca.1095-1154) gestorben war, ging die englische Krone 1154 endgültig an den legitimen Thronanwärter Heinrich II. Plantagenet (1133-1189) über. Während der Entstehungszeit des Policraticus zwischen 1156 und 1159 gab es in England keine ernsthaften Konflikte zwischen König und Kirche[13]. Obwohl Johannes König Stefan als einen schlechten Herrscher vorstellt, ja ihn als Tyrannen identifiziert und Heinrich dagegen als rex iustus darstellt, ihn stets lobend erwähnt, hat er auch diesen ermahnt, dauerhaft eine gerechte Politik zu betreiben (Poli.VI.18, S.49f.*[14] ). Scheinbar hatte sich bereits zu dieser Zeit eine absolutistisch anmutende Tendenz in der Politik Heinrichs angekündigt, sowie das Verlangen auch in kirchlichen Fragen einen konkreten politischen Einfluss ausüben zu wollen.
b) Der Autor: Johannes von Salisbury[15] wurde zwischen 1115 und 1120 in Old Sarum geboren. Nachdem er von 1135/36 bis zu seiner Priesterweihe 1147 vor allem in Paris und vermutlich auch in Chartres studiert hatte, war er für einen kurzen Zeitraum an der Pariser Universität tätig. Danach trat er entweder in den Dienst seines Freundes Peter ein, dem Abt von Montier-la-Celle/Troyes oder hat sich in Anschluss an die Synode von Reims 1148 im Gefolge von Papst Eugen III. aufgehalten. Sicher ist, dass Johannes noch im Jahr 1148 anhand eines Empfehlungsschreibens von Bernhand von Clairvaux in den Dienst des Erzbischofs Theobald von Canterbury (ca.1090–1161) eintrat. Wegen des anhaltenden Konfliktes zwischen Erzbischof Theobald von Canterbury, dem Oberhaupt der englischen Kirche und dem englischen König Stefan von Blois war Johannes in der Folgezeit als erzbischöflicher Beauftragter an der päpstlichen Kurie tätig, um den Papst für die Sache des Erzbischofs zu gewinnen. Nachdem Theobald im April 1161 gestorben war und Thomas Becket (ca.1118-1170) im Mai 1162 auf Wunsch König Heinrichs II. das Amt des Erzbischofs von Canterbury angenommen hatte, diente Johannes auch diesem. Allerdings zerbrach mit der Berufung Beckets zum Erzbischof und seiner nun kirchenfreundlich ausgerichteten Politik sein anfänglich gutes Verhältnis als Lordkanzler zu Heinrich[16]. Aus Furcht vor Gewalttätigkeiten und Intrigen verließ Johannes im Herbst 1163 seine Heimat und ging nach Frankreich. Wegen des sich zuspitzenden Konfliktes mit Heinrich folgte ihm Thomas Becket etwa ein Jahr später nach. Solange Thomas sich in Frankreich aufhielt, bemühte sich Johannes um eine Schlichtung des Streites zwischen den beiden Kontrahenten. Dies führte sogar zu einem Teilerfolg. Zwischen den Jahren 1169 und 1170 leitete er die Vorbereitungen zur Rückkehr des Erzbischofs nach England und reiste dafür im Herbst 1169 nach Canterbury[17]. Nachdem Thomas Becket 1170 nach England zurückgekehrt, aber am 29. Dezember 1170 ermordet worden war, hielt sich Johannes zunächst im Umfeld einiger englischer Bischöfe auf, um ab 1174 das Amt des Schatzmeisters an der Kathedrale in Exeter zu bekleiden. Mit Unterstützung des Erzbischofs Wilhelm von Sens und des französischen Königs Ludwig VII. wurde er 1176 zum Bischof von Chartres gewählt. Er starb am 11. Oktober 1180[18]. Auch Johannes konnte aus eigener Erfahrung ein Urteil über einen schlechten Herrscher bilden und daraus seine Gedanken über ein Widerstandsrecht gegen diesen formulieren. Er selbst hatte die Flucht nach Frankreich als passiven Widerstand gewählt.
c) Die Quelle: Johannes hat den Policraticus beginnend mit dem siebten und weiten Teilen des achten Buches zwischen 1156 und 1159 verfasst[19]. Als Anlass können zwei Vermutungen dienen. Johannes war, vielleicht durch eine höfische Intrige[20], in Ungnade beim König gefallen. Um Heinrichs Wohlwollen wiederzuerlangen, hat er ihn im Policraticus stets lobend erwähnt und ihn als den größten der britischen Könige gerühmt (Poli.VIII.25, S.389). Zudem versuchte er wohl mit der Widmung des Policraticus an Thomas Becket dessen Unterstützung in dieser Sache zu gewinnen. Ein anderes Anliegen von ihm war es vielleicht, den weltlich gesinnten Lordkanzler für die geistlichen Pflichten und Aufgaben eines Erzbischofs anhand des Policraticus vorbereiten zu wollen, denn Thomas Becket war bereits zu Lebzeiten Theobalds zu dessen Nachfolger designiert worden[21].
Nachdem der Leser in den Policraticus [22] mit einem elegischen Gedicht von 306 Versen unter dem Titel Entheticus [23] eingeführt worden ist, folgen als Hauptstück acht Bücher, die jeweils durch einen Prolog inhaltlich miteinander verbunden werden[24]. Für unsere Fragestellung sind die Bücher IV, V, VI und teilweise Buch VIII wichtig. Im vierten Buch und im sechsten Kapitel des fünften Buches hat Johannes die Herrscherrechte und -pflichten vorgestellt, indem er auf bekannte Bibelzitate zurückgriff, die bereits in früheren Fürstenspiegeln zu diesem Zweck verwendet worden waren[25]. So hat er hier eine umfassende Erörterung des Königs-gesetzes (Poli.IV.4,S.79f.; Dtn 17,14-20) und der Prophetenworte Hiobs (Poli.V.6, S.207f.; Hiob 29,7f.) vorgenommen. Daneben führt er im fünften Buch die Organismuslehre ein, die er nach eigener Angabe aus der institutio Trajani von Plutarch geschöpft habe (Poli.V.2, S.163f.). Im sechsten Buch bezieht er diese speziell auf die Kriegsleute und die staatlichen Beamten, um dann erneut eine Betrachtung über das Wesen des Staates und die Pflichten des Herrschers anzustellen. Schließlich hat Johannes im achten Buch das Wesen der Tyrannis aufgedeckt[26]. Im Policraticus wird das Verhältnis zwischen Kirche und Königtum, der Unter-schied einer gerechten und ungerechten Herrschaft und die grundsätzliche Unverzichtbarkeit einer stabilen, auf Recht, Gerechtigkeit und Billigkeit basierenden Rechtsordnung erörtert[27].
Als Referenzen hat Johannes die Autoritäten der klassischen Antike, die Worte der Heiligen Schrift und die der Kirchenväter verwendet. Ebenso hat er sein Wissen um das Römische Recht in den Policraticus einfließen lassen, das er vermutlich, neben der Heiligen Schrift, als Niederschrift der lex divina ansah[28]. Darüber hinaus konnte er auch auf persönliche Erfah-rungen und Erlebnisse während seiner Studienzeit in Frankreich und im Dienst des Erzbi-schofs Theobald stehend, wo ihm die Korrespondenz und dessen Vertretung in juristischen und politischen Belangen oblagen, zurückgreifen. Durch diese Tätigkeit fand er zudem Zutritt zum englischen Hof, so dass er die Regierungsweise König Stefans und die König Heinrichs II. kennenlernte. Seine Weltanschauung ist daher nicht einseitig aus theoretischen Schriften gewonnen, sondern setzt sich aus der Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis, Idee und Tatsache zusammen[29]. Allerdings sind die Bezüge zur Gegenwart, speziell auf England im Policraticus selten. Damit steht Johannes aber in der Tradition der Fürstenspiegel, die „eine nicht an die Gegenwart und nicht an einzelne Staaten gebundene Geltung[30] “ in Anspruch nehmen wollen, sondern einer universellen Aufgabe, der Anleitung zur Regierung und zur Erziehung des Herrschers, dienen sollen. Die Fürstenspiegel sind rein theoretische Schriften zur Staatspolitik.
d) Die Quellenkritik: Der Policraticus ist vielleicht der erste englische Fürstenspiegel[31] und mit 113 Handschriften sehr gut überliefert. Vermutlich war er für einen Leserkreis bestimmt, der nicht nur über Kenntnisse der Heiligen Schrift und der Kirchenväter, sondern auch über die antike Literatur verfügte, so dass Johannes großzügig mit seinen Quellen umgehen konnte, indem er sie entweder wörtlich zitierte, als Referenz heranzog oder einfach erfand[32]. Dazu schrieb er im ersten Prolog, „wenn etwas allzu unglaubwürdig ist, vertraue ich darauf, dass man mir Nachsicht schuldet, der ich nicht verspreche, alles, was hier geschrieben wird, sei wahr, sondern es diene, wahr oder falsch, dem Nutzen der Leser. […] Ich bekenne, dass ich mich dienstfertiger Lügen bedient habe, und […] stimme zu, wenn ich der Lüge beschuldigt werde[33].“ Johannes wollte so mit seiner Schrift teils lehrend, teils mahnend wirken, aber nicht dem Urteil des Lesers voraus greifen, denn dieser sollte sich selbst ein Urteil bilden. Daher hat er sich nicht auf eine bestimmte Lösung festgelegt, sondern mehrere verschiedene Möglichkeiten als Lösung vorgestellt, die sich durchaus auch widersprechen[34]. Der Leser sollte zur Lösung eines Problems in der Praxis wie in der Theorie jedes Mal neu sein Gewissen erforschen, um die möglichste Wahrscheinlichkeit der Wahrheiten in Erfahrung zu bringen und danach zu urteilen und zu handeln. So hat Seit[35] treffend erklärt, dass bei Johannes die „unübersehbare Tendenz, widersprüchliche Auffassungen miteinander zu ver-mitteln, nicht lediglich Ausdruck von diplomatischer Vorsicht oder gar von Unkenntnis und Entscheidungsschwächen [sind] (obwohl ihm gerade dies immer wieder vorgeworfen wurde), sondern einen intellektuellen Habitus [darstellen], den Johannes im Horizont einer von ihm selbst als >akademisch<, d.h. skeptisch, bestimmten probabilitischen Sichtweise gut zu be-gründen versteht: Demnach entstehen unlösbar erscheinende Konflikte im praktischen wie im theoretischen Bereich daraus, dass die Wahrheits- und Geltungsansprüche der beteiligten Po-sitionen übersteigert werden, unter Verkennung der grundsätzlichen Begrenztheit der mensch-lichen Vernunft, deren Erkenntnisse […] niemals logisch notwendig sind, sondern stets in spezifischen Kontexten gewonnen werden und deshalb kontextabhängige Geltung besitzen.“
Johannes hat mit dem Policraticus vermutlich „die erste umfassende und daher sehr einfluss-reiche Erörterung staatsphilosophischer Fragen[36] “ gebracht, so dass seine Schrift eine weite Verbreitung fand und jahrhundertelang die Staats- und Moralphilosophie beeinflusste[37].
2.3 De regimine principum von Thomas von Aquin
a) Das zeitliche Umfeld: Vermutlich hat Thomas den Fürstenspiegel zwischen 1265 und 1266 in Rom verfasst. Als Adressat wird der König des Kreuzfahrerstaates Zypern genannt. Dabei ist unklar, ob Hugo III. oder sein Vetter Hugo II. angesprochen werden sollte[38]. Hugo III. von Antiocheia-Lusignan war seit 1267 König von Zypern und seit 1268/69 König von Jerusalem. Beide Ämter hat er bis zu seinem Tod 1284 bekleidet. Bereits seit 1261 nahm er dabei das Amt des Regenten[39] in Zypern für seinen Vetter Hugo II. (†1267) ein. Ebenso war er seit etwa 1264 Regent über Jerusalem[40]. Die politische Lage in Zypern um die Mitte des 13. Jahrhunderts lässt sich nicht sicher rekonstruieren. Die Zyprioten hatten 1233 die Verfassung von Jerusalem übernommen, um einen Aufstand gegen ihren Herrscher juristisch legitimieren zu können. Denn nach dieser durfte der Herrscher keine Maßnahmen ohne Bewilligung seiner Vasallen treffen. Diese verweigerten ihm aber die Zusammenarbeit, so dass er handlungs-unfähig wurde und die Monarchie sich quasi auflöste. Die Situation etwa dreißig Jahre später ist schwer zu beschreiben. Vermutlich habe Anarchie geherrscht, so die Meinung von Chenu[41]. Eine Stärkung der königlichen Stellung war also notwendig.
b) Der Autor: Thomas von Aquin[42] wurde 1224/25 in Roccasecca/Neapel geboren. Nachdem er eine Erziehung bei den Benediktinern genossen hatte, begann er 1238 an der Universität in Neapel zu studieren. Im zwanzigsten Lebensjahr trat er in den erst 1215 gegründeten Domini-kanerorden ein. Doch seine Familie missbilligte diesen Entschluss, weil ihm damit eine angesehene Laufbahn in der Kirche verschlossen war. Auf dem Weg nach Paris, wo er seine Studien fortführen wollte, wurde er deshalb von seinen Angehörigen entführt und musste eine einjährige Haushaft erdulden. Danach konnte er sein Studium von 1245 bis 1248 in Paris und später in Köln bei Albertus Magnus, in dessen Vorlesungen er die aristotelische Philosophie kennenlernte, fortsetzen. Nach Paris kehrte er 1252 zurück, wo er bis 1256 als baccalaureus studierte und dann als Magister an der theologischen Fakultät tätig wurde. Im Laufe der Zeit wirkte er bald an der Pariser Universität, bald im Auftrag seines Ordens in Italien. Vermutlich in Verbindung mit einem gesundheitlichen Zusammenbruch erlebte Thomas am 6. Dezember 1273 eine innere, geistige Erfahrung. Danach war es ihm nicht mehr möglich Schriften zu diktieren, so dass viele seiner Werke unvollendet blieben. Im Auftrag des Papstes reiste der bereits erkrankte Thomas Ende Januar 1274 zum 2. Konzil nach Lyon. Auf der Reise hatte er aber einen Unfall und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich, so dass er am 7. März in der Zisterzienserabtei Fossanuova starb. Sein Leben wurde einerseits durch die Zugehörigkeit zum Dominikaner Orden, andererseits durch seine Tätigkeit als Professor für Theologie an der Pariser Universität bestimmt. Die sozialen und politischen Ereignisse seiner Zeit hat Thomas deshalb nur im Raum der Universität und des Ordens wahrgenommen[43], so dass er wohl auf keine persönliche Erfahrung mit einem schlechten Herrscher zurückgreifen konnte und stattdessen die Tyrannis vor allem in den Schriften Aristoteles kennengelernt hatte.
c) Die Quelle: Die Unruhen in Zypern und die dortige schwache Monarchie könnten als An-lass für die Abfassung des Fürstenspiegels gedient haben. Weißert[44] vermutet, dass Thomas von Papst Urban IV. den Auftrag dazu erhalten habe. Leider begründet er seine These nicht. Aber nachvollziehbar wäre, dass der Papst für politische Unternehmungen ins Heilige Land einen festen Stützpunkt in Zypern für die Kreuzfahrer haben wollte. Vor diesem Hintergrund ist die Funktion der Schrift als Legitimation der Herrschaft des Königs in Zypern zu sehen. Thomas selbst gibt keine näheren Gründe an, mit welcher Zielsetzung er den Fürstenspiegel verfasst hat. Vermutlich wollte er den König von Zypern bei der Errichtung einer Monarchie und im politischen Kampf gegen die zypriotischen Magnaten stärken[45]. Allerdings hat er in seiner Schrift kein zweites Mal einen Bezug auf Zypern oder dessen König unternommen.
Zu Beginn des Fürstenspiegels werden in einer kurzen Einführung die zu behandelnden Themen und der Adressat benannt. Als Hauptstück folgen zwei Bücher. Das erste Buch ent-hält 15 Kapitel, das zweite bricht nach dem vierten Kapitel ab[46]. Nachdem Thomas begründet hat, warum die Menschen einer staatlichen Gemeinschaft bedürfen (I.1) und er die Monarchie als beste Staatsform favorisiert (I.2), greift er im Sinn der scholastische Methodik „Sic et Non“ den Gegensatz der Monarchie, die Tyrannis auf (I.3). Der Unterschied zwischen Monar-chie und Tyrannis ist, dass der König das Gemeinwohl seines Volkes, der Tyrann aber das Eigenwohl anstrebe. Nachdem Thomas den Übergang von der Tyrannis zur Aristokratie bei den Römern als geschichtlichen Erfahrungsbericht geschildert hat (I.4), begründet er, warum eine Tyrannis öfters dann entstehe, wenn mehrere regieren als wenn nur einer die Herrschaft ausübt (I.5). Darauf gibt er Ratschläge zur Vermeidung einer Tyrannis (I.6). Ob Ehre und Ruhm (I.7) oder stattdessen die himmlische Seligkeit (I.8,9) dem König ein angemessener Lohn sein könne, wird von Thomas ausführlich besprochen. Dabei erwarten den König bereits im Diesseits Freundschaft, Reichtum, Ehre, Ruhm und eine lange Herrschaft. Dagegen wird der Tyrann diesen Gütern nicht teilhaftig wegen seinen Untugenden und seiner schlechten Regierung (I.10,11). Danach behandelt Thomas das Königsamt und die allgemeinen Regierungsaufgaben (I.12-15), die er schließlich genauer betrachtet und vertieft (II.1-4). Für unsere Fragestellung wird der Schwerpunkt auf dem ersten Buch des Fürstenspiegels liegen.
Thomas hat Metaphern und Gleichnisse zur Natur und Vernunft als Belege für seine Thesen verwendet, die er in den Werken Aristoteles, Augustinus oder in der Heiligen Schrift kennen-gelernt hatte. Als Erfahrungsbericht griff er auf die römische Antike und deren Autoren wie Cicero und Sallust zurück.
d) Die Quellenkritik: Wilhelm von Mörbeka († gegen 1300) hatte die aristotelische Schrift über die Politik entdeckt und auf Wunsch von Thomas aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt[47]. Obwohl Thomas nie eine Vorlesung über Aristoteles gehalten hat, kommentierte er dessen Hauptwerke. Als seine Aufgabe betrachtete er es, die Schriften Aristoteles zu verteidigen und zu korrigieren, sowie dessen Gedanken und Thesen nutzbar für das Studium der Theologie zu gestalten. Sein Ziel war es, eine realistische Philosophie anhand der aristotelischen Schriften und der theologischen Grundsätze zu entwickeln. In Form einer höheren Synthese hat er deshalb Meinungen verbunden, die sich in seinen verwendeten Quellen widersprachen. Der Fürstenspiegel wurde seiner Gattung entsprechend von Thomas in einem allgemeinen Rahmen verfasst, so dass er auch von anderen Herrschern, unabhängig vom Adressaten, dem König von Zypern, als Richtschnur herangezogen werden konnte, um eine theoretische Grundlage für ihr Amt und ihre Herrschaft zu erhalten.
3 Die mittelalterliche Rechts-, Staats- und Verfassungsvorstellung
Als Ausgangspunkt zum mittelalterlichen Widerstandsrecht wird das Rechtsdenken der Zeit betrachtet, denn die Vorstellung über Recht und Unrecht war damals eine andere als sie es heute ist. Dabei lassen sich zwei Auffassungen, die germanische und die kirchliche, für das Recht wie auch für das Widerstandsrecht unterscheiden, die teils Verbindendes, teils Gegensätzliches enthalten[48]. Ebenso sind zeitliche Differenzierungen festzustellen. Obwohl die damalige Weltanschauung auf einer einheitlichen Geschlossenheit des Weltbildes beruhte, lassen sich für die Rechtsvorstellung drei Zeitstufen benennen. Nachdem das Gewohnheits-recht im Frühmittelalter dominierte, diente das Recht im Hochmittelalter als erzieherisches Heilmittel in der christlichen Lehre, um eine religiöse Erlösungskultur und -politik zu verwirklichen. Während des Spätmittelalters wurde es mehr und mehr als geschriebenes und staatliches Recht technisiert. Es kam zu einer verstärkten Differenzierung, indem zwischen positivem Recht und Naturrecht unterschieden, das objektive Staatsrecht von den subjektiven Privatrechten und jeweils vom Begriff des Guten und des Alten gelöst wurde[49].
Der christliche Leitgedanke des Mittelalters, die Erlösung vom Materiellen und Irdischen und die Hinwendung zu Gott und zu den göttlichen Dingen, konnte sich auf dem Rechtsgebiet nicht vollständig entwickeln. Am Deutlichsten wurde wohl die Verbindung des christlichen Erlösungsgedankens mit dem Bereich des Rechtes in den teils wirklichkeitsfernen Spekulationen der Fürstenspiegel vollzogen, die eine Herrscher- und Staatsethik, teils auch eine Rechtsphilosophie enthielten. Dagegen kann der christliche Erlösungsgedanke in den Schriften der rechtskundigen Laien und Juristen kaum aufgespürt werden, weil das sachliche Rechtsgebiet dem mittelalterlichen Fühlen fern lag und sich nur teilweise spiritualisieren ließ[50].
Neben den Erläuterungen zur mittelalterlichen Rechts- und Verfassungsvorstellung werden einige Belege aus dem IV, V und VI Buch des Policraticus von Johannes von Salisbury als Vergleich und Ergänzung angeführt. Johannes hat darin einige Grundzüge des Rechtes seiner Zeit und die rechtliche Stellung des Herrschers angesprochen. Als Mann der Kirche und Anhänger der Hierokratie gibt er aber das göttliche Gesetz (lex divina) statt das gute alte Recht als oberste Richtschnur an[51]. Diese begriffliche Differenzierung soll aber nicht weiter irritieren. Stattdessen dürfen die Begriffe Gesetz und Recht mehr oder weniger gleichwertig gelten[52]. Ebenso vertritt der im 12. Jahrhundert lebende Johannes bereits die zweite Zeitstufe der Rechtsvorstellung, in der, wie bereits erwähnt, das Recht mit der christlichen Lehre und den göttlichen Gesetzen verflochten wurde, um es als erzieherisches Mittel zur Erlangung des höchsten Gutes in Gott (summum bonum) zu nutzen. Vermutlich fühlte er sich auch mehr dem göttlichen Gesetz, wie es die Heilige Schrift belegt, und weniger einem weltlichen, einem von Menschen gefundenen Recht verpflichtet. Zu Johannes mutmaßlicher Abneigung gegen das Gewohnheitsrecht und einer einzelstaatlichen Gesetzgebung sei später mehr gesagt. Was hat der Mensch des Mittelalters nun unter ‚Recht’ verstanden? Was hat das gute alte Recht für die damalige Verfassung bedeutet?
a) Das germanisch-mittelalterliche Recht als gutes altes Recht
In Fachkreisen ist umstritten, ob das altgermanische Wort für Recht ê mit aequus (billig, recht, gerecht) oder mit aevum (Ewigkeit) zusammenhängt. Nach Kern[53] würden beide Übersetzungen in der mittelalterlichen Vorstellung fast dasselbe beinhalten, „denn was von Ewigkeit her bestand, ist billig, und was billig ist, muss […] auf ewige Ordnungen“ ruhen. Etwas Vergleichbares im Sinn, aber mit anderen Worten findet sich bei Johannes, der bestimmte, dass die Gerechtigkeit Gottes (iustitia Dei) Gerechtigkeit in Ewigkeit sei (iustitia in aeternum) und die Billigkeit (aequitas) sein Gesetz (Poli.IV.2, S.63)[54]. Aus sachlichen Gründen hat Kern der Übersetzung von ê mit aequus den Vorrang gegeben, weil das mittelalterliche Rechtsdenken nicht zwischen Recht, Billigkeit, Staatsvernunft und Sittlichkeit unterschieden habe[55]. Während die damaligen Gelehrten den Gegensatz zwischen den antiken Rechtsideen und dem lebendigen Gewohnheitsrecht ihrer Zeit erfasst, das positive Recht um das Naturrecht ergänzt und kontrovers gegenüber gestellt hatten, war das allgemeine Rechtsdenken frei von diesen Differenzen und hat das Recht als etwas Ganzes und Eines begriffen[56]. Das Recht wurde durch die Eigenschaften des Alters und des Gutseins bestimmt. Beide Merkmale galten dabei als eine einzige, einheitliche Eigenschaft. Das Recht wäre also kein Recht, wenn eine der beiden Eigenschaften fehlen würde, selbst dann, wenn es vom Herrscher formal bestimmt worden wäre. Das Recht wurde in den Gewohnheiten[57], sprich in den Erinnerungen der ältesten und glaubwürdigsten Leute, und in den leges patrum gefunden. Als Erinnerungshilfe konnten Urkunden und Rechtsbücher dienen, die aber nicht zwingend notwendig waren[58], weil das Recht ungesetzt und ungeschrieben war[59].
Als wesentliche Eigenschaft für das objektive Recht hatte das Alter gegolten[60]. Doch war der Begriff des alten Rechtes mehr ein Gütemerkmal als eine Zeitbestimmung, denn dasjenige Recht, das als besser angesehen wurde, galt bis zu seiner Widerlegung als älteres Recht[61]. Für das subjektive Recht war die Zugehörigkeit zu den leges patrum maßgebend. Allerdings unterschieden die Zeitgenossen nicht zwischen objektivem und subjektivem Recht[62], statt-dessen hatte das objektive Recht alle subjektiven Rechte sämtlicher Untertanen enthalten. Das objektive Recht war die Summe aller subjektiven Rechte[63]. Daneben ist noch die fehlende Differenz von positivem und idealem Recht zu ergänzen[64]. Auch Johannes hat diesen Unter-schied nicht vollzogen als er schrieb, dass das Recht (ius) „nach dem Idealbild der Billigkeit (aequitas) eingerichtet werden“ soll (Poli.IV.7, S.113). Unter dem Recht wurden das sittliche Empfinden, das Richtige, das Gerechte, das Vernünftige und das Gute mitgedacht. Das Recht war göttlich, natürlich, moralisch und positiv[65]. Dabei galt das Gutsein auch als Grundlage für den Staat[66].
Obwohl das Dasein von ungerechtem und schlechtem Recht über einen langen Zeitraum den Zeitgenossen zu der Erkenntnis verhalf, dass Gewohnheit und Alter allein noch kein gutes Recht gewähren, hatten sie dennoch geglaubt, dass vor einem lang andauernden Unrecht zuerst ein gutes Recht bestanden habe. Damit war der Unverjährbarkeitsgedanke als zunächst kirchliche Überlegung in die germanische Rechtsvorstellung eingedrungen[67]. Die Zeitgenos- sen folgerten nun daraus, dass das gute Recht nicht durch menschliche Erwägung gesetzt sein könne, sondern von Gott stammen müsse. Das Gesetz ist von Gott erdacht und sein Geschenk an die Menschen, so hat es Johannes in Anschluss an die Griechen Papianus und Demos-thenes formuliert (Poli.IV.2, S.63). Gott allein war der Ursprung allen Rechtes, nicht der Staat und nicht der Herrscher oder irgendein menschlicher Gesetzgeber. Im Recht wurde die ewige, heilige Gerechtigkeit gesehen, die im göttlichen Dienst stehend jedem das Seine zuspricht (suum cuique), um die von Gott gegebene Gesellschafts- und Werteordnung[68] (ordo) und den Frieden (pax) zu wahren. Das göttliche Gesetz lege, so Johannes, die Gerechtigkeit (iustitia) und die Billigkeit (aequitas) aus und die Billigkeit teile jedem das Seine zu (Poli.IV.2, S.63). Weil das gute Recht in Gott seinen Ursprung hatte, war es unverjährbar, unerschütterlich und unabhängig von menschlichen Gesetzgebern und Richtern. Auch wenn diese das gute Recht verdunkeln und verdrehen mochten, konnten sie es nicht beseitigen. Denn das gute Recht war auch in Zeiten der Verdunkelung vorhanden. Unrecht und schlechtes Recht galten niemals mehr als eine Verdrehung des guten Rechtes[69]. Die Zeitgenossen kannten daher auch keinen Termin der Setzung oder Außerkraftsetzung eines Rechtssatzes[70], weil das gute Recht immer existierte, aber erst gefunden werden musste, um dann zur Geltung gelangen zu können.
b) Die mittelalterliche Staatsvorstellung
Der Staat ist im Mittelalter gleichbedeutend mit der Monarchie. Die damaligen Menschen kannten aus eigener Anschauung nur die Monarchie als Regierungsform von größeren Staaten. Zudem konnten sie bezüglich des Staates nicht in abstrakten Begriffen, sondern nur in konkreten persönlichen Vorstellungen denken, so dass der Staat als Handelnder und Willensträger nur im Herrscher gesehen wurde[71]. Daher war auch nicht der Staat, sondern die Person des Herrschers Rechtssubjekt[72]. Den modernen Staatsbegriff kannte das Mittelalter da-gegen nicht[73]. Diese allgemein gültige Vorstellung des Staatswesens kann beispielhaft an der Organismuslehre von Johannes veranschaulicht werden. Johannes war davon ausgegangen, dass die Menschen sich zueinander wie die Gliedmaßen eines Körpers verhalten würden (Poli.IV.1, S.59). Der Staat stellt so einen Körper dar (corpus rei publicae), dessen Haupt (caput) der Herrscher ist, der ihn mit Vernunft (ratio) lenkt. Die Seele (anima) des Staats-körpers sind die Priester, die ihm die notwendige Lebensfähigkeit verleihen (Poli.V.2, S.165). Daraus folgerten Johannes und seine Zeitgenossen, dass der Herrscher über den Leib, nicht aber über die Seele und das Seelenheil seiner Untertanen gebieten dürfe[74]. Neben anderen Vorstellungen hatte auch diese zum Konflikt zwischen der staatlichen und kirchlichen Autori-tät und sogar zum behaupteten Primat der Kirche vor dem Herrscher und dem Staat geführt[75]. Obwohl Johannes in der Organismuslehre die Priester über den Herrscher gestellt hat, wertet er ihn und den Staat gegenüber der Kirche nicht ab, sondern versucht beiden Machtsphären ihre jeweils eigenen Funktionen und Tätigkeitsfelder zu zusprechen[76]. Nachdem Haupt und Seele als die wesentlichen lebentragenden Organe des Staatskörpers vorgestellt worden sind, wird der Senat als dessen Herz (cor) benannt. Welche Vorstellungen Johannes bei der Einrichtung des senatus vorgeschwebt haben, ist nicht genau zu bestimmen, denn im Mittelalter gab es weder einen Senat noch eine Volksvertretung im römisch-antiken Sinn. Vielleicht hat er darunter den consensus fidelium als beratende Versammlung des Herrschers verstanden. Die Zöllner, Amtsdiener und Hilfsbeamten sind die unbewaffnete, die Kriegsleute die bewaffnete Hand (Poli.VI.1, S.265). Die Bauern und Handwerker stellen die Füße dar (Poli.VI.20, S.285f.). Die Richter und Provinzvorsteher sind Augen, Ohren und Zunge. Die Finanzverwaltung wird vom Magen und von den Eingeweiden repräsentiert (Poli.V.2, S.165f.). Nachdem Johannes einen guten, gottesfürchtigen Staat beschrieben hat, stellt er auch einen schlechten, gottlosen Staat vor (Poli.VIII.17, S.311f.). Darin ist der Tyrann das Haupt und das Abbild des Teufels, der nicht die göttlichen Gesetze befolgt. Die Seele wird von häretischen, schismatischen und gotteslästerlichen Priestern verkörpert. Das Herz sind gewissenlose Ratgeber. Als Augen, Ohren, Zunge und unbewaffnete Hand agieren ungerechte Beamte. Die bewaffnete Hand wird von gewalttätigen Kriegsleuten geführt. Die Füße stellen diejenigen Bauern und Handwerker dar, die den göttlichen Vorschriften und den rechtmäßigen Einrichtungen widerstreiten.
Die Körper-Staat-Metapher war nicht neu und Johannes selbst hat die insitutio Traiani von Plutarch als Referenz dafür erwähnt (Poli.V.2, S.163f.). Die Metapher wird von der Vorstellung getragen, dass die Mitarbeit jedes einzelnen Körper- wie Staatsgliedes an seinem jeweiligen Standort notwendig für das Fortbestehen des Ganzen ist. Sobald aber ein Glied seine Aufgabe nicht erfüllen würde, hätte nicht nur das Einzelglied, sondern der ganze Körper darunter zu leiden (Poli.VI.20, S.289; VI.25, S.73*; VI.29, S.89*). Der Einzelne ist so ab-hängig vom Ganzen wie das Ganze abhängig vom Einzelnen ist. Die Körper-Staat-Metapher wird von Johannes aber nur bezüglich der Zusammensetzung und –arbeit, der den Staat aufbauenden Glieder wahrgenommen[77]. Sobald der Staat als Willensträger angesprochen wird, gibt er das Bild von einem organisch organisierten Staat auf. Der Staatsorganismus selbst kann für ihn nicht Träger eines staatlichen Willens, nicht Handelnder des Staates, nicht staatliches Rechtssubjekt sein. Dies ist allein dem Herrscher vorbehalten. Daher hat Johannes die Kriegsleute und die Beamten als Hände des Herrschers, nicht als Hände des Staatskörpers bezeichnet (Poli.VI.1,S.267) und eine Misshandlung der Bauern und Handwerker als Fußgicht des Herrschers, nicht als Erkrankung des Staatskörpers gedeutet (Poli.VI.20,S.287). Der Herrscher ist nicht nur das Haupt des Körpers, sondern die Verkörperung des ganzen Staates selbst (Poli.V.2, S.163). Er allein trägt die Verantwortung für alle Stände (Poli.IV.1, S.59) und mit seiner Sittlichkeit und Tugend steht oder fällt die des Staates[78]. Damit entsprach Johannes der allgemeinen mittelalterlichen Vorstellung. Er hat seine Organismuslehre wie folgt zusammengefasst:
„Da […] [die] Amtsgewalt [des Herrschers] allgemein ist, schöpft sie die Kräfte aller aus und muss, damit sie nicht in sich fehlerhaft ist, für die Unversehrtheit aller Glieder Sorge tragen. Der fürstliche Körper hat aber gleichsam so viele Glieder, wie es Aufgaben bei der Verwaltung der fürstlichen Herrschaft gibt. Solange er aber durch seine makellose Tugend und seinen guten Ruf seine einzelnen Untertanen im Stand erhält, ihre Aufgaben zu erfüllen, bringt er gleichsam eine gewisse Gesundheit und Zierde der Glieder hervor. Wenn der Herrscher aber nachlässig ist oder über die Aufgaben hinwegsieht und deshalb seine Tugend oder sein Ruf einer Einbuße erfährt, befallen seine Krankheiten und Fehler gleichsam die Glieder. Die Unversehrtheit des Hauptes hat auch nicht lange Bestand, wo die Trägheit der Glieder die Oberhand gewinnt (Poli.IV.12, S.161).“
Daneben hat Johannes ergänzend die Natur als Vorbild für den Herrscher in seiner Regierung erwähnt (Poli.V.9, S.237). Weil der Staat aber kein Naturding, sondern ein „ethisches Projekt[79] “ ist, muss die bloße Naturnachahmung überschritten und der Staat unter ein gött-liches wie vernünftiges Gesetz gestellt werden, um eine dauerhafte Herrschaft zu gewähren. „Der Anfang jeder einzelnen Sache ist also in der Natur gegründet […]. Der Fortschritt geht aus der Übung, Vollendung aus der Kunst hervor (Poli.VI.19, S.58*). Wie das Gleichnis der Bienen und das Beispiel der Königin Dido von Karthago zeigen, so soll der Herrscher die Natur nachahmen, aber auch klug und nicht leichtfertig handeln (Poli.VI.22, S.295f.). In Anschluss an Vergils[80] Bienenstaat erkannte Johannes zudem, dass ohne einen Herrscher kein Staat und keine Treue bestehen würde (Poli.VI.21, S.295). Dennoch wurde bereits vor und während des Investiturstreites der Gedanke formuliert, dass die staatliche Obrigkeit eine über der Herrscherperson stehende Würde sei[81]. Trotz dieser Vorstellung überwog aber im staatsrechtlichen Denken der Zeit das personale Element über dem abstrakten[82].
c) Die Beziehung des guten, alten Rechtes zum mittelalterlichen Verfassungsdenken
Das Recht war souverän, der Staat aber nicht. Staat und Herrscher standen unter dem Recht. Sie dienten zur Verwirklichung des Rechtes und waren von ihm abhängig. Sie hatten sich aus dem Dasein des über ihnen stehenden Rechtes abzuleiten[83]. Der Herrschaftsanspruch wurde aus der Autorität des Rechtes gezogen[84]. „Das Recht macht die Obrigkeit[85].“ Die Machtvoll-kommenheit und die Beurteilung des Herrschers, ob er wegen seiner Entschlüsse und Hand-lungen als gerecht oder ungerecht, gut oder schlecht angesehen werden musste, waren vom Ansehen des Rechtes (Poli.IV.1, S.61) und vom Rechtsempfinden der Untertanen abhängig. Deshalb konnte sich neben dem guten alten Recht kein Staatsrecht etablieren, denn nur das Recht als solches hatte Bestand[86]. Weil der Staat kein Recht sui generis besaß, durfte der Herrscher weder, im modernen Sinn, Privatrecht mit Hilfe des Staatsrechtes brechen noch das Privatrecht ändern. Denn alle Privatrechte galten dem Staat und so dem Herrscher als Grund-rechte. Alle (subjektiven) Rechte waren verfassungsmäßig geschützt und unantastbar durch das (objektive) Recht[87]. Staats- und Privatrecht wurden wie objektives und subjektives Recht als Einheit wahrgenommen. Die „Einheit und Unteilbarkeit aller (subjektiven) Rechte in dem (objektiven) Recht[88] “ ist die Grundlage des mittelalterlichen Verfassungsdenkens. Obwohl der Herrscher das Haupt und die Verkörperung des Staates war, durfte er das gute alte Recht nicht willkürlich ändern, sondern musste es finden und wahren. Diese zwei Pflichten und die darin liegende Beschränkung des Herrschers hat auch Johannes in zwei Metaphern benannt, wo es heißt: „denn der gewissenhafte Leser [der Herrscher] ist Schüler des Gesetzes, nicht Lehrer, und er spannt das Gesetz auch nicht auf sein Verhältnis wie einen Gefangenen auf die Folter, sondern er passt seine Verständnisweisen der Absicht des Gesetzes und seiner ungeschmälerten Geltung an (Poli.IV.7, S.111).“ Der Herrscher habe dem Gesetz zu gehorchen (Poli.IV.1, S.59).
d) Die Aufgaben des Herrschers: Rechtsbewahrung, Rechtsbindung, Rechtsfindung
Der Herrscher hatte dem guten alten Recht als Werkzeug, zu dessen Findung und Wahrung zu dienen. Er sei, so Johannes, „Lehensmann des Gesetzes (Poli.IV.1, S.59)“ und Knecht der Billigkeit (Poli.IV.2, S.65). Ihm oblag die Aufgabe, die (subjektiven) Rechte aller Untertanen zu wahren (suum cuique) und damit den Landesfrieden (pax) zu garantieren. Zur Rechtsbewahrung gehörte auch die Einhaltung der göttlichen Gesetze und der Kirchenrechte. Als Liktor Gottes habe der Herrscher nach dessen Gesetzen zu urteilen, so Johannes (Poli.IV.2, S.67). Der Staatszweck und so das Herrscherdasein waren einzig auf die Rechtsbewahrung, die auch eine Rechtsfindung enthielt, ausgerichtet. Solange der Herrscher das Recht wahrte und gutes altes Recht fand, solange war er Herrscher, ließ er aber davon ab, durften, ja mussten die Untertanen mit Berufung auf das verletzte Recht zum Widerstand gegen den Herrscher schreiten. Denn „der Herrscher ist Herrscher nur im Recht[89].“ Die Rechtsbewahrung garantierte aber auch ihm selbst eine Sicherung der Herrschaft[90]. Denn das Recht, kraft dem der Herrscher regierte, war sein (subjektives) Recht und gleich dem, das etwa der Hörige auf die Bearbeitung der Scholle innehatte[91]. Schließlich wurde auch der Herrscher in seinen gesellschaftlichen Rechtsstand hineingeboren.
Weil aber allein der Herrscher zur Bewahrung, ja zum Schutz der (subjektiven) Rechte der Untertanen berufen wurde, galt das Interregnum für die mittelalterlichen Menschen als ein ernsthaftes Problem. Denn wenn der Herrscher verstarb, abgesetzt oder getötet wurde, ohne dass ein legitimer Nachfolger bestimmt worden war, würde in der herrscherlosen Zeit Unrecht und Unfrieden im Reich regieren, weil keinem, außer dem Herrscher, die Bewahrung und der Schutz der untertänigen Rechte oblag[92]. Wenn es diese Staatsvorstellung im Mittelalter nicht geben hätte, käme jene Zeit auch ohne Herrscher aus, so Kern[93]. Dennoch hat Johannes die These aufgestellt, dass ein gottesfürchtiges und sündenfreies Volk nur Gott als Herrscher bedürfe (Poli.IV.11, S.151; 1 Sam 8,7) . Um ein dauerhaftes Interregnum zu verhindern, konnten die Untertanen dem künftigen Herrscher sogar mit dem Tod drohen, wenn er die Wahl nicht annehmen wollte[94]. Die Rechte des Reiches wie die der Untertanen blieben während eines Interregnums bestehen[95].
Der Herrscher war an das Recht gebunden und diese Rechtsbindung wurde mit dem Thronge-lübde formal bestätigt[96]. Das Throngelübde enthielt dabei nichts, wozu der Herrscher nicht ohnehin verpflichtet gewesen wäre, doch hatte es die rechtlichen Pflichten des jeweiligen Herrschers beurkundet und seine persönliche Haftung für diese gegründet[97]. Die Rechts-bindung traf aber nicht nur auf den Herrscher, sondern auf alle Untertanen zu. Auch Johannes hat die Bindung an das Gesetz für den Herrscher wie für die Untertanen betont . Vor allem die Rechtsbindung des Herrschers sollte bewirken, dass er nicht behaupten könne, „ihm sei irgendetwas gestattet, was von der Billigkeit der Gerechtigkeit abweicht (Poli.IV.1, S.61f.).“
Während des Hochmittelalters hatten nun kirchenrechtlich und römisch-rechtlich Gebildete den Herrscher über das positive Recht und unter das göttliche oder Naturrecht gestellt[98]. Damit war der Herrscher vom positiven Recht, aber nicht vom göttlichen oder Naturrecht entbunden. Dies lässt sich im Ansatz auch bei Johannes nachvollziehen. Er hat den Herrscher aber nicht ausdrücklich über ein positives Recht gesetzt, sondern ihn von der Buchstabentreue des göttlichen Gesetzes und des menschlichen Rechtes (humanum ius)[99] freigesprochen (Poli.IV.6, S.95). „In den Belangen, die veränderlich sind, besteht Spielraum für einen Nachlass vom Wortlaut des Gesetzes, doch so, dass der Geist des Gesetzes durch den ausgleichenden Gewinn an Sittlichkeit und Nützlichkeit [bewahrt wird] (Poli.IV.7, S.115)“. Allerdings schweigt Johannes darüber, welche Belange veränderlich sein können und welche nicht. Obwohl der Herrscher an das göttliche Gesetz gebunden ist, hat Johannes ihm einen Freiraum in der Rechtsfindung gewährt, in dem der Herrscher vom Wortlaut des göttlichen Gesetzes, nicht aber von dessen Sinngehalt abweichen dürfe. Dasselbe gilt für das menschliche Recht. An einer anderen Textstelle hat er den ‚absoluten’ Gedanken aufge-griffen, wonach der Herrscher von der Verbindlichkeit an das Gesetz freigestellt sei. Aber diese Worte, so Johannes, seien nicht in dem Sinn zu verstehen, dass dem Herrscher „gestattet wäre, Unbilliges zu tun; vielmehr soll er […] aus Liebe zur Gerechtigkeit die Billigkeit pflegen und für den Nutzen des Gemeinwesens sorgen (Poli.IV.2, S.65)“. Die Wahrung der Billigkeit und Gerechtigkeit bleibt für den Herrscher stets bindend und verpflichtend. Johannes hat deshalb jene Leute kritisiert, die den Herrscher nicht dem Gesetz unterwerfen wollen und stattdessen behaupten, dass dasjenige Gesetzeskraft habe, was nach dem Willen des Herrschers sei. Damit würden sie ihn aber, so Johannes weiter, gesetzlos (exlex) machen (Poli.IV.7, S.113). Ein Herrscher der nicht an Recht und Gesetz gebunden ist, muss als recht- und gesetzlos gelten, weil er nicht mehr im, sondern über oder neben, also außerhalb von Recht und Gesetz steht. Vielleicht kann der gesetzlose Herrscher hier mit einem Rechtlosen, mit einem aus der Gemeinschaft Verbannten verglichen werden. So hat Johannes die Lehre von der Unverantwortlichkeit und Unantastbarkeit sowie die Theorie von einer absoluten Gewalt des Herrschers abgelehnt und ihn stattdessen mit Verweis auf Deuteronomium 17,14-20 unter das göttliche Gesetz gestellt (Poli.IV.4, S.79f.), das ihm sogar zur Verurteilung gereichen könne (Poli.IV.6, S.103), wenn er es missachten sollte. Ebenso hat er die Bindung des Herrschers an das unveränderliche Völkerrecht (ius gentium) erwähnt (Poli.IV.7, S.113).
Wie aber wird das Recht gefunden? Bei der Rechtsfindung war der Herrscher nicht verpflich-tet eine Übereinstimmung mit dem guten alten Recht auf einem formal vorgeschriebenen Weg zu erreichen. Das Recht konnte etwa durch eine göttliche Inspiration des Herrschers gefunden werden[100]. Bei gewöhnlichen Fällen war die Rechtsvermutung des Herrschers ausreichend, dass sein gefundenes Recht stillschweigend oder ausdrücklich mit dem guten alten Recht und dem allgemeinen Rechtsempfinden übereinstimmte. So vertrat der Herrscher einerseits die Untertanen (vgl.Pol.IV.3, S.71), andererseits das gute alte Recht. Alles was er als Recht be-stimmte, hatte bis zu dessen Widerlegung als Recht gegolten, als ob es von der Gesamtheit der Untertanen gefunden worden wäre[101]. Das gewordene Recht beruht daher nicht auf einem willkürlichen Akt des Herrschers, sondern galt als wirklich gefundenes Recht im Einklang mit den Untertanen[102]. So hat Johannes erklärt, dass der Pluralis maiestatis in den Konstitutionen und Edikten dafür verwendet werde, um diese „oder irgendeine andere Verlautbarung nicht so sehr die einer Person als die der Gesamtheit“ erscheinen zu lassen (Poli.V.4, S.183).
Generell war jeder Untertan zur Rechtsfindung und –bewahrung berufen[103]. In der Regel wurde das Recht mit Hilfe der Rechtsvorstellung der Untertanen bzw. deren Vertrauens-männer[104] und in alten Überlieferungen gefunden. Bevor der Herrscher sich also wegen eines von ihm gefundenen Rechtes in einen ernsthaften Widerspruch zur öffentlichen Meinung gesetzt haben würde und ihm daraus ein Nachteil erwachsen wäre, konnte er den Rat und die Zustimmung seiner Ratgeber einholen, so dass diese an der Rechtsfindung des Herrschers praktisch beteiligt waren[105]. Der Herrscher konnte den Konsens von seinen Ratgebern als Gerichtsurteil, Weistum oder Rat einfordern. Ein gerichtlich gefundenes Recht war dabei gewichtiger als ein einfacher Rat. Die endgültige Entscheidung über ein gefundenes Recht oblag aber allein dem Herrscher[106]. Der Konsens war dem Herrscher freigestellt. Er gewährte ihm aber eine gewisse Sicherheit, dass jedes von ihm gefundene Recht mit dem guten alten Recht und mit dem allgemeinen Rechtsempfinden übereinstimmte[107].
Wer war konsensberechtigt? Dem Herrscher wurde die Entscheidung, von wem er Rat und Zustimmung einfordern wollte, freigestellt[108]. Die zum Konsens berufenen Untertanen hatten dem Herrscher, soweit sie hofpflichtig waren, eine Ratspflicht geschuldet, deren Versäumnis ihnen zur Strafe gereichen konnte[109]. Zu den Ratgebern wurden Bischöfe, Herzöge und andere einflussreiche Magnaten gezählt „wie sie naturgemäß politisch und staatsrechtlich als Ratgeber zuerst in Frage kamen[110] “, aber keine Landfremden[111]. Nachdem im Frühmittelalter der Kreis der konsensberechtigten Personen stets Veränderungen unterworfen war, weil keiner bestimmten Personengruppe ein Recht zustand, vom Herrscher gehört werden zu müssen[112], wurde im Spätmittelalter die Konsensberechtigung auf die Stände begrenzt[113]. Daneben war dem Herrscher auch freigestellt, wann und wo er eine Ratsversammlung einberufen und was er zur Beratung stellen wollte[114].
Johannes hat dem Herrscher für die Einhaltung und Umsetzung der göttlichen Gesetze ge-rechte Priester (Poli.IV.6, S.97) und in Anlehnung an den griechischen und römischen Senat eine Versammlung von weisen Männern als Ratgeber empfohlen (Poli.V.9, S.227f.). Als Vor-bild für die geistlichen Ratgeber nennt er die Priester des Stammes Levi (Dtn17,18). Sie sollen frei von Habgier, Ehrgeiz und verwandtschaftlicher Zuneigung sein, sich aber durch eine verdienstliche Lebensführung und einen guten Ruf auszeichnen. Ihre Berufung könne durch die „einige Gesinnung der Gläubigen oder [durch] die gewissenhafte Fürsorge der Vorgesetzten (Poli.IV.6, S.97)“ erfolgen. Über den Charakter der Laienratgeber hat Johannes ähnliches bestimmt. Sie sollen nicht ungerecht, hochmütig, habgierig oder mit anderen schweren Lastern, sondern mit sittlicher Würde und gutem Willen ausgestattet sein (Poli.V.9, S.235). „Wer aber sorgfältig alles untersucht und dann aufgrund seiner Einsicht in die Sachlage auch ausführt, was getan werden muss, ist zweifellos weise und höchst geeignet, Fürsten Rat zu erteilen (Poli.V.9, S.233)“.
In der mittelalterlichen Theorie gab es aber einige Rechte, wie der Besitz- und Rechtsstand des Reiches und der Untertanen, über die der Herrscher nicht einseitig verfügen durfte[115]. Der Herrscher, der ohne Konsens seine Krone lehnbar oder zinspflichtig machen würde, hätte sich dadurch selbst abgesetzt, weil er damit nicht nur seinen Rechtsstand, sondern auch den seiner Untertanen gemindert hätte. Die Fürsten dürften dann einen neuen Herrscher wählen[116]. Die Konsensgebundenheit des Herrschers war in diesen Fällen rechtlich anerkannt, obwohl auch hier der Herrscher nicht durch eine bestimmte verfassungsrechtliche Notwendigkeit an eine ausdrückliche Einholung des Konsenses gebunden war. Solange ihm freistand selbst zu wählen, wen er als Ratgeber hören wollte und solange der Konsens von irgendwelchen ‚gefügigen Höflingen’ abgegeben werden durfte, war die rechtliche Konsensgebundenheit des Herrschers „die bloße Attrappe einer Verfassungsgarantie[117].“ Dies hat auch Johannes erkannt und deshalb nicht mit Kritik an den schlechten Höflingen gespart (vgl.Poli.V.10, S.237f.).
Bei der Rechtsfindung des Herrschers und seiner Ratgeber wurde nun nicht nach der Mehrheit entschieden[118]. Stattdessen sollte eine fiktive Einstimmigkeit aller Ratgeber gegeben sein[119]. Letztlich hatte aber der Herrscher, nachdem er seine Ratgeber angehört hat, die Entscheidung allein zu treffen[120], da nur in seiner Person die staatliche Handlungsfähigkeit gegeben war. Er allein war das Zentrum aller Staatsgeschäfte[121]. Mit Bezug auf das Römische Recht (CIC, In-stitutionen I.2 (6), S.4) hat daher Johannes bestimmt, dass der Wille des Herrschers zum Wohl und Nutzen des Gemeinwesens Entscheidungskompetenz besitzen müsse und sein Entschluss ‚Gesetzeskraft’ habe, wenn sein Urteil nicht von der Billigkeit abweicht (Poli.IV.2, S.65). Deshalb soll er, so Johannes weiter, den Rechtsfall, den er nicht kennt, „genau erforschen […] und nicht eher jemanden entgegentreten, als der Fall aufgrund gesetzmäßiger Gründe völlig entschieden ist (Poli.V.6, S.211).“ Zudem dürfe sich der Herrscher bei der Rechtsfindung weder von geschwätzigen Leuten (Poli.V.6, S.215) noch von jugendlicher Leichtfertigkeit be-einflussen lassen, sondern soll nach seinem Gewissen mit Klugheit und Weisheit entscheiden. Auch dürfe er nicht bestechlich (Poli.V.6, S.211) und parteilich sein. Er soll frei von Jähzorn, Verbitterung und Hass, nur nach dem leidenschaftslosen Urteil des Gesetzes handeln (Poil.IV.2, S.67).
Praktisch wurde wohl in der Regel ein Mittelweg zwischen dem Willen des Herrschers und der Rechtsvorstellung seiner Ratgeber gesucht. Mit Bezug auf Plutarch hat dagegen Johannes bestimmt, dass „in allen Angelegenheiten das ausgeführt werden muss, was den rangniedrigen Menschen, d.h. der Menge nützt; denn die Minderheit tritt stets hinter der Mehrheit zurück (Poli.VI.20, S.287)“. Ein gefundenes Recht hätte so stets zum Wohl und Nutzen der untertänigen Mehrheit gereichen müssen. Die Rechtsfindung war aber praktisch von der Stärke oder Schwäche des Herrschers gegenüber seinen Ratgebern, Fürsten und Untertanen, möglicher Dritte und seinen inneren wie äußeren Feinden abhängig. Deshalb sollte er die öffentliche Meinung kennen und demgemäß seine Entschlüsse ausrichten, wenn er länger an seinem (subjektiven) Recht, der Herrschaft, festhalten wollte. So hatte er entweder seinen Ratgebern nachzugeben, obgleich er eine andere Meinung vertrat, oder musste um seine Herrschaft und dessen Fortbestand fürchten, wenn er ihren Rat nicht annehmen wollte. Jedoch durfte das Recht, das der Herrscher mit seinen Ratgebern gefunden hatte, auch nicht das (sub-jektive) Recht eines Untertanen verletzen. Weder der Herrscher, noch die Ratgeber, noch die untertänige Gesamtheit, auch nicht alle im Verbund durften das (subjektive) Recht eines Un-tertanen durch ein gefundenes Recht willkürlich ändern, wenn dieser auf seinem guten alten Recht beharrte[122]. Nur der freiwillige Verzicht des Rechtsinhabers konnte das (subjektive) Recht auf rechtlichem Weg beseitigen, wenn dabei ebenso wenig das gute alte Recht be-schnitten wurde. Der Einzelne konnte so theoretisch die Bildung des Staatswillens lähmen[123]. Der Herrscher sollte generell jeden Untertan in dem Rechtsstand belassen, in dem er ihn vor-gefunden hatte (suum cuique), um die bestehende Rechts-, Gesellschafts- und Werteordnung (ordo) zu wahren[124]. Der Herrscher war so mehr der Rechtsbewahrung als der Rechtsfindung verpflichtet.
[...]
[1] Zum zeitlichen Umfeld: Geiss, Artikel: „Heinrich IV.“, in: Geschichte griffbereit 2 (2002), S.134f.. Koch, Manegold, S.11f.. Laakmann, Königsgewalt, S.20. Jordan, Der Kaisergedanke, in: DA 2 (1938), S.90f..
[2] Zum Autor: Fuhrmann, „Volkssouveränität“, S.26f.. Koch, Manegold, S.16f..Laakmann, Königsgewalt, S.9-15.
[3] Laakmann hat das Frühjahr 1082 als frühsten Zeitpunkt der Abfassung genannt. Auf jeden Fall müsse der Schreibbeginn noch vor Gregors Tod 1085 gelegt werden, Königsgewalt, S.24.
[4] Fuhrmann, „Volkssouveränität“, S.29. Koch, Manegold, S.17. Laakmann, Königsgewalt, S. 22f..
[5] Laakmann, Königsgewalt, S.67.
[6] Koch, Manegold, S.84f..
[7] Koch, Manegold, S.106-130. Die hystoria soll auch als Vorlage von Paul von Bernried (1080-1128) (Gregorii papae VII. vita) und Bernold von Konstanz (1054-1100) (Apologeticae rationes, De solutione iuramentorum) verwendet worden seien, Koch, Manegold, S.69, S. 84f.. Vgl. Kern, Gottesgnadentum, S.172, Fußnote 376.
[8] Koch, Manegold, S.24f.. Laakmann, Königsgewalt, S.83.
[9] Koch, Manegold, S.13. Vgl. dazu auch Fuhrmann, „Volkssouveränität“, S.29f..
[10] Koch, Manegold, S.18. Vgl. Laakmann, Königsgewalt, S.62, S.111.
[11] Koch, Manegold, S.13.
[12] Laakmann, Königsgewalt, S.31.
[13] Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.44.
[14] Die mit * gekennzeichneten Quellenhinweise sind aus der Übersetzung von Roman Brüschweiler, Das sechste Buch des Policraticus (1975) entnommen.
[15] Zum Autor:Brüschweiler, Policraticus, S.90-94.Schaarschmidt,Saresberiensis,S.9-60.Seit,Policraticus,S.11-21.
[16] In diesem Interessensumschwung von Thomas Becket findet sich der dem Mittelalter charakteristische Dualismus von Kirche und Staat und das sich daraus entwickelte Spannungsverhältnis wieder. Als Lordkanzler sah sich Thomas uneingeschränkt König und Staat, als Erzbischof aber Papst und Kirche verpflichtet, Schaarschmidt, Saresberiensis, S.36f..
[17] Brüschweiler, Policraticus, S.93. Schaarschmidt, Saresberiensis, S.55.
[18] Seit, Policraticus, S.11.Nach Schaarschmidt soll Johannes am 25.Oktober gestorben sein, Saresberiensis, S.60.
[19] Seit, Policraticus, S.18. Schaarschmidt, Saresberiensis, S.142f..
[20] Seit, Policraticus, S.18. Zur Intrige: Brüschweiler, Policraticus, S.93. Schaarschmidt vermutet, dass seine Freundschaft mit Papst Adrian IV. ein Faktor für die Intrige gegen ihn war, Saresberiensis, S. 32f., S.144.
[21] Schaarschmidt, Saresberiensis, S.143f..
[22] Zur Deutung des griechischen Titels Policraticus und dessen Untertitel sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum, vgl. Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.24, Schaarschmidt, Saresberiensis, S.144f..
[23] Vgl. Schaarschmidt, Saresberiensis, S.146-148.
[24] Eine ausführliche Inhaltsangabe liefert Schaarschmidt, Saresberiensis, S.146-194.
[25] Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.36f..
[26] Die im Buch VIII enthaltene Tyrannuslehre wird in dieser Arbeit nicht besprochen.
[27] Seit, Policraticus, S.17.
[28] Während des 12. Jahrhunderts hatte der italienische Magister Vacarius das Römische Recht am Hof des Erzbischofs Theobald gelehrt, Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.41f. Schaarschmidt glaubt, dass Johannes das Römische Recht einerseits in England bei Vacarius, andererseits in Frankreich kennengelernt haben könnte, Saresberiensis, S.18, S.29. Das Römische Recht zu lehren, wurde aber unter König Stefan verboten, Saresberiensis, S.17f.. Ferner vermutet Seit, dass Johannes das Römische Recht während seines Aufenthaltes an der päpstlichen Kurie studiert haben könnte, Policraticus, S.17, Fußnote 13.
[29] Schaarschmidt, Saresberiensis, S.30.
[30] Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.44.
[31] Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.23.
[32] Seit, Policraticus, S.19.
[33] Poli. Prolog I zitiert nach Seit, Policraticus, S.19, Fußnote 16.
[34] Vgl. Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.37.
[35] Seit, Policraticus, S.15.
[36] Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.23.
[37] Gennrich, Die Staats- und Kirchenlehre, S.169-171.
[38] Grabmann, Thomas von Aquin, S.333.
[39] Im Allgemeinen ist ein Regent ein Regierender, im Besonderen ein Regierungsverweser des Monarchen, wenn dieser etwa wegen Minderjährigkeit sein Amt nicht wahrnehmen kann, Fuchs, Raab, Artikel: „Regent“, in: Wörterbuch Geschichte, S.673.
[40] Hugos Herrschaft über Jerusalem wurde von seiner Verwandten Maria von Antiocheia bestritten, die später ihre Rechte an Karl I. von Anjou veräußerte. Im Laufe der Zeit hatte sich Hugos Machtstellung wegen der vordringenden Mamelucken in Syrien und wegen des Streites um das Thronrecht von Jerusalem in seiner Familie verringert, Edbury, Artikel: „Hugo III. von Antiocheia-Lusignan“, in: LexMa V (2003), Sp.158f..
[41] Grandclaude, M., Les particularités de De regimine principum de S. Thomas, Rev. hist. de droit, 1929, S. 665-666 zitiert nach Chenu, Das Werk des Heiligen, S.379.Weißert, Über die Herrschaft, S.7.
[42] Zum Autor: Kenny, Thomas von Aquin, S.11f.. Elders, Artikel: „Thomas von Aquin“, in: LexMa VIII (2003), Sp.706-711. Weißert, Über die Herrschaft, S. 4f..
[43] Chenu, Das Werk des Heiligen, S. 5. Weißert, Über die Herrschaft, S. 5.
[44] Weißert, Über die Herrschaft, S.8.
[45] Weißert, Über die Herrschaft, S.7.
[46] Die Schrift wurde nachweislich ab dem vierten Kapitel des zweiten Buches entweder von Tholomaeus von Lucca, Schilling, Staats- und Soziallehre, S.137, Fußnote 5, oder von Aegidius Colonna fortgeführt, Weißert, Über die Herrschaft, S.11. Vgl. Grabmann, Thomas von Aquin, S.331f.. Berges, Fürstenspiegel, S.317f..
[47] Bosone, Aufsatz, S.9.
[48] Für die folgende Untersuchung wird der Aufsatz „Recht und Verfassung im Mittelalter (1919)“ von Fritz Kern und sein Buch „Gottesgnadentum und Widerstandsrecht (1914)“ verwendet. Obwohl Kerns Thesen zum guten alten Recht bis heute einflussreich sind, finden sie in der mittelalterlichen Terminologie und Begrifflichkeit keine Stütze, so Kroeschell, Artikel: „Recht“, in: LexMa VII (2003), Sp.510-513. Dagegen kann der folgende Vergleich von Kerns Thesen und der idealen Rechts- und Verfassungsvorstellung, wie sie Johannes im Policraticus entwickelt hat, angeführt werden. Kern wollte die ‚Ideen’, „die Anschauungen, wie sie bewusst und unbewusst, ausgesprochen und unausgesprochen dem breiten Rechts- und Verfassungsleben“ des Mittelalters zugrunde lagen, darstellen, nicht die ‚Realien’, aber auch „nicht die abstrakten Theorien mittelalterlicher Gelehrter“, Recht, S.1. Natürlich überschneiden sich die ‚Ideen’ der mittelalterlichen Rechts- und Verfassungsvorstellung mit den ‚Realien’ und sind teilweise auch in den damaligen Theorien der Gelehrten enthalten. Schließlich kann eine Vorstellung darüber nur aus den überlieferten Quellen gewonnen werden.
[49] Vgl. Kern, Recht, S.74f., S.78.
[50] Kern, Recht, S.77.
[51] Der Nachweis der Bibelzitate im Policraticus wird einerseits als Beleg von Johannes selbst, andererseits von Stefan Seit als quellenkritische Angabe gegeben. Die verwendeten Bibelzitate weichen teilweise von der heutigen Einheitsübersetzung ab. Dasselbe gilt für De regimine principum von Thomas von Aquin.
[52] Johannes hat den Begriff Gesetz (lex) auf das göttliche Gesetz bezogen und ihm einen christlich-religiösen Ursprung, die Heilige Schrift und Gott, zugrunde gelegt (Poli.IV.2, S.63). Dagegen ist der Rechtsbegriff von Kern mehr einem germanischen Ursprung entlehnt, Recht, S.6f..
[53] Kern, Recht, S.6.
[54] Für die Bezeichnung der Gerechtigkeit hat Johannes einmal den Begriff iustitia, der nur die Gerechtigkeit beinhaltet, und ein anderes Mal den Begriff aequitas, der nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch die Billigkeit umfasst, verwendet. Im Folgenden nutzt er vor allem den Begriff aequitas, weniger den der iustitia. Beide Begriffe scheinen bei ihm einen göttlichen Ursprung, aber einen verschiedenen Sinngehalt zu haben.
[55] Kern, Recht, S.6f..
[56] Das allgemeine Rechtsempfinden konnte vor allem dem Corpus iuris civilis nichts abgewinnen, Kern, Gottesgnadentum, Anhang VI, S.265. Auch im Hoch- und Spätmittelalter war es noch überwiegend vom germanischen Rechtsbegriff geprägt, so dass die christlichen und antiken Rechtsvorstellungen nur wenig an Einfluss gewonnen hatten, Gottesgnadentum, S.123, Fußnote 266.
[57] Weil sich die moderne Vorstellung vom Gewohnheitsrecht nur schwer mit dem mittelalterlichen Rechtsbegriff decken und erhellen lässt, so Kern, Recht, S.4, ebenso weil wir uns bereits in der zweiten Zeitstufe der Rechtsvorstellung befinden und wegen der von Kern geleisteten Begriffsdefinition wird im Folgenden nicht der Begriff des Gewohnheitsrechtes, sondern der des ‚guten alten Rechtes’ verwendet.
[58] Kern, Recht, S.3.
[59] Kern, Recht, S.12.
[60] Kern, Recht, S.3.
[61] Kern, Recht, S.18.
[62] Kern, Recht, S.22. Auch gab es keinen Unterschied zwischen den Urkunden, die ein Sonderrecht, und denen, die ein allgemeines Recht, bezeugten.
[63] Kern, Gottesgnadentum, S.123.
[64] Kern, Recht, S.7.
[65] Kern, Recht, S.8, S.47.
[66] Dennoch vertraten der Papst und seine Anhänger zeitweise die Ansicht, dass die staatliche Obrigkeit und der Herrscher vom Teufel abzuleiten seien, Bezold, Volkssouveränität, S.3.
[67] Kern, Recht, S.4f..
[68] Das mittelalterliche Rechtsdenken kannte keinen abstrakten Rechtsbegriff. Es gab kein Recht an sich, Gurjewitsch, Das Weltbild, S.208. Stattdessen lebte der Mensch im Recht. Er wurde in seinen Rechtsstand (Adliger, Höriger, Freier) hineingeboren und hatte sein Recht aus der gesellschaftlichen Stellung, die er einnahm, abzuleiten. Dasselbe galt für den Herrscher. Daher musste die Gott gegebene Gesellschaftsordnung mit den Rechten der einzelnen Stände gewahrt werden, weil der mittelalterliche Mensch nur daraus seine Rechte und Pflichten entnehmen konnte. In der Regel sollte, ja musste jeder in dem Rechtsstand verbleiben, in den er hineingeboren worden war, um die Ordnung zu wahren. Dennoch konnte der Rechtsstand auch gewechselt werden, etwa beim Übertritt eines Laien in den geistlichen Stand.
[69] Kern, Recht, S.12f..
[70] Kern, Recht, S.13. Aber bereits hier seien der Widerruf und die Kassierung von Rechtssätzen durch den Herrscher erwähnt.
[71] Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.2.
[72] Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.3.
[73] Kern, Recht, S.1.
[74] Vgl. Kern, Gottesgnadentum, S.175.
[75] Kern, Gottesgnadentum, Anhang XX, S.329.
[76] Vgl. Spörl, Gedanken um Widerstandsrecht, S.22f..
[77] Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.34f.
[78] Vgl. Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.35.
[79] Seit, Policraticus, S. 24.
[80] Vergil, Georgica, IV.153-218 im Wortlaut von Johannes übernommen.
[81] Die Idee eines transpersonalen regnum hatte schon Wipo in der zwischen 1039 und 1046 geschriebenen Gesta Chuonradi II. imperatoris in Form einer Schiffsmetapher erwähnt. Er erklärte, dass Reich und Herrscher mit Schiff und Steuermann verglichen werden können, so dass das Reich wie das Schiff fortbesteht, auch dann, wenn der Herrscher wie der Steuermann nicht mehr da sei, Gesta 7, in: Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts (1990),S.558f..
[82] Kleineke, Englische Fürstenspiegel, S.4.
[83] Kern, Recht, S.9. Bereits Augustinus hatte mit Bezug auf Cicero erläutert, dass der Staat sich aus dem Recht und der Gerechtigkeit abzuleiten habe, so dass es keinen Staat gebe, wenn kein Recht und keine Gerechtigkeit vorhanden sei (DCD XIX.21, S.567).
[84] Vgl. Schaarschmidt, Saresberiensis, S.160f..
[85] Kern, Gottesgnadentum, S.164, Fußnote 355.
[86] Koch erwähnt, dass es in der fränkisch-deutschen Verfassung ein eigenes Recht des Königtums gegeben habe, Manegold, S.141. Dass solche Ansätze zu finden sind, hat auch Kern ergänzt, Gottesgnadentum, S.127.
[87] Kern, Recht, S.50.
[88] Kern, Recht, S.46f..
[89] Kern, Gottesgnadentum, S.164, Fußnote 355.
[90] Kern, Recht, S.47.
[91] Kern, Recht, S.46.
[92] Während eines Interregnums, so die damalige Vorstellung, würde die Staatsgewalt an Gott als den ursprüng-lichen Regenten zurückfallen. Die provisorische Regierung der Fürsten hatte währenddessen keinen Anspruch auf diese. Jene sollten aber mit der Neuwahl eines Herrschers das Interregnum schnellstmöglich beenden, Kern, Gottesgnadentum, Anhang VII, S.268f..
[93] Kern, Recht, S.52f., Fußnote 2.
[94] Kern, Gottesgnadentum, S.267f..
[95] Vgl. Kern, Gottesgnadentum, S.269.
[96] Ab dem 9. Jahrhundert kam es zur Entwicklung eines regelmäßigen Throngelübdes, Kern, Gottesgnadentum, Anhang XIII, S.300.
[97] Kern, Gottesgnadentum, S.133f..
[98] Kern, Gottesgnadentum, S.125.
[99] Seit hat hier ius mit ‚Gesetz’, ich dagegen mit ‚Recht’ wiedergeben. Johannes hat einige Aussagen über ein menschliches Recht getroffen, das unter dem göttlichen Gesetz steht und vermutlich mit dem weltlichen Recht gleichgesetzt werden kann (vgl. Poli.V.4, S.193; V.5, S.197).
[100] Recht und Gesetz konnten als eine lebende Vernunft (lex animata) im Herrscher verortet werden. Die Lex-animata-theorie diente dazu, den Herrscher als alleinigen Gesetzgeber zu benennen, Berges, Fürstenspiegel, S. 49f.. Vom Hochmittelalter bis ins 17. Jahrhundert galt, dass der Herrscher frei als lex animata über dem positiven, aber unter dem göttlichen oder Naturrecht steht, Kern, Gottesgnadentum, Anhang VI, S.264f..
[101] Vgl. Kern, Gottesgnadentum, S.128, Anhang VII, S.266f..
[102] Kern, Gottesgnadentum, Anhang VI, S. 264.
[103] Kern, Recht, S.5.
[104] Als Vertrauensmänner galten die Magnaten, die principes, optimates und proceres. Die Vertretung der Gesamtheit durch die Magnaten ist selbstverständlich geworden, ohne dass dafür irgendein bestimmter Akt vollzogen worden wäre oder eine feste Regel bestanden hätte, Kern, Gottesgnadentum, Anhang IX, S.276. Ferner sind die abstrakten Begriffe des ‚Reiches’, dessen ‚Gesamtheit’ und deren Vertretung im mittelalterlichen Denken unbestimmt und fließend in ihrer Bedeutung, Gottesgnadentum, Anhang IX, S.278.
[105] Zum consensus fidelium: Kern, Recht, S.53f., Gottesgnadentum, S.129f., Anhang VIII, IX, X, XI, S.269-294.
[106] Kern, Gottesgnadentum, Anhang X, S.286.
[107] Vgl. Kern, Gottesgnadentum, S.129f..
[108] Kern, Recht, S.57. Der Rat konnte sich aber nicht selbst bilden, obwohl jedem Untertan, vor allem den proceres das Recht zustand, unter Umständen auch selbstständig gegen den Willen des Herrschers zu handeln, Gottesgnadentum, Anhang VII, S.266.
[109] Kern, Gottesgnadentum, Anhang X, S.279.
[110] Kern, Gottesgnadentum, Anhang IX, S.281. Allerdings sind die in den Urkunden genannten und die tatsächlichen Ratgeber häufig unterschiedliche Personen. Bei der Wahl der beurkundenden Ratgeber war nicht die „geschichtliche Wahrheit, sondern [die] politische Erwägung“ bedeutsam. Kern hat dies an der Magna Charta gezeigt, in der nicht die politischen Anhänger, sondern die Gegner als Ratgeber des Herrschers benannt werden, um sie zur Anerkennung der Urkunde zu verpflichten und diese nicht als Parteiwerk erscheinen zu lassen, Gottesgnadentum, Anhang VIII, S.271.
[111] Kern, Gottesgnadentum, Anhang X, S.287f..
[112] Kern, Gottesgnadentum, S.130, Anhang X, S.281.
[113] Zum Konsensrecht der Stände: Kern, Recht, S.61, Fußnote 2. Dabei wurden auch die Grenzen der konsens-pflichtigen Herrscherverfügungen abgesteckt und das Widerstandsrecht auf die Stände beschränkt, Recht, S.65f..
[114] Kern, Gottesgnadentum, Anhang X, S.279.
[115] Kern, Recht, S.60.
[116] Kern, Gottesgnadentum, Anhang X, S.285.
[117] Kern, Gottesgnadentum, Anhang X, S.287.
[118] Das Mehrheitsprinzip wurde erst mit dem Konsensrecht der Stände eingeführt, Kern, Recht, S.65.
[119] Kern, Gottesgnadentum, Anhang IX, S.277.
[120] Kern, Gottesgnadentum, Anhang X, S.286f., Anhang IX, S.277.
[121] Kern, Gottesgnadentum, Anhang X, S.279.
[122] Vgl. Kern, Gottesgnadentum, S.128f., Anhang VI, S.263.
[123] Kern, Recht, S.58f..
[124] Kern, Gottesgnadentum, S.128f..
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Astrid Klahm (Autor:in), 2010, Untersuchung über das Widerstandsrecht im Hochmittelalter anhand ausgewählter zeitgenössischer Schriften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/439427
Kostenlos Autor werden










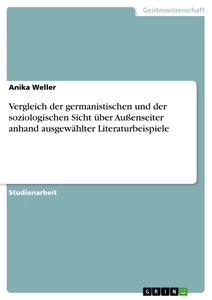




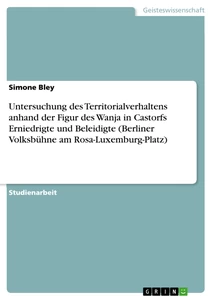




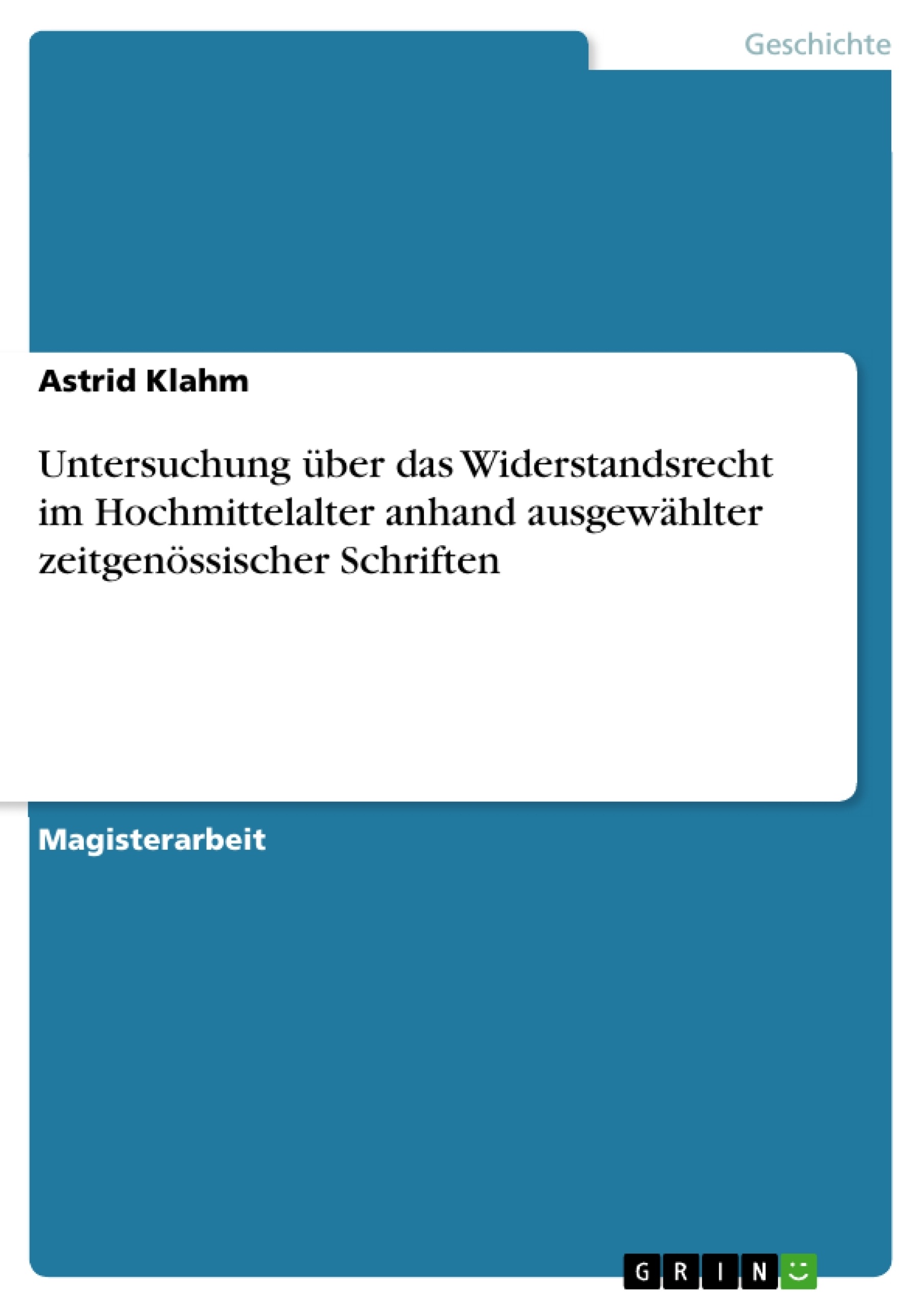

Kommentare