Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Begriffsbestimmung
1.1. Aggression – Aggressivität – Aggressives Verhalten
1.2. Ärger
1.3. Gewalt
2. Ansätze zur Gewaltprävention
2.1. Problemfeld: Aggressives Verhalten an Schulen
2.1.1. Ausmaß und Erscheinungsformen
2.1.2. Risikofaktoren für die Entstehung
2.2. Handlungskonzepte zur Gewaltprävention an Schulen
2.2.1. Grundlagen der Gewaltprävention
2.2.2. Förderung der Selbstkontrolle und der Selbstsicherheit
2.2.2.1. Selbstkontrolle
2.2.2.2. Selbstsicherheit
2.2.3. Stärkung der sozialen und emotionalen Kompetenzen
2.2.3.1. Soziale Kompetenz
2.2.3.2. Emotionale Kompetenz
2.2.4. Schlichterprogramme für Schüler
2.2.5. Verbesserung des Schulklimas
2.3. Beispiele von Projekten der Gewaltprävention
2.4. Erfolge in der Gewaltprävention
2.5. Zusammenfassung
3. Der Zusammenhang von Gewaltprävention und Gesundheitsförderung
3.1. Ziele und Inhalte der Gesundheitsförderung
3.2. Psychische Gesundheit und Selbstverwirklichung
3.3. Selbstverwirklichung als ein Ziel von Gewaltprävention
3.4. Gesundheitsrelevante Gewaltprävention
3.5. Zusammenfassung
4. Modell einer Gewaltpräventionsmaßnahme am Beispiel des Konzeptes „Locker bleiben“ des Albert-Schweitzer-Familienwerkes e.V
4.1. Das Lüneburger Projekt des ASFs
4.1.1. Konzeption des Betreuungsprojektes
4.1.2. Kooperation mit Schulen
4.2. Das Konzept zur Gewaltprävention
4.2.1. Die Zielgruppe
4.2.2. Ziele
4.3. Inhalte, Teilziele und deren Begründungszusammenhang
4.3.1. Thema Konflikt
4.3.2. Thema Gewalt
4.3.3. Kommunikative Verständigung
4.3.4. Ärger und andere Emotionen
4.3.5. Selbstbehauptung und Selbstsicherheit
4.3.6. Selbstverteidigung
4.3.7. Vermitteln durch Mediation
4.4. Verknüpfung zu Ansätzen der Gesundheitsförderung
4.5. Diskussion
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Zu Beginn dieses Jahres (Januar 2004) ging ein Thema durch die Medien: Jugendliche Gewalt an Schulen. An einer Berufsschule in Hannover hatte eine Gruppe Jugendlicher über Monate hinweg einen Jungen körperlich misshandelt, mit Stangen auf ihn eingeschlagen, getreten, gestoßen und ihm verbal zugesetzt. Und dies alles ungeachtet, während ihr Lehrer im Nebenraum saß und von all dem nichts mitzubekommen schien. Die Jungen filmten ihre Übergriffe mit einer Digitalkamera und stellten die Gewaltszenen ins Internet, wodurch die Öffentlichkeit auf die Übergriffe aufmerksam wurde.
Gewalt und Aggression unter Kindern und Jugendlichen ist ein Thema, das seit mehreren Jahren sowohl Schüler, Eltern, Pädagogen und Politiker beschäftigt. In regelmäßigen Abständen rückt es ins Zentrum der Öffentlichkeit und der wissenschaftlichen Diskussion. Kriminalstatistiken als auch Medien zeichnen ein Bild, nachdem die Kinder- und Jugendkriminalität über die letzten Jahre zugenommen hat. Besonders besorgniserregend sei dabei, dass die Täter immer jünger würden. Andere Stimmen lassen verlauten, Kinder würden durch den überhöhten Fernsehkonsum unruhig in ihrem Verhalten und zunehmend aggressiver.
Die sich abzeichnende Entwicklung verlange nach Lösungen im Sinne von Intervention und vor allem in Form von Prävention, denn Präventionskonzepte scheinen sowohl langfristig erfolgreicher als auch deutlich kostengünstiger zu sein als Interventionsmaßnahmen.
In Deutschland werden derzeit sehr viele Konzepte zum Eindämmen der Gewalt unter Jugendlichen eingesetzt. Gewaltarbeit und Gewaltforschung sind über die Jahre hinweg fortgeschritten und haben sich immer weiter spezialisiert und konkretisiert. So konnte sich die Präventionsarbeit immer auf aktuelle Forschungsergebnisse stützen und ihre Konzepte diesen anpassen. Daraus entstanden immer feingliedrigere Konzepte, die sich nach unterschiedlichen Ansatzpunkten und Inhalten differenzierten (Zielsetzung, Zielgruppe, Präventions- oder Intervention, Schule, Familie, Freizeit, etc.). Während sich manche von ihnen eigens auf das Training elterlicher Erziehungsmethoden spezialisiert haben, wird anderswo versucht, die Solidarität der Unbeteiligten mit den Opfern zu stärken. Wieder andere setzen bei der Gestaltung attraktiver Freizeitangebote für die Jugendlichen oder der Gemeinwesenarbeit an.
Doch auch in vielen Schulen wird Gewaltarbeit heutzutage groß geschrieben. Die dort praktizierten Maßnahmen reichen von Theaterprojekten über Streitschlichter-Ausbildungen bis zu der Gestaltung der schulischen Räumlichkeiten (vgl. Landesbildungsserver Baden-Württemberg, 20.09.2004). Die Institution Schule wird in diesem Zusammenhang nicht mehr als ein isoliertes System der Bildung und Erziehung verstanden, sondern als ein Teil der gesellschaftlichen Öffentlichkeit, die ebenso ihren Beitrag zu leisten hat, wie Eltern, Jugendhilfe oder Politik. Eine Kooperation von Schule und Jugendhilfe im Sinne der Schulsozialarbeit ist meiner Ansicht nach eine sinnvolle Form der Gewaltprävention, da es sich hier zum einen um ein niedrigschwelliges Angebot handelt und zudem die lebensweltlichen Bezüge der Jugendlichen im Schulalltag berücksichtigt werden (vgl. Schmidt/ Winkler, 23.09.2004).
Unter den verschiedenen Formen der Zusammenarbeit existieren spezielle Gewaltpräventionsprogramme, die von außen an die Schule herangetragen werden, um in allen oder auch nur einigen Klassen durchgeführt zu werden. Dabei können sie entweder im Rahmen einer Projektwoche, einer Arbeitsgemeinschaft oder eines Workshops stattfinden oder aber auch als Vertretungsstunden in den schulischen Alltag integriert werden. Welcher Ansatz am effektivsten ist, kann hier nicht ohne weiteres bestimmt werden, gibt es doch bei jeder Variante Vor- und Nachteile.
In der hier vorliegenden Arbeit wird das Konzept eines Gewaltpräventionsprojektes vorgestellt werden, welches in seiner ursprünglichen Form für mehrere aufeinander folgende Tage konzipiert wurde. Allerdings lässt es sich flexibel einsetzen, je nachdem, wie es sich in den Stundenplan der Schüler einfügen soll.
Bei den Modulen des Konzeptes handelt es sich vorwiegend um Fördermaßnahmen bestimmter Kompetenzen mit dem Ziel, die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit zu stärken und sie in Konfliktsituationen handlungsfähig zu machen. Die teilnehmenden Schüler sollen also nicht nur in der Entwicklung einer positiven Identität unterstützt und gefördert, sondern auch auf eventuelle Konfliktsituationen vorbereitet werden, um deren Eskalation zu verhindern. Aus diesem Grunde beinhaltet das Konzept Trainingseinheiten der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, der Emotionsregulierung und Kommunikationsfähigkeit sowie der konstruktiven Schlichtung in Auseinandersetzungen.
Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, inwiefern sich Maßnahmen der Persönlichkeitsstärkung als förderlich erweisen, um aggressivem Verhalten vorzubeugen. Da ihre Effektivität von einigen Kritikern aufgrund des eher indirekten Einflusses auf destruktives Verhalten bezweifelt wird, bedürfen sie einer theoretischen Fundierung, um sich als zweckdienlich zu beweisen. Dieser Nachweis soll hier erbracht werden.
Dafür werden die Maßnahmen des Projektes „Locker bleiben“ nicht nur auf ihre Art und Weise untersucht, mit der sie Einfluss auf das Verhalten der Schüler nehmen können, sondern ebenso bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für die körperliche wie seelische Gesundheit der jugendlichen Teilnehmer.
Um den Einstieg in die Problematik zu erleichtern, erfolgt nach einer kurzen Definition der wichtigsten Begriffe im ersten Teil der Arbeit, eine Betrachtung des Phänomens „Gewalt an Schulen“. Zu diesem Anlass wird ein Blick in die Gewaltforschung geworfen, um einige prägnante Ergebnisse über die Formen, das Ausmaß und die Einflussfaktoren aggressiven Verhaltens herauszustellen. Dabei lassen sich hinsichtlich der beiden letztgenannten Aspekte unterschiedliche, sich teilweise widersprechende Ergebnisse auffinden. Insbesondere die Theorien und Studienergebnisse bezüglich der Auslöser aggressiven Verhaltens sind äußerst umfangreich. Letzten Endes kann jedoch ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren als wahrscheinlich betrachtet werden, was wiederum auf viele Anknüpfungspunkte der präventiven Gewaltarbeit schließen lässt. Wie diese aussehen können, wird an Beispielen ausgewählter, für das Konzept relevanter Handlungsstrategien beschrieben.
Anhand der darauf folgenden Präsentation der Inhalte, Ziele und Evaluationsergebnisse einzelner Präventions- und Interventionsprojekte, lassen sich bestimmte Maßnahmen ausmachen, die im Zusammenhang mit Erfolgen in der Gewaltarbeit stehen.
Nicht allein aus diesem Grund fließen einige von ihnen in das Konzept „Locker bleiben“ ein. So soll zudem in Kapitel 3 darauf hingewiesen werden, welchen entscheidenden Beitrag diese Maßnahmen zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit Jugendlicher leisten können. Dies wird durch die Verbindung der Ziele und Inhalte der Gesundheitsförderung mit denen der Gewaltprävention geschehen.
Im darauf folgenden Kapitel wird schließlich eine Lüneburger Einrichtung der Jugendhilfe vorgestellt, aus deren Arbeit das Projekt „Locker bleiben“ hervorging. Dessen Konzeption wird ausführlich erläutert, um die Effektivität der einzelnen Themengebiete und Übungen theoretisch zu untermauern. Auch die im Laufe der Arbeit gewonnen Erkenntnisse über die Bedingungen erfolgreicher Prävention werden deren Wirksamkeit bekräftigen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das hier vorgestellte Konzept erst später seine praktische Anwendung in der schulbezogenen Jugendarbeit finden wird und daher noch keine Angaben über seine tatsächliche Effektivität gemacht werden können.
In der abschließenden Diskussion soll es um die Problemstellung gehen, ob sich Gewalt allein durch ein Projekt wie „Locker bleiben“ vermeiden lässt oder ob dafür weitere Schritte nötig sind, bei denen der Schwerpunkt auf andere Bereiche gesetzt wird.
Hiermit möchte ich zu einem besseren Verständnis im Umgang mit Jugendlichen beitragen und verdeutlichen, dass eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Gewaltproblems von Vorteil sein kann, da die einseitige Variante Gefahr läuft, wichtige Einflussfaktoren zu übersehen.
Es sei darauf hingewiesen, dass ich in den folgenden Ausführungen aufgrund des Leseflusses die maskuline Form benutze, die weibliche aber durchaus als integriert betrachtet werden soll.
1. Begriffsbestimmung
Aggressionen sind ein Problem, seit es Menschen gibt. Dabei werden die destruktiven Aspekte von Aggressionen bei Kindern und Jugendlichen von Eltern und Erziehern häufig als störend und bedrohlich erlebt. Wenn sich Kinder wütend, rücksichtslos oder provokant verhalten, sind Erwachsene oft verunsichert und stehen diesem Phänomen hilflos gegenüber. Sie wissen nicht, wie sie mit der Aggressivität ihrer Kinder umgehen sollen. Aggressionen stellen also in vielen Fällen ein Alltagsproblem dar. Zwar werden die Begriffe ’Aggression’, ’Ärger’, ’Aggressivität’ und ’Wut’ im alltäglichen Sprachgebrauch oft vermischt, in der Fachliteratur jedoch voneinander getrennt betrachtet. Da die Literatur eine Fülle von Begriffsbestimmungen aufzeigt, erweist es sich als sehr schwierig, eine allgemeingültige Definition zu finden. Dennoch wird hier versucht aus einigen Beispielen eine für diese Arbeit angemessene Begriffsbestimmung von Aggression, Aggressivität und Gewalt sowie Ärger, Wut und Hass zu formulieren.
Nach Kusche (2000, S.17) unterscheiden sich die Terminologien von Gewalt und Aggression dadurch, dass Gewalt durch negative Emotionen zu Destruktivität führen kann, während Aggressionen eine Verhaltensweise ausdrücken, „(…) die durchgeführt werden kann oder muß - je nach Werteordnung des (potentiellen) Täters“, d.h. Aggressionen sind nicht automatisch negativ besetzt. Den Begriff Gewalt assoziieren wir allerdings überwiegend mit negativen Begriffen wie ’Feindseligkeit’, ’Destruktivität’ oder ’Brutalität’ und denken dabei an körperliche Auseinandersetzungen. Dabei bleibt oft unberücksichtigt, dass es neben der physischen Gewalt auch eine Menge anderer Formen, wie die der psychischen, verbalen, sexuellen, frauen- oder fremdenfeindlichen Gewalt gibt.
Helmut Frank (1996, S.20) verdeutlicht den Unterschied von Gewalt und Aggression mit einem Zitat von Hacker (1985) folgendermaßen: ,,Alle Gewalt ist Aggression, aber nicht alle Aggression ist Gewalt.“ Gewalt ist also eine destruktive Form Aggressionen auszuleben. Als Gemeinsamkeiten von Aggressionen und Gewalt ist festzustellen, dass sie, wenn auch in unterschiedlichen Formen und Motivationen, eine Konfrontation sind.
Wenn im Verlauf dieser Arbeit von Aggressionen die Rede ist, werden darunter die destruktiven Formen aggressiven Verhaltens verstanden.
1.1 Aggression - Aggressivität – Aggressives Verhalten
Nach Kusche (2000, S.20) blieb „Aggression bzw. aggressives Verhalten (…) über die letzten Jahrzehnte in der Definition fast gleich.“ So beschreibt er die Aggression als eine Verhaltensstörung, die „(…) darauf ausgerichtet ist, einen anderen direkt oder indirekt zu schädigen“ (ebd., zit. nach Petermann/ Petermann 1990). Auch in Anlehnung an Banduras sozial-kognitive Lerntheorie wird Aggression als ein destruktives Verhalten bezeichnet, „(…) das im sozialen Bereich auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren als aggressiv definiert wird, von denen einige eher im Ermessen des Betrachters als beim Handelnden liegen“ (ebd. S.20f, zit. nach Bandura 1973). Denn nicht allem was vom Beobachter als aggressives Verhalten eingestuft wird, muss eine Schädigungsabsicht des Aggressors zugrunde liegen. So kann ein Anrempeln für einen Außenstehenden aggressiv wirken, für den Betroffenen aber ein freundschaftliches Schubsen darstellen.
Gewalt darf dabei nicht mit kleineren Streitereien oder Raufereien zwischen gleichstarken Partnern verwechselt werden, sondern setzt immer ein Ungleichgewicht der Kräfte voraus.
Nach Bründel und Hurrelmann (1994, S.23) ist Aggression „(…) ein wissenschaftlicher Begriff und bezeichnet eine Handlung, die auf die Verletzung eines Menschen zielt. >>Aggressivität>> [hingegen] ist der Begriff für die Absicht, eine solche verletzende Handlung zu begehen“, also die Bereitschaft zu aggressivem Verhalten. Diese Trennung erscheint sinnvoll, da sich Aggressivität in seiner ursprünglichen Bedeutung von dem lateinischen Wort ’aggredi’ (Herangehen, Annähern, Antriebskraft) ableitet und somit eine Motivation beschreibt, bei der der Handelnde etwas ’in Angriff nimmt’. Er hat also die Bereitschaft zu aggressivem Verhalten (vgl. Lexikon der Psychologie 2000, S.27).
Dieses aggressive Verhalten wird aber erst dann zum Problem, „(…) wenn es als eine bestimmte Form der Konfliktaustragung mit Schädigungen oder Beeinträchtigungen von Menschen oder Sachen verbunden ist“ (Verres/ Sobez 1980, S.34).
Aggressionen können gegen Personen, Sachen oder gegen sich selbst gerichtet sein (vgl. Kraußlach 1981, S.50f). Wenn Menschen versuchen ihre Aggressionen an Gegenständen abzureagieren, wird dieses Verhalten von der Gesellschaft zwar nicht gebilligt, aber im Gegensatz zur Gewalt gegen Personen weniger geächtet. Allerdings werden beide Aggressionsäußerungen rechtlich geahndet. Gegen das Subjekt selbst gerichtete Aggressionen (in Form von Kratzen, Beißen, Schnippeln, etc.) werden von der Gesellschaft nicht sanktioniert, sondern als Hilfeschrei gedeutet. Daraus lässt sich schließen, dass die Autoaggression eher das Mitleid der Mitmenschen erregt, während nach außen gerichtete Aggressionen oft als reine Böswilligkeit bewertet werden.
Weiterhin können sich Aggressionen auf drei Ebenen zeigen (vgl. ebd. S.53): auf der verbalen bzw. psychischen Ebene (durch Drohungen, Beleidigungen, Erniedrigungen, Demütigung, Verunsicherung, Vernachlässigung, etc.), auf der Signalebene, bei der sich Aggressionen durch die Gestik und Mimik des Aggressors ausdrücken und auf der Handlungsebene, als eine gegen andere Menschen bzw. Sachen gerichtete Gewaltanwendung (Schlagen, Verletzen, Vandalismus, etc.).
Auch Aggressivität äußert sich auf unterschiedliche Weise: Im Falle der ’Reaktiven Aggressivität’ zieht sich das Individuum bei Schwierigkeiten zurück und reagiert mit Regression, Resignation oder aber auch mit Angriff (vgl. Merkens 1993, S.21ff). Bei der ’Instrumentellen Aggressivität’ zielt der Aggressor mit seinem destruktiven Verhalten auf „Anerkennung, Beachtung oder Durchsetzung bestimmter Forderungen“ (ebd. S.23) ab. Wenn das aggressive Verhalten einer Person einem aggressiven Modell nachahmt, nennt Merkens dies eine ’Imitative Aggressivität’. Diese spielt beispielsweise eine wichtige Rolle bei der Diskussion um den Einfluss von medialer Gewaltdarstellung, auf die jedoch in dieser Arbeit nur ansatzweise eingegangen werden soll. Eine weitere Ausdrucksform aggressiven Verhaltens ist die ’Identifikative Aggressivität’, die sich im Rahmen verschiedenartiger Gruppenformen zeigt, wenn sich das Individuum den Gruppenerwartungen anzupassen versucht (ebd. S.26).
Letzten Endes bleibt die Frage, warum Kinder und Jugendliche dieses Verhalten zeigen. Die Wissenschaft hat eine Anzahl von Theorien zur Erklärung aggressiven Verhaltens hervorgebracht. Sie reichen von den klassischen psychoanalytischen und ethologischen Ansätzen, die Aggressionen als Folge angeborener Aggressionstriebe betrachten (Trieb- und Instinkttheorie nach Freud, Lorenz u.a.), über die Annahme, aggressives Verhalten wäre die Reaktion auf erlebte Frustrationen (Frustrations-Aggressionstheorie nach Dollard, Doob, Miller, Mowrer und Sears), bis zu den lerntheoretischen Erklärungsansätzen, bei denen aggressives Verhalten eine Form der Nachahmung darstellt (Theorie des sozialen Lernens nach Bandura). Daneben existieren soziologische Theorien, die das menschliche Verhalten im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Werten und Normen betrachten (Anomietheorie) und dessen Klassifikation durch gesellschaftliche Definitions- und Zuschreibungsprozesse erklären (Etikettierungstheorie).
Diese und einige neuere Ansätze der Aggressions- und Gewalttheorie lassen sich unter anderem bei Schubarth (2000, S.64) in einer detaillierten Übersicht nachlesen, die auch die aus den Theorien resultierenden Konsequenzen für die Gewaltprävention beinhaltet.
Anhand jener zahlreicher Theorien lässt sich erkennen, dass das Thema Gewalt zwar einerseits umstritten ist, andererseits aber eine breite theoretische Grundlage für die Intervention und Prävention vorhanden ist. Laut Schubarth (2000, S.62) verdeutlicht diese Pluralität an Theorien, „(…) daß es nicht die eine Erklärung oder die Theorie gibt, sondern eine Reihe von Theorien bzw. Erklärungsansätzen für Aggression und Gewalt, die sich gegenseitig ergänzen bzw. die miteinander konkurrieren.“ Man hat erkannt, dass es aufgrund der Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen von Gewalt und deren Bedingungen keine linearen Ursachenzuschreibungen und keine eindimensionale, monokausale Erklärung geben kann. Wenn auch der eine oder andere Ansatz kritisch zu hinterfragen ist, muss doch immer berücksichtigt werden, dass jede dieser Theorien ihren spezifischen Erklärungswert besitzt und somit bei Überlegungen bezüglich der Präventions- bzw. Interventionsmaßnahmen berücksichtigt werden sollte.
Da aber eine ausführliche Vorstellung und Diskussion der Theorien den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, sei hier lediglich auf einige Beispiele weiterführender Literatur verwiesen.[1]
1.2 Ärger
In der Aggressionsforschung unterscheidet man zwischen Aggressionen, die zur Erreichung bestimmter Ziele eingesetzt werden (instrumentelle Aggression) und affektiv - expressiven Aggressionen, die sich spontan und impulsiv als Reaktion auf Wut oder Ärger äußern (vgl. Verres/ Sobez 1980, S.147). Selg, Mees und Berg (1997, S.8) geben aber zu bedenken, dass negative Gefühle wie Ärger oder Wut nicht immer offen gezeigt werden und somit nicht unbedingt in Aggression enden müssen.
Wenn wir uns über etwas ärgern, motiviert uns diese Emotion das Objekt oder Problem über das wir uns ärgern zu beseitigen. Insofern „(…) tendiert jeder Ärger zur Aufhebung des Anlasses (…)“ (ebd. S.9). Wenn uns dies gelingt, haben wir eine Störung entfernt. Mit welchen Mitteln wir die Überwindung eines Hindernisses allerdings vollziehen und welche Kompetenzen und Ressourcen uns dabei zur Verfügung stehen, entscheidet über den Wert des Ergebnisses. So kann beispielsweise eine aggressive Beseitigung des Problems zwar unseren akuten Ärger mindern, aber eine gestörte Beziehung zum Objekt hinterlassen. Andererseits kann eine offene und nicht-aggressive Aussprache mit dem (hier lebendigen) Objekt förderlich für die Beziehung sein.
Wut enthält laut Selg, Mees und Berg (ebd.) „(…) weniger kognitive Anteile [und] weniger Reflexion“ und äußert sich somit spontaner als Ärger. Während sich Wut schnell und explosiv entladen kann, ist Hass eine überdauernde, langfristige Einstellung zu einem Objekt und kann auf dessen Vernichtung zielen (vgl. ebd.).
Da wir aber im Alltag Gefühle von Wut, Ärger oder Hass kaum auseinander halten können und auch im Sprachgebrauch keine exakte Trennung vornehmen, wird hier auf eine genauere Analyse der drei Begriffe verzichtet und im Sinne von Selg, Mees und Berg (ebd. S.10) die Gemeinsamkeit herausgestellt: Alle diese negativen Gefühle haben eine große Affinität zur Aggression und sind deshalb ein Warnsignal, auf das geachtet werden muss, wenn man aggressivem Verhalten vorbeugen möchte. Auf die Verbindung zwischen Ärger und Aggression wird in der Vorstellung des Gewaltpräventionskonzeptes unter 4.3.4 näher eingegangen.
1.3 Gewalt
Schließlich gibt es auch für den Terminus Gewalt (lat. violentia) keinen einheitlichen Wortgebrauch. Laut dem Lexikon der Psychologie (Bd.2, 2001, S.149, zit. nach Theunert 1987) beinhaltet der Begriff den Einfluss eines Stärkeren auf einen Schwächeren und ist somit die „Manifestation von Macht und /oder Herrschaft, mit der Folge, und/oder dem Ziel der Schädigung von einzelnen oder Gruppen von Menschen“, wobei „das Ziel der Gewaltausübung (…) gegenüber der Folge in den Hintergrund“ tritt. Welches Verhalten als Gewalt definiert wird, hängt allerdings von den Werten und Normen einer Gesellschaft ab, wie auch vom subjektiven Empfinden des Gewaltopfers.
Nach Kusche (2001, S.19) verstehen wir unter Gewalt generell „(…) eine soziale Interaktion zwischen Menschen“, die wir mit Gefühlen wie Hass, Wut oder Feindseligkeit verbinden. Somit wäre auch der Begriff Gewalt negativ besetzt. Allerdings gibt es ebenso Ausnahmesituationen, in denen Gewaltübergriffe toleriert werden, wie etwa bei den Attentaten gegen Hitler (vgl. Selg/ Mees/ Berg 1997, S.8).
Einigkeit herrscht jedoch über die Formen und Ausdrucksweisen von direkter Aggression. Diese sind nach Bründel und Hurrelmann (1994, S. 23f) folgende: die körperliche Gewalt, von der Sachbeschädigung bis zur Körperverletzung, die psychische Gewalt (Aus- und Abgrenzungen, oder Mobbing) sowie die verbale Gewalt, die sich durch Beleidigungen, Drohungen oder Diskriminierung äußert. Eine weitere Form der Gewalt ist die strukturelle Gewalt, welche zum Beispiel durch überdimensionierte Leistungsanforderungen ausgeübt wird (vgl. ebd. S.24). Im Übrigen sind die Autoren einer Meinung darüber, dass Gewalt immer nur durch den Kontext einer Situation bestimmt wird, je nach dem was das Opfer, der Täter oder mögliche Beobachter als Gewalt definieren bzw. wie sie die Situation wahrnehmen.
Um aber auch die nicht direkt beobachtbaren Formen physischer und psychischer Gewalt in eine Definition zu integrieren, wird hier Gewalt im Sinne Galtungs als eine „(…) Beeinträchtigung der somatischen oder geistigen Verwirklichung“ eines Menschen definiert, die allerdings auch vermeidbar wäre (Verres/ Sobez 1980, S.39, zit. nach Galtung 1971).
2. Ansätze zur Gewaltprävention
Nachdem die grundlegenden Begriffe dieser Arbeit definiert wurden, soll im folgenden Teil auf das Phänomen der Jugendgewalt an Schulen eingegangen werden, indem ältere und neuere Forschungsergebnisse hinsichtlich der Erscheinungsformen sowie innerschulische und externe Determinanten (Einflussfaktoren) jugendlicher Gewalt vorgestellt werden. Anschließend werden mögliche Handlungsstrategien der Gewaltprävention betrachtet, welche aus den vielfältigen Ursachenzusammenhängen hervorgehen. Inwiefern diese Maßnahmen in schon vorhandenen Präventionskonzepten- und modellen integriert sind, wird sich an kurzen Auszügen dieser Programme zeigen. Dabei werden weniger die Präventionsmöglichkeiten fokussiert, die im Rahmen einer sozialpädagogischen Schule auf Schulebene praktiziert werden, sondern Projekte die sich von außerhalb unterstützend in ein schulisches Gewaltpräventionskonzept einklinken lassen.
Am Ende dieses Kapitels sollen die aufgeführten Programme auf ihre Effektivität hin untersucht werden, um festzustellen, welche konkreten Maßnahmen sinnvoll oder weniger sinnvoll für die praktische Arbeit mit Jugendlichen sein können.
2.1 Problemfeld: Aggressives Verhalten an Schulen
Das Problemfeld ’Gewalt an Schulen’ wurde in Deutschland erstmals in den 90er Jahren zum öffentlichen Thema der Medien und der Forschung (vgl. Holtappels u.a. 1999, S.7). Jedoch gab es schon in den 70er Jahren vereinzelt Studien zur Gewalt an Schulen, die allerdings noch sehr beschränkt waren. Seit den 80ern wurden die Forschungen präziser und konzentrierten sich überwiegend auf die geschlechts-, schulform-, und sozialisationsspezifische Gewalt (vgl. Schwind u.a. 1997, S.30). Anfang der 90er Jahre bekam die Gewaltforschung Hochkonjunktur, da die Medien und die breite Öffentlichkeit einen Anstieg der Jugendgewalt zu registrieren glaubte. Hier wurden auch erstmals Nachforschungen betreffend der Ursachen schulischer und außerschulischer Gewalt angestellt und Informationen über die Gewaltentwicklung gesammelt (vgl. ebd. S.33f). Dennoch etablierte sich erst ab 1993 ein interdisziplinäres Forschungsfeld, aus dem umfangreiche Ergebnisse zum Thema ’Gewalt an Schulen’ hervorgingen (vgl. Holtappels u.a. 1999, S.7). Diese Forschungsergebnisse basieren auf Erhebungen in verschiedenen Städten Deutschlands und verschaffen einen Gesamtüberblick über die damals aktuelle Gewaltrate in den einzelnen Bundesländern. Die aus den empirischen Untersuchungen der Jahre 1970 bis 1999 resultierenden Ergebnisse sollen im Folgenden vorgestellt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse einzelner Schulumfragen bezüglich des Ausmaßes, der Entwicklung und der Erscheinungsformen schulischer Gewalt erheblich variieren, sich aber dennoch ein allgemeiner Trend ablesen lässt.
2.1.1 Ausmaß und Erscheinungsformen
Zunächst muss festgestellt werden, dass nach Ansicht der breiten Öffentlichkeit über die letzten Jahre eine Zunahme jugendlicher Gewalt stattgefunden hat. Ob Gewalt an Schulen tatsächlich vermehrt aufgetreten ist, lässt sich nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Laut Schubarth (2000, S.73f) wurde durch die Ergebnisse vielfältiger Studien in deutschen Städten und Bundesländern übereinstimmend festgestellt, dass eine Dramatisierung der Gewaltbelastung an Schulen den Forschungsergebnissen widerspräche, eine Verharmlosung des Problems aber ebenso unangebracht wäre.
Auch die Bundesjustizministerin Zypries erklärt in ihrer Rede bei den Osnabrücker Friedensgesprächen 2003 eine Dramatisierung für unangebracht. Demnach zeigen „die Zahlen zur Gewaltkriminalität (…), dass wir allen Anlass für präventive Bemühungen haben, dass aber kein Grund für eine Dramatisierung besteht. So machen die Gewalttaten nur einen kleineren Teil der gesamten Straftaten aus“ (Bundesministerium der Justiz, 22.6.2004).
Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes hat die Gewaltkriminalität allerdings bis 2002 stark zugenommen, wobei die leichte Körperverletzung stärker ansteigt als die schwere (vgl. Bundeskriminalamt, 22.6.2004). Allein in den Jahren 2002 und 2003 wurde eine Zunahme der Gewaltdelikte von 3,4 Prozent registriert (vgl. Bundesministerium der Justiz, 22.6.2004). Kein Anstieg ließe sich allerdings bei der Körperverletzung mit Todesfolge feststellen.
Bei Rückschlüssen von den Zahlen der Kriminalstatistik auf die tatsächliche Gewaltenrate muss allerdings zu bedenken gegeben werden, dass heutzutage eine verbesserte Aufhellung des Dunkelfeldes sowie ein verändertes Anzeigeverhalten dazu beitragen, dass mehr Straftaten erfasst werden.
Da Statistiken der Polizei oder der Versicherungen aufgrund ihrer Unvollständigkeit (Dunkelfeld) und Eingrenzung der als kriminell bezeichneten Akte (Mord, Totschlag, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, gefährliche und schwere Körperverletzung, Raub und räuberische Erpressung) nur eine geringe Aussagekraft über das Ausmaß schulischer Gewalt haben, lassen sich die Gewalthäufigkeit und ihre Erscheinungsformen an Schulen mittels Lehrer- und Schülerbefragungen genauer, wenn auch nicht vollständig erfassen. So gibt Volker Krumm (in: Holtappels u.a. 1999, S.76) in seiner „Methodischen Analyse schulischer Gewaltforschung“ zu bedenken, dass Meinungen verschiedener Befragten-Gruppen nicht als Tatsachen ausgegeben werden dürften, da sie eben immer noch der subjektiven Wahrnehmung unterliegen.
Letztendlich lassen sich mindestens genauso viele Studien finden, die einen Anstieg der Gewalt belegen, wie jene, die ihn widerlegen. Dennoch soll im Weiteren eine ungefähre Vorstellung von dem vermittelt werden, was zahlreiche Studien der letzten Jahre befunden haben. Obwohl die Studien unter anderem aufgrund ihrer unterschiedlichen Definitionen und Operationalisierungen des Untersuchungsgegenstandes nur teilweise miteinander zu vergleichen sind, zeichnet sich in ihren Ergebnissen folgender Trend ab:
1. nähme die Zahl extrem schwieriger Kinder zu (vgl. Schwind u.a. 1997, S.46);
2. kämen Formen von Vandalismus, Körperverletzung, Erpressung und Raub sowie Sexualdelikte nicht häufiger als früher vor (vgl. ebd. S.47). Diese härteren Gewalthandlungen würden laut Schubarth (2000, S.87) von einer kleinen Minderheit begangen: „Je härter die Gewaltform, desto weniger tritt sie auf“;
3. Demgegenüber wurde jedoch ein Anstieg der Verrohung der Sprache in Form von Beleidigungen und Beschimpfungen registriert, wobei auch Lehrer Opfer von Beschimpfungen und Beleidigungen wären, allerdings seltener von körperlichen Angriffen der Schüler. Eine grobe Rangfolge ließe sich, so Schubarth (2000, S.83), anhand Untersuchungen in Kassel, Sachsen-Anhalt und Schleswig Holstein erstellen: Demnach dominiere die verbale und psychische vor der physischen Gewalt und dem Vandalismus. Auch eine von 1992-1994 an Schulen von Sachsen-Anhalt durchgeführte Studie kann ihre Ergebnisse dieser Reihenfolge anschließen (vgl. Knopf 1996, S.19). Interessanterweise schätzen die Schüler das Auftreten der einzelnen Gewaltformen durchgehend höher ein als die Lehrer.
4. konzentriere sich die Gewalt auf Sonderschulen, Hauptschulen und Gesamtschulen (vgl. Schwind u.a. 1997, S.47), was eine schulformspezifische Gewalt charakterisiert. So weisen auch einige der bei Holtappels, Heitmeyer, Melzer und Tillmann (1999) vorgestellten Studien darauf hin, dass bei Gymnasiasten weniger gewalttätige Vorfälle zu verzeichnen sind als auf Sonder- oder Hauptschulen (vgl. Tillmann, S.16; Lösel u.a., S.150 sowie Knopf 1996, S.14). Während an Gymnasien nur knapp ein Drittel der Lehrer eine Gewaltzunahme wahrnimmt, belaufen sich die Zahlen an Förderschulen auf ganze 90%, so Schubarth (2000, S.75). Kusche (2000, S.154) führt die hohe Gewaltenrate auf Schulen der individuellen Lernförderung unter anderem auf einen „niedrigschwelligen Umgang der Eltern und Geschwister mit Gewalt“ zurück;
5. würden Jungen den Großteil bei der physischen Gewalt ausmachen, Mädchen hingegen eher auf der verbalen Gewaltebene agieren, wobei aber generell auf beiden Seiten eine Verrohung der Sprache zu verzeichnen sei (vgl. Schwind u.a. 1997, S.47). Gewalt ist also ein überwiegend männliches Phänomen, wobei sich diese hauptsächlich auf körperliche Gewaltanwendungen konzentriert (vgl. Tillman 1999, S.16; Bundeskriminalamt, 22.06.2004). Mädchen tendieren zwar eher zu verbalen Aggressionen gegenüber ihren Mitschülern und Mitschülerinnen, weisen aber auch eine höhere Kriminalitätsfurcht auf, so Schubarth (2000, S.87). Dass Mädchen dennoch gleichermaßen aggressive Gefühle verspüren wie Jungen, diese aber in einer anderen, oft auch gegen sich gerichtete Weise zeigen, ist nach Popp (in: Holtappels u.a. 1999, S.220f) eine wichtige Erkenntnis, die bei Präventions- bzw. Interventionsmaßnahmen berücksichtigt werden muss. Demnach ist eine geschlechtsspezifische Jungen- und Mädchenarbeit notwendig, um einen vorurteilsfreien Umgang miteinander zu ermöglichen;
6. liege der „Höhepunkt der Aggressionen (…) bei den siebten und achten Schuljahren, also in den Pubertätsjahren; dabei geben die befragten Schüler selbst an, dass die Gruppengewalt zunimmt; d.h. Gruppen von Schülern greifen einzelne Mitschüler an bzw. setzen sie unter Druck“ (Schwind u.a. 1997, S.47);
7. sei es laut Bründel und Hurrelmann (1994, S.27) zu einer Veränderung der Intensität jugendlicher Gewalt gekommen, vor allem der körperlichen Gewalt. Die subjektive Wahrnehmung der Lehrer und Schüler registriere ein geringeres Mitgefühl und eine sinkende Hemmschwelle bei ansteigender Gewaltbereitschaft. Gewalt an Schulen äußere sich heutzutage auf brutalere und skrupellosere Art und Weise als früher. So bedürfe es heutzutage keinem extremen Anlass um sich zu prügeln. Auch Kusche (2000, S.51) kommt zu dem Resultat, dass sich „nicht die Quantität, sondern die Qualität“ der physischen Gewalt verändert hat;
8. schließt Marek Fuchs (in: Holtappels u.a. 1999, S.134) aus den Ergebnissen einer in Bayern durchgeführten Studie zum Thema „Ausländische Schüler und Gewalt an Schulen“, dass die Nationalität der Schüler eine verschwindend geringe Bedeutung für das Gewaltverhalten an Schulen hat. Mit dem stimmt eine Vielzahl anderer Studien überein;
9. bestehe noch Uneinigkeit über den gewaltfördernden Einfluss von „(…) schlechten Schulleistungen und Leistungsdruck, der Größe der Klassen und Schulen, [und] der Architektur des Gebäudes (…)“ (Schwind u.a. 1997, S.47); und
10. existieren laut Olweus (2002, S.42f) typische Täter- und Opfermerkmale. Demnach ist das typische Opfer ängstlicher und unsicherer als es SchülerInnen im Allgemeinen sind. Außerdem ist es oft vorsichtig, empfindsam und still. Ein charakteristisches Opfermerkmal sei ein niedriges Selbstvertrauen und eine negative Einstellung gegenüber Gewalt. Passivität, körperliche Unterlegenheit sowie negative Selbsteinschätzung wären wesentliche Faktoren dafür, dass man eher zum Opfer von Gewalthandlungen anderer werde.
Insgesamt sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die isolierte Betrachtung der Charakteristika eines Opfers eine Viktimisierung nicht erklären kann. Darüber hinaus zeigen viele Opfer die oben beschriebenen Verhaltensweisen nicht, so Olweus (ebd.).
Der typische Gewalttäter hingegen will Macht ausüben, was ihm durch seine körperliche Überlegenheit meist auch gelingt. Er reagiert schnell aggressiv, da er seiner Umgebung oft schon feindselig gegenüber steht und kaum noch positive Resonanz seiner Mitmenschen wahrnimmt. Allerdings wäre auch anzunehmen, dass einige der aggressiven Schüler gleichzeitig ängstlich oder passiv seien. Jene werden von Olweus (ebd.) als „passive Gewalttäter, Mitläufer oder Gefolgsleute“ bezeichnet.
Generell lassen sich die Befunde der einzelnen Studien nur unter Vorbehalt generalisieren und sind deshalb lediglich tendenzielle Kriterien für die präventive Gewaltarbeit. Auch wenn ein dramatischer Anstieg der schulischen Gewalt weder durch Statistiken, noch durch Befragungen eindeutig belegt werden kann, ist die Situation insgesamt beunruhigend und fordert alle am Erziehungsprozess Beteiligten verstärkt dazu auf, sich an Gewaltpräventionsprogrammen zu beteiligen.
2.1.2 Risikofaktoren für die Entstehung
Um in der Gewaltprävention tätig zu werden, muss man sich die Frage stellen, was Jugendliche zu gewalttätigem Verhalten veranlasst, wobei zahlreiche Untersuchungen belegen, dass man bei der Ursachenforschung von gewalttätigem Verhalten nicht eindimensional denken darf, sondern sich einer Pluralität der Risikofaktoren, die das Verhalten Jugendlicher beeinflussen, bewusst sein sollte. Es existiert also eine Vielzahl situativer und sozial-struktureller Bedingungen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Einfluss auf die Art, die Intensität und die Häufigkeit zwischenmenschlicher Aggressionen nehmen. Kommen bei einem Kind oder Jugendlichen mehrere solcher ungünstigen Bedingungen zusammen, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Betroffene ein von Aggressionen geprägtes Verhaltensmuster entwickelt.
Als die hauptsächlichen Ursachen schulischer Gewalt nennen Schwind, Roitsch, Ahlborn und Gielen (1997, S.48) in Bezug auf die Forschungsergebnisse die familiären Verhältnisse der Jugendlichen, den Medienkonsum, soziale Benachteiligung sowie Überforderung und andere schulinterne Einflüsse. Meyenberg und Scholz (1995, S.43) fügen ergänzend die „Verschiebung von Leitbildern“ und einen „allgemeinen Werteverlust“, „Probleme in der sozialen Integration“ oder auch die „Identitätskrisen“ der Jugendlichen hinzu. Hier wird deutlich, dass das Individuum in seinem Verhalten nicht nur durch sein soziales Umfeld geprägt wird, sondern eben auch durch individualistische Persönlichkeitsfaktoren. Dabei spielt wie bereits erwähnt das jeweilige Geschlecht eine Rolle sowie auch der „individuelle Stimulationsbedarf“ oder die „Gewissenhaftigkeit“ der Person (vgl. Funk/ Passenberger 1999, S.258).
Außerschulische Faktoren, wie familiäre Verhältnisse, der Einfluss der Peer-Gruppe (Freundeskreis), der Konsum von Mediengewalt oder die gesellschaftliche Benachteiligung und Wandlungsprozesse sind sicherlich die meist genannten Ursachenbeschreibungen. Da sich Kinder und Jugendliche aber zum größten Teil des Tages in der Institution Schule aufhalten, stellt sie ein wichtiges Sozialisationsfeld und somit auch Interventionsfeld dar. Schulen sind keine Inseln der Gewalt, jedoch muss auch dort, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, nach spezifischen Möglichkeiten zur Gewaltprävention gesucht werden.
So deuten die aus einer Cluster-Analyse zu Täter-Opfer-Typologien resultierenden Ergebnisse darauf hin, dass Einflussfaktoren in familiären und milieuspezifischen Kontexten zu finden sind, aber eben auch innerhalb der Schule in Form von „(…) Lehrerverhalten, Leistungsdruck, Leistungsattribuierung, Desintegration in der Klasse/Schule und Individuum-Klasse-Beziehungen (…)“ (Rostampour/ Melzer 1999, S.188) bestehen. Doch auch Langeweile, Lärm im Unterricht oder Unterforderung können nach Schubarth (2000, S.99) Auslöser schulischer Gewalt darstellen.
Wenn Jugendliche mit überhöhten Leistungsanforderungen, Konkurrenzdruck, Macht- und Besitzverhältnissen konfrontiert werden, denen sie nicht genügen können, reagieren sie mit Hilflosigkeit, Ärger oder Minderwertigkeitsgefühlen. Im Bildungs- und Arbeitssystem nicht mithalten zu können, erzeugt bei Jugendlichen nicht nur Gefühle der Zukunftslosigkeit, sondern ein generelles Misstrauen gegenüber gesellschaftlichen Anforderungen. Diese Ohnmacht äußert sich nicht selten in aggressiven Trotzreaktionen, so Bründel und Hurrelmann (1994, S. 266). Insbesondere auf dem Hintergrund der Modernisierungs-, Enttraditionalisierungs- und Individualisierungsprozesse in unserer Gesellschaft wird von der heutigen Jugend verstärkt Eigenverantwortung und Selbstinszenierung erwartet, mit denen sie schnell überfordert sind (vgl. Sickendieck 1999, S.143). Durch die Selektion und den Konkurrenzdruck gerade im schulischen Bereich wird eine soziale Integration immer schwieriger und defizitäre Verhaltensformen wie Sucht, Verwahrlosung oder Gewalt immer wahrscheinlicher.
Viele der Jugendlichen reagieren mit Rückzug und Abgrenzung von der Gesellschaft und ihren Regeln, wenn sie keinen Rückhalt durch ihre Mitmenschen erhalten und sie den gesellschaftlichen wie schulischen Anforderungen nicht Stand halten können. Die begehrte Anerkennung und Prestige finden diese Jugendlichen dann häufig in ihren Peer-Gruppen, was jedoch meist nur „(…) durch Mithalten auf einem bestimmten materiellen Niveau, durch Gleichziehen in Aussehen, Auftreten, Kleidung (Markenprodukte) und Taschengeld“ oder durch die Gewaltausübung zu erreichen ist, so Bründel und Hurrelmann (1994, S.268).
So sammelt der Mensch als Mitglied vieler sozialer Gruppen, wie der Familie, der Schule, dem Ausbildungsplatz oder dem Freundeskreis, reichhaltige Sozialisationserfahrungen, die ihn in seinem Handeln beeinflussen. Während ihm diese Erfahrungen einerseits hilfreich bei der Bewältigung seiner Entwicklungsaufgaben sein können, laufen sie immer auch Gefahr falsch interpretiert zu werden. Dementsprechend erfolgt aggressives Verhalten aus einer Ursachenpluralität, wobei diese Faktoren in Zusammenhang mit gewalttätigem Verhalten stehen können, jedoch nicht zwangsläufig zu gewalttätigem Verhalten führen müssen.
Im Rahmen dieser Arbeit soll nicht weiter auf den Einfluss der vielfältigen sozialen und gesellschaftlichen Kontextfaktoren eingegangen werden, da eine begrenzte Gewaltpräventionsmaßnahme wie „Locker bleiben“ keinesfalls alle Ursachen schulischer Gewalt beheben kann und sich somit vorwiegend auf schülerorientierte Maßnahmen beschränkt.
2.2 Handlungskonzepte für die Gewaltprävention an Schulen
Aus der Erkenntnis einer Ursachenvielfalt wird die Konsequenz gezogen, dass Präventiv- oder Interventionsmaßnahmen in unterschiedlichen Bereichen ansetzen müssen, um alle Ursachen größtmöglich abzudecken. Generell lassen sich einige Maßnahmen zu übergeordneten Handlungsstrategien zusammenfassen, die in diesem Kapitel dargestellt werden sollen. Dass es über diese Maßnahmen hinaus andere sinnvolle Ansatzpunkte gibt, soll dabei nicht bestritten werden.
Vorweg werden dafür die zentralen Motive jugendlicher Gewalt nach Nolting (2001, S.151) dargestellt, um die daraus resultierenden präventiven Maßnahmen zu erläutern:
- „Expressive Aggression“ als impulsive Unmutsäußerung (durch fehlende Selbstkontrolle und Frustrationstoleranz);
- „Vergeltungsaggression“, die sich durch Ärger, Groll, Hass usw. als Folge von Provokation äußert (durch fehlendes Selbstvertrauen und der Unkenntnis alternativ- konstruktiver Handlungsmöglichkeiten; zur Wiederherstellung des Selbstwertgefühls);
- „Bedrohungs- und Abwehraggression“ mit der Funktion der Schadensabwendung (instrumentell; durch das Fehlen alternativ- konstruktiver Handlungsmöglichkeiten; zur Abwehr von Gefahr);
- „Erlangungsaggression“ mit dem Ziel der Erhaltung von Vorteilen (durch fehlende Selbstkontrolle, da verschobene, unbewusste Impulse dominieren; die Schädigung ist nicht die eigentliche Intention; zur Erlangung von materiellem Gewinn, Beachtung oder Anerkennung);
- „Spontane Aggression“, wobei die Schmerzzufügung emotionale Befriedigung verschafft und die eigene Identität erfahrbar macht (auch hier durch fehlende Selbstkontrolle, da die Grenzen des Gegenübers nicht angemessen wahrgenommen werden).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jugendliche in der konkreten Situation aus Motiven der egoistischen Durchsetzung, des Frust- oder Ärgergefühls und/oder der angstmotivierten Aggression gewalttätig werden. Daraus lassen sich Tendenzen pädagogischer Arbeit ableiten die eine Förderung folgender Kompetenzen beinhalten: die der Selbstkontrolle, der Selbstbehauptung und des empathischen Einfühlens in andere sowie die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Frustrationstoleranz. Überdies ist eine Förderung alternativer Handlungsfertigkeiten, wie beispielsweise der Kommunikationskompetenz, angebracht. Auf die hier genannten Ansatzpunkte wird in den nachstehenden Kapiteln näher eingegangen.
2.2.1 Grundlagen der Gewaltprävention
Um den beschriebenen Formen aggressiven Verhaltens vorzubeugen, sollten Gewaltpräventionsprogramme grundsätzlich bestimmte Maßnahmen beinhalten, die bei Martin (1999) in seinen zwölf Grundformen von Gewaltprävention integriert sind. Es handelt sich um die Identitätsstärkung der Jugendlichen, die Vermittlung von gesellschaftlich anerkannten Werten und Normen sowie die Berücksichtigung gruppenspezifischer Antriebe und Prozesse.
Da Gewaltakte gegenüber Menschen immer Ausdruck einer bestimmten Kommunikation und Interaktion sind, und die „(…) menschliche Interaktion das Medium darstellt, in dem Jugendliche ihre Identität, Ich-Stärke oder Identitätsdiffusion, ausbilden“ (Martin 1999, S.123), ist es wichtig, den Jugendlichen Möglichkeiten einer gesunden Interaktion aufzuzeigen. Wenn Jugendliche aufgrund ihrer unangemessenen Verhaltensweisen Ausgrenzung, Benachteiligung oder Etikettierung erfahren, wirkt sich dies negativ auf ihre Identitätsbildung aus und kann zu asozialen Werteinstellungen führen (vgl. ebd. S.124).
Ein weiteres gewaltpräventives Vorgehen ist die Förderung prosozialer Werteinstellungen Jugendlicher. Prosoziales Verhalten zielt darauf ab, „(…) anderen Personen Erleichterung oder Verbesserung der Lebenssituation zu verschaffen“, so Verres und Sobez (1980, S.139, zit. nach Lück 1975), ihnen also in Misslagen zu helfen. Fremden Menschen zu helfen scheint jedoch in der heutigen Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich zu sein. Dies hängt nicht zuletzt mit dem gesellschaftlichen Wandel zusammen. Durch den im Laufe der Individualisierung und Modernisierung entstandenen Wertepluralismus wurden die Werte und Normen unserer Gesellschaft immer verschwommener und sind durch die verstärkte Eigenverantwortung und Selbstinszenierung schwieriger realisierbar geworden. Das Individuum ist dementsprechend verstärkt um seinen eigenen Vorteil bemüht, anstatt sich selbstlos um das Wohl anderer zu kümmern. Hinzu kommt, dass die moralische Erziehung seitens der Eltern immer häufiger durch die Medien abgelöst wird. Helden aus Spielfilmen, die oft nur durch gewalttätiges Handeln allgemein anerkannte Normen und Werte der Gesellschaft verteidigen können, laden laut Bründel und Hurrelmann (1994, S.192) „(…) geradezu zur Identifikation ein.“ Gewaltanwendungen können dadurch fälschlicher Weise als Mittel zum Zweck interpretiert werden. Auch in manchen Computerspielen wird Gewalt als Wettbewerb dargestellt und mit positiv besetzten Werten wie Patriotismus oder Kameradschaft verbunden (vgl. ebd. S.193). Eine Moralerziehung seitens der Eltern, Lehrer oder Sozialpädagogen sollte aber nicht aus einer rein „kognitiven Verabreichung von Wertekatalogen“ bestehen, sondern muss den Jugendlichen durch Erfahrungen, Diskussionen sowie Urteilsfindung und Urteilsrevision bewusst gemacht werden (vgl. Moning-Konter 2003, S.49). Zudem garantiert die Kenntnis geltender Normen und Werte nicht, dass sich auch nach ihnen gerichtet wird.
Wie empirische Untersuchungen erwiesen haben, ist Jugendgewalt überwiegend ein Gruppenphänomen, bei dem Gruppendynamik und Konformitätsdruck eine wichtige Rolle spielen (vgl. Martin 1999, S.160). Wie man in einer Gruppe agieren kann, ohne von seiner individuellen Meinung und Sichtweise abzurücken, kann sehr gut in der Gruppenarbeit im Unterricht oder im Rahmen eines Trainings verdeutlicht werden. Dabei vollziehen sich innerhalb einer Gruppe Prozesse der Rollenzuschreibung, Ausgrenzung oder des Gruppenzwangs. Diesen Prozess zu beobachten und gegebenenfalls aufzulösen bzw. zu klären, ist eine wichtige Vorraussetzung für eine gelingende Gruppenarbeit, in der Vertrauen und Gemeinsinn bestehen (vgl. ebd.). Eine entspannte Atmosphäre kann z.B. durch Gruppen- oder Vertrauensspiele aufgebaut werden, in denen sich die Jugendlichen untereinander besser kennen lernen und sich ihre Ängste gegenseitig anvertrauen können. Bis eine vertraute, aber offene Gesprächsgrundlage hergestellt werden kann, in der sich niemand ängstigt oder zurückgewiesen fühlt, jede Meinung akzeptiert und toleriert wird, bedarf es einiger beziehungsstiftender und vertrauensfördernder Interaktionen aller Beteiligten.
Im Folgenden sollen vier übergeordnete Ansätze der Gewaltprävention vorgestellt werden, aus denen eine Vielzahl von Präventions- und Interventionskonzepten hervorgegangen sind. Dabei konzentrieren sich manche dieser Konzepte nur auf eine dieser Strategien, andere integrieren noch Maßnahmen über diese hinaus. Die Handlungsansätze sind in dem Sinne gegliedert, dass sie von Möglichkeiten auf der personellen Ebene, über die der Interaktion, bis zu Maßnahmen auf der Schulebene reichen.
2.2.2 Förderung der Selbstkontrolle und der Selbstsicherheit
Selbstkontrolle und Selbstsicherheit erscheinen uns im Allgemeinen als erstrebenswerte Eigenschaften, um uns zu einer reifen, verantwortungsvollen und selbstbewussten Persönlichkeit entwickeln zu können. Ersteres, um nicht unreflektiert und willkürlich all unseren akuten Bedürfnissen nachzugehen und letzteres, um die vielen Anforderungen in unserer Entwicklung bewältigen zu können. Inwiefern die Förderung beider Kompetenzen aggressivem Verhalten vorbeugen kann wird nachstehend aufgezeigt.
2.2.2.1 Selbstkontrolle
Sein Verhalten kontrollieren zu können bewerten wir auf den ersten Blick als wünschenswerter und erfolgsversprechender als ein impulsives Auftreten. Doch laut Logue (1996, S.65) „(…) ist das Endergebnis einer normalen Entwicklung eine Persönlichkeit, die in der Lage ist, je nach Situation impulsiv oder selbstkontrolliert zu handeln (…).“ Gerade Kinder reagieren vorwiegend impulsiv (vgl. ebd. S.66), was einerseits negative Folgen haben kann, ihnen andererseits aber auch Spontanität und Lebensfreude ermöglicht.
Dass ein gewisses Maß an Spontanität sehr förderlich sein kann, soll hier nicht geleugnet werden. Welches Verhalten der Situation nach angemessen erscheint, hängt allerdings stark vom situativen Kontext ab. Ein selbstkontrolliertes Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass ein momentanes Bedürfnis zugunsten eines langfristig größeren Vorteils aufgeschoben wird (vgl. ebd. S.30). Inwiefern ein kontrolliertes Verhalten für die angemessene Bewältigung einer Konfliktsituation notwendig ist, soll hier näher erörtert werden.
Lückert & Lückert (2000, S.348) betrachten Selbstkontrolle als dann erforderlich, „(…) wenn wir ein unerwünschtes Verhalten unterbrechen und uns von ihm lösen wollen. Die zur Lösung dieses Konflikts herangezogenen Verhaltensweisen bezeichnen wir als Selbstkontrolle.“ In diesem Falle geht es um die Lösung des Konflikts zwischen aggressivem und friedlichem Verhalten.
Sich und sein Verhalten steuern und kontrollieren zu können, ist ein Anliegen der Verhaltenstherapie bzw. der Selbstkontrolltherapie (vgl. Lexikon der Psychologie, Bd.4, 2001, S.135). Sie geht im Sinne der klassischen Lerntheorie davon aus, dass Verhaltensweisen durch operantes Konditionieren, also durch Erfolge oder Misserfolge, erworben und verinnerlicht werden und folglich durch positive Verstärkung (Lob, Belohnung, Aufmerksamkeit, etc.) oder negative Konsequenzen (Bestrafung, Tadel, Nichtbeachtung, Schläge, etc.) beeinflussbar sind (vgl. Liebel 1992, S.35). Da Bestrafungen allerdings nur zeitlich und situativ begrenzt Wirkung zeigen, handelt es sich hierbei weniger um einsichtiges Verhalten, als um eine „(…) Aggressionshemmung aus Angst vor Strafe“, so Nolting (2001, S.119). Laut Montada (Oerter/ Montada 1995, S.867) haben einige Experimente beweisen können, dass eine einsehbare Begründung strenge Strafen überflüssig macht. Demzufolge ist die positive Verstärkung friedlichen Verhaltens bzw. eine angemessene, am Fehlverhalten des Kindes oder Jugendlichen orientierte Konsequenz vorzuziehen, wenn eine auf Einsicht basierende Erziehung angestrebt wird.
Wenn nun eine gewaltfreie Konfliktregelung (langfristig) positivere Konsequenzen verspricht als das spontane Abreagieren von Aggressionen - hier kann eine kurzfristige Befriedigung auftreten-, könnte der Jugendliche die gewaltlose Schlichtung vorziehen. Doch dafür benötigt er nicht nur die Fähigkeit, sich und sein Verhalten kontrollieren zu können. Obendrein müssen ihm die positiven wie negativen Konsequenzen seines Verhaltens bewusst gemacht werden und dies möglichst vor der Konfliktsituation, da impulsive Aggressionen in der konkreten Situation kaum Raum für Abwägungen offen halten. Demnach könnte insbesondere der spontanen oder expressiven Aggression durch eine verbesserte Selbstkontrolle vorgebaut werden.
Inwiefern ein selbstkontrolliertes Verhalten also als positiv zu bewerten ist zeigt sich an folgendem Beispiel: Ein Jugendlicher, der aufgrund einer Provokation oder Frustration Ärger verspürt und sich somit in einer Konfliktsituation befindet, steht vor der Wahl zwischen einer gewaltlosen Reaktion, die langfristig positive bzw. keine negativen Konsequenzen nach sich ziehen würde und der gewalttätigen Auseinandersetzung, die eventuell eine kurze Befriedigung verschaffen, auf lange Sicht aber negative Konsequenzen haben könnte, wie zum Beispiel die einer Anzeige wegen Körperverletzung. Wenn ihm diese möglichen Konsequenzen aber nicht bewusst sind, oder er sie sich in der konkreten Situation nicht vergegenwärtigt, wird er höchstwahrscheinlich seinem spontanem Impuls Vorrang geben, um eine schnelle Befriedigung zu erzielen.
Nehmen wir an, er ist sich den positiven wie negativen Folgen bewusst, entweder aufgrund seiner Erfahrungen in ähnlichen Situationen oder weil sie ihm zuvor aufgezeigt wurden, und er steht wieder vor der Wahl einer impulsiven oder kontrollierten Reaktion. Vorausgesetzt dem Jugendlichen erscheinen die positiven Folgen einer nicht-aggressiven Auseinandersetzung erstrebenswerter als die kurzfristige emotionale Befriedigung einer spontanen Aggression, wird er sich wahrscheinlich zugunsten einer kontrollierten Reaktion entscheiden. Dies setzt allerdings ein Verhaltensrepertoire voraus, aus dem der Jugendliche eine angemessene Verhaltensweise wählen kann.
Um ihm diese Entscheidung zu erleichtern, sollten dem Jugendlichen demnach nicht nur die unmittelbaren und langfristigen Vorteile selbstkontrollierten Verhaltens aufgezeigt werden, sondern vor allem auch die negativen Konsequenzen, die auf gewalttätiges Verhalten folgen können.
Damit sich der Jugendliche gegen eine impulsive Aggression entscheidet, müssen ihm Alternativreaktionen aufgezeigt werden, damit er weiß, wie er sich stattdessen verhalten kann. Dies bedeutet aber auch, dass auf eine friedliche Streitschlichtung eine positive Resonanz (Lob, Belohnung) folgen sollte, was immer noch schnell in Vergessenheit gerät. Hilfreich ist eine Verkürzung der Zeitspanne zwischen nicht-aggressivem Verhalten und einer positiven Konsequenz. Letztendlich hat Selbstkontrolle zum Ziel „(…) das Verhaltensrepertoire unabhängig von externer Kontrolle aufrechtzuerhalten“, so Reinecker (1978, S.36), was ein operantes Konditionieren überflüssig machen würde.
Wenn Kinder und Jugendliche lernen, ihre Gefühle und ihr Verhalten zu beobachten, ihre akuten Impulse aufzuschieben bzw. zu kontrollieren und in kritischen Situationen alternative Handlungsstrategien anzuwenden, werden sie durch die daraus resultierenden Erfolgserlebnisse bestätigt und ihr Verhalten im Sinne der Selbstverstärkung gefestigt (vgl. ebd. S.104).
2.2.2.2 Selbstsicherheit
Um die gesellschaftlichen Anforderungen bewältigen zu können, bedarf es vieler emotionaler wie sozialer Kompetenzen um einer Überforderung oder sozialen Ängsten vorzubeugen. Dies beinhaltet die Fähigkeit mit sozialen Ängsten oder Unsicherheiten umgehen zu können, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und angemessen auszudrücken sowie schwierige Situationen meistern zu können. „Besonders schwierige Situationen bestehen in der Regel darin, ’Nein zu sagen’ und ’sich von anderen abzugrenzen’ (Lexikon der Psychologie, Bd.4, 2001, S.143). Dementsprechend äußert sich Selbstsicherheit in selbstbestimmtem Verhalten (vgl. Paulus 1994, S.275). „Selbstbestimmung in sozialer Verantwortung“ bedeutet frei und selbstverantwortlich über sein Verhalten entscheiden und die daraus resultierenden Konsequenzen einkalkulieren zu können (vgl. ebd.). Dafür ist ein Mindestmaß an Selbstsicherheit Voraussetzung, um in schwierigen Situationen in der Lage zu sein, die richtige Verhaltensweise zu wählen. Außerdem berücksichtige selbstsicheres Verhalten „(…) die Bedürfnisse und Wünsche der Umwelt und im Konfliktfall, d.h. in einer Situation, in der eigene und Umweltbedürfnisse unterschiedlich, vielleicht sogar gegensätzlich sind, wird eine Lösung im Kompromiß gesucht“, so Liebel (1992, S.71).
Wo selbstsicheres Auftreten jedoch durch Ängste oder Phobien verhindert wird, kann nicht selbstverantwortlich und angemessen reagiert werden. Daraus ergeben sich Teilziele eines Selbstsicherheitstrainings, wie beispielsweise das Erlernen, seine Anliegen und Wünsche deutlich zu formulieren und sie mittels angemessener Verbalisierungstechniken durchzusetzen (vgl. Lexikon der Psychologie, Bd.4, 2001, S.143). Dies darf allerdings nicht mit dem egoistischen Durchsetzen eigener Bedürfnisse zum Nachteil anderer verwechselt werden.
Wenn Jugendlichen geholfen wird sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst zu werden sowie ihre Wünsche zu artikulieren und mit kommunikativen Mitteln durchzusetzen, gewinnen die Jugendlichen an Handlungskompetenz und können schwierige Situationen besser bewältigen. Je öfter solche Verhaltensweisen erfolgreich eingesetzt werden konnten, desto selbstsicherer werden die Jugendlichen in ihrem Verhalten. „Um das eingeübte Verhalten aufrechtzuerhalten, lernen die Teilnehmer [eines Selbstsicherheitstrainings] Selbstkontrollstrategien; (…)“ (ebd.), mit denen sie beispielsweise Angstgefühle zugunsten eines angestrebten Ziels kontrollieren können. Demzufolge sind Strategien der Selbstkontrolle auch eine wichtige Voraussetzung für das selbstsichere Auftreten eines Menschen in sozialen Konfliktsituationen.
Somit bewirkt eine Förderung der Selbstkontrolle wie auch der Selbstsicherheit eine Kompetenzerweiterung auf emotionaler wie auch sozialer Ebene. Auf ihre Umsetzung wird im Verlauf der Vorstellung des Projektes „Locker bleiben“ näher eingegangen.
2.2.3 Stärkung der sozialen und emotionalen Kompetenz
Nachdem die speziellen Kompetenzen Selbstkontrolle und Selbstsicherheit aufgezeigt wurden, sollen nun auch andere Fertigkeiten beschrieben werden, die das menschliche Verhalten beeinflussen. Dieses Kapitel wird eine Übersicht ineffektiven bzw. inkompetenten Verhaltens sowie die Notwendigkeit einer Förderung kompetenten Verhaltens zugunsten einer gewaltlosen und selbstsicheren Interaktion der Jugendlichen aufzeigen.
Um in sozialen Interaktionen handlungsfähig zu sein, bedarf es bestimmter kognitiver, emotionaler, kommunikativer und sozialer Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten liegen laut dem Lexikon der Psychologie (2001, Bd.4, S.197) dann vor, „(…) wenn eine Person in einer sozialen Situation einerseits in der Lage ist, eigene Ziele weitestgehend zu verwirklichen und dabei andererseits eine soziale Akzeptanz dieses Verhaltens gewährleisten kann.“ Hierbei wird deutlich, dass nicht nur die Durchsetzung individueller Bedürfnisse ein Ziel der Verwirklichung darstellt, sondern eben gerade auch die soziale Anpassung an gesellschaftliche Ansprüche und Situationsbedingungen. Auftretende Schwierigkeiten bei der hier erforderlichen Kompromissfindung können durch bestimmte Fertigkeiten besser überwunden werden, die im Folgenden näher erklärt werden sollen.
2.2.3.1 Soziale Kompetenz
Um festzustellen, was unter sozialer Kompetenz zu verstehen ist und wie sie im Sinne der Gewaltprävention gefördert werden sollte, wird zunächst auf das Fehlen solcher Kompetenzen und dessen Folgen eingegangen.
Hintergrund inkompetenten Verhaltens sind soziale Unsicherheiten, die laut Petermann & Petermann (2000, S.53ff) aus biologischen, psychischen oder sozialen Faktoren resultieren. Auch nach Lückert & Lückert (2000, S.107) gründen die sozialen Ängste „(…) in Selbstunsicherheit und einem Mangel an Selbstbehauptung.“ So können beispielsweise fehlende Gelegenheiten zum sozialen Lernen oder ein Mangel an positiver Verstärkung ein Hilflosigkeitsverhalten im Umgang mit anderen Menschen auslösen. Sozial ängstliche Personen befürchten häufig, von anderen nicht beachtet oder abgelehnt zu werden, oder sie haben Angst vor Konflikten, öffentlichen Reden, Autoritätspersonen oder davor Kritik zu äußern (vgl. ebd.). Die Angst auslösenden Situationen sind daher häufig diejenigen, die aufgrund von sozialer Inkompetenz nicht befriedigend bewältigt werden können. Wenn sich bei Kindern bzw. Jugendlichen soziale Ängste manifestiert haben, vermeiden sie ähnliche Situationen sozialer Interaktion schlimmstenfalls auch in der Zukunft (vgl. Pfingsten/ Hinsch 1991, S.24). Aufgrund dessen setzen Kompetenztrainings wie das von Petermann & Petermann (2000) bei Ängsten und Phobien von sozial unsicheren Kindern an.
Um Situationen, in denen man nicht weiß wie man sich angemessen verhalten soll, unter Kontrolle zu bekommen, reagiert man seinem Vermögen entsprechend (vgl. Petermann/ Petermann 2000, S.60f). Diese Reaktion kann vielerlei Formen haben, allerdings eben auch die der Aggression. Die Wahrscheinlichkeit einer aggressiven Reaktion nimmt zu, je weniger Wahlmöglichkeiten verschiedener Verhaltensweisen vorhanden sind. Aggressives Verhalten resultiert folglich vornehmlich aus einem Mangel an emotionalen und kognitiven Kompetenzen sowie der Unfähigkeit, durch Alternativreaktionen die Situation zu bewältigen.
Wie sehen nun aber die Fertigkeiten aus, die sozial kompetentes Verhalten garantieren? Laut Schwarz (1990, S.28) drückt sich soziale Kompetenz als Fähigkeit folgendermaßen aus:
„(…) aufgrund der Einsicht in die Bedingungszusammenhänge einer sozialen Situation [können] individuelle Ansprüche und Interessen der Beteiligten erkannt, gegeneinander sowie gegen allgemeine Normen, Regeln und Prinzipien menschlichen Zusammenlebens abgewogen, Verhaltensalternativen daraufhin beurteilt werden (…), inwieweit sie geeignet sind, die bestehende Situation in eine für direkt und indirekt Betroffene dauerhaft befriedigendere Situation zu überführen und als geeignet erkanntes Verhalten zu realisieren (…).“
Daraus wird ersichtlich, dass sozial kompetentes Verhalten „eine differenzierte soziale Wahrnehmung, eine komplexe soziale Urteilsfähigkeit und ein umfassendes Repertoire an sozialen Handlungsweisen“ (Jugert u.a. 2002, S.9) voraussetzt. Um dieses mehrschichtige Fähigkeitsrepertoire zu konkretisieren lässt sich eine Vielzahl von Teilaspekten herausstellen, die für sozial verantwortliches Verhalten maßgeblich sind. Grundsätzlich ist die Ablehnung von Aggressionen Basis eines friedfertigen Umgangs. Um soziale Situationen und ihre Dynamiken richtig einschätzen zu können, bedarf es der Einsicht in soziale Zusammenhänge und der Reflexion solcher Situationen. Aber auch die Erkenntnis der eigenen sozialen Verantwortung ist zwingend erforderlich.
Als maßgebliche Fertigkeiten sozialer Interaktion werden von mehreren Autoren die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, die Kenntnis von Problemlösungsstrategien sowie Kontakt-, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten genannt (vgl. Jugert u.a. 2002, S.11; Schwarz, 1990, S.29; Pfingsten/ Hinsch, 1991, S.4).
Diese lassen sich weiter konkretisieren. So listen Pfingsten und Hinsch die bei Gambrill dargestellten Beispiele sozial kompetenter Verhaltensweisen auf, die sich folgendermaßen zusammenfassen lassen: Es handelt sich dabei um die Fähigkeit der Durchsetzung eigener Rechte (z.B. Nein-Sagen, Änderungen bei störendem Verhalten verlangen oder Unterbrechungen im Gespräch unterbinden), die Fähigkeit Beziehungen aktiv zu gestalten (z.B. unerwünschte Kontakte beenden oder auf Kontaktangebote reagieren) sowie mit Gefühlen und Lob bzw. Kritik umzugehen, aber auch, sich entschuldigen zu können (vgl. Pfingsten/ Hinsch 1991, S.3, zit. nach Gambrill 1977).
Um uns in einer Interaktion angemessen verständigen zu können, benötigen wir insbesondere die erwähnte Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Da in der Gesellschaft aber ein ausgeprägter Mangel an personaler Kommunikation herrscht, bedarf es im Sinne der Präventionsarbeit eine Förderung der Kommunikationskompetenz (vgl. Martin 1999, S.113), die einen wesentlichen Aspekt des Programms „Locker bleiben“ ausmacht.
Untersuchungen nach bestehe ein „(…) Zusammenhang zwischen aggressivem Verhalten Jugendlicher und gestörter Kommunikation (…)“, so Martin (ebd., zit. nach Meier 1997). Dies scheint verständlich, bewirken doch Beleidigungen, Herabsetzungen oder kommunikative Missverständnisse Frustrationen, während einfühlende, offene und verständnisvolle Gespräche diese abbauen können.
[...]
[1] Primärliteratur: Bandura (1986); Freud (1915); Lorenz (1966) Sekundärliteratur: Bründel/Hurrelmann (1994); Martin (1999); Merkens (1993); Nolting (2001); Schubarth (2000)
- Arbeit zitieren
- Lina Walter (Autor:in), 2004, Gewaltprävention an Schulen im Rahmen der Gesundheitsförderung (am Beispiel eines Konzeptes des Albert-Schweitzer-Familienwerkes e.V.), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43753
Kostenlos Autor werden
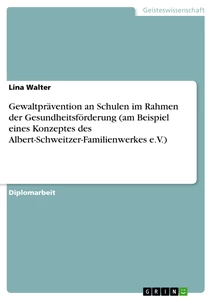



















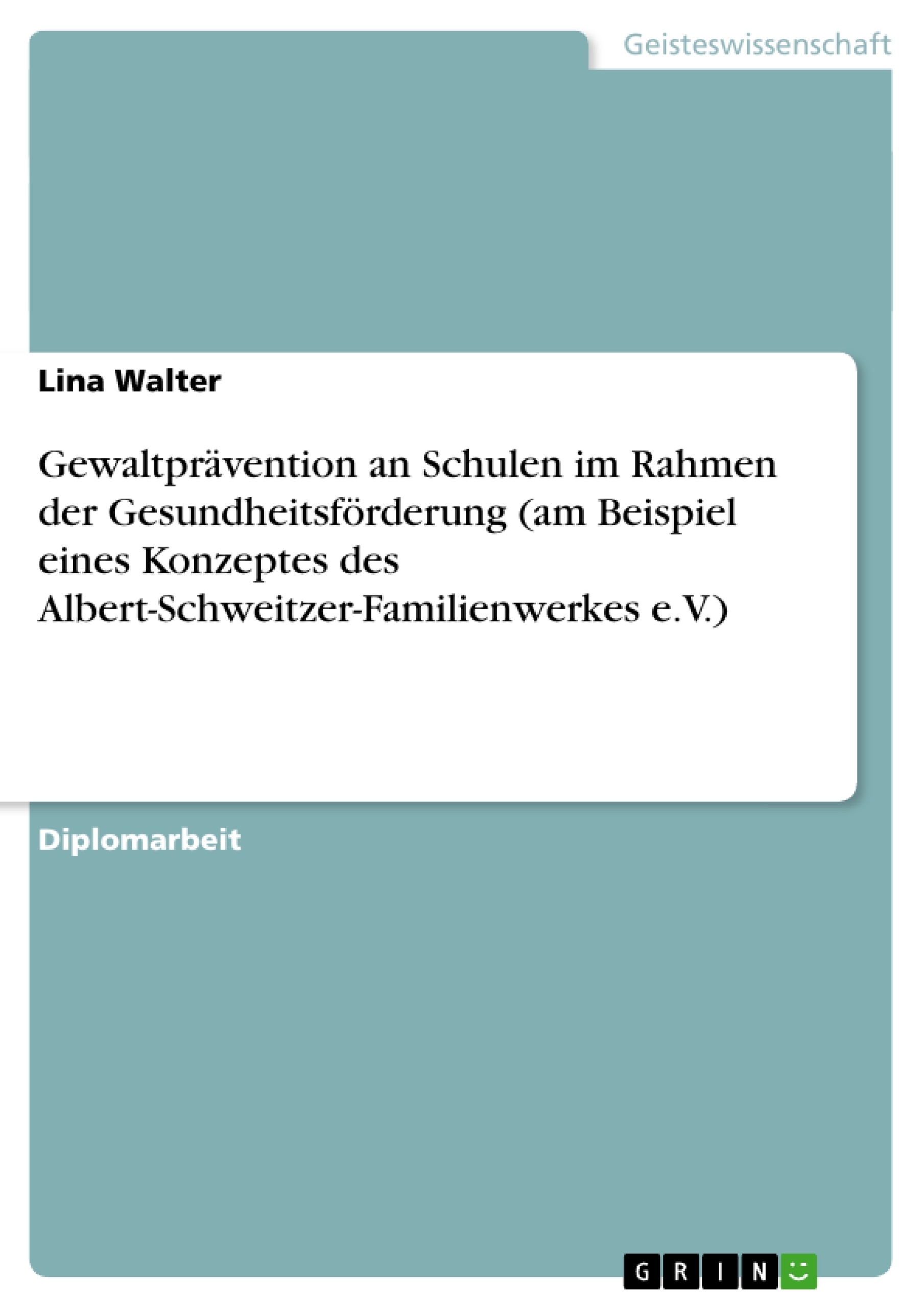

Kommentare