Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abstract
1. Einleitung
1.1 Ausgangslage
1.2 Leitende Fragestellung
1.3 Aufbau der Arbeit
2. Genderforschung - Geschlecht als soziales Konstrukt
2.1 Geschlechterrollen und ihre Entwicklung
2.1.1 Sex-/ Gender-Debatte
2.1.2 Gender und Beruf
2.2 Geschlechterstereotype
2.3 Geschlecht und Teamarbeit
2.3.1 Geschlechtsspezifische Merkmale der Teamarbeit
2.3.2 Verhalten im Team
2.3.3 Geschlechtshomogene Teams
3. Führung - Theorie und Geschlecht
3.1. Definition Führung
3.2 Führungsverhalten
3.2.1 Führungsverhalten und Geschlecht
3.3 Führungsmotivation
3.4 Status Quo: Frauen in Führung
3.4.1 Ursachen der Unterrepräsentanz - Ein exemplarischer Auszug
4. Emotionen und Emotionsarbeit
4.1 Definition Emotion
4.2 Emotionsarbeit - Definition und Darstellung
4.2.1 Strategien des Oberflächen- und Tiefenhandelns
4.2.2 Vier Dimensionen der Emotionsarbeit
4.2.3 Darstellungsregeln und ihre Quellen
4.2.4 Auswirkungen von Emotionsarbeit
5. Methodische Aspekte des Forschungsvorhabens
5.1 Forschungsziel
5.2 Forschungsfeld
5.3 Beschreibung der Erhebungsmethode
5.4 Beschreibung der Auswertungsmethode
6. Darstellung und Diskussion der Ergebnisse
6.1 Merkmale des erhobenen Materials
6.2 Darstellung der Ergebnisse
6.2.1 Merkmale der Hierarchieebenen
6.2.2 Merkmale der Kommunikation und Sprache
6.2.3 Darstellung von Gefühlen
6.2.4 Erwartungen und Ziele an weibliche Führungskräfte
6.2.5 Rollenbilder weiblicher Führungskräfte
6.2.6 Stereotype gegenüber weiblichen Führungskräften
6.2.7 Wahrgenommene geschlechtsspezifische Unterschiede
6.2.8 Widerstände und Hindernisse weiblicher Führungskräfte
6.3 Diskussion und Zusammenführung der Ergebnisse
6.3.1 Diskussion der Ergebnisse
6.3.2 Beantwortung der Hauptforschungsfrage
7. Fazit
7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
7.2 Kritische Reflexion des methodischen Vorgehens
7.3 Implikationen für Wissenschaft und Praxis
Quellenverzeichnis
a. Literatur
b. Internetquellen
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: „Typisch Frau“, „typisch Mann" und der „ideale Manager"
Abbildung 2: Beziehung zwischen den vier Dimensionen der Emotionsarbeit
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abstract
Emotionsarbeit umfasst die Regulation der eigenen Emotionen und nimmt insbesondere durch das Wachstum des tertiären Sektors im beruflichen Umfeld zu. Sie zeigt sich darin, dass Menschen ihre Emotionen gegen Lohn verstärken, abschwächen oder umwandeln, um Ziele und Erwartungen der Organisation zu verwirklichen. Neben den organisationsbezogenen Werten beeinflussen insbesondere gesellschaftliche Normen die Anpassung von Emotionen, sodass geschlechtsspezifische Rollenbilder und Vorurteile eine relevante Position einnehmen. Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es zu untersuchen, wie weibliche Führungskräfte geschlechtshomogener Teams Emotionsarbeit ausüben und welche emotionalen Belastungen sie wahrnehmen. Hierzu wurden Erwartungen, Hindernisse und soziale Beziehungen, die die Befragten beeinflussen, ebenso wie das Darstellen von Emotionen mithilfe eines qualitativen Forschungsdesigns untersucht. Zur Erhebung des Materials wurden elf leitfadengestützte Interviews mit weiblichen Führungskräften männer- und frauendominierter Teams geführt. Die Auswertung erfolgte mithilfe einer deduktiven und induktiven Kategorienbildung nach Mayring. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird deutlich, dass emotionale Belastungen insbesondere von weiblichen Führungskräften, die in frauendominierten Teams und auf einer niedrigeren Hierarchieebene tätig sind, wahrgenommen werden. Sie resultieren insbesondere aus konfligierenden Erwartungen und Rollenbildern, mit denen sich diese Führungskräfte konfrontiert sehen.
Hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten für Wissenschaft und Praxis erlauben die Ergebnisse Implikationen, die sich vorwiegend in der Führungskräfteauswahl und in Personalentwicklungsmaßnahmen zeigen.
Keywords: Emotionsarbeit, emotionale Belastungen, Frauen in Führungspositionen, geschlechtshomogene Teams
1. Einleitung
1.1 Ausgangslage
Der Wandel von einer Industrie- zu einer Dienstleistungsgesellschaft hat auch eine Veränderung des Zusammenhangs von Emotionalität und Beruf hervorgerufen. Die in Dienstleistungsberufen geforderte Beobachtung des eigenen Gefühlsausdrucks und die Anpassung dieser an die Erfordernisse der Berufsrolle führen zu einer weiteren Form der Arbeit: der Emotionsarbeit. Die amerikanische Soziologin Arlie Russell Hochschild prägte diesen Begriff nachhaltig und befasste sich intensiv mit der Thematik, die als verhältnismäßig junge Disziplin der arbeitspsychologischen Forschung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Emotionsarbeit nimmt hierbei verschiedene Grundformen an, im Rahmen derer Menschen versuchen, Emotionen zu unterdrücken oder zu erzeugen, tatsächlich empfundene Gefühle zu verändern oder den Grad der emotionalen Betroffenheit zu steuern (Hochschild 1990, S. 15). Diesen Ansatz griffen Doris Cornils und Daniela Rastetter 2012 auf, um eine Untersuchung der Emotionsarbeit von Führungskräften vorzunehmen. Hierbei wird deutlich, dass im Führungsbereich eine gezielte Emotionsregulation notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Außerdem hat das Merkmal Geschlecht eine relevante Bedeutung. Demnach haben Frauen in diesen Ebenen einen besonderen Bedarf an Emotionsregulierungskompetenzen, da sie als weibliche Minderheit in einer männerdominierten Kultur agieren. Bezüglich vorherrschender und wirkender Emotionsnormen stehen hierbei sozial verankerte Geschlechtsstereotype in einem direkten Widerspruch zum männlichen Managerideal (Cornils & Rastetter 2012, S. 166; ebd., S. 174).
1.2 Leitende Fragestellung
Die vorliegende Forschungsarbeit baut auf diesen Erkenntnissen von Hochschild sowie Cornils und Rastetter auf. Die Annahme ist hierbei, dass nicht nur das Geschlecht des Emotionsarbeiters relevant ist, sondern auch Geschlechtsmerkmale des Umfeldes (insbesondere des Teams) einen Einfluss auf die Emotionsarbeit weiblicher Führungskräfte haben.
Die zugrundeliegende Forschungsfrage lautet daher:
Welche emotionalen Belastungen nehmen weibliche Führungskräfte in geschlechtshomogenen Teams wahr?
Diese Fragestellung soll mittels einer qualitativen Untersuchung empirisch erforscht werden, bei der weibliche Führungskräfte frauen-, sowie weibliche Führungskräfte männerdominierter Teams als Untersuchungsgruppe im Fokus stehen.
1.3 Aufbau der Arbeit
Diese Masterarbeit ist schwerpunktmäßig eine Forschungsarbeit, die Implikationen für Wissenschaft und Praxis hervorbringt.
Zu Beginn wird im zweiten Kapitel die Genderforschung näher beleuchtet. Hierbei stehen Geschlechterrollen, Geschlechterstereotype und Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Teamarbeit im Fokus der Darstellungen.
Im dritten Kapitel wird zunächst anhand einiger Definitionen der Begriff ,Führung‘ erläutert. Anschließend werden die Konstrukte Führungsverhalten und Führungsmotivation dargestellt, wobei auch an dieser Stelle ein Bezug zum Merkmal Geschlecht hergestellt wird. Abschließend wird in diesem Kapitel der Status Quo zu Frauen in Führungspositionen aufgezeigt.
Im vierten Kapitel werden Emotionen und Emotionsarbeit fokussiert und erläutert. Dabei wird auf Strategien, Dimensionen, Regeln und Auswirkungen von Emotionsarbeit eingegangen.
Im fünften Kapitel wird das Forschungsvorhaben aufgezeigt. Hierbei werden das Forschungsziel und das Forschungsfeld dargestellt und die Methoden der Erhebung und Auswertung vermittelt.
Im sechsten Kapitel erfolgt die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse anhand mehrerer Merkmale. Zudem wird ein Bezug zur Forschungsfrage hergestellt.
Abschließend wird im siebten Kapitel ein Fazit gezogen. Dieses umfasst eine Zusammenfassung der Ergebnisse, eine kritische Reflexion des methodischen Vorgehens, sowie Implikationen für Wissenschaft und Praxis.
2. Genderforschung - Geschlecht als soziales Konstrukt
Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Emotionsarbeit weiblicher Führungskräfte in geschlechtshomogenen Teams. Im Rahmen dieser Thematik stellt die Genderforschung ein zentrales Konstrukt dar, da sowohl die befragten Personen, als auch das fokussierte Umfeld geschlechtsspezifischen Merkmalen und Rollenerwartungen unterliegen. Um das Geschlecht als einen zentralen Untersuchungsgegenstand darzustellen, unterteilt sich das folgende Kapitel in verschiedene Unterpunkte. Zunächst erfolgt ein Blick auf die Geschlechterrollen, die sich in unserer Gesellschaft entwickelt haben und aktuell vorherrschen. Zudem werden Geschlechtsstereotype dargestellt, die die berufliche und private Praxis von Frauen und Männern beeinflussen. Im abschließenden Teil wird das Konstrukt der Teamarbeit unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Merkmale vorgestellt.
2.1 Geschlechterrollen und ihre Entwicklung
Menschen werden in ein gesellschaftliches System hineingeboren und unterliegen anhand ihres Geschlechts von Beginn an gewissen Rollenerwartungen.
„Die geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen an Frauen und Männer stellen eine kulturabhängige Definition von Verhalten dar, das als den Geschlechtern in einer bestimmten Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit angemessen gilt. Diese kulturspezifische Bestimmung der Geschlechterrollen ist also ein historisch bedingtes Produkt.“ (Becker-Schmidt & Knapp 2000, S. 68).
Die Erwartungen, die mit den Rollen einhergehen, herrschen kollektiv in Kultur und Gesellschaft vor und können vom Individuum nicht beeinflusst oder verändert werden. Es handelt sich hierbei um eine definierte soziale Rolle. Bei Missachtung der daraus resultierenden Normen oder einem Verhalten, dass gegen die Erwartungen verstößt, kann mit Sanktionen zu rechnen sein, die sich in Form von Ausgrenzung, Verspottung oder Kritik zeigen können (Athenstaedt & Alfermann 2011, S. 13).
Betrachtet man im Folgenden die historische Entwicklung der Geschlechterrollen, so stellte die Anthropologie des 18. Jahrhunderts eine frauenfeindliche Zuspitzung dar. Die (finanzielle) Sicherung der Existenz, sowie die Übernahme der fundamentalen Reprodukionserfordernisse stellen im eigentlichen Sinne gesellschaftliche und staatliche Aufgaben dar, die beiden Geschlechtern zuteilwerden sollten. Im 18. Jahrhundert kennzeichnete die Gesellschaft jedoch eine starke Segmentierung, indem die Hausarbeit und Kinderziehung an Frauen delegiert und ihnen infolge der Zugang zum Arbeitsmarkt entzogen wurde (Becker-Schmidt & Knapp 2008, S. 27). Der Mann war somit für die Gestaltung der außerfamilialen Bereiche und die Ausübung einer Erwerbstätigkeit zuständig und fungierte als Oberhaupt, Beschützer und Ernährer der Familie. Die vielfältigen Möglichkeiten und Gestaltungsräume des außerfamilialen Umfeldes wurden Frauen vorenthalten, die immer konsequenter auf ihre Rolle als Hausfrau, Mutter und Ehefrau aufmerksam gemacht wurden. Um diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zu durchbrechen, bedurfte es Ende des 18. Jahrhunderts eines beschleunigten wirtschaftlichen und technischen Wandels, der entsprechenden Druck in der Gesellschaft und den Unternehmen auslöste. Die in diesem Zusammenhang aufkommende Fabrikarbeit, die durch entsprechende Maschinen die Arbeit leichter und unqualifizierter gemacht hatte, verursachte eine zunehmende Trennung von Frauen und ihrer häuslichen Arbeit (Hausen 2013, S. 192). Die Arbeitsprozesse, in die Frauen im Rahmen der Industrialisierung einbezogen wurden, umfassten kaum qualifizierte Arbeiten, sowie ,frauenspezifische‘ Tätigkeiten, die schlecht bezahlt wurden und somit zur Sicherung der Existenz nicht ausreichten (Gildemeister & Robert 2008, S. 286). So wurde die Reproduktion der Geschlechterordnung im modernen Erwerbssystem zwar akzeptiert, die Grundüberzeugung, dass Männer einen höheren Anspruch auf einen Erwerbsarbeitsplatz, sowie eine bessere Bezahlung haben, hielt sich jedoch unangefochten (Hausen 2013, S. 206).
Mit der Verknüpfung der beiden Lebensbereiche von Berufs- und Hausarbeit beschäftigt sich das Konzept der doppelten Vergesellschaftung, das verschiedene Annahmen darlegt. Zum einen besagt es, dass Frauen zwei unterschiedlichen und in sich widersprüchlich strukturierten Aufgabenfeldern nachkommen und in diesen jeweils soziale Zusammenhänge erfahren. Darüber hinaus wird angenommen, dass die Sozialisation von Frauen durch die zwei Kriterien des Geschlechts und der sozialen Herkunft bedingt ist. Als dritte Annahme postuliert das Konzept, dass die Eingliederung in eine Gesellschaft eine soziale Verortung, ebenso wie Eingriffe in die psychosoziale Entwicklung erfordert (Becker-Schmidt 2010, S. 68). Auf Basis dieser Annahmen zeigen sich Unterschiede zu männlichen Lebensläufen in den Diskontinuitäten, mit denen Frauen in der Familien- und Berufsplanung konfrontiert sind. Diese lassen sich beispielweise bei der Suche nach Ausbildungsplätzen erkennen oder umfassen den Aus- und Wiedereinstieg von Frauen nach der Elternzeit (ebd., S. 69). Obwohl sowohl die politische, als auch die wirtschaftliche Situation eine Angleichung der Geschlechtsbalance in den vergangenen Jahren förderte, zeigt auch das heutige Arbeitsverhältnis, dass Aspekte der frühneuzeitlichen Gesellschaft nicht vollends in Balance sind. Frauen sind demnach auch heute noch im weitesten Sinne für die alltägliche Haus- und Familienarbeit zuständig, sodass die Erwerbstätigkeit oftmals als sekundäre und phasenweise Beschäftigung verstanden wird. Zudem ist auch die gesellschaftliche Dominanz männlicher Personen gegenüber Frauen heutzutage noch vorzufinden (Hausen 2013, S. 244 ff.). Dies zeigt sich beispielsweise in der geschlechterhierarchischen Strukturierung des Arbeitsmarkts (z.B. Führungsstruktur). Es wird daher deutlich, dass eine gesellschaftspolitische Verankerung der Geschlechterrollen im sozialen Sicherungssystem bis heute vorherrscht. Die geschlechtsspezifische Arbeitsordnung, die den Frauen eine Entscheidung gegen die Familienzuständigkeit erschweren sollte, hat sich im Spannungsverhältnis zwischen Erwerbsarbeit und Familie bis heute gehalten (ebd., S. 245).
Fortschreitende und differenziertere Forschungen, die teilweise auch auf dem Konzept der doppelten Vergesellschaftung aufbauen, führten zu einer theoretischen und methodischen Verschiebung in der Frauen- und Geschlechterforschung. In dieser Wendung wird das Geschlecht nun als Strukturkategorie erfasst. Dies impliziert, dass das Geschlecht als Ursache sozialer Ungleichheit bezeichnet werden kann, die nicht auf andere Faktoren zurückgeführt werden können (Degele 2008, S. 65). Ursula Beer erforschte diesen Ansatz in den 1980er Jahren. Geschlecht geht demnach über das ,Frausein‘ oder ,Mannsein‘ hinaus und ihm wird ein entsprechendes Verhaltensrepertoire zugeordnet. Diese Betrachtungsweise betont die strukturierende Wirkung des Geschlechts, welche von einer sozialen Abgrenzung der Geschlechter unter dem Aspekt ihrer gesellschaftlichen Ungleichheit ausgeht. Diese soziale Abgrenzung zeigt sich in einem sozioökonomischen und politischen Gefälle zwischen den beiden Geschlechtern. Geschlecht ist demnach das Ergebnis sozial-historischer Konstruktionsprozesse, wodurch es kein individuelles Merkmal einer einzelnen Person darstellt, sondern Annahmen beschreibt, die in der Gesellschaft verankert sind. Dies bedingt auch geschlechtliche Ungleichgewichte wie Rangordnungen (Becker-Schmidt & Knapp 2000, S. 35 ff.). Aktuell können inhaltlich zwei Schwerpunkte in der Geschlechterforschung gefunden werden. Die erste Betrachtungsweise beschränkt das Konstrukt Geschlecht auf „Fragen der Zuschreibung von Geschlechtszugehörigkeit an Individuen und auf die Darstellung von Geschlechtszugehörigkeit durch Individuen“ (Becker-Schmidt & Knapp 2000, S. 78). Dieser Blickwinkel ignoriert jedoch Aspekte, die für die zweite Betrachtungsweise zentral sind. Diese umfassen das Problem sozialer Ungleichgewichte im Geschlechterverhältnis, sozialstrukturelle Auswirkungen des ,Doing Gender‘ und Fragen der asymmetrischen Positionierung der Geschlechter im Ordnungssystem der Zweigeschlechtlichkeit (ebd.). Verschiedene Diskussionen dieses Ansatzes um die Unabänderlichkeit und Ausschließlichkeit sexueller, rassischer, geschlechtlicher und ethnischer Identitäten bilden ihre Kritik auf drei Punkten. Im ersten Punkt wird die Annahme einer vermeintlich naturgegeben Basis von Geschlecht, Sexualität, Ethnizität und Rasse abgelehnt. Stattdessen wird ihre soziale Konstruktion fokussiert und eine Rekonstruktion angestrebt. Diese Rekonstruktion soll insbesondere im Rahmen der Verflüssigung oder Prozessualisierung der Kategorien stattfinden, sodass eine Transformation von den bereits dargestellten Strukturkategorien in Prozesskategorien stattfindet. Im Rahmen dieser Transformation wird aus ,gender‘ ,doing gender‘ und aus ,sexuality‘, ,race‘ und ,ethnicity‘ wurden ,doing sexuality‘, ,doing race‘ und ,doing ethnicity‘ (Dengele 2008, S. 94). Die Bezeichnung ,Doing Gender‘ basiert hierbei auf der Annahme, dass Menschen ihre Umwelt und Kultur aktiv mitgestalten und keine passiven und durch äußere Faktoren geformten Charaktere sind (Rendtorff 2011, S. 221). Dies impliziert, dass ,Doing Gender‘ gegensätzlich zur traditionellen Sichtweise auf das Geschlecht wirkt, da das Geschlecht in diesem Ansatz nicht als natürlicher Ausgangspunkt von Unterscheidungen im Handeln und Erleben betrachtet wird, sondern das Ergebnis komplexer, sozialer Prozesse ist. Um ein besseres Verständnis zu schaffen, ist die Vergegenwärtigung soziologischer Interaktionstheorien unerlässlich. Interaktion entsteht hierbei immer dann, wenn Personen sich gegenseitig wahrnehmen und aufeinander reagieren. Sie basiert auf Klassifikation und Typisierung. Klassifikationen wirken hierbei zur Komplexitätsreduktion und dienen der Ordnung der Umwelt und der Einordnung des Gegenübers (Gildemeister & Robert 2008, S. 17 f.). Dies zeigt sich auch in vorherrschenden Regelsystemen unserer Gesellschaft, an denen sich Individuen hinsichtlich verschiedener Kriterien, wie Verhalten oder Kleidung, orientieren. Diese werden von der Umwelt verstanden, interpretiert und zugeordnet, sodass sich ein Code manifestiert, der immer sexuiert, was bedeutet, dass er von den Geschlechterregeln der Gesellschaft geformt wird. „„Doing Gender“ heißt also in etwa: Wir wählen aus den zur Verfügung stehenden Verhaltensmöglichkeiten diejenigen aus, von denen wir meinen, dass sie zu unserem Geschlecht ‚passen‘ und in Einklang stehen mit den Erwartungen an uns als Zugehörige einer Geschlechtsgruppe und die zugleich unsere individuelle Nuance dieser geschlechtlichen Darstellung zum Ausdruck bringen können.“ (Rendtorff 2011, S. 221).
2.1.1 Sex-/ Gender-Debatte
Die Sex-/ Gender-Debatte dauert bereits seit über drei Jahrzehnten an. Grundlage dieser liefert die Annahme, dass vermeintlich Natürliches nicht natürlich sein muss, sondern sozial konstruiert sein kann. Diese Annahme der Konstruktion liegt auch dem bereits erwähnten Strukturansatz zugrunde. Eine Trennung von Sex und Gender weist an dieser Stelle jeglichen Kausalzusammenhang zurück: Sex, als biologische Geschlechterdifferenz, begründet keinerlei gesellschaftliche Ungleichheit, während Gender per Annahme keine zwangsläufige Konsequenz von Sex ist. Gender basiert vielmehr auf der Wahrnehmung von Unterschieden zwischen den Geschlechtern und übersetzt diese in kulturelle Zuschreibungen von ,Frausein‘ und ,Mannsein‘ (Becker-Schmidt & Knapp 2000, S. 67 f.). Diese Debatte war insbesondere für die feministische Theoriebildung in den 1970er Jahren relevant und übte eine wichtige politische Funktion aus. Die damalige, oben bereits dargestellte, politische und kulturelle Rolle der Frau basierte auf der biologistischen Auffassung der ,Natur der Frau‘, die im Rahmen dieser Debatte zurückgewiesen werden sollte. Im Fokus stand nun die Erkenntnis, dass es unabhängig von der Natur etwas sozial Gemachtes gibt, das die Rolle der Frau beeinflusst. Insbesondere die Diskussion zur Hierarchie von Geschlechtern wurde von dieser Sichtweise beeinflusst und es zeigte sich ein nicht zu unterschätzender Fortschritt (ebd.).
2.1.2 Gender und Beruf
Die Darstellung der Geschlechterrollen und ihrer Entwicklung zeigte bereits einen Zusammenhang zwischen Geschlecht und Erwerbsarbeit auf. Eine spezifische Betrachtung des Geschlechts im beruflichen Kontext soll darüber hinaus lebensphasenorientierte Merkmale herausstellen.
Es zeigt sich demnach, dass sich Mädchen, obwohl sie bessere Schulabschlüsse erzielen als Jungen, immer noch überproportional häufig für ,typisch weibliche‘ Ausbildungsberufe oder Studiengänge entscheiden. Diese umfassen insbesondere Verkaufs- und Büroberufe, sowie soziale Dienstleistungsberufe und semiprofessionelle Gesundheitsberufe. Junge Männer hingegen entscheiden sich häufig für Berufe des gewerblich-technischen Bereiches, sowie ebenfalls für kaufmännische Berufe. Insgesamt nutzen Männer ein größeres Spektrum an Berufseinstiegsmöglichkeiten, sodass eine größere Streuung vorliegt (BMBF 2017, S. 34 f.). Die Tätigkeiten, die Frauen ausüben, sind häufig die, die Männer nicht ausüben wollen. Dadurch zeigt sich eine Separierung der Einsatzbereiche von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Organisationen und eine horizontale Segregation wird deutlich. Die ,weiblichen‘ Bereiche umfassen Arbeitsplätze, die qualitativ schwieriger oder unzulänglicher sind, wo die Anforderungen maßloser oder diffuser sind und die Bezahlung schlechter ist als in den von Männern ausgeübten Bereichen. Zusammenfassend kennzeichnen ,typische Frauenberufe‘ geringe Einkommens-, Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die häufig auch als Sackgassenberufe bezeichnet werden (Rabe-Kleberg 1992, S. 47 ff.). Die beruflichen Wege, die Frauen wählen, sind somit oftmals nicht als Basis für Führungspositionen geeignet. Dies kann dadurch begründet werden, dass Sozialisationsmechanismen in der Schule und im Elternhaus den Zugang zu Führungspositionen für Frauen verzerren. Die Weichen für die Berufsausbildung und -ausübung von Frauen werden bereits während der Schulbildung beeinflusst. Die Institution Schule ist hierbei ein gesellschaftlicher Bereich, in dem Mädchen meist erfolgreicher sind als Jungen. Dies resultiert insbesondere aus der weiblichen Fähigkeit, sich an Normen und Standards (in diesem Fall der Schule) anpassen zu können. Ausbildungen traditioneller Frauenberufe zeigen daher häufig einen schulischen Charakter auf, da sich junge Frauen in diesen Strukturen leichter zurechtfinden. So finden Ausbildungen im sozialen, erzieherischen und pflegerischen Bereich, ebenso wie eine Vielzahl an Büroberufen, die als vollzeitschulische Bildungsgänge angeboten werden, im schulischen System statt. In technischen Berufen gab es hingegen lange Zeit keine Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen. Frauenarbeit wurde in diesen Bereichen erst eingeführt, als auf diese ressourcenbedingt nicht mehr verzichtet werden konnte. Trotz des Zugangs zu diesen Berufen kann von einer Gleichstellung nicht gesprochen werden, da durch die Vorenthaltung qualifizierter Ausbildungen niedrigere Löhne an Frauen gezahlt wurden (Rabe-Kleberg 1992, S. 80 ff.). Innerhalb der Organisationen wird die Zuweisung von Frauen zu bestimmten Berufsgruppen oftmals von Männern vorgenommen, da diese in deutlicher Mehrheit Führungspositionen innehaben. Hier zeigt sich neben der horizontalen ebenfalls eine vertikale Segregation, die in Kapitel 3.4 näher betrachtet wird. Es wird hierbei angenommen, dass auch berufspolitische Prozesse bewusst genutzt werden, um Frauen aus bestimmten Wirtschaftsbereichen und qualifizierten Berufen auszuschließen und den beruflichen Werdegang beeinflussen zu können (ebd.). Eine solche Form der Diskriminierung zeigt sich exemplarisch in der Gehaltsdifferenz, die zwischen Frauen und Männern vorherrscht. Hierbei zeigen Längsschnittstudien, dass bei gleich guten Absolventinnen und Absolventen wirtschaftlicher Studiengänge die Einstellungschancen zwar ähnlich gut sind, Frauen jedoch häufiger einen zeitlich begrenzten Anstellungsvertrag erhalten und deutlich schlechter vergütet werden als Männer (Rosenstiel & Nerdinger 2011, S. 196).
2.2 Geschlechterstereotype
Stereotype bezeichnen eine Reihe von Überzeugungen, die ein Individuum über die Mitglieder einer bestimmten sozialen Gruppe hat. Es werden also bestimmte Merkmale mit einer sozialen Kategorie assoziiert (Petersen & Dietz 2006, 5 f.). Eine Zuordnung von Personen zu bestimmten Gruppen mit entsprechender Merkmalsausprägung dient der Vereinfachung und als soziale Orientierungshilfe. Menschen können auf Basis der Gruppierung das Verhalten und die Einstellung anderer Personen subjektiv besser vorhersagen und erkennen (Fischer, Asal & Krueger 2013, S. 98). Ein weiteres Charakteristikum stellt der kognitive Charakter von Stereotypen dar, wodurch sie in ihrer Ausprägung positiv, neutral oder auch negativ konnotiert sein können (Petersen & Dietz 2006, 5 f.). Geschlechterstereotype beziehen sich hierbei auf die soziale Kategorie des Geschlechts mit den Ausprägungen ,Mann‘ und ,Frau‘. Sie kennzeichnet das Vorhandensein deskriptiver, sowie präskriptiver Anteile. Deskriptive Aspekte beschreiben traditionelle Annahmen darüber, wie Frauen und Männer typischerweise sind und werden den Geschlechtern zugewiesen. Sie erleichtern die soziale Wahrnehmung, indem gewisse Erwartungen erzeugt und Interaktionen erleichtert werden (Alfermann & Athenstaedt 2011, S. 15). So ,sind‘ Frauen emotional und Männer dominant. Da diese Annahmen zugrunde liegen und nicht hinterfragt werden, zeigt sich Verwunderung, wenn sich diese nicht bestätigen. Präskriptive Anteile beschreiben die Erwartungen, wie sich Frauen und Männer verhalten sollen oder wie sie sein sollen. Sie basieren auf den traditionell definierten Geschlechterrollen und stellen eine Legitimation für gesellschaftlich definierte Unterschiede zwischen Männern und Frauen dar. Demnach ,sollen‘ Frauen emotional agieren und Männer dominieren. Werden präskriptive Erwartungen enttäuscht, zeigt sich auch hier zunächst Verwunderung. Darüber hinaus kann sich diese jedoch bis hin zur Verärgerung und zu sozialen Sanktionen steigern (Alfermann & Athenstaedt 2011, S. 15). Die deskriptiven und präskriptiven Anteile von Geschlechterstereotypen verdeutlichen ihre Änderungsresistenz. Das Erfassen stereotyper Eigenschaften nimmt ab der Kindheit mit steigendem Alter zu und bereits nach Abschluss des Grundschulalters ist der Erwerb von Geschlechterstereotypen weitestgehend abgeschlossen. Die zu diesem Alter bereits vorherrschenden Stereotype bleiben dann meist über die gesamte Lebensspanne stabil (ebd.).
Die von uns angenommenen geschlechtsspezifischen Charakteristika zeigen zunächst unsere individuellen Geschlechterstereotype auf. Diese können Persönlichkeitseigenschaften oder Körpercharakteristika, berufliche oder private Rollen, sowie andere Merkmale abbilden. Die wissenschaftliche Forschung untersucht insbesondere Stereotype bezüglich Emotionen und Eigenschaften und zeigt über Jahre hinweg ein einheitliches Bild auf. Von Frauen wird demnach erwartet, dass sie stärkere und tiefergehende Emotionen erleben, während nur Ärger und Stolz Emotionen darstellen, die eher Männern zugeschrieben werden (Alfermann & Athenstaedt 2011, S. 15 f.). Rosenkrantz et al. untersuchten 1968 jene Eigenschaften, die von Personen als eher männlich oder eher weiblich eingeschätzt werden. Hierfür ließen sie eine Reihe ausgewählter Eigenschaften von Probandinnen und Probanden daraufhin beurteilen, ob sie diese einem Mann oder einer Frau zuschreiben würden. Als Ergebnis konnten feminine positive und maskuline positive Eigenschaften benannt werden, die jeweils von mehr als 75% der Probandinnen und Probanden dem jeweiligen Geschlecht zugeordnet wurden (Rosenkrantz et al. 1968, S. 288). Frauen seien demnach beispielsweise sehr taktvoll, sanft und einfühlsam und würden über gute Manieren verfügen. Sie seien besorgt um ihr Äußeres und sehr angetan von Literatur und Kunst. Positive maskuline Eigenschaften seien demgegenüber, dass Männer sehr aggressiv und wenig emotional, sowie unabhängig und dominant auftreten würden. Männer seien zudem interessiert an Mathematik und Naturwissenschaften. Insgesamt zeigte die Untersuchung, dass Frauen eher Emotionalität, Zurückhaltung und eine Vorliebe für Kunst und Literatur zugeschrieben werden, während Männer aggressivere und konkurrenzbedachtere Eigenschaften charakterisieren und sie stärkere Vorlieben zur Logik als zur Hermeneutik zeigen (ebd., S. 291). Es werden für diese Differenzierungen die beiden Pole ,Wärme/ Expressivität‘ bei Frauen und ,Kompetenz/ Instrumentalität‘ bei Männern verwendet. Ein direkter Vergleich der beiden Dimensionen zeigt hierbei, dass Menschen Wärme der Kompetenz vorziehen, was evolutionspsychologisch begründet ist. Für das Überleben der Menschen ist es wichtiger, ob wir einer Person Vertrauen schenken können, als dass wir ihren Wert für die Gruppe zu schätzen wissen. Die Dimension ,Wärme‘ suggeriert ein vertrauenserweckendes Auftreten, wodurch wir diese Personen als warmherzig und hilfsbereit empfinden und sie daher positiver bewerten. Es entsteht ein sogenanntes „Sympathieurteil“ (Alfermann & Athenstaedt 2011, S. 19 ff.). Diese Sympathie, ebenso wie weitere interpersonale Faktoren, weichen in der Dimension ,Kompetenz‘ dem Respekt. Menschen neigen dazu, kompetente Personen zu achten und sie zu respektieren. Den beiden Dimensionen kann aufgrund ihrer gegensätzlichen Polung eine Ambivalenz zugrunde liegen, sodass wir Personen als warm und inkompetent oder kompetent und kalt empfinden können. Menschen, die wir beispielsweise als sehr maskulin empfinden, können somit als sehr kompetent, gleichzeitig jedoch als unnahbar und arrogant wahrgenommen werden. Diese Kategorisierung verdeutlicht darüber hinaus Statusunterschiede, die auch in der Gesellschaft eine Wirkung erzielen. Da Männer oft für kompetenter gehalten werden, werden auch Eigenschaften, die dieser Dimension entsprechen, häufig mit dem männlichen Geschlecht assoziiert. Hierdurch kommen gesellschaftlich akzeptierte Statusunterschiede zum Tragen. Es zeigt sich ein allgemein vorherrschender Zusammenhang zwischen Statuspositionen und Geschlechterstereotypen. Insbesondere statusniedrigere Gruppen werden häufig mit weiblichen Stereotypen wie Expressivität und Warmherzigkeit beschrieben. Statushöheren Gruppen werden dagegen männliche Stereotype wie Ehrgeiz und Kompetenz zugeschrieben (ebd., S. 21 ff.).
Diese geschlechtsspezifischen Zuschreibungen zeigen sich auch im internationalen Vergleich. Steffens und Ebert griffen 2016 eine Studie von Williams und Best aus dem Jahr 1990 auf, die ebendiese Geschlechterstereotypen in 25 Ländern untersuchte und im Ergebnis eine Varianz von 42% feststellen konnte. Eigenschaften, die in mindestens 20 der 25 Nationen einstimmig als typisch männlich bezeichnet wurden, sind beispielsweise Aggressivität, Dominanz, Maskulinität und Stärke. Typisch weibliche Eigenschaften sind etwa Empathie, Femininität und Unterwürfigkeit. Diese Eigenschaften zeigen sich auch in der geschlechtsspezifischen Berufswahl, die ohne den Einbezug von Geschlechterstereotypen kaum zu erklären ist. Während Männer insbesondere Hierarchie-stützende Arbeitsbereiche wählen und somit ihre Akzeptanz gegenüber hierarchischen und machtgeprägten Strukturen zeigen, bevorzugen Frauen Gleichberechtigung und streben daher nach Hierarchie-schwächenden Bereichen. Zudem unterscheiden sich die beiden Geschlechter hinsichtlich der Rahmenbedingungen ihrer beruflichen Tätigkeit. Männer streben nach Status und Einkommen, während Frauen Flexibilität und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schätzen, wodurch sie Berufe mit langen Arbeitstagen als nicht erstrebenswert erachten (Steffens & Ebert 2016, S. 129 ff.).
Hinsichtlich der Entstehung von Geschlechtsstereotypen konnten Hoffman und Hurst (1990) in ihrer Studie zeigen, dass Geschlechterstereotype nicht auf den tatsächlichen Persönlichkeitseigenschaften von Männern und Frauen basieren, sondern eine Folge der gesellschaftlichen Rollenverteilung darstellen, die bereits in Kapitel 2.1 erläutert wurde. Hierfür wurden die Versuchspersonen gebeten, sich einen Lebensraum mit zwei Arten von Lebewesen vorzustellen, „Ackmanians“ und „Orinthians“. Die beiden Berufe, die ausgeübt werden konnten, waren die der Erzieherin/ des Erziehers oder der Arbeiterin/ des Arbeiters. Die Gruppen unterschieden sich darin, dass von den Achmanians 80% die Kinder erzogen und 20% in der Stadt arbeiteten, während es bei den Orinthians genau andersherum war. Die Probandinnen und Probanden erhielten zudem Beschreibungen von 15 Personen jeder Gruppe, in denen der Beruf und jeweils eine weibliche (z.B. warmherzig), eine männliche (z.B. unabhängig) und eine neutrale (z.B. kreativ) Eigenschaft angegeben wurden. In der anschließenden Aufforderung, die einzelnen Personen zu beschreiben, zeigte sich, dass die Charakterisierungen vorwiegend von der Häufigkeitsverteilung der Rollen innerhalb einer Spezies beeinflusst wurden. Demnach wurden den Ackmanians mehr weibliche und den Orinthians mehr männliche Eigenschaften zugeordnet (Hoffman & Hurst 1990, S. 206). In der Theorie der sozialen Rollen kommt Alice Eagly 1997 zu dem Ergebnis, dass sich Frauen und Männer darüber hinaus an ihre geschlechtsspezifischen Rollen anpassen. Ziel der Anpassung ist hierbei, die spezifischen Fähigkeiten und Ressourcen, die mit der erfolgreichen Rollenleistung verbunden sind, zu erwerben und ihr soziales Verhalten an ebendiese Rollenanforderungen anzupassen (Eagly, Wood & Diekmann 2000, S. 126 f.). Die gezeigten Verhaltensweisen entsprechen demnach den sozialen Rollen und werden durch jene Merkmale charakterisiert, die insbesondere im Familien- und Berufsumfeld für die jeweilige Rolle typisch sind. Den Kern des Frauenstereotyps prägen hierbei die bereits dargestellten Wärme-/ Expressivität-Merkmale. Diese ergeben sich daraus, dass Frauen häufig Berufe wählen, die der Hausfrauen- oder Mutterrolle entsprechen oder einen niedrigeren Status haben (z.B. Erzieherin). Männer, die hingegen Berufsrollen übernehmen, die einen hohen Status haben (z.B. Manager) oder in ihrer Ernährerrolle die (finanzielle) Existenz sicherstellen, prägen die Merkmale Kompetenz/ Instrumentalität (ebd., S. 140 ff.). Das traditionelle gesellschaftliche Frauenstereotyp ergibt sich somit aus einem relativ niedrigen sozialen Status der Frau und ihrer kooperativen Interdependenz mit dem männlichen Geschlecht. Die Abhängigkeit zeigt sich hierbei insbesondere im privaten Bereich (Haushalt, Partnerschaft, Familie). Das traditionelle Männerstereotyp prägen dagegen ein relativ hoher gesellschaftlicher Status des Mannes und der berufliche Wettbewerb mit Frauen. Die Wettbewerbsorientierung stellte sich hierbei im Rahmen des Wandels der Geschlechterrollen ein, da Frauen zunehmend aus der traditionellen Rolle als Hausfrau und Mutter ausbrachen, bzw. weiterhin ausbrechen (Eckes 2008, S. 180).
2.3 Geschlecht und Teamarbeit
Die Teamarbeit stellt in der vorliegenden Forschungsarbeit ein zentrales Konstrukt dar, da Unterschiede zwischen frauen- und männerdominierten Teams betrachtet werden. Frauen und Männer unterscheiden sich hierbei nicht nur in der jeweiligen Berufs- und Branchenwahl, sondern darüber hinaus auch in der Arbeitsweise, wie das nachfolgende Kapitel verdeutlichen soll.
2.3.1 Geschlechtsspezifische Merkmale der Teamarbeit
Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich zwischen Männern und Frauen nicht erst innerhalb der Teamarbeit, sondern bereits vorab in dem Bedürfnis nach einem Arbeiten im Team. Es zeigt sich, dass Frauen häufiger nach Teamarbeit streben, während Männer bevorzugt als Einzelkämpfer agieren. Viele männliche Versuchspersonen haben sich in einer Studie von Kuhn und Villeval (2011) erst dann freiwillig für Teamarbeit entschieden, als sie einen konkreten materiellen Vorteil aus dieser Zusammenarbeit erzielen konnten. Frauen schätzen das Konstrukt der Teamarbeit jedoch bereits als solches, ohne materiellen Zugewinn (Kuhn & Villeval 2011, S. 33). Die Forscher/innen begründen dies unter Berücksichtigung mehrerer Aspekte. Frauen schätzen zum einen die Leistung ihrer Teamkolleginnen und Teamkollegen weniger pessimistisch ein als Männer. Männliche Teammitglieder haben niedrigere Erwartungen an die Leistungen ihrer Partnerin/ ihres Partners und sehen sich selbst als fähiger an (ebd., S. 14). Zum anderen reagieren Männer stärker auf materielle Anreize, sodass sie sich selbst bei einem im Team nur geringfügig höheren Stücklohn im gleichen Maße für Teamarbeit entschieden haben wie Frauen (ebd., S. 34). Der letzte Aspekt umfasst geschlechtsspezifische Werte und verdeutlicht, dass Frauen mehr Wert auf soziale Aspekte des Arbeitens legen, wie etwa das faire Teilen eines gemeinsam erwirtschafteten Gewinns (ebd.).
Eine Studie von Ferdinand A. von Siemens (2015) hat zudem gezeigt, dass die Präsenz von Frauen das Verhalten männlicher Teammitglieder verändert. Per Annahme entstehen zusätzliche Nutzen für die Teamproduktivität durch Geschlechterdiversität in Teams, wenn Frauen und Männer ähnlich erwartete Fähigkeiten aufweisen und die finanziellen Anreize nicht zu stark sind. Die Vorteile resultieren daraus, dass Männer zu einer stärkeren Signalisierung ihrer Fähigkeiten neigen und demnach besser performen, wenn Frauen im Team sind. Die zugrundeliegende Annahme hierbei ist jedoch, dass nur Arbeitnehmer mit hohen Fähigkeiten auf die Geschlechterdiversität reagieren, da insbesondere diese Personen in der Lage sind, ihre Anstrengungen zu erhöhen (Siemens 2015, S. 10). Die Geschlechterdiversität zeigt hierbei größte Effekte in jungen Teams, wo viele der Teammitglieder noch nicht in einer stabilen sexuellen Beziehung sind und maximiert in solchen die erwartete Teamproduktion (ebd., S. 4). Dieser Effekt basiert auf altersspezifischen Unterschieden im ,Signalisieren‘, da dieses ein strategisches Vorgehen bezeichnet und insbesondere zwischen Personen stattfindet, die an einer Partnerschaft interessiert sind (ebd.). Von Siemens konnte weiter zeigen, dass diese Auswirkungen der Geschlechterdiversität von Geldanreizen verdrängt werden. Bei monetären Anreizen wird eine gesteigerte Leistung der Teammitglieder unabhängig vom ,sozialen Signalisieren‘ wahrgenommen, sodass sich die individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter durch den monetären Ansporn zeigen (ebd.). Die Geschlechterzusammensetzung eines Teams hat darüber hinaus einen signifikanten Einfluss auf die Risikobereitschaft der Gruppe. Je höher der Anteil männlicher Teammitglieder, desto riskanter wird eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Bei höherem Frauenanteil sinkt die Risikobereitschaft einer Gruppe. Diese Ergebnisse einer empirischen Studie des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (2017) decken sich mit verhaltensökonomischen Erkenntnissen der Vergangenheit, wonach sich Männer bei Individualentscheidungen risikobereiter verhalten als Frauen. Verglichen mit der durchschnittlichen Risikoneigung der einzelnen Mitglieder einer Gruppe treffen Männergruppen zu riskante und Frauengruppen zu wenig riskante Entscheidungen (ifw Kiel 2017, o.S.).
2.3.2 Verhalten im Team
Neben den geschlechtsspezifischen Präferenzen hinsichtlich der Teamarbeit zeigen sich auch auf individueller Ebene Unterschiede in den Verhaltens- und Arbeitsweisen zwischen Männern und Frauen bei der Arbeit im Team.
In Bezug auf ihre inhaltliche Arbeit stellen Männer eine Situation kurz und prägnant dar und bieten meist unmittelbar eine Lösung an. Sie verstehen sich als Problemlöser, während Frauen im ersten Moment darauf bedacht sind, Verständnis zu erzeugen, bevor sie die Lösung eines Problems anstreben (Tannen 1991, S. 49 f.). Frauen schweifen daher häufiger in Details ab und geben einen umfangreichen Überblick über eine Situation; sie stellen hierbei zahlreiche Details und Argumente vor (ebd., S. 125 f.). Dies zeigt sich ebenfalls in der Qualität der Argumente und in der Kommunikation. Männer argumentieren sachlich-neutral und zielbezogen. Sie denken sach- und lösungsorientiert, während Frauen eher sozial- und beziehungsorientiert denken (Hochland 2013, o.S.). Für Frauen steht der Beziehungsaspekt auch in der Sprache im Vordergrund, da diese ein Instrument darstellt, um Bindungen knüpfen und eine Gemeinschaft schaffen zu können (Tannen 1991, S. 79). Sie versuchen daher, Inhalte, Gedanken und Gefühle des Gegenübers nachzuvollziehen und finden sich eher in der Rolle des Zuhörers wieder, während diese Rolle bei Männern häufig ein Gefühl der Unterlegenheit auslöst (ebd., S. 154). Ein weiteres Instrument, das Frauen in der Kommunikation nutzen, ist ,Klatsch‘. ,Klatsch‘ wird hierbei insbesondere als weibliches Instrument verstanden und oftmals genutzt, um eine Verbindung oder Beziehung aufzubauen. Die eigenen Freundinnen auf dem neusten Stand zu halten, ist für viele Frauen kein Privileg, sondern eine Verpflichtung, da das Erzählen von Geheimnissen ein wesentlicher Bestandteil von Freundschaft ist (Tannen, S. 102 f.). Daher vergleichen sich Frauen häufig mit anderen Frauen und beobachten diese in ihrem Auftreten und Verhalten. Männer pflegen dagegen einen statusorientierten Sprachstil, der durch Selbstdarstellung geprägt wird. Männer nutzen Gespräche als Mittel zur Sicherstellung ihrer Unabhängigkeit, indem sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten darstellen und Kommunikation verwenden, um Aufmerksamkeit zu erhalten (ebd., S. 79). Sie konzentrieren sich somit eher auf die Darstellung der eigenen Person, statt auf ihr Umfeld.
In Konversationen zeigt sich die weibliche Beziehungsorientierung dadurch, dass Frauen auf Fragepartikel zurückgreifen und diese häufiger verwenden als Männer (Lakoff 1975, S. 14). Die Verwendung von Fragepartikeln verhindert eine Selbstverpflichtung des Sprechers hinsichtlich des Gesagten und vermeidet somit mögliche Konflikte mit dem Adressaten (ebd., S. 16 f.). Es ist eine vorsichtige und beziehungsorientierte Art der Formulierung, was auch die Nachteile dieses Stils verdeutlicht. Die Verwendung von Fragepartikeln erweckt den Eindruck, als wäre die Sprecherin/ der Sprecher sich ihrer/ seiner nicht sicher und würde beim Adressaten nach Bestätigung suchen. Männer, die statusorientiert kommunizieren, würden diesen Fragestil daher nicht bewusst verwenden, was zur Folge hat, dass die männliche Kommunikation häufig weniger höflich klingt (ebd., S. 16 f.). Die Statusorientierung des Mannes wird zudem durch eine der am häufigsten zitierten Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zu Gender und Sprache unterstrichen. Diese These besagt, dass es in Konversationen insbesondere die Männer sind, die Frauen unterbrechen und seltener andersherum. Jemanden zu unterbrechen wird hierbei als unhöflich und böswillig erachtet und stellt ein Mittel dar, mit dem ein Gespräch dominiert und der Gesprächsverlauf kontrolliert werden kann. An dieser Stelle muss jedoch berücksichtigt werden, dass Kommunikation zu komplex ist, als dass diese Wirkung alleine auf die Strategie des Unterbrechens zurückgeführt werden kann (Tannen 1991, S. 206 ff.). Die Charakteristika des männlichen Sprachstils zeigen sich jedoch nicht nur in der Qualität, sondern ebenfalls in der Quantität. In öffentlichen Situationen haben Männer einen höheren Redeanteil, während Frauen besonders in privaten Situationen stärker kommunizieren (Tannen 1991, S. 80 ff.). Dies resultiert aus den Logiken, die den beiden Geschlechtern zugrunde liegen. Die Logik, die das Weltbild der Frau beeinflusst hat, hat einen privateren Charakter. Es wurden eigene Erfahrungen berücksichtigt und integriert, sowie die Erfahrungen anderer zu eigenen Erfahrungen in Beziehung gesetzt. Die Logik des Mannes zeigt Tendenzen von Öffentlichkeitsmerkmalen. Er erwarb Informationen und argumentierte nach Regeln der formalen Logik, wie beispielsweise beim Vorgehen in wissenschaftlichen Untersuchungen (ebd., S. 96).
2.3.3 Geschlechtshomogene Teams
Die vorliegende Forschungsarbeit betrachtet das Merkmal der geschlechtshomogenen Teams und stellt dieses in den Fokus. Für die nachfolgende Feldforschung soll daher die Begrifflichkeit ,geschlechtshomogen‘ definiert werden, wobei der Begriff ,Token‘ hierfür von zentraler Bedeutung ist. Dieser von Zedlacher und Haas aufgegriffene Begriff geht auf Rosabeth Moss Kanter zurück, die jene Bezeichnung in einer Untersuchung zur Minderheit weiblicher Personen im organisationalen Kontext einführte. Nach Kanter werden Minderheiten (Tokens) bis zu einem Anteil von 15% nicht als Individuen wahrgenommen, sondern stellen Repräsentantinnen/ Repräsentanten einer, bzw. ihrer sozialen Gruppe dar. Bei einem Anteil von weniger als 15% herrscht eine erhöhte Sichtbarkeit der Minderheitengruppe vor und sie sind dem besonderen Druck ausgesetzt, außergewöhnliche und gute Leistungen zu erbringen. Zudem wird ihre Andersartigkeit häufig überbetont und sie werden in stärkerer Form von der Mehrheitsgruppe stereotypisiert. Die Stereotypisierung fördert, dass in den Augen der Mehrheit nicht die Person als solches, sondern die gesamte Gruppe, der sie zugehörig ist, scheitert, wenn eine Person der Minderheitengruppe die geforderte Leistung nicht vorweisen kann (Zedlacher & Haas 2011, S. 1). Die Einbeziehung einer Token-Mitarbeiterin/ eines Token-Mitarbeiters in eine Belegschaft soll in der Regel den Eindruck von sozialer Inklusion und Vielfalt erzeugen, um Vorwürfe sozialer Diskriminierung ablehnen zu können (Hogg & Vaughan 2008, S. 368). Token-Dimensionen umfassen hierbei häufig die Dimensionen der Diversity-Forschung. Im Hinblick auf das Modell der Four Layers of Diversity von Gardenswartz und Rowe lassen sich die Diversity-Dimensionen in vier Ebenen unterteilen: organisationale Dimension, äußere Dimension, innere Dimension und die Persönlichkeit. Im Rahmen des Tokenism-Konzepts ist insbesondere die innere Dimension mit den Ausprägungen Geschlecht, Alter, physische Fähigkeiten, sexuelle Orientierung, ethnische Zugehörigkeit und Religion- und Weltanschauung von zentraler Bedeutung (Gardenswartz & Rowe 2008, S. 21). In der vorliegenden Forschungsarbeit steht hierbei die Ausprägung des Geschlechts im Fokus. Für männliche Tokens zeigen sich an dieser Stelle andere Auswirkungen als für weibliche Tokens. So sind die meisten der von Kanter beschriebenen sozialpsychologischen Prozesse bei männlichen Minderheiten zwar identifizierbar, jedoch stimmen sie oftmals nicht mit den erwarteten negativen Auswirkungen überein. Für männliche Tokens entsteht somit aus der besonderen Sichtbarkeit und aus vorherrschenden Stereotypisierungen kein beruflicher Nachteil. In Bezug auf weibliche Tokens ergibt sich hingegen ein stark heterogenes Bild. Zwar lassen sich in einigen Studien die von Kanter beschriebenen Prozesse bestätigen und negative Konsequenzen, wie Isolation und Stereotypisierung, bei Frauen als Minderheitengruppe erkennen, jedoch gilt dies nicht über alle Untersuchungen hinweg. Andere Studien berichten von einer guten Integration und guten Aufstiegsbedingungen für die weibliche Minderheit, sowie einem kollegialen, solidarischen Team- und Arbeitsklima (Mucha 2014, S. 47).
3. Führung - Theorie und Geschlecht
In ihrer Thematik und Methodik untersucht diese Masterarbeit die Zielgruppe weiblicher Führungskräfte geschlechtshomogener Teams. Im Fokus steht daher neben geschlechtsspezifischer Merkmale auch das Konstrukt der Führung, welches im Folgenden näher betrachtet wird. Zunächst erfolgt eine Begriffsdefinition, die als Grundlage für die anschließenden Aspekte des Führungsverhaltens und der Führungsmotivation dient. Im Anschluss daran wird der Status Quo von Frauen in Führungspositionen in Deutschland beleuchtet und eine Ursachenanalyse dieser Situation vorgenommen.
3.1. Definition Führung
Die Begriffe Führung und Führungsverhalten werden in vielfältiger Weise und aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen heraus definiert.
Eine bekannte Definition ist hierbei die nach James MacGregor Burns (1978), einem amerikanischen Politologen und Historiker. Burns definiert Führung als Verhalten, dass von Menschen ausgeübt wird, wenn sie „mit bestimmten Motiven und Zielen im Wettbewerb oder im Konflikt mit anderen die institutionellen, politischen, psychologischen und anderen Ressourcen so mobilisieren, sodass sie die Motive der Geführten wecken, verpflichten und befriedigen“ (Burns 1978, S. 18). Die Einflussnahme durch Führungskräfte kann hierbei auf unterschiedlichen Wegen stattfinden. Es wird unterschieden in „Führung durch Gestaltung der Strukturen“ (Organigramme, Stellenbeschreibungen, Personalentwicklungsprogramme, etc.) und „Führung durch Personen“ (u. a. das Verhalten der Vorgesetzten und die Art, wie sie Gespräche führen und Aufgaben koordinieren) (Rosenstiel 2009, S. 3).
Oswald Neuberger (2002) zeigt in seinem Versuch einer Definition die Vielfältigkeit des Führungsbegriffes auf. Eine Zusammenfassung relevanter Komponenten des Führungsverständnisses resultierte in der folgenden synthetischen und handlungstheoretischen Führungsdefinition:
„Führung in Organisationen ist ein von Beobachtenden thematisierter Interaktionsprozess, bei dem eine Person in einem bestimmten Kontext das Handeln individueller oder kollektiver Akteure legitimerweise konditioniert; als kommunikative Einflussbeziehung nutzt sie ein unspezifisches Verhaltensrepertoire, um - auch mit Hilfe von und in Konkurrenz zu dinglichen und institutionellen Artefakten - die Lösung von Problemen zu steuern, die im Regelfall schlecht strukturiert und zeitkritisch sind.“ (Neuberger 2002, S. 47).
Die unterschiedlichen Definitionen einzelner Forschungen und Disziplinen wurden von Weinert (1989) auf Gemeinsamkeiten untersucht. Hierbei zeigten sich abschließend drei Merkmale, die von einem Großteil der Ansätze postuliert und unter der Definition von Führung abgebildet werden. Diese drei Merkmale bestimmen den Begriff ‚Führung‘ in der vorliegenden Forschungsarbeit und prägen das Führungsverständnis, das im weiteren Verlauf zugrunde liegt:
1. „Führung ist ein Gruppenphänomen (das die Interaktion zwischen zwei oder mehreren Personen einschließt);
2. Führung ist intentionale soziale Einflussnahme (wobei es wiederum Differenzen darüber gibt, wer in einer Gruppe auf wen Einfluss ausübt und wie dieser ausgeübt wird, u.a.m.);
3. Führung zielt darauf ab, durch Kommunikationsprozesse Ziele zu erreichen.“ (Weinert 1989, S. 555).
Die Führungsforschung unterscheidet weiter zwischen einer heroischen und einer postheroischen Phase. Die heroische Führung charakterisiert das Setzen einer Idee oder eines Ziels und das bewusste Kalkulieren, mit diesem einen Ansatz zu gewinnen oder zu verlieren. In diesem Führungsverständnis herrschen nur die Optionen ,Gewinn‘ oder ,Verlust‘ vor. Die Vorteile dieses Ansatzes liegen zum einen in der Arbeitsersparnis und zum anderen in der Möglichkeit, einen Gewinn einem eindeutigen Weg zuzuordnen. Niederlagen werden hierbei extern attribuiert und auf Umgebungsfaktoren, wie Umwelt oder Mitarbeiter/innen, zurückgeführt (Baecker 2015, S. 1 f.). Der postheroische Führungsansatz ist demgegenüber wesentlich komplexer. Dieses Führungsverständnis zeichnet sich durch seine Prozessorientierung aus, indem eine wiederkehrende Überprüfung stattfindet, die reflektiert, mit welchen Ressourcen und Kompetenzen unter welchen Bedingungen welche Erfahrungen gemacht wurden (ebd.). Sie entwickelte sich seit den 1990er Jahren und lässt eine stärkere Differenzierung, als die bloße Unterscheidung zwischen Gewinn und Verlust, zu (Furtner & Baldegger 2016, S. 1). Merkmale und Systeme wie Teams, Projekte und Abteilungen werden in beiden Führungsansätzen als Gegenstand betrachtet. Während der heroische Ansatz die Bedeutung dieser jedoch bewusst versucht zu schmälern, um sie der eigenen Führung zu unterwerfen, betrachtet die postheroische Führung sie aus einem anderen Blickwinkel. Sie versucht die Systeme unter Berücksichtigung des Innen und Außen zu stärken und zu sichern (Baecker 2015, S. 1 f.).
3.2 Führungsverhalten
Beim Führungsverhalten kann zwischen den Dimensionen mitarbeiterorientiertes Verhalten und aufgabenorientiertes Verhalten unterschieden werden, was eine Zuordnung aller empirisch unterschiedenen Verhaltensweisen erlaubt (Neuberger 2002, S. 21). Mitarbeiterorientiertes Führungsverhalten berücksichtigt die persönlichen und individuellen Bedürfnisse der Arbeitnehmer/innen und respektiert diese, ebenso wie spezifische und individuelle Vorstellungen. Aufgabenorientiertes Führungsverhalten fokussiert hingegen die Erreichung der Unternehmensziele und beeinflusst die individuellen Zielvorgaben der Mitarbeiter/innen, sowie die Unterstützung bei und Delegation von Aufgaben (Nerdinger 2014, S. 87). Die Wirkung dieser beiden Dimensionen des Führungsverhaltens wurde in vielen wissenschaftlichen Studien untersucht. In ihrer Metaanalyse analysierten Judge, Piccolo und Ilies (2004) 163 unabhängige Korrelationen für mitarbeiterorientiertes und 159 Korrelationen für aufgabenorientiertes Führungsverhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass das Führungsverhalten, gemessen über die beiden genannten Dimensionen, in einem relativ starken Zusammenhang mit den Führungsergebnissen steht. Die Korrelation liegt bei der Dimension des mitarbeiterorientierten Führungsverhaltens bei ρ=.48 und bei dem aufgabenorientierten Verhalten bei ρ=.29 mit den Führungsergebnissen. Die einzelnen Aspekte, die beeinflusst werden und sich im Ergebnis zeigen, variieren jedoch zwischen den beiden Dimensionen. Das mitarbeiterorientierte Verhalten steht demnach in einem starken Zusammenhang mit der Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen (z.B. Arbeitszufriedenheit, Zufriedenheit mit der Führung), der Motivation und der Führungseffektivität. Das aufgabenorientierte Verhalten hingegen korreliert besonders mit der Leistung der Führungskräfte und der Leistung der Gruppe, sowie der Organisation. Die Gültigkeit der Ergebnisse konnte in den meisten Fällen unabhängig von der verwendeten Maßnahme verallgemeinert werden, sodass die Ergebnisse der Studie von Judge, Piccolo und Ilies für die Führungsforschung insgesamt und für die Differenzierung nach den Dimensionen ,Mitarbeiterorientierung‘ und ,Aufgabenorientierung‘ Relevanz haben (Judge, Piccolo und Ilies 2004, S. 39 ff.).
Die Forschungsansätze, die Führungsverhalten untersuchen, stellen eine Vielzahl an Theorien und Modellen zur Verfügung. Eines der bekanntesten Modelle, welches im Folgenden erläutert wird, ist das in den 1990ern entwickelte Full-Range-Leadership-Modell von Bass und Avolio. Dieses Modell zählt zur heroischen Phase und unterscheidet zwischen der transaktionalen, der transformationalen und der Laissez-faire-Führung (Furtner & Baldegger 2016, S. 139). Die Führungskraft agiert in diesem Modell vordergründig als Einzelperson und stellt Fokus und Zentrum der Organisation dar. Das Führungsverhalten umfasst hierbei unterschiedliche Ausprägungen, die von einer aktiven Führung (transformationale Führung) über eine passive Führung bis hin zu der völligen Abwesenheit von Führung (Laissez-faire-Führung) reichen (ebd., S. 140 f.). Eine genauere Betrachtung der einzelnen Führungsstile soll die Abgrenzung und Unterscheidung eingängiger machen.
Der transaktionale Führungsstil basiert auf dem lerntheoretischen Konstrukt der Verstärkung. Die Führungskraft überwacht hierbei sowohl den Weg, den die Mitarbeiter/innen zur Zielerreichung wählen, als auch die Erreichung dieser Ziele im Ergebnis. Der Erfolg der Mitarbeiter/innen wird belohnt, während die Verfehlung der Ziele bestraft wird (Nerdinger 2014, S. 90). Dieser Ansatz lehnt sich an die Weg-Ziel-Theorie der Führung an, die auf Evans und House zurückgeht. Dieser Theorie nach kann sich das Führungsverhalten einer Person je nach Situation verändern und ist nicht stabil. Die Geführten stellen hierbei einen situativen Faktor dar, der zu einer Verhaltensanpassung der Führungskraft führt (Rosenstiel, Molt & Rüttinger 2005, S. 361). Nach Evans ist die Motivation des Geführten einem bestimmten Weg zu folgen sowohl für die Zielerreichung, als auch für die Jobzufriedenheit relevant (Evans 1970, S. 281). Die Führungskräfte unterliegen demnach dem Versuch, die Motivation der Geführten durch den Einsatz entsprechender Führungsinstrumente zu beeinflussen, um so eine Zielerreichung sicherstellen zu können (Rosenstiel, Molt & Rüttinger 2005, S. 361). Der transformationale Führungsstil nimmt eine Erweiterung des transaktionalen Ansatzes vor. Er baut auf der normalen Auslastung der Mitarbeiter/innen auf und ,transformiert‘ die Geführten hin zu einer erhöhten Anstrengung. Diese Extra-Anstrengung kann über vier Techniken hervorgerufen werden. Hierbei handelt es sich um den idealisierten Einfluss, die inspirierende Motivierung, die intellektuelle Stimulierung und die individualisierte Behandlung (Nerdinger 2014, S. 90). Die Laissez-Faire-Führung kennzeichnet als dritten Führungsstil die starke Absenz von Führung, wodurch sie häufig auch als Nonleadership bezeichnet wird. Das Führungsverhalten ist sehr ineffektiv und passiv. Das Einhalten und Erreichen von Zielen wird weder kontrolliert, noch gefördert und spielt in den Augen der Führungskraft keine für sie relevante Rolle (Furtner & Baldegger 2016, S. 143 f.). Auf diese führungszentrierten Ansätze reagierte die postheroische Phase, indem sie in ihren Annahmen die Führungskraft als Einzelperson zunehmend ablehnt. Diese Phase konzentriert sich stärker auf die Potenziale der Geführten und beleuchtet den Führungsbegriff aus einer anderen Perspektive. Zentrale Schlüsselbegriffe sind Self-Leadership, Shared Leadership und Empowering Leadership (ebd., S. 2).
In einer empirischen Untersuchung zeigten Mahoney, Jerdee und Carroll, dass die Bedeutung einzelner Führungsverhaltensweisen zudem vom Merkmal der Hierarchieebene beeinflusst wird und demnach unterschiedlich ausfallen kann (Mahoney, Jerdee & Carroll 1965, S. 109 f.). Während Führungskräfte auf der unteren Leitungsebene eines Unternehmens insbesondere als Supervisor tätig sind (diese Funktion umfasst 51% der Führungstätigkeit), nimmt diese Rolle mit steigender Hierarchieebene ab und ein Agieren als Planer und Generalist wird bedeutender (Planer: Lower Management (LM) 15%, Middle Management (MM) 18%, Higher Management (HM) 28%; Generalist: LM 9%, MM 10%, HM 20%; Supervisor: LM 51%, MM 36%, HM 22%) (ebd.). Dies zeigt, dass die beratenden und unterstützenden Tätigkeiten, ebenso wie der enge Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit zunehmender Hierarchieebene generalistischen und standardisierten, prozessorientierten Aufgaben weichen.
3.2.1 Führungsverhalten und Geschlecht
Im Jahr 2011 untersuchten Vinkenburg et al. in zwei experimentellen Studien das Führungsverhalten im Hinblick auf Geschlechterstereotypen. Die erste Studie untersuchte die Genauigkeit von deskriptiven Geschlechterstereotypen, die in Bezug auf Führungsstile vorherrschen. Die zweite Studie untersuchte präskriptive Stereotype über die Bedeutung von Führungsstilen für die (Be-)Förderung von Frauen und Männern auf verschiedenen Ebenen in Organisationen (Vinkenburg et al. 2011, S. 10). Hierbei konnte gezeigt werden, dass Frauen ein stärker transaktionales und transformationales Führungsverhalten zeigen, während Männer häufiger auf Laissez-faire-Führungspraktiken und Management-by-Exception-Verhalten zurückgreifen (ebd., S. 18 f.). Management-by-Exception beschreibt ein Führungsverhalten, bei dem die Führungskraft nur in Ausnahmesituationen in die Aufgaben und Arbeiten der Mitarbeiter/innen eingreift. Die Führungskraft wird somit nur aktiv, wenn sie helfend oder unterstützend eingreifen muss (Nerdinger 2014, S. 90). Die Studie zeigte zudem, dass die inspirierende Motivation (als Technik der transformationalen Führung) von männlichen Führungskräften als wichtiger erachtet und von diesen häufiger verwendet wird. Zudem ist sie insbesondere im Rahmen einer Beförderung zum CEO bedeutend. Ferner wurde deutlich, dass für den beruflichen Aufstieg von Frauen eine weitere Technik relevant ist. Hierbei handelt es sich um die individuelle Berücksichtigung, die Frauen selbst als wichtiger erachten und im Gegensatz zur inspirierenden Motivation auch häufiger zeigen (Vinkenburg et al. 2011, S. 18 f.). Während Männer ihren Fokus auf die inspirierende Motivation legen sollten, wird von Frauen erwartet, dass sie für ihren beruflichen Aufstieg eine Kombination aus inspirierender Motivation und individueller Berücksichtigung vornehmen. Hieraus entsteht für weibliche Führungskräfte eine Art Doppelbelastung, indem sie die inspirierende Motivation zusätzlich zur individuellen Berücksichtigung in ihr Verhalten integrieren sollten (ebd.). Die unterschiedlichen Techniken, die je nach Geschlecht präferiert und fokussiert werden, können hierbei mit vorherrschenden Geschlechtsstereotypen tendenziell in Verbindungen gebracht werden. Demnach werden Frauen als emotionaler und in Hinblick auf die weibliche Rolle der Mutter als einfühlsamer wahrgenommen, sodass angenommen werden kann, dass die Beachtung und Wertschätzung des einzelnen Individuums der weiblichen Rolle Nahe liegt. Im Gegensatz dazu kann die inspirierende Motivation mit männlichen Eigenschaften, wie Initiative und Durchsetzungsstärke, assoziiert werden. Eine genauere Betrachtung vorherrschender und einflussnehmender Geschlechtsstereotypen wurde bereits in Kapitel 1.2 vorgenommen.
Kark et al. (2012) überprüften in ihrer Studie, ob Führungskräfte als effektiver wahrgenommen werden, wenn sie weibliche, männliche oder androgyne Eigenschaften zeigen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Führungskräften Androgynität zu einer stärkeren Identifikation der Geführten führt (Kark, Waismel-Manor & Shamir 2012, S. 620). Die Effektivität von Führungskräften bezieht sich demnach auf die Fähigkeit, kulturell männliche und weibliche Eigenschaften zu zeigen, wie es androgyne Führungskräfte tun, die sowohl typisch weibliche (z.B. empathisch, einfühlsam), als auch männliche (z.B. durchsetzungsfähig, autoritär) Eigenschaften innehaben. Der Ansatz der Androgynie soll die Mann-Frau-Differenz überwinden und schafft eine Gleichheitsthese, nach der sich beide Geschlechter ändern und Widersprüche in einer dritten Position vereint werden sollen. Hierbei werden in dieser Position sowohl geschlechtsspezifische Merkmale bewahrt, als auch verändert und letztlich auf eine höhere Ebene des allgemein Menschlichen gehoben (Neuberger 2002, S. 790 f.). Nach Neuberger (2002) ist die Figur des Androgynen „die Überwindung des in Wahrnehmung, Sprache und Denken angelegten Differenzprinzips […].“ (ebd., S. 791). Die Forscher/innen konnten in ihren Ergebnissen darüber hinaus geschlechtsspezifische Unterschiede aufzeigen. Es wurden sowohl für weibliche, als auch für männliche Manager höhere Werte auf der Maskulinitätsskala als auf der Feminitätsskala gemessen. Demnach wurden bei Frauen mehr maskuline Verhaltensweisen erkannt als weibliche Merkmale bei Männern, sodass Frauen häufiger androgyn auftreten (Kark, Waismel-Manor & Shamir 2012, S. 630). Darüber hinaus zeigen sich nach Kark et al. geschlechtsspezifische Unterschiede insbesondere dann, wenn nicht-androgyne Eigenschaften gezeigt werden. Frauen werden demnach stärker dafür bestraft, wenn sie als nicht-androgyn wahrgenommen werden und das Zeigen männlicher Eigenschaften ausbleibt. Das äußert sich in einer geringeren persönlichen Identifikation der Geführten mit der Führungskraft und einer geringeren Bewertung als transformative Führungskraft (ebd., S. 637). Dies steht im Einklang mit der von Eagly und Karau (2002) untersuchten Role Congruity Theory, nach der sich in Bezug auf weibliche Führungspersönlichkeiten das Vorurteil zeigt, dass eine wahrgenommene Inkongruenz zwischen weiblicher Geschlechterrolle und Führungsrolle besteht. Diese Inkongruenz äußert sich in zwei Formen. Zum einen werden Frauen als potentielle Inhaber von Führungsrollen weniger positiv wahrgenommen als Männer. Zum anderen wird ein bestimmtes Verhalten, dass die Vorgaben einer Führungsrolle erfüllt, weniger positiv bewertet, wenn es von Frauen gezeigt wird (Eagly & Karau 2002, S. 573). Nicht-androgyne männliche Führungskräfte werden von männlichen Geführten positiver bewertet als von weiblichen Geführten und insgesamt weniger kritisch beurteilt als nicht-androgyne weibliche Führungskräfte (Kark, Waismel-Manor & Shamir 2012, S. 637). Diese Ergebnisse zeigen, dass sowohl Frauen, als auch Männer androgyne Verhaltensweisen zeigen sollten, um ihre Führungseffektivität zu steigern. Bezüglich der erläuterten Führungsstile entsprechen androgyne Manager der transformationalen Führung am stärksten. Nicht-androgyne Manager hingegen zeigen geschlechtsunspezifisch am stärksten vermeidendes Führungsverhalten, welches hoch ineffektiv ist (ebd., S. 629).
Die vorgestellten Studien bringen exemplarisch nur einige Ergebnisse hervor, die bezüglich geschlechtsspezifischem Führungsverhalten in den vergangenen Jahren erzielt werden konnten. Neuberger (2002) analysierte verschiedene dieser empirischen Studien zu Führungsverhalten und Geschlecht und konnte entgegen verschiedener Annahmen zeigen, dass weder in Bezug auf Führungsverhalten, noch auf Führungserfolg bedeutsame und stabile geschlechtsspezifische Unterschiede nachgewiesen werden können. Es werden zudem keine markanten Führungsstilunterschiede zwischen den Geschlechtern deutlich und auch ein unter allen Umständen überlegener Führungsstil konnte nicht definiert werden. Dies resultiert insbesondere aus der sozialen Konstruktion des Merkmals ,Geschlecht‘, da Frauen und Männer demnach typisiert und auf wenige Haupttendenzen im Rahmen der Sozialisation reduziert werden. Zudem unterliegen beide Geschlechter externen Zwängen (z.B. Effizienzforderung, Zeitdruck), wodurch der individuell bevorzugte Führungsstil nicht frei praktiziert werden kann (Neuberger 2002, S. 790).
3.3 Führungsmotivation
Um im nächsten Abschnitt den Aspekt der Führungsmotivation beleuchten zu können, ist zunächst eine Begriffsdefinition erforderlich. „Mit ,Motivation‘ ist [im Folgenden] die Gesamtheit der intrapsychischen Beweggründe gemeint, die Qualität, Richtung, Intensität und Dauer von Handlungen bestimmen.“ (Neuberger 2002, S. 533). Zudem ist eine Person motivierter und probiert mit größerer Wahrscheinlichkeit ein neues Verhalten aus, wenn sie glaubt, dass sie mit diesem erfolgreich sein kann und belohnt werden wird (Neuberger 2002, S. 585).
Bereits 1938 stellte der US-Psychologe Henry Murray fest, dass zwei Bedürfnisse unsere Motivation beeinflussen und formen: viszerogene und psychogene Bedürfnisse. Während viszerogene Bedürfnisse auf organismischen Vorgängen beruhen, haben psychogene Bedürfnisse keine subjektiv lokalisierbaren, körperlichen Ursprünge. Sie werden durch vorherrschende Spannungen verursacht, die in einer starken Abhängigkeit zu äußeren Bedingungen oder Bildern, die diese Bedingungen verdeutlichen, stehen. Sie beziehen sich daher auf mentale oder emotionale Befriedigungen (Murray 1938, S. 76 f.). Auf Grundlage dieser Erkenntnis richtete sich das größte Forschungsinteresse auf die drei Motive Leistung, Macht und Anschluss, wofür McClelland mit seiner Motivationstheorie 1953 den Grundstein legte. Diese Motive erzeugen ein solches Interesse, da sie in fast allen alltäglichen Situationen angeregt werden können und daher eine Art ,Hauptbedürfnis‘ des Menschen darstellen. Sie regen die individuelle Motivation zu Handlung und Leistung an (Langens, Schmalt & Sokolowski o.J., S. 76). Das leistungsmotivierte Verhalten (Leistungsmotivation) kennzeichnet hierbei, dass an das eigene Handeln ein Gütestandard angelegt und somit die eigene Tüchtigkeit bewertet wird (Brunstein & Heckhausen 2006, S. 145). Das Bedürfnis nach Macht (Machtmotivation) kennzeichnet das Bedürfnis, andere in ihrem Erleben und Verhalten kontrollieren, sowie beeinflussen zu können. Primär steht die Kontrolle von Ressourcen im Fokus, die durch Kontrolle über andere Person angestrebt wird. Eine Machtquelle, die die Legitimation zu einer solchen Kontrollübernahme darstellt, ist die Führungsposition (Schmalt & Heckhausen 2006, S. 213 ff.). Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit (Anschlussmotivation) beschreibt das Bedürfnis, durch Freundschaften oder andere zwischenmenschliche Verbindungen soziale Beziehungen aufzubauen (Murray 1938, S. 83). Die zwei Komponenten, die sich bei dem Anschlussmotiv unterscheiden lassen, werden als „Hoffnung auf Anschluss“ und „Furcht vor Zurückweisung“ bezeichnet (Sokolowski & Heckhausen 2006, S. 198). Welche Motive bei einer Person stark ausgeprägt sind, hängt davon ab, welche Erfahrungen sie in ihrer sozialen Entwicklung gemacht hat. Hierbei können sich Motive jedoch im Jugend- und Erwachsenenalter noch ändern (Furtner & Baldegger 2016, S. 25 f.).
Im Hinblick auf die hier darzustellende Führungsmotivation greifen Schmalt und Heckhausen eine Längsschnittstudie von Kock zwischen 1952 und 1961 auf, die 15 neugegründete Unternehmen untersuchte. Diese Studie konnte belegen, dass ein hohes Machtmotiv, ein hohes Leistungsmotiv und ein geringes Anschlussmotiv langfristig für den unternehmerischen Erfolg ausschlaggebend sind. Hierfür hat Kock verschiedene wirtschaftliche Entwicklungsfaktoren in diesen Unternehmen erhoben und mit den nachträglich gemessenen Leistungs-, Macht- und Anschlussmotiven der maßgebenden Personen der Firmenleitung in Beziehung gesetzt (Schmalt & Heckhausen, S. 231). Auch Wainer und Rubin (1969) untersuchten 51 technische Unternehmen im Hinblick auf die Beziehung zwischen Motivation und Unternehmensleistung. Hierbei wurden die Motivausprägungen der Unternehmer/innen im Zusammenhang mit der Unternehmensleistung der Organisationen, die sie gründeten und betrieben, untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass eine hohe Leistungsmotivation und eine moderate Machtmotivation mit hohen Unternehmensleistungen verbunden sind. Die Auswirkungen des Macht- und des Anschlussbedürfnisses auf die Leistung scheinen von ihrem Einfluss auf die Führungsstile abhängig zu sein und zeigen einen individuelleren Charakter auf (Wainer & Rubin 1969, S. 183 f.).
[...]
- Arbeit zitieren
- Joana Zweiffel (Autor:in), 2018, Emotionsarbeit weiblicher Führungskräfte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434729
Kostenlos Autor werden







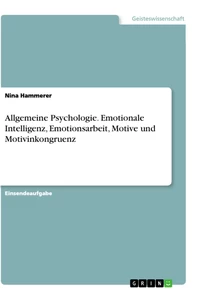





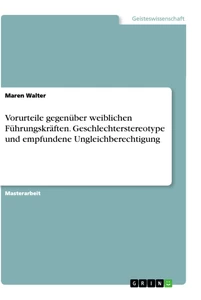








Kommentare