Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Teil I. Einleitung und Methodik der Arbeit
A. Einleitung
B. Zum Begriff des Wettbewerbsföderalismus
1. Versuch einer Operationalisierung
2. Die ökonomische Theorie des Föderalismus als ideengeschichtlicher Hintergrund
2.1 Der Rational-Choice-Ansatz
2.2 Grundlagen eines wettbewerbsorientierten Föderalismus
Teil II. Kooperativer Föderalismus und Wettbewerbsföderalismus – Praxis und Ideal
A. Die Praxis: Unitarisch-kooperativer Föderalismus im Grundgesetz
1. Die Große Finanzreform von 1969 – die institutionalisierte Kooperation
1.1 Entstehungszusammenhang
1.2 Ergebnisse der Finanzreform
2. Zentrale Institutionen der bundesdeutschen Finanzverfassung
2.1 Aufgaben- und Ausgabenverteilung (Art. 104a GG)
2.1.1 Das Konnexitätsprinzip als Grundsatz
2.1.2 Ausnahmen
2.2 Kompetenzen zur Steuergesetzgebung (Art. 105 GG)
2.3 Die vertikale Verteilung der Steuererträge (Art. 106 GG)
2.3.1 Das Trennsystem (Art. 106 Abs. 1 und 2 GG)
2.3.2 Das Verbundsystem (Art. 106 Abs. 3 GG)
2.4 Das System des Finanzausgleichs (Art. 107 GG)
2.4.1 Der horizontale Finanzausgleich zwischen den Ländern (Länderfinanzausgleich)
2.4.1.1 Länderfinanzausgleich im weiteren Sinne (Art. 107 Abs. 1 GG)
2.4.1.2 Länderfinanzausgleich im engeren Sinne (Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG)
2.4.2 Der vertikale Finanzausgleich – die Bundesergänzungs- zuweisungen (Art. 107 Abs. 2 S. 3 GG)
2.4.2.1 Fehlbetrags-BEZ
2.4.2.2 Sonderbedarfs-BEZ
B. Die Theorie: Reformszenarien für eine Neuausrichtung der föderalen Ordnung
I. Vorschläge aus dem politischen Raum
1. Position der Bundesregierung
2. Position der Länderregierungen
3. Position der Länderparlamente – der „Föderalismuskonvent“
4. Reformkonzepte parteinaher Stiftungen und Einrichtungen
4.1 Konrad-Adenauer-Stiftung
4.2 Bundesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (BACDJ)
4.3 Friedrich-Naumann-Stiftung
5. Reformkonzepte parteiunabhängiger Stiftungen
5.1 Bertelsmann Stiftung
5.2 Stiftung Marktwirtschaft
6. Stiftungsallianz „Bürgernaher Bundesstaat“
II. Reformkonzepte aus dem Wirtschafts- bzw. finanzwissenschaft- lichen Bereich
1. Abmilderung der Fehlanreize des Finanzausgleichs durch Abbau der Grenzbelastungen – eine Reformstudie
1.1 Darstellung der Zahlungen im Finanzausgleich 1999
1.2 Darstellung der Grenzbelastungen im Finanzausgleich 1999
1.3 Reformvorschlag
2. „Begrenzte Steuerautonomie“ der Länder – eine Studie des ifo-Instituts
2.1 Begrenztes Zuschlags- oder Abschlagsrecht der Länder
2.2 Effizienzverbesserung bei der Mischfinanzierung
3. Getrennte Aufgaben- und Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern – eine Simulation
3.1 Vorschlag für die Aufgaben- (Ausgaben-)Verteilung
3.2 Gebundenes Trennsystem bei der Steuerverteilung
3.3 Ergebnisse des Simulationsmodells
3.4 Realisierbarkeit des Konzepts
4. Reformvorschläge des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)
4.1 Eindeutige Zuordnung von Staatsaufgaben, Finanzverant- wortung und Steuereinnahmen
4.2 Abschaffung von Gemeinschaftsaufgaben und Mischfinanzierung
4.3 Zurückführung des Länderfinanzausgleichs
5. Position der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber- verbände (BDA)
5.1 Entflechtung bei der Gesetzgebung
5.2 Stärkung der Länderautonomie und Neuordnung des Länderfinanzausgleichs
6. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
6.1 Vorschläge zur Steuerentflechtung
6.2 Abbau von Mischfinanzierungen
III. Reformüberlegungen von Seiten der politikwissenschaftlichen Forschung
1. Die Agenda einer realisierbaren Föderalismusreform bei Fritz W. Scharpf
1.1 Experimentierklauseln für die Bundesländer
1.2 Einführung eines systematischen Leistungsvergleichs für die Lösungen der Länder
1.3 Zur Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern
2. Die Reform der Finanzbeziehungen bei Arthur Benz
2.1 Wichtige Funktionen der Gemeinschaftsaufgaben
2.2 Beibehaltung der Aufgaben- bzw. Ausgabenverteilung im Grundgesetz
2.3 Finanzhilfen nicht generell ausschließen
3. Modernisierung durch eine Korrektur des Status quo
3.1 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
3.2 Neugliederung des Bundesgebietes
3.3 Neuverteilung von Gesetzgebungskompetenzen
3.4 Auflösung von Verflechtungstatbeständen
4. Lernen von den Nachbarn? Die Rolle von „best practice“- Modellen
5. Das Modell des kooperativen Wettbewerbsföderalismus und die indirekte Entflechtung
6. Zusammenfassung der Reformvorschläge
Teil III. Die Reformierbarkeit des deutschen Föderalismus – Wettbe- werbsföderalismus als bloßes Symbol oder tatsächlich machbar?
A. Ergebnisse bisheriger Reformbemühungen
B. Institutionelle Widerstandspotenziale und Blockademög- lichkeiten
1. Parteienwettbewerb als Hemmnis für Reformen
1.1 Die Rolle des Parteienwettbewerbs bei Gerhard Lehmbruch
1.2 Die Rolle der Parteien im Reformprozess bei Arthur Benz
2. Vetospieler im Reformprozess
2.1 Vetospieler Wahlrecht – die Notwenigkeit zur Koalitionsbildung
2.2 Vetospieler Bundesrat
2.3 Vetospieler Bundesverfassungsgericht
3. Die „Politikverflechtungsfalle“
3.1 Politikverflechtung im deutschen Bundesstaat
3.2 Die Theorie der Politikverflechtung
4. Der historisch-institutionelle Ansatz – Pfadabhängigkeit gewachsener Strukturen
5. Der akteursorientierte Ansatz – Handeln aus politischen Eigeninteressen
6. Der rational-psychologische Ansatz – die Angst vor unkalkulierbaren Risiken
C. Kritische Diskussion
1. Alles nur Pfadabhängigkeit und Politikverflechtung?
2. Relativierung des Parteienwettbewerbs
3. Vetospieler handeln auch strategisch
D. Anforderungen an eine „machbare“ Föderalismusreform
1. Prinzipielle Voraussetzungen einer strukturellen Reform
1.1 Einbeziehung und Mobilisierung der Öffentlichkeit
1.2 Nicht bloß Anpassungsreformen
1.3 Abgesicherte sozio-ökonomische und kulturelle Vielfalt
1.4 Aufbrechen des Steuerverbundes
1.5 Überdenken der Kompetenzen des Bundesrates
1.6 Positive Nebenwirkungen von Reformen
2. Berücksichtigung der Komplexität des deutschen Bundesstaates
Teil IV. Zusammenfassendes Fazit und Ausblick
Teil I. Einleitung und Methodik der Arbeit
A. Einleitung
Es sollte der große Wurf werden, doch letztlich hat es nicht gereicht. Am Ende des vergangenen Jahres (2004) erklärten die Vorsitzenden der im Oktober des Jahres 2003 eingerichteten gemeinsamen Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Moderni- sierung der bundesstaatlichen Ordnung, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Franz Müntefering und der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU), die Föderalismusreform offiziell für gescheitert. Hauptgrund war der Kompetenzstreit zwischen Bund und Ländern um die Bildungspolitik. Umso bedauerlicher, hatten sich doch beide Ebenen bereits in anderen wesentlichen Reformbereichen bis zur Beschluss- reife geeinigt. So galt in der Kommission unter anderem das d’accord, die Bestimmungen des EU-Stabilitätspaktes ins Grundgesetz aufzunehmen und die Länder bei einer Ver- letzung der Defizitobergrenze an Strafzahlungen zu beteiligen. Doch schlussendlich patzten die Politiker „bei der ‚Mutter aller Reformen’“[1]. Das Scheitern der Bemühungen rief sowohl auf Seiten der Politik als auch der Wirtschaft Bestürzung und Bedauern hervor. Bundespräsident Horst Köhler nannte das Ergebnis „kein Ruhmesblatt für die Politik“[2], während der scheidende Präsident des Bundesverbandes der Industrie (BDI), Michael Rogowski, „den Fehlschlag ‚blamabel für Deutschland’“[3] hält.
Doch wie soll und vor allem wie kann es nun weitergehen? Der deutsche Föderalismus ist reformbedürftig. Darin stimmen Politiker von Bund und Ländern überein und dieser Befund wird auch von Wissenschaftlern, die sich mit der Bundesstaatlichkeit in Deutsch-land befassen, geteilt. Auch der Bundespräsident hat sich der Sache verschrieben: „Das Thema interessiert ihn seit Amtsbeginn (...). Köhler hat sich entschlossen, das ganze Gewicht seines Amtes in die Waagschale zu werfen.“[4] Das sieht man auf Seiten der beiden großen Parteien ähnlich. „Das Scheitern der Kommission ‚kann nicht das letzte Wort gewesen sein’, mahnte CDU-Chefin Angela Merkel (...) in einem Brief an alle Mandats- träger der Partei. Mit einem Neubeginn dürfe man nicht bis zum nächsten Jahr warten, erklärte auch Bundeskanzler Gerhard Schröder.“[5] Und schenkt man den Ankündigungen der FDP Glauben, so möchten die Liberalen als Reaktion auf das Scheitern alsbald einen Vorstoß in Richtung eines Verfassungskonvents unternehmen.
Übereinstimmung scheint es auch bei der Beantwortung der Frage nach den Gründen für die Reformbedürftigkeit zu geben. Genannt werden Strukturen, die die Leistungsfähigkeit der Politik von Bund und Ländern beeinträchtigen, die zu Entscheidungsblockaden führen und als dringend bezeichnete Reformvorhaben auf wichtigen Politikfeldern ver-hindern und die hinsichtlich ihrer demokratischen Qualität als mangelhaft gelten. Verwie- sen wird weiterhin auf ein Übermaß an Unitarisierung[6] und das Fehlen von Möglichkeiten zu eigenständiger Politikgestaltung sowohl des Bundes als auch einzelner Länder als Folge des Verbundföderalismus. Es geht somit auch um die Frage der Anpassungsfähigkeit eines föderalen Staatswesens an veränderte politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Föderalistische Systeme sind nämlich „ständig wechselnden Anfor- derungen und Problemen ausgesetzt (...).“[7] Sie befinden „sich unter einem stetigen Anpas- sungs- und Optimierungsdruck.“[8] Dies gilt selbstverständlich auch und ganz besonders für den deutschen Föderalismus, man denke nur an die Herausforderungen der politi- schen und vor allem finanziellen Bewältigung der Deutschen Einheit. Gerade unter solchen Gegebenheiten ist es besonders interessant zu beobachten, „wie (...) institutionelle Anpassungen erbracht werden (oder auch nicht), wie die Akteure des ‚constitutional process’ im Föderalismus agieren, wie sich dadurch ein föderalistisches System ändert, und welche Auswirkungen dies auf Politikformulierung und Politikgestaltung hat.“[9] Damit wird klar: föderalistische Staatswesen entwickeln sich weiter, mal mehr, mal weniger, bleiben aber im Endergebnis nicht statisch. In Anlehnung an Jens Joachim Hesse und Arthur Benz unterliegen sie einem ständigen „Prozess der Reproduktion institutioneller Struktur“ (Hesse/Benz 1988 ). Lothar Späth spricht bezogen auf den deutschen Födera- lismus vom „energisch betriebenen Wandel vom Versorgungsstaat zur Bürgergesellschaft (...)“[10] Was hier in einem knappen Satz zum Ausdruck kommt, konkretisiert sich in den Ausführungen Fritz W. Scharpfs. Er ist der Ansicht, die deutsche Politik werde heutzutage „auch durch die Globalisierung der Kapitalmärkte, durch die Vollendung und die Osterweiterung des europäischen Binnenmarktes, durch die Erstreckung der euro- päischen Wettbewerbspolitik auf Aufgaben der ‚Daseinsvorsorge’, durch die Europäische Währungsunion und den Verlust einer auf die deutsche Wirtschaft zugeschnittenen Geld- politik, und vor allem durch die Folgen hoher Arbeitslosigkeit und fallender Geburtenra- ten“[11] vor neue Herausforderungen gestellt. Deshalb gelte „die gleiche Struktur (des deutschen Föderalismus, Anm. d. Verf.) den Meinungsführern einer zunehmend frustrier- ten und politikverdrossenen Öffentlichkeit geradezu als die eigentliche Ursache der politischen Malaise in unserem Land.“[12] Die Öffentlichkeit wird nun aber nicht nur von Personen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft repräsentiert, sondern letztendlich von der gesamten Bevölkerung eines Staatswesens.
Schenkt man den Umfrageergebnissen der Initiative „Perspektive Deutschland“ Glauben, macht sich auch in diesem Bereich verstärkt Sorge und Misstrauen in Bezug auf die Problemlösungskompetenz unserer staatlichen Strukturen breit. Die Initiative, die gemein- sam vom Beratungsunternehmen McKinsey & Company, dem Magazin Stern, dem Zweiten Deutschen Fernsehen und dem Internet-Unternehmen AOL ins Leben gerufen wurde, ermittelt seit 2001 durch Internetbefragungen jährlich die Einstellungen der deutschen Bevölkerung unter anderem zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen. Für das Jahr 2003 kommt die Studie unter anderem zu dem Ergebnis, dass „das Misstrauen gegenüber den Institutionen“[13] weiter gestiegen ist. „Alles in allem gaben 50 % der Bürger an, dass sie den öffentlichen Institutionen, Organisationen und Einrichtungen eher misstrauen denn vertrauen. (...) Die Menschen mahnen noch entschiedener als im Vorjahr Verbesserungen an. Während im Vorjahr bereits 68 % der Bürger dringenden Verbes- serungsbedarf bei Deutschlands öffentlichen Institutionen sahen, ist dieser Wert in diesem Jahr auf 77 % angestiegen.“[14] Die Umfrageergebnisse bestätigen das zuvor Gesagte: Es rumort im Gebälk, im strukturellen Gebälk des politischen Systems der Bundesrepublik und damit auch im bundesdeutschen Föderalstaat und seinen institutio- nellen Strukturen. Es herrscht also Einigkeit in der Frage, dass der deutsche Föderalismus, so wie er sich im Moment im Grundgesetz präsentiert, reformbedürftig ist. Das „ob“ einer Reform steht also fest. Über das „wie“ allerdings wird heftig diskutiert. Nicht nur die Politiker der alten und neuen Hauptstadt beschäftigen sich bereits seit längerem mit diesem Thema, auch die Wissenschaft und die Wirtschaft streiten trefflich mit, wenn es um Mittel und Methoden der Reform des Föderalismus geht. Im Raum stehen eine Vielzahl unterschiedlicher Vorstellungen und Ansätze, wie eine Reform des deutschen Bundesstaates auszusehen habe. „Auf dem Prüfstand (...) stehen das Zusammenspiel und die Kompetenzen von Bund, Ländern und Kommunen. Aber auch allgemein ist die Frage gestellt, ob der deutsche Föderalismus in seiner gegenwärtigen Form den Herausfor- derungen der Zukunft gewachsen ist.“[15]
Bereits vor vielen Jahrzehnten sind diese Fragen bearbeitet worden, doch jeweils auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Schwerpunkten. „Die Reformdiskus- sion in den neunziger Jahren orientiert sich im Unterschied zu früheren Diskussionen, die in den sechziger Jahren den kooperativen Föderalismus zum Gegenstand hatte und in den siebziger und achtziger Jahren die Politikverflechtung als Hindernis für eine Reform kritisierte, an der ökonomischen Theorie und tritt für den Wettbewerbsföderalismus ein, der gegebenenfalls auch auf Kosten der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse für mehr Effizienz sorgen soll.“[16] Diesen „neuralgischen Punkt“ des Grundgesetzes, der seine konkrete Ausformung expressis verbis im Artikel 72 Abs. 2 über die Bestimmungen der konkurrierenden Gesetzgebung erfährt, hat auch unlängst Bundespräsident Horst Köhler kritisiert. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus sagte er wörtlich: es „gibt es nun einmal überall in der Republik große Unterschiede in den Lebensverhältnis- sen. Das geht von Nord nach Süd wie von West nach Ost. Wer sie einebnen will, zemen- tiert den Subventionsstaat und legt der jungen Generation eine untragbare Schuldenlast auf. Wir müssen wegkommen vom Subventionsstaat.“[17] Dass der Bundespräsident mit diesen Worten insbesondere in den neuen Bundesländern eine breite Welle der Entrüs- tung auslöste, braucht hier nicht näher erläutert zu werden. Wichtig ist die Botschaft hinter seinen Worten. Offensichtlich spricht sich unser Staatsoberhaupt gegen einen Mechanismus der „Gleichmacherei“ (Anm. d. Verf.) aus, der in unserer Verfassung nicht nur in den Bestimmungen über die konkurrierende Gesetzgebung eingebaut ist, sondern auch wesentliche Teile der Finanzverfassung (vgl. die Artikel 104a – 115 des Grundge- setzes [das Wort Grundgesetz wird im folgenden der Einfachheit halber mit GG abge- kürzt) umfasst und tritt für mehr Wettbewerb zwischen den einzelnen Ebenen des Bundesstaates ein. Damit ist der zentrale Begriff gefallen, um den es in dieser Abhandlung gehen soll, und der lautet: Wettbewerb. Wie oben dargestellt, steht dieses Modell verstärkt seit den neunziger Jahren auf der Tagesordnung all der Reformer, die die aktuelle Ausge- staltung des deutschen Föderalismus kritisieren und die sich in ihrer Argumentation hauptsächlich an ökonomischen Effizienzkriterien orientieren. Im Detail geht es dabei um den Vorwurf, die Bundesländer hätten vor allem durch den Einfluss des Bundes über die konkurrierende Gesetzgebung kaum noch Spielräume für eine autonome Politik. Gerade im Bereich einer eigenständigen Steuergesetzgebung und damit in der Möglichkeit, selb- ständig Einnahmequellen zu generieren, seien sie massiv durch den Bund eingeschränkt (vgl. Art. 105 GG). In gleichem Atemzug wird der Finanzausgleich kritisiert, dem eine nivellierende Wirkung durch Ausgleichszahlungen und Zuweisungen sowohl durch den Bund an die Länder als auch zwischen den einzelnen Ländern untereinander zugespro- chen wird und der den Bundesländern dadurch keine Anreize böte, eine vernünftige Finanz- bzw. Wirtschaftspolitik zu betreiben. Diese These des mangelnden Anreizes wird vorzugsweise von der Seite der Wirtschaft vertreten. Sie plädiert für eine Abschaffung der wichtigsten Regelungen des Finanzausgleichs und fordert mehr Autonomie und Wettbe- werb für und zwischen den Bundesländern.
Doch sind solche Reformüberlegungen in die Realität überführbar? Taugen sie für eine Reform des deutschen Bundesstaates? Auf diese Fragen eine Antwort zu finden ist das Ziel dieser Arbeit. Dazu widmet sich Kapitel B zunächst der begrifflichen Dimension des Wettbewerbsföderalismus und seines ideengeschichtlichen Hintergrundes. Ohne die theoretische Herleitung des Begriffes ist ein Verständnis davon, was Wettbewerbsfödera- lismus im Kern meint, nur sehr schwer wenn gar überhaupt nicht möglich.
In Teil II der Arbeit erfolgt eine Darstellung des aktuell praktizierten deutschen Föderalismus. Kapitel A macht dabei in einem kurzen historischen Abriss deutlich, dass die große Finanzreform von 1969 und die damit verbundene und heute in ihren größten Teilen noch gültige Finanzordnung als zentraler Motor für die Ausgestaltung des deutschen Föderalismus fungiert hat. „Die Ausgestaltung des Finanzwesens stellt ein Kernstück des Bundesstaates dar“[18], und damit wird auch deutlich, dass die Verteilung der finanziellen Ressourcen zwischen dem Bund und seinen Gliedstaaten von herausragender Bedeutung in einem föderalen Staatswesen ist. Altbundespräsident Roman Herzog bestätigt dies wenn er sagt, dass „in der modernen Politik die Frage der Finanzen der eigentlich springende Punkt ist.“[19] Der Staat sei heute „mehr als zu jeder anderen Zeit auf kostspielige Investitionen und Geldtransfers ausgerichtet (...) und da die staatlichen Aufgaben hierzulande auf Bund und Länder verteilt sind, hängt alles auch davon ab, wie die Masse der staatlichen Einnahmen, also vor allem der Steuern, auf diese beiden Ebenen des Bundesstaates verteilt werden.“[20] An diese Problematik knüpfe ich in dieser Arbeit an und stelle somit die finanziellen Beziehungen zwischen Bund und Ländern sowie den Ländern untereinander in den Vordergrund meiner Analyse. Dieses Vorgehen lässt sich schon mit der prinzipiellen Konzeption eines föderalen Bundesstaates begründen: „Im sozialen Bundesstaat bestand und besteht immer ein Spannungsverhältnis zwischen dem föderalen Prinzip der Vielfalt, der Unterschiedlichkeit und des Wettbewerbs einerseits und dem solidaritätsverpflichteten Prinzip der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse andererseits.“[21]
Die Finanzordnung wird als sogenannter „Brennpunkt“ (Begriff in Anlehnung an den Kurs „Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland“ der Fernuniversität Hagen) des deutschen Föderalismus angesehen. Dabei ist es zunächst einmal angebracht, die wesent- lichen Instrumente bzw. die Ausgestaltung der geltenden Finanzordnung zu erläutern und in das Blickfeld des Lesers zu rücken. In der Finanzverfassung legt das Grundgesetz u.a. eine Abgrenzung der Finanzierungszuständigkeit von Bund und Ländern (Art. 104a GG), eine Trennung der Kompetenzen des Bundes und der Länder für die Steuergesetzgebung (Art. 105 GG) und die Ertragshoheit (Art. 106 und 107 GG) fest. Neben diesen Fragen sind für das Thema der Arbeit auch die sogenannten Mischfinanzierungen von Interesse, bei denen sich der Bund an verschiedenen Ausgaben der Bundesländer und ihrer Gemein- den beteiligt. Dies sind die Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a und b GG, die Finanz- hilfen nach Art. 104a Abs. 4 GG, die Geldleistungsgesetze nach Art. 104 Abs. 3 GG und der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) nach Art. 106a GG. Ich beschränke mich auf die Darstellung der beiden zuerst genannten Mischfinanzierungen, da diese in der Reformdebatte verstärkt Beachtung erfahren. Die übrigen Aspekte der Finanzverfassung können im folgenden außer Betracht bleiben. Die theoretische Darstellung der Instru- mente unserer Finanzverfassung wird zudem durch Datenmaterial, auch in Form von Zeitreihen, veranschaulicht und ergänzt. So erhält der Leser einen detaillierten und auch zahlenmäßigen Überblick über die finanziellen Bund-Länder-Beziehungen.
Im Hinblick auf die Darstellung des Finanzausgleichssystems muss unbedingt auf Fol- gendes hingewiesen werden: Seit dem ersten Januar 2005 existiert ein neues System der Finanzverteilung zwischen Bund und Ländern. Hintergrund ist das Urteil des Bundesver- fassungsgerichts vom 11. November 1999, in dem es über eine Klage der drei „Geberlän- der“ im Länderfinanzausgleich, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg, gegen das Finanzausgleichssystem, entschieden hatte. In seinem Urteil hatte das Gericht unter anderem einen „Maßstab für die Bestimmungen der Einnahmen und Ausgaben des Bundes und der Länder“ vom Gesetzgeber gefordert, nach dem die „Umsatzsteueranteile von Bund und Ländergesamtheit zu berechnen sind.“[22] Bund und Länder hatten sich sodann Anfang Juli 2001 über ein Maßstäbegesetz[23] als Grundlage des neu zu fassenden Finanzausgleichsgesetzes geeinigt. Dieses ist seit dem ersten Januar diesen Jahres Teil des sogenannten „Solidarpaktfortführungsgesetzes“ und beinhaltet eine Reihe neuer Rege- lungen über die Verteilung des Steueraufkommens zwischen Bund und Ländern. Immer dort, wo es zu einer Änderung der bis Ende 2004 geltenden Finanzausgleichsregelungen kam, wird bei der Darstellung der Instrumente des Finanzausgleichs gesondert darauf hingewiesen und das bis Ende 2004 geltende Recht dem künftigen Recht gegenüberge- stellt. Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass auch die Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit“[24] durch das neue Finanzausgleichsgesetz (im folgenden mit FAG abgekürzt) eine Änderung erfahren hat. Seit Beginn des Jahres 2005 kommt allein der Bund für dessen Finanzierung auf, was bis Ende 2004 auch die Länder anteilig taten. Einen Schwerpunkt in der Debatte um eine Reform des Finanzausgleich bildet dieser Bereich des Finanzausgleichs jedoch nicht.
Kapitel B stellt dem praktizierten Modell des deutschen Föderalismus das Reformmodell des Wettbewerbsföderalismus gegenüber. Nach der Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes in Kapitel A erfolgt hier quasi eine Beschreibung dessen, was gewollt ist, also des Soll-Zustandes. Der Autor beschreibt Reformszenarien bzw. Lösungsvorschläge, wie sie sich in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Politikwissenschaft finden. „In der Reformde- batte kann dabei auf eine Vielzahl von Analysen, Einzelvorschlägen und einige umfassen- de Reformkonzepte (...) zurückgegriffen werden (...).“[25] Bei der großen Anzahl von Mei- nungsäußerungen und konkreten Vorschlägen, die in den vergangenen Jahren vorgelegt wurden und auch heute vorgelegt werden, kann es nicht um Vollständigkeit gehen. Die Arbeit enthält vielmehr eine Auswahl von Positionspapieren und Vorschlägen, die zusammen genommen das breite Spektrum maßgeblicher Vorstellungen spiegeln. Diese Vorstellungen sind zum größten Teil wettbewerbsföderalistisch geprägt und finden sich verstärkt bei den Vertretern der Wirtschaft und der politischen Stiftungen.
Zum Bereich der Politik zählen neben den Positionen der Bundesregierung und der Länderregierungen auch die den im Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen nahe- stehenden politischen Stiftungen (z..B. Konrad-Adenauer-Stiftung) oder parteinahe Einrichtungen, soweit sie sich mit dem Thema in eigenen Projekten oder Reformkommis- sionen befassen. Neben den parteinahen haben sich auch einige parteiunabhängige Stiftungen (z.B. Bertelsmann Stiftung), mit dem Thema Föderalismusreform auseinander-gesetzt. Auch die dahingehend verabschiedeten Konzepte werden vorgestellt. Zum Be- reich der Wirtschaft zählen insbesondere Studien oder Projekte der großen Wirtschafts- institute (z.B. Institut für Wirtschaftsforschung, ifo-Institut), soweit sie sich mit der Neuausrichtung der föderalen Finanzbeziehungen befassen. Das Aufkommen ökono- misch orientierter Argumentationsmuster in der Diskussion um eine Föderalismusreform basiert auch auf finanzwissenschaftlichen Überlegungen. Eine Reihe von Wissenschaftlern hat Vorschläge unterbreitet, die hauptsächlich die negativen Anreizwirkungen und die hohen Grenzbelastungen des geltenden Finanzausgleichs kritisieren. Auch in einer politikwissenschaftlichen Arbeit verlangt das Thema eine Auseinandersetzung mit den – ausschließlich ökonomisch angelegten - Reformkonzepten der Finanzwissenschaft. Zumal sich dort auch die ökonomischen Begründungsmuster wiederfinden lassen, die die ehema- ligen Klageführer gegen den Länderfinanzausgleich (die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen) benutzt haben.
In einem letzten Schritt werden Reformvorschläge aus dem Bereich der politikwissen- schaftlichen Forschung beleuchtet. Gerade hier finden sich eine Reihe von Vorbehalten gegen eine ausschließlich am föderalen Wettbewerb orientierte Neuausrichtung unserer Verfassung. Es wird aber nicht nur Kritik geübt, sondern es werden auch konkrete Reformvorschläge unterbreitet, die es darzustellen gilt. Bei der Darstellung der unter- schiedlichen Reformkonzepte ist auf folgendes hinzuweisen: Aufgrund der erst zu Beginn des Jahres 2005 in kraft getretenen Reform des Finanzausgleichs beziehen sich die erläuterten Reformvorschläge und insbesondere die dargestellten Szenarien ausschließlich auf das „alte“ Recht bzw. die alte Fassung des Finanzausgleichs. Dies schmälert aber keinesfalls die Bedeutung und Aktualität der Empfehlungen im Hinblick auf zukünftige Reformdebatten.
Nachdem in Teil II wichtige Reformszenarien und Denkanstöße für mehr Wettbewerb zwischen Bund und Ländern gegeben wurden, beschäftigt sich Teil III mit der Frage der tatsächlichen Reformierbarkeit des deutschen Föderalismus. Hier geht es darum heraus- zufinden, welche Schwierigkeiten und Hindernisse bei der beabsichtigten Reform auftre- ten können. Dabei wird zu zeigen sein, dass Reformbemühungen, seien sie auch noch so notwendig, immer auch mit institutionellen Strukturen des politischen Systems konfron- iert sind, die sich mehr oder weniger auch als Stolpersteine für eine nachhaltige Föderalis- musreform erweisen können. Von Interesse ist also das, was machbar ist und das, was nicht. Um darauf eine Antwort geben zu können, greife ich auf eine Reihe unterschied- licher Thesen und Ansätze aus der politikwissenschaftlichen Forschung zurück.
Der vierte und letzte Teil der Arbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Analyse zusammen. Es soll deutlich werden, welche Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen gezogen werden können. Der Leser darf eine Antwort darauf erwarten, welche prinzi- piellen Anforderungen an eine Föderalismusreform zu stellen sind und ob das Modell des Wettbewerbsföderalismus letzten Endes eine realistische Chance für eine grundlegende Reform unserer föderalen Republik bietet.
B. Zum Begriff des Wettbewerbsföderalismus
1. Der Versuch einer Operationalisierung
Oben wurde bereits an anderer Stelle gesagt, dass die Reformdiskussion um den deutschen Föderalismus vor allem in den neunziger Jahren anhand der ökonomischen Theorie bzw. des Wettbewerbsföderalismus geführt wird (vgl. Margedant, a.a.O). Und trotzdem scheint sich die Wissenschaft schwer zu tun mit einer eindeutigen Definition dessen, was Wettbewerbsföderalismus überhaupt bedeutet.
Zieht man das erst im Jahre 2004 herausgegebene und damit aktuelle „Wörterbuch zur Politik“ von Manfred G. Schmidt zu Rate, so findet sich darin keine explizite Definition des Begriffs. Es wird lediglich auf die unterschiedlichen Ausprägungsformen von Föderalismus im Allgemeinen hingewiesen.[26] Der Begriff „Wettbewerbsföderalismus“ wird dabei nicht einmal erwähnt. Das sieht in der öffentlichen Debatte, die vor allem von Seiten der Politik und der Wirtschaft geführt wird, anders aus. Dort werden wie selbstver- ständlich Begriffe wie Effizienz und Wettbewerb benutzt und als Argument für eine Reform des deutschen Föderalismus herangezogen. Das dies so ist, hat zu einem großen Teil mit den gewaltigen finanziellen Folgen der Finanzierung der Deutschen Einheit zu tun. Mit ihr sah sich unsere gesamte Finanzordnung vor neue, große Herausforderungen gestellt. Durch gewaltige Finanztransfers in die neuen Bundesländer sollte erreicht werden, dass diese sich zügig in ihrer Wirtschaftskraft den westlichen Gliedstaaten anglei- chen. Das ist bekanntlich nicht gelungen, und darum war es auch nicht verwunderlich, dass insbesondere der Finanzausgleich zwischen den aufkommensstarken und –schwachen Bundesländern erneut zum politischen Streitthema wurde. Beklagt wurde und wird deshalb die angeblich nivellierende Wirkung des gegenwärtigen Finanzausgleichs und die dadurch auftretende Folge, dass die finanzschwachen Bundesländer nicht genügend Anreize bekämen, ihr Steueraufkommen durch eigene Bemühungen zu verbessern. Andererseits würden finanzstarke Bundesländer durch hohe Ausgleichszahlungen bestraft. Folglich taucht der Begriff „Wettbewerbsföderalismus“ auch im Normenkontrollantrag der drei Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen vom Juli 1998 gegen den Länderfinanzausgleich auf. Dabei könnte durchaus der Eindruck entstehen, eine Reform in Richtung auf mehr Wettbewerb beinhalte automatisch Forderungen für eine Reform des geltenden Finanzausgleichssystems. Die Diskussion scheint sich auch selbstredend dahingehend zu entwickeln[27], doch dies war nicht immer so:
Als einer der ersten setzt sich Hartmut Klatt bereits zu Beginn der 80er Jahre mit dem Begriff des „Konkurrenzföderalismus“ als Alternative zum kooperativen Bundesstaat[28] auseinander. Für ihn bedeutet Föderalismus zunächst „eine Balance, ein Gleichgewicht zwischen Elementen der Kooperation und Koordination einerseits, der Konkurrenz und des Wettbewerbs andererseits.“[29] Ausgehend von diesem Grundverständnis konstatiert er für den deutschen kooperativen Bundesstaat, er habe die zulässige Grenze der Zusam- menarbeit zwischen den Exekutiven auf Bundes- und Länderebene überschritten.[30] In der Folge definiert er Konkurrenzföderalismus als einen Mechanismus, bei dem „im Bund-Länder-Verhältnis sowie im Verhältnis der Länder untereinander grundsätzlich bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und der Lösung von Problemen Konkurrenz und Wettbewerb gelten.“[31] Allerdings setze ein solches Konzept keine verfassungsrechtlichen Änderungen voraus, sondern ziele auf eine restriktive Wahrnehmung der Rechte und Instrumente im bestehenden Kooperationssystem.[32] Damit kommt für Klatt nur ein „gradueller Wandel“[33] des deutschen Bundesstaates in Richtung auf mehr Wettbewerb in Betracht. An den Grundfesten der Verfassung soll nicht gerüttelt werden. Änderungen an den Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern werden nur im Rahmen einer Teil- entflechtung bei den Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen des Bundes sowie über einen Abbau der Mischverwaltung erörtert. Von Vorschlägen zu einer Reform des Finanzausgleichs ist keine Rede.[34] Damit decken sich Klatts Äußerungen mit dem Tenor der damaligen Befürworter des Wettbewerbsföderalismus. Die Thematik des Finanzaus- gleichs wird „allenfalls subsidiär, als ‚Nebenschauplatz’, betrachtet. Eine Reduktion bzw. Verengung des Konzepts (...) auf Fragen des Finanzausgleichs wird ausdrücklich abge- lehnt.“
Wettbewerbsföderalismus erfährt also bereits zu Beginn der 80er Jahre eine erste „Themenkarriere“, und zwar „in Verbindung mit der schon seit Mitte der siebziger Jahre verstärkten Auseinandersetzung um Erfahrungen und Entwicklungsperspektiven des durch ‚Politikverflechtung’ gekennzeichneten ‚kooperativen Föderalismus’.“[35]
Carl-Christian von Weizsäcker nähert sich dem Begriff, indem er die Existenz eines Wettbewerbsföderalismus überhaupt erst zur Bedingung für eine lernende Gesellschaft macht. Wettbewerbsföderalismus ist für ihn „die Verfassung bzw. der staatliche Rahmen für eine lernende Gesellschaft.“[36] Von Weizsäcker zielt dabei auf die Überlegenheit der Gesellschaften ab, die dezentral organisiert sind. Nur in einer solchen Organisationsform könnten unterschiedliche Problemlösungen versucht werden. Eine zentral organisierte Gesellschaft hingegen versperre sich der Möglichkeit zusätzlicher Erkenntnis.[37] Als Bei- spiel einer solch neuen Erkenntnis nennt er die Experimente kleiner Staaten wie Holland, Dänemark oder der Schweiz in ihren jeweiligen Arbeitsmarktpolitiken. Die Rechtfertigung des Wettbewerbsföderalismus sieht er in einer besseren Experimentierfähigkeit dezentral organisierter Gesellschaften, die so eine höhere Problemlösungsfähigkeit erreichten: „Daher wird es stets sinnvoll bleiben, unterschiedlichen Teilen der Gesamtgemeinschaft zu ermöglichen, in relativ großer Autonomie unterschiedliche Lösungen zu versuchen.“[38]
Was kann nun zusammenfassend als Definition von Wettbewerbsföderalismus gelten? Eine einheitliche oder gar allgemein gültige scheint es nicht zu geben. Vielmehr erfährt der Begriff in der deutschen Reformdebatte bestimmte „Konjunkturzyklen“, in denen die Schwerpunkte jeweils unterschiedlich gesetzt werden. Ein Schwerpunkt der heutigen Re- formdiskussion bildet die Frage der finanziellen Beziehungen zwischen Bund und Ländern und den Ländern untereinander und insbesondere die Frage des Finanzaus- gleichssystems. Somit scheint der Begriff auch in gewisser Weise abhängig zu sein vom jeweils aktuellen politischen Tagesgeschäft bzw. von dem, was politisch gerade opportun ist. „Schließlich geht es selbst bei diesem Thema, das bei der breiten Öffentlichkeit ver- gleichsweise wenig Emotionen wecken kann, auch um die Herrschaft über den politischen Wortschatz.“[39] Und weiter heißt es: „Angesichts einer abstrakten und schwer zugäng- lichen Materie bieten Begriffe wie Konkurrenz und Wettbewerb (...) die Möglichkeit, ‚kom- plexe’ föderative Strukturprobleme gegenüber Wählern und Steuerzahlern auf solche Unterscheidungen zu reduzieren (...).“[40] Nichts anderes taten die drei Bundesländer, die in ihrem Normenkontrollantrag vor dem Bundesverfassungsgericht den Begriff des Wettbe- werbsföderalismus als „Allheilmittel“ gegen einen scheinbar übernivellierend wirkenden Finanzausgleich benutzten. Insofern ist der Definition Münchs zuzustimmen, die in dem Begriff seit seiner Einführung in die öffentliche Diskussion zu Beginn der 80er Jahre, eine Bündelung aller Entflechtungs- und Reföderalisierungsinitiativen sieht, die als notwendig gelten, um einerseits das bundesdeutsche föderative System insgesamt zu modernisieren und andererseits die negativ bewerteten Elemente des Verbundföderalismus zu über- winden.[41]
2. Die ökonomische Theorie des Föderalismus als ideengeschichtlicher Hintergrund
2.1 Der Rational-Choice-Ansatz
Wissenschaftstheoretisch gesehen bildet die ökonomische Theorie des Föderalismus eine Variante der großen Familie der Theorien rationaler Wahlhandlung (engl.: Rational-Choice-Theorien). Sie entspringen bereits zur Zeit der Aufklärung und haben in Machia- velli und Hobbes ihre ersten Vorläufer, „die als erste der auch heute noch zentralen Frage nachgingen, wie Gesellschaft, politische Ordnung und allgemeine Wohlfahrt erreichbar sein könnten, wenn man sich den Menschen als ein ausschließlich durch eigene Interessen geleitetes Subjekt vorstellen müsse.“[42] Wichtig dabei ist erstens die Annahme, dass der Mensch seine Entscheidungen aufgrund seiner subjektiven Bedürfnisse und Wünsche trifft und zweitens, dass er dies immer unter der gegebenen Bedingung knapper Güter tut und zwischen mehreren, günstigeren oder teureren Alternativen wählen muss. Rational-Choice-Modelle unterstellen, dass es hierbei vor allem auf zwei Tatbestände ankommt:
a.) der Mensch ist in der Lage, für jede seiner Entscheidung (Handlung) die Kosten und Nutzen gegeneinander aufzurechnen und damit zu einem Netto-Nutzen zu gelangen; gleichzeitig könne er die Nutzen verschiedener Handlungen gegeneinan- der abwägen und in eine bevorzugte Reihenfolge bringen.
b.) der Mensch verhält sich jederzeit rational, d.h. er trifft immer die Entscheidung, die ihm den größten Nutzen verspricht.
In dieser Sichtweise erscheint der Mensch durchaus verengt als bloßer „homo oecono- micus“. Vor allem durch die Wirtschaft und die Finanzwissenschaft erfährt diese Theorie unter dem Deckmantel des ökonomischen Föderalismus in den 80er und 90er Jahren eine Weiterentwicklung. „Aus der Übertragung (...) auf die politische Praxis ergab sich die Notwendigkeit, das Modell um weitere Annahmen zu erweitern, weil in diesem Bereich i.d.R. kollektive oder korporative Akteure (Organisationen, Institutionen) als Handlungs- träger tätig sind.“[43]
2.2 Grundlagen eines wettbewerbsorientierten Föderalismus
„Im Modell des (reinen) Föderalismus, ‚Wettbewerbsföderalismus’, in Analogie zur (reinen) Marktwirtschaft und Demokratie, steht das Angebot an kollektiven Gütern im Wettbe- werb. Ein Bürger, dem das angebotene Bündel an kollektiven Gütern in einer Gebiets- körperschaft nicht zusagt, kann als Konsequenz in eine andere, ihm besser zusagende Gebietskörperschaft abwandern (voting by foot).“[44] Dieses auf Charles M. Tiebout zurück- gehende Idealmodell des Wettbewerbsföderalismus ist in der Realität allerdings nicht durchführbar. Nur wenn Voraussetzungen wie eine „atomistische Struktur, unmittelbare Anpassung, keine (geringen) externe(n) Effekte, gerechte Einkommensverteilung gegeben sind“[45], stellen sich diese Effekte ein. Es zeigt sich jedoch, dass diese Bedingungen nur beschränkt gegeben sind.
Überträgt man nun die Idee des Rational-Choice-Modells auf das Gebilde eines föderalen Bundesstaates, so lautet die Kernfrage: Wie müssen die öffentlichen Aufgaben auf die einzelnen staatlichen Ebenen aufgeteilt werden, damit eine optimale Aufgabenerfüllung erreicht wird? Es geht also, ökonomisch gesprochen, um die Effizienz der Aufgabenerfül- lung. „Die Funktionen des Staates werden dabei entsprechend den finanzwissenschaft- lichen Theorien als Allokation von Ressourcen, Verteilung von Einkommen und Stabili- sierung gesamtwirtschaftlicher Prozesse bestimmt.“[46] Für die Aufgabenerfüllung existieren zwei Optionen: die zentrale, bei der ausschließlich der Bund die alleinige Verantwortung trägt, oder die dezentrale, wobei die jeweiligen Bundesländer für eine optimale Aufgaben- erfüllung verantwortlich sind. Die ökonomische Theorie des Föderalismus geht dabei davon aus, dass jede dieser beiden Optionen mit gewissen Vor- und Nachteilen verbun- den sind. Wallace E. Oates hat sich in seinem Werk „Fiscal Federalism“ mit beiden Mög- lichkeiten auseinandergesetzt und stellt mögliche „sozio-ökonomische Entwicklungsten- denzen dar, die sowohl zu einer Zentralisierung als auch zu einer Dezentralisierung führen könnten.“[47] Aus allokativer Sicht sprächen dabei für eine zentrale Aufgabenwahrnehmung die produktionswirtschaftlichen Vorteile i.S. von „economies of scale“. Dies hängt damit zusammen, dass „viele öffentliche Leistungen nur ab bestimmten Größenordnungen angeboten werden können.“[48] Aber auch das Problem der sogenannten „spill overs“, des Auftretens externer Effekte bei einer ausschließlich dezentralen Lösung, wird als Argu- ment für eine Aufgabenwahrnehmung des Bundes angesehen. Dabei geht es darum, dass Kosten und Nutzen der Aufgabenerfüllung möglichst auch bei derselben Einheit anfallen. Ein bereitgestelltes öffentliches Angebot eines Landes A beispielsweise soll also auch gleichermaßen den Bewohnern des Landes A zu Gute kommen. Zudem bestehe aufgrund der gestiegenen räumlichen Mobilität der Bevölkerung und insbesondere der Wirtschaft die Gefahr, dass beim Fehlen eines gewünschten öffentlichen Gutes in die Region abge- wandert wird, die dieses Gut anbietet (vgl. Tiebout). Andererseits führe eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung „zu (komplexeren) Verflechtungen, aus denen Steuerungs- und Rationalitätsdefizite bei den Entscheidungsstrukturen resultieren, die wiederum im Zwei- felsfall ‚teurere’ Lösungen mit sich bringen.
Wichtige Entscheidungsmuster sind in diesem Zusammenhang Zurückhaltung gegenüber Veränderungen, Gleichbehandlung und Besitzstandswahrung verbunden mit der Verta- gung von Konflikten oder deren Verschiebung in andere Regelungsbereiche, in denen ein Kompromiss leichter zu finden ist.“[49] Aufgaben mit regional begrenztem Wirkungskreis sollten also dezentral wahrgenommen werden und nur alle anderen, übrigen Aufgaben dem Zentralstaat vorbehalten bleiben (Subsidiaritätsprinzip, Dezentralisierungstheorem von Oates). Zudem steigen die Kosten einer zentralen Lösung umso mehr an, je größer die Entscheidungseinheit wird. Ihren Ausdruck finden sie in Informations-, Verwaltungs-, Abstimmungs- und Verhandlungskosten. „Darüber hinaus erschwert eine Teilung der Kompetenzen auch die parlamentarische Kontrolle (Stichwort: Exekutivföderalismus).“[50] Die Konsequenz dabei seien eine geringe Innovationsfähigkeit und eine schlechtere Befriedigung individueller Bedürfnisse. Gerade dies wird in der heutigen Reformdebatte besonders betont.
Neben der Allokationsfunktion werden dem Staat in einem marktwirtschaftlichen System noch zwei weitere Funktionen zugewiesen. Zum einen die Distributionsfunktion, bei der der Staat die sich aus dem Marktprozess ergebende Einkommensverteilung korrigiert, soweit sie nicht mit der politisch gewünschten übereinstimmt. „Dabei wird in der Regel eine gewisse Nivellierung sowohl der personellen wie auch der regionalen Einkommens- verteilung angestrebt.“[51] Zum anderen besteht die Aufgabe des öffentlichen Sektors darin, „für Preisniveaustabilität und Vollbeschäftigung sowie für angemessenes Wirtschafts- wachstum zu sorgen“[52] (Konjunktur- bzw. Stabilitätsfunktion).
Dadurch, dass die ökonomische Theorie des Föderalismus die gesamte Gesellschaft als ein Geflecht von Marktbeziehungen ansieht, werden konsequenterweise „auch die inter- organisatorischen Beziehungen zwischen den Entscheidungsinstanzen im föderativen Staat als Tauschbeziehungen analysiert.“[53] Und wo, wenn nicht in den finanziellen Bezie- hungen bzw. den Finanzströmen kommt das Verhältnis zwischen Bund und Ländern besser zum Ausdruck? Die Finanzströme können vor allem anhand des Finanzausgleichs abgelesen werden und „sollen (...) dazu beitragen, Ungleichheiten in der Finanzausstattung zwischen Gebietskörperschaften auszugleichen, durch zweckgebundene Zuweisungen des Zentralstaates an die regionalen und lokalen Einheiten sollen allokations- und konjunktur- politische Ziele erreicht werden.“[54]
Damit kann zum nächsten Teil der Arbeit übergeleitet werden. Zunächst werden dabei die finanziellen Beziehungen zwischen Bund und Ländern im Grundgesetz dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf der Darstellung des Finanzausgleichssystems liegt.
Teil II. Kooperativer Föderalismus und Wettbewerbsföderalismus – Praxis und Ideal
A. Die Praxis: Unitarisch-kooperativer Föderalismus im Grundgesetz
In kaum einem anderem Bereich eines föderalen Bundesstaates lässt sich das Verhältnis zwischen dem Gesamtstaat und seinen Gliedstaaten so deutlich ablesen wie in der Ausgestaltung ihrer finanziellen Beziehungen. Die Finanzverfassung beantwortet „ganz grundsätzlich die Frage, welche Ebene im Bundesstaat für die Finanzierung welcher Staatsaufgaben aufkommen muss. Dann legt die Finanzverfassung fest, ob es der Zentral- staat oder die Gliedstaaten sind, die die Steuergesetze erlassen (...). Bestimmt wird auch die sogenannte Ertragshoheit, also wie sich die gesamten Einnahmen des Staates auf die verschiedenen bundesstaatlichen Ebenen aufteilen. Schließlich kann man der Finanzver- fassung entnehmen, welche Transfers zwischen dem Zentralstaat und den Gliedstaaten bzw. den Gliedstaaten untereinander durchgeführt werden; sie enthält demzufolge Rege- lungen über das Finanzausgleichssystem.“[55] Somit gibt sie Aufschluss darüber, wie der Bundesstaat föderal organisiert ist, d.h. ob er auf konsensualer Konfliktregelung bzw. Kooperation und Gewaltenverschränkung zwischen beiden staatlichen Ebenen beruht oder auf dem Konkurrenzprinzip aufbaut, sprich, die Autonomie von Bund und Ländern in den Vordergrund stellt und auf Gewaltenteilung setzt. Je nach Ausprägung bezeichnet man das kooperative Modell als den sogenannten intrastaatlichen, sein Pendant als den interstaatlichen Föderalismustyp. Der bundesdeutsche Föderalismus ist, schon allein durch die Beteiligung der Länder(regierungen) über den Bundesrat an der Gesetzgebung des Bundes und den damit verbundenen Kooperationszwängen zweifelsohne als koopera- tiv einzustufen.
Nun ist es nicht und kann auch nicht Ziel dieser Arbeit sein, sämtliche Kooperations- mechanismen zwischen Bund und Ländern zu analysieren. Dies würde zum einen den Rahmen der Arbeit sprengen, zum anderen würde es auch am eigentlichen Thema vorbeiführen. Was zunächst zu tun bleibt ist, die Finanzverfassung im Grundgesetz als Ursache und strukturelles Merkmal des unitarisch-kooperativen Bundesstaates zu identifizieren. Es müssen in einem weiteren Schritt die zentralen institutionellen Rege- lungen der Finanzverfassung herausgearbeitet werden, die für die Reformdebatte von besonderer Bedeutung sind und an denen sich die wettbewerbsföderalistischen Reform- geister anstoßen. Ziel ist es deutlich zu machen, warum die Finanzverfassung damals wie heute als föderaler Zankapfel gilt. Dies geschieht in einer dem Umfang der Arbeit gerecht- werdenden Länge. Zuvor soll jedoch ein kurzer historischer Rückblick auf die Hintergrün- de des Entstehens unserer heutigen Finanzverfassung gegeben werden.
1. Die Große Finanzreform von 1969 – die institutionalisierte Kooperation
1.1 Entstehungszusammenhang
Wirft man einen Blick zurück in die Geschichte des Grundgesetzes, so bildet die Realisierung der Großen Finanzreform im Jahre 1969 einen wichtigen und wesentlichen Teil, wenn nicht sogar den wesentlichen Teil auf dem Weg zu einem Mehr an Kooperation und Politikverflechtung zwischen Bund und Ländern. „Durch diese Finanzreform, die den bis dahin gravierendsten Einschnitt in die bundesstaatliche Ordnung darstellte, wurden die bereits üblichen Formen der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern nicht nur intensiviert, sondern auch verfassungsrechtlich klar definiert.“[56]
Als Hintergrund der Reform lassen sich zwei Tatsachenkomplexe anführen: zum einen entwickelten sich seit Mitte der 50er Jahre die Einnahmen auf Seiten des Bundes und der Länder sehr unterschiedlich. Dies hing mit der Ertragshoheit der verschiedenen Steuer- arten zusammen. Dem Bund fiel das Aufkommen an der Umsatzsteuer zu, das relativ stabilen Charakter hatte, während die Länder an der wachstumskräftigen Einkommens- und Körperschaftssteuer zu je 2/3 über ein Verbundsystem beteiligt waren. Parallel dazu hatten sich auch die Ausgabenlasten beider Ebenen unterschiedlich stark erhöht. Die
Steigerung auf Seiten des Bundes betrug im Zeitraum von 1955 bis 1962 140 %, die der Länder 116 %.[57] Dies erlaubte keine gleichmäßige Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Zum anderen weitete der Bund in dieser Phase, vor allem aufgrund der unzureichenden Leistungsfähigkeit der finanzschwachen Länder, seine Finanzkompetenzen aus. In der Praxis schuf er verschiedene Finanzierungsgesetze (z.B. das Landwirtschaftsgesetz oder die Wohnungsbeihilfen) und begann somit – abseits seiner verfassungsrechtlichen Zustän- digkeit – in großem Stile Länderaufgaben zu finanzieren. Ein Grund für dieses Vorgehen fand sich quasi immer. Entweder aufgrund eines Hinweises auf die Wirtschaftseinheit des Bundesgebiets, „kraft Sachzusammenhangs“ oder aufgrund „ungeschriebener Bundeszu- ständigkeiten“. Die Finanzierung solcher Länderaufgaben verband der Bund mit finanziel- len Auflagen. Die Länder mussten seine Zuschüsse mit eigenen Mitteln aufstocken. Der Bund bestimmte also, welche Aufgaben Priorität besaßen und führte mit Hilfe dieser Dotationspolitik die Länder am „Goldenen Zügel“.
Ein solches Vorgehen verlangte geradezu nach Protest. Auf der Konferenz der Minister- präsidenten der Länder im Juni 1963 wurden Forderungen nach einer klaren Abgrenzung von Bundes- und Länderaufgaben sowie gemeinschaftlichen Aufgaben erhoben. Im März des darauffolgenden Jahres wurde eine Sachverständigenkommission für eine Finanzre- form unter dem Vorsitz des ehemaligen hessischen Finanzministers und Vizepräsidenten der Deutschen Bundesbank, Heinrich Troeger, eingesetzt. Die sogenannte „Troeger-Kommission“ sollte ein Gutachten für eine umfassende Finanzreform erstellen, welches dann auch im Februar 1966 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde und eindeutige Züge eines kooperativen Föderalismus aufwies. Wichtig für die Arbeit sind nun die Regelungen bzw. Ergebnisse, auf die sich Bund und Länder im Rahmen der Großen Finanzreform geeinigt haben.
1.2 Ergebnisse der Finanzreform
Mit den neuen Regelungen der Finanzreform von 1969 wurden die kooperativen Struk- turen der Finanzverfassung nicht etwa erst neu geschaffen. „Die Veränderungen (...) waren (...) eher quantitativer als qualitativer Art. Mit der Einführung des Instituts der ‚Gemeinschaftsaufgaben’ und der Errichtung einiger gemeinsamer Bund-Länder-Gremien (Art 91a und b GG) wurde der Handlungsspielraum der Länder weiter eingeengt, mit der Neufassung der Art. 104ff. GG das Mischsystem im Finanzwesen weiter ausgebaut. In beiden Fällen setzten die Verfassungsänderungen eigentlich nur den legalisierenden Schlusspunkt unter Entwicklungen, die sich in den 60er Jahren praeter legem durchgesetzt hatten.“[58] Ein Blick zurück in die Historie zeigt, dass die bundesdeutsche Finanzverfas- sung schon immer auf Kooperation und Verflechtung angelegt war. Dies gilt aber wohlge- merkt nur für die Finanzverfassung des Grundgesetzes. Im Jahre „1871 setzten die Ein- zelstaaten durch, dass das Reich finanziell von ihnen abhängig, gleichsam zu einem Kost- gänger wurde. Unter der Weimarer Verfassung waren die Verhältnisse umgekehrt, was zu einem starken Übergewicht des Reiches führte. Bei der Abfassung des Grundgesetzes bemühte man sich, den finanziellen Einfluss von Bund und Ländern auszubalancieren.“[59] Unter den Verantwortlichen im Parlamentarischen Rat wurde heftig über die künftige Finanzordnung des Bundes gestritten. Vor dem Hintergrund des Drängens der Alliierten kam schließlich ein Kompromiss zustande, der die in der Geschichte des deutschen Föderalismus angelegte Struktur eines „Verbundsystems“ festschrieb: Die Finanzver- waltung wurde zwischen Bund und Ländern aufgeteilt, ein Finanzausgleich unter den Ländern vorgesehen, der Bund hatte das Schwergewicht bei der Finanzgesetzgebung. Dieser Kompromiss war demnach kaum dazu geeignet, die föderative Ordnung des Grundgesetzes zu stärken. Verstärkt wurde der Trend zu mehr Kooperation und Unita- risierung unter anderem durch die oben erwähnten neuen Instrumente der Gemein- schaftsaufgaben und der Finanzhilfen des Bundes. Allerdings bliebe die Schilderung der Ergebnisse der Finanzreform unvollständig, würde man die Einigung über den soge-
nannten „Großen Steuerverbund“ unerwähnt lassen. Dabei handelte es sich um „eine Neuregelung der Steuerverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Die bishe- rige Verbundmasse von Einkommen- und Körperschaftsteuer wurde auf die (bis dahin dem Bund allein zustehende) Umsatzsteuer ausgeweitet.“[60] Die Inhalte der hier erwähnten Regelungen der Finanzverfassung werden im nächsten Unterkapitel neben anderen we- sentlichen Instrumenten und Institutionen ausführlicher behandelt.
2. Zentrale Institutionen der bundesdeutschen Finanzverfassung
Im Folgenden erfolgt ein kurzer Überblick über die wichtigsten Regelungen unserer Finanzordnung. Dabei handelt es sich insbesondere um die Verteilung der Aufgaben zwischen Bund und Ländern, die Zuständigkeit in der Steuergesetzgebung, die Verteilung des Steueraufkommens und die Regelungen im Rahmen des Finanzausgleichssystems.
2.1 Aufgaben- und Ausgabenverteilung (Art 104a GG)
2.1.1 Das Konnexitätsprinzip als Grundsatz
Das Grundgesetz normiert bei der Verteilung der Aufgaben zwischen Bund und Ländern in Art. 104a Abs. 1 GG das sogenannte Konnexitätsprinzip[61]. Dieses Prinzip besagt, dass Bund und Länder gesondert die Ausgaben tragen, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben. Es erstreckt sich auch auf die bei ihren Behörden entstehenden Ver- waltungsaufgaben (Art. 104a Abs. 5 GG) und bedeutet dahingehend zweierlei: zum einen ist es beiden Ebenen verwehrt, Vorhaben zu finanzieren, die jeweils in die Verwaltungszu- ständigkeit der anderen Ebene fallen. Zum anderen darf weder die eine noch die andere staatliche Ebene der anderen die Finanzierung ihrer Aufgaben auferlegen.
2.1.2 Ausnahmen
Vom Konnexitätsprinzip existieren im Grundgesetz zahlreiche Ausnahmen, die den verflechtenden Charakter der Finanzverfassung deutlich machen. Wir wollen uns auf diejenigen beschränken, die in der wettbewerbsföderalistischen Reformdebatte am intensivsten kritisiert werden.
(a) Finanzhilfen des Bundes an die Länder (Art. 104a Abs. 4 GG)
„Dieses Instrument ermöglicht (...) dem Zentralstaat, aus konjunktur-, struktur- und wachstumspolitischen Gründen den Ländern Finanzhilfen zu gewähren und auf diese Weise trotz ihrer in Art. 109 Abs. 1 GG garantierten Haushaltsautonomie Einfluss auf sie zu nehmen.“[62] Damit der Bund von dieser Möglichkeit Gebrauch machen kann, muss eine der in dem Absatz genannten Voraussetzungen vorliegen. Beispiele für Investitionshilfen sind die Förderung von Stadtentwicklung und –sanierung oder das sogenannte Investi- tionsförderungsgesetz aus dem Jahre 1993, das den neuen Bundesländern seit 1995 für die Dauer von zehn Jahren zusätzliche Mittel in Höhe von ungefähr 3,3 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung stellt.
Aus wettbewerbsföderalistischer Sicht sind insbesondere die beiden letzten Zwecke des Art. 104a Abs. 4 GG (zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet, zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums) interessant, zielen sie doch „auf länger- fristige allokative Wirkungen ab und gestatten (...) dem Bund, längerfristige Finanzhilfen zu gewähren.“[63]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: „Bund-Länder Finanzbeziehungen auf der Grundlage der geltenden Finanzverfassungsordnung“,
in: Fachblick Finanz- & Wirtschaftspolitik, Dokumentation des Bundesministeriums der Finanzen,
Oktober 2004, S. 6
(b) Gemeinschaftsaufgaben (Art. 91a und b GG)
Eine weitere wichtige Ausnahme vom Konnexitätsprinzip bilden die Gemeinschafts- aufgaben. Sie sind im Grundgesetz enumerativ aufgezählt und beinhalten das Recht des Bundes, sich in den dafür vorgesehenen Bereichen an den Ausgaben der Länder zu beteiligen. Die maximale Beteiligungshöhe regelt das Grundgesetz in Absatz vier. Das Institut der Gemeinschaftsaufgaben ist in der Reformdiskussion unter anderem deshalb von Bedeutung, da „sie durch die doch recht rigide Rahmenplanung die Autonomie und die Eigenständigkeit der Länder aushöhlen.“[64] Zum anderen stellt sich die generelle Frage, ob der Aufgabenkatalog heute noch zeitgemäß ist, verliert doch beispielsweise die Land- wirtschaft (vgl. Art. 91a Abs. 1 Nr. 3 GG) gesamtwirtschaftlich gesehen zunehmend an Bedeutung, während der Dienstleistungssektor weiter expandiert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: „Bund-Länder Finanzbeziehungen auf der Grundlage der geltenden Finanzverfassungsordnung“,
in: Fachblick Finanz- & Wirtschaftspolitik, Dokumentation des Bundesministerium der Finanzen,
Oktober 2004, S. 6
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: „Bund-Länder Finanzbeziehungen auf der Grundlage der geltenden Finanzverfassungsordnung“,
in: Fachblick Finanz- & Wirtschaftspolitik, Dokumentation des Bundesministerium der Finanzen,
Oktober 2004, S. 6
2.2 Kompetenzen zur Steuergesetzgebung (Art. 105 GG)
Bei der Kompetenz, Steuern gesetzlich festzusetzen, hat der Bund eine überragende Rolle vor den Ländern inne. Dies kommt weniger in Absatz eins des Artikels zum Ausdruck, denn dadurch, dass die Zollgesetzgebungskompetenzen der EU-Mitgliedstaaten durch EU-Marktverordnungsvorschriften und Abschöpfungsregelungen weitgehend ersetzt wurden und der Bund zusätzlich zu den bestehenden Finanzmonopolen keine neuen schaffen darf, ist die normierte ausschließliche Steuergesetzgebung des Bundes politisch eher unbedeutend geworden. Entscheidend ist vielmehr Absatz zwei. Er liefert dem Bund quasi jederzeit eine Möglichkeit, von seinem Gesetzgebungsrecht Gebrauch zu machen. Entweder,
a) das Aufkommen der „übrigen Steuern“ fällt ihm ganz oder teilweise zu oder
b) es liegen die Voraussetzungen der konkurrierenden Gesetzgebung aus Art. 72 Abs. 2 GG vor.
„Eine dieser Voraussetzungen ist in der Regel gegeben. Denn wenn der Bund aus einer Steuer keinen Ertrag erhält (vgl. Art. 106 Abs. 2 Ziffer 1 bis 6 GG) (...) ist stets die in Art. 72 Abs. 2 GG genannte Voraussetzung gegeben, dass die Herstellung gleichwertiger Lebens-verhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erfordert.“[65]
Aus wettbewerbsföderalistischer Perspektive ist nun interessant, dass die Regelung in der Praxis nichts anderes als eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes bedeutet. Der Einfluss der Länder auf die Gesetzgebung über den Bundesrat (Art. 105 Abs. 3 GG) ändert daran nichts. „Den Ländern wurde immer mehr Eigenständigkeit in der Steuerpolitik genommen. Eine markante Situation war der Große Steuerverbund 1969, hinzu kamen 1997 der Verlust der Länder, die Vermögensteuer zu erheben und 1998 die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. In der Reformdiskussion spielt daher die fehlende Autonomie (...), selbständig Steuern zu erheben und damit (...) Einnahmen zu gestalten, eine wichtige Rolle.“[66]
Diese fehlende Autonomie der Länder wird auch nicht durch Art. 105 Abs. 2a GG ausgeglichen, wonach ihnen die Gesetzgebungsbefugnis über die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern zusteht. Diese Regelung erfährt eine Einschränkung dahingehend, dass diese Steuern nicht gegen das sogenannte „Gleichartigkeitsverbot“ verstoßen dürfen. Damit verfolgt das Gesetz zwei Ziele: erstens soll der Steuerschuldner vor Mehrfachbe- lastungen geschützt werden, zweitens sollen sich die Länder nicht aus demselben Steuer- topf bedienen wie der Bund. Für die Konkretisierung des Gleichartigkeitsverbots hat das Bundesverfassungsgericht mehrere Prüfungspunkte entwickelt, so z.B. das Kriterium „gleiche Quelle wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit“.
Für eine unitarische Ausrichtung des Grundgesetzes spricht in diesem Zusammenhang auch die vom obersten Verfassungsgericht erlassene Rechtsprechung. Selbst wenn in einem Bundessteuergesetz nichts zur Ländergesetzgebung steht, „liegt stets eine er- schöpfende Regelung des Bundes vor, sobald er einen Steuergegenstand in Anspruch genommen hat. Die Länder sind selbst dann von der Gesetzgebung ausgeschlossen, wenn der Bund nur einen Teil dieses Steuergegenstandes beansprucht.“[67]
2.3 Die vertikale Verteilung der Steuererträge (Art. 106 GG)
Von entscheidender Bedeutung in einer Finanzverfassung ist die Regelung der Ertrags- hoheit. Sie bestimmt, welche staatliche Ebene welchen Anteil an den Staatseinnahmen erhält. Somit wird hier über den finanziellen Spielraum der jeweiligen Gebietskörperschaft entschieden. Grundsätzlich existieren zwei Möglichkeiten, die Ertragshoheit auszugestal- ten: Ein Trennsystem, wonach Zentralstaat und Gliedstaaten jeweils einen bestimmten Anteil der Einnahmen erhalten und die Erträge bestimmter Steuern entweder allein dem Bund oder den Ländern zustehen (vgl. Systeme der USA und der Schweiz, in denen Zen- tralstaat und Gliedstaaten jeweils getrennt voneinander eine Einkommensteuer festsetzen können). Auf der anderen Seite das Verbundsystem, wonach eine Gebietskörperschaft ein Monopol über gewisse Steuern besitzt und die anderen Zuweisungen erhalten. Die deutsche Finanzverfassung vereint beide Systeme in sich. Doch liegt der Schwerpunkt deutlich beim Verbundsystem. Insbesondere mit den Ergebnissen der Großen Finanzre- form tendiert Deutschland zunehmend zu einem Verbundsystem.
2.3.1 Das Trennsystem (Art. 106 Abs. 1 und 2 GG)
Beide Absätze zählen diejenigen Steuerarten auf, über die der Bund bzw. die Länder jeweils alleine die Ertrags- bzw. Aufkommenshoheit besitzen und über die sie frei verfügen dürfen. Eine Aufzählung jeder einzelnen Steuerarten erübrigt sich hier. Dies kann im Grundgesetz selbst nachgelesen werden. Zu erwähnen ist hier lediglich, dass die Vermögensteuer in Absatz zwei Ziffer 1 seit dem Jahre 1997 weggefallen ist.
2.3.2 Das Verbundsystem (Art. 106 Abs. 3 GG)
Von viel größerer Bedeutung für die Verteilung der Einnahmen zwischen Bund und Ländern ist das System der Gemeinschaftssteuern, auch großer Steuerverbund genannt. Danach stehen das Aufkommen der Einkommen- , Körperschaft- und Umsatzsteuer gemäß Art. 106 Abs. 3 Satz 1 GG Bund und Ländern gemeinsam zu, soweit es nicht den Gemeinden zugewiesen ist. Letzteres gilt für die Einkommensteuer. Nach einer vorheri- gen Zuteilung von 15 % an die Gemeinden wird der Rest (85 %) je zur Hälfte an Bund und Länder verteilt. An der Körperschaftsteuer sind die Gemeinden nicht beteiligt, weshalb Bund und Länder hier jeweils 50 % erhalten. Die Anteile an der Umsatzsteuer werden durch ein zustimmungspflichtiges Bundesgesetz festgelegt und sind gemäß der Revisionsklausel in Art. 106 Abs. 4 GG neu festzusetzen, wenn sich das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben des Bundes und der Länder wesentlich anders entwickelt. Insgesamt machen die Gemeinschaftsteuern ¾ aller Steuereinnahmen aus.
Da sich die Arbeit auf die finanziellen Beziehungen zwischen Bund und Ländern konzentriert, bleiben die Regelungen über die Einnahmeverteilung an die Gemeinden (Abs. 5 bis 9) unberücksichtigt.
Tabelle 1: Anteile von Bund und Ländern am Umsatzsteueraufkommen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: „Bund-Länder Finanzbeziehungen auf der Grundlage der geltenden Finanzverfassungs- ordnung“, in: Fachblick Finanz- & Wirtschaftspolitik, Dokumentation des Bundesministeriums der Finanzen, Oktober 2004, S. 15
2.4 Das System des Finanzausgleichs (Art. 107 GG)
Die Regelungen über den Finanzausgleich sind in der Finanzverfassung der Bundesre- publik Deutschland von herausragender Bedeutung. Dies hängt damit zusammen, dass mit ihnen die primäre Verteilung der Steuereinnahmen durch Art. 106 GG durch Umver- teilung geändert bzw. korrigiert wird. Zunächst interessiert jedoch die Frage, worin die Zielsetzungen eines Finanzausgleichssystems liegen. Existieren – eingedenk der zum Teil heftig geführten kontroversen Debatten um eine Reform Finanzausgleichs – überhaupt so etwas wie gemeinsame Prinzipien bzw. allgemein anerkannte Grundsätze für den richtigen Finanzausgleich? Otto-Erich Geske hat solche Grundsätze in synoptischer und verständ- licher Form aufgestellt[68] und fügt hinzu: „Man kann sogar davon ausgehen, dass eine generelle Zustimmung über die allgemeinen Grundsätze besteht.“[69] Danach lässt sich der bundesdeutsche Finanzausgleich von folgenden Grundsätzen leiten:
a) Herstellung und Sicherung der Selbständigkeit
b) Angleichung der Lebensverhältnisse
c) Leistungsanreize
d) einfach und transparent
e) finanzwirtschaftliche Ordnungsfunktion
Doch so einfach scheint es damit nicht zu sein. Geske weiter: „Dieser generelle Konsens geht aber sehr schnell bei konkreten und quantifizierten Einzelregelungen verloren. Dann wird sichtbar, dass zwischen den einzelnen Postulaten eine Vielzahl von Zielkonflikten besteht (...).“[70] Diese Zielkonflikte spiegeln die öffentliche Diskussion um eine Reform des bundesdeutschen Föderalismus wieder. Anhand detaillierterer Ausführungen zu den oben genannten Grundsätzen sei dies verdeutlicht. zu a)
Das Postulat, dass durch den Finanzausgleich die Autonomie von Bund und Ländern herzustellen und zu sichern sei, wird die Zustimmung aller finden. Wird jedoch das Auto- nomieprinzip besonders herausgehoben, so bedeutet dies eine einseitige Betonung der Interessen der finanzstarken Länder, was der Aufgabe des sogenannten bündischen Prinzips, des Einstehens füreinander, gleichkommt. „Die solidarischen Leistungen, die bei den finanzschwachen Ländern erst Autonomie sichern oder ermöglichen, werden bei den finanzstarken Ländern als eine Einschränkung ihrer finanziellen Autonomie empfun- den.“[71]
[...]
[1] „Föderalismus-Fiasko – Politiker patzen bei der ‚Mutter aller Reformen’“, Quelle: Spiegel-Online, URL: www.spiegel.de/politik/deutschland v. 17.12.2004
[2] „Köhler kritisiert Scheitern der Föderalismus-Reform“, Quelle: Die Welt, URL: www.welt.de v. 20.12. 2004
[3] ebd.
[4] Feldenkirchen/Leffers/Neukirch: „Mutter aller Blockaden“, in: Der SPIEGEL, Nr. 2 v. 10.1.2005
[5] ebd.
[6] Unter Unitarisierung wird eine gesellschaftliche Zielvorstellung eines föderal verfassten politischen Systems verstanden, die auf Integration und Gleichheit der Lebensbedingungen ausgerichtet ist. Schematisch dargestellt anhand eines bipolaren Kontinuums wird somit ein unitarischer Bundesstaat von zentripetalen Kräften geleitet, die eher in Richtung Einheitsstaat tendieren. Dem entspricht auf der anderen Seite des Kontinuums ein Bundesstaat, der Vielfalt und Eigenständigkeit als oberste Ziele betrachtet und zentrifugale Tendenzen aufweist; vgl. Schultze,Rainer-Olaf: „Föderalismus“, in: Nohlen, Dieter (Hrsg.): „Wörterbuch Staat und Politik“, Bonn 1998, S. 156
[7] Kilper/Lhotta: „Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland“, Kursbrief 3229 der Fernuniversität Hagen, Hagen 1992, S. 23
[8] ebd.
[9] ebd.
[10] Späth, Lothar: „Was jetzt getan werden muss – Seitenblicke auf Deutschland“, Stuttgart/Leipzig
2002, S. 9
[11] Scharpf, Fritz W.: „Der deutsche Föderalismus – reformbedürftig und reformierbar?“, Working Paper 04 v. 2. Mai 2004, Quelle: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung URL: www.mpi-fg-koeln.mpg.de
[12] ebd.
[13] Quelle: Perspektive Deutschland, Ergebnis-Kurzbericht 2003/2004, URL: www.perspektive-deutschland.de, S. 19
[14] ebd.
[15] Margedant, Udo: „Reform des deutschen Föderalismus“, in: Zukunftsforum Politik der Konrad- Adenauer-Stiftung, Nr. 50, Sankt Augustin 2002, S. 9
[16] ebd.
[17] “Jeder ist gefordert”, Focus-Interview mit Bundespräsident Horst Köhler v. 13.09.2004, Quelle: Website des Bundespräsidialamtes, URL: www.bundespaesident.de
[18] Margedant, Udo: „Grundzüge der Finanzordnung der Bundesrepublik Deutschland“, in: Projekt Föderalismusreform der Konrad-Adenauer-Stiftung, Arbeitspapier Nr. 37, Sankt Augustin 2001, S. 3
[19] Herzog, Roman: „Strukturmängel der Verfassung?“, Stuttgart/München 2000, S. 115
[20] ebd.
[21] Pilz, Frank: „Das bundesstaatliche Finanzsystem und sein Reformspielraum: Von der Anfassungs-fähigkeit zur Reformunfähigkeit der Politik?“, in: Zeitschrift für Politik, Heft 1/2002, S. 4
[22] BverfG, 2 BvF 2/98 vom 11.11.1999, Absatz-Nr. 274, in: Margedant, Grundzüge der Finanzordnung der BRD, S. 25
[23] Gesetz über verfassungskonkretisierende allgemeine Maßstäbe für die Verteilung des Umsatzsteuerauf- kommens, für den Finanzausgleich unter den Ländern sowie für die Gewährung von Bundesergänzungs- zuweisungen (Maßstäbegesetz – MaßstG), BT-Drucksachen 14/5951, 14/5971 u. 14/6581 vom 5. Juli 2001
[24] Die Bildung des Fonds 1990 war eine Reaktion auf die strukturellen Disparitäten zwischen alten und neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung. Man entschied sich deshalb für eine zeitlich begrenzte Übergangsregelung zugunsten der neuen Länder. Sie erhielten in den Jahren 1991 bis 1994 insgesamt 160,7 Mrd. DM an Fondsmitteln. Der Fonds lief 1995 aus, seitdem sind die neuen Länder vollständig in den gesamtdeutschen Länderfinanzausgleich integriert.
[25] Schultze, Rainer-Olaf: „Indirekte Entflechtung: Eine Strategie für die Föderalismusreform?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Heft 3/2000, S. 681
[26] so unterscheidet Schmidt den zentrifugalen (Eigenständigkeit und Vielfalt betonenden) vom zentripetalen (Integration und Gleichheit betonenden) Föderalismus, den zentralisierten vom dezentralisierten Bundes- staat, den dualen vom kooperativen Föderalismus, den gering verflochtenen Föderalismus vom Bundesstaat der Politikverflechtung und den konföderalen Föderalismus (der die relative Autonomie der Gliedstaaten betont) vom „unitarischen Bundesstaat“ (der auf eine gewisse Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse abzielt).
[27] vgl. auch andere Abhandlungen, z.B. Hickel, Rudolf: „Vom kooperativen zum konkurrierenden Föderalismus? Der Länderfinanzausgleich unter Reformdruck, in: Blätter für deutsche und inter-nationale Politik, Heft 12/2000, S. 1483 ff.; von Arnim, Hans-Herbert: „50 Jahre Föderalismus in Deutschland. Perversion einer Idee“, in: Morath, Konrad (Hrsg.): „Reform des Föderalismus“, Frankfurter Institut – Stiftung Marktwirtschaft und Politik, S. 41
[28] Der Begriff des kooperativen Bundesstaates bzw. des kooperativen Föderalismus kommt in der deutschen Föderalismusdebatte insbesondere in den 70er Jahren, meist in Verbindung mit dem Begriff der „Politikver- flechtung“, auf. Hintergrund spielen dabei die vielfältigen Regelungen der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und auch der Länder untereinander, die durch die 1969 verabschiedete Finanzreform und ihre Instrumente (vgl. an anderer Stelle unten) besonders deutlich werden.
[29] Klatt Hartmut: „Parlamentarisches System und bundesstaatliche Ordnung – Konkurrenzföderalismus
als Alternative zum kooperativen Bundesstaat“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 31/1982, S. 21
[30] ebd., S. 21 ff.
[31] ebd., S. 22
[32] ebd.
[33] ebd., S. 23
[34] ebd., S. 23 ff.
[35] Schatz, Heribert/van Ooyen, Robert Chr./Werthes, Sascha: „Wettbewerbsföderalismus – Aufstieg und Fall eines politischen Streitbegriffes, Baden-Baden 2000, S. 15
[36] von Weizsäcker, Carl-Christian: „Wettbewerbsföderalismus in Europa“, in: Müller-Groeling, Hubertus (Hrsg.): Reform des Föderalismus – kleine Festgabe für Otto Graf Lambsdorff, Liberal Verlag Berlin 2002, S. 62
[37] ebd.
[38] ebd., S. 65
[39] Münch, Ursula: „Konkurrenzföderalismus für die Bundesrepublik: Eine Reformdebatte zwischen Wunschdenken und politischer Machbarkeit“, in: Jahrbuch des Föderalismus 2001, Nomos Verlags-gesellschaft Baden-Baden 2001, S. 120
[40] ebd.
[41] Münch, S. 120
[42] Schatz/van Ooyen/Werthes, S. 43
[43] Schatz/van Ooyen/Werthes, S. 45
[44] Thöni, Erich: „Politökonomische Theorie des Föderalismus – eine kritische Bestandsaufnahme, in: Eichhorn, Peter/Friedrich, Peter (Hrsg.), Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft, Baden-Baden 1986, S. 45
[45] ebd.
[46] Benz, Arthur: „Föderalismus als dynamisches System. Zentralisierung und Dezentralisierung im föderativen Staat“, in: Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Forschung, Bd. 73, Opladen 1985, S. 16
[47] ebd., S. 19
[48] Lenk, Thomas/Schneider, Friedrich: „Zurück zum Trennsystem als Königsweg zu mehr Föderalismus in Zeiten des ‚Aufbau Ost’?, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Band 219/3+4, Stuttgart 1999, S. 413
[49] Lenk/Schneider, S. 413
[50] ebd.
[51] Peffekoven, Rolf: „Finanzausgleich I – Wirtschaftstheoretische Grundlagen“, in: Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft (HdWW), Bd. 2, Stuttgart/Tübingen/Göttingen 1988, S. 615
[52] Peffekoven, Finanzausgleich I, S. 616
[53] Benz, S. 18
[54] ebd.
[55] Laufer, Heinz/Münch, Ursula: „Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland“, Opladen 1998, S. 199
[56] Laufer/Münch, S. 210
[57] Zahlen nach dem Zeitungsartikel „Die Krise ist die Mutter der Reformen“ von Karl M. Hettlage, in: Die ZEIT, v. 3.5.1963, in: Renzsch, Wolfgang: „Finanzverfassung und Finanzausgleich – Die Auseinander- setzungen um ihre politische Gestaltung in der Bundesrepublik Deutschland zwischen Währungsreform und deutscher Vereinigung (1948 bis 1990), Bonn 1991, S. 209
[58] Abromeit, Heidrun: „Der verkappte Einheitsstaat“, Opladen 1992, S. 48
[59] Arndt, Hans-Wolfgang: „Wege zur Stärkung der Finanzkraft von Ländern und Kommunen“, in: Projekt Föderalismusreform der Konrad-Adenauer-Stiftung, Arbeitspapier Nr. 40/2001, Sankt Augustin 2001, S. 7
[60] Laufer/Münch, S. 211
[61] von lat. connex, Verbindung, Zusammenhang; rechtlich i.S. eines Zurückbehaltungsrechts
[62] Laufer/Münch, S. 201
[63] Huber, Bernd: „Die Mischfinanzierungen im deutschen Föderalismus – ökonomische Probleme und Reformmöglichkeiten“, in: Projekt Föderalismusreform der Konrad-Adenauer-Stiftung, Arbeitspapier Nr. 48/2001, Sankt Augustin 2001, S. 15
[64] ebd. S. 13ff.
[65] Laufer/Münch, S. 204
[66] Margedant: „Grundzüge der Finanzordnung der Bundesrepublik Deutschland“, S. 13
[67] Margedant, S. 12
[68] Geske, Otto-Erich: „Der bundesstaatliche Finanzausgleich“, München 2001, S. 29ff.
[69] ebd., S. 29
[70] ebd.
[71] ebd., S. 30
- Arbeit zitieren
- David Wolf (Autor:in), 2005, Wettbewerbsföderalismus als Reformperspektive? Lösungsvorschläge und Chancen einer Reform des deutschen Bundesstaates, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42792
Kostenlos Autor werden







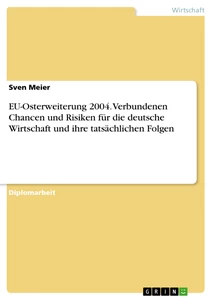


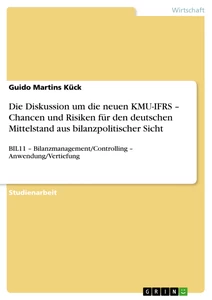




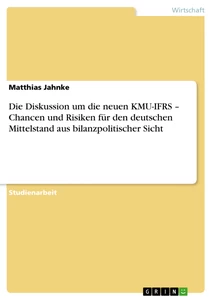


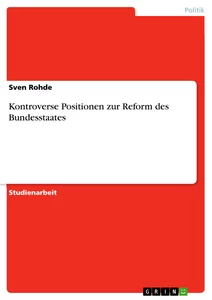



Kommentare