Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis:
Abbildungsverzeichnis:
Abkürzungsverzeichnis:
1 Einleitung
2 Theoretischer Bezugsrahmen – Soziologischer Neo-Institutionalismus
2.1 Entstehung und Argumentation
2.1.1 Institution und Institutionalisierung
2.1.2 Technische und institutionelle Umwelten
2.1.3 Legitimität
2.1.4 Entkopplung
2.1.5 Rationalitätsmythen
2.1.6 Institutioneller Isomorphismus
2.1.6.1 Organisationale Felder
2.1.6.2 Institutioneller Isomorphismus
2.1.6.2.1 Isomorphismus durch Zwang
2.1.6.2.2 Isomorphismus durch Druck
2.1.6.2.3 Isomorphismus durch Nachahmung
2.2 Kritik
3 Qualitätsmanagement
3.1 Definition Qualität
3.2 Qualitätsmanagement und seine Geschichte
3.3 Die DIN EN ISO 9000ff. Normenreihe
3.3.1 Entstehungskontext
3.3.2 Zielsetzung und Inhalt
3.3.3 Aufbau
3.3.4 Zertifizierungsprozess
3.3.5 Verbreitung
3.3.6 Vorteile und Kritik
4 Das Krankenhauswesen als Teil des deutschen Gesundheitswesens
4.1 Das deutsche Gesundheitswesen
4.2 Das deutsche Krankenhauswesen
4.3 Gesetzliche Verpflichtung zum Aufbau eines internen Qualitätsmanagements
5 Theoriegeleitete Analyse
5.1 Die DIN EN ISO 9001 als Rationalitätsmythos
5.2 Verbreitung der DIN EN ISO 9001 im Krankenhaussektor durch institutionellen Isomorphismus
5.2.1 Der Krankenhaussektor als organisationales Feld
5.2.1.1 Institutioneller Isomorphismus durch Zwang
5.2.1.2 Institutioneller Isomorphismus durch Druck
5.2.1.3 Institutioneller Isomorphismus durch Nachahmung
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis:
Tabelle 1: Verbreitung zertifizierter Qualitätsmanagementsysteme an deutschen Krankenhäusern, Stand 2013 (Kuntsche/Börchers 2017, S.290)
Tabelle 2: Wirtschaftsfaktor Gesundheitswesen (vgl. Kuntsche/Börchers 2017, S.12)
Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1: Überleben von Organisationen (in Anlehnung an Meyer/Rowan 1977, S. 353)
Abbildung 2: Darstellung des Prozessmodells des Qualitätsmanagementssystems nach DIN EN ISO 9000ff. (Hensen 2016, S.120)
Abbildung 3: Die 10 führenden Nationen in der Anzahl der Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9000ff. im Jahr 2012 (vgl. Kuntsche/Börchers 2017, S.159)
Abbildung 4: Branchenverteilung anhand der ausgestellten Zertifikate im Jahr 2010 (vgl. Kuntsche/Börchers 2017, S.160)
Abkürzungsverzeichnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
„ Für eine moderne Gesundheitspolitik steht die Frage der Qualität ganz obenan Wir müssen viel stärker das Qualitätsmanagement in Praxis und Klinik verankern“ (Plenarprotokoll 14/49 1999, S.4153).
Mit diesen Worten verteidigte die damalige Gesundheitsministerin Andrea Fischer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) den selbsterklärten Schwerpunkt des „Gesetz(es) zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000“ (GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000), welches am 16.12.1999 vom Bundestag verabschiedet werden sollte, in seiner ersten Lesung. Ziel dieses Schwerpunktes war es, in Zukunft die Qualität der medizinischen Versorgung in Deutschland stärker garantieren und sicherstellen zu können (vgl. Hensen 2016, S. 51). Dazu wurden Änderungen im Sozialgesetzbuch (SGB) V §137 Nr.6 Satz 3 Absatz 1 durch den Gesetzgeber vorgenommen, nach denen alle nach SGB V §108 in Deutschland zugelassenen Krankenhäuser fortan gesetzlich dazu verpflichtet wurden, ein internes Qualitätsmanagement (QM) aufzubauen. Wie QM in Krankenhäusern auszusehen und welche Anforderungen es zu erfüllen habe, wurde in den Folgejahren, insbesondere in den Qualitätsman agement-Richtlinien für Krankenhäuser (KQM-RL ), konkretisiert.
Der Entscheidung des Gesetzgebers waren langjährige Untersuchungen, Initiativen und Demonstrationsprojekte vorangegangen (vgl. Ertl-Wagner et al. 2009, S. 17f.). Denn zunächst schien es keine Selbstverständlichkeit, dass organisatorische Maßnahmen in deutschen Krankenhäusern implementierbar sein, die in ihren Grundzügen auf die Ideen und Erfahrungen des amerikanischen Ingenieurs Frederick W. Taylor in den Midvale Stahlwerken der 1880er Jahre zurückgehen und in der Folge vorrangig in der produzierenden Industrie weiterentwickelt wurden (vgl. Kunsche/Börchers 2017, S. 53-57). Auch vor diesem Hintergrund war und ist eine anhaltende Skepsis gegenüber einem QM in Krankenhäusern immer wieder Anlass für Konflikte (vgl. Costa 2014).
Bei all dieser Aversion von Vertretern des Gesundheitswesens gegenüber dem QM und dessen Ursprüngen ist es verwunderlich, dass am Ende der 2000er Jahre rund 17% aller Krankenhäuser eine Zertifizierung ihres internen Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9000ff. Normenreihe 1 vorwiesen 2 (vgl. Kuntsche/Börchers 2017, S.290). Also nach einer Norm, die von sich zwar behauptet universell einsetzbar zu sein, aber vorrangig für militärische Güter, Kraftwerke, Luft- und Raumfahrt sowie die Elektroindustrie entwickelt und eingesetzt wurde (vgl. Walgenbach 2000, S.3) und sich seit 2002 in direkter Konkurrenz mit dem speziell für Krankenhäuser entwickelten KTQ-Zertifikat ( Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen) befindet (Ertl-Wagner et al. 2009, S.37). Darüber hinaus ist die Zertifizierung und Rezertifizierung nach ISO 9000ff., gleiches gilt für KTQ, mit hohen Kosten verbunden, wobei seitens des Gesetzgebers ausdrücklich kein zertifiziertes QM vorgeschrieben wurde. Gleichzeitig wird die Effektivität eines nach ISO 9000ff. zertifizierten QM, also das Kernargument für die Implementation aus wirtschaftlicher Perspektive, aus organisationssoziologischer Sicht, angezweifelt (vgl. Walgenbach 1998, 2000). Die Frage, die sich angesichts der vielen Kritikpunkte an der ISO 9000ff. Normenreihe zunächst aufdrängt lautet: Wieso ließen Krankenhäuser in den 2000er Jahren ihr internes Qualitätsmanagement nach der ISO 9000ff. Normenreihe zertifizieren und wie kam es zu einer so raschen Verbreitung der Qualitätsnorm im Krankenhaussektor?
Im Rahmen einer wirtschaftswissenschaftlichen Arbeit würde der Fokus zur Beantwortung der Frage verknüpft werden mit einer Bewertung der Effizienz des QM nach ISO 9000ff. im Vergleich zu seinen Alternativen. Die Perspektive, die im Rahmen dieser organisationssoziologischen Arbeit jedoch angenommen werden soll, widmet sich der Effizienz der ISO 9000ff. Normenreihe nur am Rande. Hier soll vielmehr die Wechselwirkung zwischen Organisationen und ihrer Umwelt nach einer kausalen Begründung für die starke Verbreitung von ISO 900ff. Zertifizierungen im Krankenhauswesen untersucht werden. Hierbei soll sich an dem Vorgehen von Peter Walgenbach (1998, 2000) orientiert werden. Dieser hatte bereits in den 90er Jahren mit Hilfe der Theorie des soziologischen Neoinstitutionalismus (NI) die rasche Verbreitung von ISO 9000ff. Zertifikaten in der deutschen Wirtschaft plausibel zu erklären vermocht. Die Theorie des soziologischen NI, die in ihren Grundzügen die auf die Arbeiten von Meyer und Rowan (1977), Zucker (1977) und DiMaggio und Powell (1983) zurückgeht, eignet sich hervorragend dazu die Existenz, Strukturen und Prozesse von Organisationen zu erklären und zwar im Zusammenhang mit deren institutioneller Umwelt (Senge 2011, S.99). In ihr werden formale organisationale Strukturen nicht über das Kriterium der Effizienz, sondern über das Streben nach Legitimität der Organisation gegenüber ihrer institutionellen Umwelt versucht zu erklären.
Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern der Neo-Institutionalismus und dessen Ansätze die rasche Verbreitung der DIN-Qualitätsnorm im Krankenhaussektor in den 2000er Jahren erklären können.
Die Vorgehensweise gestaltet sich wie folgend: Um sich der Forschungsfrage zu nähern werden im Rahmen der Bachelorarbeit Dokumente und Statistiken, Primär- und Sekundärquellen ausgewertet. Im folgenden Kapitel wird zunächst auf den theoretischen Bezugsrahmen, den soziologischen NI, genauer eingegangen. Seine Entstehung und Argumentationslinien werden nachgezeichnet, gefolgt von einer Erörterung der zentralen Begriffe der Theorie. Genauer wird auf den von DiMaggio und Powell (1983) erarbeiteten Institutionellen Isomorphismus eingegangen. Das Kapitel schließt mit einer Kritik an der Theorie und ihren Limitationen. Daran anschließend wird das Qualitätsmanagement thematisiert. Seine Entstehungsgeschichte und zentrale Begrifflichkeiten werden erörtert. Explizit wird hier auf die ISO 9000ff. Normenreihe eingegangen, ihren Entstehungskontext, ihre Ziele, das eigene Qualitätsverständnis, die Gliederung aber auch die Verbreitung als auch die Kritik an der Norm werden beschrieben. Darauffolgend wird auf das deutsche Krankenhauswesen als Teil des Gesundheitswesens eingegangen. Die gesetzlichen Grundlagen, die deutsche Krankenhäuser zum Aufbau eines QM verpflichten, werden erörtert, genauso wie die Machbarkeitsstudien, die der Entscheidung des Gesetzgebers vorausgegangen waren. Anschließend werden die Verbreitungsgrade der verschiedenen QM Systeme im deutschen Krankenhauswesen erörtert. Im Kapitel „theoriegeleitete Analyse“ kommen die „Werkzeuge“ des soziologischen NI letztlich zur Anwendung. Im ersten Schritt der Analyse gilt es zu untersuchen, ob die ISO 9000ff. Normenreihe den Rang eines „Rationalitätsmythos“ einnimmt, der von der gesellschaftlichen Umwelt institutionalisiert wurde, und durch Krankenhäuser in die Formalstruktur adaptiert wurde, um sich die Legitimität gegenüber der Umwelt zu sichern.
Im zweiten Schritt wird untersucht, inwiefern sich die Verbreitung der Qualitätsnorm im Krankenhaussektor durch die Überlegungen von DiMaggio und Powell (1983) zum institutionellen Isomorphismus erklären lässt.
Abgeschlossen wird die vorliegende Arbeit mit einem Fazit.
2 Theoretischer Bezugsrahmen – Soziologischer Neo-Institutionalismus
In ihren Grundzügen geht die Theorie des NI auf die Arbeiten von Meyer und Rowan (1977), Zucker (1977) und DiMaggio und Powell (1983) zurück. Sie hat seit den 90er Jahren eine enorme Popularität und Anwendung erfahren und wird vorrangig dazu genutzt, die Existenz, Strukturen und Prozesse von Organisationen zu erklären und zwar im Zusammenhang mit deren institutioneller Umwelt (Senge 2011, S.99).
Die Theorien des NI können zweifelsohne als eine Kritik an den dominanten Perspektiven der US-amerikanischen Organisationswissenschaft der 1960er verstanden werden (vgl. ebd., S.17). Dominant waren zu jener Zeit ökonomisch geprägte Theorien wie die Kontingenztheorie, der Ressourcen-Dependenz-Ansatz, der Populationsökonomische Ansatz und die Transaktionskostentheorie. Als ökonomisch geprägt gelten sie, weil in ihnen vorrangig „gewinnbringende Organisationen untersucht werden und zwar hauptsächlich mit Bezug auf Entwicklungen des Marktes, hinsichtlich der Veränderungen der Wettbewerbsdichte oder in Abhängigkeit von Ressourcenverteilungen“ (ebd., S.15). Die organisationale Umwelt, mit der die Organisationen in einem Austauschprozess stehen, wird in ihnen auf den Markt bzw. die Ökonomie reduziert. Um auf dem Markt zu bestehen, so die Grundannahme der ökonomisch geprägten Theorien, sei organisationales Handeln dabei den Prinzipien der Zweckrationalität und Effizienzmaximierung unterworfen. Die Ausprägung der formalen organisationalen Strukturen ist in den ökonomisch geprägten Theorien folglich das Resultat einer zweckrationalen Anpassung an den Markt.
Kritisiert werden von Vertretern des NI insbesondere zwei Dinge. Zum einen, dass wesentliche Aspekte der organisationalen Umwelt, wie die institutionellen politischen und wertbezogenen, ausgeblendet werden und zum anderen, dass rationales Handeln einzig im Sinne der Rational-Choice Theorie, also auf Effizienzmaximierung ausgelegt, verstanden werde (vgl. ebd., S.17).
In makroinstitutionalistischen NI Theorievarianten, die hier zum Einsatz kommen und auf die in der Folge genauer eingegangen wird, wird die ökonomische Umweltdimension, auch technische Umwelt genannt, nicht verworfen. Jedoch wird argumentiert, dass die Bedeutung der technischen Umwelt „im Zeitverlauf an Bedeutung verloren hat und im Hinblick auf zu beobachtende Ausgestaltungen der formalen Organisationsstruktur in zunehmendem Maße an Erklärungskraft verliert“ (Kieser/Walgenbach 2010, S.43). Vielmehr sei es die von den ökonomischen Theorien vernachlässigte kulturelle oder institutionelle organisationale Umwelt, an der sich Organisationen bezüglich der Ausgestaltung ihrer formalen Strukturen orientieren. Die institutionelle Umwelt ist dabei keineswegs homogen. In ihr existieren eine „Vielzahl von Bereichen, in denen jeweils spezifische Vorstellungen von »Rationalität« bzw. »richtiger« Organisationsgestaltung bestehen“ (ebd.). Was letztlich rational ist, hängt somit von dem jeweiligen Bereich der institutionellen Umwelt ab. Was in einem Bereich der institutionellen Umwelt als rational gilt kann folglich im Widerspruch zu den Vorstellungen eines anderen Bereichs stehen (vgl. Meyer/Rowan 1977).
In mikroinstitutionalistischen Theorievarianten des NI werden Organisationen selbst als Institutionen betrachtet. Durch die Generierung von institutionalisierten Strukturen, so die Vorstellung, beeinflussen sie ihre Umwelt. Auf besagte Theorievariante wird im Folgenden nicht genauer eingegangen werden.
2.1 Entstehung und Argumentation
2.1.1 Institution und Institutionalisierung
Beim Institutionenbegriff handelt es sich um einen von Durkheim eingeführten Schlüsselbegriff der Soziologie. Soziologie selbst definierte Durkheim (2014) in seinem Werk „Die Regeln der soziologischen Methode“ als die Wissenschaft von den Institutionen“, wobei er Institutionen als „Glaubensvorstellungen und durch die Gesellschaft festgesetzte… Verhaltensweisen“ (Senge 2011, S.82) definiert. An Durkheim anknüpfend liefert Luhmann eine für den NI besonders fruchtbare Definition des Institutionenbegriffs. Dieser sieht Institutionen als eine besondere Art sozialer Regeln für soziale Handlungen, wobei diese Regeln von Dauer, verbindlich und maßgeblich sein müssen (vgl. Luhmann 1996, S.111ff.). Dabei sind diese drei Dimensionen, zeitlicher, sozialer und sachlicher Art, die eine soziale Regel, welche den Rang einer Institution innehat, teilweise nur unscharf bestimmbar. Nach welcher Dauer, also zeitlicher Dimension, werden soziale Regeln beispielsweise zu einer Institution? Folgt man den Überlegungen von Berger und Luckmann (1997, S.62ff.) werden Regeln in dem Moment zur Institution, in dem sie von einer Generation zur Nächsten weitergegeben werden. Weniger präzise, aber vielleicht auch deshalb zutreffender für eine sich rapide wandelnde Gesellschaft, konstatiert Summer (vgl. 1959), dass Institutionen nach einer nicht planbaren Zeit entstehen und auch wieder auflösen können. Wann also die Dauer einer sozialen Regel lang genug ist, um diese in den Rang einer Institution zu erheben, ist nicht klar zu beantworten.
Eine Regel hat dann, entlang ihrer sozialen Dimension, den Rang einer Institution, wenn sie für einen oder mehrere Akteure verbindlich ist. Dabei ist es unbedeutend, ob sie durch die Akteure rational erschlossen oder wertgeschätzt wird. Dadurch das sie verbindlich ist übt sie Zwang aus und hat in einer gewissen Weise „Macht“ über die durch sie beeinflussten Akteure. Jedoch können Institutionen auch immer wieder „deinstitutionalisiert“ werden (vgl. Senge 2011, S. 95).
Maßgeblichkeit, also die sachliche Dimension einer Institution, zeichnet sich dadurch aus, dass das „Vorhandensein einer Regel mit dem Verhalten eines Akteurs korreliert“ (ebd., S.96). Sollte keine Verhaltensänderung aufgrund des Vorhandenseins einer Regel bei einem Akteur auftreten, bedeutet dies jedoch nicht, dass eine Regel nicht den Rang einer Institution innehat. Sie kann einen latenten Einfluss auf den Akteur haben, auch wenn er diese nicht wahrnimmt und erkennt. Hierzu gehören internalisierte Wertemuster und Alltagsregeln, die den Akteuren nicht bewusst, jedoch wirksam auf deren soziales Handeln wirken (vgl. ebd., S.96). Es sind diese latenten Institutionen, die im Fokus des NI stehen (vgl. Scott 2001, S. 57).
Damit eine Regel jedoch zu einer Institution wird, bedarf es der sogenannten Institutionalisierung. Die Institutionalisierung besteht aus Prozessen, „durch die heute bestehende gesellschaftliche Zwänge, Verpflichtungen und Gegebenheiten den Status von grundlegenden Regeln im Handeln und Denken in einer Gesellschaft eingenommen haben“ (Walgenbach 2001, S. 323). Der Prozess der Institutionalisierung selbst besteht dabei aus vier Phasen, Habitualisierung, Typisierung, Objektivierung und Sedimentierung. Habitualisierung bedeutet die routinemäßige Verinnerlichung bestimmter Handlungen, was zu einer Gewöhnung und in der Folge zu einer Reduktion von zu treffenden Entscheidungen führt. Unter Typisierung versteht man die „Kategorisierungen von Personen und Handlungen nach gesellschaftlich determinierten Mustern“ (Sandhu 2012, S.24). Zur Institutionalisierung kommt es, „sobald habitualisierte Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok typisiert werden“ (Berger/Luckmann 1997, S.58). Durch Habitualisierung und Typisierung werden Institutionen zu etwas, „das(s) seine eigene Wirklichkeit hat, eine Wirklichkeit, die dem Menschen als äußeres, zwingendes Faktum gegenübersteht“ (ebd., S.62). Auf diese Weise entsteht mit der Zeit eine scheinbar objektive Wirklichkeit, die jedoch durch menschliches Handeln selbst entstanden ist und sich durch Sedimentierung in der Gesellschaft ablagert (vgl. Sandhu 2012, S.24).
2.1.2 Technische und institutionelle Umwelten
In der Vorstellung der Institutionalisten muss die organisationale Umwelt in zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Umwelten, die jeweils auf ihre eigene Art und Weise auf Organisationen wirken, unterschieden werden (vgl. Walgenbach 2000, S. 26; Meyer/Rowan 1977, S. 353f.). Zum einen gehen sie von technischen Umwelten aus, in denen Waren und Dienstleistungen getauscht werden und „Organisationen aufgrund der effektiven und effizienten Koordination und Steuerung der Arbeitsprozesse entlohnt werden“ (Walgenbach 2000, S. 26). Zum anderen sehen sie auch institutionelle Umwelten, „in denen Organisationen Konformität mit institutionalisierten Regeln zeigen müssen um aus ihren Umwelten Unterstützung zu erhalten und Legitimität zugesprochen zu bekommen“ (ebd.).
Um zu überleben, müssen Organisationen sich den Anforderungen und Ansprüchen der verschiedenen Umwelten unterwerfen. Will eine Organisation den Ansprüchen ihrer technischen Umwelt gerecht werden, so ist sie dazu angehalten ihre Strukturen in Bezug auf die effiziente Koordination und Steuerung der Arbeitsaktivitäten, wie beispielsweise die Produktion, zu modellieren. Denn nur wenn es ihr gelingt ihre Strukturen möglichst effizient zu gestalten, ist es ihr möglich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu erhalten und somit das Überleben der Organisation selbst zu garantieren. Vorgaben der technischen Umwelt sind in einem hohen Maße konsistent, weshalb Organisationen sich bei der Gestaltung ihrer formalen Strukturen und auch der Ausgestaltung ihrer Aktivitäten an diesen orientieren können (vgl. ebd., S. 48). Die „rationale“ Gestaltung einer Organisation ist in diesem Sinne darauf ausgelegt, Mittel und Zwecke in Einklang zu bringen um ein möglichst hohes Maß an effizienten und vorhersehbaren Ergebnissen zu generieren. Eine Steuerung der Organisation findet in diesem Kontext vorrangig über Ergebniskontrolle statt (vgl. ebd., S. 26f.).
Um den Ansprüchen ihrer institutionellen Umwelten gerecht zu werden muss eine Organisation formale Strukturen adaptieren, die in besagten Umwelten der Vorstellung von Rationalität entsprechen. Nur so ist eine Organisation vor Kritik und Fragen ihrer institutionellen Umwelt geschützt und wird von ihr als legitim angesehen, was ihr in der Folge den Zugang zu Ressourcen ermöglicht. Der Zugang zu besagten Ressourcen ist dabei essentiell für das Überleben einer Organisation. Da die Vorgaben der institutionellen Umwelt jedoch stark inkonsistent sind, können formale Strukturen und Aktivitäten nicht klar in Übereinstimmung gebracht werden. Ob die als rational geltenden formalen Strukturen, welche durch die institutionellen Umwelten eingefordert werden, objektiv rational und effizient sind, ist dabei zweitrangig. Eine Steuerung der Organisation findet in diesem Kontext über Prozesskontrolle oder Kontrolle, ob durch institutionelle Umwelten vorgegeben Strukturen übernommen wurden statt (vgl. ebd., S. 27).
Organisationen sind immer beiden Arten von Umwelten ausgesetzt. Dass es dabei unterschiedliche Grade gibt, in denen sich eine Organisation an der einen oder anderen Umwelt orientieren muss, hängt von der jeweiligen Natur der Organisation ab. Eine Organisation, die dem produzierenden Gewerbe zugerechnet werden kann und in einem direkten Konkurrenzkampf mit anderen Organisationen steht, muss sich zwangsläufig stärker den Anforderungen ihrer technischen Umwelt unterwerfen, um sich auf dem Markt zu bewähren und in der Folge ihr Überleben zu gewährleisten. Dahingegen sind Organisationen wie Schulen, die sich nicht in einem direkten Konkurrenzkampf befinden, fast ausschließlich nur davon abhängig sich den Vorgaben ihrer institutionellen Umwelt zu unterwerfen. Banken oder Krankenhäuser hingegen befinden sich in einer Ausganglage, die von ihnen erwartet sich sowohl in einem hohen Maß an den Vorgaben ihrer institutionellen Umwelten als auch ihrer technischen Umwelten zu orientieren (vgl. ebd., S. 30f.).
2.1.3 Legitimität
Um zu überleben ist eine Organisation zum einen darauf angewiesen sich sowohl an den Vorgaben ihrer technischen als auch institutionellen Umwelten zu orientieren. Eine Orientierung an den technischen Umwelten bedeutet, dass eine Organisation darauf angewiesen ist das Marktgeschehen und den Konkurrenzkampf zu anderen Organisationen in ihre Entscheidungen einzubeziehen. Das Streben nach organisationaler Effizienz ist unter dem Gesichtspunkt der Orientierung an der technischen Umwelt ausschlaggebend (vgl. Meyer/Rowan 1977, S. 353).
Mit der Orientierung an den Vorgaben ihrer institutionellen Umwelten erlangt eine Organisation Zugang zu deren Ressourcen. In welchem Grad ihr Zugang zu diesen gewährt wird hängt davon ab, wie stark sie sich gegenüber eben dieser zu legitimieren vermag, so die Vorstellung von Meyer und Rowan (1977, S. 353).
Legitimität erhält eine Organisation jedoch nur dann, wenn sie ihre Strukturen und Verhaltensweisen den Vorstellungen ihrer organisationalen Umwelt in Bezug auf das was als rational, effizient und effektiv gilt anpasst, ungeachtet dem Ergebnis (vgl. ebd., S. 341; Scott 2001). Je höher dabei die Legitimität, desto höher die Überlebensfähigkeit einer Organisation (vgl. Walgenbach 2000, S. 36). Es sind also nicht primär und einzig die Anforderungen der technischen Umwelt, nach der sich eine Organisation ihre formalen Strukturen modellieren und handeln muss, sondern auch und vor allem die Vorgaben der institutionellen Umwelt, so die Vorstellung im NI.
2.1.4 Entkopplung
Wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits angeklungen, können die Vorgaben der institutionellen und technischen Umwelten, denen sich eine Organisation ausgesetzt sieht, in einem hohen Maße inkonsistent und auch widersprüchlich sein. Vorgaben und Anforderungen aus dem Bereich der institutionellen Umwelt, wie beispielsweise zum Thema Arbeitsschutz, können so in einem krassen Widerspruch zu denen der technischen Umwelten stehen, die eine möglichst hohe Effizienz verlangen. Dabei kann eine Organisation keine der beiden Umweltarten vollständig ignorieren, ist sie doch auf ein Bestehen in beiden Umweltarten angewiesen, um das organisationale Überleben zu garantieren. Um diesen Widerspruch auflösen zu können, steht Organisationen nach Meyer und Rowan (vgl. 1977, S. 356f.) die Strategie der Entkopplung, bzw. des „decouplings“ offen. Beim Entkoppeln werden die formalen Strukturen nach den Vorgaben und Anforderungen der institutionellen Umwelt modelliert, wobei deren Inspektionen, Beurteilungen und Kontrollen stark zurückgefahren werden. Denn die tatsächlichen Aktivitäten der Organisation werden auf informale Wege, entkoppelt von den formalen Organisationsstrukturen und nach Maßgabe der technischen Umweltvorgaben, durchgeführt (vgl. Meyer/Rowan 1977, S. 357). Im Zuge des Entkoppelns werden (1.) formale Regeln entweder direkt unterlaufen, (2.) formale Regeln so informationsarm ausgestaltet, dass sie auf die Aktivitäten der Organisation keine Auswirkungen haben oder (3.) so gestaltet, dass sie den technischen Kern von Aktivitäten nicht berühren. Formale Strukturen haben auf diese Weise nurmehr den Charakter eines Lippenbekenntnisses und werden mit passendem Vokabular betitelt um eine Konformität der Organisation mit den Vorgaben der institutionellen Umwelt zu suggerieren (vgl. Walgenbach 2000, S. 50f.). Die Vorteile für eine Organisation sind offensichtlich. Die Illusion, dass die formalen Strukturen tatsächlich den Vorgaben der institutionellen Umwelt entsprechend auf die Organisation und ihre Aktivitäten wirken, wird auf diese Weise aufrechtgehalten. Da die organisationalen Aktivitäten darüber hinaus eben nicht an die starren formalen Strukturen gebunden werden, ist es für Organisationen so möglich, Widersprüche zwischen Formalstruktur und Aktivitäten der Organisation, basierend auf den unterschiedlichen Anforderungen der Umwelten, zu vermeiden. Die Integration von widersprüchlichen Anforderungen der Umwelten in die Formalstruktur würde darüber hinaus den Anspruch einer Formalstruktur auf Widerspruchsfreiheit und Konsistenz nicht gerecht werden können.
Das „Schauspiel“ welches über formale Strukturen gegenüber institutionellen Anforderungen aufgeführt wird mag auf dem ersten Blick anrüchig erscheinen. In den Augen von Meyer und Rowan (1977) wird es Organisationen so erst häufig möglich ihre eigentliche zweckrationale Aufgabenerfüllung durchzuführen (vgl. Meier/Schimank 2012, S.123).
2.1.5 Rationalitätsmythen
Die Vorgaben der institutionellen Umwelt, nach denen Organisationen ihre formalen Strukturen modellieren müssen, um gegenüber dieser ein möglichst hohes Maß an Legitimität zu erreichen nehmen nach Meyer und Rowan (vgl. 1977, S. 340f.) den Rang von „Mythen“ ein. „Der „Mythos“-Begriff bezeichnet dabei zunächst unhinterfragte Annahmen darüber, welche Merkmale eine moderne und erfolgreiche Organisation kennzeichnen, welche Ziele sie vernünftigerweise verfolgt und welche Mittel geeignet sind, um diese Ziele zu erreichen“ (Meier/Schimank 2012, S. 120). Der Begriff Mythos bedeutet jedoch nicht, dass diese Annahmen sachlich unrichtig oder falsch sind, er unterstreicht lediglich, dass besagte Annahmen ohne Prüfung als wahr interpretiert werden. Da diese Mythen über die Vorgabe von legitimen Mitteln und Zielen letztlich vorgeben, was als eine rationale Organisation zu gelten habe, wird der Begriff „Mythos“ in diesem Sinne auch als „Rationalitätsmythos“ verwandt (vgl. ebd., S. 120f.). Aufgrund der zunehmenden Differenzierung der Gesellschaft entstehen in ihren verschiedenen Bereichen eine Vielzahl von Rationalitätsmythen, die Elemente und Verfahren vorgeben, die als „rationale“ Mittel zur Erreichung eines erwünschten Zweckes gelten. Was als rational gilt kann folglich nicht mehr pauschal, sondern muss differenziert und im Kontext der jeweiligen Umwelt betrachtet werden. Beispiele für solche Rationalitätsmythen sind Balanced Scorecard, Controlling und Assesment Center, die ungeachtet ihrer tatsächlichen Effekte als Kriterium für eine Organisation gelten, um als modern und effizient wahrgenommen zu werden (vgl. ebd., S. 121). Neben diesen, in erster Linie auf Technologie und das Kerngeschäft einer Organisation ausgerichteten Rationalitätsmythen, existieren weitere Rationalitätsmythen, in denen sich gesellschaftliche Gerechtigkeitsnormen oder Werte widerspiegeln. Hierzu zählen Fair Trade oder Umwelt- und Verbraucherschutz (ebd.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Überleben von Organisationen (in Anlehnung an Meyer/Rowan 1977, S. 353).
2.1.6 Institutioneller Isomorphismus
Für Institutionalisten findet Institutionalisierung in erster Linie auf Ebene der organisationalen Felder statt und ist damit ein interorganisationaler Prozess (vgl. Walgenbach 2000, S. 37).
In ihrem Aufsatz „The Iron Cage Revisited: Institional Isomorphism And Collective Rationality in Organizational Fields“ gehen DiMaggio und Powell (1983) der Frage nach, weshalb sich Organisationen innerhalb des gleichen organisationalen Feldes bezüglich ihrer formalen Strukturen so ähneln. Ursächlich sehen sie hier einen strukturellen Anpassungsprozess an die Erwartungen der Umwelt, den sie, angelehnt an Hawley (1969), als „Isomorphie“ bezeichnen (vgl. Kühl 2002, S. 158).
DiMaggio und Powell (1983, S. 149) unterscheiden, angelehnt an Meyer (1979) und Fennell (1980), zwei Arten von Isomorphismus: Kompetitiven und Institutionellen Isomorphismus. Kompetitiver Isomorphismus eignet sich dazu Angleichungsprozesse der formalen Strukturen von Organisationen in perfekten Wettbewerbssituationen zu erklären. Da dieser jedoch nur für Organisationen in komplett freien und offenen Märkten, die losgelöst von ihrer institutionellen Umwelt agieren, hinreichende Erklärungen liefert, halten DiMaggio und Powell den institutionellen Isomorphismus für aufschlussreicher.
Institutioneller Isomorphismus erklärt Angleichungsprozesse von organisationalen Formalstrukturen innerhalb organisationaler Felder aufgrund der sich dort etablierten Institutionen. Er setzt folglich zunächst die Institutionalisierung oder Strukturierung eines organisationalen Feldes voraus (vgl. Kapitel 2.1.6.1). Durch die Entstehung von Institutionen werden dann die Handlungsspielräume von Organisationen eingeengt, was in der Folge zu einer Angleichung der formalen Strukturen und Entscheidungen führt. Dieser Prozess wird von DiMaggio und Powell (1983) als institutioneller Isomorphismus bezeichnet. Diesen unterscheiden sie in drei Typen von institutionellen Isomorphismen. Eine Unterscheidung ist jedoch vielmehr analytischer Natur, da sie sich in ihrer Wirkung stark ähneln können und empirisch letztlich kaum voneinander zu unterscheiden sind (vgl. DiMaggio/Powell 1983, S. 150). Diese drei Isomorphismen sind: Isomorphismus durch Zwang, Isomorphismus durch Druck und Isomorphismus durch Nachahmung genannt (vgl. Kapitel 2.1.6.1 ff.).
2.1.6.1 Organisationale Felder
Nach DiMaggio und Powell bezeichnet der Begriff organisationales Feld eine Analyseeinheit. Als organisationale Felder ist die Gesamtheit aller relevanten Akteure gemeint, „die in ihrer Aggregation einen deutlich erkennbaren Bereich institutionellen Lebens darstellen“ (Walgenbach 2000, S. 37). Dies können Organisationen jeder Art sein, wie beispielsweise Behörden aber auch Produzenten oder Konsumenten, die die gleichen Produkte oder Dienstleistungen anbieten oder konsumieren (vgl. DiMaggio/Powell 1983, S. 148). Ferner zählen auch Ressourcengeber, Interessengruppen und auch Gewerkschaften dazu (vgl. Senge 2011, S. 102). Der Blick der Institutionalisten richtet sich dabei nicht auf einzelne Organisationen des Feldes, sondern vielmehr auf die Strukturen in denen diese operieren. Organisationale Felder existieren nur dann, wenn sie institutionell bestimmt oder strukturiert sind (vgl. DiMaggio/Powell 1983, S. 148). Dabei sind organisationale Felder keine Konstanten. Sie können sich genau so spontan auflösen, wie sie entstanden sind, bestehen aber möglicherweise auch über längere Zeiträume (vgl. Sandhu 2012, S. 106). Der Prozess der Institutionalisierung oder Strukturierung eines organisationalen Feldes besteht aus vier Teilprozessen: (1.) Es kommt zu einer Verstärkung der Interaktion zwischen den Organisationen eines Feldes, (2.) es entstehen klar definierten interorganisationalen Beherrschungsstrukturen und Kooperationsmustern, (3.) es kommt zu einer Zunahme der Informationsmenge die Organisationen in einem Feld bewältigen müssen, (4.) eine gegenseitige Wahrnehmung der Mitglieder von Organisationen, welche in einem gemeinsamen Feld agieren, entwickelt sich.
Eine Entstehung eines organisationalen Feldes durch dessen Institutionalisierung oder Strukturierung ist Voraussetzung für das Einsetzen des Prozesses der Homogenisierung, auch Isomorphismus genannt.
[...]
1 Im folgenden Verlauf der Arbeit wird der Begriff „DIN EN ISO 9000ff. Normenreihe“ synonym mit dem Begriff „DIN EN ISO 9001“ verwandt. Zwar ist der Begriff „DIN EN ISO 9001“ weitläufiger bekannt, er reduziert jedoch die Vielzahl von interdependenten Normen auf eine einzelne Norm (vgl. Kapitel 3.3).
2 Weitere 26% aller Krankenhäuser wiesen eine Zertifizierung nach KTQ auf. Die restlichen 57% aller Krankenhäuser verfügten über kein zertifiziertes QM (vgl. Kuntsche/Börchers 2017, S.290).
- Arbeit zitieren
- Anonym, 2018, Die Verbreitung von DIN EN ISO 9001-Zertifikaten im deutschen Krankenhaussektor in den 2000er-Jahren aus Sicht des soziologischen Neoinstitutionalismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/427519
Kostenlos Autor werden


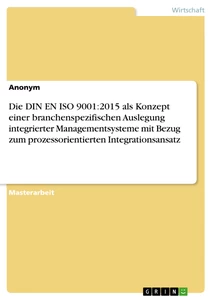

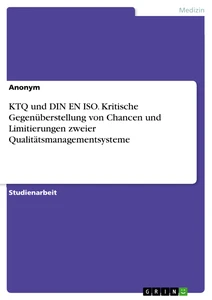












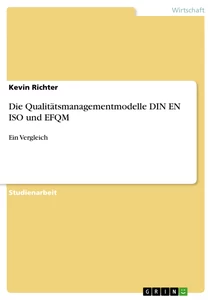

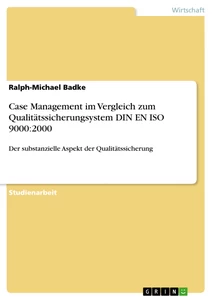
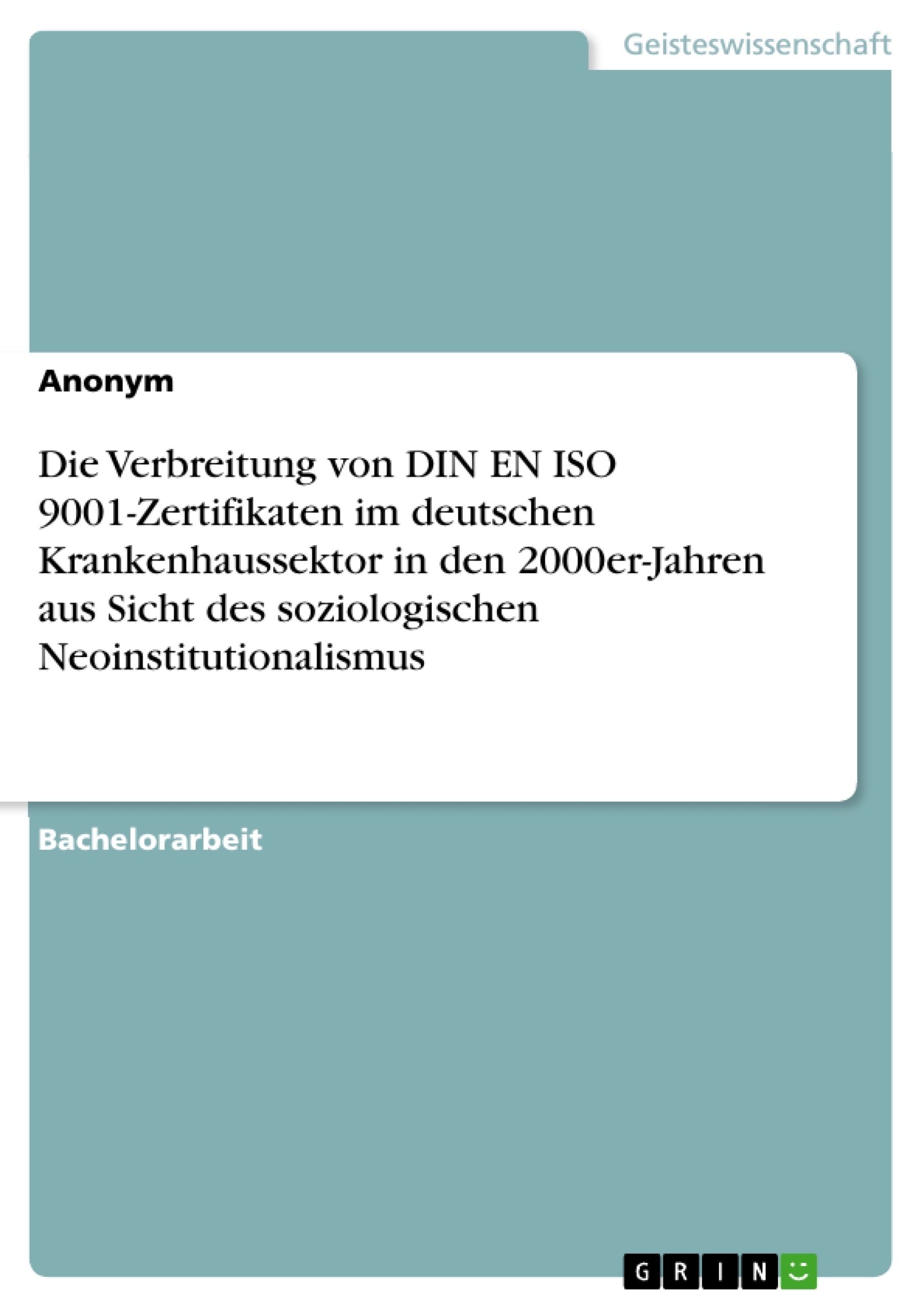

Kommentare