Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Zusammenfassung
1 Einleitung
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Stigmatisierungserfahrungen und Offenbarung der eigenen Behinderung
2.2 Stigmatisierungserfahrungen und Depression
2.3 Stigmatisierungserfahrungen und Intergruppenangst
2.4 Stigmatisierungserfahrungen und der Wunsch nach Inklusion
2.5 Stigmatisierungserfahrungen und Zurückweisungssensitivität
2.6 Stigmatisierungserfahrungen und Selbstwertgefühl
2.7 Stigmatisierungserfahrungen und soziodemografische Daten
2.7.1 Grad der Behinderung
2.7.2 Wohnort
2.7.3 Geschlecht
3 Methode
3.1 Stichprobe
3.2 Instrumente
3.2.1 Inventar Subjektiver Stigmatisierungserfahrungen (ISE)
3.2.2 Items zur Offenbarung der eigenen Behinderung
3.2.3 Patient Health Questionnaire 9 (PHQ9)
3.2.4 Inter group Anxiety Scale
3.2.5 Desire For Inclusion Scale
3.2.6 Rejection Sensitivity Questionnaire (RSQ)
3.2.7 Self-Esteem-Skala
4 Auswertung
4.1 Stigmatisierungserfahrungen und Offenbarung der eigenen Behinderung
4.2 Stigmatisierungserfahrungen und Depression
4.3 Stigmatisierungserfahrungen und Intergruppenangst
4.4 Stigmatisierungserfahrungen und der Wunsch nach Inklusion
4.5 Stigmatisierungserfahrungen und Zurückweisungssensitivität
4.6 Stigmatisierungserfahrungen und Selbstwertgefühl
4.7 Stigmatisierungserfahrungen und soziodemografische Daten
4.7.1 Grad der Behinderung
4.7.2 Wohnort
4.7.3 Geschlecht
4.8 Interkorrelationen
5 Diskussion
5.1 Stigmatisierungserfahrungen und Offenbarung der eigenen Behinderung
5.2 Stigmatisierungserfahrungen, Depression, Intergruppenangst, Zurückweisungssensitivität und Selbstwertgefühl
5.3 Stigmatisierungserfahrungen und der Wunsch nach Inklusion
5.4 Stigmatisierungserfahrungen und soziodemogr afische Daten
5.5 Fazit
Literaturverzeichni
Anhang
Tabellenverzeichnis
1. Übersicht: Vorurteile (öffentlich/ selbst) und Diskriminierung (öffentlich/ selbst)
2. Darstellung der deskriptiven Daten des Bildungsstands und der Haupttätigkeit
3. Darstellung der deskriptiven Daten zur Behinderung der Befragten
4. Auswirkungen der Stigmatisierungserfahrungen auf unterschiedliche Bereiche
5. Anzahl der Personenkategorien, denen sich die Befragten offenbarten
6. ״Mit wem haben Sie über Ihre Behinderung gesprochen?“
7. Korrelationen zwischen Stigmatisierungserfahrungen (ISE), Offenbarung (O), Depression (PHQ), Intergruppenangst (IAS), Wunsch nach Inklusion (DIS), Zurückweisungssensitivität (RSQ) und Selbstwertgefuhl (SW) 27
Gender Erklärung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.
״Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider.Er nimmt jedes Mal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderenimmer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung,sie passten auch heute noch.“(George Bernard Shaw)
Zusammenfassung
Mit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008 verpflichtete sich Deutschland auf verschiedenen Ebenen die Inklusion behinderter Menschen zu fördern und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu bekämpfen. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, die Stigmatisierungserfahrungen von körperlich behinderten Menschen zu erfassen und Zusammenhänge zu Konstrukten wie Depression, Intergruppenangst und Zurückweisungssensitivität im Kontext von Inklusion zu untersuchen.
Im Zentrum der Studie Stand ein Online-Fragebogen, der von körperlich behinderten Menschen beantwortet wurde. Es konnte gezeigt werden, dass Depression, Intergruppenangst und Zurückweisungssensitivität positiv mit Stigmatisierungserfahrungen korrelieren. Des Weiteren konnten signifikante negative Zusammenhänge zwischen Stigmatisierungserfahrungen und Selbstwertgefühl sowie Offenbarung der eigenen Behinderung beschrieben werden. Signifikante Unterschiede gab es im Hinblick auf Stigmatisierungserfahrungen im Geschlecht.
Darüber hinaus zeigen die Untersuchungen der Studie signifikante Zusammenhänge zwischen nahezu allen Konstrukten, was deutlich macht, wie schwierig die Lage für körperlich behinderte Menschen ist und dass die Umsetzung der Inklusion noch weiter voranschreiten muss.
Schlüsselwörter. Inklusion, Stigmatisierung, Diskriminierung, Stereotype, s elb stkategorisierung stheorie, в ehinderung
1 Einleitung
Zur Verwirklichung der gesellschaftlichen Teilhabe behinderter Menschen dient unter anderem das am 1. Mai 2002 in Kraft getretene Behindertengleichstellungsgesetz (BGG). Die Herstellung einer umfassenden Barrierefreiheit gilt als Hauptziel - gemeint ist damit sowohl die Beseitigung von Barrieren für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Menschen als auch die Hilfen zur Kommunikation von blinden, seh- oder hörbehinderten Menschen.
Im Jahr 2008 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) von den Vereinten Nationen unterzeichnet. Das Kernstück dieses völkerrechtlichen Vertrages sind die Menschenrechte von Menschen mit einer Behinderung, der weltweit größten Minderheit, mit Chancengleichheit als oberstes Ziel (Deutscher Bundestag Sekretariat PA 11 - Ausschuss für Arbeit und Soziales, 2008). Er verpflichtet die Vereinten Nationen, so auch Deutschland, jegliche Maßnahmen zu unternehmen, um der Diskriminierung behinderter Menschen in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Die Konvention steht in 50 Artikeln klar, dass diese ein uneingeschränktes und selbstverständliches Recht auf Teilhabe besitzen. Sie schließt unter anderem Gleichberechtigung und Nicht-Diskriminierung (Art. 5), Recht auf Leben (Art. 10), gleiche Anerkennung vor dem Recht (Art. 12), Achtung der Privatsphäre (Art. 22), Bildung (Art. 24); Arbeit und Beschäftigung (Art. 27) und Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben (Art. 29) mit ein (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, 2011).
Sowohl dem Behindertengleichstellungsgesetz als auch in der UN Behindertenrechtskonvention hegt das Leitbild der Inklusion zugrunde. Dabei geht es nicht nur darum, wie sich der Einzelne zur Teilhabe anpassen muss, sondern es geht auch darum, dass die Gesellschaft sich der Vielfalt der Menschheit öffnet (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, 2014). Inklusion erfüllt vollständig und ohne Einschränkungen das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes: ״[...] Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ (Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, 2005, Art. 3.3). Laut der letzten Verstößeberichte des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung 2013 und 2016 gibt es noch einige Hindernisse für körperlich behinderte Menschen. Im Bericht von 2013 steht der Mangel an barrierefreien Bussen und automatischem Kneeling[1] im Fokus (Bericht des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, 2011- 2013), im Bericht 2016 wird, laut Bedarfsschätzung des Kuratoriums Deutsche Altenhilfe (KDA), das Fehlen von 41 Tausend barrierefreien/ -armen Wohnungen in
Berlin bemängelt (Bericht des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, 20132016). Die Verstößeberichte erfassen die strukturelle Diskriminierung durch Behörden oder sonstige öffentliche Stellen. Doch nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern auch im persönlichen Umgang warten Hindernisse auf körperlich behinderte Menschen (Petersen & Six, 2008). 50 Jahre nach Erving Goffmans Studie Stigma (1967), in der er die Wirkung negativer sozialer Zuschreibungsprozesse auf Identität und Selbstwahrnehmung Betroffener und die Folgen für sozialen Ausschluss beschrieben hat, sind Stigmatisierung, Diskriminierung und Ausgrenzung behinderter Menschen nach wie vor gesellschaftliche Realität (Petersen & Six, 2008).
Die übergeordnete Frage mit der sich diese Arbeit beschäftigt, ist, ob sich der Inklusionsgedanke in Deutschland wirklich schon auf die Gesellschaft übertragen hat. Dazu wird untersucht, ob und in wie weit körperlich behinderte Menschen Stigmatisierungserfahrungen machen.
2 Theoretischer Hintergrund
Das Wort Stereotyp kommt ursprünglich aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus den Wörtern Stereos (dt. : starr, hart, fest) und typos (dt. : Entwurf, feste Norm) (Petersen & Six, 2008). Heute gilt ein Stereotyp als eine Reihe von Überzeugungen über die Mitglieder einer sozialen Gruppe. Stereotype sind also kognitive Schemata, die Verarbeitungs- und Urteilsheuristiken implizieren (Petersen & Six, 2008). Zentraler Mechanismus der Entstehung von Stereotypen ist die soziale Kategorisierung (Petersen & Six, 2008). Es werden Gruppen von Menschen zusammengefasst, die sich durch geteilte Überzeugungen (z.B. gleiche Parteizugehörigkeit) oder vom Typ Mensch her ähneln (z.B. Karrierefrau) oder durch ein äußerlich sichtbares Merkmal Ähnlichkeiten aufweisen (z.B. körperliche Behinderung) (Petersen & Six, 2008). Jeder Mensch ist Mitglied vieler sozialer Kategorien (Petersen & Six, 2008). Sie dienen als Ordnungsrahmen, zur Strukturierung und Vereinfachung sozialer Situationen (Petersen & Six, 2008). Durch eine Kategoriezugehörigkeit können Menschen beurteilt werden, auch wenn über sie nur wenige Informationen vorliegen. Kategorisierung macht also stereotype Inhalte deutlich (Petersen & Six, 2008). Gibt es eine Zustimmung zum Stereotyp, die verbunden ist mit negativer emotionaler Reaktion, entsteht ein Vorurteil (Rüsch, Berger, Finzen & Angermeyer, 2004). Schlägt sich die negative Bewertung darüber hinaus in einem negativen Verhalten gegenüber dieser Person nieder, nennt man dies Diskriminierung (Rüsch et al, 2004) (Tabelle 1).
Ein Stigma ist im ursprünglichen Sinne ein Zeichen, das in den Körper eines Sklaven oder Verbrechers gebrannt oder geschnitten wurde, um sie für die Öffentlichkeit zu markieren (Petersen & Six, 2008). Auch heute noch ist ein Stigma ein unvorteilhaftes Merkmal, über das die ganze Person herabgesetzt wird (Piontek, 2009). Das Stigma bildet sich, wenn eine negative Diskrepanz zwischen virtualer sozialer Identität und aktualer sozialer Identität bildet (Petersen & Six, 2008). Die virtuale soziale Identität beinhaltet Erwartungen bezüglich der Attribute, die der Person aufgrund von Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe in stereotyperweise zugeschrieben werden (Maskos, 2004). Die aktuale soziale Identität steht dem gegenüber. Sie meint die Attribute, die eine Person tatsächlich besitzt (Maskos, 2004). Die Diskrepanz, die abhängig von Bewertungsprozessen ist, hat Diskriminierung zur Folge und birgt so negative Konsequenzen für den Stigmatisierten (Schulze, 2005). Darüber hinaus kann das Stigma in die eigene Persönlichkeit übernommen werden, das Selbstkonzept wird negativ beeinflusst (Petersen & Six, 2008) (Tabelle 1). Der Betroffene stigmatisiert sich selbst und es kommt zur beschädigten Identität (Rauchfleisch, 1999). Finzen (2000) nennt in diesem Zusammenhang den Begriff der zweiten Krankheit - Das Stigma selbst ist so belastend wie die eigentliche Erkrankung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Selbstkonzept umfasst die Wahrnehmung und das Wissen um die eigene Person. Es besteht also aus kognitiven Repräsentationen des Selbst (Petersen & Six, 2008). Es beinhaltet verschiedene Komponenten, die je nach Situation salient werden (Fischer, 2016). Das Selbstkonzept ist ein wichtiger Begriff in der Selbstkategorisierungstheorie, einer Theorie der Gruppenformierung und der sozialen Selbstdefmition von Turner, Hogg, Oakes, Reicher und Wethereil (1987). Durch die Prozesse der Kategorisierung begreift sich der Mensch selbst, so entsteht sein Selbstkonzept. Die Kategorisierung findet auf unterschiedlichen hierarchisch angeordneten Ebenen statt (Turner, Hogg, Oakes, Reicher & Wethereil, 1987). Auf der nach Turner et al. (1987) obersten Ebene grenzt sich das menschliche Wesen vom Tier oder von Pflanzen ab, auf einer niedrigeren Ebene findet die Ingroup-Outgroup-Kategorisierung statt (z.B. Psychologe VS. Ingenieur). Die unterste Ebene, die Turner et al. (1978) beschreiben, basiert auf den Ähnlichkeiten und Unterschieden innerhalb der Mitglieder der Ingroup (z.B. Sozial- VS. Neuropsychologe). Die Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten zu anderen, die sich im Kategorisierungsprozess herausbilden, sind die Basis für die Stereotype (Turner et al. 1987).
Identifiziert sich das Individuum mit der Ingroup, wird die Selbstwahrnehmung depersonalisiert. Das bedeutet, dass die Wahrnehmung des Selbst durch den passenden Stereotypen ersetzt wird (Petersen & Six, 2008). Die Person bestimmt sich selbst durch die Position der Ingroup in der Gesellschaft (Petersen & Six, 2008). Im Kontext der eigenen Gruppe wird das Selbst als austauschbar angesehen (Petersen & Six, 2008).
Da Individuen laut Tajfel und Turner (2004) danach streben, eine möglichst positive Selbsteinschätzung zu erhalten, ist die Bewertung der Gruppen von großer Bedeutung für deren Mitglieder (Fischer, 2016). Aus diesem Grund schätzen Individuen ihre Gruppe besonders positiv ein (Fischer, 2016). Diese Ingroup-Favorisierung, die zumeist durch die besondere Überlegenheit oder Bedeutung der eigenen Gruppe begründet wird, geschieht unter Berücksichtigung der stereotypen Attribute der Gruppen (Petersen & Six, 2008). Durch die positive Bewertung der Ingroup wird das Selbstwertgefühl gestärkt (Fischer, 2016). Auch Stigmatisierung und Diskriminierung der Outgroup ermöglichen eine Steigerung des Wertes der eigenen Gruppe (Petersen & Six, 2008). Sind die Unterschiede zwischen Ingroup und Outgroup zu gering oder werden als zu gering vermutet, wird die soziale Identität bedroht. Bei dem Versuch die Distinktheit wieder herzustellen, wird die Outgroup wiederum durch soziale Diskriminierung abgewertet (Petersen & Six, 2008). Diskriminierung der Outgroup kann also auch eine Folge von Unsicherheit über die Kategorien sein (Hogg, 2000).
Diese Ingroup-Outgroup-Effekte werden als Grundlage dieser Arbeit genutzt und auf körperlich behinderte Menschen bezogen. Körperlich behinderte Menschen sind von Stigmatisierung, Diskriminierung und Ausgrenzung betroffen (Petersen & Six, 2008) und besonders auf dem Gebiet der Behindertenforschung werden Stigmaprozesse als identitätsverändernd erlebt (Cloerkes, 2000). Darüber hinaus weisen Minderheiten, wie körperlich behinderte Menschen, laut Simon, Hastedt und Aufderheide (1997) eine höhere Selbststigmatisierung auf. Weitere mögliche Folgen von Stigmatisierungserfahrungen sind für körperlich behinderte Menschen das Auftreten von Depression und ein gemindertes Selbstwertgefühl (Maskos, 2004), geringe Selbstbestimmung (Simon et al, 1997), Geheimhaltung der Behinderung (Rüsch et al, 2004), Angst in Interaktion, Kontaktverlust und Isolation (Cloerkes, 2000).
Neben der Stigmatisierungserfahrung sollen sechs Konstrukte in dieser Arbeit besondere Berücksichtigung finden: die Offenbarung der eigenen Behinderung, Depression, Intergruppenangst, der Wunsch nach Inklusion, Zurückweisungssensitivität und das Selbstwertgefühl. Außerdem werden Zusammenhänge zwischen soziodemografischen Daten und Stigmatisierungserfahrungen untersucht.
2.1 Stigmatisierungserfahrungen und Offenbarung der eigenen Behinderung
Schwerbehinderte Menschen sind nur dann dazu verpflichtet, ihre Behinderung zu offenbaren, wenn sie von einem potentiellen Arbeitgeber zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch ausdrücklich danach gefragt werden und der Bewerber anerkennen muss, dass er die von ihm geforderte Leistung aufgrund seiner Behinderung nicht erbringen kann (BIH Integrationsämter, 2014). Im Kontext des sozialen Lebens eines Behinderten ist es ihm selbst überlassen, ob und wem er von seiner Einschränkung erzählt. Zu einem offenen Umgang mit der eigenen Behinderung gehören untrennbar die Akzeptanz der Behinderung respektive die Anerkennung der Behindertenrolle (Cloerkes, 1997). Diese Rolle anzunehmen bedeutet Klarheit über die Erwartungen zu schaffen und schützt den behinderten Menschen vor Überforderung (Cloerkes, 1997). Das führt wiederum zu Normalisierung des Verhältnisses zu anderen Menschen (Cloerkes, 1997). Ein weiterer Aspekt ist, dass ein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit anderen Gleichbehinderten ausgelöst wird, wenn jemand seine Behinderung und sich selbst als Person mit einer Behinderung akzeptiert (Seywald, 1976). Als mögliche Vorteile der Offenbarung der Behinderung nennen Rüsch und Kollegen (2004) in einer Studie mit psychisch behinderten Menschen unter anderem eine Selbstwertsteigerung und verringerte Belastung durch Geheimhaltung der Behinderung.
Im Sinne des Stigma-Managements wird zum Schutz der Identität, damit also der Vermeidung von Stigmatisierungserfahrungen, häufig versucht, unerwünschtes Anderssein zu verbergen (Goffman, 1967). Forschungsergebnisse aus Studien mit psychisch behinderten Menschen legen schwerwiegende Folgen des Stigma-Managements nach Goffman dar. Die soziale Integration wird schwieriger, die betroffenen Personen ziehen sich mehr und mehr zurück und es kommt zu höherer Arbeitslosigkeit (Rüsch et al, 2004).
Fragestellung 1 : Gibt es einen Zusammenhang zwischen Offenbarung der eigenen körperlichen Behinderung und Stigmatisierungserfahrungen?
H11: Es gibt einen negativen Zusammenhang zwischen dem Offenbaren der eigenen körperlichen Behinderung und Stigmatisierungserfahrungen.[2]
2.2 Stigmatisierungserfahrungen und Depression
An Depression erkrankte Menschen haben eine gedrückte Stimmung und einen geminderten Antrieb. Die Fähigkeit zu Freude, das Interesse und die Konzentration sind vermindert (Dilling, Mombour & Schmidt (Hrsg.), WHO - World Health Organization WHO Press Mr. Ian Coltart, 2015). Diese Symptome bestimmen ihr Erleben und Verhalten. In jedem Jahr sind ungefähr 6-8% der Durchschnittsbevölkerung von einer depressiven Störung betroffen (Wittchen & Hoyer, 2011). Der Entstehung dieser Krankheit können biologische, psychosoziale und soziokulturelle Faktoren zugrunde liegen (Wittchen & Hoyer, 2011).
Prädisponierende Faktoren sind unter anderem auch schwerwiegende Krankheitserfahrungen oder chronische Belastung (Wittchen & Hoyer, 2011). Da körperlich behinderte Menschen zumeist schwerwiegende Krankheitserfahrungen machen, sind sie eindeutig vorbelastet an einer Depression zu erkranken. In einer Reihe von Untersuchungen ließ sich ein direkter Zusammenhang zwischen dem Erleben von Diskriminierung und einer schlechten gesundheitlichen Verfassung nachweisen (z.B. Landrine, Klonoff, Gibbs, Manning & Lund, 1995; Clark, Anderson, Clark & Williams, 1999; Schmitt, Branscombe & Postmes, 2003). Link, Struening, Rahav, Phelan und Nuttbrock (1997) präzisierten die Auswirkungen von Diskriminierungen und zeigten einen positiven Zusammenhang zwischen Diskriminierung und Depression auf.
Die psychosozialen Auswirkungen von Depression sind unter anderem ein gemindertes Selbstwertgefühl und sozialer Rückzug (Myers, 2008). Darüber hinaus halten depressionsbedingte Einschränkungen wie beispielsweise geringe Arbeitsproduktivität, langer Arbeitsausfall oder sogar Arbeitsplatzverlust oft wesentlich länger als die eigentliche Depressionssymptomatik an und können ein Rückfallfaktor sein (Wittchen, Jacobi, Klose, Ryl & Ziese, 2010). Körperlich behinderte Menschen, die an einer Depression erkranken, erfahren nicht nur aufgrund der Körperbehinderung Stigmatisierung, sondern ebenso aufgrund der psychischen Erkrankung. Nach Rüsch et al. (2004) werden Menschen mit psychischen Erkrankungen sogar noch missbilligender behandelt als körperlich Behinderte, weil sie häufig für ihre Erkrankung verantwortlich gesehen werden. In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob es einen Unterschied in den Stigmatisierungserfahrungen gibt zwischen depressiven Menschen mit körperlicher Behinderung und nicht-depressiven Körperbehinderten (Fragestellung 2).
H21: Depressive körperlich behinderte Menschen erfahren mehr Stigmatisierung als nicht-depressive körperlich behinderte Menschen.
2.3 Stigmatisierungserfahrungen und Intergruppenangst
Die Kontakthypothese besagt, dass Kontakt zwischen Gruppen Vorurteile abbaut (Dolíase, 2001). Gordon Allport formulierte diese im Jahr 1954 und spezifizierte dabei auch die Art des Kontakts: 1. Personen müssen in der Kontaktsituation den gleichen Status haben. 2. Personen müssen gemeinschaftlich ein kooperatives Ziel verfolgen. 3. Die Mitglieder der beiden Gruppen müssen interagieren und sich persönlich näher kennenlernen. 4. Der Kontakt muss durch Autoritäten oder lokale Normen, Erlasse und Vorschriften unterstützt werden (Dolíase, 2001). Wiederholter Kontakt zwischen Gruppen unter den angeführten Bedingungen kann die Auftretenswahrscheinlichkeit von Intergruppenangst reduzieren (Petersen & Six, 2008). Dies zeigen auch vorangegangene Forschungen (Paolini, Hewstone, Voci, Harwood, & Cairns, 2006; Pettigrew & Tropp, 2008). In der jüngsten Zusammenstellung sämtlicher Untersuchungen zur Kontakthypothese haben Pettigrew und Tropp (2000) feststellen können, dass diese für jede Art von Ingroup-Outgroup-Kontakt gilt: Also auch für den Kontakt zwischen Behinderten und Nichtbehinderten.
Als Intergruppenangst wird die Angst vor Interaktion oder antizipierter Interaktion mit einer Outgroup bezeichnet (Clifton & Aberson, 2012). Sie ist verbunden mit Gefühlen des Unbehagens und resultiert in diversen negativen affektiven, kognitiven und behavioralen Konsequenzen (Clifton & Aberson, 2012). Intergmppenangst ist eine entscheidende Variable, um den Erfolg oder Misserfolg von Intergruppenkontakt zu verstehen (Greenland, Xéniás & Maio, 2012): So wird sie zum Beispiel auch als antizipierte negative Konsequenz von Intergruppenkontakt, wie etwa die negative Bewertung respektive Ablehnung durch die Fremdgruppe, die Sorge um fehlende eigene Kompetenzen im Umgang mit der Fremdgruppe oder die Befürchtung, von der Fremdgruppe ausgenutzt oder dominiert zu werden, angeführt (Kuchenbrandt, 2009). Auf Basis des zuvor Erläuterten wurden folgende Fragestellung und Hypothese formuliert.
Fragestellung 3: Gibt es einen Zusammenhang zwischen
Stigmatisierungserfahrungen und Intergruppenangst bei körperlich behinderten Menschen?
H31: Stigmatisierungserfahrungen und Intergruppenangst bei körperlich
behinderten Menschen sind positiv korreliert.
2.4 Stigmatisierungserfahrungen und der Wunsch nach Inklusion
Unangenehme und bedrohliche Situationen zu vermeiden ist eine Prämisse in der sozialen Interaktion (Cloerkes, 1979). Um negative Reaktionen des Gegenübers zu umgehen und sich selbst zu schützen, ziehen Menschen, deren Äußeres von der Norm abweicht, sich häufig aus der Gesellschaft anderer Menschen zurück (Glassi, 2008). Statt Inklusion kommt es so mehr und mehr zu Isolation (Cloerkes 1979). Bisherige Forschungen haben gezeigt, dass trotz Zurückweisung bei behinderten Menschen der Wunsch nach Inklusion unvermindert ist (Greenaway, Jetten, Ellemers & van Bunderen. 2015). In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob es bei körperlich behinderten Menschen einen Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach Inklusion und Stigmatisierungserfahrungen gibt (Fragestellung 4).
H41: Stigmatisierungserfahrungen und der Wunsch nach Inklusion sind bei
körperlich behinderten Menschen negativ korreliert.
2.5 Stigmatisierungserfahrungen und Zurückweisungssensitivität
Unter Zurückweisungssensitivität (englisch: rejection sensitivity) wird die Erwartung von Zurückweisung, die erhöhte Wachsamkeit für potentielle Signale der Zurückweisung und die übermäßige Reaktion auf Zurückweisung verstanden (Downey & Feldman, 1996). Die Zurückweisungssensitivität bezieht sich demnach auf drei Prozesse: die Erwartung, die Wahrnehmung und die Reaktion. Personen mit einer hohen Zurückweisungssensitivität erwarten grundsätzlich von anderen Personen zurückgewiesen zu werden, identifizieren auch in harmloser sozialer Interaktion schnell potenzielle Signale der Zurückweisung und neigen zu übertriebenen Reaktionsmustern wie übermäßiges Bemühen um Zuwendung, zu sozialem Rückzug oder aggressiven Verhaltensweisen (Ayduk, Mendoza, Mischei, Downey, Peake & Rodriguez, 2000). Hohe Zurückweisungssensitivität ist also ein Faktor, der die Integration in eine Gruppe gefährdet (Purdie & Downey, 2000).
Laut Downey und Feldman (1996) ist eine hohe Zurückweisungssensitivität als Resultat früher und andauernder offener und verdeckter Zurückweisung in Form von physischer oder verbaler Gewalt und emotionaler Vernachlässigung anzusehen. Vor allem die Zurückweisung durch Eltern oder Gleichaltrige führt zu einem Anstieg der Zurückweisungssensitivität (Rosenbach, 2013). Auch erneut erlebte Zurückweisung kann verstärkte Zurückweisungssensitivität zur Folge haben (Purdie & Downey, 2000). Ayduk und Kollegen (2000) beschreiben einen Kreislauf zwischen hoher Zurückweisungssensitivität und sinkendem Selbstwertgefühl, welches wiederum zu einer Erhöhung der Zurückweisungssensitivität führt. Je mehr körperlich behinderte Menschen Stigmatisierungserfahrungen machen, also zurückgewiesen werden, desto höher müsste demnach ihre Zurückweisungssensitivität sein. In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob es bei körperlich behinderten Menschen einen Zusammenhang gibt zwischen Stigmatisierungserfahrungen und der Zurückweisungssensitivität (Fragestellung 5).
H51: Bei körperlich behinderten Menschen sind viele Stigmatisierungserfahrungen mit einer höheren Zurückweisungssensitivität assoziiert.
2.6 Stigmatisierungserfahrungen und Selbstwertgefühl
Das Konzept des Selbstwertes ist ein Konzept, welches in verschiedenen Disziplinen der Psychologie eine wichtige Bedeutung besitzt (Potreck-Rose & Jacob, 2013). Diese bedeutsame Stellung liegt darin, dass Selbstwert als wichtige Größe für das Verständnis der Persönlichkeit und von sozialer Interaktion gilt (Potreck-Rose & Jacob, 2013). Die Forschung zur Ursachenattribution belegt schon lange, dass Menschen grundsätzlich dazu geneigt sind, ihre Umwelt selbstwertdienlich zu interpretieren - nämlich external (Potreck-Rose & Jacob, 2013). Jedoch geben Personen mit derartiger Attribution die Kontrolle aus der Hand (Potreck- Rose & Jacob, 2013). Als Folge daraus werden negative Ereignisse in mehrdeutigen Situationen doch auf eigenes Versagen attribuiert, um die Kontrolle im persönlichen und sozialen Bereich wiederzuerlangen und zu sichern (Glassi, 2008). Für behinderte Menschen bedeutet dies, dass durch anhaltende Stigmatisierung und die folgende internale Attribution ihr Selbstwert weiter und weiter sinkt (Glassi, 2008). Eine Studie mit psychisch behinderten Menschen von King, Dinos, Shaw, Watson, Stevens, Passetti, Weich und Serfaty (2007) belegt, dass Erfahrung von Stigmatisierung und Selbstwertgefühl negativ korreliert sind. Auch Wright und Gronfein (1996) berichten einen negativen Effekt von erfahrener und antizipierter Stigmatisierung auf das Selbstwertgefuhl über eine Periode von einem Jahr (Markowitz, 1998). Laut Krajewski, Burazeri und Brand (2013) geht das Stigma einer psychischen Erkrankung mit einem niedrigen Selbstwert einher.
Ein weiterer Aspekt, der hierbei zu beachten ist, ist dass aus dem geminderten Selbstwertgefühl eine zusätzliche Behinderung der Teilnahme an der sozialen Interaktion entsteht (Schulze, 2005). Dadurch kann es wiederum zu einer Verstärkung der Symptomatik der Erkrankung kommen und den Stigma-Prozess somit aufs Neue in Gang setzen (Schulze, 2005). Für den Betroffenen bedeutet dies, dass es zu einem Teufelskreis aus Stigmatisierung und Selb st Wertminderung kommen kann (Schulze, 2005). Auf Basis des zuvor Erläuterten wurden folgende Fragestellung und Hypothese formuliert.
Fragestellung 6: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Selbstwertgefühl und Stigmatisierungserfahrungen bei körperlich behinderten Menschen?
H61: Bei körperlich behinderten Menschen sind viele Stigmatisierungserfahrungen mit einem geringen Selbstwertgefühl assoziiert.
2.7 Stigmatisierungserfahrungen und soziodemografische Daten
2.7.1 Grad der Behinderung
Es ist gesichert, dass leichter behinderten Menschen eine negativere Einstellung entgegengebracht wird als schwerer behinderten Personen (Farina, Sherman & Allen, 1968; Cloerkes, 1979). So registrierten zum Beispiel Farina, Sherman und Allen (1968) bei Versuchspersonen eine wesentlich höhere Bereitschaft, dem leicht körperbehinderten Vertrauten schmerzhafte Elektroschocks zu erteilen als dem Vertrauten im Rollstuhl. Dass gesunde Menschen eine schwere Behinderung beim Gegenüber eher akzeptieren, hängt laut Cloerkes (1979) mit der größeren Eindeutigkeit der Behinderung zusammen. Diese klare Stereotypisierung ist verbunden mit niedrigen Erwartung und der Erfüllung der Behindertenrolle. Leichtere Behinderungen lösen beim Gegenüber meistens eine Verhaltensunsicherheit aus (Cloerkes, 1979). An den behinderten Menschen werden infolge der Unwissenheit die gleichen Erwartungen bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit wie an Nichtbehinderte (Cloerkes, 1979). Bei Nichterfüllen der Erwartungen sind die sozialen Reaktionen umso heftiger (Cloerkes, 1979). In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob es einen Unterschied zwischen Nicht-Schwerbehinderten und Schwerbehinderten im Hinblick auf Stigmatisierungserfahrungen gibt.
H71: Nicht-Schwerbehinderte erfahren mehr Stigmatisierung als s chwerbehinderte.
2.7.2 Wohnort
Die Interaktion zwischen einem nicht-behinderten Menschen und einem behinderten Gegenüber ist grundsätzlich durch ein hohes Maß an Ambivalenz und Verhaltensunsicherheit gekennzeichnet, welche durch intensiven Kontakt im Sinne der Kontakthypothese abgebaut werden können (Petersen & Six, 2008). Die Einwohnerzahl eines Dorfes liegt bei maximal 5000 Menschen. Eine Stadt hingegen hat zwischen 5000 und 3,5 Millionen Einwohner (Springer Gabler Verlag). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass behinderte Menschen, die in einer Stadt leben deutlich einfacher Kontakte zu Ihresgleichen knüpfen können, weil es mehr von Ihresgleichen gibt. Sasse (2005) beschreibt in ihrer Arbeit zu Sonderschulen im ländlichen Raum, die Anerkennung und Akzeptanz von Verschiedenheit als einen Lernprozess. Aufgrund der geringeren Bevölkerungsanzahl in ländlichen Gegenden und dem daraus resultierenden mangelnden Kontakt zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten, ist es schwieriger diesen Lernprozess in Gang zu bringen. Auch durch die anhaltenden Traditionen kann die Akzeptanz von körperlich behinderten Menschen nicht vorausgesetzt werden (Sasse, 2005). In dieser Arbeit soll der Einfluss des Wohnorts auf die Stigmatisierungserfahrungen untersucht werden und auf Basis des zuvor erläuterten wurde folgende Hypothese formuliert.
Fragestellung 8: Gibt es einen Unterschied zwischen Leben auf dem Dorf und Leben in der Stadt im Hinblick auf Stigmatisierungserfahrungen von körperlich Behinderten?
H81: Körperlich behinderte Menschen, die auf dem Dorf leben, erfahren mehr Stigmatisierung als körperlich behinderte Menschen, die in der Stadt leben.
2.7.3 Geschlecht
״Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, und ergreifen in dieser Hinsicht Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt genießen können.“ Dies ist ein Auszug aus der UN-Behindertenrechtskonvention (2014) aus Artikel 6 ״Frauen mit Behinderung“ (S. 18). Behinderte Frauen erleiden eine doppelte Diskriminierung, als Frau gegenüber Männern und als behinderter Mensch gegenüber Nichtbehinderten (Zinsmeister, 2007). Waxman (1991) zufolge werden die Vorstellungen von ״Frau“ und ״behinderter Frau“ von unterschiedlichen Assoziationen begleitet. Das Bild einer Frau wird vorwiegend mit Merkmalen wie Arbeit, Schönheit, Sexualität, Mutter und Ehefrau verbunden (Waxman, 1991, Lang, 2007). Die Vorstellung einer behinderten Frau hingegen weckt Assoziationen wie Schwäche, Abhängigkeit, Alter und Verzweiflung (Waxman, 1991; Lang, 2007). Die mentalen Repräsentationen sind also sehr unterschiedlich. Nach Wienhues (1988) gelten weibliche Behinderte dadurch oft als geschlechterlose Wesen. Sie sind weder hinreichend attraktive Partnerinnen für Männer (Ortland, 2008) noch ernsthafte Konkurrentinnen (Wienhues, 1988). Behinderten Frauen wird verstärkt das tradierte historische Frauenklischee zugeschrieben (Cloerkes, 1997).
Frauen mit einer Behinderung, die die geschlechterlose Rolle ablegen wollen, betonen ihre Weiblichkeit und nehmen aktiv am Leben teil (Glassi, 2008). Von vielen wird dieses Verhalten als negativ wahrgenommen, weil die Frauen dem Bild der ״armen Behinderten“ widersprechen, sich sogar dagegen auflehnen (Glassi, 2008). Daraus ist zu schließen, dass es starke normative Überzeugungen gibt, wie Frauen mit Behinderungen sich zu verhalten haben (Glassi, 2008). Wenn Betroffene sich diesen normativen Überzeugungen widersetzen, stellt sich bei Nichtbehinderten eine kognitive Dissonanz und damit ein unbehagliches Gefühl ein (Glassi, 2008). In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob es einen Unterschied zwischen körperlich behinderten Frauen und körperlich behinderten Männern in dem Erfahren von Stigmatisierung gibt (Fragestellung 9)
H91: Körperlich behinderte Frauen erfahren mehr Stigmatisierung als körperlich behinderte Männer.
3 Methode
Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen einer Studie, die am Lehr- und Forschungsgebiet Berufliche Rehabilitation an der RWTH Aachen durchgeführt wurde, entwickelt und beschäftigt sich mit einem Ausschnitt dieser. Gegenstand der Gesamtstudie sind die Stigmatisierungserfahrungen von körperbehinderten Menschen im Kontext der Inklusion.
Zur Erstellung des Fragebogens wurde SoSci Survey, ein Softwarepaket für wissenschaftliche Onlinebefragungen genutzt. Die Befragung wurde über 59 Tage (20.12.2016 bis 16.02.2017) über verschiedene Kanäle, vor allem per Mail und über Facebook verbreitet. Als Anreiz wurde den Teilnehmern bei abgeschlossener Befragung der Gewinn von sechs Amazon-Gutscheinen im Gesamtwert von 170 Euro in Aussicht gestellt.
Der Fragebogen (siehe Anhang) beinhaltete einen soziodemografischen Teil mit 17 Items und weiterhin 18 Skalen, von denen für diese Arbeit nur ein Teil relevant war. Zur Datenauswertung wurde sich des Statistik-Programms IBM SPSS Statistics 24 beholfen. Alle invers gepolten Items der verschiedenen Instrumente wurden vor der Auswertung umgepolt.
3.1 Stichprobe
Der Fragebogen wurde von 7501 Personen aufgerufen, von 939 begonnen und von 544 Personen abgeschlossen, davon sind es 432 abgeschlossene Datensätze auf der letzten Seite. Die übrigen sind bereits auf Seite 1 abgeschlossen gewesen, weil keine körperliche Behinderung vorlag. Die Beendigungsquote, errechnet aus begonnenen und abgeschlossenen (letzte Seite) Datensätzen, liegt bei 46%. Es wurden die schnellsten 10 % der Teilnahmen ausgeschlossen, um einer Verzerrung der Daten durch unaufmerksames und zu schnelles Beantworten der Fragen vorzubeugen (Rossmann, 2010). Außerdem mussten aufgrund von unpassenden Angaben (1 mal psychische Behinderung; 1 mal keine Behinderung) zwei Datensätze ausgeschlossen werden. Es blieben 398 vollständige Teilnahmen zur Auswertung.
Die mittlere Bearbeitungszeit für den Fragebogen lag bei 34.88 Minuten (maximal: 85.53; minimal: 19.98; SD = 13.01; Md= 30.88). 302 Teilnehmer waren weiblich (76%) und 95 männlich (24%), 1 Teilnehmer machte keine Angabe zu seinem Geschlecht. Das Durchschnittsalter lag bei 39.76 Jahren, mit einem Höchstalter von 72 Jahren. Der jüngste Teilnehmer war 13 Jahre alt. Bezüglich des Wohnorts berichteten 112 Teilnehmer in einer ländlichen Gegend zu wohnen (28.14%), 76 in einer Kleinstadt (19.10%), 99 in einer Stadt (24.87%) und 111 in einer Großstadt (27.89%). 145 Teilnehmer waren verheiratet (36.43%), 163 ledig (40.95%), 85 in Partnerschaft lebend (21.36%) und 5 verwitwet (1.26%). 256 Teilnehmer waren zum Zeitpunkt der Studie berufstätig (64.32%) (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2
Darstellung der deskriptiven Daten des Bildungsstands und der Haupttätigkeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die am häufigsten genannten Behinderungen als Hauptdiagnose waren Multiple Sklerose (47 mal), Morbus Crohn (30 mal), Diabetes (27 mal), Spina Bifida (19 mal), Amputationen (18 mal) und Gehörlosigkeit (18 mal). Die übrigen 239 Angaben bezogen sich auf weitere Behinderungsformen wir zum Beispiel Arthrose, Arthritis, Ataxie, Paresen, Spastiken und Plegien. 170 Teilnehmer geben an, an einer Mehrfachbehinderung zu leiden (42.7%), 327 hatten einen Schwerbehindertenstatus (82.2%). Hilfsmittel benötigten 296 Teilnehmer (74.4%) (siehe Tabelle 3). Am häufigsten wurden die Hilfsmittel Medikamente (173 mal), Rollstuhl (127 mal), Gehhilfe (96 mal) und Sehhilfe (82 mal) genannt.
Tabelle 3
Darstellung der deskriptiven Daten zur Behinderung der Befragten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2 Instrumente
Neben der Erfassung personen- und krankheitsbezogener Daten, kamen in dieser Arbeit folgende Skalen zum Einsatz.
3.2.1 Inventar Subjektiver Stigmatisierungserfahrungen (ISE)
Lange Zeit blieb in der Stigmaforschung die Seite der vom Stigma betroffenen Menschen unberücksichtigt. Um einen Überblick über die Prävalenz des subjektiven Stigmas zu erlangen, müssen Ausmaß und Intensität der Stigmatisierungserfahrungen erfasst werden. Professor Heather Stuart entwarf zusammen mit seinen Kollegen in Kanada auf Grundlage empirischer Literatur das Inventory of Stigmatizing Experiences (ISE), welches genau diese subjektiv erlebte Stigmatisierungserfahrung des Betroffenen erfassen sollte. Von Schulze, Stuart und Riedel-Heller (2009) wurde darüber hinaus eine deutsche Version des Fragebogens erstellt.
Das ISE besteht aus der Stigma-Erfahrungs-Skala (SES), welche 9 Items zur Stigmatisierungserfahrungen in verschiedenen Lebensbereichen auf einer 5-stufigen Ratingskala (1 = nie, 5 = immer) erfasst (Beispielitem: ״Hat Sie schon einmal jemand gehänselt, schikaniert oder belästigt, weil Sie eine körperliche Behinderung haben?“) und der Stigma-Auswirkungs-Skala (SAS), die die Intensität der psychosozialen Auswirkungen von Stigma auf Lebensqualität, soziale Kontakte, Selbstwertgefühl, familiäre Beziehungen und Schule/ Beruf anhand einer 10-stufigen Ratingskala (1 = das kleinstmögliche Ausmaß, 10 = das größtmögliche Ausmaß) erfasst.
Die deutsche Version des ISE weist gute Reliabilitäten auf. Die Stigma-ErfahrungsSkala hat einen Wert von Cronbachs a = .74 (englisches Original: Cronbachs a = .83), die Stigma-Auswirkungs-Skala einen Wert von Cronbachs a = .86 (englisches Original Cronbachs a = .91). Dementsprechend ist der ISE ein kompaktes, reliables Instrument zur Messung von Ausmaß, Schweregrad und Auswirkungen erlebter Stigmatisierung (Schulze et al, 2009). Die interne Konsistenz beider Teilskalen betrug in der vorliegenden Untersuchung Cronbachs a = .88. Sowohl der SES als auch der SAS waren somit reliabel einzuschätzen.
Da mit dem ISE ursprünglich psychisch behinderte Menschen untersucht wurden, mussten für unsere Untersuchung die Items so umformuliert werden, dass sie für die Befragung Körperbehinderter verwendbar wurden.
[...]
[1] Kneeling ist das automatische Absenken eines Busses. Es erleichtert das Ein- und Aussteigen.
[2] Der Einfachheit halber wird im Text auf die Darstellung der analog zur Altemativhypothese Hl formulierten Nullhypothese Ho verzichtet. Diese sind der H1-H0-Tabelle aus dem Anhang zu entnehmen.
- Arbeit zitieren
- Birte Anhenn (Autor:in), 2017, Stigmatisierungserfahrungen von körperlich behinderten Menschen im Kontext von Inklusion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424397
Kostenlos Autor werden

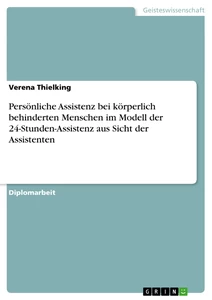










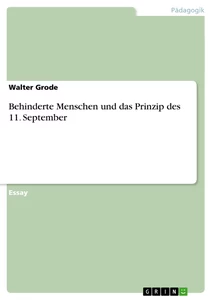
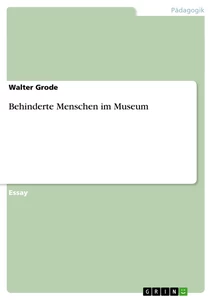








Kommentare