Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anlagenverzeichnis
1 Einleitender Teil
1.1 Ausgangslage und Problemstellung
1.2 Zielsetzung der Arbeit
2 Das Berufsbild der Gesundheits- und Krankenpflege in Deutschland
2.1 Historische Entwicklung professioneller Pflege in Deutschland
2.2 Pflege als Hilfstätigkeit für die Ärzteschaft
2.3 Problemfelder der Gesundheits- und Krankenpflege
2.4 Vorzeitiger Berufsausstieg als Hauptgrund des Personalmangels
2.5 Akademisierung des Berufsbildes
2.6 Anforderungen an die Personalführung
3 Interessenvertretungen in der Pflege
3.1 Organisationsmöglichkeiten Pflegender
3.2 Berufsverbände
3.3 Gewerkschaften
4 Empirische Untersuchung
4.1 Quantitatives Forschungsdesign
4.2 Fragestellung und Ziel der Untersuchung
4.3 Methodik der Datenerhebung
4.3.1 Befragung
4.3.2 Durchführung
4.4 Quantitatives Auswertungsverfahren
5 Darstellung der Ergebnisse
6 Fazit und Handlungsempfehlung
Anlagen
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anlagenverzeichnis
Anlage 1 Anschreiben zum Fragebogen
Anlage 2 Fragebogen
Anlage 3 Kodierung Fragebogen
Anlage 4 Antworten Fragebogen kodiert
Anlage 5 Ergebnisse Fragebogen graphisch dargestellt
1 Einleitender Teil
״Nach Florence Nightingale lassen sich Pflegende durch die tiefe Sorge um Patienten und Angehörige motivieren“ (Pokorski et al. 2005: 63). Diese Aussage aus der Mitte des 19. Jahrhunderts prägt noch heute die Vorstellung vieler, wenn über die Motivation von Pflegepersonal gesprochen wird. Dabei war bereits die rechili- che Ausgangslage um 1800 der Entwicklung der Pflegeberufe wenig förderlich. Krankenpflege gehörte nicht zu den traditionellen Heilberufen, hatte somit keine eigenen Kompetenzen und jede eigenständige Handlung des damaligen Pflegepersonales wurde als ״Kurpfuscherei“ geahndet (vgl. Schweikardt 2008: 267ff.). Doch ist gerade das Ansehen eines Berufes noch immer einer der ausschlaggebendsten Gründe, sich als junger Mensch für diesen Beruf zu entscheiden. Viele deutsche Abiturienten bewerben sich um einen Studienplatz im Fachbereich Medizin und interessieren sich weniger für eine Ausbildung im Pflegesektor, da für diese als Zugangsvoraussetzung ein Schulabschluss der mittleren Reife ausreicht (vgl. DEKV 2004: 27).
Die Attraktivität eines Berufes hängt allerdings immer grundsätzlich mit dessen Akademisierungsgrad zusammen (vgl. Gruber, Kastner 2005: 7). Mittlerweile gibt es in Deutschland eine stark zunehmende Zahl an heterogenen Studienangeboten für Pflegekräfte. Allerdings ist zu beobachten, dass die Studiengänge sich von der direkten Patientenversorgung wegbewegen hin zu Stabs- und Führungspositionen. Zentrale Voraussetzung einer Aufwertung des Berufsbildes der Pflegekräfte sollte daher sein, akademisches Pflegepersonal direkt am Patienten einzusetzen. Dazu bedarf es allerdings eines Kulturwandels in den Einrichtungen des GesundheitsWesens, aber besonders auch in der Pflege selbst (vgl. BAG Pflegemanagement im DBfK 2015). Die berufspolitische Interessenvertretung zeigt allerdings ein extrem heterogenes Bild und einen sehr geringen Organisationsgrad unter den Pflegenden (vgl. Baur et al. 2008: 138).
Zum Problemfeld der geringen Attraktivität des Berufsfeldes und zu den difieren- zierten Interessengruppen der Gesundheits- und Krankenpflege gesellt sich der demografische Wandel. Allein zwischen den Jahren 1999 und 2013 erhöhte sich die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland um 30 Prozent auf rund 2,63 Millionen (vgl. DIP 2016: 17). Bis 2060 wird diese Zahl auf 4,7 Millionen steigen (vgl. BMG 2016). Das System der Pflege steht vor dem Kollaps und als Lösung von politischer Seite wird ein neues Ausbildungsgesetz gefeiert (vgl. BMG; BMFSFJ 2016). Dabei besagt eine Studie des Forschungsinstitutes für betriebliche Bildung, dass ״... zunehmend langjährige Beschäftigte aus gesundheitlichen Gründen vom aktiven Pflegedienst in andere Bereiche versetzt werden - oder sie steigen ganz aus dem Beruf aus. Zugleich wird es aber schwieriger, Nachwuchskräfte zu gewinnen und das Ausscheiden von Leistungsträgem zu kompensieren“ (f-bb O.J.). Die Motivation zu der vorliegenden Arbeit zieht der Autor aus ebendieser Diskrepanz. Gefühlt gehen die politisch diskutierten Lösungsvorschläge am Problem des Berufsstandes vorbei. Trotz generalisierter Ausbildung dürfen Pflegekräfte ihre erworbenen Kompetenzen im Klinikalltag nicht selbstständig einsetzen. Auch eine Akademisiemng ist wenig sinnvoll, wenn nicht der Wille besteht, den Pfle- gebemf als eine eigenständige Disziplin gleichwertig der Ärzteschaft zu établie- ren. ״Die selbstständige Ausübung der Heilkunde, das wollen die Menschen“ (Westerfellhaus 2016). Doch ob die Pflegekräfte dies selbst wollen und warum es dem Bemfsstand seit Jahrzehnten so schwerfällt notwendige Änderungen voranzubringen, dazu soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten.
Dabei wird im literarischen Teilbereich, der die Kapitel eins und zwei der Arbeit umfasst, die berufliche Krankenpflege zuerst vor ihrem historischen Hintergmnd beschrieben. Es wird aufgezeigt, inwieweit die Historie und eine dominante Ärzteschaft die aktuellen Problemfelder des Pflegeberufs bestimmen. Im Verlauf wird der Stand der Professionalisierungsbestrebungen des Berufes dargestellt und dabei auch ein Vergleich zu anderen Ländern gezogen.
Im dritten Kapitel der Arbeit wird das heterogene Feld der Interessengruppen innerhalb der Pflegebranche skizziert, um eine Vorstellung zu erzeugen, warum die Pflege sich selbst mit Verändemngen so schwertut. Die Kapitel vier und fünf stellen anschließend die empirische Forschungsarbeit dar. Abschließend wird, basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung, ein Fazit gezogen und es werden Handlungsempfehlungen des Autors gestellt.
1.1 Ausgangslage und Problemstellung
Die Relevanz der ausgewählten Thematik ergibt sich aus der beruflichen Praxis um das Jahr 2017. Die Personalsituation spitzt sich weiter zu und die demografi- sehe Entwicklung in Deutschland verstärkt die Problematik auf verschiedenen Wegen. ״Es gibt unzählige Beispielländer, in denen der Berufsstand der Pflege hoch angesehen ist, eine angemessene Bezahlung erhält und die gesellschaftliche Anerkennung eine Selbstverständlichkeit geworden ist“ (Fajardo 2013: 59). In Deutschland hingegen wird die beachtliche Leistung, welche Pflegende erbringen, nicht nur von deren Vorgesetzten und anderen Berufsgruppen negiert. Pflegende selbst nehmen ihre Leistung aufgrund ständiger Diffamierung nicht mehr als positiv wahr (vgl. Cassier-Woidasky 2007: 275).
In der vorliegenden Arbeit wird bewusst der Schwerpunkt auf Gesundheits- und Krankenpflegekräfte gelegt. Eine Analyse anderer Bereiche, wie zum Beispiel der Altenpflege, bedarf aufgrund der Größe des Bereiches eigener ForschungsanStrengungen. Vor dem Hintergrund der starken Heterogenität im Bereich der Pflege muss allerdings auf eine katastrophale Datenlage hingewiesen werden, was dazu führt, dass in verschiedener Literatur mit uneinheitlichen Daten gearbeitet wird und es häufig zu einer irreführenden Wahrnehmung kommt (vgl. Hoesch 2009: 261). Viele Statistiken separieren den Pflegeberuf in unterschiedliche Bereiche, einige beziehen Geburtshelfer und Sanitäter mit ein, wieder andere trennen zwischen Erwachsenen- und Kinderpflege. Aus diesem Grund lassen sich gewisse Überschneidungen und Ungenauigkeiten der Beschäftigungszahlen in dieser Ar-beit nicht vermeiden.
1.2 Zielsetzung der Arbeit
Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist darauf gerichtet, die Situation der in der Pflege Beschäftigten vor ihrem geschichtlichen Hintergrund und ihrer Abhängigkeit zur Berufsgruppe der Ärzte darzustellen. Darüber hinaus sollen die verschiedenen Problemfelder der Pflegekräfte zu Beginn des 21. Jahrhunderts aufgezeigt werden. Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit trägt abschließend dazu bei, die Motive zur Arbeitsausführung sowie Vorstellungen zur Akademisie- rung und berufspolitischer Vertretung der Berufsangehörigen aufzuzeigen. Es wird ein Einblick über die Vorstellungen der Pflegenden zur Akademisierung des Berufsfeldes gewährt. Beginnend erfolgt mit dem literarischen Teil der Arbeit zunächst eine Darstellung, wie das Berufsbild der Pflege strukturiert ist und welchen Platz die Pflege im Gesundheitswesen einnimmt.
2 Das Berufsbild der Gesundheits- und Krankenpflege in Deutschland
Pflege ist eine Disziplin, die in verschiedene Kategorien differenziert wird, näm- lieh nach den zu verrichtenden Tätigkeiten, Altersgruppen sowie dem Grad der Pflegebedürftigkeit (vgl. Sewtz 2006: 131). Gesundheits- und Krankenpflegekräfte sind dabei eigenverantwortlich für den Prozess der Leistungserbringung, also für die eigentliche Pflege am Patienten, verantwortlich. In diesem Rahmen erheben sie den Pflegebedarf, planen pflegerische Handlungen, evaluieren diese Pflegehandlungen abschließend und tragen so zur Qualitätssicherung im Gesundheitswesen bei. Zudem sind Pflegekräfte nicht nur beratend, anleitend und unterstützend für Patienten, sondem auch für deren Angehörige tätig und fördern durch ihre Arbeit die Selbstständigkeit der Patienten (vgl. MfGuV 2010: 9).
Im Laufe der Zeit hat sich die Gesundheits- und Krankenpflege zu einer Disziplin entwickelt, die Wissen um die Gesunderhaltung sowie die Krankheitsbewältigung produziert und verbreitet (vgl. Schroeter 2006: 55). Neue Herausforderungen für das Berufsfeld entstehen vor dem Hintergrund des medizinisch-technischen FortSchritts, des demografischen Wandels und auch eines veränderten Krankheitspanoramas (vgl. Schroeter 2006: 69). In der Bundesrepublik Deutschland waren im Jahr 2015 nach Zahlen der Gesundheitsberichtserstattung des Bundes rund 927.000 Gesundheits- und Krankenpflegekräfte beschäftigt. Die Geschlechterverteilung zeigt mit 85 Prozent zu 15 Prozent eine deutliche Überzahl weiblichen Personals (vgl. GBE 2017). Dies sind zu erwartende Zahlen, denn noch immer wird Pflege als klassischer Frauenberuf angesehen (vgl. Oertle Bürki 2008: 44). Die Berufszulassung zur Gesundheits- und Krankenpflege sowie Ausbikhmgs- und Prüfungsordnung sind auf Bundesebene festgelegt, während die Ausführung der Gesetze, Ordnungen, Lehrpläne und Qualitätsanfordemngen den Ländern vor-behalten sind. Dies führt zu teils stark voneinander abweichenden Ausbildungen innerhalb Deutschlands (vgl. GVG 2011: 50).
Die Ausbildungen zur Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie deren Hilfsberufe werden gemeinschaftlich vom Krankenpflegegesetz erfasst. Mit dem Krankenpflegegesetz von 2004 wurde erstmals die Möglichkeit geschaffen, die Ausbildungen zu ändern und neben den drei pile- gerischen Kembemfen, zu denen ebenso die Ahenpflege gehört, auch Ausbildungsmodelle zu schaffen, die über Altersgrenzen von Patienten hinweg ausbilden. Diese Modelle bieten zunächst eine gemeinsame Grundausbildung über zwei Jahre, um dann im letzten Ausbildungsjahr für eine Spezialisiemng der Auszubildenden zu sorgen (vgl. Krampe 2009: 16 f.).
Im Gesetzentwurf zur Pflegeausbildung vom April 2017 wurde beschlossen, die generalistische Pflegeausbildung für die Berufe der Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege und ebenso der Ahenpflege flächendeckend und verpflichtend einzuführen. Ein Einzelabschluss in Gesundheits- und Krankenpflege wird somit, anders als in den Bereichen der Kinder- und Ahenpflege, nicht mehr möglich sein (vgl. Maas 2017). In einer Pressemitteilung äußert sich Andreas Westerfellhaus,
Präsident des Deutschen Pflegerates (DPR), dazu wie folgt: ״Der Deutsche Pflegerat bedauert das Scheitern der großen Reform der Pflegeausbildung. Den ... gefundenen Kompromiss zum Pflegeberufereformgesetz sieht der DPR als ersten Schritt einer Reform an ... . Für die Krankenpflege ist es ein größerer, für die Alten- und Kinderkrankenpflege leider aber nur ein kleiner Schritt, um die Pflegeberufe zukunftssicherer zu machen und damit die Patientensicherheit zu gewährleisten“ (DPR 2017).
Erklärungsansätze, warum die Einzelabschlüsse in den Bereichen der Alten- sowie der Kinderpflege auch im neuen Gesetzentwurf erhalten bleiben, zeigen vergangene Diskussionen. Vertreter der Altenpflege sorgten sich schon in den 1990er-Jahren im Rahmen der Generalisierung um eine Deprofessionalisierung des eigenen Berufes und auch die Kinderkrankenpflege betonte immer wieder die Unabdingbarkeit einer Schwerpunktsetzung auf Vertiefungsbereiche der Pädiatrie (vgl. Moses 2015: 135).
Die allgemeine Krankenpflege selbst bildete seit den 1960er-Jahren viele Berufszweige heraus. Zu nennen sind hier zum Beispiel die Intensiv- und Anästhesiepflege, die onkologische Pflege sowie die psychiatrische Pflege. Unter dem Ökonomischen Druck des sich wandelnden Gesundheitswesens Anfang der 1990er- Jahre entstanden neue, mit der Krankenpflege verwandte Berufsfelder. Da die Spezialisierung durch Zusatzausbildung zu lange dauerte, entstand zunächst der Beruf des Operationstechnischen Assistenten und anschließend der des Techni- sehen Assistenten im Endoskopiebereich (vgl. Krampe 2009: 18 f.). Darüber hinaus entstehen fortlaufend neue Möglichkeiten zu weiterführenden Spezialisierungen, die allerdings je nach Bundesland voneinander abweichen und teilweise in anderen Bundesländern nicht anerkannt werden (vgl. GVG 2011: 56). ״Je nach Aufgabenbereich bewegt sich die Pflege in großer Nähe zu den Bereichen Medizin, Betriebswirtschaft oder sozialer Arbeit und seit einiger Zeit auch Public Health“ (Krampe 2009: 25).
Im Zuge der Professionalisierungsbestrebungen kamen die ״Handlungsfelder ... der präventiven, rehabilitativen und kurativen Patientenzentrierung auf der Mikro, Meso- und Makroebene der Gesellschaft“ (Neumann 2009: 10) zum Berufsbild hinzu. Das Arbeitsfeld beruflich Pflegender ist heute gerade im ambulanten Sektor diversifizierter denn je. So arbeiten Pflegekräfte als Freiberufler, als Angestell- te in Krankenhäusern, Pflegediensten und Sozialstationen der Wohlfahrtsverbände und zunehmend auch in ambulanten Einrichtungen der Krankenhäuser (vgl. Krampe 2009: 23). Weitere Beschäftigungsbereiche finden Krankenpflegekräfte zudem in Arztpraxen, bei Blutspendediensten, in humanitären Organisationen und auch bei Krankenkassen sowie Gesundheitsbehörden (vgl. MfGuV 2010: 9). Gerade durch die verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten zeichnen sich die Berufsverläufe durch eine hohe innerberufliche Mobilität aus, die sich in häufigen Arbeitsplatzwechseln zeigt (vgl. Krause 2007: 10).
Eine Schwierigkeit der Pflege besteht darin, dass die Gesellschaft nicht erkennt, welche zentrale und einzigartige Dienstleistung der Beruf darstellt. Wertschätzung erhält die Pflegekraft für ihre Fürsorge und Betreuung und so zeigt auch die DarStellung derer fast immer in die altruistische und fürsorgliche Richtung (vgl. Bernhard, Walsh 2000: 4 ff.). Jahrzehntelang war die Krankenpflege eng mit christlich-religiösen Gemeinschaften verbunden. Ausbildungsfragen wurden vor dem Hintergrund dieses Zusammenhanges diskutiert. Die gute Krankenschwester definierte sich nicht durch ihre Ausbildung, sondern durch ihre Berufung zur Barmherzigkeit (vgl. Moses 2015:10). Nach Martin Dinges hängt das Schattendasein der Pflege auch mit ihrem beruflich sowie fachlich ungesicherten Status zusammen.
Pflege steht institutionell zwischen den Stühlen, sie ist weder ein richtiger Lehrberuf noch Gegenstand eines Studiums (vgl. Dinges 2015: 7). ״Das Streitgespräch zwischen Pflegekräften und Außenstehenden über die Frage, ob die Krankenpflege ein eigenständiger Beruf ist oder nicht, ist noch nicht beendet“ (Bernhard, Walsh 2000: 1).
2.1 Historische Entwicklung professioneller Pflege in Deutschland
״Die Geschichte der Pflege ist lang, die des Pflegeberufes hingegen Vergleichsweise kurz“ (Schroeter 2006: 43). Zudem ist die Pflegegeschichte vielfältig und nicht nur stark mit den Disziplinen der Medizingeschichte, der Kirchen- und Religionsgeschichte sowie der Frauen- und Geschlechtergeschichte verbunden, sondem auch mit der Sozial- und Alltagsgeschichte (vgl. Schweikardt 2008: 296). Im 17. Jahrhundert fanden große wirtschaftliche wie auch gesellschaftliche Wandlungsprozesse statt und der Arzt war im Rahmen dieser Wandlungsprozesse erstmals auf der Suche nach einer Person, die die Pflege der Kranken in seinem Sinne übernahm. Der Arzt wollte in den unruhigen Zeiten seinen Stand und Status definieren und fand eine passende, ihm untergebene Person im Krankenwärter. Arbeitspraktische wie auch charakterliche Zuschreibungen aus dieser Zeit blieben auch während der nächsten zwei Jahrhunderte unverändert (vgl. Panke-Kochinke 2001: 23).
Erneut waren es gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die mit der Industrialisierung sowie intensiven kriegerischen Auseinandersetzungen einhergingen und als Entstehungsbedingungen der beruflichen Pflege im 19. Jahrhundert gelten (vgl. Wanner 1987: 25). Geschichtlich gab es drei große Gruppen, aus welchen sich die berufliche Krankenpflege entwickelte: religiöse Verbände und Orden, konfessionslose Zusammenschlüsse bürgerlicher Frauen sowie ungebildete Schichten, die den Beruf lediglich zum Broterwerb ausführten (vgl. Schweikardt 2008: 23).
Die berufliche Krankenpflege in Deutschland entwickelte sich hauptsächlich aus dem kirchlichen Mutterhaussystem, das bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die einzig denkbare Form der Krankenpflege darstellte (vgl. Schroeter 2006: 45). Für Krankenschwestern bedeutete das Mutterhaussystem aber vor allem eines: Abhängigkeit, Unselbstständigkeit sowie ständige Verfügbarkeit bei einem völlig unzureichenden Lohn (vgl. Bischoff 1997: 127). ״Das Motto des Aufopferns und Dienens verhinderte lange Zeit eine Qualifizierung des Berufes der Krankenpflege“ (Sewtz 2006: 133). Die geringe Bezahlung, fragwürdige Arbeitsbedingungen und Undefinierte Tätigkeitsfelder prägten die Pflege bis in den Ersten Weltkrieg hinein (vgl. Lauber 2012: 55).
Bestrebungen Einzelner, die Krankenpflege zu einem angesehenen Beruf zu machen, wurden stark von Konflikten zwischen verschiedenen Verbänden und Interessengruppen überlagert. So schwächte sich die Pflege selbst, bevor überhaupt ein eigenständiges Berufsbild entstehen konnte (vgl. Schweikardt 2008: 276). Die Entwicklung der Pflege zu einem qualifizierten Beruf hatte in Deutschland zu diesem Zeitpunkt, im Gegensatz zu Ländern wie Großbritannien oder den USA, nie eine Chance (vgl. Schweikardt 2008: 278).
Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die ersten Züge einer vollwertigen und einheitlichen Ausbildung erkennbar. In Preußen wurden im Jahr 1907 Ausbil-dungsinhalte sowie Prüfungsbestimmungen festgelegt und die Pflege entwickelte sich stark in Richtung medizinischer Assistenz, da Ärzte als Lehrer bzw. Vorge-setzte die Ausbildungsinhahe maßgeblich festlegten (vgl. Bögemann-Großheim 2011: 15 f.). Diese Entscheidungen über den Krankenpflegeberuf, welche in Deutschland noch vor dem Ersten Weltkrieg fielen, tragen wesentlich zum Ver- ständnis des Berufsbildes und seiner Problemfelder im 21. Jahrhundert bei (vgl. Schweikardt 2008: 12).
Mit dem Krankenpflegegesetz von 1938, das weitgehend auf dem Gesetz von 1907 fußte (vgl. Moses 2015: 14), wurden erstmals einheitliche AusbildungsbeStimmungen und Standards festgelegt. So mussten Pflegeschüler bei der Aufnahme das 18. Lebensjahr vollendet und die Schule mit dem Volksschulabschluss beendet haben. Zudem musste der Nachweis über eine mindestens einjährige hauswirtschaftliche Tätigkeit erbracht werden. Die eigentliche Ausbildung dauerte anschließend eineinhalb Jahre (vgl. Kreutzer 2005: 231 f.). 1942״ wurde dann reichsweit eine zweijährige Ausbildung eingeführt, und das Krankenhauspraktikum entfiel“ (Schweikardt 2008: 294).
Die Nationalsozialisten trieben ihre ideologische Gleichschaltung auch in der Ausbildung des Pflegepersonals voran und drängten christliche wie auch demokratische Werte in den Hintergrund. Das Gesetz zur Ordnung der Krankenpflege von 1938 sah demnach mindestens 200 Stunden theoretischen Unterricht vor, wovon wiederum mindestens 25 Prozent eindeutig der Vermittlung nationalsozialistischer Ideologien gewidmet sein sollten (vgl. Ulmer 2016).
Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges galt das erlassene Gesetz innerhalb der neu gegründeten Bundesrepublik fort, natürlich mit Ausnahme der rassistischen und antisemitischen Passagen. Erst mit dem 1957 umgesetzten Krankenpflegegesetz wurde eine dreijährige Ausbildung eingeführt. Das blieb jedoch die größte Neuerung und auch die Folgegesetze von 1965 und 1985 brachten keine entscheidende Veränderung (vgl. Schweikardt 2008: 294).
Im Zuge der Veränderungen durch das bundeseinheitliche Gesetz von 1957 sperrten sich die Mutterhausverbände dagegen, nur examinierte Schwestern zu beschäftigen, und auch die Gewerkschaften setzten sich weiter für möglichst niedrige Zulassungsbestimmungen ein (vgl. Moses 2015: 15). Ein Grund dafür ist im ausgeprägten Personalmangel in der Krankenpflege ab Mitte der 1950er-Jahre zu sehen, der auf einen Ausbau der Krankenhausinfrastruktur und eine zunehmende Emanzipierung der Frauen zurückzuführen war (vgl. Kreutzer 2005: 24). Zudem verringerte sich die Arbeitszeit im Laufe der Jahre 1956 bis 1974 von anfangs 54 Wochenarbeitsstunden auf schließlich 40 Wochenarbeitsstunden (vgl. Moses 2015: 17). Im Weiteren ist durch diese Umstände wohl auch die Einführung der beruflichen Krankenpflegehilfe mit der Novellierung des Jahres 1965 zu erklären (vgl. Schroeter 2006: 46).
Zumindest wurden ab Ende der 1950er-Jahre Lehrgänge für die sogenannten Un- terrichtsschwestem deutlich ausgebaut. Die von der Deutschen Krankenhausge- Seilschaft veröffentlichten Empfehlungen zur Fort- und Weiterbildung von Krankenschwestern gingen 1963 weit über die Anforderungen des Krankenpflegege- seizes von 1957 hinaus (vgl. Kreutzer 2005: 250 f.). Im Jahr 1966 kam es zu einer neuen Ausbildungs- und PrüfungsVerordnung. Nun musste mindestens ein RealSchulabschluss nachgewiesen werden und die Zahl der theoretischen Stunden wurde auf mindestens 1200 erhöht (vgl. Moses 2015: 18).
In den 1960er- und 1970er-Jahren lag der Schwerpunkt auf der Verberuflichung der pflegerischen Arbeit. Inhaltlich ging es um einen Wandel der Strukturen, der Arbeitsinhalte und der Arbeitsbedingungen. Allerdings trug dies nur wenig zur Lösung bestehender Probleme bei. Während der 70er-Jahre kam es zu einem deutliehen Zugewinn an medizinisch-naturwissenschaftlichen Kenntnissen, allerdings nicht zu einer Weiterentwicklung des pflegerischen Berufsbildes.
In den 80er-Jahren begann die Pflege sich mit sich und ihrem Selbstverständnis zu befassen. Es kamen Forderungen zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zu neuen Aus- und Weiterbildungskonzepten auf. Im Rahmen dieser Emanzipationsanstrengungen wurde auch die hierarchische Arbeitsteilung zwischen Ärzten und Pflegekräften problematisiert (vgl. Reinhart 1999: 31 ff.). Seither verstärkte sich also auch in Deutschland die Debatte um die Professionalisierung der Pflege. Als Vorbilder galten sowohl Großbritannien als auch die USA - in beiden Ländern war und ist die Ausbildung an Universitäten gebunden und es gab bereits eine international anerkannte Pflegeforschung (vgl. Schweikardt 2008: 11). ״Die Krankenpflege wurde mehr und mehr als professionell betriebener Beruf wahrgenommen, dem es gelungen sei, sich zwischen beruflicher Lohnarbeit und traditionell gewachsenen Formen zu etablieren“ (Moses 2015: 37).
Doch wie schwer sich Deutschland in der Entwicklung der beruflichen Pflege weiterhin tat, zeigt die Umsetzung einer Richtlinie der EG von 1977. Die darin geforderte gegenseitige Anerkennung der Berufsabschlüsse, konnte aufgrund kontroverser Diskussionen zwischen den deutschen Interessengruppen erst im Jahre 1985 umgesetzt werden (vgl. Moses 2015: 27). Das 1985 verabschiedete Krankenpflegegesetz trug schließlich den europäischen Forderungen Rechnung, gab erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik definierte Ziele für den Beruf vor und forderte den Erwerb pflegerischer Handlungskompetenzen (vgl. Stöcker 2002: 22 f.). Seit den 1990er-Jahren wird die Pflege in Deutschland zunehmend wissenschaftlich betrachtet und es fließen entsprechende Theorien und Modelle in die Pflegepraxis ein (vgl. Sewtz 2006: 136). Als Impuls zu dieser wissenschaftlichen Betrachtung erwies sich die Wiedervereinigung Deutschlands.
In der DDR gab es bereits seit den 1960er-Jahren einen Fachstudiengang für Medizinpädagogen und seit den 1970er-Jahren einen für Leitungsaufgaben qualifizie-renden universitären Diplomstudiengang (vgl. Moses 2015: 40). So konnten in der DDR in der Regel nach abgeschlossener Berufsausbildung Abschlüsse in Pflege-pädagogik, in den Pflegewissenschaften und im Pflegemanagement erworben werden (vgl. GVG 2011: 55).
Die Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts standen folglich ganz im Zeichen von Höherqualifizierung und berufli- eher Aufwertung (vgl. Bals 2002: 132). Das Krankenpflegegesetz von 2004 ״... definiert [nun] erstmals eigenverantwortlich durchzuführende Aufgaben als pile- gerische Kemkompetenzen, während eine von führenden Vertreterinnen des Pile- gebendes geforderte Akademi si erung im Gesetz nicht vorgesehen ist“ (Schwei- kardt 2008: 294 f.).
Die Krankenpflege scheint im Jahr 2017 trotz der fortschreitenden Akademisie- rung nicht viel weiter zu sein als vor zwanzig Jahren. Diskutiert wird weiter über neue, eigenständige Aufgaben vor dem Hintergrund des sich verändernden Gesundheitswesens. Der Ruf nach Akademisierung und Professionalisierung ist laut, doch ein Mangel an Personal besteht noch immer (vgl. Moses 2015: 157). ״Die Geschichte der Krankenpflege als Beruf ist noch nicht geschrieben worden. Dazu bedarf es umfassender Forschungen, die die Pflegewissenschaft erst noch leisten muß [sic!]“ (Panke-Kochinke 2001: 15).
2.2 Pflege als Hilfstätigkeit für die Ärzteschaft
״Kein anderer Beruf hat für die Entwicklung der Krankenpflege und deren Ausbildungssektor eine ähnlich weitreichende Bedeutung erlangt wie die Medizin“ (Wanner 1987: 33). Die beiden Professionen der Medizin und der Pflege waren und sind eng miteinander verknüpft, wobei die Pflege als Komplement zur Medi-zin konzipiert wurde. Historisch betrachtet erlangte die Pflege erst durch die Nähe zur Medizin und durch die Dominanz der Ärzteschaft ihr bis ins beginnende 21. Jahrhundert anhaltendes niedriges Prestige (vgl. Sewtz 2006: 134). Die Beziehung zwischen Pflege und Medizin ist dabei allerdings nicht natürlichen Ursprunges, sondem historisch gewachsen (vgl. Wanner 1987: 33).
Bereits im 17. Jahrhundert trat das Amt des weisungsempfangenden Krankenwärters in das Blickfeld der Ärzte. Diese benötigten einen Menschen, der die Pflege des Kranken nach ärztlichen Vorstellungen übernahm, um so seinen eigenen Stand und Status zu definieren und letztlich zu sichern. Treue und Fleiß in der Arbeit, Zuschreibungen, die die Erwartungen der Ärzte an Pflegende beschrieben, blieben folgend auch im 18. und 19. Jahrhundert zentraler Bestandteil, wenn es darum ging, das Idealbild der Pflegenden so zu beschreiben, dass es in die Rolle der ärztlichen Hilfstätigkeit passte (vgl. Panke-Kochinke 2001: 23).
Johann Storch definierte im 18. Jahrhundert Arbeitsfelder der Pflege, deren AusWirkungen bis in die Gegenwart verfolgt werden können. So argumentierte er, dass derjenige, der die Anweisungen des Arztes Umsetzen will, sich strikt an Regeln halten muss. Die Pflegekraft soll in der Lage sein, Kranke nach einem vom Arzt bestimmten Schema zu beobachten, diese Beobachtungen wahrheitsgemäß wiederzugeben und angemessene Fragen zu stellen. Sie darf allerdings nichts ohne Anweisungen des Arztes unternehmen. Alles, was die Pflegekraft in Eigeninitiative entscheidet, wurde aussortiert und in den Bereich des gefährlichen Aberglaubens verwiesen (vgl. Panke-Kochinke 2001: 25f.).
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts reklamierten Ärzte die Pflege als ihr eigenes Spezialgebiet, wollten verantwortlich sein für deren Weiterentwicklung und so Pflege als ihren eigenen Hilfsberuf festigen (vgl. Schweikardt 2008: 278). So entstand bei den Pflegenden bereits früh das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden, und es scheint noch im Jahre 2017 das typische Erbe der Pflegeberufe zu sein, als Hilfskraft angesehen zu werden. Historisch befanden sich Pflegende immer in einer untergeordneten und dienenden Rolle. Damit lässt sich ein mangelndes Selbstwertgefühl erklären, gemischt mit der Angst, vom Arzt bloßgestellt zu werden: verbunden mit der Befürchtung, dass die eigene Meinung nicht zählt (vgl. Teige- 1er 2017: 14).
Noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts lassen sich innerhalb des Gesundheitssystems starke Hierarchisierungen ausmachen - noch immer genießt der Arzt in unserer Gesellschaft höchstes Ansehen, während Pflegekräfte relativ wenig WertSchätzung erfahren (vgl. Sewtz 2006: 10). Allerdings ist zu beobachten, dass sich auch das Ansehen des Arztes ändert. Wurden rzte huflg als ״Otter in Weiß“ bezeichnet, wandelt sich auch hier das Image hin auf das Normalmaß eines anspruchsvollen Handlungsauftrages. Leider macht das alleine die Pflege in ihrer Beschaffenheit nicht attraktiver (vgl. Schmidt-Jortzig 2009: 92).
Der amerikanische Medizinsoziologe Eliot Freidson beschrieb in einer Studie von 1970 den Aufstieg des Berufsstandes der Ärzte an die Spitze des Gesundheitswesens. Demnach gelang es den Ärzten, durch staatliche Unterstützung und UnterStützung ihrer eigenen Berufsorganisation, das Recht zu erlangen, die Arbeitsteilung auf dem Gebiet der Medizin zu bestimmen (vgl. Schweikardt 2008: 15). Vonseiten der Ärzteschaft wird auch aufgrund von hierarchischen Strukturen im Gesundheitswesen der Pflegeberuf häufig als medizinischer Assistenzberuf oder auch nicht-akademischer Gesundheitsberuf bezeichnet (vgl. Schroeter 2006: 55). Zudem führen die bereits beschriebenen hierarchischen Strukturen zu einer zunehmenden Unzufriedenheit der pflegerischen Mitarbeiter. Der Chefarzt ist noch viel zu häufig der ״Gott“ seiner Abteilung, seine Entscheidungen dürfen selbst dann, wenn sie offensichtlich falsch sind, nicht offen infrage gestellt werden (vgl. Heidenreich 2009: 177). Eine offene Kommunikationskultur ist so in der Klinik nicht realisierbar, was wiederum zu mehreren Problemen führt. ״Denn eine ineffiziente und unzureichende Kommunikation kann im Krankenhaus fatale Folgen haben. Aufseiten der Patienten gehören dazu verzögerte Behandlung, Fehldiagnosen, unerwünschte Patientenereignisse bis zum Tod des Patienten. Aufseiten der Mitarbeiter resultieren aus einer schlechten Kommunikationskultur nicht nur eine miese Stimmung, sondern auch eine höhere Erkrankungsrate, Fluktuation bis hin zumBurn-out“ (Teigeier 2017: 14).
Eine intensive und kollegiale Zusammenarbeit auf Augenhöhe führt hingegen zu einer erhöhten Versorgungsqualität und einer verbesserten Arbeitszufriedenheit aller Beteiligten (vgl. GVG 2011: 42). Mit Pflegekräften auf Augenhöhe arbeiten und kommunizieren, dass müssten Ärzte, wenn auch Pflegekräfte über einen akademischen Abschluss verfügen. Allerdings wird hier bereits Ablehnung signāli- siert, da dadurch die gewohnte Assistentenfunktion der Pflege für den Arzt hinfällig wäre (vgl. Teigeier 2012: 1023).
Im Rahmen der Vorbereitungen des neuen Krankenpflegegesetzes um die Jahrtau-sendwende drängten sowohl Pflegewissenschaftler als auch Pflegeverbände da-rauf, die Pflege als eine von der ärztlichen Verordnung unabhängige Leistung zu etablieren. Erwartet wurde dies, weil die Zahl der Personen, die zwar Pflege, aber keine ärztliche Versorgung benötigt, steigt. Zudem sind Modelle, in denen Pfle-gende in Bezug auf Pflegehilfsmittel verschreibungsbefugt sind, in Ländern wie Schweden, Großbritannien und den USA seit Längerem etabliert. Da ein solches Modell in Deutschland nicht durchsetzbar war, zementiert sich die Dominanz der Medizin über die Pflege selbst da, wo sie dysfunktional geworden ist. So wurde der Pflege auch nach der Jahrtausendwende eine wesentliche Vorbedingung auf dem Weg zum eigenständigen Beruf vorenthalten (vgl. Krampe 2009: 13).
״[Denn] das 2004 novellierte Krankenpflegegesetz erlaubte .. Pflege weiterhin nur auf ärztliche Anordnung“ (Moses 2015: 160).
Zunehmend zeigen auch die Finanzen ihr Konfliktpotenzial in der Beziehung zwi- sehen beiden Berufsgruppen. Ärzte erkämpften sich bekanntermaßen deutlich höhere Tariflöhne, sodass für die Pflegekräfte vom Gesamtbudget der Krankenhäuser kaum etwas übrig bleibt (vgl. Gaede 2012: 52). So stiegen die Personalkos-ten im pflegerischen Bereich der Krankenhäuser von 2002 bis 2010 um rund 6 Prozent, während im gleichen Zeitraum ein Anstieg der Personalkosten im ärztli-chen Bereich von rund 52 Prozent zu verzeichnen war (vgl. DIP 2012: 13 f.). Vor dem Hintergrund der Akademisierung fürchtet die Ärzteschaft Gehaltseinbu-ßen, denn wenn sowohl für Pflegekräfte wie auch für Mediziner ein Studium vo-rausgesetzt wird, müssten Angehörige beider Professionen bei gleichbleibendem Personalbudget die gleiche Entlohnung erhalten (vgl. Teigeier 2012: 1023). Regu-liert und abgesichert durch eigene Körperschaften und staatlich legitimiert durch Gesetze und Verordnungen, erhält sich die Ärzteschaft allerdings eine umfassende Vorherrschaft gegenüber Pflege- und Gesundheitsberufen (vgl. Schroeter 2006: 56). Hier zeigt sich die Notwendigkeit der Organisierung und Akademisierung des Berufsfeldes. ״Nur wenn die Pflegepraxis wissenschaftlich fundiert wird und ohne ärztlichen Einfluss agieren kann, können Pflegende eigenverantwortlich neue Aufgaben übernehmen“ (Moses 2015: 11). Ob die Pflegekräfte überhaupt gewillt sind, neue Aufgaben bei sinkenden Ressourcen zu übernehmen, bleibt dabei aller-dings fraglich (vgl. Cassier-Woidasky 2011: 168).
2.3 Problemfelder der Gesundheits- und Krankenpflege
״Probleme des Arbeitsfeldes Pflege [sind vielschichtig und] werden .. sowohl in personellen Ressourcen, im Umfeld und seinen Anforderungen, in der Arbeitsorganisation und in der Organisation der Pflege selbst verortet“ (Sewtz 2006: 140). In der öffentlichen Wahrnehmung wird die Krankenpflegekraft häufig leider nur mit TV-Sendungen wie ״Für alle Fälle Stefanie“ assoziiert: Darin ist die KrankenSchwester vor lauter Berufung den ganzen Tag damit beschäftigt, Probleme ihrer Patienten zu lösen, zu helfen, mitzuleiden und aus diesem Grunde wahrscheinlich nicht in der Lage, verantwortungsvolleren Tätigkeiten nachzukommen (vgl. Hasseler, Meyer 2006: 52 f.).
Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Pflegeberufe vereinen nahezu alle Belastungsfaktoren in ihrem Berufsfeld. So kommt zu den körperlichen und psychi- sehen Belastungen, die der Arbeitsalltag hervorbringt, noch die Schichtarbeit hinzu (vgl. Heidenreich 2009: 205). Aufgrund dieser Belastungen verlässt eine Vielzahl der Pflegekräfte den Beruf frühzeitig und Nachwuchskräfte bleiben aus. Der Pflegekräftemangel ist ein bis dato ungelöstes und bundesweites Problem (vgl. Fricke2013: 1).
So wies die Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit zum Jahresende 2016 einen Mangel an Gesundheits- und Krankenpflegekräften in nahezu allen 16 Bundesländern aus. Die Vakanzzeit für zu besetzende Stellen lag zum Jahresende 2016 bei 132 Tagen und rechnerisch kamen auf 64 Arbeitslose 100 offene Stellen. Dies ist, gemessen an den reinen Zahlen, nochmals eine Verknappung zum Vorjahr (vgl. BA 2016: 13). ״Zugleich nimmt aufgrund der demographischen Entwicklung das Arbeitskräftepotential in Deutschland insgesamt nach allen Vorausschätzungen ab“ (GVG 2011: 31). Auf der anderen Seite steigt die Arbeitsbelastung durch höhere Fallzahlen sowie kürzere Verweildauern in den Kliniken (vgl. GVG 2011: 41). Dazu kommen immer höhere Erwartungen von Patienten und deren Angehörigen (vgl. Heidenreich 2009: 2).
All diese Umstände haben zur Folge, dass der Pflegeberuf in der öffentlichen Wahrnehmung nicht attraktiver ist. Denn niemand möchte gerne einen Beruf erlemen, über den so negativ berichtet wird (vgl. Müller 1994: 11). Im Vergleich mit anderen europäischen Staaten und dem angloamerikanischen Raum erscheint die deutsche Pflege wenig zeitgemäß und überholt. Möglichkeiten der Modemi- sierung werden seit vielen Jahrzehnten unter dem großen Begriff der Professiona- lisiemng thematisiert (vgl. Moses 2015: 12).
Doch die größten Einschnitte entstanden nicht durch eine rasch fortschreitende Professionalisierung der Pflege, sondern durch die unzähligen Reformen und Reformvorhaben, die auf eine effizientere Leistungserbringung und verbesserte institutionelle Rahmenbedingungen abzielten (vgl. Sewtz 2006: 9). Wie sich dies im Arbeitsalltag äußert, zeigt das Zitat von Katja Thimm: ״Unbarmherzig aber sind die Sackgassen, die paradoxen Mechanismen: Wenn Ärzte, Pfleger und KrankenSchwestern ihren Patienten wegen betriebswirtschaftlicher Vorgaben nicht die Zeit widmen, die sie selbst für nötig halten. Wenn Kostendmck zu neuen Kosten führt, weil am Anfang eines Jahres festgelegt wird, wie ausgelastet eine Klinik im De-zember sein soll“ (Thimm 2017: 54).
Der zunehmende ökonomische Druck hat eine zunehmende Überforderung der Pflegekräfte zur Folge. So entstand ein Teufelskreis aus häufigen Krankheitsfällen, Frustration und mangelndem Nachwuchs (vgl. Heidenreich 2009: 5). Als Lösungsvorschlag für die Probleme innerhalb des Gesundheitswesens werden häufig die gesellschaftliche Aufwertung der Beschäftigten, verbesserte Arbeitsbedingungen durch ausreichend Personal, arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeitmodelle und die Etablierung von Karrieremöglichkeiten genannt (vgl. Sewtz 2006: 14). Allerdings ist es auch zum Ende der 2000er-Jahre noch so, dass die Begriffe ״Pflegebe- ruf‘ und ״Attraktivität“ ein Paradoxon für die deutsche Bevölkerung ergeben (vgl. Fajardo 2013: 38). Zudem werden aufgrund des deutlich ausgebauten teilstationären sowie ambulanten Bereiches immer stärkere Spezialisierungen der Pflegenden notwendig.
Die Arbeitsbereiche haben sich unter dem ökonomischen Druck deutlich diversi- fiziért (vgl. Krampe 2009: 23). Pflegende haben dabei immer intensivere Aufgabenbereiche übernommen. Allerdings hinkt ihr Ansehen, auch aufgrund der fehlenden akademischen Grundausbildung und der Konzipierung rund um den ärztlichen Beruf herum, den Anforderungen an das Berufsfeld hinterher (vgl. Sewtz 2006: 140). Die beschriebenen Umbrüche sind mit zusätzlichen Unsicherheiten und Unklarheiten verbunden, und der Wunsch vieler Pflegender richtet sich auf klare rechtliche Regelungen (vgl. GVG 2011: 42).
Doch noch heute ist in Deutschland nicht einmal klar geregelt, welche pflegerisehen Tätigkeiten Fachpersonal Vorbehalten sind (vgl. GVG 2011: 44). Ein weiteres, bereits angeschnittenes Problem, das die Berufsangehörigen von gleich zwei Seiten betrifft, ist der demografische Wandel. Viele Gesellschaften - nicht nur die deutsche - werden in diesem Jahrhundert einen explosionsartigen Anstieg der Hochaltrigen verkraften müssen. Hinzu kommt der Wandel der Familienstrukturen und der damit einhergehende Trend zur Singularisierung (vgl. Schroeter 2006: 10 ff.). Selbst in konservativen Szenarien, die von sinkenden Pflegequoten einer alternden Gesellschaft ausgehen, ist bis ins Jahr 2050 eine Zunahme der pflegebedürftigen Personen um 57 Prozent zu erwarten (vgl. GVG 2011: 15). Dieser gesellschaftliche Umbruch benötigt auch eine veränderte Pflege, qualitativ wie quantitativ.
Doch der Politik fällt es schwer, die Problemlagen in ihrer Komplexität zu erfassen und zielgerichtete wie auch umfassende Lösungen zu präsentieren. Pflegepolitisch wird über das Recht auf berufliche Bildung daher auf einem Niveau wie um das Jahr 1900 diskutiert (vgl. Stöcker 2002: 11). Der Gesundheits- und Pflegebereich ist ein bedeutendes Berufsfeld und gleich mehrere Faktoren wie die demografische Entwicklung, Qualitätssteigerung der Gesundheits Versorgung und ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend zum Gesundheitsbewusstsein sprechen dafür, dass seine Bedeutung noch weiter steigen wird.
Die Bedeutungszunahme schlägt sich auch in dem allgemeinen Wunsch nach adäquaten Qualifizierungen nieder (vgl. Gruber, Kastner 2005: 9). Doch noch immer wird pflegerische Arbeit auf handwerkliches Tun reduziert, in dem aufgrund mangelnder Qualifizierung eigenständiges Denken und Planen nicht vorgesehen sind (vgl. Moses 2015: 11).
Zwischen den Jahren 1998 und 2010 sank die Arbeitszufriedenheit von Pflegeper- sonai nach einem Gutachten des rheinisch-westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung mit dem Arbeitsklima und der Personalausstattung, und auch grundsätzlich besteht ein deutlicher Zusammenhang der Arbeitszufriedenheit und der Anzahl der Mitarbeiter im Arbeitsbereich (vgl. Augurzky et al. 2016: 74). Doch gerade im Zuge der Einführung von Fallpauschalen, sogenannten DRGs, sank das Personalbudget und damit die personelle Ausstattung im Pflegebereich deutlich (vgl. Braun et al. 2009: 71). Zwischen den Jahren 1997 und 2007 wurden rund 13,5 Prozent der Personalstellen im Pflegebereich abgebaut (vgl. Cassier- Woidasky 2011: 168). Infolgedessen stieg die Arbeitsbelastung, Überstunden und Krankheitsausfälle nahmen zu (vgl. GVG 2011: 35).
Das alles geschah vor dem Hintergrund seit Jahren steigender Fallzahlen, immer älterer wie zugleich multimorbiderer Patienten und fortschreitender Medizintechnik. Die Ärzte konnten durch starke Verhandlungsrunden des Marburger Bundes zusätzliche Stellen wie auch einen deutlichen Gehaltsanstieg durchsetzen. All das kostete viel Geld und so stiegen die Ausgaben der Krankenkassen für Klinikbehandlungen seit 2006 um fast 50 Prozent auf rund 73,3 Milliarden. Ein Ende der Kostenspirale ist nicht abzusehen (vgl. Thimm 2017: 46). Der Druck zur radikalen Erneuerung der pflegerischen Praxis ergibt sich zum einen aus den externen Zwängen und den strukturellen, epidemiologischen sowie technischen Verände-rungen im Gesundheitswesen und zum anderen aus einer innerberuflichen Not-Wendigkeit heraus, die Qualität der Pflege zu verbessern, um den veränderten Rahmenbedingungen gerecht zu werden (vgl. Krampe 2009: 106 f.).
Nach Susanne Sewtz wird eine erfolgreiche Professionalisierung der Pflege an einer Laiensanktionierung und an beruflicher Autonomie festgemacht. Von bei- dem ist die Pflege allerdings noch sehr weit entfernt. Pflege ist weisungsgebunden und umfänglich von der Medizin abhängig. Weder eine spezielle Expertise noch autonome Kontrolle kann die Pflege aktuell nachweisen. Behinderungen auf dem Weg der Professionalisierung sind nach Sewtz die ausgeprägte berufspolitische Zersplitterung, die geschlechterspezifischen Traditionen sowie die inhaltliche Dif- fusität der Pflege (vgl. Sewtz 2006: 162).
Nötige Reformen hin zu mehr Qualifizierung - in Anlehnung an europäische Nachbarn wie Großbritannien oder die Niederlande - wurden immer wieder im Geflecht der vielen verschiedenen Interessen blockiert (vgl. Dinges 2015: 7).
Trotz aller Problemfelder in der täglichen Arbeit und über deren Rahmenbedingungen hinaus müssen alle Beteiligten der Pflege ihren Beitrag dazu leisten, die gesellschaftliche Bedeutung des Berufsfeldes wertschätzend darzustellen.
״Die beachtliche Leistung, die die Pflegenden erbringen, wird jedoch nicht nur von Vorgesetzten und anderen Berufsgruppen negiert, sondern auch von ihnen selber nicht als Leistung wahrgenommen. ... Wenn die eigene Leistung von anderen [allerdings] ständig negiert wird, nimmt man sie selber nicht mehr als positiv wahr“ (Cassier-Woidasky 2007: 275).
2.4 Vorzeitiger Berufsausstieg als Hauptgrund des Personalmangels
Die Llucht aus der Pflege: Mit diesem Begriff wird häufig das Phänomen der frühzeitigen Berufsaufgabe des Pflegepersonals beschrieben. Demnach ist die Verweildauer im Krankenpflegeberuf im Vergleich mit anderen Berufsgruppen extrem kurz, jedoch sind die Ursachen für den vorzeitigen Berufsausstieg weitgehend unerforscht (vgl. Sewtz 2006: 159 f.). Einen Versuch, die Gründe der frühzeitigen Berufsaufgabe von Pflegekräften zu erforschen, wurde Anfang des 21. Jahrhunderts europaweit im Rahmen der NEXT-Studie unternommen. Rund 40.000 Pflegekräfte aus zehn Ländern nahmen an der Untersuchung teil.
Dabei zeigte sich, dass deutsche Pflegekräfte zwar an ihrem Beruf hängen, aber im europäischen Vergleich deutlich häufiger mit dem Gedanken spielen, diesen zu verlassen. Nach den Erhebungsdaten der Studie denkt demnach fast jede fünfte in Deutschland beschäftigte Pflegekraft intensiv über eine Berufsaufgabe nach. Un-ter den Ausstiegswilligen finden sich sowohl junge, gut ausgebildete und zudem motivierte Pflegekräfte wie auch resignierte, gesundheitlich eingeschränkte und erschöpfte Berufsangehörige. Im Rahmen der NEXT-Studie wurde zudem ein klarer Zusammenhang zwischen den gesundheitsbelastenden Arbeitsbedingungen und dem Wunsch nach Berufsaufgabe aufgezeigt (vgl. Hasselhorn et al. 2005: 144).
Gerade bei den jungen und motivierten Berufsaussteigern mit Abitur liegt zudem die Vermutung nahe, dass sie aufgrund des hohen Numerus clausus zur Aufnahme eines Medizinstudiums mit der Pflegeausbildung lediglich die Wartezeit sinnvoll und studiennah überbrücken möchten und nach der Ausbildung ein Medizinstudium anstreben (vgl. DEKV 2004: 27 f.). Häufig suchen sich Berufsangehörige aber auch nur andere Arbeitsbereiche im Gesundheitswesen, um den schlechten Arbeitsbedingungen zu entfliehen. Nicht zu vergessen sind auch die Berufsunterbre- eher, die aus familiären Gründen für eine gewisse Zeit aus dem Berufsleben austreten (vgl. Krause 2007: 9 f.).
Viele Pflegende sind an sich hoch motiviert und würden gerne länger im Beruf verbleiben, sind allerdings enttäuscht vom beruflichen Alltag und der fehlenden Perspektive (vgl. GVG 2011: 41). Aufgrund des akuten Personalmangels werden seit den 2010er-Jahren zumindest Maßnahmen diskutiert, mit denen eine längere Verweildauer im Beruf erreicht werden kann. Dies soll nicht nur durch eine höhere Vergütung und eine Lohnspreizung, die Weiter- sowie Höherqualifizierung belohnt, sondem auch durch Rückkehrangebote für Berufsaussteiger, eine altersgerechte Arbeitsorganisation und durch die Ausweitung der Karrieremöglichkeiten erreicht werden (vgl. Augurzky et al. 2016: 76).
Ein vorzeitiger Berufsausstieg erfolgt allerdings nicht nur freiwillig. Das Durchschnittsalter der beruflich Pflegenden steigt deutlich und es ist absehbar, dass Pflegekräfte den andauernd hohen Belastungen nicht bis ins Rentenalter Standhai- ten. Letztlich werden viele Pflegekräfte auch aufgrund von Arbeitsunfähigkeit frühzeitig aus dem Bemf ausscheiden (vgl. Frerichs 2009: 58 f.). Dass das Problern der frühzeitigen Berentung zunehmen wird, zeigt sich auch vor dem Hintergrund des steigenden Durchschnittsalters der Beschäftigten. Altersbedingte VerSchleißerscheinungen werden zunehmen, wenn in wenigen Jahren mehr als 50 Prozent der Mitarbeiter älter als 50 Jahre sind (vgl. Tőiken 2007: 79). Gerade um den Berufsaustritt älterer Fachkräfte aus der Pflege zu verhindern, sind Arbeitsbedingungen und auch vertragliche Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass es möglich ist, bis zum Rentenalter gesund in dem Bemfsfeld zu arbeiten (vgl. GVG 2011: 41).
Die Einrichtungen im Pflegesektor dürfen in diesem Prozess allerdings auch die jungen Pflegekräfte nicht außer Acht lassen, damit diese erst gar nicht beginnen zu verschleißen, sondern befähigt werden, bis ins Rentenalter durchgängig leistungsfähig zu bleiben (vgl. Heidenreich 2009: 201). Sämtliche Maßnahmen in Unternehmen müssen auf arbeitslebenslange Entwicklung ausgerichtet werden. Denn je früher gesundheitliche Prävention einsetzt, umso größer sind die Erfolge für die Mitarbeiter im hohen Lebensalter (vgl. Tőiken 2007: 85). Schlechte Arbeitsbedingungen und die damit verbundenen Belastungen können allerdings nur überwunden werden, wenn engagierte Pflegekräfte am Beruf festhalten, sich auf höchster Ebene engagieren und Veränderungen einfordern (vgl. Speri 1996: 149). ״Wichtig für die Pflegenden ... sind neben der eigentlichen Tätigkeit die WertSchätzung der Gesellschaft, Gestaltungsmöglichkeiten in der täglichen Arbeit, Sinngebung und soziale Verbindungen“ (GVG 2011: 10).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Pflegepersonal trotz der hohen Belastungen im Arbeitsalltag und der im Verhältnis schlechten Entlohnung zwar sehr mobil innerhalb des weitläufigen Berufsfeldes ist, sich allerdings generell durch eine große Bindung zum erlernten Beruf auszeichnet. Das Tätigkeitsfeld wechselt, doch der Beruf bleibt. Gerade vor diesem Hintergrund bietet die fortschreitende Akademisierung neue Perspektiven (vgl. Krause 2007: 9 f.).
2.5 Akademisierung des Berufsbildes
Wird in Deutschland über die Zukunft der Pflege gesprochen, fällt allerorts der Begriff der Akademisierung. Im Folgenden soll nun zunächst geklärt werden was Akademisierung bedeutet und wo sie im sogenannten Professionalisierungspro- zess einzuordnen ist. Cassier-Woidasky beschreibt Professionalisierung nach dem Amerikaner Wilensky als einen Prozess, in dem aus einer nebenbei ausgeübten Tätigkeit eine Vollzeitbeschäftigung wird. Im ersten Schritt werden mit der aufkommenden Frage nach Ausbildung spezialisierte Schulen errichtet, folgend entstehen verschiedene Ausbildungs- und Forschungsprogramme, um die Wissensbasis zu erweitern, und letztlich verlagert sich die Ausbildung an die Universität, es werden Berufsorganisationen gegründet und eine eigene Berufsethik entsteht (vgl. Cassier-Woidasky 2007: 57).
Die Akademisierung hingegen ist wie auch die Ausbildung als ein Professionskriterium einzuordnen. Sie dient ebenfalls der Generierung und Systematisierung von Wissen, berührt auf dem Weg der Profes sionalisierung allerdings mehr formale und inhaltliche Bedingungen (vgl. Cassier-Woidasky 2007: 70). Bernhard und Walsh stellen den Fortschritt der Pflege hin zur Profession anhand des von Pavaiko entwickelten Kontinuum-Modells der Professionalisierung dar. Dabei überprüften sie alle acht Gruppenkategorien des Modells und wendeten diese auf die Situation der internationalen Pflege an. Zusammenfassend kamen sie nach Einordnung aller Kriterien, die unter anderem gesellschaftliche Bedeutung, Autonomie, Gemeinschaftssinn und den ethischen Kodex umfassen, zu dem Schluss, dass der Schlüssel zur Professionalisierung im Ausbau von Führungskompetenzen liegt. Pflege solle sich ihrer gesellschaftlichen Macht bewusst werden und aufzeigen, dass eine professionelle Pflege letztlich der Gesellschaft zugutekommt (vgl. Bernhard; Walsh 2000: 2 ff.).
״Ziele der Professionalisierung der Pflege sind das Erreichen eines dem Ärzteberuf vergleichbaren gesellschaftlichen Einflusses und einer entsprechenden beruflichen Identität, die Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen, der Ausbruch aus der Rolle der Aufopfernden und Zuarbeitenden“ (Sewtz 2006: 137). Um diese Ziele zu erreichen, muss sich die Pflegepraxis stärker der Wissenschaft zuwenden, um ein Fundament zu schaffen, auf dem Pflegende eigenverantwortlich neue Aufgaben übernehmen können (vgl. Moses 2015: 11).
Zentrales Argument für eine Akademisierung der Pflege, die mit einer besseren wissenschaftlichen Qualifizierung einhergeht, sind die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die tiefgreifend in das bestehende Gesundheitswesen eingreifen und dadurch zu neuen, eigenständigen Aufgaben in der Pflege führen werden (vgl. Moses 2015: 11). Doch auch in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts ist es leider so, dass die nicht-akademischen Berufszweige im Gesundheitswesen als karriere-verhindernde Sackgassenberufe gelten (vgl. Sewtz 2006: 10).
Und doch stehen viele Pflegekräfte trotz dieser Sackgassenproblematik einer Akademisierung ihres Berufsfeldes kritisch gegenüber. So stellt Eva-Maria Krampe in ihrer Untersuchung ״... eine nicht unerhebliche Akademikerfeindlichkeit bei den Pflegenden“ (Krampe 2009: 257) fest, allerdings nicht aus Angst vor einer eigenen Dequalifizierung, sondern eher aus der Verweigerung einer rationalen und effizienten Arbeitsweise heraus. Die Vorurteile, die Berufsangehörige der Pflege gegenüber der neuen Gruppe der Pflegewissenschaftler haben, führt langfristig zu einer Entfremdung zwischen Akademikem und Pflegekräften (vgl. Krampe 2009: 257).
Auf dem Weg der Akademisierung wurde bereits in den 1970er-Jahren begonnen, angloamerikanische Pflegetheorien und -modelle in die Pflegeausbildung zu integrieren (vgl. Moses 2015: 13). Die USA gelten als ״Mutterland“ der Akademi- sierung der Pflege - so gibt es in den USA bereits seit Beginn des 20. Jahrhun- derts Pflegestudiengänge und seit den 1950er-Jahren ist die eigenständige Disziplin der Pflegewissenschaft universitär etabliert. Im Zuge der Akademisierung und der damit einhergehenden Verwissenschaftlichung hat sich die Pflege in den USA in ihrer Positionierung und ihrem Kompetenz- und Aufgabenspektrum deutlich verändert. Die Pflege nimmt in der Gesundheits- und Krankenversorgung der USA eine starke und zentrale Position ein, ihr Status und Ansehen sind kaum mit der Pflege im deutschsprachigen Raum vergleichbar (vgl. Schaeffer 1995: 127 ff.).
Aber auch in Deutschland wurde bereits Mitte des 20. Jahrhunderts auf amerikanische Initiative hin die erste Schule für Schwesternschülerinnen auf amerikanischer College-Ebene angesiedelt. An der Universität Heidelberg sollten ab dem Jahr 1953 Krankenschwestern zu einer neuen, wissenschaftlich orientierten Pflege-Elite ausgebildet werden. Hier sperrten sich allerdings die Mutterhausverbände gegen eine höhere Qualifizierung, da sie Sorge hatten, dass gut ausgebildete Krankenschwestern nicht mehr bereit sein würden, sämtliche pflegerische wie auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten zu übernehmen (vgl. Moses 2015: 20).
Wie schwer die Akademisierung in Deutschland in der Vergangenheit vonstatten- ging, zeigt auch der Versuch eines sechssemestrigen Diplomstudienganges für Pflegepädagogen an der Freien Universität Berlin. Nach einmaliger Durchführung von 1976 bis 1981 wurde dieser wieder eingestellt. Grund waren bildungspoliti- sehe, parteipolitische sowie universitätsinterne Beschlüsse und letztlich die unentschlossene Haltung der Berufsverbände (vgl. Moses 2015: 28).
Seit den frühen 2000er-Jahren ist das Studienangebot für Pflegekräfte quantitativ deutlich angewachsen und bewegt sich mittlerweile im dreistelligen Bereich. Das hängt auch damit zusammen, dass die Professionalisierung durch Akademisierung mittlerweile als einer der wichtigsten Beiträge zur Erhöhung der Attraktivität des Berufsbildes angesehen wird (vgl. Krause 2007: 12). Angehende Akademiker können aus rund 100 Bachelorstudiengängen und etwa 50 Masterstudiengängen wählen, die in ihrer Ausprägung unterschiedlich stark an der praktischen Pflegearbeit orientiert sind und sich auf rund 3.000 Studienplätze im Pflegebereich verteilen (vgl. Millich 2016: 90).
Die Rahmenbedingungen wie auch die Zugangsvoraussetzungen zu den bestehenden Pflegestudiengängen sind unterschiedlich ausgeprägt und setzen meistens eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem grundständigen Pflegeberuf sowie teilweise Berufserfahrung voraus (vgl. Sewtz 2006: 151). Das führt dazu, dass ein Bildungsweg zum Erreichen des akademischen Grades ״Master“ im pflegerischen Bereich meist noch acht Jahre beansprucht. So müssen neben drei Jahren Berufsausbildung ein sechssemestriger Bachelorstudiengang sowie ein vier- bis fünfse- mestriger Masterstudiengang absolviert werden. Somit ist der Zeitraum, vergii- chen mit einem abgeschlossenen Medizinstudium, um zwei Jahre länger (vgl. Teigeier 2012: 1023). Dies schreckt Pflegekräfte ab und führt dazu, dass sie eher eine Weiterbildung oder sogar einen vollständigen Berufsausstieg dem Studium vorziehen (vgl. DEKV 2004: 28 f.).
Modellversuche von grundständigen Studiengängen in der Pflege, die neben einem Hochschulabschluss auch die Voraussetzungen zum Führen der BerufsbeZeichnung ״Gesundheits- und Krankenpfleger/in“ schaffen, sind aufgrund der rechtlichen Bestimmungen zur praktischen Anbindung an Krankenhäuser schwer zu realisieren. Aktuelle Modelle schließen das Studium an die Ausbildung an und Ausbildungsinhalte werden angerechnet, sodass nach rund vier Jahren sowohl der Berufsabschluss als auch ein Bachelorabschluss zu erreichen sind (vgl. GVG 2011: 55). Viele Inhalte, die früher lediglich durch Weiterbildungen abgedeckt wurden, werden nach und nach an die Fachhochschulen, teilweise auch an die Universitäten, verschoben. Dazu zählen besonders Bereiche der Pflegepädagogik und des Pflegemanagements. Zudem gibt es den Studiengang der Pflegewissenschaft, der wie die anderen Studiengänge meist eine abgeschlossene Ausbildung in einem Pflegeberuf voraussetzt und künftige Wissenschaftler für den Pflegebereich ausbilden soll (vgl. Krampe 2009: 19). Als weitere Studiengänge sind die Bereiche des Gesundheitsmanagements, der Gesundheitsförderung, der Gesundheitskommunikation sowie Public Health zu nennen (vgl. Blättner 2008: 124). Zukünftig sollen zudem Studiengänge modellhaft durchgeführt werden, die heil- kundliche Tätigkeiten ermöglichen (vgl. GVG 2011: 56). Leider Stehen dem AnSpruch auf Umsetzung pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse in der Berufspraxis die hohen Arbeitsanforderungen und Belastungen entgegen (vgl. GVG 2011: 40 f.). Damit sich das Pflegepersonal am Forschungsprozess beteiligt, sollten die Bedingungen so gestaltet werden, dass hierfür Zeit im Arbeitsalltag bleibt (vgl. Bernhard, Walsh 2000: 246).
Häufig ist im Rahmen der Akademisierungsdebatte zu lesen, dass akademisch ausgebildetes Personal nicht finanzierbar sei. Dies lässt sich allerdings mit einem Vergleich der Einkommens Struktur amerikanischer, auf Hochschulniveau ausgebildeter Pflegekräfte widerlegen. Trotz Akademisierung stieg das Einkommen nicht konstant zum Ausbildungsniveau. Eine Gehaltsangleichung zu anderen Professionen erfolgte über Jahrzehnte - demnach bliebe auch in Deutschland genügend Zeit, um nach Lösungen für die befürchtete Kostenlawine im Zuge der Aka- demisierungsbestrebungen der Pflege zu suchen (vgl. Schaeffer 1995: 139 f.). Auch haben die möglichen Zusatzqualifikationen auf Fachhochschulniveau bisher noch keinerlei Auswirkungen auf institutionalisierte Ansprüche an bestimmte Positionen bzw. entsprechend gehobene Bezahlung in Deutschland gezeigt (vgl. Krampe 2009: 20 f.). Doris Schaeffer wamt vor dem Fehler, Pflegestudiengänge nur auf Teilbereiche zu begrenzen. Nur durch ein breites Angebot von Studiengängen - gemäß den unterschiedlichen Aufgabenbereichen - ist eine Aufwertung, Verändemng und Professionalisierung des Bemfes zu erreichen. Wenn man von amerikanischen Erfahmngen etwas lemen kann, dann dass die Pflegeausbildung in praxisorientierte Studiengänge zu integrieren ist, um lange Ausbildungswege zu vermeiden. Darauf aufbauend sollte es weiterführende Studiengänge wie auch Promotionsmöglichkeiten geben (vgl. Schaeffer 1995: 142 f.).
Auch Eva-Maria Krampe stellt in ihrer Untersuchung zur Professionalisierung der Pflege zusammenfassend fest, dass die Professionalisierung mithilfe von Akade- misiemng und Verwissenschaftlichung unter der Tendenz leidet, den Professiona- lisiemngsstatus nicht mehr für alle Beschäftigten einzufordem, sondern unterschiedliche Professionen für verschiedene Bemfsgmppen innerhalb der Pflege zu legitimieren. Damit wird der Forderung nach einem eigenständigen Bemf, der sich selbst verwaltet und unabhängiger von ärztlicher Weisung wird, sowie der Zusammenführung aller Bemfsangehörigen in eine gemeinsame, alle Interessen vertretende Organisation jegliche Gmndlage entzogen (vgl. Krampe 2009: 252). Sich von der Medizin zu befreien, war die Erwartung der Pflegenden an die Aka- demisierung. Stattdessen wächst die Distanz von pflegenden Berufsangehörigen zu ihren akademisierten Kollegen und die Entfremdung wird dabei als notwendige Ausdifferenzierung im Professionalisierungsprojekt gepriesen. Mit dieser Strategie wird allerdings darauf verzichtet, Mehrheiten innerhalb des Berufes von einer Akademisierung zu überzeugen (vgl. Krampe 2009: 258). Allen am Prozess beteiligten Gruppen muss bewusst sein, dass die Einführung neuer Assistenzbemfe oder auch nur die Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten durch Pflegepersonal nicht zur Professionsentwicklung des Bemfsfeldes Pflege beiträgt, denn auch diese Tätigkeiten bleiben im heutigen System noch immer unter ärztlicher Kontrolle (vgl. Cassier-Woidasky 2011: 180).
[...]
- Arbeit zitieren
- Tobias Gemeinhardt (Autor:in), 2017, Was bewegt Gesundheits- und Krankenpflegekräfte?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/423692
Kostenlos Autor werden









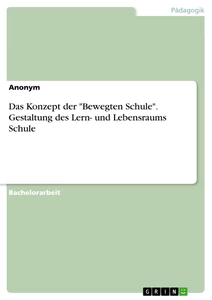










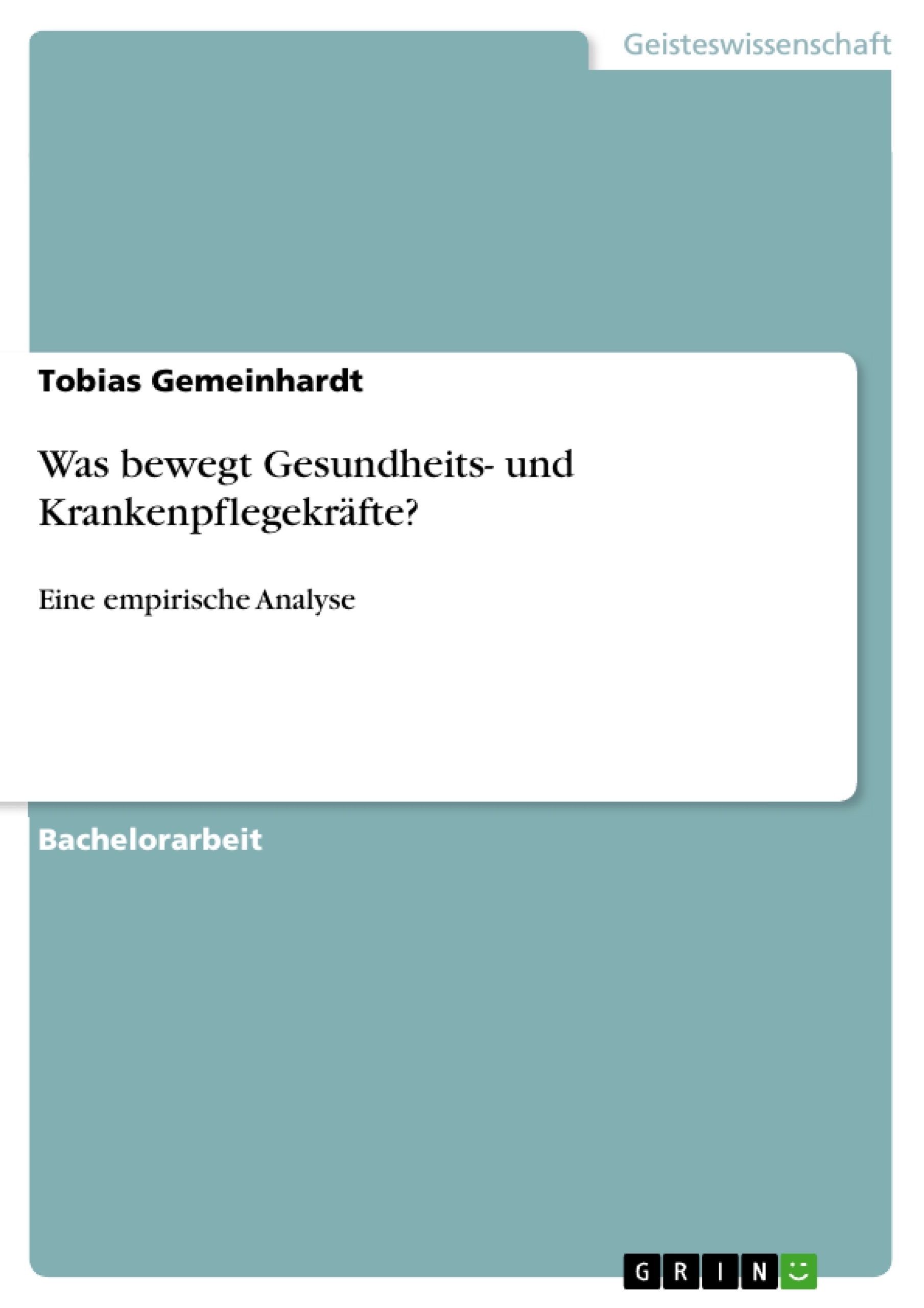

Kommentare