Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Ziele dieser Arbeit
1.2 Fragestellungen
2 Selbstständige Lebensführung und Gesundheit im Alter
2.1 Prävention und Gesundheitsförderung
2.2 Alternsprozesse und selbstständige Lebensführung
2.3 Gesundheitskompetenz in Deutschland
2.4 Gesetzliche Grundlagen
2.4.1 Sozialgesetzbuch
2.4.2 Sozialgesetzbuch
3 Geschichte und Hintergründe zum Präventiven Hausbesuch
3.1 Der Präventive Hausbesuch in Deutschland
3.2 Zielgruppe und Zugangswege
3.3 Multidimensionale Assessments
3.4 Informieren und Beraten
3.5 Beratungsthemen
3.6 Kompetenz der Beratenden
3.7 Vertrauen und Beziehungsgestaltung
3.8 Betrachtungen aus Seniorensicht
4 Kompetenzentwicklung für professionell Pflegende
4.1 Experteninterviews
4.2 Basisqualifikation
4.3 Leitlinie zur Personalstrategie
4.3.1 Stellenbeschreibung
4.3.2 Stellenanzeige
4.3.3 Anforderungs- und Eignungsprofil
4.3.4 Bewerberauswahl
4.3.5 Einarbeitungskonzept
4.3.6 Qualitätsstandard
4.3.7 Qualitätsmanagement
4.4 Perspektiven für professionell Pflegende
4.5 Erfahrungen aus dem aktuellen Pilotprojekt GS+
5 Institutionelle Rahmenbedingungen und Implementierung
5.1 Zukünftige Leistungsanbieter für Präventive Hausbesuche
5.2 Voraussetzungen zur Implementierung
5.3 Pflegende in einem neuen Setting
5.4 Erfolgsfaktoren Präventiver Hausbesuche
5.5 Präventive Hausbesuche in der Öffentlichkeit
6 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen
6.1 Allgemeine Zusammenfassung und kritische Anmerkungen
6.2 Stand der Forschung
6.3 Handlungsempfehlungen
6.4 Ausblick
Literaturverzeichnis
Anlagenverzeichnis
Zur besseren Lesbarkeit verzichtet die Autorin darauf, bei Berufs- und Personenbezeichnungen sowohl die männliche als auch die weibliche Form zu verwenden. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Gesundheitsgewinn
Abb. 2: Hausbesuchsfolge innerhalb eines Jahres
Abb. 3: Auszug aus Erfassungsbereiche STEP-m
Abb. 4: Kompetenzbereiche der Beratenden
Abb. 5: Stellenbeschreibung
Abb. 6: Stellenanzeige
Abb. 7: Anforderungs- und Eignungsprofil
Abb. 8: Auszug 1 aus dem Einarbeitungskonzept
Abb. 9: Auszug 2 aus dem Einarbeitungskonzept
Abb. 10: Qualitätsstandard zum PHB
Abb. 11: Verknüpfung: Individuelle Beratung – Sozialraumentwicklung
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Klassifikation von Präventionsmaßnahmen
Tab. 2: Typen der Primärprävention
Tab. 3: Konzeptionelle Kernelemente des PHB
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Die Menschen in Europa werden immer älter. Innerhalb der EU ist der demografische Wandel in Deutschland am weitesten fortgeschritten (vgl. Seidel et al. 2013). Prognosen zur durchschnittlichen Lebenserwartung zeigen, dass sich die Altersgruppe der über 65-Jährigen zwischen 2010 und 2050 verdoppeln wird, und keine Altersgruppe stärker wachsen wird als die der über 80-Jährigen (vgl. BZgA 2013: 36).
Die meisten der hier lebenden Senioren möchten im Alter gerne so lange wie möglich in ihrem Haus oder der vertrauten Wohnung verbleiben (vgl. Millich 2016: 50). Entscheidend für eine selbstständige Lebensführung im Alter ist vor allem die Gesundheit. Mit einem höheren Lebensalter steigen jedoch die Risiken von körperlichen Einschränkungen, Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit (vgl. Maßem 2016: 6).
Ein Lebensalter von über 75 Jahren muss nicht mit Krankheit und Abhängigkeit einhergehen, das zeigen Untersuchungen, wie z. B. die „Generali-Altersstudie“, das „Münchner Modell zu Präventiven Hausbesuchen“ oder die Studien des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e. V., wie das „Projekt mobil“, die „PON-Studie“ u. a. Im Modellprojekt „Gemeindeschwester plus“ wird aktuell der Präventive Hausbesuch (PHB) bei Senioren ohne Pflegebedarf erprobt (vgl. DIP 2016a). Dieser Hausbesuch dient der Erhaltung der Selbstständigkeit und Vermeidung oder Hinauszögern von Pflegebedürftigkeit durch risikoorientierte, qualifizierte und individuelle Beratung (vgl. BVPG 2007: 36). Kennzeichnend sind der niedrigschwellige Zugang und die Bringstruktur. DIP-Direktor Prof. Dr. Frank Weidner betont indessen, dass PHB keine Einzelmaßnahmen sind, sondern als Bausteine in der kommunalen Seniorenarbeit zu sehen sind (vgl. Gruhl et al. 2016: 43).
Im Rahmen einer nicht repräsentativen Querschnittsuntersuchung wurden in der Region Trier 122 Senioren zur Akzeptanz von PHB befragt. Sie waren vom Konzept des PHB mehrheitlich überzeugt und würden das Angebot bereits heute annehmen, wenn die Möglichkeit bestünde (vgl. Maßem 2017).
Diese Bachelorarbeit stützt sich auf diese Erkenntnisse und die Erwartung, dass der PHB nach Abschluss des rheinland-pfälzischen Projektes GS+ wohl als neue Dienstleistung im Gesundheitswesen eingeführt werden wird.
Für professionell Pflegende, z. B. Gesundheits- und Krankenpfleger (PFK), ergibt sich ein neues Handlungsfeld, das nicht pflegebedürftige ältere Menschen in den Mittelpunkt stellt. Diese Arbeit soll interessierte PFK informieren. Sie richtet sich aber besonders an die künftigen Leistungsanbieter von PHB, z. B. an Kommunen oder Träger von Pflegestützpunkten und kann zur gezielten Vorbereitung auf das neue Geschäftsfeld verwendet werden.
Diese Arbeit basiert auf einer intensiven Literaturrecherche. Sehr bedeutsam ist die durch das DIP veröffentlichte Literatur, z. B. „Präventive Hausbesuche bei Senioren – Projekt mobil“ und das „Beraterhandbuch“. Beide Bücher sind wichtige wissenschaftliche Grundlagenwerke, obgleich sie bereits 2008 und 2009 veröffentlicht wurden (vgl. Maßem 2017: 2).
Das erste Kapitel dieser Bachelorarbeit führt in das Thema ein. Die Autorin legt ihre persönliche Motivation dar sowie die Ziele und Fragestellungen. Das zweite Kapitel befasst sich mit der selbstständigen Lebensführung im Alter und wirft einen Blick in die Sozialgesetzbücher V und XI. Im dritten Kapitel werden der PHB erläutert und die notwendigen Kompetenzen der Beratenden dargelegt. Ausgangsbasis für das vierte Kapitel sind Experteninterviews und deren Ergebnisse, die in ein Personalkonzept für die künftigen Leistungsanbieter münden. Das fünfte Kapitel behandelt institutionelle Rahmenbedingungen und Überlegungen zur Implementierung von PHB. Schließlich werden im sechsten Kapitel die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und Handlungsempfehlungen formuliert.
1.1 Ziele dieser Arbeit
Das Ziel dieser Bachelorarbeit besteht darin, Handlungsempfehlungen zur Kompetenzentwicklung und zur Implementierung von PHB für die künftigen Leistungsanbieter in Einrichtungen des Gesundheitswesens zu entwickeln.
Die Zielsetzung erfordert einen qualitativen Forschungsansatz und ein induktives Vorgehen. Zu diesem Zweck sollen Experteninterviews in mehreren Modellregionen stattfinden, die den PHB bereits erprobt haben. Dazu gehören die Projekte GS+ in Rheinland-Pfalz und PräSenZ in Baden-Württemberg. Ziel ist es, Mitwirkende beider Projekte zu befragen, um eine gute Informationsbasis verschiedener Praktiker zu erlangen. Ein zentraler Aspekt dieser Arbeit sind die Leitfadeninterviews, deren Ergebnisse in ein Personalkonzept einfließen, z. B. als Leitlinie zur Personalstrategie oder als Qualitätsstandard.
1.2 Fragestellungen
Die zentralen Fragestellungen dieser Bachelorarbeit lauten:
- Lassen sich aus den bisherigen Erkenntnissen zum PHB Handlungsempfehlungen und Arbeitsinstrumente für die künftigen Leistungsanbieter entwickeln?
- Wie kann die Kompetenzentwicklung von PFK hin zur „Pflegefachfrau/-fachmann für PHB" gestaltet werden?
- Wo kann der PHB künftig verortet werden?
Hieraus ergeben sich folgende Einzelfragen:
- Welche Basisqualifikation sollten Beratende für PHB mitbringen?
- Gibt es ausreichende Erkenntnisse zur Entwicklung einer Muster-Stellenbeschreibung und wie könnte sie aussehen?
- Wie könnte eine Muster-Stellenanzeige aussehen?
- Wie könnte ein Muster-Einarbeitungskonzept gestaltet werden?
- Wie könnte der Bildungs- und Unterstützungsbedarf ermittelt werden?
- Wie könnte ein Fragebogen zur Einarbeitung aussehen?
- Lässt sich mit den bisherigen Ergebnissen ein Muster-Qualitätsstandard entwickeln und wie könnte er aussehen?
2 Selbstständige Lebensführung und Gesundheit im Alter
Die Themen „Selbstständige Lebensführung“ und „Gesundheit im Alter" werden immer wichtiger. In der Generali-Altersstudie wird eine selbstständige Lebensführung als zentrales Anliegen der älteren Generation beschrieben (vgl. Bruttel, Köcher 2012: 303). Wichtige Voraussetzung dafür ist eine stabile Gesundheit. Gesundheit im Alter bedeutet jedoch nicht das vollständige Freisein von körperlichen, seelischen und sozialen Einschränkungen, sondern umfasst vielmehr Aktivität, Lebenszufriedenheit, subjektiv erlebte Gesundheit, Gesundheitsverhalten und einen gesunden Lebensstil. Sie verwirklicht sich derart, wie Aktivität und soziale Teilhabe im täglichen Leben möglich sind und gelebt werden (vgl. Seidel et al. 2013: 14).
Die Gruppe der älteren Menschen ist sehr heterogen. Ihre individuellen Voraussetzungen und Biografien sind verschieden, ebenso die damit einhergehenden Chancen und Risiken für die Gesundheit. Die Menschen erreichen ein hohes Alter in sehr unterschiedlicher körperlicher und geistiger Verfassung (vgl. BZgA 2015: 11). Insofern spielen in einer älter werdenden Bevölkerung Prävention und Gesundheitsförderung eine große Rolle.
2.1 Prävention und Gesundheitsförderung
Die Begriffe „Prävention“ und „Gesundheitsförderung“ werden in der internationalen Fachliteratur nicht einheitlich verwendet (vgl. Hurrelmann et al. 2014: 13). Um eine Klarheit herbeizuführen, werden hier zunächst die Begriffe vor dem Hintergrund ihrer zeitlichen Entstehung erläutert.
Der historisch ältere Begriff „(Krankheits-) Prävention“ entwickelte sich in der Sozialmedizin des 19. Jahrhunderts aus der Debatte um soziale Hygiene und Volksgesundheit. Mit den Begriffen „Vorbeugung“, „Vorsorge“, „Prophylaxe“ oder „Prävention“ wurden alle Ansätze der Krankheitsvermeidung zusammengefasst. Der entscheidende Ansatz galt dem Zurückdrängen von Krankheitsauslösern und der Absicht, sie ganz auszuschalten. Ziel war es, Krankheiten, ihre Verbreitung und ihre Auswirkungen zu vermindern. Dies bezog sich z. B. auf unzureichende hygienische Lebensbedingungen oder belastende Arbeitssituationen, die die Lebensqualität und -dauer der Bevölkerung schwer beeinträchtigten (vgl. Hurrelmann et al. 2014: 13) (vgl. Maßem 2017: 4). Prävention setzt vom Grundgedanken zeitlich vor einer Erkrankung und Beeinträchtigung an (vgl. DIP 2009: 23).
Der Begriff „Gesundheitsförderung“ entstand aus den gesundheitspolitischen Debatten der WHO, die „Gesundheit“ als Zustand des völligen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens definierte. In einer Konferenz in Ottawa wurde das in einem Konzept der Gesundheitsförderung etabliert (vgl. WHO 1986). „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“. (WHO 1986) (vgl. Maßem 2016: 9).
Gemeinsames Ziel der Interventionsformen Prävention und Gesundheitsförderung ist, einen individuellen sowie kollektiven Gesundheitsgewinn zu erzielen, entweder durch das Zurückdrängen von Krankheitsrisiken oder durch das Fördern gesundheitlicher Ressourcen (vgl. Hurrelmann et al. 2014: 14).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Gesundheitsgewinn bei Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention (vgl. DIP 2009: 17)
Hurrelmann skizziert dies mit einer am Gesundheitsgewinn orientierten Darstellung (vgl. Abb. 1). Die Eingriffslogik der Gesundheitsförderung ist die, Bedingungen zu verändern, um die Gesundheits- und Lebensqualität zu erhöhen. Die Logik der Prävention ist es, die Auftretenswahrscheinlichkeiten von Krankheiten und Beeinträchtigungen zu reduzieren. Somit möchte die Prävention allgemeine Risikofaktoren beeinflussen, z. B. Bewegungsarmut und Rauchen, die ihrerseits multiple Wirkungen haben (vgl. DIP 2009: 17ff.).
„Als Risikofaktoren werden in den Sozial- und Gesundheitswissenschaften Bedingungen bezeichnet, die empirisch nachweisbar die Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer bestimmten Krankheit erhöhen.“ (DIP 2009: 23). Statistisch ermittelte Risikofaktoren beschreiben Zusammenhänge zu beobachteten Häufigkeiten in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Wichtigste Risikofaktoren für die häufigsten Erkrankungen, wie Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs und Demenz sind Bluthochdruck, hohe Blutfettwerte, Übergewicht, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung und dauerhafte psychische Überlastung (vgl. Hurrelmann et al. 2014: 14).
Das Risikofaktorenmodell ist eine wichtige Interventionsgrundlage für präventive Maßnahmen. Im Idealfall soll so früh eingegriffen werden, dass sich aus den identifizierten Risikofaktoren noch keine Krankheitssymptome (Primärprävention) entwickelt haben (vgl. Hurrelmann et al. 2014: 14).
Hurrelmann et al. greifen die in der Medizin gebräuchliche Klassifikation von Präventionsmaßnahmen nach Gerald Caplan von 1964 auf. Diese differenziert die Präventionsmaßnahmen in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention (vgl. Tab.1) (vgl. Hurrelmann et al. 2014: 36 f.) (vgl. Maßem 2017: 4 f.).
Tab. 1: Klassifikation von Präventionsmaßnahmen (vgl. Hurrelmann et al. 2014: 37)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Rosenbrock beschreibt drei Typen der Primärprävention. Er bezieht die Lebensumwelt der Betroffenen mit ein, wie z. B. beim Präventiven Hausbesuch mit seiner Bringstruktur (vgl. Tab 2) (vgl. Rosenbrock 2008: 16).
Tab. 2: Typen der Primärprävention (vgl. Rosenbrock 2008: 16f.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2 Alternsprozesse und selbstständige Lebensführung
Der körperliche Alternsprozess ist eine physiologische Entwicklung über den gesamten menschlichen Lebenslauf. Die Ausprägungen der Alternsprozesse sind bei älteren Menschen individuell sehr verschieden. Menschen gleicher Altersgruppen zeigen eine große Variabilität in der Leistungsfähigkeit ihres Organismus. Alternsprozesse erhöhen die Verletzlichkeit des menschlichen Organismus und machen anfällig für Krankheiten. Alter und Krankheit überlagern sich und bestimmen gemeinsam die Lebensdauer. Im höheren Lebensalter beeinflussen auch Umweltfaktoren und Lebensstil zunehmend die gesundheitlichen Funktionen (vgl. DIP 2009: 42 ff.).
Psychische Alternsprozesse zeigen sich in Funktionen, die an biologische Strukturen gebunden sind. Hier geht es z. B. um die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, Gedächtnisleistung, Wahrnehmung, Umstellungsfähigkeit, Bewältigung neuartiger kognitiver Probleme (vgl. Duden online o. J.: kognitiv = das Wahrnehmen, Denken, Erkennen betreffend) und die Psychomotorik (vgl. Duden online o. J.: Psychomotorik = Gesamtheit aller willkürlich gesteuerten, bewusst erlebten und von psychischen Momenten geprägten Bewegungsabläufe, z. B. das Gehen) (vgl. DIP 2009: 44). Dem entgegen zeigt die erfahrungsgebundene Intelligenz Gewinne bis ins hohe Lebensalter. „Ältere Menschen, die regelmäßig kognitiv herausfordernden Tätigkeiten nachgehen, weisen in einem geringeren Ausmaß kognitive Einbußen auf.“ (DIP 2009: 44). Das DIP schreibt weiter, dass die besten Leistungen häufig erst im höheren Lebensalter erbracht werden, da eine lange Lernzeit zu einem Reichtum an Erfahrung und damit zur Expertise führt (vgl. DIP 2009: 45).
Einfluss auf die Gesundheit und Selbstständigkeit im Alter haben einerseits personenbezogene Aspekte wie physische, kognitive, emotionale, soziale und alltagspraktische Funktionen. Andererseits spielen Umweltmerkmale wie räumliche, infrastrukturelle, soziale, medizinische, pflegerische und rechtliche Aspekte eine große Rolle (vgl. DIP 2009: 28 f.) Im vierten Altenbericht setzt die Bundesregierung auf die Prinzipien von Normalität, von Integration und Partizipation sowie von Individualität und Kontinuität der Lebensführung (vgl. BMFSFJ 2002: 19). Die steigende Lebenserwartung ist für die meisten Menschen mit dem Wunsch verbunden, auch im Alter gesund und selbstständig zu leben. „Ein Verbleib in der eigenen Wohnung ist, ganz im Sinne einer möglichst langen autonomen Lebensführung, in allen Bevölkerungsgruppen der 65- bis 85-Jährigen die erste Präferenz.“ (Köcher, Bruttel 2012: 308). In der Studie „Patientengerechte Gesundheitsversorgung für Hochbetagte“ sagte ein Drittel der Befragten, dass sie, so lange es der Gesundheitszustand zulässt, eigenständig in der eigenen Wohnung leben möchten, gegebenenfalls mit Unterstützung durch professionelle Dienste (vgl. Seidel et al. 2013: 155).
Entscheidend für eine selbstständige Lebensführung im Alter ist vor allem die Gesundheit trotz nicht umkehrbarer Alternsprozesse. Hier rückt der PHB (vgl. Abschnitt 3.1) in den Mittelpunkt, dessen Ziel es ist, Gesundheit und selbstständige Lebensführung im Alter so lange und umfassend wie möglich zu fördern (vgl. DIP 2009: 31). Doch welche Gesundheitskompetenzen bringen die Deutschen, respektive die ältere Bevölkerung mit?
2.3 Gesundheitskompetenz in Deutschland
Die langjährige pflegepraktische Erfahrung der Autorin zeigte in zahlreichen Patienten- und Angehörigenkontakten, dass die allgemeine Gesundheitskompetenz, wie sie z. B. im Kontext eines Krankenhausaufenthaltes offenkundig wird, problematisch ist. Am Beispiel eines Medikaments lässt sich das verdeutlichen, denn häufig kommt es vor, dass Patienten diese nicht namentlich benennen können. So werden Tabletten eher in Farbe und Form beschrieben und möglicherweise mit einer eingängigen Indikation, z. B. Wasser- oder Blutdrucktablette versehen. Unabhängig vom Alter ist es allgemein schwierig, die relevanten Informationen eines Medikamentenbeipackzettels zu erfassen und die individuell richtigen Handlungen abzuleiten. Schaeffer et al. weisen in ihrer kürzlich veröffentlichen repräsentativen Studie darauf hin, dass lediglich 7,3 % der Deutschen über eine exzellente Gesundheitskompetenz verfügen. Hingegen 54,3 % wiesen eine problematische oder inadäquate Gesundheitskompetenz auf. Besonders häufig betroffen sind ältere Menschen, Personen mit Migrationshintergrund, niedriger Bildung und chronischer Krankheit (vgl. Schaeffer et al. 2017: 53 ff.). In einer nicht repräsentativen Studie zur Akzeptanz von PHB äußerten Senioren unter anderem das Anliegen, dass eine Krankenschwester die Medikamente oder das Blutdruckmessgerät erklären solle (vgl. Maßem 2017: 26). Von den insgesamt 122 Senioren dieser Studie sagten 48 Teilnehmer, dass sie gerne mit einer kompetenten Krankenschwester über Gesundheitsfragen sprechen würden, wenn es das Angebot gäbe (vgl. Maßem 2017: 29).
„Mit höherem Bildungsstand steigt die Chance, lange gesund zu bleiben, das belegen Statistiken. Gesundheitsbildung kann Gesundheitsbewusstsein vermitteln und Möglichkeiten aufzeigen, sich selbst Gutes zu tun. Zum Gesundheitsbewusstsein gehört ein vernetztes Wissen über körperliche, seelische, soziale und ökologische Zusammenhänge von Gesundheit.“ (BZgA 2014: 27).
2.4 Gesetzliche Grundlagen
Einen gesetzlichen Anspruch auf PHB für nicht pflegebedürftige Menschen im höheren Lebensalter gibt es noch nicht. Doch welche Grundlagen zur Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung gibt es für die Senioren?
2.4.1 Sozialgesetzbuch V
Mit Inkrafttreten des Präventionsgesetzes vom 17. Juli 2015 wurde das nationale Gesundheitsziel „Gesund älter werden“ zur Gesundheitsförderung und Prävention verankert. „Die Krankenkasse sieht in der Satzung Leistungen zur Verhinderung und Verminderung von Krankheitsrisiken (primäre Prävention) sowie zur Förderung des selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handelns der Versicherten (Gesundheitsförderung) vor." (PrävG § 20 SGB V). Der DBfK schreibt, dass die Erbringung präventiver Leistungen nach wie vor stark im ärztlichen Bereich verortet sind. Dennoch ist das Gesetz ein Fortschritt für die professionelle Pflege, obgleich die Auswirkungen des Gesetzes bisher noch wenig spürbar sind (vgl. DBfK 2016: 2).
2.4.2 Sozialgesetzbuch XI
Obwohl sich der Beratungsauftrag von PSP nicht nur auf die Beratungen zu Leistungen des SGB XI bezieht, sondern auch auf „sonstige Hilfsangebote“, weisen die Evaluationen zur Arbeit von PSP aus mehreren Bundesländern darauf hin, dass hauptsächlich Angehörige und Bezugspersonen von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen beraten werden (vgl. § 7c SGB XI) (vgl. DIP 2016: 4f.). Das Modellprojekt GS+ sieht die Zusammenarbeit, Verzahnung und Regelung von Zuständigkeiten mit den PSP vor. Ziel ist es, die bestehenden Leistungen wirksam zu erweitern sowie präventive und gesundheitsfördernde Angebote und Strukturen zu stärken (vgl. DIP 2016: 5).
3 Geschichte und Hintergründe zum Präventiven Hausbesuch
Die Bevölkerung in Europa wird immer älter und die sozialpolitische Bedeutung einer möglichst langen und selbstständigen Lebensführung im eigenen Zuhause immer wichtiger. Eine Maßnahme zur Unterstützung älterer Menschen ist der Präventive Hausbesuch (PHB), der bereits 1960 modellhaft angeboten wurde. Erste Studien fanden 1984 im Rahmen des Rødovre-Projekts in Dänemark statt. 1990 folgten in England Gesundheitsuntersuchungen für die über 75-Jährigen. Seit 1996 gibt es in Dänemark ein Gesetz, wonach den Älteren zwei PHB zustehen. Mit einer gesetzlichen Regelung folgte Australien 1998 und Finnland führte den PHB 2010 ein (vgl. Pohlmann 2016: 305 ff.). Beachtenswert sind auch z. B. österreichische Studien zu Personen ab 70 Jahren. Dort möchte man die Lebens- und Gesundheitssituation bewusstmachen, die Lebensführung den altersspezifischen Veränderungen anpassen und mögliche Ressourcen aktivieren (vgl. Schulc et al. 2016: 526).
3.1 Der Präventive Hausbesuch in Deutschland
Seit 2002 werden deutschlandweit Projekte erprobt und weiterentwickelt, die sich unter dem Hyperonym „Präventive Hausbesuche“ zusammenfassen lassen. Für ein einheitliches Verständnis des Begriffs „Präventiver Hausbesuch“, wählte das BMFSFJ folgende Definition: „Der präventive Hausbesuch, bei dem ältere Menschen in ihrer häuslichen Umgebung untersucht und beraten werden, bildet eine geeignete Methode (a) zur Früherkennung von Risikofaktoren und Erkrankungen, (b) zur Intervention bei bestehenden Risikofaktoren und Erkrankungen sowie (c) zur gezielten Beeinflussung von Merkmalen des Lebensstils, der Lebenslage und der Umwelt mit dem Ziel der Vermeidung von Risikofaktoren und Erkrankungen.“ (BMFSFJ 2003; zit. n. Roling et al. 2012: 1).
Die BVPG bezeichnet den PHB als ein perspektivisch vielversprechendes Mittel zur Prävention im Alter. Dieser diene der Erhaltung der Selbstständigkeit und der Vermeidung von Pflegebedürftigkeit bei älteren, noch selbstständigen Menschen durch ein multidimensionales Assessment und anschließende wiederholte risikoorientierte, qualifizierte, individuelle Beratung (vgl. BVPG 2007: 36). Das DIP definiert den PHB als Maßnahme, deren Kernelement die Information und Beratung von Personen in ihrer häuslichen Umgebung zu Themen der selbstständigen Lebensführung, Gesunderhaltung und Krankheitsvermeidung ist (vgl. DIP 2009: 53).
Die hier genannten Definitionen skizzieren einen Dienstleistungscharakter mit dem Merkmal einer aufsuchenden Beratung. Dahinter stehen Konzepte, die Senioren befähigen sollen, so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause führen zu können (vgl. Maßem 2017: 5).
Das BVPG nennt folgende Präventionsziele von PHB bei älteren Menschen:
- Verhindern des Auftretens von Krankheit; Senken der Mortalitätsrate (vgl. Duden online o. J.: Mortalität = Sterblichkeit),
- Günstiges Beeinflussen der Krankheitsschwere im Verlauf; Senken der Krankenhauseinweisungen oder der Behandlungsdauer,
- Verhindern alltagsrelevanter Krankheitsauswirkungen in Form von Schädigungen und Beeinträchtigungen von Aktivitäten und Teilhabe,
- Pflegebedürftigkeit verzögern, Pflegeheimeinweisungen reduzieren,
- Stärken der funktionalen Gesundheit,
- Positive Kontextfaktoren in der Persönlichkeit und dem Verhalten älterer Menschen stärken und negative vermindern (vgl. BPVG 2007: 3).
Das DIP formuliert als Ziel, die Gesundheit und selbstständige Lebensführung im Alter so lange und umfangreich wie möglich zu erhalten (vgl. DIP 2009: 53).
Die Kernelemente des PHB und die zu erwartenden Ergebnisse werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (vgl. Tab. 3) (vgl. Maßem 2016: 10).
Tab. 3: Konzeptionelle Kernelemente des PHB (vgl. DIP 2009: 61 ff.); eigene Darstellung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
- Arbeit zitieren
- Brigitte Maßem (Autor:in), 2017, Der Präventive Hausbesuch. Handlungsempfehlungen, Konzept und Implementierung eines innovativen Angebots, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/421230
Kostenlos Autor werden





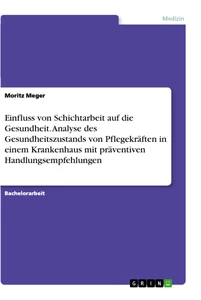
















Kommentare