Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was bedeutet Work-Life-Balance?
2.1 Begriffsbestimmung
2.2 Die Entwicklung des Work-Life-Balance Terminus
2.2.1 Das Konzept der Salutogenese von Antonovsky
2.2.2 Auswirkungen des Konzepts der Salutogenese
2.3 Das heutige WLB-Konzept
2.3.1 Die gesellschaftliche Entwicklung
2.3.2 Die betriebliche Entwicklung
2.3.3 Die individuelle Perspektive
2.3.4 Geschlechtsspezifische Unterschiede von WLB
2.4 Belastungs- und Schutzfaktoren
2.4.1 Stress
2.4.2 Gesundheit
2.5 Umsetzung von Work-Life-Balance
2.5.1 Betriebliche Work-Life-Balance Maßnahmen
2.5.2 Individuelle Work-Life-Balance Maßnahmen
3. Charakteristika der Psychotherapie
3.1 Anerkannte psychotherapeutische Richtlinienverfahren
3.1.1 Die Psychoanalyse
3.1.2 Die tiefenpsychologisch fundierte Therapie
3.1.3 Die Verhaltenstherapie
3.2 Das Berufsbild der PsychotherapeutInnen
3.2.1 Psychologische PsychotherapeutInnen
3.2.2 Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen
3.2.3 Ärztliche PsychotherapeutInnen
3.3 Besonderheiten der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
4. Spezifische berufliche Belastung von PsychotherapeutInnen
4.1 Aktuelle Situation der PsychotherapeutInnen in Ausbildung
4.2 Folgen der hohen Belastung von PsychotherapeutInnen
4.3 Bewältigungsmöglichkeiten
4.3.1 Copingstrategien
4.3.2 Copingstrategien von PsychotherapeutInnen
4.3.2.1 Selbsterfahrung und Supervision
4.3.2.2 Psychohygiene
4.3.2.3 Entspannungstechniken
4.3.2.4 Persönliche Lebensführung
4.4 Work-Life-Balance bei PsychotherapeutInnen in Ausbildung
4.5 Ausbildungsbedingungen als Untersuchungsgegenstand
5. Work-Life-Balance und psychisches Wohlbefinden
5.1 Psychisches Wohlbefinden
5.2 Relevante Variablen
6. Empirischer Teil
6.1 Methodik
6.1.1 Quantitative und qualitative Forschung
6.1.2 Auswahl des Messinstruments
6.1.2.1 Measure of Work-Life-Balance
6.1.2.2 Der Psychological General Well-Being Index (PGWBI)
6.1.3 Gütekriterien
6.1.4 Überprüfung des Fragebogens
6.2 Untersuchungsdurchführung
6.2.1 Ziel der Untersuchung
6.2.2 Datenanalyse
6.2.3 Fragestellungen und Postulate
6.2.4 Teilnehmer
6.3 Ergebnisse
6.3.2. Ergebnisse der Fragen zur Work-Life-Balance
6.3.3 Ergebnisse der Fragen zum psychischen Wohlbefinden
6.3.4 Auswertung der offenen Fragen
6.3.3.1 Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen in Ausbildung
6.3.3.2 Approbierte Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen
6.3.4 Vergleich der Ergebnisse beider Stichproben
6.3.5 Korrelationen
6.3.5.1 PsychotherapeutInnen in Ausbildung
6.3.5.2 Approbierte PsychotherapeutInnen
7. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
7.1 Zusammenfassung der deskriptiven Daten
7.1.1 Abhängigkeiten und Einflussfaktoren
7.2 Ergebnisse des Fragebogens
7.2.1 Fragen zur Work-Life-Balance
7.2.2 Fragen zum psychischen Wohlbefinden
7.3 Korrelationen
7.4 Zusammenfassende Ergebnisse der offenen Fragen
7.4.1 Ergebnisse der offenen Fragen N
7.4.2 Ergebnisse der offenen Fragen N
7.4.3 Vergleich der Antworten beider Stichproben miteinander
7.5 Beantwortung der zugrundeliegenden Fragestellungen
8. Abschließende Diskussion
9. Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Variablen des WLB Fragebogens
Tabelle 2: Anzahl und Nummer Items der jeweiligen Variable
Tabelle 3: Ergebnisinterpretation PGWB
Tabelle 4: Unterschiede bei den Ergebnissen des PGWBI Frauen/Männer
Tabelle 5: Zusammenfassung aller Variablen
Tabelle 6: Offene Fragen
Tabelle 7: Reliabilität des Fragebogens mit den Teilnehmern dieser Studie
Tabelle 8: Vergleich der 2 Stichproben WLB
Tabelle 9: Mittelwerte WLB gesamt Bezahlung/Arbeitsbelastung
Tabelle 10: Vergleich der zwei Stichproben PGWBI
Tabelle 11: Mittelwerte PGWBI gesamt Bezahlung/Arbeitsbelastung
Tabelle 12: Definition WLB
Tabelle 13: Wie wird gute WLB hergestellt
Tabelle 14: Erschwernisse
Tabelle 15: Definition WLB
Tabelle 16: Wie wird gute WLB hergestellt
Tabelle 17: Erschwernisse
Tabelle 18: Feststellung Signifikanz WLB Skalen
Tabelle 19: Feststellung Signifikanz PGWBI Skalen
Tabelle 20: Zusammenhang PGWBI Gesamtskala und WLB Gesamtskala
Tabelle 21: Zusammenhänge PGWBI Gesamtskala und WLB Skalen
Tabelle 22: Zusammenhänge WLB Gesamtskala und PGWBI Skalen
Tabelle 23: Zusammenhang WLB Gesamtskala und PGWBI Gesamtskala
Tabelle 24: Zusammenhänge PGWBI Gesamtskala und WLB Skalen
Tabelle 25: Zusammenhänge WLB Gesamtskala und PGWBI Skalen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Erklärungsmodell Work-Life-Balance nach Haddon und Hede
Abbildung 2: Zusammenhang von Belastungs- und Schutzfaktoren
Abbildung 3: Altersverteilungen
Abbildung 4: Geschlechterverteilung
Abbildung 5: Verteilung in Deutschland
Abbildung 6: Beziehungsstatus
Abbildung 7: Anzahl der Kinder
Abbildung 8: Wochenarbeitsstunden
Abbildung 9: Zusätzliche Berufstätigkeit
Abbildung 10: Bezahlung Psychiatriepraktikum
Abbildung 11: Wochenarbeitszeit und Berufstätigkeit
Abbildung 12: Berufstätigkeit und Beziehungsstatus
Abbildung 13: Berufstätigkeit und Bezahlung Praktikum
Abbildung 14: Wochenarbeitszeit und Bezahlung Praktikum
Abbildung 15: Berufstätigkeit und Kinder
Abbildung 16: Wochenarbeitszeit und Kinder
Abbildung 17: Anzahl Kinder und Wochenarbeitszeit
Abbildung 18: verteilung Kinder auf die Geschlechter
Abbildung 19: Wochenarbeitszeit und Kinder
Abbildung 20: Anzahl Kinder und Wochenarbeitszeit
Abbildung 21: Verteilung Kinder auf Geschlechter
1. Einleitung
Manchmal, wenn ich mit einem Patienten darüber spreche, wie wichtig es ist, im Hinblick auf die alltäglichen Belastungen eigenen Bedürfnisse zu beachten, fällt mir auf, wie widersprüchlich dieser Ratschlag ist, da ich als Psychotherapeutin in Ausbildung ja selbst hoch belastet bin und meine eigenen Bedürfnisse oft zurückstelle um sowohl meiner Familie als auch meinen Patienten gerecht zu werden.
Stress und depressionsbedingte Krankheiten gelten in der heutigen Gesellschaft als Problem mit einer großen Tragweite. Sie geben in allen Altersgruppen Anlass zur Besorgnis, da sie weit verbreitet sind und sich in vielfältiger Weise auswirken. Stress und Depressionen führen zu einem erheblichen Verlust der Lebensqualität, indem sie zu sozialer Ausgrenzung und erhöhter Mortalität beitragen. Zu berücksichtigen sind neben den individuellen gesundheitlichen Aspekten auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Strategien zum Erhalt der psychischen Gesundheit sind daher in allen Politik- und Tätigkeitsbereichen von zunehmender Bedeutung (Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen). Mit dem Ziel Work-Life-Balance als gesellschaftlich relevantes Thema und als betriebliche Aufgabe zu etablieren, hat die Bundesregierung 2003 in Kooperation mit der Bertelsmannstiftung eine „Allianz für die Familie“ gegründet. Insbesondere die im internationalen Vergleich niedrige Geburtenrate in Deutschland hat zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit dem Thema Work-Life-Balance auf politischer und wirtschaftlicher Ebene geführt. Die im Februar 2004 präsentierte Studie „Monitor Familienfreundlichkeit“ hat gezeigt, dass zu dem Zeitpunkt immerhin noch zwei Drittel der Betriebe in Deutschland dem Thema Work-Life-Balance für ihren wirtschaftlichen Erfolg keine Relevanz zuschrieben. Die Führungsebenen großer Unternehmen sind nach wie vor von Männern dominiert. Ein Großteil deutscher Firmen reduziert seinen Nachwuchspool nach wie vor auf Männer, die ein traditionelles Familienmodell befürworten und somit dem Unternehmen permanent zur Verfügung stehen.
Hoch qualifizierte, motivierte und innovative Mitarbeiter finden sich allerdings ebenso außerhalb dieser Gruppe.
Work-Life-Balance gilt als ein Thema, mit dem hauptsächlich Frauen gezwungen sind, sich auseinanderzusetzen, die neben der eigenen Familie berufstätig sein müssen oder wollen. Eine US Studie mit 353 erfolgreichen Betrieben konnte 2003 belegen, dass die Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil in Führungspositionen einen bis zu 35% höheren finanziellen Gewinn ausschütteten, als Unternehmen mit wenig Frauen in der Führungsebene. Die 2002 veröffentliche Studie „Leaders in a Global Economy“ zeigt, dass das Thema Work-Life-Balance zunehmend auch für Männer relevant wird. Vorstandsmitglieder, die sich bewusst mehr Zeit für ihre Familie nahmen, zeigten sich erfolgreicher, als diejenigen, die sich vorwiegend über ihre Arbeit definierten. Dieser Entwicklung werden sich auch die männerdominierten Firmen zukünftig kaum entziehen können (Erler (1) 2003).
Aber nicht nur für die Mitarbeiter in wirtschaftlichen Unternehmen, auch für Menschen, die in sogenannten Heilberufen tätig sind, ist Work-Life-Balance ein bedeutendes Thema. Hierzu gehören hochqualifizierte Kräfte, wie Ärzte und Psychologen genauso wie Pflegekräfte. Schicht- und Bereitschaftsdienste, sowie das Ausgeliefertsein von Personalmangel bei gleichzeitiger Verpflichtung und Verantwortung gegenüber Patienten führen in diesen Berufen oft zu langen und anstrengenden Arbeitszeiten.
Eine an Bedeutung zunehmende Gruppe der Heilberufler sind die PsychotherapeutInnen. Die ambulante vertragspsychotherapeutische Versorgung wurde im Jahr 2013 in Deutschland von mehr als 13.000 Psychologischen PsychotherapeutInnen und über 3.000 Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen sichergestellt. Hinzu kamen ca. 5300 ärztliche PsychotherapeutInnen. Diese haben pro Quartal circa eine Million Patienten in der Gesetzlichen Krankenversicherung versorgt (Bundespsychotherapeutenkammer 2014/www.bptk.de).
Immer mehr Patienten werden aufgrund psychischer Störungen behandlungsbedürftig. Auch Kinder und Jugendliche sind von dieser Entwicklung betroffen.
Der Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie e.V. BKJPP geht davon aus, dass etwa ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland an einer psychischen Störung leiden („Kölner Stadtanzeiger“, 11.11.2006; Müller, 2007). Insgesamt sind nach einer Untersuchung des Robert-Koch-Instituts (www.kiggs.de) 5% der Kinder und Jugendlichen psychisch so auffällig, dass sie behandlungsbedürftig sind (Deutsches Ärzteblatt 103 (15), 2006, A970). Die Berufsorganisationen der PsychotherapeutInnen fordern schon lange eine Verbesserung der Versorgungsstruktur um sowohl Patienten, die sehr lange auf einen Therapieplatz warten müssen, als auch niedergelassene Therapeuten zu entlasten.
Eine Psychotherapeutin, die es kaum schafft für sich selber zu sorgen, wird wenig Erfolg damit haben dem Patienten gegenüber glaubhaft zu vermitteln, dass sie ihm helfen könne. Ein guter Therapeut braucht demnach Bedingungen, die es ihm ermöglichen für eine ausgewogene Work-Life-Balance zu sorgen. Nur ein psychisch und physisch gesunder Therapeut kann seinen Patienten dauerhaft helfen. Dies belegen auch Studien, die zeigen, dass der Erfolg einer Therapie auch vom eigenen Wohlbefinden des Therapeuten abhängt (Cierpka et al. 1997, Guy et al. 1989).
Insbesondere die Therapeutenausbildung ist für viele PsychologInnen eine Belastungsprobe. Etwa 8000 PsychologInnen mit Diplom- oder Masterabschluss, befinden sich zurzeit in der Psychotherapeutenausbildung. In dieser durch das Psychotherapeutengesetz geregelten Form gibt es die Ausbildung seit 1999. In vielen Bundesländern, insbesondere in Ballungsgebieten, wie München oder Hamburg werden die PsychologInnen für ihre praktische Tätigkeit, die 1800 Stunden umfasst, überhaupt nicht bezahlt. Mindestens drei Jahre dauert es, bis sich ein Psychologe nach dem Studium "Psychologischer Psychotherapeut" nennen darf. Für die genauso umfangreiche Ausbildung zum “Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten” sind neben PsychologInnen auch PädagogInnen und SozialpädagogInnen zugelassen. Die Psychotherapeuten in Ausbildung (abgekürzt PIA) werden in den Kliniken als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt. Zusätzlich müssen die angehenden TherapeutInnen mehrere hundert Stunden Theorie und Einzeltherapiestunden unter Supervision absolvieren.
Hinzu kommen Pflichtstunden an Selbsterfahrung, Arbeitsgruppen und eine umfangreiche Abschlussprüfung. Im Durchschnitt zahlt ein Psychotherapeut in Ausbildung im Verlauf für diese 23.400 Euro.
Dennoch ist der Andrang in die Ausbildungsinstitute groß, denn die Therapeutenausbildung ist Voraussetzung für eine Kassenzulassung und obligatorisch für den Erwerb einer Approbation, die PsychologInnen und PädagogInnen - anders als Ärzte - nicht mit dem Studienabschluss allein beantragen dürfen (Bundespsychotherapeutenkammer 2014/www.bptk.de). Viele geraten in der Ausbildung unter finanziellen Druck. Sie müssen das umfangreiche aber nicht oder schlecht bezahlte Praktikum und den Beruf unter einen Hut bekommen. Zudem fällt die Ausbildungszeit inmitten der Familienplanung, so dass Kinder, Partner, Beruf und Ausbildung miteinander vereinbart werden müssen. In der Praxis verlängert sich die Ausbildungszeit dadurch nicht selten auf bis zu zwölf Jahre.
Angeregt durch meine eigene Situation inmitten der Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und den damit verbundenen beruflichen und privaten Herausforderungen entstand das Anliegen herauszufinden, von welchen Kriterien eine gute Work-Life-Balance in der Psychotherapeutenausbildung abhängig ist und inwieweit diese Kriterien sich nach der Approbation verändern. Im Austausch mit anderen Ausbildungsteilnehmern bestätigte sich die Annahme, dass diese umfangreiche und langwierige Ausbildung für die meisten eine hohe psychische und physische Belastung darstellt.
Ich stellte mir die Frage, welche Faktoren hierfür eine Rolle spielen könnten. Wären es die schwierigen Ausbildungsbedingungen, wie die nicht oder kaum bezahlten 1800 Stunden Psychiatriepraktikum neben 600 Stunden theoretischer Ausbildung, die mit hohen Kosten verbunden ist, dann müsste sich das Gefühl der Belastung nach der Approbation deutlich reduzieren. Sollten Faktoren, wie Berufsauffassung, die Fähigkeit sich abzugrenzen und andere individuelle Risiko- oder Schutzfaktoren eine bedeutende Rolle spielen, wäre anzunehmen, dass sich die subjektiv wahrgenommene Belastung nach der Approbation nicht deutlich verbessert.
In dieser Arbeit möchte ich untersuchen, wie stark Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen in Ausbildung durch die gegebenen Bedingungen belastet sind und von welchen Faktoren für sie die Herstellung einer ausgewogenen Work-Life-Balance abhängig ist.
Außerdem interessiert mich, ob der Wegfall ausbildungsspezifischer Belastungsfaktoren bei den bereits approbierten Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen eine höhere Zufriedenheit hinsichtlich der persönlichen Work-Life-Balance zur Folge hat oder ob das subjektive Belastungsgefühl bei approbierten TherapeutInnen genauso hoch ist wie bei PsychotherapeutInnen in Ausbildungen und somit ausbildungsunabhängige Ursachen hat.
Eine Beschränkung auf die Gruppe der PsychotherapeutInnen liegt neben dem persönlichen Interesse darin begründet, dass deren Ausbildungsbedingungen bereits von der Bundespsychotherapeutenkammer als reformbedürftig anerkannt wurden. Im Fokus der anstehenden Reform steht die Tatsache, dass die Approbation erst am Ende der gesamten postgradualen Weiterbildung erfolgt und nicht bereits, wie zum Beispiel bei den Medizinern, mit einem Staatsexamen am Ende des Studiums. Die Psychotherapeutenkammer hat daher mittlerweile ein Gesamtkonzept zur Reform der Psychotherapieausbildung erstellt, welches 2017 veröffentlicht werden soll. Um als Gesetzentwurf verabschiedet zu werden, müsste dieses Konzept nach den Neuwahlen 2017 im Koalitionsvertrag der Bundesregierung aufgenommen werden. Die Ausbildungssituation der PsychotherapeutInnen ist demnach politisch hoch aktuell. Bis zu einer endgültigen Reform der Ausbildungsbedingungen können Ausbildungsinstitute von den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung profitieren, indem sie durch eine entsprechende Anpassung der Auswahlverfahren und Ausbildungsangebote die Abbruchrate von Ausbildungsteilnehmern reduzieren.
Inhaltlich beschäftigt sich diese Arbeit mit der Ausbildungssituation und der damit verbundenen Work-Life-Balance von angehenden Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen, die VerhaltenstherapeutInnen werden möchten.
Der theoretische Teil beschäftigt sich zunächst mit allgemeinen Erläuterungen zum Begriff „Work-Life-Balance“. Im darauffolgenden Kapitel werden verschiedene psychotherapeutische Verfahren dargestellt und auf Besonderheiten der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie eingegangen. Anschließend werden spezifische Belastungen von PsychotherapeutInnen, als auch deren Folgen und Bewältigungsmöglichkeiten aufgeführt.
Abschließend werden im theoretischen Teil die Work-Life-Balance bei PsychotherapeutInnen in Ausbildung, sowie deren Einfluss auf das psychische Wohlbefinden behandelt und die zugrundeliegenden Fragestellungen formuliert.
Der auf den theoretischen Teil folgende empirische Abschnitt beinhaltet die Durchführung, Auswertung und Ergebnisdarstellung der Untersuchung. Hierzu wurden in einer deutschlandweit angelegten Umfrage angehende Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen zu ihrer Work-Life-Balance und zu ihrem psychischen Wohlbefinden befragt. Außerdem wurden bereits approbierte Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen hinsichtlich ihrer Work-Life-Balance befragt um eine Aussage darüber treffen zu können, ob sich die Work-Life-Balance nach der Approbation verändert. Als Untersuchungsmethode wurde ein Fragebogen gewählt, der sich aus “Brett and Stroh`s (2003) Measures of Work-Life-Balance” und ”The Psychological General Well-Being Index (PGWBI) published by Dupoy (1984)”, sowie einem qualitativen Teil mit drei offenen Fragen zusammensetzt. Vor der abschließenden Diskussion werden die Ergebnisse zusammengefasst und die zugrundeliegenden Fragestellungen beantwortet.
2. Was bedeutet Work-Life-Balance?
2.1 Begriffsbestimmung
Der Begriff Work-Life-Balance hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Schlagwort entwickelt, insbesondere wenn es um Handlungsempfehlungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Bei dem zurzeit größten Online Buchhandel Amazon erhält man zu dem Suchbegriff „Work-Life-Balance“ 11.368 Ergebnisse (19.7.2012).
Mit Titeln wie „Work-Life-Balance: Wie Sie Beruf und Familie in Einklang bringen“ (Cassens, 2003), „Work-Life-Balance: So bringen Sie Ihr Leben (wieder) ins Gleichgewicht“ (Cobaugh, Schwerdtfeger, 2005) oder „Besser leben mit Work-Life-Balance. Wie Sie Karriere, Freizeit und Familie in Einklang bringen“ (v. Eichborn, 2003) häufen sich in den letzten Jahren Ratgeber, die mit dem Versprechen von mehr Lebensqualität um Käufer werben.
Aber auch der Anteil wissenschaftlicher Veröffentlichungen zu dem Thema „Work-Life-Balance“ ist in den letzten Jahren gestiegen. Während sich vor wenigen Jahren nur wenige Quellen für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung eigneten, von denen ein Großteil aus den USA stammte, finden sich mittlerweile sowohl im Fachportal Pädagogik als auch im Psyndex/PubPsych jeweils mehrere hundert Einträge. Begründet durch die Tatsache, dass verschiedene Länder unterschiedliche Sozial- und Infrastrukturen, sowie jeweils ein eigenes, kulturell bedingtes Werteverständnis aufweisen, bezieht sich die Definition von Work-Life-Balance in der vorliegenden Arbeit auf Deutschland.
„Work-Life-Balance“ bedeutet wörtlich übersetzt „Arbeit-Leben-Balance“. Eine Gegenüberstellung dieser beiden Bereiche impliziert einen Gegensatz zwischen Arbeit und Leben (Schmidt-Lellke 2007, S.30). Es wird suggeriert, dass in der Arbeitszeit nicht gelebt und in der Lebenszeit nicht gearbeitet wird. Dies ist insofern irreführend, als dass sich Arbeit und Freizeit nicht voneinander trennen lassen. Einerseits ist die Erwerbsarbeit ein Teil des Lebens, andererseits finden sich auch in der Freizeit Arbeitsbelastungen in Form von Kindererziehung, Weiterbildung und Hausarbeit (Schmidt-Lellke, 2007). Aufgrund dieser Problematik ist eine eindeutige Definition der Termini WORK, LIFE und BALANCE wichtig.
Im Folgenden soll unter dem Begriff WORK die reine Erwerbsarbeit, also die berufliche Tätigkeit, die zur Sicherung des Lebensunterhaltes dient, verstanden werden.
Mit LIFE ist die Lebenswelt gemeint, die das reine Privatleben umfasst, wozu auch unbezahlte Arbeit, zum Beispiel im Haushalt, und die Familie gehören.
Eine erfolgreiche Lebensgestaltung impliziert, dass das Verhältnis von WORK und LIFE ausbalanciert ist. Wie bei einer Waage ist dies dann der Fall, wenn das Gewicht der zwei Bereiche auf beiden Waagschalen gleich verteilt ist. Die Balance beschreibt demnach einen Stillstand. Work-Life-Balance wäre so die Beschreibung eines Ist-Zustands, welcher sich konträr zu der sich verändernden, dynamischen Arbeits- und Lebenswelt verhält. Entsprechend dieser Problematik wird in dieser Arbeit unter dem Begriff keine starre 50:50-Gewichtung, sondern vielmehr eine möglichst gute Vereinbarkeit der unterschiedlichen Interessen im Berufs- und Privatleben verstanden.
Für die Erhaltung der Sinnhaftigkeit des Lebens ist aus systemischer Sicht von Bedeutung, dass die verschiedenen Rollen und Funktionen, die der Mensch innerhalb der unterschiedlichen Subsysteme, in denen er sich bewegt, zu erfüllen hat, miteinander in Einklang stehen.
„Dies bedeutet, dass der Mensch nur in Balance ist, wenn er zwischen den einzelnen Subsystemen innerhalb der Lebens- und Arbeitswelt nicht mit seinem Rollen- und Funktionsgefüge in Konflikt steht“ (Weinheim 2007, 21ff.).
In der vorliegenden Arbeit ist daher unter BALANCE ein ausgewogenes Selbstmanagement im Hinblick auf eine ausreichende Beachtung eigener Bedürfnisse bezüglich der beiden Bereiche WORK und LIFE zu verstehen, welches ohne eine gewisse Dynamik nicht realisierbar wäre.
Die Begrifflichkeit WORK-LIFE-BALANCE impliziert vor dem Hintergrund der einzelnen Begriffsdefinitionen, die Schaffung eines Ausgleichs zwischen dem Berufs- und dem Privatleben. Misslingt die Vereinbarkeit dieser beiden Hauptlebensbereiche dauerhaft, kommt es zu psychischen und physischen Beschwerden, wie Schlafstörungen, Erschöpfung und Burnout (Cassens 2003). Hinzukommend sind die belastenden und erholenden Aktivitäten innerhalb der einzelnen Bereiche zu berücksichtigen. So ist auch innerhalb des Berufslebens, genau wie in der privaten Zeit, eine Balance zwischen Beanspruchung und Regeneration anzustreben. Die Herstellung einer solchen Balance hängt von verschiedenen Faktoren ab (Freier 2005):
1. Funktionen, die Individuen in den jeweiligen Lebensbereichen wahrnehmen
2. Die Gewichtung der beiden Lebensbereiche
3. Die individuelle Stressempfindlichkeit, sowie Copingstrategien
4. Die Lebensphase, in der sich ein Mensch gerade befindet
5. Individuelle Lebensgewohnheiten
Hinzu kommen nach Seiwert und Tracy (2002) noch weitere Faktoren, die den Erhalt der körperlichen und seelischen Gesundheit beeinflussen:
1. Leistung und Arbeit: Wohlstand, Erfolg, Freude am Beruf
2. Körper: Gesundheit, Fitness, Ernährung
3. Kontakt: Familie, Freunde, soziale Anerkennung
4. Sinn: Religion, Selbstwirksamkeit, Erfüllung, Zukunft
Einerseits, bedeutet eine Balance nicht, dass alle Faktoren gleichsam berücksichtigt werden müssen, andererseits kann die mangelnde Befriedigung eines Bedürfnisses in einem Bereich nicht durch eine Übererfüllung in einem anderen kompensiert werden (Gauger 2009).
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend definiert WORK-LIFE-BALANCE wie folgt (2005, S.4):
„Work-Life-Balance bedeutet eine neue, intelligente Verzahnung von Arbeits- und Privatleben vor dem Hintergrund einer sich dynamisch verändernden Arbeits- und Lebenswelt. (...) Die dreifache Win-Situation durch Work-Life-Balance resultiert aus Vorteilen für die Unternehmen, für die einzelnen Beschäftigten, sowie einem gesamtgesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen.“
Im Folgenden soll vor dem Hintergrund der dargestellten Bedeutungen und Einflussfaktoren unter dem Begriff
WORK-LIFE-BALANCE
ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen dem Berufs- und dem Privatleben als auch zwischen den jeweiligen Handlungsanforderungen und individuellen Bedürfnissen innerhalb der einzelnen Lebensbereiche
verstanden werden. Der Begriff kann einerseits absolutistisch, als eine zeitliche Balance zwischen den verschiedenen Lebensbereichen (Greenhaus et al., 2003; Kalliath Brough, 2008; Reiter, 2007) und andererseits situationsspezifisch, also durch die Zufriedenheit in den verschiedenen Lebensbereichen/-rollen definiert werden. (Brett Stroh, 2003; Kalliath Brough, 2008; Reiter, 2007). Nach Reiter (2007) ist die situationsspezifische Definition für die wissenschaftliche Forschung am sinnvollsten.
In diesem Fall ist Work-Life-Balance darunter zu verstehen, wie zufrieden eine Person mit ihrer Rolle in den beiden Bereichen Arbeit und Privatleben ist und wie die Person die ablaufenden Prozesse bewertet. Dies kann durchaus das Herausragen einer konkreten Rolle bedeuten, ohne dadurch einen Konflikt zu provozieren (Reiter, 2007).
Die situative Definition von Work-Life-Balance erlaubt dem Individuum Work-Life-Balance auf der Grundlage seiner eigenen Zufriedenheit und positiven Funktion in beiden Bereichen, Beruf und Privatleben, zu definieren (Reiter, 2007, Wilkinson 2013, S.13).
Eine australische Studie zu verschiedenen Einflussfaktoren auf die Dynamik von Work-Life Balance und deren Auswirkungen (Haddon, Hede 2009) hat gezeigt, dass die individuelle Wahrnehmung der Work-Life-Balance von variierenden Faktoren, die entweder begünstigend oder erschwerend auf die Work-Life-Balance einwirken, abhängig ist. Hiermit sind sowohl wechselnd vorhandene Umweltfaktoren, als auch die sich ständig wandelnden Arbeits- und Lebensbedingungen gemeint (siehe Abbildung 1). Die Studie hat ergeben, dass die individuelle generelle Gesundheit, die Zufriedenheit und die Leistungsfähigkeit eine Konsequenz der wahrgenommenen Work-Life-Balance ist (Haddon, Hede 2009, S.17).
Abbildung 1: Erklärungsmodell Work-Life-Balance nach Haddon und Hede
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Aus: Haddon, Hede, 2009, S.30)
2.2 Die Entwicklung des Work-Life-Balance Terminus
Die Idee des Work-Life-Balance Ansatzes ist nicht neu. Bereits Aristoteles war davon überzeugt, dass unterschiedliche Bestandteile des Lebens ausbalanciert und ein Weg der Mitte gefunden werden müsse, um eine gewisse Lebenszufriedenheit zu erreichen (Leist, 2005). Vor dem Beginn des Zeitalters der Industrialisierung im 19. Jahrhundert war die Arbeit dem Rhythmus der Natur unterworfen und diente ausschließlich der Lebensgrundversorgung. Freizeitgestaltung, die der Lebensfreude diente, war dem Adel vorbehalten. Mit dem Zeitalter der Industrialisierung gab es durch den Einsatz neuer Technologien erstmals flächendeckend eine räumliche Trennung zwischen Betrieben und Wohnungen, was wiederum zu einer Veränderung der familiären Arbeits- und Lebensgemeinschaften führte (Freier, 2005, S.23). Eine weitere Folge dieser Entwicklung war eine neue Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Die Industrialisierung führte dazu, dass die Männer für die Arbeit in den Fabriken ihr Heim verließen und die Hausarbeit den Frauen zugewiesen wurde. Da es sich hierbei um keine für den Lebensunterhalt relevante Arbeit handelte, wurden die Frauen in ihrem Status reduziert (Hofmann, 2008, S.11). Dieses Rollenverständnis der erwerbslosen Ehefrau änderte sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in dem Frauen langsam mehr Selbständigkeit und Unabhängigkeit durchsetzten. Der Human Relations- Ansatz der 20er und 30er Jahre setzte sich erstmals intensiv damit auseinander, wie Arbeit und Leben zu gestalten sind. Noch in den 50er und 60er Jahren war das Rollenverständnis von Arbeitnehmern auf Konformität und Integration ausgerichtet. Der Einzelne war wie ein Rädchen in einem Getriebe ein rein funktionaler Bestandteil des Gesamtbetriebes. Die Konflikttheorie der 60er Jahre grenzte sich gegenüber dem rollentheoretischen Ansatz ab: Konflikte wurden nicht mehr ausschließlich als ein aus dem sozialen Zusammenhang herausfallendes Ereignis gesehen. Vielmehr wurde begonnen, dynamische Aspekte zu thematisieren und sich konstruktive Konfliktbewältigungskompetenzen anzueignen. Diese veränderten Rollenverhältnisse erschwerten aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zeitgleich verbesserten sich die Arbeitsschutzbestimmungen und die gesundheitliche Versorgung.
Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts fand insbesondere im gesundheitlichen Bereich ein Umdenken statt und Handlungstheorien verbanden sozialwissenschaftliche Erkenntnisse mit der Lösung gesellschaftlicher Probleme. Mit Hilfe der Handlungstheorien wurde versucht herauszuarbeiten, wie der Mensch in zielgerichteter Auseinandersetzung mit seiner Umwelt handelnd seine Umgebungsbedingungen verändern und gleichzeitig seine Persönlichkeit flexibel gestalten kann (Leist, 2005). Es wurde vermehrt der Fokus auf Faktoren gelegt, die Gesundheit erhalten, anstelle ausschließlich Krankheiten zu bekämpfen. Geprägt wurde diese Sichtweise der Salutogenese (Salus, lat. = Unverletztheit, Heil) von dem Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1923-1994) als Komplementärbegriff zur Pathogenese.
2.2.1 Das Konzept der Salutogenese von Antonovsky
Das Hauptanliegen Antonovskys war eine veränderte Sichtweise auf die Gesundheit von der noch Anfang der 1970er Jahre üblichen risikoorientierten hin zu einer ressourcenorientierten Perspektive. Seiner Ansicht nach sollte man sich auf all jene Faktoren konzentrieren, die eine Person trotz vieler gefährdender Einflüsse gesund erhalten, anstatt ausschließlich auf das zu schauen, was einen Menschen krank mache. Um diese neue „salutogenetische Blickrichtung“ (Wustmann 2011, S.26) zu veranschaulichen, hat Antonovsky eine Metapher benutzt, deren Formulierung hier aus meiner Masterarbeit (Eggers, 2011) übernommen wurde:
„Menschen schwimmen in einem Fluss voller gefährlicher Strudel und Stromschnellen. Der Fluss symbolisiert das individuelle Leben eines Menschen, welches – genau wie der Verlauf des Flusses – sehr unterschiedlich sein kann. Der Schwimmer in dem Fluss muss Hindernisse, wie Stromschnellen, Strudel und gefährliche Tiere überwinden, im wahren Leben Armut, Krankheit und Krisen. Um mit diesen Hindernissen zurechtzukommen, braucht der Mensch Ressourcen und Schutzfaktoren. Beim pathogenetischen Ansatz, wo nach Risikofaktoren geschaut wird, wird probiert, den Schwimmer in einer gefährlichen Situation zu retten.
Im salutogenetischen Modell wird man versuchen, den Menschen zu einem guten Schwimmer auszubilden, oder ihm das Schwimmen zu erleichtern, damit er alleine die schwierigen Situationen meistern kann (Bengel, Strittmatter und Willmann, 2001, S.141; Kipker 2008, S.25).“
Diese Metapher verdeutlicht, dass es für Antonovsky wichtig war, Faktoren zu finden, die, unabhängig von den äußeren Umständen des Lebens, gute Bedingungen und Perspektiven ermöglichen.
2.2.2 Auswirkungen des Konzepts der Salutogenese
Angeregt durch den Perspektivenwechsel Antonovskys gewann gesellschaftlich, politisch und auch wissenschaftlich das Thema Gesundheitsförderung an Bedeutung. Als Folge dieser Entwicklung lag der Fokus in den folgenden Jahrzehnten auf der Prävention von Krankheiten, also der Stärkung von Ressourcen und Bewältigungsstrategien, und somit auf einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Hinblick auf das psychische Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Beschäftigten (Bengel, Strittmatter, Willmann, 1998).
In den 80er Jahren verschärfte sich mit dem Aufkommen der New Economy der Widerspruch zwischen postmateriellen Werten, wie die Erfüllung von Bedürfnissen, und materieller Eingebundenheit in Form komplexer werdender hoher Arbeitsanforderungen. Um diesen gerecht zu werden, wurde es notwendig, den Alltag außerhalb der Arbeitszeit straff zu organisieren. Hierzu wurden vermehrt Trainings und Seminare zur Bewältigung von Stress und Rollenkonflikten für Arbeitnehmer angeboten (Bengel, Strittmatter, Willmann, 1998). Doch die Konflikte zwischen Handlungsanforderungen und beruflichen Zielen spitzten sich für viele berufstätige Menschen zunehmend zu, so dass 1986 erstmals der Begriff Work-Life-Balance geprägt wurde (Leist, 2005). Eine Balance zwischen den Hauptlebensbereichen Erwerbstätigkeit und Freizeit galt nun als erstrebenswert. Im Jahr 1989 wurde die europäische Rahmenrichtlinie über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Richtlinie 89/391/EWG) verabschiedet (Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen 2010, S. 87).
Laut Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beinhaltet Gesundheit heute nicht mehr nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern auch körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten für den Schutz der Gesundheit seiner Beschäftigten zu sorgen. Er ist hingegen nicht dazu verpflichtet, idealtypische Arbeitsbedingungen zu schaffen (Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen 2010, S. 17). Heute sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten mit einer weiterhin steigenden Anzahl neuer Anforderungen konfrontiert.
Seit 1990 führt die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (eine Agentur der Europäischen Kommission) alle fünf Jahre eine repräsentative Studie über die Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union durch. Diese Studie zielt darauf ab, die Wirkung von Prävention in den Bereichen Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit zu beurteilen. Im Zentrum der aus Sicht der Beschäftigten durchgeführten Studie stehen gesundheitliche Aspekte der Beschäftigten, wie psychische und physische Belastungen, Entlastungsfaktoren, Arbeitsorganisation und Führung, Weiterbildungsangebote, Sozialverträglichkeit der Arbeitszeiten, sowie Diskriminierung und Persönlichkeitsschutz (Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen 2010, S.7). Unternehmen müssen Dienstleistungen und Produkte immer kurzfristiger liefern und können sich „unproduktive“ Arbeitszeiten in Form von Beschäftigten, für die keine rentable Arbeit vorhanden ist, nicht mehr leisten. Auf der anderen Seite stehen die Beschäftigten, für die eine flexible Freizeitgestaltung und familiäre Interessen zunehmend an Wert gewinnen. Die Studie zeigt zudem, dass eine gute Work-Life Balance (hier: Gleichgewicht zwischen Belastungen und Ressourcen) zu einem subjektiven Gesundheitsgefühl und einer hohen Arbeitszufriedenheit führt (Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen 2010, S. 87).
2.3 Das heutige WLB-Konzept
Bis heute hat das Thema Work-Life-Balance stetig an Brisanz zugenommen. In den letzten 10 Jahren haben sich die Krankmeldungen aufgrund psychischer Störungen verdoppelt.
Von 100 Beschäftigten klagen 60 über einen hohen Termindruck, 56 über ein sehr hohes Arbeitstempo und 40 über extrem eintönige Arbeit (Glomm, 2009). Die Gründe hierfür sind vielschichtig und beruhen auf gesellschaftlichen, betrieblichen und individuellen Entwicklungen.
2.3.1 Die gesellschaftliche Entwicklung
Nennenswerte Einflussfaktoren auf gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen sind die demografische Entwicklung, eine steigende Frauenquote in den Führungsebenen, neue Technologien, Globalisierung, der Struktur- und Wertewandel, sowie steigende Anforderungen.
1. Der demographische Wandel in Deutschland
Ein Grund für die Brisanz des Themas Work-Life-Balance in Deutschland ist die demografische Entwicklung. Eine stetig sinkende Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und die steigende Anzahl älterer Menschen wirken sich u.a. auf wirtschaftliche Interessen, den Arbeitsmarkt, das Bildungs- und Erziehungswesen und die sozialen Sicherungssysteme aus. Im Jahr 2009 kamen auf 100 Personen im Erwerbsalter (20 bis unter 65 Jahre) 34 Personen im Rentenalter (ab 65 Jahre). 2030 wird sich diese Zahl voraussichtlich auf über 50 erhöht haben, während dieser Altersquotient 1970 noch bei 25 lag (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2011, S.3). Bereits seit vier Jahrzehnten sterben in Deutschland mehr Menschen, als Kinder geboren werden. Die Folge ist ein Bevölkerungsrückgang um 5,7% bis 2030, einhergehend mit gravierenden strukturellen Veränderungen in der Bevölkerung. Im Jahr 2030 werden voraussichtlich 17% weniger Kinder und Jugendliche und 15% weniger Personen im erwerbsfähigen Alter als heute in Deutschland leben. Hingegen wird die Anzahl der Menschen im Rentenalter um 33% zunehmen. Einer der Gründe für diese Entwicklung ist die konstant niedrige Geburtenrate in Deutschland von durchschnittlich 1,4 Kindern pro Frau. Diese Zahl wird voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten relativ konstant bleiben, während das durchschnittliche Alter, in dem Frauen ein Kind bekommen, weiter ansteigen wird. Somit werden auch zukünftig in Deutschland weit weniger Kinder zur Welt gebracht werden, als für einen Generationenersatz nötig wären.
Ein weiterer Grund für den demografischen Wandel ist die stetig steigende Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung. Die zunehmende Anzahl älterer Personen führ unweigerlich zu mehr Sterbefällen. Diese zwei Faktoren: Abnehmende Geburtenrate und zunehmende Sterbefälle werden das Geburtendefizit bis 2030 um etwa 150% erhöhen (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2011, S.15). Zu diesen Fakten kommt eine sich verändernde Einwanderungsbilanz, die sich durch die seit 2011 geltende Arbeitsmarktfreiheit für Bürger aus den EU Staaten auswirken wird. Zu den langfristigen Einflussfaktoren auf den Arbeitsmarkt gehören zukünftig demnach eine starke Alterung und Verringerung der Erwerbspersonenanzahl in Deutschland, sowie eine verstärkte Wanderungsbewegung (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2011, S.18). Für Unternehmen bedeutet diese Entwicklung einen Rückgang der Anzahl junger Berufseinsteiger und von Fachkräften, sowie einen Anstieg des Durchschnittsalters der Beschäftigten. Daraus resultierend sind Unternehmen zukünftig noch vermehrt darauf angewiesen Strategien zu entwickeln, um hochqualifizierte Arbeitnehmer halten zu können. Dies wird nur durch die Umsetzung geeigneter Work-Life-Balance Maßnahmen möglich sein.
Eine Angabe darüber, ob sich diese Prognosen durch die rasant angestiegene Anzahl an Flüchtlingen, die in 2015 und 2016 Deutschland erreicht haben, deutlich verändern wird, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich.
Weiterhin zeigt die Entwicklung, dass Frauen zunehmend stärker in das Erwerbsleben eingebunden werden müssen, um eine ausreichende Beschäftigungsfähigkeit in Deutschland aufrechterhalten zu können. Die Verantwortung familienfreundliche Lösungen zu finden, liegt neben der Politik auch bei den einzelnen Unternehmen, da es zeitnah nicht mehr möglich sein wird, auf gut ausgebildete Frauen in einem Zeitraum von bis zu drei Jahren Elternzeit zu verzichten (Gauger, 2009, S.24). Die jeweilige Lebensphase der Mitarbeiter wird zukünftig stärker beachtet werden müssen, damit sowohl die Bedürfnisse von Eltern kleiner Kinder also auch die Bedürfnisse älterer Mitarbeiter berücksichtigt werden können.
2. Gesellschaftliche Veränderungen
Seit ca. Mitte der 90er Jahre ist unsere Gesellschaft durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien von gravierenden Veränderungen im technologischen und wirtschaftlichen Bereich geprägt. Diese werden durch die Globalisierung, eine weltweite wirtschaftliche und politische Vernetzung, verstärkt. Der steigende Konkurrenz- und Innovationsdruck fordert ein Höchstmaß an Flexibilität, Effektivität und Effizienz von den Unternehmen. Klassische Merkmale der Industriegesellschaft, wie stabile Beschäftigungsverhältnisse, hierarchische Organisationsformen und die lebenslange Umsetzung eines einmal festgelegten Berufsbildes verlieren vermehrt an Bedeutung. Die aktuell zu beobachtende Pluralisierung und Flexibilisierung sowohl betrieblicher als auch gesellschaftlicher Regularien resultiert aus einer stärkeren Wissensbasis von Arbeit und Organisationsstrukturen, die einen Wandel zur sogenannten Wissensgesellschaft kennzeichnet (Heidenreich, 2002, S.10). Die Folgen sind betriebliche Erwartungen zu mehr Eigenverantwortung der Beschäftigten, nichthierarchische Koordinationsstrukturen und ergebnisorientierte Gehaltsregelungen. Zudem werden durch die Entwicklung der Globalisierung eine hohe Mobilität, die die Bereitschaft zu Auslandsaufenthalten einschließt, und Multilingualität vorausgesetzt. Die Organisation eines erfüllten Privatlebens wird für den Arbeitnehmer immer schwieriger (Gauger, 2009, S.27).
In diesem Zusammenhang ist ein weiterer Aspekt zu nennen, der als Subjektivierung oder auch Entgrenzung von Arbeit bezeichnet wird. Die Begriffe kennzeichnen in der Soziologie den Strukturwandel von Arbeit dahingehend, dass berufliche Anforderungen – insbesondere in hochqualifizierten Berufen – vermehrt vorschreiben, sich ganzheitlich, also mit allen Ressourcen und Kompetenzen, selbstverantwortlich in die Arbeit einzubringen. Als Konsequenz wird eine klare Rollentrennung zwischen Berufs- und Privatperson für den Einzelnen unmöglich. Die Lebensplanung verläuft so zunehmend berufszentriert, was oft zu einer Kollision mit privaten Lebensbedürfnissen führt. Die Folge sind intrapsychische Konflikte, die zu einer Reflexion der eigenen Lebensführung zwingen (Hoff, Grote, Dettmer, Hohner, Olos, 2005, S.197).
Insbesondere für globale Unternehmen sind deshalb Work-Life-Balance Maßnahmen unabdingbar, um die Lebenszufriedenheit und damit die Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter aufrecht zu erhalten.
Ein bereits erwähnter Grund für die aktuelle Relevanz von Work-Life-Balance ist die stetige Zunahme erwerbstätiger Mütter in hochqualifizierten Berufen. Eine Koordination und Integration von Beruf und Familie in der individuellen Lebensgestaltung wird nach Hoff et al. (2005, S.197) weitaus häufiger von Frauen mit Familie in hochqualifizierten Berufen als von Männern mit Familie praktiziert. Familienväter entscheiden sich hingegen öfter für getrennt verlaufende Handlungsbereiche, wobei der berufliche Bereich dominiert. Abele, Hoff und Hohner (2003) sehen darin die Ursache, dass die Männer insbesondere in besonders prestigeträchtigen Fachgebieten häufig erfolgreicher sind als Frauen. Als Folge werden Familien immer später gegründet. Während 1980 nur jede dritte 29- jährige Frau kein Kind hatte, ist heute nur jede dritte unter 30- jährige Frau in Deutschland Mutter. Das Durchschnittsalter für die Geburt des ersten Kindes liegt heute bei über 30 Jahren, Tendenz steigend. Hinzu kommt die geringe Geburtenrate von 1,4 Kindern pro Frau und eine steigende Anzahl von Frauen, die kinderlos bleiben (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2011). Die klassische Großfamilie wurde durch zahlreiche neue Familiengebilde abgelöst. So steigt die Zahl der Alleinerziehenden, der nichtehelichen Lebensgemeinschaften und der Patchwork-Familien. Moderne Work-Life-Balance Konzepte müssen diese neuen, komplexeren Familienstrukturen berücksichtigen (Gauer, 2009, S.28). Handlungsbedarf besteht dabei sowohl auf Seiten des Staates und der Länder, als auch auf Seiten der Unternehmen, die durch Betreuungseinrichtungen, flexible Teilzeitmodelle, Heimarbeit und die Schaffung eines lernfreundlichen Klimas wirksame Maßnahmen umsetzen können.
2.3.2 Die betriebliche Entwicklung
Die erste Priorität hat für ein Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit. Aus diesem Grund gab es lange Zeit aus betrieblicher Sicht kein Motiv, sich um Work-Life-Balance Maßnahmen zu kümmern.
Dennoch gewinnt das Thema Work-Life-Balance verstärkt an Bedeutung und viele Firmen versuchen das Gesundheitsverhalten ihrer Mitarbeiter positiv zu beeinflussen. Sie haben erkannt, dass förderliche Arbeitsbedingungen im Hinblick auf sowohl physische, als insbesondere auch psychische Gesundheit, eine Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg darstellen. Angesichts des wachsenden Wettbewerbs gilt es hoch qualifizierte Arbeitskräfte an sich zu binden. Argumente für den Einsatz von Work-Life-Balance Maßnahmen sind:
- Eine höhere Attraktivität für hochqualifizierte Mitarbeiter
- Produktivitätssteigerung durch erhöhte Arbeitsmotivation und weniger Fehlzeiten
- Erhöhung der Mitarbeitermotivation und –bindung
- Sicherung einer nachhaltigen Unternehmensrendite
- Erhöhung der Akzeptanz des Unternehmens in der Öffentlichkeit
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2005)
In diesem Zusammenhang sind neben den zahlreichen positiven zudem die paradoxen Folgen von immer populärer werdenden Humanisierungsprogrammen zu erwähnen. Nach Hochschildt (2002) besteht die Gefahr bei ausgeprägten Humanisierungsprogrammen, wie sie in den USA üblich sind, dass die Arbeit so immer humaner und das Familienleben infolge zunehmender Rationalisierung immer inhumaner wird. Hochschildt resümiert in ihrer 1997 in den USA erschienenen betrieblichen Studie, dass die Work-Life-Balance Angebote, wie flexible Arbeitszeiten, fürsorgliche Vorgesetzte, Mitarbeiterbefragungen und Kinderbetreuung, in dem untersuchten Betrieb dazu führe, dass Eltern länger arbeiteten und sich der Firma besonders stark verpflichtet fühlten (Hochschildt 2002). Hochschildt entlarvte sämtliche Maßnahmen zur Förderung von Work-Life-Balance als pure Täuschungen, die in der Realität Abhängigkeiten schafften, mit der Folge, dass die Mitarbeiter immer weniger Zeit mit der Familie verbrachten. Aus dieser Situation heraus entstünden zunehmend Konflikte mit Kindern und Partner, was wiederum dazu führte, dass die Mitarbeiter regelrecht dazu verführt würden, mehr Zeit in der freundlichen und friedlichen Firma zu verbringen, um dem Alltagschaos zu entfliehen (Erler (2), 2003).
Die Arbeitnehmer würden vermutlich in der Berufswelt eine höhere Wertschätzung erfahren und fühlten sich kompetenter. Mit dieser These begründete Hochschildt, dass die vom Betrieb durchaus angebotenen flexibleren und kürzeren Arbeitszeiten von den Mitarbeitern gar nicht genutzt worden seien.
Die Schlussfolgerung eines solchen Kausalzusammenhangs zwischen der Nichtnutzung angebotener Arbeitszeitmodellen und einer Flucht aus der Familie ist durchaus zu hinterfragen. Denn auch in solchen Betrieben, die Humanisierungsprogramme und in diesem Zusammenhang flexible Arbeitszeiten anbieten, ist die tatsächliche Unternehmenskultur, die lange Arbeitszeiten schätzt und für einen beruflichen Erfolg voraussetzt, nicht alleine durch einzelne Maßnahmen zu ändern. Eine Unternehmenskultur ist tief verankert und lässt sich nur sehr langsam umprogrammieren. Die Mitarbeiter, denen flexible und kürzere Arbeitszeiten zwar angeboten werden, wissen also, dass von ihnen erwartet wird, diese nicht zu beanspruchen.
Inzwischen können in den USA zahlreiche Betriebe 20-40% weibliche Manager vorweisen. Führungskräfte werden finanziell belohnt, wenn sie Mütter befördern. Das renommierte FamilyWork Institute New York führt im Abstand von sieben Jahren die „National Study of the changing workforce“ durch. Bereits in den Ergebnissen 2002 zeigte sich eine nachweisbare Veränderung über die Zeit. Im Vergleich zu den Vorjahren fühlten sich Mitarbeiter stärker respektiert und wahrgenommen. Gleichzeitig nahmen, insbesondere bei Fach- und Führungskräften, Überarbeitungssymptome durch steigende Arbeitszeiten und durch eine Intensivierung der Arbeit zu (Erler (2), 2003).
2.3.3 Die individuelle Perspektive
Die permanent wachsenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen wirken sich unvermeidlich auf die täglichen Herausforderungen jedes einzelnen Menschen aus.
Nach Cassens (2003) sind hauptsächlich fünf Bereiche im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben von Bedeutung:
- Identifikation mit der Tätigkeit, finanzielle Absicherung, Arbeitsatmosphäre
- Familie, Freunde und soziale Bindungen
- Gesundheit
- Streben nach Anerkennung
- Ideologie, Religion
All diese Kräfte beeinflussen sich gegenseitig. Sie können sich entweder begünstigend auf die anderen Bereiche auswirken oder Konfliktpotentiale schaffen. Die individuelle Einschätzung des persönlichen Gesundheitszustands gilt als valider Indikator für objektiv gemessene gesundheitliche Probleme (Grebner et al. 2001, S.136).
Um eine persönliche Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten, ist es für jeden Einzelnen wichtig herauszufinden, welche Wünsche, Bedürfnisse und Motive ihn unter Berücksichtigung aller Lebensbereiche antreiben.
2.3.4 Geschlechtsspezifische Unterschiede von WLB
Zunächst sollte festgestellt werden, dass es erst sehr wenige Studien gibt, die die Work-Life-Balance von Frauen und Männern direkt vergleichen. Bei einem Großteil der bereits existierenden Studien handelt es sich um qualitative Forschungen. In ihrer qualitativen Studie „Gender and work-life balance for middle-aged men and women“ von 2009, stellten Emslie und Hunt fest, dass Frauen sich mit der Koordination von Terminen schwerer taten und zu Hause mehr über die Arbeit nachdachten. Männer hingegen empfanden mehr Stress im Zusammenhang mit Work-Life-Balance, wenn sie kleine Kinder hatten und besorgt waren, dass sie wichtige Meilensteine der kindlichen Entwicklung verpassen könnten. Dieser Aspekt wurde durch die Auffassung der Männer, dass die Rolle des Ernährers genauso wichtig sei, wie die direkte Rolle des Vaters, innerlich etwas korrigiert. (Emslie Hunt, 2009).
Bezüglich sogenannter Heilberufe gibt es einige Studien, die einzelne Bereiche von Work-Life-Balance von männlichen und weiblichen Ärzten vergleichen (Gander, Briar, Garden, Purnell, Woodward, 2010; Keeton, Fenner, Johnson, Hayward, 2007). In einer Studie von 2010 (Gander et al., 2010), die sich mit geschlechtsspezifischen Unterschieden von Work-Life-Balance bei Assistenzärzten beschäftigt, zeigte sich, dass sowohl weibliche, als auch männliche Teilnehmer Schwierigkeiten mit der Selbstführsorge, mit persönlichen Beziehungen und sozialer Isolation angaben. Entsprechend äußerten beide Geschlechter gleichermaßen den Wunsch nach einer besseren Work-Life-Balance. Der einzige signifikante geschlechterspezifische Unterschied in dieser Studie zeigte sich bei Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten. Hier waren die Frauen nach eigenen Angaben, stärker betroffen, als ihre männlichen Kollegen. Diese Studie beschäftigt sich ausschließlich mit Faktoren, die im Zusammenhang mit Erschöpfung stehen (Gander et al., 2010).
Im Vergleich dazu haben Keeton et al. (2007) eine Studie veröffentlicht, die sich mit der Zufriedenheit der beruflichen Laufbahn, Work-Life-Balance und Burnout bei Ärzten beschäftigt. Sie fanden heraus, dass sowohl Frauen, als auch Männer ihre Work-Life- Balance als ausgewogen empfanden. Zudem wurde deutlich, dass die Anzahl der Kinder zu Hause bei beiden, Männern und Frauen, einen signifikanten Einfluss auf die empfundene Work-Life-Balance und emotionale Erschöpfung hatte. Eine direkte Korrelation zwischen Work-Life-Balance und emotionaler Erschöpfung oder Burnout wurde in dieser Studie hingegen nicht analysiert.
Für Fachbereiche, die eine hohe Qualifikation erfordern, liegen einige Studien vor, die sich mit der geschlechtsspezifischen Wahrnehmung von Work-Life-Balance beschäftigen (Armenti, 2004). Mallinckrodt und Leong (1992) fanden heraus, dass weibliche Fachkräfte eher unter Ängsten und Depressionen litten, als ihre männlichen Kollegen. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass Akademikerinnen im Vergleich zu Akademikern seltener heirateten und weniger Kinder bekamen.
In einer Untersuchung von HochschullehrerInnen wurde deutlich, dass die weiblichen Fakultätsmitarbeiter im Durchschnitt weniger Kinder hatten, als ihre männlichen Kollegen, weniger Kinder bekamen, als sie eigentlich wollten und öfter als die Männer in unbedeutenden Positionen arbeiteten oder die akademische Laufbahn verließen (Wolfinger et al., 2009). Zudem gaben die Frauen weniger Zeit für Freizeitaktivitäten und öfter das Gefühl von Überarbeitung an, als die männlichen Mitarbeiter (Duxbury et al., zitiert in Armenti, 2004). Andere Studien haben entsprechend gezeigt, dass weibliche Hochschulmitarbeiter größere Schwierigkeiten hatten, eine Festanstellung zu erreichen, als ihre männlichen Kollegen (Connelly Ghodsee, 2011). Trotz der Tatsache, dass höher qualifizierte Berufe typischerweise mehr Flexibilität bezüglich der Arbeitszeiten ermöglichen, gaben Frauen signifikant häufiger an, diese Flexibilität oder eine Wahl bezogen auf Work-Life-Balance nicht oder erst sehr spät in ihrer Berufslaufbahn zu erleben. (Philipsen, 2010). Akademikerinnen kündigen zudem ihre Positionen oder Jobs häufiger, als Akademiker aufgrund zeitlicher oder finanzieller Einschränkungen, sowie einem Mangel an Unterstützung oder dem Gefühl nicht ernst genommen zu werden (Lynch, 2008; Gilbert Rossman, 1992). Während die geschlechtsspezifischen Unterschiede unter Akademikerinnen und Akademikern offensichtlich signifikant sind, sollte beachtet werden, dass es sich bei der Mehrzahl der Studien zu diesem Thema um Untersuchungen handelt, die fast 20 Jahre alt sind. Im Hinblick auf den wirtschaftlichen und demographischen Wandel ist anzunehmen, dass hoch qualifizierte Frauen und Männer mittlerweile mit ähnlichen Work-Life-Balance Problemen konfrontiert sind (Aumann et al., 2011).
Einige US-Studien zur Work-Life-Balance haben Zusammenhänge herausgestellt, die Geschlechterunterschiede und ethnische Vielfalt betreffen (Bianchi Milkie, 2010). Eltern hispanischer Herkunft erlebten demnach Konflikte zwischen Familien- und Berufsleben stärker als weiße oder schwarze Familien, wobei die spanischen Mütter hiervon sehr viel häufiger betroffen waren, als die Väter (Roehling, Jarvis, Swope, 2005). Entgegen des Trends der weißen amerikanischen Bevölkerung, verrichteten spanische und asiatische Frauen in den USA unverhältnismäßig mehr Hausarbeit, als ihre Männer (Sayer Fine, 2010).
Diese fehlende Unterstützung hatte vermutlich einen gravierenden Einfluss auf die Work-Life-Balance bei diesen Frauen. Während sich die meisten Studien auf die Work-Life-Balance von weißen Männern und Frauen konzentrieren, gibt es noch Bedarf für mehr Forschung im Bereich Work-Life-Balance im Zusammenhang von Geschlecht und ethnischer Vielfalt. Obwohl für Klienten ethnischer Minderheiten in der Regel Work-Life-Balance Probleme nicht im Vordergrund stehen, sind sie vermutlich dennoch die Ursache für einige Schwierigkeiten in den Partnerschaften und Familien (Barnett, Del Campo, Del Campo, Steiner, 2003).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass es nicht ausreichend Studien gibt, die sich mit Work-Life-Balance bezogen auf Geschlechterunterschiede beschäftigen, insbesondere im Zusammenhang mit dem psychologischen Wohlbefinden der berufstätigen Bevölkerung. Lediglich wenige Studien haben sich mit der Korrelation von Work-Life-Balance und generellem Wohlbefinden befasst und wenn, dann nur Teilaspekte der Begriffe untersucht (Wilkinson 2013, S. 30ff.).
2.4 Belastungs- und Schutzfaktoren
Bezüglich der Belastungs- und Schutzfaktoren wird zwischen denen im Beruf und denen im privaten Umfeld differenziert .
Berufliche Belastungs- und Schutzfaktoren
Eine hohe Verantwortung für Personen und/oder Sachwerten, ein ausgeprägtes Konkurrenzverhalten unter den Beschäftigten, ein Mangel an kollegialer Unterstützung, Isolation, fehlende soziale Kompetenzen bei Vorgesetzten, Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten, eine mangelnde Anerkennung der Leistung, strukturelle Veränderungen im Unternehmen, ein drohender Arbeitsplatzverlust, Angst vor Misserfolg, Reisetätigkeit, unzureichende Einblicke in Betriebsabläufe, Nässe, Kälte, Hitze, Lärm, zu wenig oder zu aggressive Beleuchtung, chemische oder biologische Gefahrenstoffe und schwere körperliche Arbeit sind Beispiele für teilweise häufig vorkommende Belastungen im Beruf, denen mit einer Anzahl an Schutzfaktoren entgegengewirkt werden kann.
Diese sind zum Beispiel passende qualitative und quantitative Arbeitsanforderungen, ein Arbeitsklima der gegenseitigen Wertschätzung und Unterstützung, Anerkennung durch regelmäßige Rückmeldung, ein offenes Kommunikationsverhalten, konsequente Umsetzung von Interventionen bei Mobbing, ein gesundheitsförderlich gestalteter Arbeitsplatz durch die Einhaltung von lärm- und schadstoffbedingten Grenzwerten, dem Vorhandensein von Schutzausrüstung, flexible Arbeitszeiten, wechselnde Anforderungen und die Förderung von Teamarbeit mit ausreichender Gruppenautonomie. Zudem ein guter und frühzeitiger Informationsfluss und die Beteiligung der Beschäftigten bei betrieblichen Veränderungen. Außerdem gelten eine hohe fachliche Qualifikation und Berufserfahrung als berufliche Schutzfaktoren.
Belastungsfaktoren im individuellen und privaten Umfeld Zu den Belastungsfaktoren außerhalb der beruflichen Tätigkeit zählen eine fehlende soziale Unterstützung im Familien- und Freundeskreis, keine emotional sichere Bindung an eine Bezugsperson, Konflikte in der Familie oder innerhalb sozialer Beziehungen, ein Mangel an kognitiven und sozialen Kompetenzen, sowie an der Fähigkeit das Leben sinnvoll und strukturiert zu gestalten. Außerdem ein negatives Selbstwertgefühl und Schicksalsschläge (Glomm, 2009). Den aufgeführten Belastungen entsprechend sind ein positives Selbstwertgefühl, das Vorhandensein kognitiver und sozialer Kompetenzen, eine positive Grundhaltung (Kohärenzsinn), eine interne Kontrollüberzeugung und gute Problemlösefähigkeiten als individuelle Schutzfaktoren zu nenne. Weitere Schutzfaktoren des privaten Umfelds sind mindestens eine sichere Bindung an eine Bezugsperson, eine gute soziale Unterstützung im Familien- und Freundeskreis, sowie das Erleben von Sinn und Struktur im Leben (Glomm, 2009).
Besteht zwischen den Belastungs- und den Schutzfaktoren eine Divergenz, kann in Abhängigkeit der kognitiven Bewertung einer Situation für das Individuum Stress entstehen (siehe Abbildung 2).
Abbildung 2: Zusammenhang von Belastungs- und Schutzfaktoren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.4.1 Stress
Ursprünglich stammt der Begriff Stress (engl. Druck, Beanspruchung; lat. stringere: anspannen) aus der Geologie, wo er eine einseitige Kraft bei tektonischen Vorgängen definiert. Der österreichisch-kanadische Forscher Hans Selye (1907-1982) hat den Ausdruck Stress erstmals auf psychologische Vorgänge, die Reaktionen von biologischen Systemen auf Belastungen darstellen, übertragen (Stangl, 2012). Stress ist zunächst ein neutraler Begriff, der die dynamische Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt beschreibt und somit einen festen Bestandteil des täglichen Lebens darstellt. Die negative Komponente wurde von Selye als Distress und die positive als Eustress bezeichnet.
Distress
Der sogenannte negative Stress entsteht als Folge einer Fehleinschätzung eigener Fähigkeiten oder durch die unzureichende Fähigkeit des Körpers, sich an Umweltreize anzupassen.
Eustress
Positiver Stress wird in Situationen erfahren, die zwar ein hohes Belastungspotential aufweisen, welches aber nach der individuellen Einschätzung gut zu bewältigen ist. Stellt sich das erwartete Erfolgserlebnis auch ein, werden Selbstvertrauen und Motivation gestärkt (Gauger 2009).
Ob eine Stressreaktion eine Eustress- oder Distress – Erfahrung wird, hängt von der individuellen kognitiven Bewertung der Stressfaktoren ab. Hierbei werden persönliche Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Stresssituation und ihren erfolgreichen Abschluss eingeschätzt (Krohne, 1997, S.268). Erlebt eine Person ein Ereignis als nicht kontrollierbar, so wird dieses als besonders belastend erlebt. Die Person fühlt sich „gestresst“. Es wird zwischen psychischen und physischen Auswirkungen von Stress unterschieden. Psychische Auswirkungen von Stress werden in erster Linie durch Verhaltensveränderungen sichtbar. Oft werden gesundheitsfördernde Aktivitäten, wie gesunde Ernährung, körperliche Aktivität, ausreichend Schlaf und Entspannung vernachlässigt, schädigende Verhaltensweisen, wie Rauchen, Alkoholkonsum und soziale Isolation hingegen verstärkt. Hinzu kommen Auffälligkeiten, wie ein nachlassendes Erinnerungsvermögen, eine gesteigerte Reizbarkeit und ein schlechteres Konzentrationsvermögen (vgl. Cox et al, 2005). Bei einer andauernden als Stress erlebten Belastung, sind mögliche psychische Folgen depressive Zustände, chronische Müdigkeit, eine stark verringerte Leistungsfähigkeit und eine emotionale Erschöpfung bis hin zum Burn-Out (Cassens, 2003).
Da Stress keinen direkten Einfluss auf die Physis hat, sind auch die physischen Auswirkungen als Folgen psychischer Veränderungen zu deuten. Stress führt zu einem Anstieg des Adrenalin- und Cortisolspiegels im Körper, was zu einem erhöhten Risiko für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems führt (Cox et.al., 2005).
Aufgrund einer gestörten Regeneration durch beispielsweise Schichtarbeit oder Überstunden, verändert sich der Hormonspiegel, insbesondere der des Melatonins, welches für die Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus zuständig ist (Cassens, 2003). Die individuelle Selbstreflexion und Urteilsfähigkeit ist ein entscheidender Faktor für die Prävention dauerhaft negativer Auswirkungen von Stress (Cassens, 2003, S.356).
Nur bei einem guten Gesundheitszustand ist es möglich, dass Motivation und Leistungsbereitschaft aufrechterhalten werden. Somit sind Gesundheitsförderung und Stressminderung zentrale Bestandteile des Work-Life-Balance Verständnisses.
2.4.2 Gesundheit
Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gesundheit
„ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ (Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, 22.07.1946, New York. Deutsche Übersetzung. Stand: 8.5.2014).
In der sozialwissenschaftlichen Forschung definiert Klaus Hurrelmann (2010, S.8) Gesundheit als
„Zustand des objektiven und subjektiven Befindens einer Person, der gegeben ist, wenn diese Person sich in den physischen und sozialen Bereichen ihrer Entwicklung im Einklang mit den eigenen Möglichkeiten und Zielvorstellungen und den jeweils gegebenen äußeren Lebensbedingungen befindet“.
Gesundheit ist hier als eine Art Gleichgewicht zwischen Risiko- und Schutzfaktoren zu verstehen. Eine produktive Nutzung der eigenen Leistungspotentiale ist nur in den Lebensphasen möglich, in denen dieses Gleichgewicht gelingt.
In Deutschland werden die Faktoren für ein gesundes Leben auch sozialpolitisch beeinflusst.
Die Bevölkerungsschichten mit einem geringen Einkommen und Bildungsstand haben eine kürzere Lebenserwartung aufgrund einer ungesünderen Lebensweise als privilegiertere Schichten (Schlack, 1995, S.90).
Nach einer Studie im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) lassen sich drastische Unterschiede in der psychischen Gesundheit zwischen Arbeitslosen und Beschäftigten belegen: Depression, Ängste, ein geringes Selbstwertgefühl und Einsamkeit bis hin zur Resignation konnten als wesentliche Symptome einer schlechteren psychischen Gesundheit von Arbeitslosen herausgestellt werden (DGB. Arbeitsmarkt aktuell, Nr.9. August 2010, S.2f).
Die gesundheitliche Indiskrepanz zwischen den Bevölkerungsschichten hat nach Mielck (2005, S.53) verschiedenen Ursachen:
1. Höhere gesundheitliche Belastungen, z.B. am Arbeitsplatz
2. Geringere Verfügbarkeit an Bewältigungsressourcen, z.B. soziale Unterstützung
3. Schlechtere gesundheitliche Versorgung durch z.B. schwierigere Arzt-Patienten-Kommunikation
4. Geringeres Bewusstsein für Gesundheits- und Krankheitsverhalten, z.B. Ernährung, Rauchen.
Neuere Studien zeigen zudem, dass wohlhabende Schichten größere Möglichkeiten haben, sich Umweltbelastungen, wie Feinstaub und Lärm zu entziehen (Schlüns, 2007, S. 26-31). Zu ähnlichen Erkenntnissen wie in Deutschland kommt die „National Vietnam Veterans’ Readjustment Study“ in den USA, die Risiko- und Schutzfaktoren für die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) bei Vietnamkriegsveteranen untersuchte. Zu den Schutzfaktoren zählten ein hoher sozioökonomischer Status und eine Collegeausbildung (Price, 2012).
Dieser Zusammenhang zwischen Armut, mangelnder Bildung und einem schlechteren physischen und auch psychischen Gesundheitszustand fasst der Begriff „sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen“ zusammen.
Die gesundheitliche Ungleichheit zeigt sich weltweit. In den Entwicklungsländern führt Armut oft zu einer mangelhaften Ernährung von Kindern, was sich wiederum negativ auf deren geistige, motorische und sozial-emotionale Entwicklung auswirkt. Die betroffenen Kinder sind weniger leistungsfähig, wodurch sie beruflich gering qualifiziert bleiben und wiederum ein schlechtes Einkommen erzielen. Weltweit sind nach Schätzungen 219 Millionen Kinder unter fünf Jahren aufgrund ihrer Armut kognitiv eingeschränkt. In Afrika sind es 61% der Kinder (wissenschaft.de: Studie: Armut beeinträchtigt die geistige Entwicklung von Kindern, abgerufen: 18.12.2013).
2.5 Umsetzung von Work-Life-Balance
Bei der Umsetzung von Work-Life-Balance Maßnahmen wird zwischen betrieblichen Maßnahmen, die auf unternehmerische Ziele setzen, und individuellen Maßnahmen, die der besseren Kontrollierbarkeit eigener Lebenssituationen dienen, unterschieden.
2.5.1 Betriebliche Work-Life-Balance Maßnahmen
Das unternehmerische Ziel von Work-Life-Balance Maßnahmen ist in erster Linie die Aufrechterhaltung des betrieblichen Erfolges, dessen Voraussetzung eine möglichst gesunde Belegschaft ist. Es hat sich gezeigt, dass die Unternehmenskultur, also die Kommunikationskultur und die psychologische Führung, viel entscheidender ist, als die objektive Menge von Arbeit (Hoff, et al., 2005).
Zu den am häufigsten anzutreffenden Work-Life-Balance Maßnahmen gehören die Umsetzung flexibler Arbeitszeitmodelle, wie Jobsharing oder Homeoffice, Maßnahmen zur Förderung der Familienfreundlichkeit, ein guter interner Informationsfluss, Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote, Vorbildverhalten auf der Führungsebene, sowie Maßnahmen zur Gesundheitsprävention. Problematisch ist, dass Teilzeitangebote nach wie vor meist an untere Positionen und an Frauen gerichtet sind.
Diese werden so in alten Rollenerwartungen gehalten. Führungsmitarbeiter haben zudem oft keine Kinder und sind daher nicht sensibel genug Projekte zur Förderung der Work-Life-Balance ins Rollen zu bringen (Archut, 2009). Eine mögliche Lösung wäre, dass Vorgesetzte, die Work-Life-Balance Maßnahmen unterstützen, honoriert werden. Für viele Selbständige und in den sogenannten Heilberufen sind viele dieser Work-Life-Balance Maßnahmen, wie Homeoffice und Jobsharing gar nicht oder nur schwer umsetzbar.
2.5.2 Individuelle Work-Life-Balance Maßnahmen
Ein elementares Ziel individueller Work-Life-Balance Maßnahmen ist die Kontrolle über die persönliche Lebenssituation. Sowohl Arbeits- als auch Privatleben sollten frei bestimmt worden sein und mit eigenen Werten und Zielen Konform gehen. Obwohl der objektive Anteil von Freizeit in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen ist, wird sie häufig nicht zur Erholung genutzt, sondern mit familiären Problemen, Arbeiten im Haushalt, Aktivurlaub oder dem Surfen im Internet verbracht (vgl. Hoff et. al., 2005). Zu den Auswirkungen unzureichender Work-Life-Balance Maßnahmen im privaten Bereich gehören eine hohe Scheidungsrate, der Verlust des sozialen Umfelds, Zeitmangel, Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch und schließlich ein Burnout. Trainings für ein besseres Zeitmanagement, die Verringerung der Diskrepanz von verschiedenen Rollenanforderungen und die Förderung von Selbstmanagement sind Lösungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
Da sich die Studie in der vorliegenden Arbeit explizit mit der Work-Life-Balance angehender PsychotherapeutInnen beschäftigt, ist ein genaues Verständnis des Berufes von PsychotherapeutInnen, sowie der unterschiedlichen Richtlinienverfahren bedeutsam. Das folgende Kapitel beschäftigt sich daher mit den unterschiedlichen Ansätzen von Psychotherapie, sowie den entsprechenden Unterschieden im Berufsbild.
3. Charakteristika der Psychotherapie
Was ist eigentlich Psychotherapie? In der wörtlichen Übersetzung bedeutet der Begriff Psychotherapie (von griechisch ψυχή psychḗ ‚Atem, Hauch, Seele‘ und θεραπεύειν therapeúein ‚pflegen, sorgen‘) einerseits die Behandlung seelischer Probleme und andererseits eine Behandlung mit seelischen Mitteln.
Die ersten Ansätze psychotherapeutischer Methoden, wie Hypnose, Suggestion, Imagination oder Traumdeutung sind in den philosophischen-anthropologischen Schriften von Spinoza zu finden (Wetzel Linster, 1992, S. 627f).
Das Psychotherapeutengesetz von 1999 definiert Psychotherapie als "Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist“.
Beispiele für „Störungen mit Krankheitswert“ sind Angststörungen oder Depressionen. Eine offizielle Übersicht und Definition psychischer Störungen sind in dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebenen und international anerkannten Diagnoseklassifikationssystem ICD10 (International Statistical Classification of Diseases and related Health Problems) zu finden.
3.1 Anerkannte psychotherapeutische Richtlinienverfahren
Zum heutigen Zeitpunkt gibt es drei verschiedene von den Krankenkassen anerkannte psychotherapeutische Richtlinienverfahren. Die Psychoanalyse, die tiefenpsychologisch orientierte Therapie und die Verhaltenstherapie.
[...]
- Arbeit zitieren
- Sandra Tapp (Autor:in), 2017, Work-Life-Balance und psychische Gesundheit in der Psychotherapeutenausbildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418676
Kostenlos Autor werden



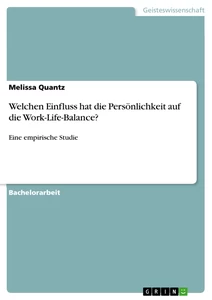

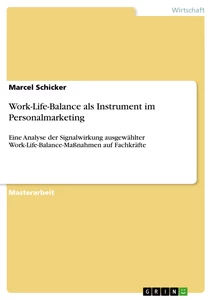




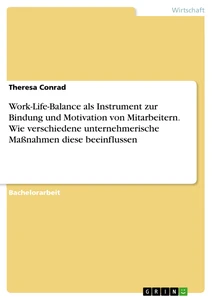



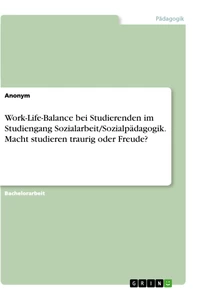








Kommentare