Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Einleitung
I.3. Kritische Lebensereignisse
3.1 Eine Einführung
3.2 Verlust und Trauer als Krise und Chance im menschlichen Leben
4. Bindung und Trennung
4.1 Die Bindungstheorie John Bowlbys
4.2 Die Forschungen von Mary Ainsworth und daraus abgeleitete Erkenntnisse über das Bindungsverhalten Erwachsener
4.3.1 Bindungs- und Bedeutungsvarianten von Familie und das Trauma des Verlusts
5. Faktoren der Trauer
5.1 Sterben und Trauer in der modernen Gesellschaft
5.2 Trauerphasen und Traueraufgaben
5.3 Folgen der Trauer
5.3.1 Allgemeine Trauersymptome
5.3.2 Pathologische Trauer
6. Verlust eines Kindes
6.1 Verschiedene Arten der Todeserfahrung - Tod eines Kindes durch
6.1.1 Fehl-, Todgeburt
6.1.2 Plötzlicher Kindstod (SIDS)
6.1.3 Schwangerschaftsabbruch
6.1.4 Krankheit
6.1.5 Plötzlicher unerwarteter Tod
a) Unfall
b) Gewaltverbrechen
6.1.6 Suizid
7. Partnerschaften in der Trauer
7.1 Geschlechtsspezifische Aspekte der Trauer
7.2 Veränderte Ehe-/Partnerbeziehung
8. Geschwistertrauer und Familiendynamik
8.1 Das Trauerverhalten von Kindern und Jugendlichen
8.1.1 Das kindliche Todeskonzept und
entwicklungspsychologische Voraussetzungen
8.1.2 Der Einfluss der Eltern auf das Trauerverhalten der Kinder
8.1.3 Faktoren der Geschwistertrauer
8.2 Veränderungen in Familienkonstellationen und deren
Auswirkungen auf die Familiendynamik
II 9. Qualitative Interviews mit Fachkräften und betroffenen Eltermn
9.1 Trauerbegleitung in Gesprächskreisen
9.2 Theoretische Anforderungen an Trauer-Gesprächskreise
9.3 Fortbildung zur Trauer- Verlust- und Hinterbliebenenbegleitung
9.4 Persönliche Trauererfahrung und Supervision bzw. Selbsthygiene
des Trauerberaters
9.5 Ergebnisse der Interviews mit den Trauerberatern
10. Selbsthilfegruppen
10.1 Anforderungen an und unterschiedliche Formen einer Selbsthilfegruppe
10.2 Ergebnis des Interviews mit einem betroffenen Ehepaar
10.3 Selbsthilfe und Soziale Arbeit
11. Abschlussgedanken
Literaturverzeichnis
Anhang: A: Leitfaden-Interview zur Befragung von Trauerberatern
A1 – A6: Interviews mit Trauerberatern
B: Leitfaden-Interview zur Befragung von betroffenen Eltern
B1: Interview mit Ehepaar B
C: Das Faltblatt „Trauerzeit“ der Region Mönchengladbach
D: Adressen von Selbsthilfegruppen oder Beratungsstellen
1. Vorwort
„Bedenkt - den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben...“
(Mascha Kaleko)
Dieser Vers sowie ein Erlebnis, das ich im August des letzten Jahres während meines Praktikums in einer Mutter-Kind-Klinik waren die Beweggründe für den Beginn dieser Arbeit. Eine Mutter hatte damals den Verlust ihres Patenkindes zu beklagen und war sehr betrübt und bestürzt. Sie erzählte mir von ihrer Familie und wie sehr alle unter dem Verlust litten. Das war mein erster Kontakt zu „Verwaisten Eltern“ bzw. den Familienangehörigen.
Die Thematik „Sterben und Tod“ hat mich im Rahmen meines Studiums an der Hochschule Niederrhein immer wieder beschäftigt, nicht zuletzt wegen der persönlichen Konfrontation mit dem Thema aufgrund des Verlustes meines Vaters im Alter von 10 Jahren. Obwohl die Zahl psychologischer Publikationen zur Todesproblematik immer größer wird, findet man in der Gesellschaft noch immer eine allgemeine Tabuisierung von Tod und Trauer.
Während des Studiums werden gelegentlich die psychosozialen Auswirkungen eines Elternverlustes auf das Kind besprochen und bearbeitet. Doch wie sieht die Situation aus, wenn Eltern ihr Kind verlieren? Welche Folgen hat der Verlust eines Kindes für die Familie? Wie gehen Eltern mit dem Tod ihres Kindes um, wie leben sie damit? Und woran liegt es, dass einige Familien daran scheitern, andere diese schwere Prüfung bewältigen können? Wie kann ihnen geholfen werden?
Wo liegen außerdem Möglichkeiten zur Trauerarbeit und was bieten bestehende Trauerangebote?
All diese Aspekte und mehr möchte ich in meine Arbeit einfließen lassen, und eine Antwort darauf finden.
Weiterhin möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Personen bedanken, die mich während dieser Arbeit unterstützt haben.
Allen Trauerberatern und Fachkräften, die durch ihre Unterstützung und mit ihren Anregungen und Erzählungen zu dieser Arbeit beigetragen haben, sei gedankt. Dadurch konnte ich unterschiedliche, für die Soziale Arbeit sehr wichtige Arbeitsfelder und Beratungsstellen kennen lernen.
Insbesondere möchte ich mich bei dem Ehepaar B. bedanken, welches mir so freundlich Einblick in seine privaten Gedanken und Erlebnisse ermöglichte und damit meine theoretischen Ausführungen zum Thema verlebendigte.
Ich danke außerdem ganz herzlich meinem Partner Jörn sowie allen meinen Freundinnen, vor allem Marylin und Barbara, die mir wertvolle Anregungen und Hilfestellung gaben sowie für die kritische Diskussion der Arbeit.
2. Einleitung
Todesfälle lösen im Allgemeinen Betroffenheit und Trauer aus. Beim Tod eines Familienmitgliedes, insbesondere eines Kindes, herrscht in der Familie eine besondere Trauer, da auch die Beziehungen untereinander von besonderem Charakter sind bzw. waren. In der Bundesrepublik Deutschland sterben jährlich ca. 16000 Kinder an verschiedenen Ursachen[1]: Schwangerschaftsabbruch, Tot- oder Fehlgeburt, Krankheit, plötzlicher Kindstod, Unfall, Suizid oder an einem Gewaltverbrechen. Die „verwaisten“ Eltern, die Geschwister, aber auch andere hinterbliebene Familienmitglieder können in eine tiefe Krise geraten. Da Beziehungen für einen Menschen einen wesentlichen Aspekt seines Selbst- und Welterlebens ausmachen, kann der Tod eines geliebten Menschen dieses erheblich erschüttern.
Der Verlust eines Kindes zerstört das systemische Gleichgewicht der zurückgelassenen Familien. Eltern und Geschwister werden durch Emotionen wie ohnmächtige Wut, Nichtwahrhaben - wollen, Schuldgefühle und Angst, Verzweiflung am Leben und Zweifel an der Gerechtigkeit überwältigt. Fragen nach dem Sinn des weiteren Lebens tauchen auf und Suizidgedanken bedrohen die Existenz. Doch Trauer in der Familie ist auch etwas Notwendiges, um den Schmerz des Verlustes verarbeiten zu können. Verwaiste Eltern stellen wegen der Intensität der Beziehung zur verlorenen Person, eine besondere Gruppe unter Trauernden dar.
Zu Beginn meiner eigentlichen Arbeit möchte ich auf kritische Lebensereignisse, ihre Effekte sowie auf die Auseinandersetzung mit ihnen eingehen (Kapitel drei).
Die Menschen reagieren vor allem dann mit Abwehr der Trauerreaktionen und Angst, wenn sie frühere Verluste und Trennungen von geliebten Personen nicht bewältigt haben oder eine chronische Belastung unverarbeiteter Trauer über Generationen in der Familie zu finden ist. Deshalb möchte ich in Kapitel vier die Bindungstheorie nach John Bowlby, der als Wegbereiter der Bindungsforschung gilt, beschreiben und den Zusammenhang von Elternbindung und Persönlichkeitsentwicklung beschreiben. Anschließend erläutere ich die Bindungs- und Bedeutungsvarianten von Familien, weil der Familie in meiner Arbeit die Hauptfunktion zukommt.
Daran schließt sich in Kapitel fünf ein Überblick über die Faktoren der Trauer mit einer Beschreibung der Trauerphasen und Traueraufgaben sowie den Folgen der Trauer.
In Kapitel sechs komme ich auf den Verlust eines Kindes durch verschiedene Ursachen zu sprechen und berichte über die verschiedenen Reaktionsweisen der Eltern.
Partnertrauer und das unterschiedliche geschlechtsspezifische Trauerverhalten ist Thema des siebten Kapitels. Häufig ist zwischen Paaren die Kommunikation in der Trauerzeit gestört, weil Frauen meist anders trauern als Männer und durch neurotische oder psychosomatische Abwehrformen der Dialog gehemmt wird.
Überlebende Geschwisterkinder, die einen Bruder oder eine Schwester verloren haben, werden oft übersehen. Die Gründe und Ursachen dafür finden sich in Kapitel acht. Jedoch kann gerade ihr Verhalten ein wichtiger Anhaltspunkt dafür sein, wie gut oder schlecht eine Familie die Trauer um ein Kind bewältigt und die Familiendynamik beeinflussen.
Vor dem Hintergrund der allgemeinen Verdrängung der Thematik Tod aus der Gesellschaft und einer immer unsicherer werdenden Familienstruktur fühlen sich viele verwaiste Eltern hilflos und allein. Sie erfahren meist weitaus weniger soziale Unterstützung als andere Trauernde, weil die Vorstellung das eigene Kind zu verlieren viele Außenstehende sprachlos machen kann und sehr erschreckend wirkt, so dass die Konfrontation mit den verbliebenen Eltern häufig vermieden wird.
In diesem Rahmen möchte ich über Sinn und Inhalt von Gesprächskreisen und Selbsthilfegruppen als Lösungsmöglichkeit und möglichen Ort der Trauer im Rahmen der Sozialen Arbeit berichten. Dazu habe ich verschiedene Fachkräfte aus der Region Mönchengladbach befragt sowie ein Gespräch mit betroffenen Eltern geführt, deren Ergebnisse ich in Kapitel 9 und 10 vorstellen möchte. Aus diesen Befragungen sowie der von mir verwendeten Literatur haben sich Vor- und Nachteile beider Trauerangebote ergeben, welche ich in Bezug für die zukünftige Soziale Arbeit im Bereich Trauer setzen möchte.
I.
3. Kritische Lebensereignisse
3.1 Eine Einführung
Für die meisten Menschen ist ein kritisches Lebensereignis ein einschneidendes unerwünschtes Erlebnis wie der Verlust des Arbeitsplatzes, ein Unfall, eine Krankheit, aber auch der Tod oder die Trennung von einer geliebten Person. Psychologen dagegen bezeichnen neben den unerwünschten auch positive Ereignisse, z.B. ein außergewöhnlicher persönlicher Erfolg, und neutrale Ereignisse wie z.B. ein Strafzettel für verkehrswidriges Verhalten als kritisch. Die Wichtigkeit und Bedeutung des Lebensereignisses variiert in ihrer Wirkung hinsichtlich der betroffenen Person. Das Ereignis widerspricht jedoch immer den kognitiven Erwartungen, Wünschen und Gewohnheiten des Betroffenen. Damit sind auch positive Lebensereignisse impliziert.[2]
Jedes kritische Lebensereignis ruft Spannung und Stress hervor, weil es mit einem Teil des „Weltbildes“ der betroffenen Person inkonsistent[3] ist. Die Höhe der entstehenden Spannung hängt von der Summe vieler einzelner Spannungen ab, die durch das kritische Lebensereignis an sich und einzelnen kognitiven Elementen entsteht. So ist z.B. das Auftreten von viel oder wenig Spannung bei einer Fehlgeburt abhängig von den Inkonsistenten in dem Weltbild des Betroffenen. Das heißt, es gibt keine objektive Wichtigkeit einzelner Ereignisse, sondern das Ausmaß an Spannung kann bei verschiedenen Personen mit gleichem Lebensereignis unterschiedlich hoch sein.[4]
Ein kritisches Lebensereignis kann nach dem Psychologen und Philosophen Richard S. Lazarus als stressvoll erlebt werden, wenn „eine Person eine Situation so beurteilt/bewertet, dass Anforderungen aus der Umwelt und /oder innere Anforderungen ihre persönlichen Ressourcen zu deren Bewältigung erschöpfen oder übersteigen.“[5] Lazarus erklärt, dass Stress nicht durch das Auftreten eines Ereignisses entsteht, sondern durch die Bewertung desselben durch die Person. Wird ein Ereignis als stressvoll erlebt und bewertet, kann sich diese Beurteilung in Form eines Verlustes oder einer Beeinträchtigung auf die Vergangenheit und die Gegenwart beziehen. Wird die Zukunft miteinbezogen, kann das Ereignis als herausfordernd, also positiv, oder bedrohend und negativ beurteilt werden.
Kritische Lebensereignisse gehen immer mit einer Spannung einher, die reduziert werden will. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen kann die Person versuchen, direkt etwas an der Inkonsistenz zu ändern, indem sie handelt – die Situation bearbeitet (Bearbeitungsreaktion). Die Person kann sich aber zum anderen auch aus dem Bereich der Inkonsistenz zurückziehen (Rückzugsreaktion) und sich einem anderen Lebensbereich zuwenden. Dadurch wird die Spannung jedoch lediglich aus dem Bewusstsein ausgeklammert, anstatt reduziert.[6]
Trauerreaktionen lassen sich verschieden interpretieren.
Caplan sieht die Trauerreaktion als Copingkrise, in der die üblichen Copingstrategien (Bewältigungsstrategien) für Stressereignisse angesichts des Ausmaßes der Trauerkrise nicht mehr greifen. Die gegenwärtige Krise weckt Erinnerungen an frühere Krisen und die Abwehrfunktionen sind geschwächt. Oft gibt es auch geschlechtsspezifische Unterschiede. So flüchten Männer nach einem Verlust des Kindes eher in die Arbeit und können ihre Copingfähigkeiten meist schneller wieder nutzen als Frauen, die eher zu depressivem Verhalten neigen. Damit treten häufig verstärkte Spannungen zwischen den Partnern auf. Das soziale Unterstützungssystem spielt in diesem Modell eine große Rolle.[7]
Die Trauerreaktion kann auch als Krankheit gesehen werden, in der sich die Trauernden als verwundet und physisch verletzt bezeichnen, und Betreuung benötigen, vor allem bei Formen pathologischer Trauer, auf die ich in Kapitel 5.3.2. noch eingehen werde.
Die biologische Sichtweise einer Trauerreaktion ist ebenso möglich, da sich die Atmung, autonome und endokrine Systeme oder auch die Immunfunktion verändern können.[8]
Psychodynamisch gesehen bedeutet Trauer „den Rückzug der Libido vom verlorenen Objekt und deren Lenkung auf ein neues Objekt. Dabei kommt es häufig zur Identifikation mit dem Verstorbenen (dem verlorenen Objekt, wie Psychoanalytiker sagen) und zu narzisstischer Regression“.[9] Bei der Identifikation werden Bereiche und Eigenheiten der verstorbenen Person übernommen, um ihr immer ähnlicher zu werden und sie durch das Nachlassen des Schmerz als Objektrepräsentanz zu verinnerlichen. Regression, also das Zurückgehen auf frühere Entwicklungsstufen wird als narzisstisch bezeichnet, wenn jegliche Zuwendung dauerhaft von der Umwelt abgezogen wird und auf die eigene Person gerichtet wird.[10]
In der Konstrukttheorie und den kognitiven Modellen muss eine Person bei dem Verlust eines geliebten Menschen ihre inneren Einstellungen aufgeben und neue entwickeln, dies bedeutet neben der Änderung des Selbst auch eine Veränderung in Beziehungen zu anderen Menschen.[11]
3.2 Verlust und Trauer als Krise und Chance im menschlichen Leben
Kritische Lebensereignisse können ganz plötzlich im Leben eines Menschen auftreten und jeden möglichen Aspekt des Lebens beeinträchtigen. Der Verlust einer geliebten Person durch den Tod und die daraus entstehende Trauer gehören zu den einschneidendsten und schwierigsten zu bewältigenden kritischen Lebensereignissen mit den dauerhaftesten Konsequenzen. Verlust bedeutet immer die Trennung von etwas, das zur Existenz des Individuums gehört. Dies gilt vor allem für Eltern, die ihr Kind und damit ihren Lebenssinn verlieren.
Der Prozess der Trauer verlangt von den Eltern eine Wiederanpassung an die neue Situation. Doch gerade am Anfang sind sie wegen des Schocks oder des Leids kaum in der Lage, sich dem Wechsel anzupassen. Sie neigen dazu, alte und vertraute Gewohnheiten fortzuführen. „Zur Tagesordnung überzugehen“ ist eine häufig anzutreffende Reaktion auf einen Verlust. Doch diese Sichtweise ist im normalen Verlauf des Schmerzes nicht lange haltbar und häufig tritt dann ein Gefühl der Leere auf. Trauer ist ein starkes Gefühl, und lässt sich nicht einfach verdrängen. Eine Veränderung muss also eintreten, unter Beachtung der unterschiedlichen Erziehung, (Schul-)Bildung oder Anpassungsfähigkeit der betroffenen Person.[12]
Nach Kast „verlieren wir ständig etwas (...) [und] immer wieder ist das Leben verändert, müssen wir (...) uns den Veränderungen stellen. Aber wir verlieren nicht nur, wir gewinnen auch. Das Leben, das abläuft, gibt uns die Gelegenheit, gerade durch die vielen Veränderungen unser Wesen aufzufalten, zu entfalten. (...) Auch das Erlebnis der Trauer um einen geliebten Menschen macht unser Leben aus, es gehört auch zu uns. Wenn wir zu trauern verstehen, dann ist dies vielleicht gerade die Möglichkeit, Wesentliches an uns zu erfahren“.[13]
Zeiten des Leidens und Krisenphasen können Menschen demnach dazu zwingen, neue Wege zu finden und zu beschreiten, so dass ein entsprechender Neubeginn einen Sinn anderer Art in das Leben bringen kann. Die Lebenskrise ist daher gleichzeitig eine Sinnkrise. Dies gilt vor allem angesichts eines nahenden oder schon eingetretenen Todes, denn gerade dann stellen sich Menschen die Frage nach dem Sinn des Lebens.[14]
Durch den Todesfall einer nahestehenden Person können also auch Entwicklungs- und Veränderungsschritte in Gang gesetzt werden, indem z.B. der Betroffene eine Grenzsituation bewältigen lernt, ohne daran zu zerbrechen. In späteren ähnlichen Situationen kann er dann mit größerem Selbstvertrauen auftreten und seinen Schmerz aushalten.
Viele Menschen sind jedoch durch den Rückgang gesellschaftlich akzeptierter Trauerformen verunsichert, wie sie sich zu verhalten haben. Auch der Zeitgeist der Gesellschaft, der tatkräftige und fröhliche Menschen erwartet, macht den Tod zu einem Störfaktor und die Trauerzeit zu einer unproduktiven Zeit. Daher sind die Reaktionen auf einen erlittenen Verlust individuell unterschiedlich und hängen u.a. von der Persönlichkeit, der Art und dem Zeitpunkt des Verlustes ab, auch das soziale Umfeld kann Einfluss nehmen. Für viele Trauernde wird daher eine Unterstützung und Hilfestellung immer notwendiger.
4. Bindung und Trennung
Um die Bedeutung von Trennung und Verlust im Leben eines Menschen verstehen zu können, muss man auch den Begriff Bindungen verstehen und erkennen. Daher möchte ich im folgenden auf das Phänomen der Bindung eingehen.
Bindung wird im Humboldt–Psychologie-Lexikon als „anhaltender emotionaler Kontakt eines Menschen zum Mitmenschen und das innere Verhaftetsein eines Individuums an Ordnungen, Symbole oder Werte bzw. an deren Träger“ definiert.[15]
Verschiedene Forscher haben sich mit der Konstitution von Beziehungen beschäftigt. Eine Schlüsselfigur auf dem Gebiet der Bindungstheorie ist der britische Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby (1907 – 1990), der den Ursprung und das Wesen der Bindung in einem systemtheoretischen Kontext erklärte.
Deshalb stelle ich im Folgenden speziell die Bindungstheorie von Bowlby sowie die Forschungen seiner Schülerin Mary Ainsworth vor, weil jene das Bindungsverhalten von Kindern untersuchte, welches prägend für das Erwachsenen – Bindungsverhalten ist. Weiterhin möchte ich die Bindungs- und Bedeutungsvarianten von Familie darstellen, die bei der Verarbeitung von Verlusterlebnissen innerhalb der Familie sehr wichtig sein können.
4.1 Die Bindungstheorie John Bowlbys
Auf dem Hintergrund der Psychoanalyse, entwicklungspsychologischer Erkenntnisse und der Ethologie geht Bowlby davon aus, „dass Personen im Verlauf ihrer normalen Entwicklung rein instinktive Bindungen (attachments) aufbauen. Diese Bindungen bestehen zunächst zu den Eltern als primäre Bezugspersonen und später zu anderen Erwachsenen.“[16] Bowlby konzentrierte sich in seiner Bindungstheorie zunächst auf die Bedeutung der frühen Mutter-Kind-Beziehung. Er erkannte bei der Arbeit mit psychisch gestörten Kindern immer wieder vielseitige frühkindliche Traumatisierungen, die Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit nahmen. Als Ursache entdeckte und beschrieb er vielfältige frühzeitige Verluste und Trennungen von Bezugspersonen. Damit galt Bowlby als früher Wegbereiter der Bindungstheorie und Bindungsforschung und fasste seine Bindungstheorie in drei Haupt-Bänden zusammen: „Bindung“({1969}in Dt. 1975), „Trennung“ ({1973}in Dt. 1976) und „Verlust“ ({1980}in Dt. 1983). Sein Ziel war eine Theorie zur Therapie emotional gestörter Patienten und Familien.[17]
Bindungen entstehen nach Bowlbys These durch gewisse eigendynamische Verhaltensweisen, die auf das Herstellen und Aufrechterhalten von Nähe und Kontakt gerichtet sind. Dieses „Bindungsverhalten“ (attachment behaviour) entsteht aus der evolutionstheoretischen Suche nach Sicherheit und Schutz. Bowlby stellt sich damit gegen die Auffassungen anderer Forscher (z.B. Melanie Klein), die das Entstehen von Bindungen als Sekundärtrieb auf bestimmte biologische Triebe, z.B. den Nahrungs- oder Geschlechtstrieb, zurückführen.[18] Seine Theorie berücksichtigt stattdessen auch evolutionistische, ethologische und kognitionspsychologische Erkenntnisse.[19]
Während seiner Leitung der Kinderabteilung an der Tavistock Klinik in London entschloss sich Bowlby 1948 die Arbeit seiner Forschungsgruppe auf die Trennung von Mutter und Kind zu beschränken. Er wollte erforschen, welche Nachteile mangelnde mütterliche Zuwendung für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung haben kann und wie kleine Kinder eine längere Hospitalisierung oder Unterbringung in einer fremden Familie verarbeiten.
Demzufolge sucht ein Säugling besonders dann die Nähe zu seiner Mutter, wenn er Angst hat, z.B. vor unbekannten Situationen oder fremden Personen, sich von seiner Mutter getrennt fühlt oder gar körperlichen Schmerz erleidet. Die Nähe zur Mutter wird durch Blickkontakt und durch Herstellen von Körperkontakt mit der Mutter gesucht.
Gleichzeitig entwickelt jeder Säugling im ersten Lebensjahr eine Hierarchie von verschiedenen Bezugspersonen, auf die er bei Gefahr, Kummer oder Zorn in einer bestimmten Rangfolge je nach Verfügbarkeit der Person zurückgreift. An oberster Stelle der Hierarchie steht die Person, welche die meiste Zeit mit dem Kind verbringt und mit der das Kind die häufigsten, wenn auch nicht unbedingt die qualitativ besten Erfahrungen macht. Je nach Ausmaß des Schmerzes oder der Angst wird das Kind auf die Anwesenheit der primären Bezugsperson (in der Regel die Mutter) bestehen und sich nicht durch sekundäre Bezugspersonen trösten lassen.[20]
Bowlby spricht in seinem Band „Bindung“ (1975) über „interne Arbeitsmodelle“ („internal working models“). Dies sind Vorstellungen des Kindes über sich selbst (eigene Selbstwert- und Kompetenzeinschätzung)und über seine Bezugspersonen und deren Verfügbarkeit sowie die damit verbundenen Erwartungen und Gefühle. Das Verhalten der primären Bezugsperson und des Kindes wird somit vorhersagbar. Gerät das Kind z.B. in Gefahr, lernt es mit der Zeit seine Bezugsperson aufzusuchen, um seine Bindungsbedürfnisse je nach Person durch Nähe oder Distanz befriedigen zu lassen. Es gibt also für jede einzelne Bezugsperson auch unterschiedliche Arbeitsmodelle, welche anfangs noch recht flexibel sind. Im Verlauf der weiteren Entwicklung jedoch entwickeln sie sich zu einer psychischen Repräsentanz, der sogenannten „Bindungsrepräsentation“. Sie stellt eine Art kognitive Landkarte dar, die das Verhalten in spezifischen, überwiegend belastenden Situationen beeinflussen.[21]
Je nach Anzahl und Intensität der Bindungserfahrungen können spätere einschneidende Erlebnisse wie Verluste oder traumatische Ereignisse die Bindungsrepräsentation stabil oder instabil gestalten.
Eine sichere Bindung ist Bowlby zufolge auch Voraussetzung dafür, dass ein Säugling sich von seiner Mutter entfernen kann, um seine Umwelt zu erforschen und sich selbstständig handelnd zu erleben. Durch diese emotionale Sicherheit, kann es seine Neugier auf die Umwelt ausleben ohne in emotionalen Stress zu geraten sowie jederzeit hilfe- und schutzsuchend zurückkehren. Diese erste Beziehung im Leben des Kindes bestimmt die Fähigkeit des Kindes, später affektive Bindungen zu bilden. Das stimmt mit dem Konzept des Urvertrauens von Erik Erikson überein. Das Urvertrauen wird nach Erikson bereits in den ersten Lebensmonaten eines Menschen geprägt und beinhaltet die Grundeinstellung eines Menschen, die sich danach richtet, inwiefern er seiner Umwelt trauen kann oder nicht, je nach der Beziehung zu seiner engsten Bezugsperson.
Bindungsbedürfnis und Explorationsbedürfnis[22] stehen also in Abhängigkeit zueinander, obwohl sie entgegengesetzten Motivationen entspringen. Diese Tatsache findet sich im Laufe des gesamten Lebens wieder: Bindung und Exploration müssen immer wieder neu ausgehandelt werden.[23]
Bowlbys Bindungstheorie fand gerade in der Entwicklungspsychologie großen Anklang und zwar nicht nur innerhalb seiner Heimat Großbritannien. Seine Schüler, vor allem seine spätere kanadische Mitarbeiterin Mary Ainsworth, trugen seine Forschung in die USA, Kanada, Israel, Japan, Italien, die Niederlande und Deutschland. In Deutschland sind damit die Namen von Klaus und Karin Grossmann verbunden, zunächst Psychologen an der Universität in Bielefeld, später dann in Regensburg.[24]
Interessant ist, dass der Vater so gut wie gar nicht in den Untersuchungen auftaucht. Die Gründe dafür liegen in dem damaligen Bild des Mannes als „Ernährer und Beschützer“ der Familie, der in Kriegen diente oder den ganzen Tag beruflich eingespannt war. Und so verwundert es nicht, dass bis heute dem Vater von traditionell geprägten PsychologInnen und auch PsychoanalytikerInnen meist eine Sekundärposition eingeräumt wird. Viele sehen fürsorgerische, pflegerische, beschützende und beziehungsorientierte Angebote an ein Kind noch immer als eine originär weibliche Qualifikation.
Ich bin jedoch der Überzeugung, dass Männer sehr wohl die „Mutterstelle“ einnehmen können, was sie jedoch in nur wenigen Kulturen tun. Meist beschränken sich Väter auf sportliche oder körperliche Aktivitäten, besonders bei Jungen, und werden so zum Spielkameraden ihres Kindes.
4.2 Die Forschungen von Mary Ainsworth und daraus abgeleitete Erkenntnisse über das Bindungsverhalten Erwachsener
Mary Ainsworth, geb. Salter (1913-1999), war eine Schülerin Bowlbys und studierte in den dreißiger Jahren in Toronto Psychologie. In ihrer Promotion setzte sie sich mit der „Sicherheitstheorie“ von William Blatz (1940) auseinander, nach der jedes Individuum ein Urvertrauen zu einer Bezugsperson entwickeln muss, um sich auf sich selber verlassen zu können und sich irgendwann von den Eltern ablösen zu können. Diese Gedanken begleiteten Mary Ainsworth während ihrer gesamten späteren Zusammenarbeit mit Bowlby in der Forschungsgruppe an der Tavistock Klinik. Ihre Kenntnisse im Bereich der Diagnostik und der Methodenentwicklung waren für die weitere Entwicklung der Bindungstheorie von nachhaltiger Bedeutung, da sie bei der Formulierung der späteren Bindungsklassifikationen sehr hilfreich waren.
In Ainsworth Forschungen gab es zwei hauptsächliche Aspekte. Zum einen galt ihr Interesse der normativen und allgemeingültigen Bindung bei Säuglingen bis zum ersten Lebensjahr, in Form der Verhaltensbeobachtung in den Familien. Weiterhin wollte sie die Unterschiede in der Qualität der Bindung zwischen dem Säugling und der primären Bezugsperson herausfinden. Zur Erfassung dieser Unterschiede entwickelte sie das Beobachtungsverfahren „Fremde Situation“ („strange situation“). Dabei handelt es sich um acht aufeinanderfolgende Episoden von dreiminütiger Dauer in einem speziell für diese Untersuchung eingerichtetem Spielzimmer, in denen das Kind (zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat) zweimal von seinem Elternteil getrennt wird.[25] Für das Kind entsteht eine Stresssituation, es kommt zu einer Aktivierung des Bindungsverhaltenssystems, so dass Ainsworth Rückschlüsse auf die Bindungsorganisation ziehen konnte, d.h. es konnten erstmals Prognosen über das spätere Kontakt- und Auf
verschiedene Bindungsmuster bei den Kindern.[26]
Gleichzeitig möchte ich auf die von Main (Kollegin von Ainsworth und Professorin für Psychologie an der Long Island University) und Goldwyn im Jahre 1985[27] durchgeführten Bindungserwachseneninterviews (Adult Attachment Interview) hinweisen, in denen auch bei Erwachsenen eine Bindungsrepräsentation festgestellt werden konnte:
Die sogenannten sicher gebundenen Kinder (Gruppe B) zeigen Betroffenheit bei der Trennung von der Mutter. Wenn die Mutter zurückkommt, nehmen sie wieder Kontakt auf, können sich mit ihrer Hilfe relativ schnell wieder stabilisieren und sich dem Spiel zuwenden.
Sicher gebundene Erwachsene haben einen guten Zugang zu ihren Gefühlen und räumen Bindungen in ihrem Leben einen hohen Stellenwert ein. In belastenden Situationen können sie durch realistische Einschätzung der Situation adäquate individuelle oder soziale Strategien zur Bewältigung anwenden.
Kinder mit unsicher vermeidender Bindungsbeziehung (Gruppe A) zeigen während der Trennung nur geringe emotionale Reaktionen und ignorieren die Bezugsperson bei der Wiedervereinigung bzw. vermeiden körperliche Berührungen.
Unsicher vermeidende Erwachsene sind Bindungsthemen gegenüber sehr distanziert und können sich kaum noch an Ereignisse und Gefühle in ihrer Kindheit erinnern. Sie neigen zu unrealistischen Idealisierungen oder zur Abwertung der eigenen Person, der Bindungsperson oder der Umweltbedingungen.
Bei unsicher ambivalent gebundenen Kindern (Gruppe C) können während der Trennung starke emotionale Reaktionen beobachtet werden. Sie suchen zwar bei der Wiedervereinigung mit der Bezugsperson Körperkontakt, zeigen aber gleichzeitig Ärger und Widerstand. Zudem lassen sie sich nur schwer beruhigen und sind ohne die Hilfe der Bezugsperson nicht in der Lage, sich relativ bald wieder zu stabilisieren.
Unsicher ambivalent gebundene Erwachsene zeigen bzgl. früherer Beziehungen Ärger, Verwirrung oder Widersprüchlichkeit. Sie können unterschiedliche Gefühle nur schwer integrieren.
Main führte außerdem 1986 die Bindungsdesorganisation bei Kindern als ein viertes Bindungsmuster (Gruppe D) an. Diese Kinder zeigen unterbrochene oder ungeordnete Bewegungen, sich widersprechende Verhaltensweisen oder auch Furcht vor der Bezugsperson.[28]
Erwachsene mit Bindungsdesorganisation als Bindungsmuster fallen durch verbale und gedankliche Inkohärenzen[29] und Irrationalitäten auf, besonders wenn über belastende Erfahrungen wie Tod oder Trennung gesprochen wird.
Nach Ainsworth steht eine sichere Bindung im Kindesalter in Relation mit der Feinfühligkeit, mit der die Mutter auf die Bedürfnisse des Säuglings eingeht. Kinder können demnach nur dann psychische Stabilität und Sicherheit erfahren, wenn die Eltern neben der nötigen Erziehung und Förderung verlässlich sind und die Autonomie des Kindes anstreben, bei Gefahr aber immer zur Stelle sind und verantwortungsvoll handeln.[30]
Aus dieser Erkenntnis kann man die Entstehung des Bindungsverhaltens Erwachsener ableiten, denn der Erziehungsstil unserer Eltern prägt uns und beeinflusst damit auch das unser eigenes Bindungsverhalten.
Dieser Zusammenhang wurde in einigen Studien[31] eindeutig nachgewiesen. Je nach Gruppenzugehörigkeit der Eltern („sicher“, „unsicher vermeidend“, „unsicher ambivalent“ oder „desorganisiert“) zeigten auch die Kinder die entsprechende Bindungsrepräsentation.[32] Trotz dieser Beobachtungen wäre es jedoch zu einfach, den Eltern die Hauptschuld an etwaigen späteren psychischen Störungen des Kindes zuzuschreiben. Stattdessen muss vielmehr auch immer die jeweilige Lebenssituation sowie persönliche Einstellungen und Verhaltenserwartungen anderer Personen beachtet werden.
4.3 Bindungs- und Bedeutungsvarianten von Familie und das Trauma des Verlusts
Die Bindungs- und Beziehungserfahrungen von Kindern bzw. Erwachsenen können also die Interaktionen mit anderen (eigenen) Kindern oder Erwachsenen beeinflussen und damit eine Beziehung mitbestimmen.[33]
Die Beschäftigung mit der Art, der Dauer und der Intensität der familiären Gemeinschaft sowie daraus entstehender familiärer Bindungen, ermöglicht es, im Falle einer Verletzung des Familiensystems durch einen Personenverlust Rückschlüsse auf die Auswirkungen der einzelnen Familienmitglieder und die hohe Bedeutung der Trauerarbeit ziehen zu können. Die Familie und ihr Verhalten bzgl. eines Kindesverlustes stehen in meiner Arbeit im Vordergrund, so dass ich das Bindungssystem Familie nun näher beschreiben möchte.
Innerhalb einer Familie können verschiedene Arten von Bindungen bestehen:[34]
- Funktionale Familie: ist durch praktische Anforderungen des täglichen Zusammenlebens, wie z.B. Haushaltsführung, gekennzeichnet.
- Rechtliche Familie: ist durch die Normen des Rechtssystems definiert, z.B. aufgrund von Unterhalts- und Erziehungsverpflichtungen oder auch Sorgerechtsregelungen.
- Familie, so wie die Mitglieder sie sehen: die subjektive Wahrnehmung der einzelnen Mitglieder bestimmt, wer zur Familie gehört und wer nicht, z.B. das „schwarze Schaf“ oder der „verlorene Sohn“.
- Familie mit langfristigen Verpflichtungen: ist durch ein hohes Maß an Erwatungen bzgl. der Dauer und Stabilität der wechselseitigen Bindungen gekennzeichnet. Die langfristigen Bindungen haben gerade wegen der gemeinsam durchlebten Belastungen des Lebens bestand und können daran wachsen.
- Biologische Familie: aufgrund der Blutsverwandtschaft ist sie ein wichtiger und teilweise schwieriger Bestandteil der Identitätsbestimmung des Einzelnen.
Je nach Art der Familienform, also der jeweiligen Bedeutungs- und Bindungsform, ist es für den Einzelnen schwer, seine Mitgliedschaft zu verändern oder einfach aufzugeben. Dies gilt z.B. in der Familie mit subjektiver Zugehörigkeitswahrnehmung oder der Familie mit langfristigen Verpflichtungen. Bis ein Zugehörigkeitserleben erlischt oder andere Qualität zugeschrieben bekommt, ist meist viel Zeit notwendig. Ein Vater, der z.B. nie Zeit mit seinen kleinen Kindern verbrachte, kann Schwierigkeiten haben, im Rentenalter auf einmal Nähe und Kontakt zu diesen herzustellen.[35]
Im Falle eines Kindesverlustes (bzw. Personenverlustes generell) gilt dies ebenfalls. Aufgrund der erwarteten dauerhaften Beziehungen als „Lebensbeziehungen“ innerhalb der Familie, ist die Auflösung einer Beziehung durch den Tod eines Kindes besonders schwer zu verstehen und zu akzeptieren. Die häufig nie endende Trauerarbeit der Eltern und anderer Angehörigen verdeutlicht den Beziehungsverlust.[36]
Hier möchte ich noch einmal auf Bowlby verweisen, demzufolge es ein menschliches Grundbedürfnis ist, starke emotionale Bindungen einzugehen. Unser Leben können wir nur dann wirklich leben, wenn wir auch bereit sind, uns zu binden und auch angesichts eines möglichen Verlusts nicht vor einer Bindung zurückschrecken. Liebe und Verlust bzw. Trauer sind deshalb eng miteinander verbunden.
In intimen Beziehungssystemen, zu denen das Eltern-Kind-Verhältnis gehört, kommt es zu vielfältigen Interaktionen und wechselseitiger Kommunikation. Dies fördert eine intensive affektive Verbundenheit und ein positives Beziehungsklima, auf das in schwierigen Lebenslagen zurückgegriffen werden kann.[37]
Tritt dann eine Gefährdung des Bindungssystems ein, kommt es natürlicherweise zu Trennungsängsten und zu unterschiedlichen Aktionen der Familienmitglieder, welche die Bindung erhalten sollen. Je größer die Gefahr des Verlusts, desto ausgeprägter die Formen des Bindungsverhaltens, z.B. Weinen, Anklammern oder auch Wutausbrüche.
Jedes Mitglied kann demnach durch Einsatz der vorhandenen Ressourcen seinen Beitrag zur Problemlösung leisten, was wiederum die Verbundenheit zwischen den Mitgliedern vertiefen kann. Der Tod eines Kindes in der Familie kann demzufolge auch Beziehungsprozesse anregen und die Krise wird zur Chance der Familie und jedes Einzelnen (siehe dazu auch 3.2).[38]
Die Aktivitäten und Bemühungen zur Wiederherstellung der Bindung (wie sie auch bei der Trennungsangst auftreten) hören im Falle eines tatsächlichen Verlustes in der Regel nie vollständig auf, sie werden nur schwächer und in längeren Abständen immer wieder erneuert, also auch der Schmerz und der Kummer werden dauernd neu erlebt. Dies heißt, dass das Bindungsverhalten des Individuums erhalten bleibt und neu aktiviert wird. So kann in manchen Familien ein Zustand chronischen Stresses und chronischen Leides entstehen. Solche frühen negativen Erlebnisse können auf spätere eigene Kinder übergehen oder für ähnliche Erlebnisse anfälliger machen.
Ein Erkennen und Akzeptieren dieser veränderten Lebensumstände in der Familie, also der Verlust des Kindes als Tatsache, beeinflusst einerseits körperliche und psychische Entwicklungsprozesse der einzelnen Mitglieder, andererseits macht es neue Abstimmungen/Absprachen zwischen den Personen erforderlich. Die Familie muss so flexibel sein, dass das System neu gestaltet werden kann und ohne das verstorbene Kind zurecht kommt. Im gemeinsamen Trauerprozess mit evtl. Unterstützung von außen und ausreichend zugestandener Zeit kann dies gelingen.[39]
Das Ziel des Trauerprozesses sollte infolgedessen die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit sein, damit Beziehungen wieder aufgenommen und aufrechterhalten werden können und die Familie in ihrem Fortbestand stabilisiert wird.
Im Falle auftretender Konflikte und Symptome einer von Verlust betroffenen Person oder Familie kann die „biologisch fundierte und kohärente, empirisch zudem weitgehend abgesicherte entwicklungspsychologische“[40] Bindungstheorie sowie das Wissen um Familientheorien allen Beratern und Psychotherapeuten jeglicher Fachrichtung hilfreich sein. Sofern der Trauerprozess mehr oder weniger stark beeinträchtigt ist, kann pathologische Trauer häufig die Folge sein (siehe Kapitel 5.3.2).[41]
5. Faktoren der Trauer
5.1 Sterben und Trauer in der modernen Gesellschaft
Tod und Trauer gehören zum menschlichen Leben, es sind Bestandteile dieses Lebens. Viele Jahrhunderte war der Tod allgegenwärtig und somit gehörte das Verständnis von Tod mit seinen Ritualen in das familiäre Leben. Das tägliche Leben war durch schlechte Hygiene, Ernährungsprobleme, Seuchen, Infektionskrankheiten und anderen Mängeln ständig vom Tod bedroht. Der Allgegenwärtigkeit des Todes versuchte man mit kollektiven Handlungen wie z.B. Bußübungen, Sühneopfern oder auch Gelöbnissen zu begegnen. Der Tod gehörte also für unsere Vorfahren zum Selbstverständnis, sie hatten „gelernt mit dem Sterben zu leben“. Bräuche und Rituale entstanden, die ihnen im Schmerz und Leid Halt und Sicherheit gaben. Weiterhin erleichterte die Überzeugung an ein Leben nach dem Tod den Umgang mit Sterben und Tod und nahm den Menschen die Angst vor demselben.
Doch im 18. und 19.Jahrhundert traten erste Veränderungen im Umgang mit dem Tod ein. Das traditionelle „Personal“ für die Betreuung von Sterbenden (Priester oder nahe Verwandte) wurde durch professionelle Fachkräfte wie Ärzte oder Bestatter ersetzt. Zunehmende Individualisierung und die rationale Betrachtung zwischenmenschlicher Beziehungen haben ebenso ihren Anteil an der Veränderung traditioneller Todesriten.[42] Todesfälle werden heutzutage in der Öffentlichkeit immer weniger wahrgenommen. Vielen Menschen fehlt die „unmittelbare Erfahrung, die Möglichkeit am Modell lernen zu können und die Sicherheit, [...], eine Stütze für ihre Seelenzustände zu haben“.[43] Gleichzeitig vermeiden sie solche Kontakte und übergeben die Pflege von Sterbenden an die professionellen Krankenhäuser oder Pflegeheime, so dass sich Sterbende und Angehörige oftmals voneinander entfremden. Jedoch können gerade diese Institutionen durch verbesserte medizinische Möglichkeiten frühzeitiges Sterben verhindern, und haben damit stark zu einer veränderten Einstellung gegenüber dem Tod beigetragen. Krankheitsbilder wurden (und werden immer noch) erforscht und Heilmittel gefunden. Dadurch wandelte sich die Angst vor Krankheiten, sie waren weniger Schicksal oder „gottgewollt“, sondern ein Feind, den man bekämpfen konnte.
Die Ereignisse im 1. und 2. Weltkrieg führten ebenso zu einer anderen Sichtweise des Todes. Zwar haben Kriege das Leben der Menschen in allen Zeiten bedroht, aber durch den Einsatz neuer Waffen kam es erstmals zu einem von Menschen ausgelösten Massensterben, welches unter anderem einen Rückgang der Trauerrituale und Bestattungspraktiken nach sich zog.[44]
Rituale können jedoch bei der Bewältigung von Trauer und Tod hilfreich sein. Ein (Trauer)Ritual wiederholt soziale Situationen und schafft Sicherheit, wenn alles andere nicht mehr zu gelten scheint. „Im Angesicht des Todes ist die eigene Wirklichkeit besonders in Frage gestellt. Durch Rituale geschieht Sinndeutung.“[45] Zudem sind (Trauer)Rituale wegen ihrer Steuerbarkeit und Kontrollierbarkeit entlastend, sie funktionieren automatisch. Ein Trauerritual ist z.B. die Beerdigung. Hier vollzieht sich zum einen die Veränderung des Sozialstatus, z.B. von der Familie zu verwaisten Eltern, zum anderen können sich die Menschen (Eltern) als Betroffene zu erkennen geben und Anteilnahme erwarten. Weiterhin werden auch die Verstorbenen von den Angehörigen freigegeben und der Tod akzeptiert.[46] Solch ein Ritual erleichtert demnach das endgültige Abschiednehmen, hier kann man seinem Trauerschmerz Ausdruck verleihen und die Beziehung zum Toten klären. Insofern wirken Rituale auch solidarisierend und kommunikativ.
In unserer Gesellschaft sind Trauerrituale jedoch kaum noch vorhanden. Das Tragen von schwarzer Kleidung oder die Grabpflege z.B. werden vielfach als unangenehm erlebt, da dies häufig als einschränkend oder verpflichtend empfunden wird. Gedenkfeiern oder Trauertänze wie sie in früheren Zeiten durchgeführt wurden, sind heute selten. Doch gerade diese Abschiedrituale können die neubegonnene Zeit ohne den geliebten Menschen greifbar machen.[47]
Im Privaten haben die meisten Menschen folglich Schwierigkeiten, miteinander über Sterben und Tod offen zu kommunizieren, werden sie doch dadurch auch an ihre eigene Sterblichkeit erinnert. Sterben wurde und ist heute überwiegend eine individuelle Angelegenheit,[48] obwohl in der politischen Öffentlichkeit mittlerweile differenziert und verantwortungsbewusst über so wichtige Themen wie Sterbehilfe, Abtreibung, Mord oder auch Todesstrafe diskutiert wird.
Die Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen ist ein natürlicher Prozess, und in diesem gibt es bestimmte Mechanismen zur Bewältigung dieser Belastung. Erst im Trauerprozess kann man den Verlust verarbeiten und das Leben wie gewohnt weiterführen. Er ist jedoch auch eingebettet in gesellschaftliche Konventionen. Die soziale Akzeptanz des Trauerns wird vor allem von drei Einflussgrößen beeinflusst: dem familiären Hintergrund sowie von kulturellen und religiösen Faktoren. Schon kleine Kinder können je nach Alter, Phantasie und Vorbildern in der Familie unterschiedliche Todesvorstellungen entwickeln (siehe Kap.8.1.1).
In manchen Kulturen bestehen lebenslange Verbindungen zu dem Verstorbenen, in anderen vergisst man ihn sehr schnell: Die Buddhisten z.B. glauben an einen Kreislauf der Seelenwanderung bis zum Nirwana und werden. Ein Indianerstamm namens Hopi fürchtet sogar den Tod und glaubt, dass der Kontakt mit Toten verunreinigt.[49]
In unserer heutigen westlichen Kultur ist das Trauern auf ein Minimum verkürzt. Ein weit verbreiteter Irrtum ist der Glaube, dass es einen festen Zeitplan für die Trauerarbeit gäbe. Jede Verlängerung wird als krankhaft oder ungesund angesehen. Dabei ist die benötigte Zeitspanne von Faktoren wie der Beziehung zum Verstorbenen, dem Alter des Trauernden und seiner Persönlichkeit abhängig. Trauern unterbricht heutzutage die Alltagsroutine, es ist eine beeinträchtigende und störende Reaktion, die schnell beseitigt werden muss. Statt Ohnmacht und Klagen wurde Selbstkontrolle, Würde und Selbstbeherrschung zur sozialen Konvention.[50] Viele Gefühle und Gedanken, die früher einmal ganz selbstverständlich am Sterbebett ausgedrückt wurden, werden mittlerweile vom Alltag ausgeklammert. Die Forscherin Margaret Stroebe bezeichnete diesen Umgang mit Trauer als „Abbruch der Bindungen“[51], weil der Trauernde alle Bindungen an den Verstorbenen zerreißen soll und eine neue Identität finden soll. Menschen, die dennoch emotional an den Verstorbenen gebunden bleiben, gelten dann häufig als fehlangepasst.
Auch die traditionelle Großfamilie ist heute weniger häufig, so dass Menschen in ihrer Trauer oft stärker isoliert sind. Das Reden über verstorbene Personen mit weniger beteiligten Menschen macht diese verlegen, weil sie glauben, dass es die Betroffenen schmerzt und umgekehrt. Stattdessen wäre es für dieselben eine gute und dringend benötigte Unterstützung, da das Sprechen darüber meist Erleichterung bringt. Viele Betroffene leiden unter dieser Privatisierung und Vereinsamung bei der Trauerarbeit und tragen psychische Schäden davon. Auch die Psychiaterin Kübler-Ross war
„überzeugt davon, dass wir mehr Schaden anrichten, indem wir das Thema vermeiden (...)“ und dass es „hilfreich sein könnte, wenn mehr Menschen über den Tod und das Sterben als wesentlichen Bestandteil des Lebens sprächen, so wie sie auch nicht zögern zu erwähnen, wenn jemand ein Baby erwartet (...).“[52]
Menschen, die von einem akuten Verlust betroffen sind, spüren diese durch die Gesellschaft aufgezwungenen „Verdrängung des Todes“, müssen sich jedoch, um auf gesunde Art Abschied von dem Verstorbenen nehmen zu können, derer entziehen bzw. hart dagegen ankämpfen.
5.2 Trauerprozess, Trauerphasen und Traueraufgaben
Aufgrund der typischen Muster, die sich im zeitlichen Verlauf des Trauerprozesses ergeben, haben viele Autoren und Forscher, die sich mit Trauerarbeit beschäftigt haben, Trauerphasen beschrieben. Phasenmodelle können sehr nützlich und hilfreich sein, weil sie die kognitiven Prozesse mit den auftretenden Emotionen zueinander in Beziehung setzen, sowie den Trauernden auch Hoffnung auf ein „Ende“ der Trauer aufzeigen können.[53]
Zu den bekanntesten Trauerphasen gehören die von John Bowlby und Verena Kast. Bowlbys Phasenmodell von 1961 bestand zunächst aus drei Phasen. 1980 formulierte er jedoch noch eine weitere Phase des Schockzustandes, die er den anderen vorschaltete.
Tab. 1: Trauerphasen nach Bowlby und Kast[54]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Phasenmodelle bergen jedoch auch immer die Gefahr, dass sie zum einen das Gefühl geben, der Trauernde müsse nur lange genug passiv abwarten, bis eine Phase nach der anderen eintritt und dass sie zum anderen starr festlegen, wie ein gesunder Trauerprozess ablaufen sollte. Jede (häufig auftretende) Abweichung von dem Phasenverlauf kann dann direkt als pathologisch angesehen und interindividuelle Unterschiede außer Acht gelassen werden.
Für andere Autoren wie z.B. Schibilsky ist Trauer ein offener Prozess, der in gewissem Sinne nie ein Ende finden kann. „Trauererfolg“ könne weder zeitlich noch inhaltlich gemessen werden, und trotz der sinnvollen Einrichtung z.B. des Trauerjahres, ist dies kein verlässlicher Maßstab für den Abschluss der Trauer. Schibilsky sieht Trauer auf einem Spiralweg mit vier Dimensionen/ Räumen (Vergangenheit, Zukunft, innen und außen), die immer wieder neu durchschritten werden müssen, um sich für das Leben wie eine Spirale öffnen zu können. Damit übt er gleichzeitig Kritik an den Phasenmodellen, die sich überwiegend auf die Zeitdimension beziehen.[55]
Der amerikanische Trauerberater J. William Worden hat die Phasenmodelle aufgrund der oben angesprochenen implizierten Passivität durch Traueraufgaben ersetzt. Er betrachtet die Trauerreaktionen von Trauernden als individuell unterschiedlich, die eigene personenspezifische Trauerarbeit müsse erst entwickelt werden. Traueraufgaben verlaufen nicht chronologisch oder deutlich unterscheidbar, sondern betonen die aktive Verpflichtung des Trauernden und die Verantwortung und Kompetenz zur Erfüllung der Trauerarbeit.[56]
Worden hat vier Traueraufgaben beschrieben:
Zunächst ist es wichtig, den Verlust des Verstorbenen als Realität zu akzeptieren sowie zur Einsicht zu gelangen, dass ein Wiedersehen in diesem Leben nicht möglich ist. Es besteht ein Zusammenhang zum Suchverhalten, das vor allem Bowlby in seinem Phasenmodell ausführlich beschrieben hat. Häufig wird der Verlust vom Betroffenen geleugnet, man „will es nicht wahrhaben“ (vgl. Kast).
Weiterhin muss der Trauerschmerz vollständig erfahren und durchlebt werden. Denn eine Vermeidung oder Unterdrückung des Schmerzes verlängert den Trauerprozess. Die Bewältigung dieser Aufgabe wird von der Gesellschaft manchmal behindert, indem sie das Trauern zeitweise als ungesund stigmatisiert, Trauergefühle als unangenehm erlebt und den Trauernden ständig aufmuntern will. Manche Menschen neigen zur Empfindungslosigkeit, indem die Gefühle verdrängt, Gedankenstopp-Methoden angewendet werden oder der Verstorbene idealisiert wird.[57] Nach Bowlby „brechen früher oder später manche von denen, die jedes bewusste Trauern vermeiden, zusammen, und zwar meist in einer Form von Depression.“[58]
Gerade bei ungenügender Erledigung dieser zweiten Aufgabe, muss später oftmals eine Therapie erfolgen.
Ferner muss eine Anpassung an eine veränderte Umwelt erfolgen. Eine Umwelt, in welcher der Verstorbene zukünftig fehlt. Die meisten Betroffenen brauchen lange, um zu begreifen, was es heißt, ohne die geliebte Person zu leben. Einige Menschen verharren sehr lange in ihrer eigenen Hilflosigkeit, ziehen sich von der Welt zurück oder weichen jeglichen Anforderungen der Umwelt aus.
Eine weitere Traueraufgabe ist durch den Abzug emotionaler Energie vom Verstorbenen und der Reinvestition in eine andere Beziehung gekennzeichnet. Der Trauernde muss sich gefühlsmäßig vom Verstorbenen lösen. Den meisten Menschen fällt dies sehr schwer. Sie haben Angst eine neue Bindung einzugehen, weil sie fürchten, auch diesen Menschen wieder zu verlieren bzw. die einstige Bedeutung des Verstorbenen in ihrem Leben zu reduzieren. Viele Frauen, die zuvor ein Kind verloren haben, können dann z.B. zu extremer Überbehütung weiterer Kinder neigen. Andere Menschen wiederum schmerzt der Verlust einer Person so sehr, dass sie sich weigern, je wieder zu lieben, und so ihr Leben zum Stehen bringen.[59]
Trauerarbeit kann nur gelingen, wenn der schmerzliche Verlust durch Bewältigung der Traueraufgaben vollständig wahrgenommen und ertragen wird, so dass irgendwann neue Beziehungen eingegangen werden können und in der veränderten Umwelt ohne den Verstorbenen gelebt werden kann. Unter diesem Aspekt kann die Trauer auch eine Chance zur persönlichen Entwicklung bieten (siehe dazu auch 3.2).
Die Kenntnis über Trauerphasen und –aufgaben hat Konsequenzen für die Betreuung Trauernder. In der praktischen Arbeit mit Trauernden gibt es keine „Checkliste“ eines optimalen Trauerverlaufs mit chronologisch ablaufenden Phasen. Dennoch ist das Wissen über die Trauerphasen sehr hilfreich. Die Tatsache, dass das zeitweilige Auftreten von depressionsähnlichen Gefühlen als ein „normales“ Verhalten angesehen wird, kann für den Trauernden eine Entlastung darstellen.
Weiterhin beschreiben sie alle ein positives Ergebnis des Trauerprozesses. Dies kann dem Trauerberater helfen, negative Teilphasen nicht überzubewerten sowie dem Trauernden Kraft zum Aushalten zu geben. Trauern endet nach Meinung vieler Autoren, wenn die Traueraufgaben oder die letzte Trauerphase als Phase der Wiederherstellung durchlaufen wurde. Dafür gibt es keine festgelegte Frist, die es abzuwarten gilt.
5.3 Folgen der Trauer
Trauer ist gekennzeichnet durch verschiedene und vielfältige psychische und physische Symptome. Trauer kann sich bei jedem Menschen je nach Persönlichkeit des Hinterbliebenen, nach individueller Lebensgeschichte und den momentanen Lebensumständen, der Todesursache und dem sozialen Umfeld anders auswirken. Im Trauerprozess gibt es gewisse allgemeine Trauersymptome, die bei fast jedem Trauernden auftreten können, aber auch Komplikationen, die sog. Pathologische Trauer.
5.3.1 Allgemeine Trauersymptome
Unter allgemeinen Trauersymptomen versteht man das Trauern ohne Komplikationen. Bei der „normalen“ und sog. akuten Trauer kann man zwei wesentliche Einteilungen vornehmen: somatische Reaktionen, die meist in Folge einer Verdrängung der Gefühle auftreten und psychische Reaktionen in Form einsetzender starker Gefühle und intensiver Gedanken, überwiegend bei Personen, die sich intensiv mit dem Verlust auseinandersetzen.[60]
Die körperlichen (somatischen) Empfindungen, die im Zusammenhang mit den Trauerreaktionen auftreten, sind sehr vielseitig. Verschiedene Forscher und Psychiater haben im Laufe der Jahre unterschiedliche wissenschaftliche Arbeiten über akute Trauerreaktionen durchgeführt. Eine der bekanntesten ersten wissenschaftlichen Arbeiten ist die des amerikanischen Psychiaters Erich Lindemann von 1944 über Personen, die Familienmitglieder in einer Feuerkatastrophe verloren haben.[61]
Eine Vielzahl von Hinterbliebenen äußert Empfindungen wie Brustbeklemmungen, Überempfindlichkeit gegen Lärm, Atemlosigkeit, Muskelschwäche oder Mundtrockenheit. Auch Appetitlosigkeit, Unruhe, Zittern und Herzklopfen wurden genannt.[62] Diese Symptome beunruhigen die meisten Trauernden, so dass ein Grossteil erst einmal einen Hausarzt aufsucht, der dann zeitweise eine Trauertherapie oder Gesprächsgruppe empfiehlt. Schlafstörungen treten ebenfalls häufig auf, die sich jedoch nach einer gewissen Zeit von selbst wieder einstellen können. Sie können allerdings auch Anzeichen einer ernsten depressiven Störung sein und sollten exploriert werden. Manchmal steht die Furcht vor Träumen dahinter, in denen der Verstorbene lebendig oder in albtraumartigen Szenen mit Forderungen und Ansprüchen erscheint. Diagnostisch gesehen können Träume für den Trauerberater ein Anhaltspunkt dafür sein, wo der Trauernde im Trauerprozess gerade steht.[63]
Psychische Reaktionen, Gefühle und Gedanken unterstehen einem breiten Spektrum. Denken und Fühlen fließen in der Trauer oft zusammen. Bestimmte Gedanken wie z.B.:„Ohne mein Kind hat alles keinen Sinn mehr“ lösen intensive, aber auch für die Trauer typische Gefühle von Traurigkeit und Betäubung aus. Die meisten Gedanken treten in den ersten Stadien der Trauer auf, verschwinden aber relativ bald wieder, so z.B. der anfängliche Unglaube oder das Nichtwahrhabenwollen in Bezug auf die Todesnachricht.
Traurigkeit ist selbstverständlich das am häufigsten beobachtete Gefühl, was sich auch schnell in depressive Symptome umwandeln kann. Dennoch sollte man Depression und Trauer nicht gleichsetzen. Zwar kann sich aus der allgemeinen Traurigkeit im Trauerprozess auch eine Depression entwickeln und meist zeigt eine Depression auch ähnliche Symptome wie Trauer, also z.B. Appetitlosigkeit oder Schlafstörungen, doch gibt es einen wesentlichen Unterschied: Eine Trauerreaktion geht nur selten mit einem Verlust des Selbstwertgefühls einher, im Gegensatz zur klinischen Depression. Das bedeutet, dass das Selbstwertgefühl eines Menschen durch den Verlust einer geliebten Person lediglich zeitweise beeinträchtigt wird, aber selten völlig verschwindet. Dies gilt sogar beim Auftreten von Schuldgefühlen im Zusammenhang mit dem Verlust.[64] Im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen der American Psychiatric Association ist dies unter V62.82[65] „Einfache Trauer“ ebenso wiedergegeben: „Diese Kategorie kann verwendet werden, wenn im Vordergrund der klinischen Aufmerksamkeit die Reaktion auf den Tod eines geliebten Menschen steht. Als Teil der Reaktion [...] können manche trauernde Personen Symptome entwickeln, die charakteristisch für eine Episode der Major Depression[66] sind (z.B. Gefühle der Traurigkeit und damit verbundene Symptome wie Schlafstörungen, Appetitminderung und Gewichtsverlust). [...] Die Diagnose einer Major Depression wird im allgemeinen nicht vergeben, es sei denn, die Symptome sind auch 2 Monate nach dem Verlust noch vorhanden.“[67]
Zorn wird ebenfalls sehr oft empfunden, und verwirrt viele Trauernde Zorn. ist häufig der Auslöser für viele andere Schwierigkeiten im Trauerprozess. Er entsteht zum einen aus der Frustration heraus, dass man den Tod der geliebten Person nicht verhindern konnte, zum anderen durch die auftretende Hilflosigkeit und das von Angst begleitete Gefühl ohne den anderen nicht leben zu können. Häufig wird der Zorn statt auf den Verstorbenen auf eine andere Person gerichtet, welcher dann auch die Schuld am Tod des Verstorbenen zugeschoben wird.[68] Häufiges Ziel sind hier Ärzte, die den Kranken behandelten, Seelsorger oder auch Bestatter. Einige Hinterbliebene entwickeln in ihrer Phantasie konkrete Rachepläne, die jedoch glücklicherweise selten ausgeführt werden. Dies kann den Verlauf der Trauer stark behindern, da der Hinterbliebene sich mehr mit seinen Phantasiegebilden beschäftigt als mit seinem Trauerschmerz und dessen Bewältigung.[69] Diese unangemessene Bearbeitung des Zorns kann zu komplizierten Trauerreaktionen führen. Gefährlich wird Zorn, wenn er sich umdreht, also gegen das eigene Selbst richtet und sich in Selbstmordabsichten äußert.
Viele Trauernde leiden unter Schuldgefühlen im Zusammenhang mit dem Tod einer geliebten Person. Besonders in plötzlichen und unerwarteten Todesfällen, in denen es keine Zeit mehr gab, ungelöste Konflikte oder ähnliches mit dem Verstorbenen zu klären.
Andere Trauernde glauben nicht fürsorglich genug gewesen zu sein, den Kranken zu spät ins Krankenhaus gebracht zu haben und anderes. Diese Schuldgefühl sind meist irrational, und das ist den Trauernden auch bewusst. Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen dem Wissen entlastender Argumente für ihn selbst und dem emotionalen Gefühl der Schuld. Trauer muss immer auch emotional bearbeitet werden, sie ist nicht nur rational begreifbar. In der Trauerberatung sollten daher auch phantasierte Schuldgefühle ernst genommen werden, und nicht versucht werden, sie dem Trauernden auszureden. Irgendwann kann der Trauernde ihre Bedeutung selbst ergründen und sie sodann vielleicht als inhaltslos und überflüssig ansehen.[70]
Ein häufig auftretendes Gefühl ist Angst, sei es in Form von Unsicherheit oder bis hin zu Panikattacken. Dafür gibt es zwei Ursachen, einerseits fürchten die Betroffenen, allein nicht zurecht zu kommen und wehrlos zu sein, andererseits erkennen sie auch die eigene Sterblichkeit und die Unabwendbarkeit des Todes. Je intensiver die Angstgefühle, desto eher ist die Möglichkeit einer pathologischen Trauerreaktion gegeben, auf die ich unter 5.3.2 noch eingehen werde. Mit der Angst ist auch immer ein Gefühl der Hilflosigkeit verbunden, das aufgrund einer tatsächlichen Überforderung durch die Formalitäten der Bestattung und der Nachlassregelung verstärkt werden kann. Die meisten Trauernden sehen die Zeit der Trauer als einen sehr hohen Berg vor sich, von dem sie glauben, ihn nie überwinden zu können. Weiterhin erleben viele Trauernde Gesichts- und Gehörshalluzinationen als Erfahrungen, die zwar nur in den ersten Wochen nach dem Verlust auftreten, den Trauernden jedoch oft erschrecken. Er empfindet sich als verrückt und das verstärkt wiederum die Hilflosigkeit.[71]
Zu den üblichen Trauererfahrungen gehört weiterhin ein starkes Sehnsuchtsgefühl nach der Person des Verstorbenen. Die Hinterbliebenen verzehren sich geradezu nach einer letzten Umarmung oder Berührung der geliebten Person. Ein Abklingen dieses Gefühls bedeutet in der Regel auch ein nahes Ende der akuten Trauer. Kognitiv dazu meint der Trauernde oft, die Präsenz des Verstorbenen noch im Raum oder in seiner Nähe zu spüren.[72]
5.3.2 Pathologische Trauer
Neben der „normalen Trauer“ gibt es auch Komplikationen im Trauerprozess, die häufig als pathologische Trauer (siehe z.B. Bowlby)oder auch als abnorme Trauerreaktionen (siehe Worden) bezeichnet werden.
Bowlby bemerkte, dass sich pathologische Trauerreaktionen nur über die Beschreibung allgemeiner, die Trauerarbeit förderlicher Prozesse identifizieren und unterscheiden lassen, während der Trauerberater Worden in seinem Buch „Beratung und Therapie in Trauerfällen“ verschiedene Faktoren beschreibt, die Trauer kompliziert machen können. Diese Faktoren seien für die Art, die Intensität und die Dauer des Trauerns von mitbestimmender Bedeutung. Er unterscheidet zwei Gruppen von Trauernden: 1) die Gruppe von Menschen, bei denen Trauerreaktionen vollständig ausbleiben, sich also gar keine Trauer einstellt, und 2) eine Gruppe von Menschen, die fehlgeleitet trauern und von der Intensität und Dauer einer Reaktion geradezu überwältigt werden:[73]
1) das Ausbleiben der Trauer
Für das Ausbleiben von Trauer spielen 5 verschiedene Faktoren eine Rolle:
Dies ist erstens die Form der Beziehung, die der Trauernde zu der verstorbenen Person hat. Diese lässt sich wiederum grob in drei Kategorien einteilen:
a) Angemessenes Trauern wird oft durch hochambivalente Beziehungen verhindert, d.h. der Trauernde hat starke Gefühle der Schuld und des Zorns und ist durch die hohe Ambivalenz in der Beziehung unfähig zu trauern.
b) Ein anderer Beziehungstypus ist der hochnarzisstische, in dem der Verlust geleugnet wird, weil der Verstorbene ein Teil des eigenen Selbst war, und man diesen Teil nicht aufgeben will.
Als dritten Typus c) gibt es die durch Abhängigkeit bestimmte Beziehung. In ihr verliert der Trauernde die Quelle seiner Abhängigkeit (den Verstorbenen) und müsste damit sein Selbstbild ändern. Durch die Abhängigkeit zu einem starken Menschen fühlte sich der Trauernde ebenfalls stark, ist aber durch den Tod dieser Person wieder schwach und hilflos. Das Gleichgewicht von positiven und negativen Aspekten des Selbstbildes, welches sich bei jeder gesunden Persönlichkeit finden lässt, wird nun durch überstarke Gefühle der Hilflosigkeit gestört und die Möglichkeit eines positiven Selbstbildes ausgeschlossen.
Zweitens können auch gewisse spezifische Umstände die Trauer verkomplizieren. Die näheren Umstände eines Verlusts wie z.B. die Ungewissheit über den Verbleib einer Person, etwa bei Vermisstenmeldungen, oder auch eine Vielzahl von Verlusten innerhalb einer kurzen Zeitspanne, können die Stärke und das Ergebnis der Trauerreaktion erheblich beeinflussen.
Als dritten Faktor führt Worden anamnestische[74] Faktoren an. Dazu gehören z.B. schon frühere komplizierte Trauerreaktionen oder frühere aufgetretene Depressionen im Leben eines Menschen.
Die Persönlichkeit eines Trauernden und seine Fähigkeit mit Schmerz umzugehen, ist der vierte Faktor, der am Ausbleiben der Trauer beteiligt sein kann. Menschen, die sich aus Angst oder aus Hilflosigkeit vor extremen seelischen Schmerz verschließen, wehren sich gegen die Trauer bzw. stellen sie ganz ab. Das eigene entwickelte Selbstkonzept kann ebenfalls vom Trauern abhalten. Durch eine zugeschriebene oder auch selbst ausgefüllte Rolle in der Familie oder der Umwelt, z.B. die der starken und tapferen Person, kann es dazu kommen, dass sich der Trauernde Gefühle der Angst und Unsicherheit verbietet, und damit keine angemessene Bewältigung des Verlusts erfolgen kann.
[...]
[1] Vgl. Statistisches Bundesamt: online unter URL: http://www.destatis.de (Zugriff 22.03.2002)
[2] Vgl. Rosch Ingelhart, M. (1988), S.14 f
[3] (lat.): nicht beständig, nicht dauernd
[4] Vgl. Rosch Inglehart, M. (1988), S. 56
[5] Rosch Inglehart, M. (1988), S. 30
[6] Vgl. Rosch Inglehart,M. (1988), S. 16f
[7] Vgl. Langenmayr, A. (1999), S.25f
[8] Vgl. Langenmayr, A. (1999), S.22f
[9] Langenmayr, A. (1999), S.23
[10] Vgl. Langenmayr, A. (1999), S.23
[11] Vgl. Langenmayr, A. (1999), S. 24
[12] Vgl. Cook, B.; Phillips, S.G. (1995), S.2f
[13] Kast, V. (1982), S. 153
[14] Vgl. Iskenius-Emmler, H. (1988), S.82ff
[15] Humboldt-Psychologie Lexikon (1990), S.62
[16] Rosch-Inglehart, M. (1988), S.24
[17] Vgl. Hedervari, E. (1995), S. 26
[18] Vgl. Bowlby, J. (1975), S. 50ff
[19] Vgl. Hédervári, É. (1995), 23f
[20] Vgl. Brisch, K. (1999), S. 36
[21] Vgl. Brisch, K. (1999), S. 35ff
[22] Exploration: Erforschung, Untersuchung
[23] Vgl. Brisch, K. (1999), S. 38f
[24] Vgl. Brisch, K. (1999), S.25
[25] Vgl. Brisch, K. (1999), S. 44f
[26] Vgl. Spangler, G.: Kongressbericht DGPs 1996, online unter URL: http:\www.hogrefe.de\buch\online\kongress_40\62.htm (Zugriff: 27.02.2002
[27] Vgl. Main, M., Goldwyn, R. (1985-1993), In: Spangler, G.:Kongressbericht DGPs 1996, online unter URL: http://www.hogrefe.de/buch/online/kongress_40/62.htm (Zugriff 27.02.2002)
[28] Vgl. Hedervari, E. (1995), S.29f
[29] (lat.): Zusammenhanglosigkeit
[30] Vgl. Bowlby, J. (1995), S.57
[31] siehe dazu: Zahn-Waxler, C.; Radke-Yarrow,M. (u.a.), (1979), S.319-330 oder Frommer, E.A.; O´Shea,G. (1973), S.149-156 In: Bowlby, J (1995), S. 59
[32] Vgl. Spangler, G.; Zimmermann, P.(Hrsg.), (1995), S.45
[33] Vgl. Schneewind, K.A. (1999), S. 22
[34] Vgl. Karpel, M.A.; Strauss, E.S. (1983), In: Schneewind, K.A. (1999), S. 20f
[35] Vgl. Schneewind, K.A. (1999), S. 23
[36] Vgl. Schneewind, K.A. (1999), S.24
[37] Vgl. Schneewind, K.A. (1999), S.26
[38] Vgl. Schneewind, A. (1999), S. 27
[39] Vgl. Schneewind, A. (1999), S.28
[40] Bowlby, J. (1995), S.162
[41] Vgl. Bowlby, J. (1983), S.60ff
[42] Vgl. Specht-Tomann, M.; Tropper, D. (2001), S. 16
[43] Specht – Tomann, M.; Tropper, D. (2001), S. 59f
[44] Vgl. Specht-Tomann, M.; Tropper, D. (2001), S.21
[45] Schwerin, A.C. (1995), S. 48
[46] Vgl. Schwerin, A.C. (1995), S.49
[47] Vgl. Lothrop, H. (1991), S. 211
[48] Vgl. Specht - Tomann, M.; Tropper, D. (2001), S.14ff
[49] Vgl. Historische Entwicklungen und sozialer Wandel, online unter URL: http://www.home.t-online.de/home/Rogahn3/tod02.htm (Zugriff am 31.03.02)
[50] Vgl. Specht – Tomann, M.; Tropper, D. (2001), S.22f
[51] Vgl. Stroebe, M. (u.a.), (1992), In: Comer, R.J. (Hrsg) (1995), S. 292
[52] Kübler-Ross, E. (1971), S. 125
[53] Vgl. Langenmayr, A. (1999), S. 27f
[54] Vgl. Bowlby, J. (1980/Orig.); Kast, V. (1982)
[55] Vgl. Schibilsky, M. (1991), S. 235
[56] Vgl. Jerneizig, R.; Langenmayr, A.; Schubert, U. (1991), S. 25f
[57] Vgl. Worden, J.W. (1987), S. 19ff
[58] Bowlby, J. (1975), S. 158
[59] Vgl. Worden, J. W. (1987), S. 23f
[60] Vgl. Langenmayr, A. (1999), S.41
[61] siehe dazu: Lindemann, E. (1944), S.141-148; In: American Journal of Psychiatry 101
[62] Vgl. Worden, W. (1987), S. 28
[63] Vgl. Jerneizig, R.; Langenmayr, A.; Schubert, U. (1991), S.17
[64] Vgl. Worden, W. (1987), S.40
[65] V-Schlüssel bezeichnet den Zustand, der nicht einer psychischen Störung zuzuschreiben ist, aber
Anlass zur Beobachtung gibt
[66] Majore depressive Episode: schwere Episode depressiver Verstimmung, die deutlich beeinträchtigend ist und nicht von organischen Faktoren wie Medikamenten, Drogen oder einer med. definierten Erkrankung hervorgerufen wird.
[67] DSM IV (1998), S.771
[68] Vgl. Worden W. (1987), S.30
[69] Vgl. Jerneizig, R.; Langenmayr, A.; Schubert, U. (1991), S. 23
[70] Vgl. Jerneizig, R.; Langenmayr, A.; Schubert, U. (1991), S.22
[71] Vgl. Worden, W. (1987), S.34
[72] Vgl. Worden, W. (1987), S.34
[73] Vgl. Worden, W. (1987), S.69ff
[74] Anamnese (griech.): Vorgeschichte einer Krankheit
- Arbeit zitieren
- Bärbel Backhaus (Autor:in), 2002, Der Tod eines Kindes als kritisches Lebensereignis, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41696
Kostenlos Autor werden









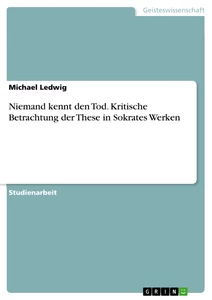





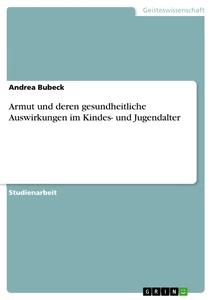






Kommentare