Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Problemaufriss
2 Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule aus der Perspektive der beteiligten Personen
2.1 Theoretische Konzepte zur Beschreibung und Deutung von Übergangen
2.1.1 Der ökopsychologische Ansatz
2.1.2 Kritische Lebensereignisse
2.1.3 Der Transitionsansatz
2.1.4 Zusammenfassung
2.2 Anforderungen und notwendige Kompetenzen für Kind und Eltern beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
2.2.1 Anforderungen auf der individuellen Ebene
2.2.2 Anforderungen auf der interaktionalen Ebene
2.2.3 Anforderungen auf der kontextuellen Ebene
2.2.4 Zusammenfassung
2.3 Schulfähigkeit und Schuleingangsdiagnostik
3 Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule aus der Perspektive der beteiligten Institutionen
3.1 Der Kindergarten
3.1.1 Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Kindergartens
3.1.2 Rechtlicher Rahmen
3.1.3 Organisatorischer Rahmen
3.1.4 Inhaltlicher Rahmen
3.1.5 Förderung bestimmter Kompetenzen im Hinblick auf die Übergangsbewältigung
3.2 Die Grundschule
3.2.1 Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der
Grundschule
3.2.2 Rechtlicher Rahmen
3.2.3 Organisatorischer Rahmen
3.2.4 Inhaltlicher Rahmen
3.2.5 Förderung bestimmter Kompetenzen im Hinblick auf die Übergangsbewältigung
3.3 Vergleich zwischen Kindergarten und Grundschule
3.3.1 Gemeinsamkeiten
3.3.2 Unterschiede
3.3.3 Zusammenfassung
3.4 Konsequenzen für den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
3.4.1 Konsequenzen auf rechtlicher Ebene
3.4.2 Konsequenzen auf organisatorischer Ebene
3.4.3 Konsequenzen auf inhaltlicher Ebene
3.4.4 Zusammenfassung
3.5 Anschlussfähigkeit von Kindergarten und Grundschule
3.5.1 Verwirklichung von Anschlussfähigkeit
3.5.2 Zusammenfassung
3.6 Begründung für eine Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule
3.6.1 Begründung für eine Kooperation in Gesetzen und Bildungsplänen
3.6.2 Begründung für eine Kooperation in Konzepten zur Beschreibung und Deutung von Übergängen
3.6.3 Begründung für eine Kooperation aus der Sicht der Erzieherinnen
3.6.4 Begründung für eine Kooperation aus der Sicht der Lehrerinnen
3.6.5 Begründung für eine Kooperation zu Gunsten des Kindes und der Eltern beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
3.6.6 Zusammenfassung
3.7 Formen der Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule
3.7.1 Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte von Kindergarten und Grundschule
3.7.2 Zusammentreffen von Kindergartenkindern und Schulkindern
3.7.3 Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und Lehrerinnen mit Eltern
3.7.4 Gemeinsame Veranstaltungen im Jahresverlauf
3.7.5 Zusammenfassung
3.8 Probleme der Zusammenarbeit
3.8.1 Informationsmangel und Empfehlungscharakter
3.8.2 Das Problem der Zusammenführung zweier unterschiedlicher Institutionen
3.8.3 Differenzierte Sichtweisen und Auffassungen der pädagogischen Fachkräfte und der Eltern
3.8.4 Probleme der Organisation
3.8.6 Zusammenfassung
4 Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule aus historischer, empirischer und internationaler Perspektive
4.1 Historische Entwicklung der Übergangsproblematik
4.2 Aktueller Forschungsstand
4.2.1 Forschungsbeiträge aus Deutschland
4.2.2 Aktuelle und noch nicht abgeschlossene Projekte aus Deutschland
4.2.3 Zusammenfassung
4.3 Internationale Perspektiven
5 Die Montessori-Pädagogik
5.1 Maria Montessori und die Grundlagen ihrer Pädagogik
5.1.1 Maria Montessori: Ärztin und Pädagogin
5.1.2 Erziehung und Bildung vom Kinde aus
5.1.3 Die sensiblen Phasen
5.2 Das Montessori-Kinderhaus
5.2.1 Die vorbereitete Umgebung
5.2.2 Das Material
5.2.3 Die Rolle der Erzieherin
5.3 Die Montessori-Schule
5.3.1 Die Freiarbeit
5.5.2 Der Fachunterricht
5.3.3 Das Material
5.3.4 Die Rolle der Lehrerin
5.3.5 Leistungsbeurteilung
5.4 Der Übergang vom Kinderhaus in die Montessori-Schule
5.5 Montessori- Pädagogik in Deutschland
5.5.1 Die Entwicklung der Montessori-Pädagogik in
Deutschland
5.5.2 Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte von Montessori-Einrichtungen
5.6 Empirische Untersuchungsergebnisse
5.6.1 Forschungsbeiträge aus Deutschland
5.6.2 Zusammenfassung
6 Empirie
6.1 Forschungsfrage
6.2 Forschungsdesign
6.2.1 Untersuchungsmethode
6.2.2 Untersuchungsteilnehmer
6.2.3 Untersuchungsdurchführung
6.2.4 Auswertungsmethode
6.3 Ergebnisse
6.3.1 Regelung der Einschulung in die Montessori-Schule
6.3.2 Formen der Zusammenarbeit
6.3.3 Kooperation mit den Eltern zwecks Übergang
6.3.4 Probleme der Zusammenarbeit
6.3.5 Vorbereitung der Kinder im Kinderhaus
6.3.6 Anschlussfähigkeit der Montessori-Schule
6.3.7 Idealbild des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule
6.3.8 Unterschiede zwischen Übergängen in Regeleinrichtungen und in Montessori-Einrichtungen
6.3.9 Bedeutung der Montessori-Pädagogik für den Übergang
6.3.10 Zusammenfassung
7 Diskussion und Ausblick
7.1 Diskussion
7.2 Ausblick
8 Schlusswort
9 Literaturverzeichnis
10 Anhang
11 Bestätigung
1 Problemaufriss
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist ein zentrales Erlebnis im Leben fast jeden Kindes. Kinder freuen sich auf die Schule. Sie werden ein Schulkind, das die Fähigkeiten der Erwachsenen und größeren Kinder erlernen wird: schreiben, lesen und rechnen. Damit kommt es den "Großen" ein Stück näher.
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist aber auch ein Übertritt in einen neuen Lebensabschnitt, der sowohl für die Kinder als auch für die Eltern mit Unsicherheiten und Verlusten einhergehen. Mit dem Schuleintritt kommen erhebliche Anforderungen auf das Kind und die Eltern zu, da die Schule eine ganz andere Welt ist als der Kindergarten.
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist wie ein Knackpunkt zwischen zwei verschiedenen Welten, der auch Pädagogen, Psychologen und Soziologen beschäftigt, seit es die zwei Einrichtungen als eigenständige Institutionen gibt.
Daneben ist die Bildungsqualität in deutschen Kindergärten zur Zeit ein sehr brisantes Thema. Dies zeigt sich in den Bemühungen der einzelnen Länder, Erziehung- und Bildungspläne für Kindertagestätten zusammen zu stellen, in Erprobungsphasen zu testen, um pädagogischen Fachkräften eine Orientierung für ihre Arbeit im Kindergarten zu geben. So veröffentlichte 2004 das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend in Rheinland-Pfalz den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten. In Bayern wurde ebenfalls 2004 vom Bayrischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen und vom Staatsinstitut für Frühpädagogik München der Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung herausgegeben. In Baden-Württemberg beginnt mit dem Kindergartenjahr 2005/06 eine Erprobungsphase des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung für Kinder in Kindertageseinrichtungen. Außer den inhaltlichen Themen enthalten die neuen Bildungs- und Erziehungsempfehlungen Informationen zum Übergang in die Grundschule. Dazu werden zum einen Kompetenzen genannt, die bei Kindern in Tageseinrichtungen aufgebaut und gefördert werden sollen, besonders im Hinblick auf die Übergansbewältigung. Zum anderen enthalten sie konkrete Beispiele, wie Kindergarten und Grundschule miteinander kooperieren können, um den Kindern den Übergang zu erleichtern.
Neben den Bildungs- und Erziehungsplänen für den Elementarbereich gibt es in einigen Bundesländern vielfältige Projekte, in deren Rahmen Möglichkeiten für eine neue Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule erprobt werden: „Schulanfang auf neuen Wegen“ (Baden-Württemberg), KiDZ - Kindergarten der Zukunft (Bayern), KinderLernwelt - KiTa und Grundschule machen Kinder stark – Gemeinsame Bildungsverantwortung für 3 - 10jährige Kinder entwickeln und verstetigen“ (Nordrhein-Westfalen) und noch viele mehr.
In Rheinland-Pfalz wird ein Ausbau des Bildungs- und Betreuungsangebots vor der Einschulung angestrebt. Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend Rheinland-Pfalz stellte im Februar 2005 ein entsprechendes Programm dazu vor. Unter anderem wird sogar geplant, ab 2008 das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei zu machen. Darüber hinaus soll ermöglicht werden, Kinder früher einzuschulen. Ein Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren sowie ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenbesuch ab 2 Jahren ab 2010 wird favorisiert.
Dies sollte zeigen, dass zur Zeit vor allem im Kindergarten regelrechte Umwälzungen stattfinden. Damit soll erreicht werden, dass die Einrichtungen des Elementarbereichs als Bildungseinrichtungen ernst genommen werden, die dem Primarbereich des Bildungssystems sowohl inhaltlich als auch organisatorisch näher kommt. Wenn Kindergarten und Grundschule aneinander anschlussfähig gemacht werden, kann es möglich gemacht werden, dass den Kindern der Übergang leichter fällt. Es würde dann keinen so großen Knackpunkt mehr geben, weil beide Institutionen organisatorisch und inhaltlich aufeinander aufbauen.
Es existieren in Deutschland schon seit Jahrzehnten Einrichtungen im Elementar- und Primarbereich, die aufgrund der gleichen Pädagogik und Methodik eng miteinander verbunden sind, so dass das Kind beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule in keine völlig neue Welt einsteigt. Als Beispiele sind Waldorf- und Montessori-Einrichtungen zu nennen. Dabei drängt sich die Frage auf, wie der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule abläuft, wenn die Arbeit beider Einrichtungen von den gleichen Prinzipien einer gemeinsamen Pädagogik geprägt ist. Wie wird dieser Übergang inhaltlich und organisatorisch gestaltet?
Es gibt vielfältige Untersuchungen und Berichte, wie der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule im Regelschulbereich gestaltet, begleitet und bewältigt wird. Studien zum Thema Übergang in Reform- und Alternativschulen gibt es kaum.
Aus diesem Grund wurde die vorliegende Arbeit verfasst, die sich zum einen theoretisch mit Übergängen in Regeleinrichtungen befasst und anschließend in einer Untersuchung die Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule in Montessori-Einrichtungen erfragt.
Es wird darauf hingewiesen, dass in der vorliegenden Arbeit die Begriffe "Kindergarten", "Kindertagesstätte" und "Kindertagesheime" synonym verwendet werden.
Im Theorieteil wurden einige Beispiele aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz genannt. Die Gründe dafür sind zum einen, dass die Untersuchung ausschließlich in Baden-Württemberg durchgeführt wurde und zum anderen, dass Bayern als Vorreiter für bildungspolitische Initiativen ist. Des Weiteren ist die vorliegende Arbeit Teil des ersten Staatsexamens für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, das in Rheinland-Pfalz absolviert wird.
2 Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule aus der Perspektive der beteiligten Personen
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist ein einschneidendes Erlebnis für Kind und Eltern. Der Prozess, in dem ein Kindergartenkind zu einem Schulkind wird und die Eltern eines Kindergartenkindes zu Eltern eines Schulkindes werden, wird oft mit gemischten Gefühlen begleitet: Vorfreude und Stolz aber auch Angst und Ungewissheit vor Unbekanntem.
Dieses Kapitel soll den Prozess des Übergangs aus der Perspektive des Kindes und der Eltern darstellen. Zunächst werden theoretische Konzepte vorgestellt, auf Grund deren allgemein Übergänge im Lebensverlauf beschrieben und gedeutet werden können. Es folgt ein Modell, das speziell den Übergangsprozess vom Kindergarten in die Grundschule veranschaulicht. Anschließend werden von den theoretischen Grundlagen ausgehend die Anforderungen für Kind und Eltern beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule beschrieben, wobei an dieser Stelle auch auf die notwendigen Kompetenzen zur Bewältigung des Übergangs eingegangen wird.
2.1 Theoretische Konzepte zur Beschreibung und Deutung von Übergangen
Übergänge im Lebensverlauf beschäftigen schon lange die Verhaltensforschung, Stressforschung und Psychoanalyse. Angeregt von der Pisa-Studie und vergleichenden Messungen der Leistungen von Schülern wurde in letzter Zeit den Übergängen im Bildungssystem im besonderen Maße Aufmerksamkeit geschenkt.
Griebel und Niesel (2004), zwei Diplom-Psychologen, die im Staatsinstitut für Frühpädagogik in München wissenschaftlich tätig sind, haben die Transitionstheorie von Cowan (1991, Griebel & Niesel 2004, S. 93) angewendet, um speziell den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu beschreiben und zu deuten. Darüber hinaus stützen sie sich auf andere theoretische Ansätze, welche schon vorher für die Untersuchung des Eintritts in die Schule herangezogen worden sind.
Griebel und Niesel (2004) nennen folgende Konzepte (Griebel & Niesel 2004, S. 84 ff.):
- der ökopsychologische Ansatz
- das kontextuelle System-Modell
- der Stressansatz
- die Perspektive der Lebensspanne
- die Theorie der kritischen Lebensereignisse.
Die Autoren weisen darauf hin, dass in diesen Ansätzen zum Teil bereits vorhandene Theorien integriert sind, so bietet zum Beispiel die Stressforschung einen Ausgangspunkt für das Konzept der kritischen Lebensereignisse (ebd., S. 91).
Im Folgenden wird auf zwei grundlegende theoretische Ansätze eingegangen, die wichtige Beiträge zur Erforschung der Übergänge im Bildungssystem geliefert haben, nämlich der ökopsychologische Ansatz und das Konzept der kritischen Lebensereignisse. Anschließend wird der Transitionsansatz von Giebel und Niesel (2004) dargestellt, welcher unter anderem auf den beiden eben genannten Ansätzen basiert und darüber hinaus durch neue Erkenntnisse die theoretische Grundlage zur Erforschung der Übergänge im Bildungssystem erweitert.
2.1.1 Der ökopsychologische Ansatz
Dieser Ansatz verweist auf den Zusammenhang zwischen dem Prozess menschlicher Entwicklung und seiner jeweiligen Umwelt. Bronfenbrenner (1981), ein ökologisch orientierter Entwicklungspsychologe, vertritt eine viel differenziertere Betrachtungsweise der Umwelt, wobei vor allem die Interaktionsprozesse „nicht auf einen einzigen Lebensbereich beschränkt sind“, sondern es werden alle „Aspekte der Umwelt außerhalb der unmittelbaren Situation um das Subjekt in Betracht gezogen“ (Bronfenbrenner 1981, S. 37). Aus dieser Perspektive besteht die Umwelt eines heranwachsenden Menschen aus Systemen, die ineinander geschlossen sind, das heißt ein System ist in ein Nachfolgendes eingebettet und wird von diesem umschlossenen.
Das unmittelbarste System, in dem sich das Kind befindet, ist die Familie, welches auch als Mikrosystem bezeichnet wird. Bronfenbrenner definiert das Mikrosystem als ein „Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen“ (ebd., S. 38). Mikrosysteme sind demnach Lebensbereiche eines Kindes, welche ein Netz von Interaktionen und Beziehungen bilden, in dem das Verhalten des einzelnen Mitglieds das Verhalten aller anderen beeinflusst. Kindergarten bzw. Schule sind ebenfalls Mikrosysteme. Alle Lebensbereiche beeinflussen sich gegenseitig, es bestehen Beziehungen zum Beispiel zwischen Familie und Kindergarten bzw. Schule, Familie und Freundeskreis usw. Ein so genanntes Mesosystem umfasst diese Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen, an denen das Kind aktiv beteiligt ist. Ein Mesosystem wird demzufolge dann gebildet, „wenn die sich entwickelnde Person in einen neuen Lebensbereich eintritt“ (ebd., S. 41).
Demgegenüber gibt es Lebensbereiche, „an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht“ (ebd., S. 42). Diese Systemebene, wie zum Beispiel die Arbeitswelt der Eltern, wird als Exosystem bezeichnet. Für den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule bedeutet dies, dass der Schulanfang das Exosystem zum Mesosystem macht, denn das Kind ist jetzt an der Wechselbeziehung zwischen Familie und Schule aktiv beteiligt.
Mikro-, Meso- und Exosystem sind eingebettet in ein Makrosystem, welches als umfassende Systemebene mit seinen gesellschaftlichen Normen und Gesetzen auf die nachgeordneten Systeme einwirkt (ebd., S. 42).
Nach Bronfenbrenner können durch diese Beschreibung der Struktur der Umwelt Bewegungen innerhalb der Systemebenen bzw. Lebensbereiche identifiziert werden (Bronfenbrenner 1981, S. 43). Folglich lassen sich nach diesem ökologischen Ansatz die Anpassung an eine Institution außerhalb der Familie, wie zum Beispiel Kindergarten oder Grundschule, als ökologischer Übergang beschreiben: Eine Person verändert „ihre Position in der ökologisch verstandenen Umwelt durch einen Wechsel ihrer Rolle, ihres Lebensbereiches oder beider“ (ebd.).
Dabei betont Bronfenbrenner, „daß jeder ökologische Übergang Folge wie Anstoß von Entwicklungsprozessen ist“ (ebd.). So ist einerseits der Übergang begründet in biologischen Veränderungen (das Älterwerden) und andererseits ist der Übergang ein Prozess, bei denen sich das Individuum und unmittelbare Umwelt aneinander anpassen müssen, was wiederum die weitere Entwicklung des Individuums vorantreibt.
Das ökopsychologische Modell von Bronfenbrenner, welches den Schuleintritt als ökologischen Übergang definiert, wurde später von Nickel (1996) aufgegriffen, um ein Konzept für Schulfähigkeit ebenfalls aus ökologisch-systemischer Sicht zu erstellen. Er war auch der Meinung, dass man den Blick nicht nur auf das Individuum richten soll, sondern auf das gesamte System, dem es angehört. Besonders dann, wenn es um die Frage geht, ob ein Kind nicht nur vom Alter her schulpflichtig ist, sondern ob es auch schulfähig ist. Somit ist Schulfähigkeit das „Ergebnis der Interaktion zwischen drei Teilsystem: Schule, Schüler und Ökologie“ (Nickel 1996, S. 92). Nickel fordert folglich, dass nicht nur der Schüler auf Grund seiner körperlichen, geistigen und motivationalen bzw. sozialen Voraussetzungen als schulfähig gilt. Sondern es muss auch der Frage nachgegangen werden, inwieweit die Schule mit ihren allgemeinen Anforderungen und speziellen Unterrichtsbedingungen dazu beitragen kann, sich dem Kind anzupassen und es somit fähig für die Schule zu machen. Jedoch sind nicht nur die am Schuleintritt unmittelbaren Beteiligten, Schule und Schüler, zu betrachten, sondern auch die so genannte Ökologie, welche schulische, vorschulische und familiäre Umwelt des einzuschulenden Kindes einschließt (ebd., S. 93). Nickel betont, dass ein gemeinsames Verständnis von einem Schulfähigkeitskonzept und vor allem ein bruchloser Übergang vom Kindergarten in die Grundschule nur dann möglich ist, wenn „diese drei ökologischen Bereiche wechselseitig fördernd interagieren“ (Nickel 1996, S. 92).
Griebel und Niesel (2004) weisen darauf hin, dass der ökopsychologische Ansatz für die Erforschung zu Übergängen im Bildungssystem sehr ergiebig ist, denn er macht unmissverständlich deutlich, dass die Entwicklung des Kindes, auch die Entwicklung der Schulfähigkeit, immer abhängig vom Kontext des Kindes verläuft (Griebel & Niesel 2004, S. 87). Sie führen aber auch an, dass dieses Konzept des ökologischen Übergangs offen lässt, welche Kompetenzen beim Wechseln zwischen den Lebensbereichen erforderlich sind. Darüber hinaus bleibt ungeklärt, wie ein gleitender Übergang zwischen Kindergarten und Schule trotz der bestehenden Diskontinuitäten zwischen den Systemen hergestellt werden soll (ebd.).
2.1.2 Kritische Lebensereignisse
Dieses Konzept definiert kritische Lebensereignisse „als solche im Leben einer Person auftretende Ereignisse (…), die durch Veränderungen und der (sozialen) Lebenssituation der Person gekennzeichnet sind und die mit entsprechenden Anpassungsleistungen durch die Person beantwortet werden müssen“ (Filipp 1995, S. 23).
Der Schuleintritt stellt eine Veränderung der Lebenssituation eines Kindes dar. Die Übernahme einer neuen Rolle und das sich Zurechtfinden in einer neuen Gruppe können als Anpassungsleistungen betrachtet werden. Deswegen kann der Schuleintritt als ein kritisches Lebensereignis bezeichnet werden.
Das Konzept der kritischen Lebensereignisse versucht, die Vielfalt der Ereignisse, die im Verlauf des Lebens auftreten können und die durch Veränderungen der Lebenssituation gekennzeichnet sind, zu systematisieren. Dabei wurden zwei Hauptgruppen von kritischen Lebensereignissen gebildet: normative und nicht normative Lebenskrisen.
Normative Lebenskrisen sind solche, die auf Grund sozialer und biologischer Normierung für alle Mitglieder eines sozialen Systems vorgegeben sind, wie zum Beispiel der Schuleintritt (Filipp 1995, S. 15). Filipp (1995) fordert, dass sowohl institutionalisierte, wie zum Beispiel Kindergarten bzw. Schule, als auch außerinstitutionelle Sozialisationsprozesse, wie zum Beispiel Familie, die Aufgabe haben, „die Person auf den Eintritt solcher Lebensereignisse vorzubereiten“ (ebd.). So sollen Kompetenzen und Verhaltensformen entwickelt, gefördert und gesichert werden, welche eine angemessene Bewältigung der kritischen Lebensereignisse erleichtern sollen.
Nicht normative Lebenskrisen sind Ereignisse, welche nur einige Mitglieder eines sozialen Systems betreffen, wie zum Beispiel Heirat, Umzug und andere.
Diese Übergangsperioden, sowohl normative als auch nicht-normative, sind insofern als Krisen aufzufassen, als dass in diesem Zeitraum „routinemäßige Formen des Verhaltens durch soziale oder biologische Veränderungen unterbrochen werden“ (Olbrich 1995, S. 134).
Jedoch sollen mit dem Begriff "Krise" nicht nur Risiken, sondern auch Chancen verbunden werden, denn die Auseinandersetzung mit einem kritischen Lebensereignis kann entwicklungsgefährdendes, aber auch entwicklungsförderliches Potenzial haben (Filipp 1995, S. 8). Griebel und Niesel (2004) weisen darauf hin, dass eine Lebenssituation insofern als kritisch betrachtet werden kann, „als sie die Bewältigungsressourcen der Person übersteigen und schädigende Wirkungen bedingen können, andererseits aber Impulse für die Entwicklung und Förderung von Kompetenzen darstellen können“ (Griebel & Niesel 2004, S. 191).
Das Konzept der kritischen Lebensereignisse will vordergründig die Wahrnehmung, Bewertung und Bewältigung des Ereignisses durch die Person untersuchen, denn „erst die individuellen Prozesse der Wahrnehmung und Einschätzung von Lebensereignissen qualifizieren diese Ereignisse als für die Person kritisch, belastend, bedeutend, erfreulich, herausfordernd und vieles mehr (Filipp 1995, S. 31). Diese Theorie verfolgt ebenfalls den ökologischen Ansatz. So wird gefordert, die kritischen Lebensereignisse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und sie im sozialen und biologischen Kontext der Person zu betrachten (Filipp 1995, S. 9).
Der aktive Umgang der Person mit diesen Ereignissen, also ein neues Gleichgewicht herzustellen zwischen der einzelnen Person und seiner Umwelt, steht im Mittelpunkt des Konzeptes (ebd.). So ist die Wahrnehmung eines Ereignisses, welches eine Veränderung des bisherigen Verhaltens fordert, der erste Schritt für die Auseinandersetzung und Bewältigung der "Krise" (ebd., S. 36). Filipp (1995) zeigt auf, dass es von verschiedenen Faktoren abhängt, inwiefern sich eine Person mit einem bestimmten Lebensereignis auseinander setzt (ebd., S. 14 ff.):
- von dem Interaktionsgefüge zwischen Ereignis-, Personen- und Kontextmerkmalen.
- von der "Bewältigungsgeschichte", das heißt inwieweit die Person ein solches Ereignis in dieser oder ähnlicher Form schon einmal erlebt hat, so dass sie auf Bewältigungskompetenzen zurückgreifen kann.
- von Merkmalen des sozioökologischen Kontextes, so sind z.B. soziale Stützsysteme Bedingungen für den Eintritt bzw. Nicht-Eintritt bestimmter Ereignisse.
- von den präventiven Maßnahmen, wie zum Beispiel soziale Unterstützung und Aufbau von Bewältigungsstrategien.
Dieser Prozess der Wahrnehmung, Bewertung und Auseinandersetzung der Person mit dem kritischen Lebensereignis zielt darauf ab, ein neues Passungsgefüge zwischen Person und Umwelt herzustellen (ebd., S. 39).
Es wurde deutlich, dass sich das Konzept der kritischen Lebensereignisse auf vielzählige Ereignisse im Lebensverlauf, welche Veränderungen im bisherigen Verhalten der betroffenen Personen fordern, anwenden lässt. Griebel und Niesel (2004) weisen jedoch darauf hin, dass kritische Lebensereignisse nicht eindeutig definiert werden können. Des Weiteren werden zwar Wahrnehmung, Auseinandersetzung und Bewertung des kritischen Lebensereignisses durch die Person näher beleuchtet, jedoch geht dieses Konzept nicht auf die Entwicklung der Identität in kritischen Lebensereignissen ein (Griebel & Niesel 2004, S. 92).
2.1.3 Der Transitionsansatz
Der Begriff Transitions kommt aus dem Englischen und wird mit "Übergang" übersetzt. Der Transitionsansatz möchte sich jedoch von dem Bild des Übergangs von einem definierten Ort zum anderen abheben. Mit dem Begriff Transitionen soll verdeutlicht werden, dass diese „ineinander übergehende und sich überblendende Wandlungsprozesse bezeichnen, wenn Lebenszusammenhänge eine massive Umstrukturierungen erfahren - ein Kind z.B. vom Kindergartenkind zum Schulkind wird“ (Griebel & Niesel 2004, S. 35). Weiterhin versteht der Ansatz „Übergänge als Phasen beschleunigter Veränderung und als besonders lernintensive Zeit“ (ebd., S. 11).
Die Autoren Griebel und Niesel (2004) beschäftigen sich im besonderen Maße mit dem Übergang von der Familie in den Kindergarten bzw. vom Kindergarten in die Schule.
Der Transitionsansatz vereint mehrere Theoriestränge. Es wurden Erkenntnisse aus dem ökopsychologischen Ansatz, aus dem Stressansatz und aus der Theorie der kritischen Lebensereignisse in dieses Übergangskonzept integriert. Ausgangspunkt war das Familien-Transitions-Modell von Cowan (1991, vgl. Griebel & Niesel 2004, S. 93). Mit Hilfe dieses Modells konnten Übergänge in der Familienentwicklug unter der Berücksichtigung der Perspektive aller Familienmitglieder untersucht werden (Griebel & Niesel 2004, S. 93). Griebel und Niesel (2004) haben das Familien-Transitions-Modell auf Grund der Ergebnisse ihrer Studie zum Übergang vom Kindergarten in die Grundschule von 1998 erweitert (ebd., S. 120). So wird hier „die Identität des Einzelnen als erlebter Status, Selbstkonzept und Verordnung des Selbst in der eigenen Lebensgeschichte in Verbindung mit Übergängen“ (ebd., S. 93) gebracht. Die subjektive Sicht des Einzelnen und die Veränderung des Selbstbildes und der Weltsicht sind zentraler Mittelpunkt des Transitionsansatzes. Neben den individuellen Merkmalen werden ebenso familiale Faktoren und kontextuelle Bedingungen für die Bewältigung der Veränderung in Folge eines Übergangs in die Betrachtungsweise mit einbezogen (Griebel & Niesel 2004, S. 11). Deshalb sprechen die Autoren beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule von einem "ko-konstruktiven" Prozess, an dem das Kind, die Eltern, pädagogische Fachkräfte des Kindergartens und der Schule und das soziale Umfeld des Kindes beteiligt sind (ebd., S. 121). Kind und Eltern müssen den Übergang aktiv bewältigen, wohingegen die Erzieherinnen, Lehrerinnen und das soziale Umfeld die Übergangsbewältigung indirekt beeinflussen. Die Übergangsphase als Prozess bezeichnet. Der prozesshafte Charakter des Transitionsansatzes verdeutlicht, dass der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule lange vor dem ersten Schultag beginnt und abgeschlossen ist, wenn das Kind ein Schulkind geworden ist bzw. wenn die Eltern sich zu Eltern eines Schulkindes entwickelt haben. Der Verlauf und die Länge dieses Prozesses findet individuell statt (ebd., S. 122).
Das Transitionskonzept beschreibt, dass der Übergang vom Kindergarten und die Schule Veränderungen auf der individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene bewirken, die vom Kind bewältigt werden müssen.
Die Anforderungen, die sich aus den veränderten Bedingungen während des Übergangsprozesses für Kind und Eltern ergeben, werden an dieser Stelle nicht näher beschrieben, da im folgenden Kapitel ausführlich darauf eingegangen wird.
Griebel und Niesel (2004) betonen, dass sich an Hand des Strukturmodells des Transitionsansatzes bestimmen lässt, ob ein Übergang erfolgreich bewältigt wurde (Griebel & Niesel 2004, S. 130). So ist zum Beispiel ein erlebter Wandel der Identität ein Bestimmungsmerkmal für den erfolgreichen Abschluss des Übergangsprozesses, wenn zum Beispiel ein Kind sich als Schulkind und wenn Eltern sich als Eltern eines Schulkindes wahrnehmen (ebd.).
2.1.4 Zusammenfassung
Jeder der aufgeführten Ansätze hat seinen eigenen Schwerpunkt. Dennoch verstehen sie alle Übergänge als Prozesse, bei denen die betroffene Person versucht, das durch Veränderungen entstehende Ungleichgewicht zwischen ihm und seiner Umwelt auszugleichen, indem er sein bisheriges Verhalten verändert. Damit sind hohe Anforderungen verbunden, durch welche die Entwicklung der Person erheblich gefördert wird. Des Weiteren haben die Ansätze gemeinsam, dass sie eine ökopsychologische Sichtweise vertreten und deshalb das Individuum in Abhängigkeit von seinem sozialen Umfeld betrachten.
Der ökopsychologische Ansatz und die Theorie der kritischen Lebensereignisse sind eher allgemein und weit gefasst und deswegen auch auf vielfältige Arten von Übergängen anwendbar. Das Transitionsmodell hingegen ist für die vorliegende Arbeit insofern genauer, als dass es speziell den Prozess des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule mit all seinen Auswirkungen beschreibt und deutet.
2.2 Anforderungen und notwendige Kompetenzen für Kind und Eltern beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
Es wurde bereits aufgezeigt, dass nach dem Transitionsmodell beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule Veränderungen auf der individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene stattfinden (Griebel & Niesel 2004, S. 122). Daraus ergeben sich bestimmte Anforderungen auf den drei genannten Ebenen, die von Kind und Eltern bewältigt werden müssen. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die notwendigen Kompetenzen zur Bewältigung des Übergangs hier nur kurz benannt werden. In einem nachfolgenden Kapitel werden diese Kompetenzen ausführlich dargestellt, die sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule aufgebaut und gestärkt werden müssen.
2.2.1 Anforderungen auf der individuellen Ebene
Wenn ein Kindergartenkind zu einem Schulkind wird, wechselt es seinen sozialen Status (Griebel& Niesel 2002, S. 15). Daraus ergibt sich, dass die Rolle des Kindes neu definiert werden muss. Da in Deutschland neben der Schulfähigkeit das Alter ein entscheidendes Kriterium für die Einschulung ist, ist genau festgelegt, wann das Kindergartenkind einen neuen Status einnimmt (ebd.). Mit dem neuen Status "Schulkind" sind bestimmte Erwartungen seitens der Umwelt an das Kind verbunden, nämlich ein bestimmtes Maß an Selbstständigkeit und damit einhergehend das Übernehmen von Verantwortung. Es müssen bestimmte Kompetenzen ausgebaut werden oder auch neu erworben werden, wenn sie im Kindergarten noch nicht erlernt wurden. Dazu gehören Kompetenzen wie Selbstverantwortung, Selbstorganisation und Selbstregulation (Bayrisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen & Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2003, S. 60). So ist das Kind in der Schule für mehr Dinge verantwortlich als im Kindergarten: für die Schultasche und die für den Unterricht notwendigen Materialien, wie Hefte, Bücher, Federmäppchen und Turnbeutel usw. Mit den Hausaufgaben kommt ein ganz neuer Bereich dazu, für den das Kind eigenverantwortlich zuständig ist. Zunächst werden die Eltern Hilfestellungen geben, aber es wird lernen müssen, sich selbst Zeit für Aufgaben und Freizeit einzuteilen. Durch die Erwartungshaltung seiner Umwelt und durch den Prozess des Statuswechsels, der bereits im Kindergarten beginnt, fühlt sich das Kind „älter, selbstständiger und größer“ (ebd., S. 17). Somit finden Veränderungen im Selbstgefühl des Kindes statt: Das Kindergartenkind, das zu einem Schulkind wird, beginnt nun sich selbst anders wahrzunehmen. Es erreicht ein anderes Bild seines Selbst (ebd., S. 16). Der Identitätswandel ist kein punktuelles Ereignis, sondern dieser Prozess beginnt, sobald sich das Kind damit auseinander setzt, dass es in die Schule kommen wird und er dauert bei manchen Kindern bis zur zweiten Klasse an (ebd., S. 27).
Auch die Eltern nehmen eine neue Rolle, wenn sie Eltern eines Schulkindes werden. Dieser Prozess des Rollenwandels beginnt ebenfalls schon lange vor dem Schuleintritt ihres Kindes mit den „zu erledigenden Formalitäten, die mit der Anmeldung verbunden sind, mit dem an Einkaufen der "Ausrüstung" für das angehende Schulkind“ (Bayrisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen & Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2003, S. 15). An die Rollen der Eltern eines Schulkindes werden ebenfalls bestimmte Erwartungen gestellt. So verlangt die Schule, dass die Eltern ihr Kind mit den für den Unterricht notwendigen Materialien ausstatten und dafür sorgen, dass es jeden Tag in die Schule geht. Des Weiteren wird von den Eltern erwartet, dass sie sich in einem gewissen Rahmen an der Elternarbeit in der Schule beteiligen. Indem die Eltern die Rolle als Eltern eines Schulkindes einnehmen und versuchen, den Erwartungen von außen gerecht zu werden, ändert sich auch ihr Selbstbild. Sie nehmen sich als Eltern eines Schulkindes wahr. Das kann sich zum Beispiel an ihrer Teilnahme an der Elternarbeit in der Schule äußern.
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule wird von starken Emotionen und Stress begleitet (ebd., S. 35). Diese müssen von Kind und Eltern reguliert werden. Dabei erleben jedes Kind und jedes Elternpaar die Gefühle anders. Bei der Bewertung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule kommt es darauf an, in welcher Weise der Prozess von den Beteiligten bewältigt wurde. So kann Stress durch eine zeitweise Überforderung verursacht werden und deshalb als negativ bewertet werden (Griebel und Niesel 2002, S. 36). Stress kann aber auch eine Herausforderung bedeuten, was „nicht unbedingt als unangenehm empfunden wird“ (ebd.).
Für das Kind kann der Übergang von positiven Gefühlen begleitet sein, wie Freude, Vorfreude, Optimismus und Neugier (ebd., S. 38). Während des Prozesses können aber auch Gefühle von Verlust, Unsicherheit und Angst entstehen. Griebel und Niesel (2002) berichten, dass Unsicherheiten und Ängste „angesichts des vielen Neuen, das auf die Kinder zukommt, in gewissen Umfang normal und im Allgemeinen nicht dramatisch sind“ (ebd., S. 37) und dass Probleme mit negativen Gefühlen, die darüber hinaus gehen, nur selten vorkommen. Natürlich ist es für die Entwicklung der Lern- und Leistungsbereitschaft eines Kindes nur förderlich, wenn das Kind den Übergang in die Schule gemeistert hat. Außerdem ist eine positive Bewältigung eines solchen Prozesses für den Umgang mit eventuell künftigem Misserfolg in der Schule wichtig, denn das Kind kann auf bereits erworbene Kompetenzen beim Überwinden von kritischen Ereignissen zurückgreifen (Griebel und Niesel 2002, S. 38). Als solche Kompetenzen, die notwendig sind, stressreiche Situationen erfolgreich zu bewältigen, sind zu nennen: Selbstregulation, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit (Bayrisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen & Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2003, S. 60).
Auch Eltern erleben den Übergang ihres Kindes vom Kindergarten in die Grundschule eher mit gemischten Gefühlen. Sie fühlen, dass für sie und ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt beginnt, was nicht allzu selten mit dem Satz "Jetzt beginnt der Ernst des Lebens!" eingeläutet wird. Die Eltern merken, dass sich durch den Besuch der Schule ihres Kindes der familiale Zusammenhalt lockert (Griebel & Niesel 2002, S. 19). Ihr Kind erweitert mit dem Schuleintritt seinen Aktionskreis, hat vielleicht mehr Freunde und wird Schritt für Schritt selbstständiger und losgelöster in seinem Denken und Handeln. Des Weiteren geraten die Eltern schnell unter Druck, einerseits weil sie nicht wissen, „ob ihr Kind den Anforderungen der Schule gewachsen sein wird“ (ebd., S. 38) und andererseits, weil sie unsicher sind, „ob sie in der Lage sein werden, ihr Kind optimal zu unterstützen und zu fördern“ (ebd.). Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule wird von den Eltern aber auch mit positiven, angenehmen Gefühlen begleitet: Sie sind stolz auf ihr großes Kind und beobachten mit elterlicher Liebe die Entwicklung ihres Kindes zu einem Schulkind.
In diesem Übergangsprozess erleben sich die Eltern in einer doppelten Funktion: Auf der einen Seite müssen sie ihre eigenen Gefühle regulieren und auf der anderen Seite dürfen sie aber auch nicht vergessen, „sich mit den Gefühlen des Kindes auseinander zu setzen“ und diese ernst zu nehmen (ebd.).
2.2.2 Anforderungen auf der interaktionalen Ebene
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule verlangt von Kind und Eltern, den Rollenzuwachs und die damit einhergehenden Verluste bzw. Veränderungen zu bewältigen.
Das Kind hat im Kindergarten eine spezielle Rolle in seiner Gruppe eingenommen und ist damit vertraut. Besonders im letzten Kindergartenjahr genießt es die Stellung, eines der "größten" und ältesten Kinder zu sein. Das ändert sich, sobald es in die Schule kommt. Eine neue Klasse wird zusammengestellt und jedes Kind muss erst seine Rolle in dieser Gruppe finden. Hinzu kommt, dass es als Schulanfänger zu den "Kleinsten" und Jüngsten in der Schule zählt. Sich in dieser neuen Rolle zurecht zu finden, stellt für das Kind eine hohe Anforderung dar. Soziale Kompetenzen wie Selbstvertrauen, die Bewältigung von Stress wie auch allgemeines Wohlbefinden helfen dem Kind, dieser Anforderung zu begegnen (Griebel & Niesel 2004, S. 131)
Zum Schulalltag gibt es bestimmte Interaktionsformen, welche die Interaktionspartner Kinder, Lehrer und Eltern beherrschen müssen (Griebel & Niesel 2002, S. 27). Die Schulanfänger müssen diese Verhaltensformen verstehen lernen, sich an sie gewöhnen, sie selbst erlernen und sie anwenden, damit sie ein Teil des Systems Schule werden. Kinder, die einen Kindergarten besucht hatten, haben ein gewisses Regelbewusstsein bereits erworben, so dass es ihnen womöglich leichter fällt, sich an die schulspezifischen Verhaltensformen, Regeln und Rituale zu gewöhnen. Somit ist Regelbewusstsein eine weitere wichtige Kompetenz für die Bewältigung des Übergangs.
Auch innerhalb der Familie ändert sich die Rolle des Kindes, wenn es ein Schulkind wird. Da es jetzt ein Schulkind ist, möchte es auch zu Hause „selbstständiger handeln“ (Griebel & Niesel 2002, S. 19). Es möchte Aufgaben übernehmen, die für ein Schulkind angemessen sind und damit vielleicht auch zeigen, dass es jetzt "größer" ist und mehr Verantwortung übernehmen kann. Unter Geschwistern müssen die Rollen ebenfalls neu verteilt werden. Hat der Schulanfänger jüngere Geschwister, die noch im Kindergarten sind, ist er jetzt das "große" Schulkind, welches nun verstärkt die Rolle des Vorbildes einnimmt. Hat es ältere Geschwister, die bereits die Schule besuchen, nimmt der Schulanfänger jetzt einen Status ein, wo er den Anspruch für sich erhebt, ernst genommen zu werden, weil er jetzt auch ein Schulkind ist.
Wie bereits erwähnt ist die Rolle der Eltern eines Schulkindes und damit ihr Status von der Institution Schule her definiert, welche bestimmte Anforderungen die Eltern stellt. So haben sie dafür zu sorgen, dass das am Kind abends rechtzeitig schlafen geht, um für den nächsten Schultag ausgeschlafen zu sein. Auch hier leistet der Kindergarten bestimmte Vorarbeiten, so dass die Eltern „eine Reihe von Erfahrungen“ (Griebel & Niesel 2002, S. 27) mit in die Schule bringen. Doch viele bekannte Umgangsformen aus dem Kindergarten sind in der Schule nicht gegeben. Direkte Kontakte zu anderen Erwachsenen, wie Lehrern und anderen Eltern, sind viel seltener und meist nur formaler Art (ebd.). Dies erschwert es den Eltern, sich in ihrer neuen Rolle zurechtzufinden. Sie fühlen sich unsicher, was von ihnen erwartet wird, was sich nicht zu selten negativ auf das Kind auswirkt (ebd., S. 28). Hinzu kommt, dass die Eltern von ihrer Schulzeit her geprägt sind, und diese Erfahrungen manchmal dazu veranlassen, das System Schule negativ zu bewerten (ebd., S. 17).
Durch die Einschulung in die Grundschule verändern sich bereits bestehende Beziehungen und Beziehungen zu neuen Personen müssen aufgebaut und weiterentwickelt werden.
Das Vorschulkind muss sich von der gewohnten Umgebung des Kindergartens und von den Erziehern trennen (ebd., S. 18). Auch von Freunden muss es sich verabschieden, die weiterhin im Kindergarten bleiben. Es werden somit einige Beziehungen abgebrochen, die sich im Laufe der Kindergartenzeit gefestigt haben. Vor allem der Abschied von Erzieherinnen der eigenen Gruppe bedeutet für das Kind meist einen großen Verlust (ebd.). Die Beziehungen zu den Kindern, die ebenfalls eingeschult werden, ändern sich schon im letzten Kindergartenjahr, denn „hier gibt es viele Gemeinsamkeiten in dem, was sie als Vorschulkinder erleben und in dem, was vor ihnen liegt“ (Griebel & Niesel 2002, S. 18). In der Schule stellt eine erhebliche Anforderung die große unüberschaubare Menge von Kindern aus den anderen Klassen dar, „die ähnlich alt sind, sowie ältere und deutlich ältere Kinder aus den höheren Klassen“ (ebd., S. 21). Wenn das Kind bei der Einschulung weiß, welche Kinder aus dem Kindergarten in die gleiche Schule, vielleicht auch in die gleiche Klasse kommen, eröffnen sich für diese eine andere Art von Freundschaften. Gerade in der neuen Umgebung der Schule orientieren sich die Schulanfänger zuerst an bekannten Merkmalen: Regeln, Rituale und natürlich an Freunde aus dem Kindergarten, die ihnen emotionale Sicherheit geben (ebd.).
Schon in der Kindergartenzeit hat das Kind gelernt, soziale Kontakte zu anderen Kindern zu knüpfen. Es musste lernen, seine eigenen Bedürfnisse und Interessen mit denen andere Kinder zu vereinbaren und mit der Zeit entwickelte sich die Fähigkeit, über sich selbst in Beziehung zu anderen nachzudenken (ebd., S. 63). Diese Kompetenz, andere Perspektiven wahrzunehmen und sich in andere rein zu versetzen wird auch Empathie genannt. Diese Fähigkeit wird dem Kind helfen, neue Freundschaften in der Schule zu schließen.
Griebel und Niesel (2002) konnten in ihrer Untersuchung feststellen, dass die Entwicklung der Beziehung zur ersten Lehrerin bzw. zum ersten Lehrer von großer Bedeutung ist (ebd., S. 19). Das Kind wird bald feststellen, dass sich diese Beziehung zur Lehrerin durch andere Rahmenbedingungen, wie Zahlenverhältnis Lehrer Kind, Fülle an Unterrichtsstoff, begrenzte Zeit des Kontaktes nur am Vormittag, erheblich von der Beziehung zu seiner Erzieherin in der Kindergartengruppe unterscheidet. Zur Bewältigung dieser Veränderung spielt „die soziale Kompetenz und die Fähigkeit zur Anpassung und Nutzung von personalen Ressourcen durch die Kinder selbst“ (ebd., S. 20) eine entscheidende Rolle.
Die Eltern, die zu Eltern eines Schulkindes werden, müssen ebenfalls vertraute Beziehungen abbrechen bzw. entscheiden, welche sie aufrecht erhalten. In dem neuen Lebensbereich Schule müssen sie neue Kontakte knüpfen, sowohl zu Lehrern als auch zu Eltern anderer Schulkinder (Griebel & Niesel 2002, S. 22). Die Eltern müssen sich ebenfalls daran gewöhnen, dass sich die Beziehung zur Lehrerin durch die seltenen Kontakte und durch die formalisierte Kommunikation kaum mit der Beziehung zur Erzieherin im Kindergarten vergleichen lässt. Griebel und Niesel (2002) weisen darauf hin, dass „beim Übergang zu Eltern eines Schulkindes die Beziehungsebene mit vergleichbaren komplexen Anforderungen verknüpft ist wie für die Kinder“ (ebd., S. 23).
Inwieweit die Beziehungen innerhalb einer Familie beeinträchtigt werden, wenn ein Kind vom Kindergarten in die Grundschule übergeht, wurde schon mehrmals angesprochen. Die Beziehungen zwischen Eltern und Kind wendet sich dahingehend, dass das Kind verstärkt nach Selbstständigkeit strebt und auch innerhalb der Familie mehr Verantwortung übernehmen möchte. Das Kind liegt viel Wert darauf, dass die Eltern es als "großes" Schulkind wahrnehmen und ihm auf einer neuen Beziehungsebene begegnen. Unter Geschwistern „können Wünsche nach mehr Dominanz oder nach mehr Unterstützung auftreten“ (ebd., S. 19), wenn ein Geschwisterkind in die Schule kommt. Hier müssen ebenso die Beziehungen untereinander neu ausbalanciert werden.
2.2.3 Anforderungen auf der kontextuellen Ebene
Kommt ein Kindergartenkind in die Schule, müssen zwei Lebensbereiche, nämlich der Lebensbereich Familie und der Lebensbereich Schule, miteinander koordiniert werden.
Jeden Tag, wenn das Kind in die Schule geht, verlässt es einen Lebensbereich und kommt in einen anderen hinein. Es pendelt zwischen zwei Lebenswelten (Griebel & Niesel 2002, S. 30). Bereits mit dem Besuch des Kindergartens hat das Kind Erfahrungen gemacht, zwischen zwei Lebenswelten hin und her zu pendeln. Jedoch wird es beim Schuleintritt feststellen, dass dieses Pendeln an bestimmte Zeiten und Tage festgelegt ist. In der Kindergartenzeit hingegen stand es dem Kind und den Eltern frei, zu entscheiden, ob das Kind zu Hause bleibt oder nicht.
Eltern einen Schulkindes haben die Aufgabe, die Lebenswelten Schule und Familie zeitlich aufeinander abzustimmen. So muss zum Beispiel die Erwerbstätigkeit der Eltern mit dem Stundenrahmen der Schule abgestimmt werden (Griebel & Niesel 2002, S. 33). Aber auch die Ferienplanung, die Mahlzeiten, der Schlafrhythmus und noch einiges mehr muss jetzt nach der Schule ausgerichtet werden, was vor allem die Flexibilität und das Organisationstalent der Eltern fordert.
Wie schon angesprochen hat jede Lebenswelt ihre eigenen Verhaltensregeln und Interaktionsmuster, an die sich die Mitglieder zu halten haben (ebd., S. 32). Meist entsteht ein Spannungsfeld durch die Unterschiede zwischen Familie und Schule, zum Beispiel wenn der „elterliche Erziehungsstil mit dem pädagogischen Stil in der jeweiligen Schulklasse“ (ebd., S. 20) nicht übereinstimmt. Hinzu kommt, dass die Eltern nicht wissen, welche Themen in der Schule behandelt werden und wie sich das mit ihren Vorstellungen und Werten vereinbaren lässt (ebd., S. 32). Gerade bei brisanten Themen wie Politik, Religion oder Sexualität könnte es somit zu Spannungen zwischen Kind und Eltern geben (ebd.). Vor allem in Migrantenfamilien, die dem moslemischem Glauben angehören, kommt es zu großen Differenzen zwischen dem Schulalltag und dem Leben der Familie, so dass das Kind zwischen zwei Kulturen pendeln muss (ebd.). Griebel und Niesel (2002) haben untersucht, ob und inwieweit die Eltern die Schulkultur in die Familienkultur hinein wirken lassen und welche Strategien sie dafür entwickeln (ebd.).
Es gibt einige Bewältigungsstrategien von Kind und Eltern beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. Jedoch sollten an dieser Stelle hauptsächlich die Anforderungen für Kind und Eltern bei diesem Übergang dargestellt werden, da diese mit der Fragestellung der Notwendigkeit einer Kooperation zwischen den drei Lebenswelten Kindergarten, Eltern und Schule eng verbunden sind. Eine Aufführung der Bewältigungsstrategien würde hier zu weit führen.
2.2.4 Zusammenfassung
Unter der Berücksichtigung der verschiedenen Ebenen wurde die Vielschichtigkeit der Anforderungen für Kind und Eltern beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule deutlich.
Oft wurde darauf hingewiesen, dass ein Kindergartenbesuch bestimmte Kompetenzen fördert, die zum Bewältigen von neuen Anforderungen notwendig sind. Die Notwendigkeit eines Kindergartenbesuchs für Kind und Eltern wird ersichtlich: Sie können auf bereits erworbene Kompetenzen zurückgreifen, wenn sie beim Schuleintritt mit vielen neuen Begebenheiten konfrontiert werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Erfüllen der Anforderungen auf der individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene ineinander greift und nicht so klar voneinander abzugrenzen ist, wie es hier dargestellt wurde. Zum Beispiel übernimmt ein Kind die Rolle des Schulkindes (individuelle Ebene), was mit dem Aneignen der Verhaltensweisen und der Interaktionsmuster der Lebenswelt Schule einhergeht (kontextuelle Ebene).
2.3 Schulfähigkeit und Schuleingangsdiagnostik
Mit dem Eintritt in die Grundschule und stellt sich immer die Frage nach der Schulfähigkeit des Kindes und inwieweit diese diagnostiziert werden kann.
Mit dem Hamburger Abkommen von 1964 wurde gesetzlich fixiert, dass der Schuleintritt nach dem Alter bestimmt wird (Ipfling 1995, S. 15). Jedoch stellt sich dabei die Frage, wie festgestellt werden kann, ob ein Kind nicht nur vom Alter her schulpflichtig ist, sondern ob es auch schulfähig ist. In den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde davon ausgegangen, dass ein Kind so weit ist, in die Schule zu gehen, wenn es einem bestimmten Entwicklungsstand und nicht ein bestimmtes Alter erreicht hat (Kammermeyer 2001, S. 253). Da sich diese Annahme auf die Reifungstheorie stützte, wurde von "Schulreife" gesprochen. Demnach wurde mit Hilfe von Schuleingangstests hauptsächlich die kognitive Entwicklung des Kindes getestet, wie zum Beispiel die visuelle Gliederungsfähigkeit. Die Testung verfolgte das Ziel, die schulreifen von den nicht schulreifen Kindern zu selektieren (ebd., S. 257). Heute wird überwiegend die Ansicht vertreten, dass das gesamte System, in dem sich ein Kind befindet, Rückschlüsse auf dessen Bereitschaft für die Schule gibt (Nickel 1996, S. 92). Aus diesem Grund wurde mit dem Begriff "Schulfähigkeit" der von der Reifungstheorie abgeleitete Begriff "Schulreife" ersetzt. Die derzeitige Schuleingangsdiagnostik bemüht sich darum, nicht nur kognitive, emotionale, soziale und motivationale Voraussetzungen beim Kind festzustellen. Durch Beobachtung des Kindes im Kindergartenalltag bzw. in einer arrangierten Schulstunde, durch Gespräche mit Erzieherinnen und Eltern wird versucht alle Faktoren zu berücksichtigen, welche die Entwicklung und damit die Schulfähigkeit eines Kindes beeinflussen (Kammermeyer 2001, S. 257 ff.). Darüber hinaus sollen die Schuleingangstests nicht „zur Selektion von nicht schulreifen Kindern dienen, sondern dazu geeignet sein, gezielte Fördermaßnahmen für vorhandene Defizite ableiten zu können“ (Knörzer & Grass 1992, Seite 90). Hinzu kommt, dass heute nicht nur nach der Schulfähigkeit des Kindes gefragt wird, sondern es ist zugleich von Interesse, inwieweit die Schule kindfähig ist. Somit sind „ebenso die Anforderungen und die Lernbedingungen der Schule zu überprüfen“ (Knauf 2001, S. 24).
Obwohl mit Hilfe von Schuleingangsdiagnostik (wie zum Beispiel das Kieler Einschulungsverfahren) festgestellt werden kann, ob schulpflichtige Kinder auch bereit sind für den Schuleintritt, bedeutet das nicht, dass jedes Kind auf dem gleichen erforderlichen Entwicklungsstand steht. Die Heterogenität der Schulanfänger muss im Anfangsunterricht berücksichtigt werden.
3 Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule aus der Perspektive der beteiligten Institutionen
Beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule kommen Kind und Eltern aus einer bekannten Lebenswelt in eine neue, unbekannte Lebenswelt hinein. Beide Lebenswelten werden jeweils durch eine Institution geprägt, welche sich in rechtlicher, inhaltlicher und organisatorischer Hinsicht unterscheiden.
In diesem Kapitel werden zunächst die historische Entwicklung, die rechtlichen, organisatorischen und inhaltlichen Merkmale und die Aufgaben im Hinblick auf den Übergang von Kindergarten und Grundschule getrennt voneinander dargestellt. In einem nachfolgenden Vergleich der beiden Institutionen werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede ausgearbeitet, um anschließend die Auswirkung auf den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu erörtern. Die Frage nach einer inhaltlichen und organisatorischen Anschlussfähigkeit der beiden Einrichtungen wird folgen. Darüber hinaus wird erläutert, inwieweit eine Kooperation zwischen den Lebenswelten Kindergarten, Schule und Familie der Anschlussfähigkeit zwischen den Institutionen beitragen kann. Es werden Formen und Probleme einer Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen, Lehrerinnen und Eltern aufgezeigt.
3.1 Der Kindergarten
3.1.1 Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Kindergartens
Der Gedanke, Kinder im Vorschulalter pädagogisch zu betreuen und zu fördern gibt es schon seit vielen Jahrhunderten. Jedoch begann sich erst Anfang des 19. Jahrhunderts die Vorschulerziehung außerhalb der Familie zu entwickeln. Somit entstand in der Zeit der Industrialisierung durch Fabrik- und Frauenarbeit die Notwendigkeit, Vorschulkinder tagsüber außerhalb der Familie zu betreuen und zu erziehen. (Ostermann 1995, S. 243). Aus dieser sozialen Notlage heraus gründeten christliche Vereine zu Beginn des 19. Jahrhunderts Kinderbewahranstalten für Kinder aus Proletarierfamilien (ebd. S. 244.). Gleichzeitig entstanden Bildungseinrichtungen für Kinder wohlhabender Eltern, die so genannten Kleinkinderschulen. Während die Kinderbewahranstalten von Kindern ab dem erst Lebensjahr besucht werden konnten und dort zu „Pünktlichkeit, Ordnung, Disziplin und Gehorsam“ (ebd.) erzogen worden, waren die Kleinkinderschulen als Übergang von der Familie in die Lernschule für Kinder ab dem dritten Lebensjahr gedacht.
Der Kindergarten in dem Sinn, was wir heute darunter verstehen, wurde erstmals von Friedrich Fröbel 1840 gegründet: Er prägte den Begriff Kindergarten, richtete Kindergärten ein und bildete Kindergärtnerinnen aus. Nach Fröbel sollte der Kindergarten die unterste Stufe eines einheitlichen Bildungssystems sein. Aber es konnte nicht erreicht werden, dass der Kindergarten eine öffentliche Bildungseinrichtung wird und somit in das Bildungssystem eingebunden werden kann. Auch konnte nicht durchgesetzt werden, dass die Ausbildung der Kindergärtnerinnen vereinheitlicht wird und der Ausbildung der Lehrer angeglichen wird (ebd., S. 246).
Nach dem Ersten Weltkrieg verabschiedete 1920 die Reichsschulkonferenz Leitsätze für den Kindergarten und veranlasste 1924 das In-Kraft-Treten des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes (RJWG): Der Kindergarten war von diesem Zeitpunkt an ein Teil der Jugendhilfe und der Aufsicht der neu geschaffenen Jugendämter unterstellt (Becker-Textor & Textor 1993, S. 52). Jedoch blieben die Kindergärten weiterhin fast ausschließlich Aufgabe der privaten Wohlfahrtsverbände, vor allem der Kirchen (Ostermann 1995, S. 246). Nach dem Subsidiaritätsprinzip, das bis heute noch gilt, haben die freien Träger gegenüber den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Vorrang (Becker-Textor & Textor 1993, S. 70).
Durch diese gesetzlichen Regelungen wurde von dem Zeitpunkt an der Versuch, den Kindergarten als erste Bildungsstufe in das Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland einzugliedern, zunichte gemacht. Der Charakter des Kindergartens als Antwort auf soziale Bedürfnisse der Familien trat wieder in den Vordergrund.
In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Kindergärten freier Träger unter die Aufsicht der nationalsozialistischen Wohlfahrt (NSV) gestellt (Becker-Textor & Textor 1993, S. 52). Die Kindergärten galten als erste nationalsozialistische Erziehungsstufe.
Bis Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts hatten Kindergärten nach wie vor den Charakter von Verwahrungsanstalten.
In den folgenden Jahren haben jedoch technische Fortschritte (z. B. "Sputnik" 1957) und gesellschaftliche Umbrüche (z. B. Studentenbewegung von 1968) Auswirkungen auf den Kindergarten in Deutschland (ebd.):
- Es wurde vermehrt über die Bedeutsamkeit einer gezielten vorschulischen Förderung nachgedacht.
- Vielzählige Vorschulprogramme wurden entwickelt.
- Eine zunehmende Pädagogisierung des Kindergartens zeichnete sich ab.
- Der autoritäre Führungsstil wurde kritisiert und antiautoritäre Erziehung wurde ganz groß geschrieben.
„Die Kritik an den Leistungen des Kindergartens und am Fehlen einer Vorschulerziehung“ (Ostermann 1995, S. 249) führte dazu, dass der Strukturplan für das deutsche Bildungswesen von 1970 einen eigenständigen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag des Kindergartens festgeschrieben hat und ab 1973 verschiedene Modellversuche gestartet wurden (Vorklassen, Eingangsstufe). Unter anderem sollte die Frage der vorschulischen Erziehung der 5- bis 6-Jährigen geklärt werden (Becker-Textor & Textor 1993, S. 53). Darüber hinaus wurden in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts die ersten Kindergartengesetze erlassen, „um eine Annäherung oder Gleichstellung der Bedingungen für Kindergärten näherzukommen“ (Becker-Textor & Textor 1993, S. 53).
1991 trat das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in Kraft, welches für Deutschland einen einheitlichen gesetzlichen Rahmen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern und in Tageseinrichtungen schaffte (ebd.).
Seit 1996 hat jedes 3-Jährige Kind laut §24 des SGB VIII einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz (Faust-Siehl 2001, S. 54).
3.1.2 Rechtlicher Rahmen
Kindertagesbetreuung ist Aufgabe der Kommunen, also der kreisfreien Städte und Landkreise, die zu diesem Zweck Jugendämter einrichten (Peucker 2005, S. 3). Das Kinder- und Jugendhilfegesetz bildet den gesetzlichen Rahmen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die einzelnen Landesministerien der Bundesländer haben die Aufgabe der Rahmengestaltung für Kinderbetreuung und können dazu mit ihren eigenen Landesgesetzen (Kindergartengesetze) das KJHG ausfüllen und ergänzen (ebd.). Die ministeriellen Zuständigkeiten für Kinder- und Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen sind in den Bundesländern unterschiedlich geregelt.
So ist zum Beispiel in Baden-Württemberg das Sozialministerium für Kinder- und Jugendhilfe und für die Aufsicht der Kindergärten zuständig (Hovestadt 2003, S. 9). Das Kultusministerium hat nach dem Kindergartengesetz des Landes Baden Württemberg (2004) die Aufgabe, die Zielsetzungen für Kindertageseinrichtungen mit Beteiligungen der Trägerverbände zu formulieren (ebd., S. 8).
In Bayern hingegen ist das Staatsministerium für Arbeit, Sozialordnung, Familie und Frauen sowohl für die Kinder- und Jugendhilfe als auch für die Kindertageseinrichtungen zuständig (ebd., S. 12). Nach dem Kindergartengesetz des Landes Bayern (1982) ist das zuständige Staatsministerium dafür verantwortlich, Rahmenpläne für die Festlegung von „Mindestanforderungen für die Erziehungs- und Bildungsziele, die personelle Ausstattung, den organisatorischen Aufbau und die Gesundheitsfürsorge für der Kindergärten“ (Hovestadt 2003, S. 11) zu erstellen. Das Ministerium hat sich mit den Trägern und dem pädagogischen Fachkräften über den Inhalt des Planes zu vereinbaren (ebd.).
In Rheinland-Pfalz ist das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig (ebd., S. 37). Die Aufsicht und Organisation der Kindertagesstätten obliegt in diesem Bundesland dem Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend (ebd.).
Die Trägervielfalt für Kindertageseinrichtungen haben alle Bundesländer gemeinsam. So gibt es öffentliche Träger (Kommunen), freie Träger (Wohlfahrtsverbände) und private Träger (Elterninitiativen, Privatpersonen). Durch das im KJHG verankerte Subsidiaritätsprinzip wird den freien Trägern ein Vorrecht vor den öffentlichen Trägern eingeräumt. Damit wird der Gedanke verfolgt, „dass unterschiedliche Wertorientierung, Inhalte und Methoden in der Praxis vertreten sind“ (Peucker 2005, S. 4).
3.1.3 Organisatorischer Rahmen
Formale Organisation
Kindertageseinrichtungen können freiwillig von 3- bis 6-Jährigen Kindern entweder ganztags oder halbtags besucht werden. Für den Kindergartenbesuch ihres Kindes haben die Eltern einen monatlichen Beitrag zu bezahlen. Die Kinder werden in altersgemischten Gruppen mit jüngeren und älteren Kindern von ausgebildeten Fachkräften betreut. Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen können sein: Erzieher, Sozialpädagogen, Kinderpfleger, Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen, Physiotherapeuten, Logopäden (Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg 2003, §7 Abs. 1). In Deutschland durchlaufen Erzieherinnen in der Regel eine dreijährige Ausbildung, wobei die mittlere Reife als Schulabschluss Voraussetzung ist.
Im Baden-Württemberg gliedert sich die dreijährige Ausbildungszeit in eine theoretische Ausbildung in der Fachschule für Sozialpädagogik von zwei Jahren und ein einjähriges Berufspraktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung (Kultusministerium Baden-Württemberg 2001, §2 Abs. 2).
Die Ausbildung der Erzieherinnen findet in Bayern an Fachakademien für Sozialpädagogik statt (Bayrisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 2000). Nach einem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung dürfen sich die Absolventinnen "staatlich anerkannte Erzieherinnen" nennen (ebd., §2, Abs. 2). Die dreijährige Ausbildung teilt sich wie in Baden-Württemberg in eine theoretische Bildung von zwei Jahren und ein Berufspraktikum von einem Jahr (ebd., §3).
In Rheinland-Pfalz unterscheidet sich die Ausbildung der Erzieherinnen für Kindertageseinrichtungen nicht wesentlich von denen in Baden-Württemberg und in Bayern (Sozialwesen Rheinland-Pfalz 2002,
§3 Abs. 2).
Im gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen wird darauf hingewiesen, dass die Fachkräfte mit den Eltern partnerschaftlich zusammenarbeiten sollen (Jugendministerkonferenz & Kultusministerkonferenz 2004, S. 6). Konkret bedeutet dies, dass „regelmäßige Gespräche mit den Eltern über das Kind sowie Informations- und Bildungsangebote für Eltern in der Tageseinrichtung“ (ebd.) stattfinden sollen. Darüber hinaus sind die Eltern an Entscheidungen der Angelegenheiten der Tageseinrichtung betreffend zu beteiligen.
Pädagogische Konzepte
Der Bildungsauftrag des Kindergartens ist zwar gesetzlich verankert (KJHG), wird aber erst durch die Landesgesetze der einzelnen Bundesländer konkretisiert (Ellermann 2001, S. 16). Somit hat jeder Kindergarten in Deutschland seinen eigenen Charakter. Das Profil einer Kindertageseinrichtung wird bestimmt durch die pädagogischen Ziele, die Grundsätze und Prinzipien der Arbeit, der Gruppenzusammensetzung und noch vieles mehr. Diese Merkmale beschreiben das pädagogische Konzept der jeweiligen Einrichtung (Ellermann 2001, S. 63).
Pädagogische Konzepte gehen auf bestimmte Pädagogen zurück. Diese haben versucht, mit ihren Methoden auf die jeweilige Situation der Kinder und ihrer Familien in bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen zu reagieren (Becker-Textor & Textor 1993, S. 58). So zeichnet sich zum Beispiel der Fröbel-Kindergarten durch die Spielgaben Fröbels aus, welches die Kinder noch heute zum freien Gestalten dem Spiel anregen (ebd., S. 60). Das pädagogische Konzept von Maria Montessori bestimmt ebenfalls bis in die Gegenwart noch viele Kindergärten. Besonderheiten sind das montessorische Material und das Prinzip der Selbstständigkeit (ebd., S. 61). Ein weiteres pädagogisches Konzept, welches in Deutschland noch heute weit verbreitet ist, ist das von Rudolf Steiner. Es ist geprägt von Steiners Menschenbild und der Lehre von verschiedenen Entwicklungsperioden (ebd., S. 63).
3.1.4 Inhaltlicher Rahmen
Bildungsauftrag
Mit dem In – Kraft – Treten des KJHG von 1995 haben Kindertageseinrichtungen, zu denen der Kindergarten zählt, einen gesetzlich verankerten Auftrag: Sie sollen durch Erziehung, Bildung und Betreuung „die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2000, S. 36, §22, Abs. 2). Dabei haben sie sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien zu richten.
Im gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen werden „die Vermittlung grundlegender Kompetenzen und die Entwicklung und Stärkung persönlicher Ressourcen“ (Jugendministerkonferenz & Kultusministerkonferenz 2004, S. 3) als Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen beschrieben. Jedoch soll diese Empfehlung erst durch die Richtlinien der Länder konkretisiert werden. Im gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen wird darauf hingewiesen, dass in den Richtlinien der Länder die Aufgaben der Tageseinrichtungen festgesetzt werden sollen, jedoch aber nicht Qualifikationsniveaus, welche die Kinder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht haben sollen (Jugendministerkonferenz & Kultusministerkonferenz 2004, S. 3).
Bildungsbereiche
Der gemeinsame Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen nennt folgende Bildungsbereiche, die bei Kindern gefördert werden sollen (Jugendministerkonferenz & Kultusministerkonferenz 2004, S. 4 f.):
- Sprache, Schrift, Kommunikation
- Mathematik, Naturwissenschaft, (Informations-) Technik
- Natur und kulturelle Umwelten
- Musische Bildung/Umgang mit Medien
- Personal und soziale Entwicklung, Werterziehung/religiöse Bildung
- Körper, Bewegung, Gesundheit.
Tagesablauf und feste Elemente der Kindergartenarbeit
Hacker weist darauf hin, dass die Kindergartenarbeit in den einzelnen Einrichtungen ganz unterschiedlich aussehen kann (Hacker 1992, S. 51). Hacker versucht, den typischen Ablauf eines Kindergartentages und dessen feste Elemente folgendermaßen zu beschreiben (ebd.):
- Gleitender Tageseinstieg: zwischen 8 und 9 Uhr werden die Kinder von ihren Eltern in den Kindergarten gebracht.
- Freispielphase: nachdem das Kind in seiner Gruppe angekommen ist, kann es sich entweder eine Spielecke zuwenden, sich mit einem Material beschäftigen oder sich einer Spielsituation anderer Kinder anschließen;
die freie Spielphase dauert bis etwa 10 oder 11 Uhr, wobei die Kinder zwischendurch am Esstisch ihr Frühstück einnehmen können.
- Angebote: der Freispielphase folgt eine Handlungs- bzw. Betätigungssituation aller Kinder, die von den Angeboten der Erzieherinnen gestaltet wird (z.B. Basteln, Vorlesen eine Geschichte)
- Übung: eine Übung ist dem eben genannten Angebot ähnlich, es ist jedoch komplexer und steht unter einem thematischen Leitmotiv (z. B. Nachspielen eines Märchens in einem Turnraum)
Didaktische Ansätze
Wie schon erwähnt wurde 1970 der Kindergarten in den Elementarbereich des Bildungswesens einbezogen. Im Folgenden wurde sich um ein Curriculum für Kindertageseinrichtungen bemüht, in dem Lernziele und einzelne Lernschritte benannt wurden, welche die Kindergartenarbeit bestimmen sollten (Ellermann 2004, S. 37). Verschiedene didaktische Ansätze wurden daraufhin entwickelt, welche bis heute noch die Kindergartenarbeit beeinflussen (ebd., S. 40 ff.):
- Der funktionsorientierte Ansatz: Training bestimmter Fähigkeiten und Fertigkeiten.
- Der lernbereichsorientierte Ansatz: Themen und Sachverhalte werden in Lernbereiche eingeteilt.
- Der situationsorientierte Ansatz: Ausgangspunkt der didaktischen und methodischen Kindergartenarbeit sind Situationen der Kinder und deren Familien.
3.1.5 Förderung bestimmter Kompetenzen im Hinblick auf die Übergangsbewältigung
Beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ergeben sich für das Kind Anforderungen auf der individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene. Die Vielschichtigkeit der Anforderungen macht deutlich, das im Kindergarten nicht nur schulnahe Vorläuferkompetenzen aufgebaut und gefördert werden sollen, sondern auch Basiskompetenzen, die für die Bewältigung von Übergängen notwendig sind (Niesel 2004, S. 95).
Die Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten für schulspezifische Anforderungen bezieht sich inhaltlich auf die Bildungsbereiche des Kindergartens (vgl. 3.1.4). Demnach sollen bereits in der Kindergartenzeit unter anderem sprachliche Bildung und Schriftsprachverständnis (literacy), naturwissenschaftliche und mathematische Grundbildung (numeracy) aufgebaut und gefördert werden (Griebel 2004, S. 6). Darüber hinaus sollen Kinder frühzeitig anfangen zu lernen, wie man lernt (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen & Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2003, S. 62). Bereits im Kindergarten soll die Förderung der lernmethodischen Kompetenz beginnen. Nicht nur, weil sie Ausgangspunkt für späteres schulisches Lernen ist, sondern diese Fähigkeit ist auch die Grundlage für ein lebenslanges und selbst gesteuertes Lernen (ebd.).
Als Basiskompetenzen, die für die Bewältigung von Übergängen erforderlich sind, können genannt werden (Griebel 2004, S. 7; Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2003, S. 60/139; Peucker 2005):
- Selbstverantwortung
- Selbstregulation
- Kommunikative Kompetenz
- Empathie
- Regelbewusstsein
- Selbstvertrauen und Selbstsicherheit
- Stressbewältigung
- Problemlösefähigkeiten
- Intrinsische Motivation
Wenn ein Kind in den Kindergarten kommt, findet für ihn ein erster Übergang in eine neue Lebenswelt statt. Wie dieser Übergang bewältigt wird, hängt im großen Maße von der Arbeit im Kindergarten ab. So sollten die oben genannten Kompetenzen schon von Anfang der Kindergartenzeit an aktiviert und gestärkt werden.
Das Kind kann im Kindergarten bei vielen Gelegenheiten lernen, „dass jeder für sich und sein Leben selbst Verantwortung trägt“ (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2003, S. 60). Von Anfang der Kindergartenzeit an wird das Kind nach und nach in die Selbstverantwortlichkeit geführt. Es ist zum Beispiel verantwortlich für seine Kleidung, für seine Turnsachen, für das Decken und Abräumen des Frühstückstisches und noch vieles mehr. Beim Eintritt in die Schule wächst das Maß an Verantwortung, so dass das Kind auf diese Kompetenz der Selbstverantwortung zurückgreifen kann.
Selbstregulation beschreibt die Fähigkeit, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, sie auszudrücken und regulieren zu können (ebd.). Im sozialen Zusammenleben im Kindergarten hat jedes Kind seine eigenen Interessen und Bedürfnisse. Das Kind muss lernen, mit anderen über seine Gefühle und Wünsche zu sprechen. Die Förderung der kommunikativen Kompetenz ist unbedingt notwendig, damit das Kind in der Lage ist, seine Empfindungen verbal auszudrücken. Indem es mit anderen über seine Gefühle und Wünsche spricht, erfährt es gleichzeitig die der anderen Kinder. Mit der Zeit baut es die Fähigkeit auf, über sich selbst in Beziehung zu anderen nachzudenken (Griebel & Niesel 2002, S. 63). Das Kind entwickelt ein Gefühl dafür, andere Perspektiven wahrzunehmen und sich in Andere rein zu versetzen. Diese Kompetenz wird Empathie genannt. Für den Übergang in die Schule bedeutet dies, dass ein Kind leichter Anschluss an eine unbekannte Gruppe findet, wenn es gelernt, hat seine eigenen Wünsche mitzuteilen, gleichzeitig aber auch die Perspektive anderer Kinder wahrnehmen kann, infolgedessen sein eigenes Verhalten und Handeln reflektiert und auf die gegebene Situation anpasst. Darüber hinaus wird das Kind sich in einer neuen Lebenswelt besser zurechtfinden, wenn es schon im Kindergarten gelernt hat, Regeln für soziales Zusammenleben zu erkennen, zu beachten und einzuhalten (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen & Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2003, S. 60). Die Kompetenz Regelbewusstsein hilft dem Kind, sich in der Schule mit ihren spezifischen Verhaltens- und Interaktionsformen zurechtzufinden. Regeln und Rituale wiederum bieten dem Kind Sicherheit und Orientierung in einer neuen Lebenswelt.
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit können sich auf Grund verschiedenartiger Situationen im Kindergarten entwickeln. Das Kind erfährt zum Beispiel durch die Zunahme an Selbstständigkeit seine Fähigkeiten und seine eigene Belastbarkeit (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen & Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2003, S. 60). Des Weiteren können die Fachkräfte im Kindergarten durch Aufmerksamkeit, Rückmeldung und positive Verstärkung dazu beitragen, dass sich ein gesundes Maß an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit entwickeln kann (ebd., S. 61). Ein gesundes Maß an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit ist beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule notwendig. In dieser Weise kann das Kind seine eigene Belastbarkeit einschätzen und hat Vertrauen in sich selbst, schwierige Lebenssituationen zu bewältigen. Darüber hinaus sollten im Kindergarten Anregungen und Hilfestellungen gegeben werden, die den Kindern die Möglichkeit bietet, sich selbst wahrzunehmen, Strategien zur Bewältigung von Stress zu entwickeln und Wege zu finden, Probleme zu lösen (ebd., S. 60). Wenn zum Beispiel das Kind erfährt, dass es sich bei Problemen an andere wenden kann, lernt es, sich in solchen Situationen aktiv um soziale Unterstützung zu bemühen (ebd., S. 141). Das Lernen von Problemlösetrategien spielt beim Aufbau der Kompetenzen Stressbewältigung und Problemlösungsfähigkeiten ebenfalls eine große Rolle. Mit dem Eintritt in die Grundschule eröffnen sich dem Kind vielfältige Situationen, die zu Stress und Problemen führen können. Es ist daher notwendig, dass das Kind bereits im Kindergarten Strategien erworben hat, solche Belastungen zu überwinden. Für das Problemlösungsverhalten des Kindes ist eine weitere Kompetenz notwendig, nämlich die intrinsische Motivation. Im Schulalltag werden Aufgaben und Anforderungen auf das Kind zukommen, wo es noch nicht einschätzen kann, ob es sie bewältigen kann. Mit der Voraussetzung jedoch, dass sich in der Kindergartenzeit eine gute intrinsische Motivation entwickelt hat, ist das Kind in der Lage, Probleme altersgemäß zu lösen (Griebel und Niesel 2002, S. 65). Zum Beispiel wird durch die freie Wahl des Spiels im Kindergarten die intrinsische Motivation gefördert, denn die Kinder sind von sich aus der Sache wegen an einer Tätigkeit interessiert. Die Bereitschaft, von sich aus etwas zu lernen und zu leisten, ist eine wichtige Voraussetzung für die notwendige Lern- und Leistungsmotivation in der Schule.
Der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung (2003) bewertet die Bewältigung von Übergängen an sich als eine Basiskompetenz und nennt sie "Transitionskompetenz" (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen & Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2003, S. 59). Demnach muss sich das Kind in seinem Leben immer wieder auf neue Situationen einlassen, sich mit diesen auseinandersetzen, sich anpassen und verändern (ebd., S. 59). Wenn ein Kind einen Übergang erfolgreich bewältigt hat, hat es sich Kompetenzen angeeignet, um weitere Übergänge in seinem Leben (Schuleintritt, Eintritt in eine weiterführende Schule, Eintritt in das Berufsleben, Partnerschaft, Elternschaft usw.) erfolgreich zu bewältigen und sie als Herausforderung und nicht als Belastung zu sehen (ebd.).
3.2 Die Grundschule
3.2.1 Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Grundschule
Die Grundschule erhielt ihren Namen und ihre rechtliche Grundlage 1919: In der Weimarer Reichsverfassung wird die Grundschule erstmals namentlich als gemeinsame Schule für alle Kinder des Volkes benannt, auf die sich das mittlere und höhere Schulwesen aufbaut (Sandfuchs 1995, S. 3). Die Reichsschulkonferenz legte 1920 fest, dass die Grundschule vier Jahrgänge umfassen soll, welche „die ausreichende Vorbildung für den unmittelbaren Eintritt in eine mittlere und höhere Lehranstalt gewährleisten“ (Topsch 2004, S. 16).
Vor diesem Beschluss war die Elementarschulbildung ständisch gegliedert: Es gab Vorschulen an Gymnasien und Realschulen, private Vorschulen und Haus- bzw. Privatunterricht (Sandfuchs 1995, S. 3).
Das pädagogische Profil der Grundschule in der Weimarer Republik war geprägt von der Reformpädagogischen Bewegung (Sandfuchs 1995, S. 7; Götz & Sandfuchs 2001, S. 19). Demnach sollten die Bildungsinhalte innerlich erlebt und selbstständig erworben werden und nicht bloß äußerlich angeeignet werden. Auch die Auswahl der Inhalte sollte sich an dem Entwicklungsstand und den Bedürfnissen der Kinder richten (ebd.).
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Begriff "Grundschule" abgeschafft und „in den curricularen Curriculum Gesamtzusammenhang der Volksschule eingeordnet“, aber die Funktion als gemeinsame Grundschule blieb für alle Kinder erhalten (Sandfuchs 1995, S. 8; Götz & Sandfuchs 2001, S. 21). Das Prinzip der Grundschularbeit, vom Entwicklungsbedürfnis des Kindes auszugehen, wurde verworfen (Götz & Sandfuchs 2001, S. 21). Erziehung und Unterricht der Grundschule richtete sich nach den weltanschaulichen Doktrinen des Nationalsozialismus: Streng lehrerzentriert und gemeinschaftsbezogen, so dass für Individualisierung und Differenzierung kein Platz war (Haarmann 2001, S. 20).
Nach dem Zweiten Weltkrieg startet eine Schulreform, die der Grundschule wieder ihren Namen gab und nationalsozialistische Lehrkräfte und Inhalte aus den Schulen verbannte. Die pädagogische Konzeption der Weimarer Grundschule wurde wieder aufgegriffen und bis Mitte der 60er Jahre weiter geführt (ebd. S. 24). Besonderen Wert wurde darauf gelegt, dass sich die Grundschule als Lebensstätte und Schonraum für Kinder darstellt, wo die Kinder eine ganzheitliche Bildung und Erziehung erfahren (ebd.). So wurde im "Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden öffentlichen Schulwesens" von 1949 festgehalten: „Die Grundschule umfaßt wie bisher die ersten vier Schuljahre aller Kinder und unterrichtet diese einheitlich.“ (zit. nach Ipfling 1995, S. 15).
1964 wurde die Grundschule eine organisatorisch eigenständige Institution, denn die Volksschule wurde nach dem Hamburger Abkommen, eine Vereinbarung zwischen den Ländern der Bundesrepublik zur Vereinheitlichung des Schulwesens, bundesweit in eine Grund- und eine Hauptschule aufgegliedert (ebd.). Ab 1965 begann eine Phase der Kritik der Grundschularbeit (Sandfuchs 1995, S. 11). Der Auslesecharakter der Grundschule und die starre und differenzierte Schulorganisation sind nur zwei Kritikpunkte von vielen, auf die hier auf Grund ihres Umfangs nicht näher eingegangen werden.
Der Strukturplan des Deutschen Bildungsrates und die KMK-Empfehlung zur Arbeit in der Grundschule von 1970 sind die bedeutenden Reformdokumente aus dieser Zeit. Der Strukturplan betonte stärker den horizontalen Aufbau des Schulwesens in Stufen: Dem Elementarbereich (Vorschulbereich) soll der Primarbereich (Grundschulbereich) folgen, auf den sollen Sekundarbereich I (Jahrgänge 5 -10), der Sekundarbereich II (Jahrgänge 11 -13) und der Tertiärbereich (Hochschulen) aufbauen (Ipfling 1995, S. 15). Des Weiteren wurde empfohlen die 5-Jährigen in eine zweijährige Eingangsstufe einzuschulen. Darüber hinaus favorisierte man „kompensatorische Förderung, selbstständiges, kooperatives und entdeckendes Lernen, intensive Elternarbeit, Wissenschafts- und Lernzielorientierung der Curricula, ein sowohl sozial wissenschaftlich als auch naturwissenschaftlich-technisch ausgerichteter Sachunterricht, Anfänge der modernen Mathematik, eine erste Fremdsprache sowie eine Betonung fachspezifischen Lernens“ (Götz & Sandfuchs 2001, S. 25). Die KMK - Empfehlung wurde analog zum Strukturplan formuliert.
Mit dem Bildungsgesamtplan von 1973 wurden im Sinne des Strukturplans Modellversuche gestartet, die vor allem die Zuordnung der 5-Jährigen klären sollten.
Infolge des Reformprozesses der nächsten Jahre gelang es, den vorher überwiegend gleichschrittigen Unterricht durch Formen offenen Unterrichts deutlich zu verringern, individuelle Förderung in verschiedenen Organisationsformen des Lernens zu ermöglichen und ausländische Kinder zu integrieren (Götz & Sandfuchs 2001, S. 26).
Seit dem Bildungsgesamtplan von 1973 ist offiziell keine neue Bildungsplanung mehr erschienen. Aus diesem Grund wurde eine Gruppe von Wissenschaftlern beauftragt, einen „Bildungsgesamtplan ´90“ zu verfassen (Ipfling 1995, S. 16). Die Autoren dieses neuen Planes betonen besonders zwei Probleme: „der allmähliche Übergang zum schulischen Lernen (im Anschluss an den Elementarbereich) und der Übergang in die "hierarchisch gegliederte" Sekundarstufe I“ (ebd.).
3.2.2 Rechtlicher Rahmen
Die rechtliche Grundlage für die Grundschule wurde schon 1919 mit der Weimarer Reichsverfassung und mit der Reichschulkonferenz von 1920 geschaffen. Auf Grund des Hamburger Abkommens von 1964 galt die Grundschule von diesem Zeitpunkt an als organisatorisch eigenständige Institution des Primarbereichs des Bildungswesens, auf die der Sekundarbereich aufbaut.
Die rechtlichen Regelungen für die Grundschule sind in den Ländergesetzen festgehalten, da das Grundgesetz den Ländern Kulturhoheit einräumt (Ipfling 1995, S. 14). So werden die Einzelheiten der Grundschule von den Gesetzen der Länderparlamente und den Verordnungen der jeweiligen Kultusministerien bestimmt (ebd.).
Die Unterschiede der ministeriellen Zuständigkeiten für Kinder- und Jugendarbeit und Kindertagesstätten in den einzelnen Ländern wurde bereits angesprochen (vgl. 3.1.2). Die ministeriellen Zuständigkeiten für das Schulwesen unterscheiden sich ebenso von Bundesland zu Bundesland.
In Baden Württemberg ist das Kultusministerium neben den Zielsetzungen für Kindertageseinrichtungen auch für das Schulwesen zuständig (Hovestadt 2003, S. 9).
In Bayern ist das Schulwesen Aufgabe des Ministeriums für Unterricht und Kultus (ebd., S. 12).
In Rheinland Pfalz hingegen steht das Schulwesen unter der Aufsicht des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend. Dieses Ministerium ist gleichzeitig für die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz zuständig
(ebd., S. 37).
3.2.3 Organisatorischer Rahmen
Formale Organisation
Die Grundschule wird seit ihrer Gründung 1919 als Einheitsschule bezeichnet. Der Begriff Einheitsschule impliziert, dass diese Schule nicht horizontal nach Schularten gegliedert ist, dass sie von allen Kindern besucht werden muss und dass dort von allen Kindern die gleiche grundlegende Bildung und die elementaren Kulturtechniken erworben werden (Bayer 2001, S. 60). Der Schuleintritt wurde nach dem Alter bestimmt, was im Hamburger Abkommen von 1964 gesetzlich fixiert wurde: „§2 (1) Die Schulpflicht beginnt für alle Kinder, die bis zum Beginn des 30. Juni eines Jahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, am 1. August desselben Jahres.“ (zit. nach Ipfling 1995, S. 15). Die Dauer der Grundschule und somit auch der Zeitpunkt der ersten Verteilung bzw. Selektion der Schüler auf die darauf folgenden Schularten, wurde in fast allen Bundesländern auf vier Jahre festgesetzt, in Berlin und Brandenburg auf sechs Jahre (ebd., S. 23).
Die Grundschüler werden überwiegend in Jahrgangsklassen mit Gleichaltrigen von Grundschullehrern unterrichtet. In manchen Schulen wird eine zusätzliche Betreuung durch weiteres Fachpersonal, wie Sozialpädagogen und Sonderpädagogen, gewährleistet. Die Ausbildung der Grundschullehrer findet an Universitäten bzw. pädagogischen Hochschulen statt, wobei das Abitur als Schulabschluss Voraussetzung ist. Die theoretische Ausbildung dauert zum Beispiel in Rheinland-Pfalz in der Regel dreieinhalb bzw. vier Jahre, woran sich eine eineinhalb-jährige praktische Ausbildung (Referendariat) in einer Grundschule anschließt.
Familie und Schule sind für das Kind zwei grundlegende Sozialisationsinstanzen (Jürgens, E. & Hacker, H. & Hanke, P. & Lersch, R. 1997, S. 171). Beide haben den gemeinsamen Erziehungsauftrag „die freie Entfaltung und Entwicklung des Kindes zu einer lebensfähigen Persönlichkeit zu fördern“ (ebd.). Aus dem gemeinsamen Erziehungsauftrag ergibt sich die Notwendigkeit der Kooperation zwischen Elternhaus und Schule. Jedoch wird auch festgestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern wenig praktiziert wird. Die Ursachen sind sehr komplex, wie zum Beispiel gegenseitige Vorurteile auf Grund von bereits gemachten Erfahrungen oder unterschiedliche Ansichten und Beweggründe der Erziehung des Kindes (ebd., S. 172). Infolge dessen finden Kontakte mit der Schule auf rein formaler Ebene statt. Informationen werden sich oft schriftlich zugesandt (Griebel & Niesel 2002, S. 28). Direkter Kontakt seitens der Schule wird meistens erst dann notwendig, wenn es Probleme gibt, woraus sich wiederum Ängste und Unbehagen bei den Eltern gegenüber der Schule einstellen (ebd.).
[...]
- Arbeit zitieren
- Franziska Bredy (Autor:in), 2005, Übergang vom Kindergarten in die Grundschule in Montessori-Einrichtungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41656
Kostenlos Autor werden





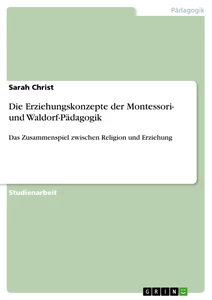














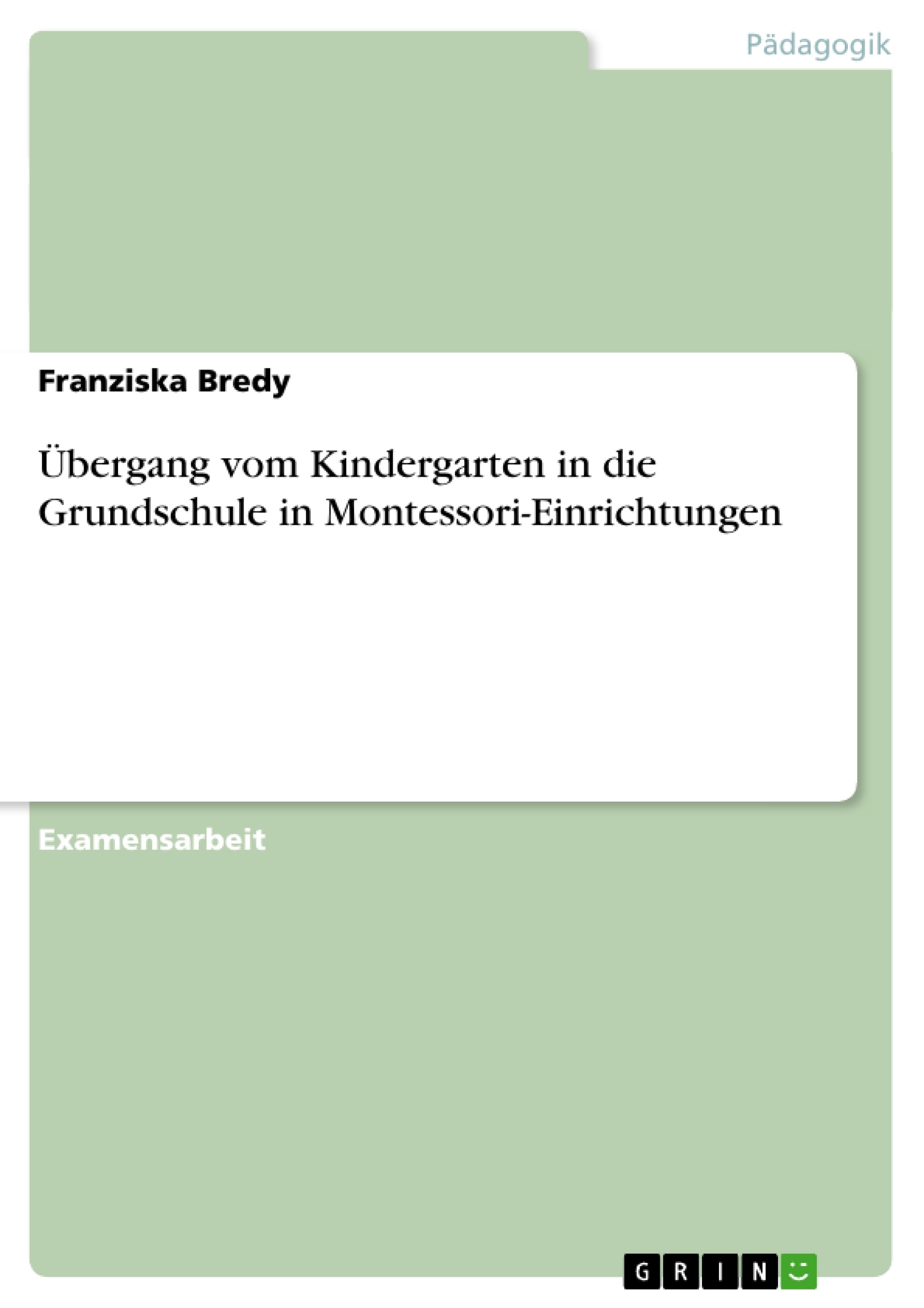

Kommentare