Leseprobe
Inhalt
1. Die Vermittelbarkeit des Todes
2. Todesbeweise als Teil zweier Zeichensysteme
3. Exkurs:
Ethischer Konflikt – der nachgetragene Sinn im Tod des Organspenders
4.1 Zeichen des Todes im Film: Waffen, Blut, Maschinen
4.2 Zeichen des Todes auf der Bühne: Ironische Nachahmung und Stillstand
5. Exkurs: Problematik des Sterbens als Prozess
6.1 Dantons Tod – lang erwartet und doch immer präsent
6.2 Lears Tochter, tot „wie die Erde“
6.3 Der Tod findet nicht statt – jedenfalls nicht hier auf der Bühne
7. Repetition, Nachtrag und Schluss
Literaturverzeichnis
1. Die Vermittelbarkeit des Todes
Zweifellos ist es wünschenswert, zu sterben, ohne daß man selbst es merkt, aber es gilt auch als erwünscht, zu sterben, ohne daß es die Umgebung gewahr wird.[1]
Um es genau zu sagen, man weiß nicht mehr, was man damit anfangen soll. Denn es ist heute nicht normal, tot zu sein, und das ist neu.[2]
Für uns, die wir keinen wirksamen Ritus zur Absorption des Todes und seiner gewaltigen Energie mehr haben, bleibt das Phantasma des Opfers und des gewaltsamen künstlichen Eingriffes des Todes.[3]
Geht man davon aus, dass dem Tod als Ereignis in unserer Gesellschaft und Kultur (aber möglicherweise auch bei anderen) etwas mit dem alltäglichen Lebensablauf Unvereinbares anhaftet, und geht man weiter davon aus, dass dieses Unvereinbare des Todes (die Verneinung des Lebens selbst) in irgendeiner Form in dieses (Leben) (re-)integriert werden und in diesem eine Bedeutung oder zumindest Einordnung erhalten muss, dann entsteht hier ein konfliktgeladener Schnittpunkt zwischen Leben und Tod. Diesen Schnittpunkt nennt man gewöhnlich Sterben.
Die Notwendigkeit der Integration des Todes in das Leben ergibt sich aus seiner Unvermeidbarkeit und Häufigkeit. Empirische Untersuchungen ergäben, bisher unwiderlegt, eine hundertprozentige Todesquote, und selbst wenn man annähme, dass die momentan gerade existierenden sechs Milliarden nicht-toten Menschen auch niemals sterben werden, wird man nicht nur täglich eines Besseren belehrt, sondern ihnen gegenüber stände eine weitaus größere Anzahl von bisher Verstorbenen, die auch aus rein rechnerischer Sicht den Tod als Zukunftsprognose ziemlich wahrscheinlich macht. Soviel also zur Unvermeidbarkeit.
Die Häufigkeit wiederum leitet sich aus der Enge des uns zur Verfügung stehenden Lebensraumes im räumlichen wie im informationellen Sinn ab und bedeutet schließlich, dass selbst wenn ein Mensch niemanden persönlich kannte, der inzwischen verstorben ist, diese Lücke spätestens durch mediale Vermittlung gefüllt wird: Viele der Menschen, über deren Existenz zu wissen von Notwendigkeit sein soll, sind bereits tot. (Cäsar, Napoleon, Marlene Dietrich, Hitler, Lady Di, Gandhi, Tut-ench-Amun, Roosevelt, Elvis – um nur eine völlig willkürliche Auswahl zu nennen.) Tod ist also ein gesellschaftliches Phänomen, das – so abstrakt es auch vermittelt sein mag – in seiner Bedeutung zumindest in Folge der Quantität seines Auftretens unbestritten sein dürfte.
Zugleich besitzt dieses Phänomen eine weitere recht spektakuläre Eigenschaft, die seine Interessantheit um ein Vielfaches erhöht: Es mag zwar jeden Menschen betreffen, ist aber eine einmalige Angelegenheit. Und die Qualität des Ereignisses lässt sich aufgrund einer bisher unüberwindlichen Kommunikationsunterbrechung nicht kommunizieren. Diese These ist natürlich vage, genauso wie gegenteilige Behauptungen über Ereignisse, die sich über dieses Phänomen hinweggesetzt haben sollen. Beispiele für solche Behauptungen finden sich in Religionen, Esotherik (da sind ja die Grenzen fließend), medizinischen und psychologischen Berichten. Man kann aber wohl von ihnen allen behaupten, dass sie auch auf ihrem Gebiet jeweils den Status von Verheißungen oder Vermutungen haben. Üblich und Teil eines Allgemeinwissens wie etwa Straßenverkehrsregeln, UN-Konventionen oder z.B. auch Geburtsvorbereitungskurse, sind solche Annahmen bisher nicht.
Dennoch, das ist unbestritten, besteht ein gewisser Informationsbedarf zu diesem Thema. Und der Vergleich mit den Schwangerschaftskursen ist nicht zufällig angebracht, denn diese Situation menschlichen Lebens kommt in Bezug auf ihre Existenzialität als Vergleich am ehesten in Frage. Bleibt aber zu beachten, dass in den seltensten Fällen – bisher ist mir zumindest keiner bekannt – dem Neuzugebärenden und nicht den Eltern ein Kurs angeboten wird. Und sollte eine ins Unendliche ausgedehnte pädagogische Vorhut auch hier in Zukunft ihre Bemühungen um Fragen à la „Wie lernt mein Baby schon im Bauch Französisch?“ auf den Bereich „Was Sie während Ihrer eigenen Geburt beachten sollten“ ausdehnen, wird sie auch hier wieder an die Grenzen der Kommunizierbarkeit stoßen.
Doch nicht nur bei dem, was dem und der Einzelnen im Sterben bevorsteht, bestände ein Bedarf an Vermittlung. Für den nicht unmittelbar Beteiligten, Zeugen im weitesten Sinne, ist eine Übereinkunft über das Ereignis offenbar noch eher vonnöten. In unserer Kultur nennt man diese Übereinkunft „Totenschein“, je nach gesellschaftlichem Bezugsrahmen auch „Todesanzeige“, „Nachruf“, „Einladung zur Beerdigung“, „Grabstein“. (Die Liste lässt sich natürlich fortführen und ausweiten zu „Eintrag im Reader’s Digest“, „Retrospektive“ oder „Best of Collection – posthum“.) Der hier evidente Bedarf an Verbreitung einer Todesnachricht ließe sich in Verbindung setzen mit der Bedeutung des Todes einer Person für ihr unmittelbares Umfeld, die Ergebnisse ihres Lebenswerkes, die Bewertung desselben. Ich möchte auf eine andere Facette der Nachricht hinaus, eine Facette, die stärker orientiert ist am physischen Geschehen und gleichwohl noch den Bezug zur Umwelt im Auge behält:
Der vage Prozess des Sterbens und der ihn beendende Zustand Tod bedürfen offenbar einer Rückbindung an den Bereich des Lebens, um diesem ein Signal zu geben, eine Rückkopplung geradezu. Das Leben benötigt das Minus, um zu verbuchen, das ein Teil sich verabschiedet hat.
2. Todesbeweise als Teil zweier Zeichensysteme
Jenes Signal nenne ich im folgenden Todesbeweis. Der Todesbeweis in seiner reinsten Form ist Bestandteil eines Systems von Zeichen, die den Übergang eines Menschen vom einen Zustand (Leben) in den anderen (Tod) für Außenstehende überprüfbar machen sollen. „Todeszeichen“ wäre vielleicht der treffendere Ausdruck im Hinblick auf das, was diese Zeichen zu leisten im Stande sind, aber der Begriff „Todesbeweis“ beinhaltet die argumentative Kraft, die diesem Zeichen innezuliegen hat. Ich ziehe ihn deshalb im Rahmen der Systematisierung vor, verwende bei der anschließenden Analyse jedoch den Begriff „Zeichen“, solange der Überzeugungsgehalt dieser Phänomene nicht geklärt ist.
Bei der folgenden Betrachtung solcher Todesbeweise sind zwei verschiedene Relevanzebenen von Interesse, die beschrieben werden können als:
1.) die Stärke der Beweiskraft in Abhängigkeit von der Spektakularität der Todeszeichen (ein experimenteller Zugang, nicht immer nur naturwissenschaftlich zu sehen, der die Überzeugungskraft und damit die Wertung eines Todesbeweises eng mit einem Vorgang von experimeteller Inszenierung desselben verknüpft)
2.) die Inszenierung eines Todes im Rahmen einer Theater-, Bühnen-, Performanz-Handlung, der (fast ausschließlich) die Vereinbarung zugrunde liegt, einen Tod lediglich darzustellen, nicht zu vollziehen (eine Inszenierung des Todes anhand von Zeichen, die keinen Beweischarakter haben, sondern zeigen sollen).
Eine pikante Überschneidung beider Ebenen bilden natürlich gerade solche Fälle, in denen im Rahmen einer Situation wie unter 2.) beschrieben ein Tod nicht nur gezeigt wird, sondern auch – ob beabsichtigt oder nicht – stattfindet, so dass die Zeichen sich ebenfalls auf die Verifizierung dieses Todes nach 1.) bezögen. Dies wird aber eher die Ausnahme – der Tabubruch oder Unfall – sein und soll hier als besonderer Fall der Verbindung von beiden Ebenen behandelt werden.
Interessant an diesen Ebenen sind natürlich – der Leser hat es womöglich ohnehin schon vermutet – mögliche Korrespondenzen, gar Parallelen innerhalb der beiden Ebenen oder das, was an Gemeinsamkeiten und Ableitungen ausgemacht werden kann. Und diese Engführung macht es auch nur möglich, aus dem weitgefassten Rahmen einige Untersuchungsbeispiele auszuwählen, wobei vermutlich hier auch nicht mehr erwähnt werden muss, dass es sich bei solchen Beispielen eben um Beispiele, um eine mehr oder weniger willkürliche und keineswegs vollständige Auswahl handelt, so wie die gesamte Fragestellung lediglich als Anregung, kleiner Vorstoß in die genannte Richtung gesehen werden kann.
Bei der Auswahl der Beispiele sind folgende Überlegungen und Kriterien berücksichtigt worden:
Die gesamte Fragestellung bis hin zum Augenmerk auf den „Todesbeweisen“ ist inspiriert von einem Textausschnitt aus Ulrike Baureithels und Anna Bergmanns Herzloser Tod. Das Dilemma der Organspende[4]. Aufgrund der Thematik der Interviews und der Profession der Interview-Partner steht jener Text unter dem Vorzeichen eines medizischen, naturwissenschaftlichen Vorgehens, das allerdings schnell auch einen gesellschafts-politischen Aspekt erhält. Dort genannte Fälle werden auch im Folgenden als Beispiele einer gegenwärtigen, sehr alltagsbezogenen Problematik angeführt. Vor allem dient dieser Text aber als Muster einer sehr deutlichen Abhängigkeit von bestimmten Zeichensystemen aus Todesbeweisen. Dem gegenüber stehen Modelle von Todesbeweisen aus der Theater-Praxis. Und hier liegt auch der Interessensschwerpunkt der folgenden Untersuchung. Das Augenmerk richtet sich auf die Texte (im mehr als wörtlichen Sinne) der Inszenierungen. Es sei erwähnt, dass die Notwendigkeit des Todesbeweises nur dann existiert, wenn der individuelle Vorgang des Einzelnen, sein Sterben, für diejenigen, mit denen es nachher kommuniziert wird, eine Bedeutung hat. Im Kontext einer Bühnen-Handlung ergibt sich diese Bedeutung aus der dramaturgischen Abfolge und der Relation des dargestellten Todes zum Rest-Text der Inszenierung. (Über die Relevanz des Todesbeweises im „realen“ Leben, wird hingegen bei Baureithel und Bergmann ausführlich gesprochen.)
Die Untersuchung von Baureithel und Bergmann gibt also so etwas wie den Startpunkt zu einer vergleichenden Untersuchung innerhalb der Inszenierungen vor. Der historische Zeitraum erhält ebenfalls aus jener Untersuchung eine grobe Einschränkung, wenn in Herzloser Tod benannt wird: „Historisch gesehen wurzelt die Entstehung einer Definition des Hirntodes in der Entwicklung technischer Widerbelebungsverfahren. [...] Die ersten Diskussionsbeiträge zu diesem Problem wurden Ende der 50er Jahre vorgelegt.“[5] Die Tradition der durch einen Arzt ausgestellten Totenscheine – um nur ein Beispiel für die Notwendigkeit der Todesbeweise zu nennen – ist natürlich viel länger. Eine Aufmerksamkeit für mit solchen medizinischen Veränderungen einhergehende Fragen und Probleme ist auf gesellschaftlicher Ebene in jüngster Zeit z.B. durch die Problematik der Genforschung gegenwärtig. Die Inszenierungsbeispiele konzentrieren sich, im Sinne einer gewissen Überschaubarkeit, auf deutschsprachige Inszenierungen der neueren Zeit, also ungefähr der letzten zehn Jahre. Allerdings nicht ohne die eine oder andere Abweichung zuzulassen, gerade auch zum Kino und seinem ganz eigenen Kanon.
Bleibt noch zu betonen, das die Untersuchung von Baureithel / Bergmann bei weitem mehr enthält als den naturwissenschaftlichen Bericht einer medizinischen Neuerung in der Definition des Todes und der dazu verwendeten Todesbeweise. Die ethischen und sozialen Aspekte, die angesprochen werden, werden weiter unten noch in Ansätzen betrachtet. Ebenso kann eine medizinische Entwicklung nicht als einziger Einfluss und Hintergrund für eine Untersuchung von Toden auf der Bühne im genannten Zeitraum gelten. Gesellschaftliche, historische und kulturelle Einflüsse spielen eine womöglich noch größere Rolle. Vollständig ausgeleuchtet werden können solche Phänomene allerdings im vorliegenden Kontext nicht. Das Augenmerk bilden, wie erwähnt, die Todesbeweise mit einer Orientierung an der medizinischen Entwicklung, wie im genannten Text geschildert, und der sich daraus vielleicht ergebenden gesellschaftlichen Wertungen. Grundzüge und Probleme dieser Entwicklung lassen sich wie folgt benennen:
3. Exkurs: Ethischer Konflikt – der nachgetragene Sinn im Tod des Organspenders
Der Tod des Organspenders, sein Hirntod, genauer gesagt, ist Teil eines Prozesses, an dem die unterschiedlichsten Interessengruppen Anteil nehmen. Die Setzung des Todeszeitpunkts ist entsprungen aus der Fragestellung, wann bei einem im Koma liegenden Menschen Wiederbelebungsmaßnahmen als nicht mehr wirksam erachtet werden können. Mit der Transplantationsmedizin ist aber die Notwendigkeit hinzugekommen, bei einem Menschen noch transplantationsfähige Organe entnehmen zu können. In dieser Umwertung liegen viele Konflikte begründet.[6]
Der Zweck dieses Todes besteht damit in der Möglichkeit zur „Eucharistie der technokratischen Gesellschaft“, wie es im Seminar „Tod auf der Bühne“ im Sommersemester 2000 am Institut für Theaterwissenschaft in einer Diskussion genannt wurde: Die Organe des Verstorbenen / Versterbenden kann sich die Allgemeinheit einverleiben. Die Allgemeinheit wird hier repräsentiert durch ihre Teile, die leidenden Menschen. Zweck des Todes ist eine weitere Nutzung des biologischen Materials aus dem Körper der sterbenden Person zur Sicherung des Fortbestandes anderer Körper, eine Resourcen-Umverteilung also, innerhalb der sterblichen, biologischen Teile der Gesellschaft.
Der Sinn, der einem solchen Tod beigemessen wird, ist letztlich der evolutionäre Beitrag zum Fortbestand der Art, abgelöst von einer individuellen Betrachtung der verstorbenen Person und abgelöst von den an diese Person geknüpften kulturellen und privaten Diskurse. Dieser Tod, der Hirntod des Organspenders, ist im höchsten Maße funktionalisiert. Baureithel und Bergmann zeigen jedoch zugleich auf, mit welchen Nebeneffekten die Transplantationsmedizin eigentlich zu kämpfen hätte, würde sie nicht tendenziell alles, was sich nicht auf den chirurgischen Akt der Organentnahme bezieht, als zweitrangig einstufen.[7]
[...]
[1] Ariès, Philippe: Geschichte des Todes. München, 1999 (9. Auflage), S. 751.
[2] Baudrillard, Jean: Der symbolische Tausch und der Tod. München, S. 198, in einem Kapitel, das bezeichnerderweise die Überschrift „Die Ausweisung der Toten“ trägt. (Kursivdruck im Original)
[3] Ebd., S. 260f.
[4] Baureithel, Ulrike / Bergmann, Anna: Herzloser Tod. Das Dilemma der Organspende. Stuttgart 1999.
[5] Ebd.,
[6] Vgl. dazu Baureithel / Bergmann, S. 71 f., ebenso wie Diskussionsbeiträge zum anderen Pol eines solchen medizinischen Dilemmas, der Gen-, aktuell Stammzellen-Forschung (z.B. Streitgespräch zwischen Andrea Fischer und Detlev Ganten, taz 28.8.2001, S. 4-5).
[7] Vgl. Baureithel /Bergmann, S. 160 f.
- Arbeit zitieren
- M.A. Sibylle Meder Kindler (Autor:in), 2001, Todeszeichen - Analysen zur Darstellung des Sterbens auf der Bühne, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4158
Kostenlos Autor werden
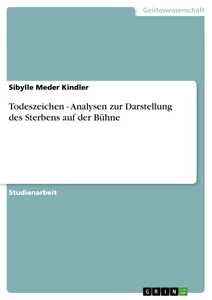
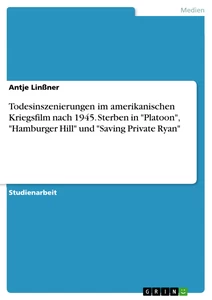








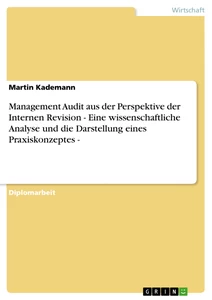



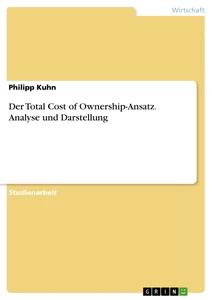





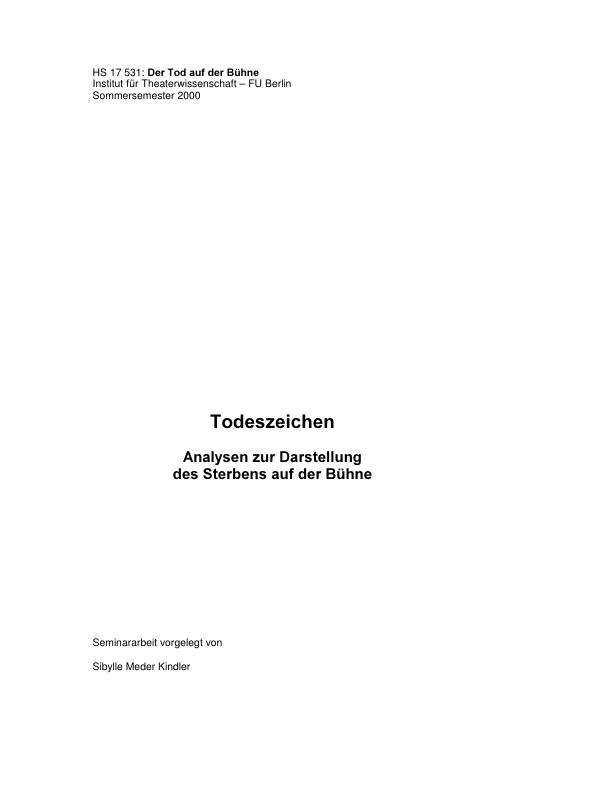

Kommentare