Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen
A. Interpretation
1. Die Philosophie des Absoluten
2. Die Philosophie der Geschichte
a) Die „Trefflichkeit des alten Athenervolks“
b) Die „Unheilbarkeit des Jahrhunderts“
c) Der politische Gegenentwurf
3. Bilder der Versöhnung
a) Die „göttliche Natur“ und das Programm einer Erlösung der Natur durch die Geschichte
b) Dichtung als „Mythologie der Vernunft“
c) Der Diotima-Mythos
4. Die Struktur des Romans
5. Hyperions Leben
B. Fachdidaktische Grundlegung
1. Ableitung und Begründung des fachdidaktischen Ansatzes
2. Verhältnis zur Fachdidaktik Rolf Geißlers
3. Folgerungen für den Literaturunterricht
4. Begründung der Wahl des Unterrichtsgegenstandes und der Zielsetzung der Unterrichtsreihe
5. Didaktische Reduktion
6. Strukturplan zur Unterrichtsreihe: „Hyperion“
7. Überblicksgraphik: Aspekte der Interpretation des Romans
8. Erläuterungen zur Überblicksgraphik
C. Materialien
1 Inhaltsübersicht zu den einzelnen Briefen des Romans
2. Hyperions wichtigste Lebensstationen
3. Die Zeitstruktur des Romans: Leben Hyperions und Romanzeit
Literaturverzeichnis
1. Textausgaben „Hyperion“
2. Literatur zur Interpretation
3. Literatur zur fachdidaktischen Grundlegung
Vorbemerkungen
„Protest“ und „Verheißung“ sind Kategorien der fachwissenschaftlichen Analyse ebenso wie des zugrundeliegenden fachdidaktischen Ansatzes und bilden – drittens – zugleich die Prinzipien der vorgenommenen didaktischen Reduktion.
Die didaktische Analyse setzt daher die Ergebnisse einer genauen Interpretation des Romans voraus. Dem entspricht die Gliederung der Arbeit.
Der Briefroman „Hyperion“ wurde in einem Grundkurs Deutsch der Jahrgangsstufe 12 an einem Gymnasium in der Ernst-Bloch-Stadt Ludwigshafen innerhalb von 11 Unterrichtsstunden erarbeitet.
Der vorliegende Text bietet die Interpretation des Romans und die fachdidaktischeGrundlegung. Weitere Bestandteile der ursprünglichen Originalarbeit sind noch die „methodischen Überlegungen“, weitere Unterrichtsmaterialien, eine ausführliche Dokumentation der Durchführung der Unterrichtsreihe und der Lernerfolgskontrollen. Auf die Wiedergabe dieser Teile wird hier verzichtet.
A. Interpretation
1. Die Philosophie des Absoluten
Das Gravitationszentrum, auf das der Roman in allen seinen Teilen und Aspekten sich bezieht, ist Hölderlins Philosophie des Absoluten.
Ihre Darstellung, soweit sie im Roman und den Vorreden zu seinen verschiedenen Fassungen selbst expliziert wird bzw. daraus rekonstruierbar ist, hat sonach die Grundlage jeder Deutung zu bilden.
Ihren Anfang nimmt daher die Interpretation bei dem Anfang jener Philosophie: „im Anfang war der Mensch und seine Götter Eins, da, sich selber unbekannt, die ewige Schönheit war.“ (89)[1]
Den Anfang also bildet das Absolute in seiner einfachen, ursprünglichen Unmittelbarkeit.
In immer neuen Wendungen muss das, was „nie gedacht wird“ (91), das „Unendlicheinige“ (91) gleichsam umkreist werden, da die Sprache der Begriffe, die ja gerade am Trennen und Unterscheiden ihr Lebenselement hat, an Es, das das Ungetrennte selber ist, nicht heranreicht: „die seelige Einigkeit“, „das Seyn, im einzigen Sinne des Worts“, „was einst ... Eins war“, „de(r) Frieden alles Friedens“, das unendliche() Ganze()“, „wo Alles Eins ist“, „unendliche(r) Frieden“[2] sind die Namen des Absoluten.
Die Sprache des Begriffs muss sich zum herakliteischen Paradoxon spreizen, um das, was nicht sich sagen lässt, wenigstens negativ, also durch die Benennung der Gegensätze, deren – nicht Aufgehobenheit – Nochnichtexistenz es ist, vorzustellen: es ist das Ἓν καὶ Πᾶν (Hen kai Pan: Ein und Alles), das Ἓν διαφέρον έαυτω (Hen diapheron heauto: das Eine in sich Unterschiedene). Bestimmter aber ist dies einige Eins, die Einheit in und an sich selbst die „ewige Schönheit“, „die Harmonie der mangellosen Schönheit“ (91), oder die Schönheit ist zunächst überhaupt nichts anderes als die Idee dieser Einheit.
Da, nach Hegels Einsicht, „es Nichts gibt, nichts im Himmel oder in der Natur oder im Geiste oder wo es sei, was nicht ebenso die Unmittelbarkeit enthält als die Vermittlung, so dass sich diese beiden Bestimmungen als ungetrennt und untrennbar und jener Gegensatz sich als ein Nichtiges zeigt“[3], ist die Schönheit nicht nur die Idee der einfachen Unmittelbarkeit der ursprünglichen Einheit, sondern ebenso der Vermittlungsbegriff, die Synthese zwischen den bereits gesetzten Gegensätzen von Theorie und Praxis, Sinnlichkeit und Sittlichkeit, Natur und Geist, Objekt und Subjekt,[4] und somit als über den vermittelten Gegensätzen stehender Begriff kein erster. Inwiefern auch Hölderlin den Begriff der Schönheit als einen der Vermittlung nimmt, wird noch darzustellen sein, für jetzt aber ist festzuhalten, dass er ihn im Anfange seiner Philosophie lediglich von der Seite seiner Unmittelbarkeit aus betrachtet.
In ihrer ursprünglichen Unmittelbarkeit aber ist die „ewige Schönheit“ sich noch „selber unbekannt“ (89).
Das Absolute ist noch leer, weiß sich nicht, ist nur erst an sich, ohne an und für sich geworden zu sein. Als dieses Bewusstlose ist es noch nicht das Wahre, an diesem Fehlenden zeigt es an sich selbst, seinen Begriff als des schlechthinnigen „Alles“ noch nicht erfüllt zu haben.
Nach seiner negativen Seite hin betrachtet, ist dies das Zerbrechen des Absoluten an seiner Defizienz, das Heraustreiben aus seiner einfachen und ursprünglichen Unmittelbarkeit. Positiv genommen aber ist diese Trennung und Unterscheidung, dieser Schmerz und Verlust, der Weg, auf dem das Absolute erst wahrhaft zu sich selbst kommen, seinen eigenen Begriff in der Bewegung des Werdens erst erfüllen, sich selbst erst wissen lernen kann.
Das Absolute, die „ewige Schönheit“, „der unendliche Frieden“ trennt, unterscheidet und entäußert sich daher im Medium der menschlichen Geschichte. Im menschlichen Bewusstsein und Selbstbewusstsein kommt das Ἓν καὶ Πᾶν auf dem Weg der Geschichte zu sich selbst; die Philosophie des Absoluten geht über in die der Geschichte.
2. Die Philosophie der Geschichte
Es ist die hier nur knapp skizzierte Dialektik, die Hölderlin bereits voraussetzt, wenn er sich im Roman und in den Vorreden jeweils nur auf den Menschen und sein Verhältnis zur Weltganzheit bezieht. Was vom Absoluten her betrachtet dessen „Vermittlung des Sichanderswerdens mit sich selbst“[5] heißen darf, ist, vom Menschen aus gesehen, der Verlust der Einheit mit der Welt, die Trauer und der Schmerz darüber, aber durch dieses Negative hindurch die Wiederherstellung der Einheit.
Programmatisch heißt es deshalb in der Vorrede zur vorletzten Fassung des „Hyperion“: „Die seelige Einigkeit, das Seyn, im einzigen Sinne des Worts, ist für uns verloren und wir mußten es verlieren, wenn wir es erstreben, erringen sollten. Wir reißen uns los vom friedlichen Ἓν καὶ Πᾶν der Welt, um es herzustellen, durch uns Selbst.“[6]
Die Einheit, die als das Telos der Dialektik des geschichtlichen Prozesses in dem notwendigen Gang durch die Hölle der Negativität, des Widerstreits und der Entfremdung erreicht wird, ist erst der Zustand der wahren, weil ihrer selbst innegewordenen Versöhnung, die weiß, was sie hinter sich gelassen: „der heilige Friede des Paradieses gehet unter, daß, was nur Gabe der Natur war, wiederaufblühe, als errungnes Eigentum der Menschheit.“[7]
Der dialektischen Bewegung nach sind also die drei Stufen von (1.)Einheit, (2.) Trennung, Entzweiung und (3.) Einheit im Zustand der Versöhnung zu unterscheiden. Diesen Stufen entsprechen in Hölderlins Geschichtsphilosophie die Antike, die Moderne (insbesondere Hölderlins Gegenwart) und die „goldenen Tage, die da kommen sollen“ (75).
Das Bild der Antike und der zeitgenössischen Gegenwart, das der „Hyperion“-Roman entwirft, ist zunächst im Einzelnen zu untersuchen.
a) Die „Trefflichkeit des alten Athenervolks“
Paradigma der ursprünglichen Einheit des Menschen mit sich und der Natur ist für Hölderlin/Hyperion die athenische Polis. Ausdrücklich heißt es schon im 4. Brief des Romans über Adamas: „Er wollte Menschen … Er kam nach Griechenland.“ (14) Ausführlich schildert und begründet der „Athenerbrief“, „Achse des Romans“[8] in mehr als einer Hinsicht, die „Trefflichkeit des alten Athenervolks“ (86) in der Kontrastierung zu Spartanern, „Aegyptier(n) und Goten“ (89). Als die entscheidende Ursache dafür, dass „vollendete() Menschennatur“ (89) sich gerade bei den Athenern entwickeln konnte, nennt Hyperion, „daß die Athener so frei von gewaltsamem Einfluß aller Art ... aufwuchsen“ (88). Ihre von außen ungestörte Entwicklung – sie sind „sich selber überlassen, wie der werdende Diamant“ (87) – bringt erst die Harmonie „schöne(r) Wesen“ (87) hervor. „Schönheit“ ist wieder der Schlüsselbegriff, der zur Bezeichnung eines in sich und mit dem Außen einigen, harmonischen Zustandes dient.
Bilden Athen und die Blütezeit seiner Kultur geschichtsphilosophisch den Idealtypus der ursprünglichen Einheit – „es war ein göttlich Leben und der Mensch war da der Mittelpunkt der Natur“ (94) —, so weist diese einzelne Stufe in sich doch auch in einer Art mikrokosmischer Spiegelung die gesamte Abfolge des dialektischen Dreischrittes auf: Aus der geschichtlich-konkreten Entwicklung des Athenervolks nämlich abstrahiert Hyperion ein Erziehungskonzept, das allgemeine Gültigkeit beansprucht und in dem die Dialektik von ursprünglicher Einheit, Unterscheidung/Trennung, Einheit auf höherer Stufe deutlich greifbar wird: „Vollendete Natur muss in dem Menschenkinde leben, eh es in die Schule geht, damit das Bild der Kindheit ihm die Rückkehr zeige aus der Schule zu vollendeter Natur.“ (87) und:
„Laßt von der Wiege an den Menschen ungestört! treibt aus der engvereinten Knospe seines Wesens, treibt aus dem Hüttchen seiner Kindheit ihn nicht heraus! tut nicht zu wenig, daß er euch nicht entbehre und so von ihm euch unterscheide, tut nicht zu viel, daß er eure oder seine Gewalt nicht fühle, und so von ihm euch unterscheide, kurz, laßt den Menschen spät erst wissen, daß es Menschen, daß es irgend etwas außer ihm gibt, denn so nur wird er Mensch. Der Mensch ist aber ein Gott, sobald er Mensch ist. Und ist er ein Gott, so ist er schön.“ (88)
Erziehung hat also vornehmlich darauf zu sehen, dass die unvermeidliche Unterscheidung, die Stufe der Aufspaltung der ursprünglichen Einheit, erst „zu ihrer Zeit“ einsetzt, damit der dialektische Gesamtprozess möglich bleibt.
Hyperions eigene Jugend und seine Erziehung durch Adamas liefern das individuelle Muster einer solchen Erziehung wie die Athener das geschichtlich-kollektive: wechselseitig spiegeln und erhellen sich der Lebensweg Hyperions, die geschichtsphilosophische Grundlegung und das von Hyperion formulierte theoretische Konzept von Erziehung; ihr Verbindendes ist die dialektische Dreischrittigkeit.
Adamas begegnet Hyperion, als dessen Zeit in sich ungestörter Entwicklung offensichtlich an ihrem äußersten Endpunkt angelangt ist und Hyperion das erste Mal jener „Zurechtweisung“[9] seiner beginnenden „exzentrische(n) Bahn“[10] bedarf, deren Darstellung die Vorrede zum „Fragment von Hyperion“ als das Programm des ganzen Romans bezeichnet: „Ich war aufgewachsen, wie eine Rebe ohne Stab, und die wilden Ranken breiteten richtungslos über den Boden sich aus.“ (14)
Adamas gelingt es, Hyperion „Richtung“ zu geben, indem er ihn in die Welt der Antike und der Natur einführt, „mit Zahl und Maß das jugendliche Treiben“ „ordnet und beruhigt“ (15), ohne doch den Schützling wie eine „Eule die jungen Adler aus dem Neste (zu) jagen“, ohne wie andere „tausendfältig die jugendliche Schönheit (zu) töten und (zu) zerstören, mit ihrer kleinen unvernünftigen Manneszucht!“ (13). Behutsam leitet er dagegen an, so dass als „köstlich Wohlgefühl“ im Rückblick von Hyperion noch empfunden wird, „wenn so das Innere an seinem Stoffe sich stärkt, sich unterscheidet (!) und getreu anknüpft und unser Geist allmählich waffenfähig wird.“ (15)
Noch die Stufe der notwendigen Entäußerung kann also als positiv erscheinen, wenn nur Erziehung, die um die Dialektik des individuellen Reife- und Wachstumsprozesses weiß, diesen sorgfältig und verantwortungsbewusst genug begleitet: „Aber schön ist auch die Zeit des Erwachens, wenn man nur zur Unzeit uns nicht weckt.“ (11)[11]
Vollends deutlich wird die Identität des Entwicklungsganges des athenischen Volkes mit dem individuellen Hyperions, wenn gleichlautend die Resultate beschrieben werden. Heißt es im Resümee seiner eigenen Entwicklung bei Hyperion „Was ich sah, ward ich, und es war Göttliches, was ich sah.“ (14), so wird der Athener als der „göttliche Mensch“ (89) bezeichnet. Und das Resümee des bereits zitierten Gedankens der Göttlichkeit des Menschen, wenn er nur ganz Mensch sei, lautet: „So war der Athener ein Mensch ..., so mußt er es werden.“ (88) Kunst, Religion, Philosophie und Staatsform der Athener sind dann dieser menschlichen Göttlichkeit „Blüten und Früchte … nicht Boden und Wurzel.“ (86)
Da das Verhältnis von Dichtung und Philosophie zueinander in einem anderen Zusammenhang noch ausführlich zu thematisieren sein wird, soll hier nur ein kurzer Abriss des von Hyperion entwickelten Begründungszusammenhangs gegeben werden.
Kunst und Religion erscheinen als „Kinder“ (89) der Schönheit. Gemeint ist hier aber nicht die „sich selber unbekannt(e) ... ewige Schönheit“ (89), die wir als einen der Namen[12] des noch unentfalteten Absoluten identifiziert haben, sondern die bereits geschichtlich-konkrete Schönheit der Athener.
Der Satz, der sich auf die „ ewige Schönheit“ bezieht, ist im konkreten Redezusammenhang nicht mehr als eine – fast beiläufige – Erinnerung an den Zustand, in dem es noch keine Götter geben konnte, da alles eins war. Es gab auf dieser Stufe des bloß an sich seienden Absoluten natürlich auch weder Menschen noch deren Geschichte, so dass die oben vorgenommene Gleichsetzung dieser Stufe mit der Antike für Hölderlin nur im Sinne der Analogie der völlig vorgeschichtlichen und bewusstlosen Einigkeit des Absoluten mit sich selbst zu der relativen Harmonie und Einigkeit auf der ersten Stufe seiner bereits stattfindenden geschichtlichen Entäußerung genommen werden darf.
Das Aspetsberger bewegende Problem, warum die Orientalen und der Norden aus Hyperions Entwurf ausgeschlossen seien, wo doch „der Ansatz der ‚ewigen Schönheit‘ …·notwendig ja nicht nur für die Athener, sondern vom ‚Anfang‘ her für alles menschliche Dasein gelten (müßte)“[13], entsteht erst gar nicht, wenn man sich bewusst macht, dass das Absolute sich in jeder Geschichte, auch der athenischen, immer schon durch sein Anderswerden, sein Negatives bewegt. Typisch dafür sind die Aegyptier und Goten, die jeweils eines der beiden negativen Extreme von „leere(r) Unendlichkeit“ und „bloße(m) Verstand“ (92) in ihrem Denken ausgebildet haben.
Was die Athener zum Symbol der Harmonie der ursprünglich ungetrennten Einheit, zur „schönen Mitte der Menschheit“ (89), qualifiziert, ist gerade ihre Ausnahmestellung, die sie der geschichtlich kontingenten, zufälligen Ungestörtheit ihrer Entwicklung verdanken.
Hyperion also, der mit dem Satz „ich spreche Mysterien, aber sie sind“ (89) verdeutlicht, dass er seinen kurzen Verweis auf den übergeordneten Zusammenhang des Werdensprozesses des Absoluten bei diesem Gespräch nicht weiter zu explizieren gedenkt, erklärt Kunst und Religion zu „Kindern“ der Athenerschönheit, also zu selbständigen Gestalten der Entäußerung dieser Schönheit: „Er (der göttliche Mensch, B. K.) will sich selber fühlen, darum stellt er seine Schönheit gegenüber sich.“ (89)
„Kunst“ wird dabei ausschließlich verstanden als die bildnerische oder dichterische Darstellung der Götter, was aus dem unmittelbar folgenden „So gab der Mensch sich seine Götter.“ (89) hervorgeht.
Zum weiteren Beleg sei noch eine spätere Stelle angeführt, an der die Gleichsetzung von Kunst und Götterdarstellung ebenfalls erscheint: „Mängel und Mißtritte gibt es überall und so auch hier. Aber das ist sicher, daß man in den Gegenständen ihrer Kunst doch meist den reifen Menschen findet ... Sie schweifen weniger als andre, zu den Extremen des Übersinnlichen und des Sinnlichen aus. In der schönen Mitte der Menschheit bleiben ihre Götter mehr, denn andre.“ (89; hervorgehoben von mir, B. K.). Dass Kunst als Darstellung des Göttlichen begriffen wird, ist als wesentlich festzuhalten für die noch zu untersuchende Bedeutung der Dichtung.
Religion ist demnach – konsequent – nichts anderes als die Liebe zu den Göttern, wie sie die Kunst darstellt: „daß ihre Kunst und Religion ... nur hervorgehn konnten aus vollendeter Menschennatur, das zeigt sich deutlich, wenn man die Gegenstände ihrer heiligen Kunst und die Religion mit unbefangenem Auge sehn will, womit sie jene Gegenstände liebten und ehrten. “ (89; hervorgehoben von mir, B. K.).
Kunst und Religion bleiben also beide auf die menschlich-göttliche Schönheit der Athener bezogen, Kunst spiegelt diese den Menschen zurück, und die Religion ist die Liebe und Verehrung dieses Spiegelbilds, also die objektiv, gegenständlich gewordene Beziehung des Menschen auf sich selbst, diese Beziehung als eigene Gestaltung. In Hölderlins Fragment „Über Religion“ wird entsprechend die Religion gefasst als „Idee oder ... Bild“, das die Menschen sich machen vom Zusammenhang zwischen sich und ihrer Welt“[14], die verschiedene „Empfindungsweise und Vorstellung ... von Göttlichem“ in Abhängigkeit gesehen von „den besondern Beziehungen ..., in denen er (jeder Mensch, B. K.) mit der Welt steht“[15] Die Athener, wie sie bei Hölderlin/Hyperion gezeichnet sind, musste das Bild ihres eigenen Zusammenhangs zum Selbstgenuss einladen.
Zurück aber in die Zeit, in der die Erde „einst überfloß von schönem menschlichen Leben“ (97), ist nicht mehr zu gelangen. Schon in der Antike, das sieht bei aller Trauer auch Hyperion, war „dieser Geist ... untergegangen, noch ehe die Zerstörer über Attika kamen“ (95), die geschichtliche Bewegung geht notwendig über die Kindheit der Menschheit hinaus:
„Von Kinderharmonie sind einst die Völker ausgegangen, die Harmonie der Geister wird der Anfang einer neuen Weltgeschichte sein. Von Pflanzenglück begannen die Menschen und wuchsen auf, und wuchsen, bis sie reiften; von nun an gärten sie unaufhörlich fort ... bis jetzt das Menschengeschlecht, unendlich aufgelöst, wie ein Chaos daliegt“. (70)
b) Die „Unheilbarkeit des Jahrhunderts“
Wenn dialektisch die Geschichte notwendig durch die absolute Negativität, die Zerrissenheit, Entfremdung und Entzweiung der Menschen selbst, untereinander und in ihrem Verhältnis zum Ganzen der Welt hindurchzugehen hat, um zu sich selbst zu kommen in einer „bessere(n) Zeit“, einer „schönere(n) Weit“ (74), so hindert diese Einsicht nicht die schonungsloseste Kritik des Bestehenden. Diese Kritik, dieser Protest ist vielmehr erst nötig und möglich auf der Grundlage einer geschichtsphilosophischen Position, die das platt Gegebene, das sich, bloß weil es ist, zugleich zum Wahren aufzuspreizen anmaßt, nach den Dimensionen des verlorenen Vergangenen wie des möglichen Zukünftigen hin aufbricht und so dessen Relativität und Unwahrheit dartut.
Möglich ist solche Kritik, weil die Idee des Anderen, die herzustellende Utopie, in ihr fortlebt und es die unüberwindliche Stärke der Dialektik ist, das Negative sowohl anzuerkennen und auszuhalten als durch dieses „Verweilen“[16] es aufzuheben.
Nötig ist der Protest gegen die „Unheilbarkeit des Jahrhunderts“ (25), um im Säurebad der Kritik die „Lieblingin der Zeit, die jüngste, schönste Tochter der Zeit, die neue Kirche“ (35) vorzubereiten und zu künden.
Den ganzen Roman durchzieht die Kritik am „Jahrhundert“, das als „kindisches“ (32), „kriechend“ (108) und langweilig (vgl. 127) bezeichnet wird. Smyrna, das „jetzige() Griechenland“ (30) und Deutschland repräsentieren die Zustände, gegen die Hyperion und seine Freunde leidenschaftlich protestieren und praktisch ankämpfen. Deren Züge treten scharf vor allem in der Kontrastierung mit dem harmonischen und erfüllten Leben der athenischen Polis hervor, so sehr, dass kaum die Vorstellung dieser athenischen Vollendung noch standhalten kann: „Als hätten wir noch eine Ahnung jener Tage! Ach! es kann ja nicht einmal ein schöner Traum gedeihen unter dem Fluche, der über uns lastet.“ (16)
War der Athener göttlich in seiner Schönheit, so scheint es in der Gegenwart Smyrnas „als hätte sich die Menschennatur in die Mannigfaltigkeiten des Tierreichs aufgelöst“ (24), Hyperion findet statt harmonischer Wesen „überall dumpfen oder schreienden Mißlaut“ (41), „Götzen von Holz, denen nichts mangelt, weil ihre Seele so arm ist“ (44). Im „Schutt des heiteren Athen()“ erkennt Diotima, „wie sich das Blatt gewandt, daß jetzt die Toten oben über der Erde gehn und die Lebendigen, die Göttermenschen drunten sind“ (144).
Kritisiert werden aber nicht allein die „Unmacht der Zeitgenossen“ (144), Völker, bei denen „Geist und Größe keinen Geist und keine Größe mehr erzeugt“ (31), „willenlose Leichname“, „Knechte und Barbaren“ (31), sondern die Gesamtheit des unheiligen Zusammenhangs von Unterdrückung und Knechtssinn. Benannt werden der „Boden, wo das Herz des Menschen unter seines Treibers Peitsche keucht“ (32), „die schmähliche Gewalt, die über ihnen (den Menschen, B. K.) lastet“ (99), „die doch alle schöngeboren sind“ (173). Ausdrücklich fordert deshalb Diotima Hyperion auf:
„Ich bitte dich, geh nach Athen hinein, noch Einmal, und siehe die Menschen auch an, die dort herumgehn unter den Trümmern ... – kannst du sagen, ich schäme mich dieses Stoffs? Ich meine, er wäre doch noch bildsam. Kannst du dein Herz abwenden von den Bedürftigen? Sie sind nicht schlimm, sie haben dir nichts zuleide getan!“ (98/99).
Selbst das Verhalten der „Räuberbande“ (131), des „bübischen Geschlechts“, der „Ungeheuer“ (146), die Misistra plünderten, verweist zurück auf ihr Jahrhundert: „Wir werden vertrauter und mancher erzählt, wies ihm erging im Leben und mein Herz schwillt oft von mancherlei Schicksal.“ (126)[17]
Die Anklage gegen die Gegenwart, gegen die Menschen wie gegen die herrschenden Verhältnisse, kulminiert im vorletzten Brief des Romans: jakobinisch inspiriert oder nicht, radikaler konnte Hölderlin die deutschen Zustände kaum geißeln.
Angegriffen werden die Deutschen, weil bei ihnen die Arbeitsteilung, diese Trennung und Geschiedenheit, zur vollständig das Leben bestimmenden Kraft geworden ist. Da die Beschränktheit auf die zufällige eigene Profession nicht als notwendiges Übel erscheint, das so wenig wie möglich die Ausfaltung und Entwicklung aller sonstigen menschlichen Anlagen behindern dürfen soll, ist der Deutsche auf sein Fach absolut reduziert. Damit aber bleibt der gesellschaftliche Zusammenhang derart atomisierter und voneinander isolierter Individuen notwendig abstrakt und undurchschaubar, wird zur „toten Ordnung“ (172), zum „Machwerk, das sie sich gestoppelt“ (174).
Es ist der Athenerbrief des Romans, der in der Erziehung der Menschen die Erklärung für die Harmonielosigkeit und notwendige Zerrissenheit der Deutschen bietet:
„Der Norden treibt ... seine Zöglinge zu früh in sich hinein, ... im Norden (schickt) sich der Geist zur Rückkehr in sich selbst an, ehe er nur reisefertig ist.“ (92)
Der Geist, der in sich zurückgekehrt ist, bevor er sich entäußert, entfaltet und entwickelt hat, ist notwendig arm, abstrakt und einseitig:
„Man muß im Norden schon verständig sein, noch eh ein reif Gefühl in einem ist, ... man muß vernünftig, muß zum selbstbewußten Geiste werden, ehe man Mensch, zum klugen Manne, ehe man Kind ist; die Einigkeit des ganzen Menschen, die Schönheit läßt man nicht in ihm gedeihn und reifen, eh er sich bildet und entwickelt. Der bloße Verstand, die bloße Vernunft sind immer die Könige des Nordens.“ (92)
Abgetrennte, abstrakte Vernunft aber verliert und hat verloren den Bezug zum lebendigen Zusammenhang der Menschen und des Menschen mit der Natur, und damit ist sie abgeschnitten von ihrem Sinn und Ziel:
„Vernunft ist ohne Geistes-, ohne Herzensschönheit, wie ein Treiber, den der Herr des Hauses über die Knechte gesetzt hat; der weiß, so wenig, als die Knechte, was aus all der unendlichen Arbeit werden soll, und ruft nur: tummelt euch“ (93)
Damit gibt Hölderlin nichts weniger als eine frühe Theorie jener instrumentellen Vernunft, deren Barbarismen im 20. Jahrhundert abundieren sollten – und zwar auch und vor allem in Deutschland. Vernunft, die ihren eigenen Anspruch auf Allgemeinheit verleugnet und dem Diktat von Arbeitsteilung willfahrt, setzt jene „Dialektik der Aufklärung“ in Gang, als deren frühe Ergebnisse Hölderlin die Barbarisierung festhält.
Der bloß instrumentellen, auf Zweckrationalität hin zurechtgebogenen Vernunft erschließt sich außerhalb der arbeitsteiligen Sparten nicht nur kein übergreifender Zusammenhang mehr, sie schneidet auch weg, leugnet – „höhnt“ und „lästert“ (173) sagt Hölderlin – ,was ihrem Prokrustesbett nicht einzupassen ist:
„daß sie sich trösten dürfen, die Geistesarmen, und lächeln und Träumer mich schelten, ... weil meine Zeit dem wütenden Prokrustes gleicht, der Männer, die er fing, in eine Kinderwiege warf, und daß sie paßten in das kleine Bett, die Glieder ihnen abhieb.“ (169)
„Nicht auf jene Befriedigung, die den Menschen Wahrheit hieße, sondern auf „operation“, das wirksame Verfahren komme es an ... Auf dem Weg zur neuzeitlichen Wissenschaft leisten die Menschen auf Sinn Verzicht.“[18]
Vorweg ist es die Natur, der die Qualitäten ausgetrieben werden, die verstümmelt wird durch die Verfahren des quantifizierend-positivistischen Verstandes: „Ihr entwürdiget, ihr zerreißt, wo sie euch duldet, die geduldige Natur“ (173). Umschlagend aber bedeutet die Exstirpation des „Göttliche(n)“ (173) aus der Natur, die positivistischer Wahn bis heute „höhnt und seellos nennt“ (173) die Selbstentwürdigung des Menschen:
„Wo aber so beleidigt wird die göttliche Natur ... da ist des Lebens beste Lust hinweg ... Wüster immer, öder werden da die Menschen, die doch alle schöngeboren sind“ (175).
Nicht Natur allein, auch die Menschen werden den Anforderungen des rational durchgestylten Produktionsprozesses unterworfen und „wo einmal ein menschlich Wesen abgerichtet ist, da dient es seinem Zweck, da sucht es seinen Nutzen, es schwärmt nicht mehr, bewahre Gott! es bleibt gesetzt“ (172/73)[19]
Die bei Hölderlin gewählten Bilder exponieren sämtlich das Motiv des fehlenden inneren, substantiellen und lebendigen Zusammenhangs: „dumpf und harmonielos wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes“ (171) sind die Deutschen, das ist „wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergoßne Lebensblut im Sande zerrinnt“ (171/172), da gibt es „Mißlaut ... in all der toten Ordnung“ (172).
Was in Hölderlins Fragment „Über Religion“ der „höhere() mehr als mechanische() Zusammenhang “ heißt, in dem die Menschen leben, so weit „sie über die physische und moralische Nothdurft sich erheben“[20], gerade das fehlt seinen Deutschen.
Weit davon entfernt, dass „dieser höhere Zusammenhang ihnen ihr heiligstes sei, weil sie in ihm sich selbst und ihre Welt, und alles was sie haben und seien, vereiniget fühlen“[21], dass sie aus dieser „lebendigeren, über die Nothdurft erhabnen Beziehung“ „erfahren, daß mehr als Maschinengang“[22], bleiben die Deutschen „gerne beim Notwendigsten“ (172) und führen ein Leben „schal und sorgenschwer und überall von kalter stummer Zwietracht“ (174).
Stellt die griechische Polis für Hölderlin in idealer Form eine „gemeinschaftliche Sphäre“ der Menschen dar, „in der sie menschlich, d. h. über die Nothdurft erhaben wirken und leiden“, und insofern „eine gemeinschaftliche Gottheit“[23] haben, so ist die politische und gesellschaftliche Ordnung seines zeitgenössischen Deutschland ein bloßes „Austernleben“ (174), unfrei, unbewusst und knechtisch.
Ums „Wetter“ (173) der Großen Revolution kümmern sich die Deutschen nicht, sie „leiden alle Schmach“ (174), und Alabandas Worte meinen nicht allein die Griechen:
„Große Taten, wenn sie nicht ein edel Volk vernimmt, sind nicht mehr als ein gewaltiger Schlag vor eine dumpfe Stirne und hohe Worte, wenn sie nicht in hohen Herzen widertönen, sind, wie ein sterbend Blatt, das in den Kot herunterrauscht.“ (31)
c) Der politische Gegenentwurf
Der absoluten Zerrissenheit und Negativität, in die der Geist sich in der Gegenwart des Dichters entäußert hat, wie es der Brief über die Deutschen markant vorführt, stellt der Roman, seiner geschichtsphilosophischen Grundkonzeption entsprechend, auf verschiedenen Ebenen Bilder der Versöhnung gegenüber, Antizipationen des Zustandes, zu dem das Absolute und die Geschichte von sich aus wollen, der als utopischer aber nur be-deutet, niemals ausgemalt werden kann: Die Schönheit, die Gestalt der Diotima, die Natur und die Dichtung sind solche Gegenbilder, die als Vor-Schein des Noch-Nicht des erlösten Zustandes bereits in den unversöhnten hineinstrahlen, sie sind als „Mythologien der Vernunft“ zu untersuchen.
Das Bild der Antike nimmt eine Sonderstellung ein: einmal als das der vergangenen, nicht erst verheißenen Harmonie, zum anderen deshalb, weil es sowohl als Mythos als auch unmittelbar politisch den gegenwärtigen Verhältnissen opponiert: als „Blüte und Frucht“ der göttlichen Menschlichkeit der Athener ist die Staatsform der Polis-Demokratie dem deutschen Despotismus deutlich konfrontiert. Im Athenerbrief selbst wird der „Sinn für Freiheit“ (90) der Athener der „Gesetzesdespotie“, der „Ungerechtigkeit in Rechtsform“ gegenübergestellt, der der „Sohn des Nordens ohne Widerwillen“ (90) sich unterwerfe.
Mit dem sehnsüchtigen Rückblick auf freie politische Verhältnisse, in denen „wie Lebensluft“, jener „allgemeine() Geist (weht)“ (174), der den Deutschen mangelt, kann es sein Bewenden aber nicht haben: Der Roman entwirft durch Alabanda und Hyperion ein Konzept, das als der direkt politisch gemeinte Gegenentwurf zur zeitgenössischen deutschen Misere zu lesen ist.
Wenn dieser Entwurf im Folgenden rekonstruiert und skizziert wird, also im unmittelbaren Anschluss an die Darstellung der Kritik des deutschen Unwesens und nicht im Zusammenhang mit den mythologischen „Bildern der Versöhnung“, so nur wegen des Unterschieds der Abstraktionsebenen – nicht im Roman, dessen ästhetische Totalität alles umfasst – , der bei der Nachkonstruktion von empirisch-politisch gemeinten und spekulativ-mythologischen Gegenbildern besteht. Keinen Augenblick darf aber verkannt werden, dass die hier getrennt behandelten Gegenbilder in Hölderlins Denken miteinander umfassend vermittelt bleiben.
„Der neue Geisterbund kann in der Luft nicht leben, die heilige Theokratie des Schönen muß in einem Freistaat wohnen, und der will Platz auf Erden haben und diesen Platz erobern wir gewiß.“ (107) –„Aber ich habs auch klug gemacht. Ich habe meine Leute gekannt. In der Tat! es war ein außerordentlich Projekt, durch eine Räuberbande mein Elysium zu pflanzen.“ (131)
Zwischen den beiden zitierten Briefstellen erzählt Hyperion die Geschichte seines aktiven Kampfes für eine praktisch-revolutionäre Veränderung des „kriechende(n) Jahrhundert(s)“ (108) und dessen Scheitern. Die Gegenüberstellung beider Textstellen macht unmittelbar den Grund für dieses Scheitern deutlich: Der Platz für einen „Geisterbund“ kann von einer „Räuberbande“ nicht geschaffen werden, Ziel und Mittel stehen nicht in einer wechselseitigen Dialektik zueinander, sondern in einem unauflöslichen Widerspruch, zumal der „Geisterbund“ noch gar nicht vorhanden ist und Hyperion gewissermaßen stellvertretend/antizipierend für diesen zu handeln unternimmt. Hyperions entscheidende Fehleinschätzung findet sich im Gespräch, das er mit Diotima führt, nachdem er Alabandas Brief erhalten hat. Auf die Einlassungen Diotimas, die ihn vom Kampf zurückhalten will, entgegnet er:
„In den Olymp des Göttlichschönen, wo aus ewig-jungen Quellen das Wahre mit allem Guten entspringt, dahin mein Volk zu führen, bin ich noch jetzt nicht geschickt. Aber ein Schwert zu brauchen, hab ich gelernt und mehr bedarf es für jetzt nicht. “ (107, hervorgehoben von mir, B. K.).
Hyperion trennt völlig mechanisch die Ausübung der befreienden revolutionären Gewalt vom Bewusstsein derer, die diese Gewalt üben sollen und für deren Befreiung er sich einsetzt. Dieser gedanklichen Abspaltung der militärisch-aktivistischen Seite entspricht dann deren spätere tatsächliche Verselbständigung. Hyperion selbst hält seine Fehleinschätzung für den Grund des Scheiterns: „Nein! mir ist recht geschehn und ich wills auch dulden“ (131) und: „Das Schicksal stößt mich ins Ungewisse hinaus und ich hab es verdient.“ (132)
Die an Diotima gerichteten Briefe zeichnen sehr genau die Vorgeschichte der späteren Plünderungen nach. Im 39. Brief, Hyperion ist noch gar nicht bei Alabanda angelangt, wird das erste Mal die Befürchtung geäußert – um allerdings sofort wieder zurückgewiesen zu werden – , die Mitkämpfer könnten zu „wild“ sein:
„Voll rächerischer Kräfte ist das Bergvolk hieherum, liegt da, wie eine schweigende Wetterwolke, die nur des Sturmwinds wartet, der sie treibt. Diotima! laß mich den Othem Gottes unter sie hauchen, laß mich ein Wort von Herzen an sie reden, Diotima. Fürchte nichts! Sie werden so wild nicht sein. Ich kenne die rohe Natur. Sie höhnt der Vernunft, sie stehet aber im Bunde mit der Begeisterung.“ (117)
Diese Begeisterung scheint Hyperion zunächst auch durchaus bei seinem „Bergvolk“ wecken zu können:
„Dann fang ich an, von besseren Tagen zu reden, und glänzend gehn die Augen ihnen auf, wenn sie des Bundes gedenken, der uns einigen soll, und das stolze Bild des werdenden Freistaats dämmert vor ihnen ... O Diotima! so zu sehn, wie von Hoffnungen da die starre Natur erweicht und all ihre Pulse mächtiger schlagen und von Entwürfen die verdüsterte Stirne sich entfaltet und glänzt, so da zu stehn in einer Sphäre von Menschen, umrungen von Glauben und Lust, das ist doch mehr, als Erd und Himmel und Meer in aller ihrer Glorie zu schaun.“ (126)
Im letzten Brief aber, den Hyperion vor der Katastrophe bei Misistra schreibt, wird die bedrohliche Stimmung im Lager geschildert und Hyperions Sorgen, dass die nicht durch Vernunft gezügelten Leidenschaften aufbrechen könnten:
„Unser Volk will stürmen, aber das würde die aufgeregten Gemüter zum Rausch erhitzen und wehe dann unsern Hoffnungen, wenn das wilde Wesen aufgärt und die Zucht und die Liebe zerreißt ... Im Lager hier ists mir, wie in gewitterhafter Luft. Ich bin ungeduldig, auch meine Leute gefallen mir nicht. Es ist ein furchtbarer Mutwill unter ihnen.“ (130)
Für die Mitkämpfenden stand also der Wunsch nach Rache und vor allem nach Beute im Vordergrund, Hyperion war es in der kurzen Zeit des gemeinsamen Lagerlebens nicht gelungen, das „Kriegsvolk“ (125) zum Teil des „neue(n) Geisterbund(s)“ (107) zu machen.
Mit Prignitz nehmen wir an, dass Hölderlin in der Darstellung der Auseinandersetzung Hyperions mit Alabanda und dem Geheimbund, dem dieser in Smyrna noch angehört, sowie in den Briefen, die Hyperions aktive Teilnahme am Befreiungskampf schildern, seine literarische „Bewältigung der Französischen Revolution“[24] leistet, mithin der Gewaltausbruch in Misistra die Phase der jakobinischen Terreur reflektiert.
Umso entscheidender für die Rekonstruktion von Hölderlins politischer Konzeption ist daher, dass „nicht eine Stelle des Romans ... endgültige Abstriche an Hyperions politisch-gesellschaftlichen Ansichten nach dem Scheitern des Aufstands (macht)“[25]. Wie die beiden ersten Briefe ebenso wie der bereits analysierte Brief über die Deutschen zeigen, hat Hyperion sich zu keinem Moment mit der herrschenden Unterdrückung abgefunden:
„Wohl dem Manne, dem ein blühend Vaterland das Herz erfreut und stärkt! Mir ist, als würd ich in den Sumpf geworfen, als schlüge man den Sargdeckel über mir zu, wenn einer an das meinige mich mahnt, und wenn mich einer einen Griechen nennt, so wird mir immer, als schnürt' er mit dem Halsband eines Hundes mir die Kehle zu.“ (7) und: „ich ... wandre durch mein Vaterland, das, wie ein Totengarten, weit umher liegt, und mich erwartet vielleicht das Messer des Jägers, der uns Griechen, wie das Wild des Waldes, sich zur Lust hält.“ (8)
Mit offensichtlicher Genugtuung kommentiert Hyperion den Ausgang der Seeschlacht bei Tschesme: „So straft ein Gift das andre, rief ich, da ich erfuhr, die Russen hätten die ganze türkische Flotte verbrannt – so rotten die Tyrannen sich selbst aus.“ (139) Auch eine grundsätzliche Ablehnung der Anwendung von Gewalt zur Befreiung von fremder Unterdrückung ist Hyperions Sache nicht, der auf Salamis den historischen Präzedenzfall der gelungenen Befreiung der Griechen von den Persern, den „Vorfahren“ der Türken, die sein Vaterland besetzt halten, lange nach seiner eigenen „Kriegsgeschichte“ (52) noch bewundert:
„Oder les ich auch auf meiner Höhe droben vom alten herrlichen Seekrieg, der an Salamis einst im wilden klugbeherrschten Getümmel vertobte, und freue des Geistes mich, der das wütende Chaos von Freunden und Feinden lenken konnte und zähmen, wie ein Reuter das Roß“ (52).
So und so, wie im Brief über die Deutschen, schreibt keiner, der seinen Frieden mit allem gemacht hat. Freilich „schäm(t)“ er sich dabei auch seiner „eigenen Kriegsgeschichte“ (52), in der es genau jenes Geistes, jener substantiellen Gemeinsamkeit, hohen Moral und Disziplin mangelte, die die alten Athener, völlig im Einklang mit ihrer im „Athenerbrief“ dargestellten politischen, kulturellen und moralischen „Trefflichkeit“(86), bewiesen haben.
Mit die verheerendste Folge der im Blutbad bei Misistra gescheiterten Befreiung ist denn auch, dass auf lange Sicht jede „Propaganda“ gänzlich kompromittiert ist, die auf die Herstellung der bewusstseinsmäßigen Voraussetzungen für die Entwicklung der „schöne(n) Gemeinde, die wir hoffen“ (112), die Erringung des „schönen, neuen, goldenen Friedens ..., wo, ... einst in unser Rechtsbuch eingeschrieben werden die Gesetze der Natur, und wo das Leben selbst ... im Herzen der Gemeinde sein wird“ (130), zielte. „Nun kann ich hingehn und von meiner guten Sache predigen. O nun fliegen alle Herzen mir zu!“ (131) formuliert Hyperion in bitterer Ironie als den ersten Gedanken, nachdem er vom Faktum der Plünderung berichtet hat.[26]
Auch jener Satz, der am eindeutigsten zu belegen scheint, dass Hyperion „sich von seinem politischen Handeln und dem Projekt eines griechischen Freistaats als eitlem Streben (distanziert)“[27] („O ich will die Entwürfe, die Fodrungen alle, wie Schuldbriefe, zerreißen.“ (141)), darf nicht als Hyperions letztes Wort genommen werden, sondern stellt eine im Ablauf der „exzentrische(n) Bahn“[28] seines Lebens bald auch wieder aufgehobene einzelne Position dar.
Bereits aus Sizilien schreibt er nämlich an Notara:
„o gäb es eine Fahne, Götter! wo mein Alabanda dienen möcht, ein Thermopylä, wo ich mit Ehren sie verbluten könnte, all die einsame Liebe, die mir nimmer brauchbar ist! Noch besser wär es freilich, wenn ich leben könnte, leben, in den neuen Tempeln, in der neuversammelten Agora unsers Volks mit großer Lust den großen Kummer stillen; aber davon schweig ist, denn ich weine nur die Kraft mir vollends aus, wenn ich an Alles denke.“ (169)
Hier spricht sich zwar Hyperions tiefe Verzweiflung über das Scheitern seines Versuchs aus, jene „neuversammelte() Agora“ zu stiften, als Ziel wird sie, wenn sie auch als zu Hyperions Lebenszeit nicht mehr erreichbar erscheint, jedenfalls nicht aufgegeben.
Der Weg zu diesem Ziel der befreiten Menschheit und Natur, wo wieder emporsteigen die „Städte der Götter“ (116) führt allerdings nicht über die direkte revolutionäre Tat, sondern über „eine künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten, die alles bisherige schaamroth machen wird.“[29]
Es ist der Weg, den Hyperion selbst von Anfang an als den richtigen ansah, weshalb er sich am Scheitern des Befreiungskampfes auch selbst Schuld zumisst: Schon in Smyrna hält er Alabandas Ansicht, veränderte Strukturen, ein revolutionierter Staat, würden die angestrebte neue Menschheit hervorbringen, entgegen:
„Was aber die Liebe gibt und der Geist, das läßt sich nicht erzwingen ... Die rauhe Hülse um den Kern des Lebens und nichts weiter ist der Staat. Er ist die Mauer um den Garten menschlicher Früchte und Blumen. Aber was hilft die Mauer um den Garten, wo der Boden dürre liegt? Da hilft der Regen vom Himmel allein. O Regen vom Himmel! o Begeisterung! Du wirst den Frühling der Völker uns wiederbringen.“ (35)
Genauer bestimmt Hyperion dann im Gespräch mit Diotima und gemeinsamen Freunden, wie er sich den Übergang zu dem angestrebten utopischen Zustand vorstellt:
„Ideal ist, was Natur war. Daran, an diesem Ideale, dieser verjüngten Gottheit, erkennen die Wenigen sich und Eins sind sie, denn es ist Eines in ihnen, und von diesen, diesen beginnt das zweite Lebensalter der Welt – ich habe genug gesagt, um klar zu machen, was ich denke.“ (71)
Ein kleiner Freundesbund soll also durch Bildung, Erziehung der Menschen auf dieses Ideal hin die „künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten“ vorbereiten. Der aus dem Roman zitierte Satz verweist den Leser auf diese Schlussfolgerung und belegt zugleich, dass dieser Gedanke noch brisant genug war, so dass ihn der Verfasser nicht explizit zu Ende formulieren konnte.[30]
[...]
[1] „Hyperion“ wird nach der im Unterricht verwendeten Reclam-Ausgabe Friedrich Hölderlin: Hyperion oder der Eremit in Griechenland. Stuttgart 1983 (= RUB 559) zitiert; die Seitenzahlen dieser Ausgabe sind unmittelbar nach jedem Zitat in Klammern angegeben. Alle anderen Texte Hölderlins werden nach der Großen Stuttgarter Ausgabe (Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. Acht Bände. Hrsg. von Friedrich Beißner. Stuttgart 1946 - 1958) zitiert, deren Einzelbände in den Fußnoten mit der Sigle StA bezeichnet sind.
[2] StA 3, S. 236
[3] Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Wissenschaft der Logik. Band 1 (= Werke in zwanzig Bänden. Band 5). Frankfurt/Main 1979, S. 66
[4] Dies der Standpunkt des „Ältesten Systemprogramms“ der Tübinger Stiftler Schelling, Hegel und Hölderlin: „Zuletzt (sic!) die Idee, die alle vereinigt, die Idee der Schönheit, das Wort in höherem platonischen Sinn genommen. Ich bin nun überzeugt, daß der höchste Akt der Vernunft, der, in dem sie alle Ideen umfaßt, ein ästhetischer Akt ist und dass Wahrheit und Güte nur in der Schönheit verschwistert sind.“ (G.W.F. Hegel: Frühe Schriften. (= Werke in zwanzig Bänden. Band 1). Frankfurt/Main 1979, S. 235)
[5] Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie des Geistes. (Werke in zwanzig Bänden. Band 3). Frankfurt-Main 1979, S. 23
[6] StA 3, S. 236
[7] Fragment von Hyperion, StA 3, S. 180
[8] Friedbert Aspetsberger: Welteinheit und epische Gestaltung. Studien zur Ichform von Hölderlins Roman „Hyperion“. München 1971, S. 44
[9] StA 3, S. 163
[10] StA 3, S. 163
[11] Die geläufige Realität·von Erziehung wird unmittelbar vor der zitierten Stelle noch einmal in schärfster Form skizziert und kritisiert: „Aber das können die Menschen nicht leiden. Das Göttliche (der Kindheit, B. K.) muß werden, wie ihrer einer, muß erfahren, daß sie auch da sind, und eh es die Natur aus seinem Paradiese treibt, so schmeicheln und schleppen die Menschen es heraus, auf das Feld des Fluchs, daß es, wie sie, im Schweiße des Angesichts sich abarbeite.“ (11)
[12] Vgl. (58): „Wißt ihr seinen Namen? den Namen des, das Eins ist und Alles? Sein Name ist Schönheit.“
[13] Aspetsberger: Welteinheit ..., S. 62
[14] StA 4, S. 275
[15] StA 4, S. 278 -279
[16] Hegel: Phänomenologie ..., S. 36
[17] Wie Klaus Schuffels gezeigt hat, werden häufig „feudale Herrschaft, despotische Regierung, ungerechte soziale Zustände, willkürliche Unterdrückung im Roman subsumiert unter dem Begriff ‚Schiksaal‘“ (Klaus Schuffels: Schiksaal und Revolution. Hyperion oder der Eremit in Griechenland. In: Le pauvre Holterling. Blätter zur Frankfurter Hölderlin-Ausgabe. Nr. 2. Frankfurt/Main 1977. (S. 35 - 53), S.38
[18] Max Horkheimer/Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Frankfurt/Main 1969, S. 8/9
[19] Schillers „Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen“ zielen auf denselben Zusammenhang von arbeitsteiliger Produktion und menschlicher Selbstentfremdung: „wir sehen nicht bloß einzelne Subjekte, sondern ganze Klassen von Menschen nur einen Teil ihrer Anlagen entfalten, während daß die übrigen, wie bei verkrüppelten Gewächsen, kaum mit matter Spur angedeutet sind ... Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus; ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens, und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft.“ (Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Mit einem Nachwort von Käte Hamburger. Stuttgart 1975 (= RUB 8994), S. 19; 20/21) Bekannt ist, wie im Geiste jener „Gesetztheit“ in unserem Jahrhundert mit der platt-dreisten Bemerkung, man solle schweigen von dem, wovon man nicht reden könne (Wittgenstein), ein Begriff von Philosophie installiert werden sollte, der selbst noch Kritik des herrschenden Unwesens und Bewahrung eines Anderen unmöglich gemacht hätte. Auch dazu hat schon Hölderlin für alle dialektische Philosophie den Kommentar geliefert: „Aus bloßem Verstande kömmt keine Philosophie, denn Philosophie ist mehr, denn nur die beschränkte Erkenntnis des Vorhandnen.“ (93)
[20] StA 4, S. 275
[21] StA 4, S. 275
[22] StA 4, S. 278
[23] StA 4, S. 278
[24] Christoph Prignitz: Die Bewältigung der Französischen Revolution in Hölderlins „Hyperion“. In: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1975, (S. 189 - 211)
[25] Schuffels: Schiksaal ..., S. 50
[26] Meines Wissens ist in der Forschung diese Textstelle, aus der doch klar hervorgeht, dass Hyperion von der „guten Sache“ (131) des Freistaats in keiner Weise abrückt, nicht berücksichtigt worden, nicht einmal Bertaux oder Schuffels führen sie an.
[27] Gisbert Lepper: Zeitkritik in Hölderlins „Hyperion“. In: Reinhold Grimm/Conrad Wiedemann (Hrsg.) Literatur und Geistesgeschichte. Festgabe für Heinz Otto Burger. Berlin 1968. (S. 189 - 207), S. 203
[28] Fragment von Hyperion, StA 3, S. 163
[29] Brief an Johann Gottfried Ebel (1797), StA 6, S. 229
[30] Bertaux, der vor allem für die späte Hymnik Hölderlins zu belegen versucht hat, dass dieser darin eine nur den Eingeweihten, revolutionär Gesonnenen verständliche „Geheimsprache“ verwendet, eine „absichtliche() Verschlüsselung“ (Pierre Bertaux: Hölderlin und die Französische Revolution. Frankfurt/Main 1969, S. 123), musste diese Stelle auffallen, und er deutet sie denn auch aus dem Bezug zum weiteren Redekontext Hyperions im Roman, in dem schließlich nicht nur von Freundschaft im allgemeinen gehandelt, sondern gerade auf die beiden Tyrannenmörder Aristogiton und Harmodius Bezug genommen werde (vgl. Bertaux: Hölderlin ..., S.128/129). Im Bertaux'schen Sinne interessant ist auch jene Stelle des Romans, an der sich Hyperion zur praktischen revolutionären Tat mit folgendem Argument entschließt: „mit Worten möchtest du ausreichen, und mit Zauberformeln beschwörst du die Welt? Aber deine Worte sind, wie Schneeflocken, unnütz, und machen die Luft nur trüber und deine Zaubersprüche sind für die Frommen, aber die Unglaubigen hören dich nicht. “ (106; hervorgehoben von mir, B.K.)
- Arbeit zitieren
- Bernd Klyne (Autor:in), 1985, Hölderlins "Hyperion". Protest und Verheißung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413588
Kostenlos Autor werden


















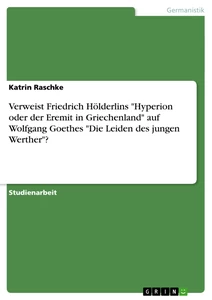



Kommentare