Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung
Abstract
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Wandel der Kriegsformen
1.2 Erklärungsansätze der Forschung
1.3 Fragestellung, zentrale Annahmen und Aufbau der Arbeit
2 Stand der Kriegsforschung
2.1 Staatszentriertheit der Kriegsforschung
2.2 Ursachenfixiertheit der Kriegsforschung
2.3 Entwicklung eines Analyserahmens
2.3.1 Grundannahmen des Konstruktivismus
2.3.2 Akteur-Struktur-Debatte
3 Die State Failure – Debatte
3.1 Die soziologische Staatstheorie nach Max Weber
3.2 Die Erosion staatlicher Herrschaft
3.2.1 Ursachen für Staatszerfall auf internationaler Ebene
3.2.1.1 Globalisierung
3.2.1.2 Dekolonisierung
3.2.1.3 Das Ende des Ost-West-Konflikts
3.2.2 Ursachen für Staatszerfall auf innerstaatlicher Ebene
3.2.2.1 Das koloniale Erbe
3.2.2.2 Akteurszentrierte Erklärungsmuster
3.2.3 Konzepte von Staatszerfall
3.2.3.1 Schwache Staaten
4 Private Gewaltakteure
4.1 Warlords
4.2 Rebellen
4.3 Organisierte Kriminalität
4.4 Vernetzung nichtstaatlicher Gewaltakteure
4.5 Motive privater Gewaltakteure
4.5.1 Greed versus Grievance
4.5.2 Greed & Grievance
5 Gewaltökonomien in innerstaatlichen Konflikten
5.1 Begriff und Charakteristika von Gewaltökonomien
5.2 Mechanismen und Dynamiken in innerstaatlichen Konflikten
5.2.1 Lokale Mechanismen
5.2.1.1 Extraktion von strategischen Rohstoffen und Bodenschätzen
5.2.1.2 Abschöpfung von Werten
5.2.1.3 Abschöpfung von Humankapital
5.2.2 Globale Mechanismen
5.2.2.1 Abschöpfung bzw. Besteuerung internationaler humanitärer Hilfe
5.2.2.2 Unterstützung aus der Diaspora
5.2.2.3 Anbindung an die Schattenglobalisierung
5.3 Gewaltökonomie und Konfliktdynamik
5.3.1 Konfliktphasen und Gewaltintensität
5.3.2 Ökonomische Strategien der Konfliktparteien
5.4 Zwischenergebnis - Gewaltökonomie als eigendynamischer Prozess
6 Gewaltökonomie als soziale Institution
6.1 Gewaltökonomie und Zerfall staatlicher Strukturen
6.1.1 Versagende Staaten
6.1.2 Gescheiterte Staaten
6.2 Fragmentierung der Konfliktparteien
6.3 Gewaltökonomie als alternatives Gesellschaftssystem
7 Abschließende Anmerkungen
8 Bibliographie
Kurzfassung
Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist die Untersuchung der Mechanismen und Prozessdynamiken, die zur Persistenz von Gewaltökonomien in innerstaatlichen Konflikten führen. Gewaltökonomien sind nicht nur eine Reaktion auf verschärfte Bedingungen der Finanzierung militärischer Gewalt, sondern setzen eine Eigendynamik frei, die maßgeblich zur ihrer Selbst-Perpetuierung führt. Durch die Analyse der Funktionsweisen und Auswirkungen von aktuellen Gewaltökonomien auf die Interessen und Handlungen von Gewaltakteuren sowie auf sozioökonomische Rahmenbedingungen wird in dieser Arbeit dargelegt, dass die Eigendynamik dieser gewaltgesteuerten Wirtschaftskreisläufe erstens zur Überlagerung der langfristigen politischen Motive der Akteure durch kurzfristige ökonomische Bereicherungsstrategien führen, was die involvierten Akteure zur Fortführung des Konflikts und Aufrechterhaltung und Verstetigung der Gewaltökonomie veranlasst und zweitens aufgrund des der Gewaltökonomie eigenen sozioökonomischen Integrationspotentials es zur Schaffung von persistenten Strukturen kommt, die konstitutiv für die Verstärkung der Eigendynamik von Gewaltökonomien sind.
Schlagwörter: Prozessdynamik, Staatszerfall, private Gewaltakteure, Gewaltökonomie, Eigendynamik
Abstract
This paper focuses on the analysis of mechanisms and internal dynamics that lead to the persistence of markets of violence in internal conflicts. Markets of violence are economic areas based upon violence, in which emerges a self-perpetuating economic system, which can remain stable over several decades. Markets of violence tend to self-reinforcing and autostabilization. From the perspective of the dominant actors in this system, immediate economic agendas become predominant over political motives. These economical agendas constitute vested interests in prolonging the conflict and stabilizing markets of violence. The continuation of the violence represents not so much the collapse of one system as the emergence of an alternative system. By large-scale societal integration, markets of violence develop into self-organising social systems. In such circumstances, the creation of persistent societal structures leads to the stabilization of markets of violence.
Keywords: Internal Dynamics, State-Failure, Non-State Actors, Markets of Violence, Self-Reinforcing Tendencies
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Wandel der Kriegsformen
Gewaltsame innerstaatliche Konflikte in der „Dritten Welt“[1] sind keine Erscheinungen der 1990er Jahre. Doch erst im Zuge der dramatischen weltpolitischen Veränderungen, die durch den Zerfall der Sowjetunion und dem Ende des Ost-West-Gegensatzes eingeleitet wurden, haben veränderte Formen kriegerischer Gewalt in der Kriegsforschung ihren Platz in der Diskussion eingenommen.
Die Analyse des Kriegsgeschehens nach 1945 lässt auf markante Veränderungen schließen. Das auffälligste Ergebnis in der Entwicklung des internationalen Kriegsgeschehens ist der Anstieg der Zahl kriegerischer Konflikte.[2] Seit einem halben Jahrhundert ist eine dramatische Zunahme der weltweiten Kriegsbelastung um durchschnittlich einen Krieg pro Jahr zu verzeichnen. Ein zweiter Befund betrifft die typologische Unterscheidung von Kriegen: während Kriege zwischen Staaten abnehmen, ist ein merklicher Anstieg von innerstaatlichen gewaltsamen Konflikten zu verzeichnen. Der Anteil zwischenstaatlicher Kriege nimmt stetig ab, so dass dieser Typus mit 6 Prozent im Jahr 2002 (AKUF 2002) einen unwesentlichen Anteil aufweist. Somit ist die dominante Form kriegerischer Auseinandersetzung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und zu Beginn des 21. Jahrhunderts der innerstaatliche Krieg und nicht der klassische zwischenstaatliche Krieg. Eine weitere Tendenz stellt die geographische Verteilung der Kriege dar. Das Kriegsgeschehen hat sich von den Zentren bürgerlich-kapitalistischer Welt in die Peripherien verlagert. Über 90 Prozent der Kriege nach 1945 fanden in Regionen der so genannten „Dritten Welt“ statt. (AKUF 2002) Ein vierter Befund betrifft die lange Dauer innerstaatlicher Kriege. Diese bewaffneten Konflikte dauern im Durchschnitt sechsmal so lange wie zwischenstaatliche Kriege. (Collmer 2003: 97)
Diese empirische Befunde verweisen auf das massive Auftreten eines Typus organisierter Gewalt, der nicht der klassischen althergebrachten Vorstellung entspricht. Berichte und Bilder aus den Konfliktregionen Afrikas, Asiens, des Kaukasus, des Nahen Ostens und des Balkans gingen um die Welt. Auch wenn die Geschehnisse vor Ort Spezifika hinsichtlich der Ereignisse, die zum Ausbruch bewaffneter Gewalt führten, aufweisen, so lässt sich aufgrund der Gemeinsamkeiten in ihrem Verlauf die These formulieren, dass es sich hier um ein neues Muster kollektiver gewaltförmiger Auseinandersetzungen handelt. Diese neuen Formen innerstaatlicher Gewalt werden in der Konfliktforschung diskutiert u.a. als „neue Kriege“ (Kaldor), „Privatkriege“ (Hobsbawm), „postnationale Kriege“ (Beck), „ethnopolitische Konflikte“ (Davies/Gurr) etc. Auch wenn teilweise unterschiedliche Terminologien verwendet werden und dabei nur Teilaspekte eines umfassenden Phänomens benannt werden, so machen die Analysen auf einen qualitativen Wandel des Gewaltproblems aufmerksam.
Im Unterschied zur Entwicklung „staatlicher“ Gewaltformen, die mit der Herausbildung und Konsolidierung des Staates seit dem Westfälischen Frieden in Beziehung stehen, deuten die „neuen“ Prozesse kollektiver Gewaltanwendung auf eine Veränderung der Strukturmuster und damit auf eine „Entstaatlichung“ des Krieges und eine damit einhergehende De-Institutionalisierung des Kriegsgeschehens hin. Gewalttätige Konfliktsituationen sind vor allem für die Länder der „Dritten Welt“ typisch, die sich tendenziell durch Staatsschwäche auszeichnen.
Vielfach wird in der Debatte behauptet, dass sich die neuen Kriege hinsichtlich der an ihnen beteiligten Gewaltakteure grundlegend vom alten Krieg unterscheiden. Dabei wird etwa von Eppler (2002), Kaldor (2000) und Münkler (2002) darauf verwiesen, dass für den neuen Krieg eine Privatisierung der Gewaltakteure typisch ist. Das heißt, dass sich im Vergleich zur alten Form des zwischenstaatlichen Krieges nicht „nur“ einige wenige zentral geführte Kampfverbände, sondern zahlreiche zumeist dezentral organisierte Kampfeinheiten wechselseitig bekriegen. Es wird in diesem Zusammenhang von Milizen, Clans, Warlords, Rebellen etc. gesprochen, wobei ihr Organisationsgrad eher als gering einzustufen ist. Damit ist auch unmittelbar die Schwierigkeit verbunden, dass es keine hinreichend klare Differenzierung zwischen den Konfliktparteien gibt.
Neben dem Wandel auf der Struktur- und Akteursebene lassen sich auch auf der Prozessebene bzw. bei der Ablaufdynamik systematische Veränderungen beobachten. Es ist eine allgemeine Brutalisierung des Kampfgeschehens zu vermerken. Ein Kennzeichen und Problem des Wandels ist die fehlende Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten. Die Zivilbevölkerung wird nicht nur häufig das Opfer der Kampfhandlungen sondern sogar bevorzugtes Ziel. Aufgrund dessen sind die Opferzahlen primär in der Zivilbevölkerung zu verorten. Dies ist Resultat systematischer Ausschreitungen. Massaker, Vertreibung und Flucht. Diese Taktik gehört zu den wesentlichen Charakteristika neuer Kriege.
Für diese Form kriegerischer Gewalt ist auch ihre besondere Intensität charakteristisch. Die Konfliktintensität ist meistens gering und zeichnet sich durch sich abwechselnde Phasen der Gewalteskalation und –deeskalation aus. Der zeitlich unregelmäßige Austrag der Kämpfe korrespondiert unmittelbar mit einer enormen Zerstörungskraft und vor allem mit der Verhärtung des Kriegsgeschehens, die in dessen Dauer zum Ausdruck kommt. In diesen Kriegen sind die Grenzen zwischen Krieg und Frieden meistens fließend. Vor diesem Hintergrund verliert das bekannte Axiom von Hugo Grotius, dass es zwischen Krieg und Frieden kein Drittes gebe, an Gültigkeit. Diese Kriege werden nicht offiziell erklärt oder beendet, vielmehr ist das Nacheinander bewaffneter Kämpfe, fragiler Kompromisse und erneuter bewaffneter Kämpfe zu beobachten, ohne dass Sieger oder Verlierer ausgemacht werden können. Entscheidende Schlachten werden gemieden, stattdessen diffundiert die Gewalt in alle gesellschaftlichen Bereiche. Die Folge ist, dass die gewohnte klare Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden, welche dem modernen westlichen Verständnis zugrunde liegt, für diese bewaffneten Auseinandersetzungen nicht mehr getroffen werden kann. Der Krieg gilt nicht mehr als Ausnahmezustand, sondern „normalisiert“ sich. Darin liegt auch die Gefahr, dass der Krieg zu einer regelrechten Lebensform (Münkler 2002, ähnlich van Creveld 1998) wird. Der Konfliktzustand wird von den Konfliktparteien am Schwelen gehalten, er verstetigt sich und es tritt eine Kommerzialisierung des Krieges ein.
1.2 Erklärungsansätze der Forschung
In der Kriegsforschung führten diese veränderten Erscheinungsformen kriegerischer Gewalt zu einer Vielzahl unterschiedlicher Erklärungsansätze und Versuche der Theoriebildung.
In der Zeit der Ost-West-Konfrontation galten sie als Stellvertreterkriege, als Auseinandersetzungen, die man auf die Positionierung auf die Seite der Supermächte zurückführen konnte. Ziele und Motive der in diesen Konflikten beteiligten Parteien konnte man durch ihren Rückgriff auf die Systemkonfrontation als ideologisch bezeichnen. Die Konzentration auf die ideologischen Fassaden trug zugleich zur Übersichtlichkeit und Klarheit im Weltgeschehen bei. Die Selbstpositionierung der Kriegsparteien in die Konfliktlinien des Kalten Krieges verschaffte ihnen Anlehnungs- und Unterstützungsmächte. Durch die Finanzierung und Bewaffnung dieser Kriegsparteien durch die Supermächte begriff man die Ökonomie dieser Bürgerkriege als Teilaspekt der globalen Ökonomie der Systemkonfrontation. (Münkler 2002: 159)
Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts war die Einstufung der lokalen Bürgerkriege als Stellvertreterkriege meist nicht mehr möglich und auch ihr einstiges sozialrevolutionäres Potential hat sich in vielen Fällen verflüchtigt. Viele Konflikte erwiesen sich als resistent gegenüber dem globalen Wandel und widerlegten damit die Stellvertreter-Theorie. Die alten ideologischen Orientierungsmuster waren nicht mehr gegeben und somit entzogen sich solche innerstaatliche Konflikte sowohl einem rational nachvollziehbaren globalstrategischen Kalkül als auch einer ideologischen Interpretation. (Ehrke 2002: 5)
Die ideologische Motivation der Akteure wurde in der Konfliktforschung durch ethnische und religiös-kulturelle Konfliktlinien ersetzt. „Conflicts have frequently been explained as the result of intractable ethnic hatreds or a descent into tribal violence and anarchy. (Keen 2000: 20)” Durch die Dominanz ethnischer und religiöser Antagonismen, atavistischer Hass, die Ideologien und geopolitische Interessen verdrängt haben, wurden diesen Konflikten Irrationalität bescheinigt.
„Many analysts have stressed the irrationality and unpredictability of contemporary civil warfare, portraying it as evil, medieval, or both. Contemporary civil conflicts often give the appearance of mindless ans senseless violence, with a proliferation of militias, chains of command breaking down, and repeated brutal attacks on civilians. (Keen 2000: 20)”
Für viele Beobachter „ist die politische Gewalt zu einem blindwütigen, irrationalen und unerklärbaren Phänomen geworden und stellt eine diffuse, vielgestaltige, aber letztlich doch eindeutige Bedrohung dar. (Jean/Rufin 1999: 8)“ Autoren wie Robert Kaplan sprachen gar von „coming anarchy“ und sahen in der Gesetzlosigkeit in der „Dritten Welt“ einen düsteren Trend (Kaplan 1994).
In den neueren wissenschaftlichen Arbeiten zu Gewaltökonomien haben die Autoren der Dämonisierung dieser Konflikte und ihrer Verbannung in den Bereich des Irrationalen entgegengehalten, dass auch oder gerade Gewaltakteure in innerstaatlichen Konflikten ökonomische Motive haben und dass es unter bestimmten Bedingungen individuell oder kollektiv rational sein kann, Gewalt anzuwenden. (vgl. Elwert 1997, Keen 2000, Münkler 2002) Zudem wird die Überwindung von Irrationalismen und die allmähliche Umstellung des Verhaltens von Leidenschaften auf Interessen, von überkommenen Bindungen auf individuelle Zweckrationalität gefordert. In diesem Zusammenhag wird in der Literatur auf die Zunahme ökonomischer Handlungslogiken im Sinne einer Ökonomisierung des Krieges aufmerksam gemacht, die nicht nur zur Verfestigung von Kriegssituationen führe, sondern auch ein Indiz dafür sind, dass sich Krieg wieder lohnt. Damit gerät die Ökonomie innerstaatlicher Konflikte und die ökonomische Motivation der Akteure verstärkt ins Blickfeld der Analyse.
Durch die Betonung der ökonomischen Dimension in gegenwärtigen innerstaatlichen Kriegen bedarf die Clausewitzsche Vorstellung vom Krieg als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln einer Modifizierung. „To paraphrase Carl von Clausewitz, war has increasingly become the continuation of economics by other means.“ (Keen 1998: 11)
Der Krieg, so wird in der Debatte über neue und alte Kriege vielfach behauptet, hat sich hinsichtlich der Versorgungsstrukturen der Kampfverbände grundlegend gewandelt. So spricht man in der Literatur (Elwert 1997, Rufin 1999, Kaldor 2000) von einer neuartigen Gewaltökonomie bzw. einer neuen Kriegswirtschaft. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass mit der veränderten Gewaltökonomie veränderte Gewaltmotive einhergehen. (Münkler 2002, Elwert 1997, Keen 1998) Danach beginnen in den neuen Kriegen insbesondere kurzfristige ökonomische Gewaltziele die bislang dominanten ideologischen und identitätsbezogenen Gewaltmotive zu überlagern. Es kommt zu einer Ökonomisierung der Gewaltziele. Das entscheidende Argument ist dabei, dass durch die Herausbildung von Gewaltökonomien die an dem Konflikt beteiligten Parteien ökonomisch begünstigt werden und aufgrund dessen sind sie an der Verstetigung der Gewaltökonomie und der Perpetuierung des Konfliktzustandes interessiert. Diese Feststellung stellt die Kriegsforschung, wie von Mats Berdal und David Malone zu Recht vermerkt wurde, vor völlig neue Herausforderungen:
„(…) the nature of these war economies challenge many of the core assumptions that have informed thinking and duided policy with respect to civil wars and internal conflict in the 1990s. Indeed, in some of the cases examined, what is usually considered to be the most basic of military objectives in war – that is, defeating the enemy in battle – has been replaced by economically driven interests in continued fighting and the institutionalization of violence (...)” (Berdal/ Malone 2000: 2)
1.3 Fragestellung, zentrale Annahmen und Aufbau der Arbeit
Die These, dass eine Wechselbeziehung zwischen Gewaltökonomie und Konfliktdynamik besteht und dass der Zustand der Instabilität und permanenter Gewalt auf das Kalkül der Akteure, das unmittelbar mit dem Bestreben nach ökonomischer Ausbeutung und Institutionalisierung direkter Herrschaft zusammenhängt, zurückzuführen ist, wurde in vielen Fallstudien (Jean/Rufin 1999, Reno 1999) untersucht. Noch aber fehlt eine systematische Untersuchung der Faktoren, die zur Persistenz von Gewaltökonomien[3] führen.
Ziel der Arbeit ist es daher, durch die Untersuchung und Diskussion der Literatur zu innerstaatlichen Kriegen und zu aktuellen Gewaltökonomien zu einem besseren Verständnis ihrer Formen, Mechanismen und Ablaufdynamiken zu gelangen. Denn gegenwärtige Gewaltökonomien, so die zentrale These dieser Arbeit, setzten ihre eigene Dynamiken frei, die maßgeblich zu ihrer Persistenz beitragen. Im Zentrum der Analyse stehen die Funktionsweisen der Gewaltökonomie, wobei der Schwerpunkt auf den Einfluss der Mechanismen der Gewaltökonomie auf das Handeln der Akteure und ihren Beitrag zur Stabilisierung und Verstetigung dieser ökonomischen Strukturen liegt.
Diese Arbeit beruht auf drei grundlegende Annahmen, die explizit oder implizit in die Analyse eingehen und die Perspektive auf den Untersuchungsgegenstand vorstrukturieren. Aus Gründen der Transparenz sollen im Folgenden diese zentralen Annahmen skizzenhaft dargestellt werden.
Die erste Annahme postuliert einen tief greifenden Wandel in der Bedeutung und Funktion der Kriegsökonomie. In den traditionellen zwischenstaatlichen Kriegen erlangte die Kriegswirtschaft eine strategische und sogar kriegsentscheidende Bedeutung. Dementsprechend wurden die Rüstungsindustrie und andere militärisch wichtige Produktionszweige durch die Regierung und militärische Führung durch direkte planerische Vorgaben stark forciert. Die traditionelle Kriegsökonomie zeichnete sich also durch die Zentralisierung der ökonomischen Entscheidungen aus. Die Kriegswirtschaft wird an die Erfordernisse der militärischen Führung angepasst und dem Kriegsziel untergeordnet. (Aust 2001: 33ff) Im Gegensatz dazu sind Gewaltökonomien Ökonomien ohne staatliches Gewaltmonopol. Die Märkte in Gewaltökonomien sind unreguliert und ungeschützt und stellen deswegen die Akteure vor andere Optionen. Die Gewaltökonomie darf man nicht mit dem Verschwinden der Ökonomie gleichsetzen. Es kommt vielmehr zu einer Transformation der ökonomischen Formen.
Mit dem Begriff der Transformation hängt die zweite Ananahme zusammen, nämlich, dass ein innerstaatlicher Konflikt nicht zugleich den völligen gesellschaftlichen Zusammenbruch bedeutet. Gerade in lang andauernden innerstaatlichen Konflikten bilden sich gesellschaftliche Ordnungsformen heraus, die an den Konfliktzustand angepasst sind. Es kommt also zu sozialen Wandlungsprozessen innerhalb der Gesellschaft.
Die dritte Annahme knüpft an die Rationalität der in der Gewaltökonomie involvierten Gewaltakteure an. Die Akteure in einer Gewaltökonomie weisen ein wirtschaftliches Handeln auf, das sich durch eine Kosten-Nutzen-Abwägung auszeichnet. Dieser Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass wirtschaftliches Handeln stets sozial eingebettet ist. Dieses Wirtschaftsverständnis ist auf Polanyi zurückzuführen, der diesen substantivistischen Wirtschaftsbegriff in die Diskussion eingeführt hat. Demnach ist Wirtschaft ein Prozess gegenseitiger Einwirkungen von Mensch und Umgebung sofern dieser Prozess der materiellen Bedürfnisbefriedigung dient. (Polanyi 1979: 215)
Die vorliegende Arbeit ist inhaltlich in fünf Kapitel gegliedert. Im Folgenden sollen die einzelnen analytischen Schritte konkretisiert werden.
Ausgehend von der These, dass in Bezug auf die gewandelten Formen kriegerischer Gewalt in der Kriegsforschung noch „Handlungsbedarf“ besteht, wird im Kapitel I in einem ersten Schritt auf zwei zentrale Probleme der traditionellen Kriegsforschung hingewiesen. Das ist zum einen die Schwäche der Disziplin zur angemessenen begrifflichen Erfassung gegenwärtiger innerstaatlichen Konflikte. Denn in den meisten Studien der Kriegsforschung das Konzept des modernen Nationalstaats als Ausgangspunkt der Analyse fungiert und dementsprechend bleibt der zwischenstaatliche Krieg im Zentrum der Disziplin. Zum zweiten ist das die Tatsache, dass die Forschung zum Gegenstand Krieg eine primäre Ausrichtung auf die Kriegsursachen aufweist. Einer wissenschaftlichen Annäherung an die internen Dynamiken und Prozesse von Kriegen sowie im Verlauf von lang andauernden innerstaatlichen Kriegen oftmals entstehenden persistenten Strukturen wurde bislang nur wenig Aufmerksamkeit zugeteilt. Da es aber nur ein tragfähiges Konzept von Wandel erlaubt die internen Dynamiken und sozialen Prozesse zu begreifen, wird auf die Annahmen der Theorie des sozialen Konstruktivismus als Strukturierungskomponente dieser Arbeit zurückgegriffen. Grundlegend wird dabei die Akteur-Struktur-Debatte sein, die sich nicht so stark durch normative Implikationen auszeichnet, sondern als Analyserahmen, mit dem gesellschaftliche Prozesse zum Vorschein gebracht werden können. Dabei wird das Entstehen und Wandel solcher Prozesse als das Resultat der Wechselbeziehungen zwischen Struktur und dem Handel individueller und kollektiver Akteure verstanden. Auf die Gewaltökonomie übertragen muss erstens geklärt werden, welche strukturellen Rahmenbedingungen das „Entstehen“ und die Verstetigung der Gewaltökonomie begünstigen und zweitens welche Motive und Interessen die privaten Gewaltakteure haben.
In einem zweiten Kapitel wird aufgrund dessen auf die State-Failure-Debatte eingegangen. Eine wesentliche Rolle spielen in diesem Abschnitt die internationalen und innerstaatlichen Ursachen für Staatszerfall. Des Weiteren werden die in der Literatur diskutierten Konzepte von Staatszerfall analysiert und die einzelnen Etappen und deren Charakteristika diskutiert, um zu einem Gesamtkonzept der strukturellen Vorbedingungen für das Entstehen von Gewaltökonomien zu gelangen.
Unmittelbar mit dem Staatszerfall und dem Verlust des staatlichen Gewaltmonopols ist die Privatisierung der Gewalt verbunden. Das dritte Kapitel ist dann der Gewaltakteure gewidmet. Die Akteurskonstellation in den neuen Kriegen ist durch eine Unübersichtlichkeit, multiple Identitäten und Diffusität gekennzeichnet. Aufgrund dessen kann man nicht alle Gewaltakteure in die Betrachtung einbeziehen. Der Hauptaugenmerk fällt deswegen auf folgende Gruppen: Warlords, Rebellen und kollektive Kriminalität. Es wird versucht die Hauptcharakteristika, Motive und Ziele dieser Gruppen herauszuarbeiten. Die Motive werden dann nach politischen/wirtschaftlichen typologisiert, um zu erste Erkenntnisse für das Handeln dieser Akteurskonstellationen zu gelangen.
Im vierten Kapitel dieser Arbeit werden die Formen und Charakteristika von Gewaltökonomien nachgezeichnet sowie verschiedene Mechanismen und Funktionsweisen der Gewaltökonomie vorgestellt. Im Anschluss daran wird die These untersucht, dass es eine Wechselbeziehung zwischen der Gewaltökonomie und die Konfliktdynamik gibt. Des Weiteren werden die freigesetzten Dynamiken diskutiert und ihren Einfluss auf die Persistenz der Gewaltökonomie analysiert.
Im Anschluss daran werden im fünften Kapitel die Auswirkungen der freigesetzten Eigendynamik auf die strukturellen Rahmenbedingungen und auf die Konstellationen der privaten Akteure untersucht. Der Schwerpunkt in diesem Abschnitt liegt jedoch auf das gesellschaftliche Integrationspotential von Gewaltökonomien und ihre Entwicklung zu umfassende Gesellschaftssysteme.
2 Stand der Kriegsforschung
2.1 Staatszentriertheit der Kriegsforschung
Die Bedeutung der Begriffsbildung für die Erforschung des Krieges ist frühzeitig erkannt worden. Und doch, gibt es in der Kriegs- und Konfliktforschung keine klare und allgemein akzeptierte Definition des Krieges. (Chojnacki 2003: 2) Ein zentrales Problem sozialwissenschaftlicher Forschung stellt die Tatsache dar, dass sie auf Begriffe angewiesen ist, die eine stabile Identität des bezeichneten Gegenstands postulieren, obwohl sich dieser Gegenstand in der Zeit verändert. Die Vorstellung, mit dem Begriff des „Krieges“ werde ein überzeitliches und unveränderliches Muster menschlicher Interaktion bezeichnet, ist zwar die Voraussetzung analytischer Forschung, doch zugleich ihr Problem. Denn sie berücksichtigt nicht, dass sich zentrale Merkmale des Krieges ändern können, die ehemals zu denen gehörten, die ihn begrifflich bestimmten. (Daase 2003: 165f) Dass die wissenschaftliche Fassung des Gegenstandes „Krieg“ umstritten ist, hat seinen Grund nicht zuletzt in dessen politischen Charakter. Denn in jedem einzelnen Fall hat die Kennzeichnung eines Konfliktes als Krieg auch immer eine politische Konnotation. Zudem bestimmen neben politischen Absichten und Haltungen auch der allgemeine Sprachgebrauch und sein Niederschlag in „offiziellen“ Texten und Zeitungen die Verwendungsweisen des Begriffs (Schlichte 2002:113).
Für den Umstand, dass der Begriff des „Krieges“ seit den neunziger Jahren besonders umstritten ist, führt Daase (1999) die These an, dass der Kriegsbegriff immer weniger der Kriegswirklichkeit entspricht. Das hängt unmittelbar mit den vorherrschenden Perspektiven auf den Kriegsbegriff, die sich in den Politikwissenschaften etabliert haben. Beide basieren noch weitgehend auf einem europäischen Politikverständnis, das von Nationalstaaten als Akteure ausgeht. Dabei wird das Merkmal der Staatlichkeit mindestens eines Akteurs als Abgrenzungskriterium vorausgesetzt, um den Krieg von anderen Formen organisierter Massengewalt zu unterscheiden. Demnach wird Krieg entweder als institutionalisierter Rechtzustand verstanden, d.h. als legitime und verregelte Form des Konfliktaustrags zwischen Staaten bzw. ihren regulären Armeen (vgl. Wright 1965), oder aber es wird auf das instrumentell – politische Kriegsverständnis nach Clausewitz zurückgegriffen. Letzterem zufolge ist Krieg ein rationales Mittel zur Durchsetzung von Staatsinteressen und deswegen eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln zur Erreichung militärischer Ziele, um dem Gegner seinen politischen Willen aufzuzwingen (vgl. Clausewitz 1980). Doch die meisten politischen Konflikte der Gegenwart entsprechen nicht mehr diesem Muster. Sie sind in der Mehrzahl innerstaatliche Konflikte und haben, wenn überhaupt, nur auf einer Seite einen staatlichen Akteur (vgl. Holsti 1996, Daase 1999).
Die Folge ist, dass zum einen der Kriegsbegriff und empirische Wirklichkeit aufgrund des Formwandels politischer Gewalt (vgl. Kap.1) zunehmend auseinander klaffen. Zusätzlich wird die Identifizierung von Staatlichkeit europäischer Prägung immer problematischer in Bezug auf jene Kriege, in denen Staatlichkeit kaum institutionalisiert ist wie in Afghanistan, Sierra Leone, DR Kongo. Die Identifizierung des Merkmals der Staatlichkeit mindestens einer der Akteure ist in diesen Fällen eine politische, nicht aber wissenschaftliche Entscheidung. (Schlichte 2002:114) Zum anderen wird in der Kriegsforschung eine analytische Unterscheidung zwischen „eigentlichen“, d.h. zwischenstaatlichen und „uneigentlichen“, d.h. innerstaatlichen Kriegen getroffen. Damit geht zwangsläufig eine moralische Bewertung der „normalen“ Kriege zwischen Staaten und „pathologischen“ Kriege zwischen Gruppen einher. (Daase 1999: 77)
Wenn aber der Begriff des „Krieges“ nicht mehr eine wissenschaftlich geeignete Analysekategorie darstellt und seinen empirischen Gegenstand nicht mehr voll erfasst, dann entsteht die Neigung, den Begriff in unterschiedlicher, sich gegenseitig in Frage stellender Weise, zu gebrauchen.[4]
2.2 Ursachenfixiertheit der Kriegsforschung
Eine zweite Schwäche sozialwissenschaftlicher Kriegsforschung besteht in ihrer Fixierung auf Ursachen. Damit ist die klassische Kriegsforschung in den Internationalen Beziehungen in erster Linie Kriegsursachenforschung. Diese Tatsache ist dadurch zu erklären, dass der Krieg weniger als soziale Institution denn als ein Ereignis angesehen wird. In der traditionellen Kriegsforschung wird der Krieg weniger als ein Regelsystem wahrgenommen und analysiert denn als Zusammenbruch aller Regeln. (Daase 1999: 83) Aufgrund der Konzeption des Krieges als eine Katastrophe, steht die Analyse seiner Verursachung in den Vordergrund.
Als Musterbeispiel traditioneller Kriegsforschung gilt das Correlates of War Project (COW), das vor mehr als drei Jahrzehnten unter der Leitung von David Singer an der University of Michigan begann und inzwischen als COW2 an der Pennsylvania State University fortgesetzt wird.
Das Vorgehen dieser Schule ist am Behavioralismus orientiert und daher streng induktiv: Nicht die Formulierung von theoretisch informierten Thesen und theoretische Zusammenhänge sollen die Erkenntnis anleiten, sondern die möglichst umfassende datenbasierte Erfassung des „historical record“ (Singer 1990). Das Ziel dieser Forschungsrichtung war und ist die Aufdeckung jener „Gesetze“, die nach dem covering-law-Modell der naturwissenschaftlichen Erklärung für alle Fälle geltende Ableitungen des empirischen Vorkommens von Kriegen bietet (Schlichte 2002:116). Damit liegt der Schwerpunkt dieser Schule auf die Identifizierung von Kriegsursachen mittels statistischer Korrelationen. Problematisch ist jedoch, dass sich aus quantitativen Korrelationsaussagen keine kausalen Erklärungen ableiten lassen. (Daase 1999: 88)
In seinem Artikel „Beyond Correlations: Toward a Causal Theory of War“ setzt sich David Dessler für eine kausale Theoriebildung durch die Analyse von „[…] causal mechanism that produce a certain kind of change […]“ ein. (Dessler 1991: 351). Dieses Verständnis von Kausalität beruht auf der Vorstellung, dass bestimmte ursächliche Kräfte und prozessuale Faktoren identifiziert werden können, ohne die bestimmte Ereignisse nicht zustande gekommen wären. Nach dieser Konzeption von Kausalität können Kriege erst dann als „erklärt“ gelten, wenn die ihnen zugrunde liegenden Faktoren analysiert und als notwendige, wenn auch nicht hinreichende Ursachen festgestellt werden können (Dessler 1991: 352).
Doch keiner von diesen Ansätzen hat zu eindeutigen Erkenntnissen über die Ursachen des Krieges geführt. Die Hauptproblematik ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass unterschiedliche Bedingungen und Ereignisfolgen zum gleichen Ergebnis führen können. Somit können die eigentlichen Ursachen empirisch nicht isoliert werden. Gleichzeitig können aber die gleichen Bedingungen und Ereignisfolgen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dadurch erscheint es wieder als problematisch eine spezifische Ursache für einen bestimmten Krieg zu identifizieren. Hinzu kommt, dass Kriege die Tendenz aufweisen sich von ihren ursprünglichen Ursachen und Zielen zu verselbständigen, d.h. dass sich Kriege von ihren Ursprüngen lösen und in ihrem Verlauf Dynamiken und Prozesse anstoßen, die den Krieg unabhängig von seinen originären Ursachen vorantreiben. Eine Kausalanalyse, die die Dynamiken im Verlauf des Krieges ausblendet, greift folglich zu kurz. (Endres 2004: 17f)
Aufgrund dieser Schwierigkeiten liegen keine gesicherten Ereignisse der Kriegsursachenforschung vor. (Daase 1999: 81) Vor diesem Hintergrund erscheint der Übergang von der Ursachenforschung hin zur Analyse der Wirkungszusammenhänge als eine logische Lösung. Durch die Betonung der Erforschung des Krieges als Prozess, können die Gesetze und Dynamiken besser analysiert werden. Durch die Berücksichtigung der Prozesshaftigkeit können gängige Kategorisierungen (Definition des Krieges als statische Größe) überwunden werden und den Krieg als eine wandelbare soziale Interaktionsform begreifen. (Daase 1999: 82) Erst durch das Verständnis des Krieges als Prozess, nicht als Ereignis oder gar Chaos, kann seine strukturbildende und –verändernde Kraft zum Gegenstand der Analyse werden. Denn in dem Maße, indem sich die Praxis des Krieges verändert, wandeln sich auch Akteure und Strukturen und umgekehrt.
2.3 Entwicklung eines Analyserahmens
In dem vorausgehenden Abschnitt wurde es deutlich, dass die Grundkonzepte der Kriegsforschung aufgrund ihrer terminologischen Festlegungen und Ursachenfixiertheit ungeeignet sind, die aktuellen Kriegsereignisse und die mit ihnen zusammenhängenden Wandlungsprozesse in der internationalen Politik zu erfassen. Um die Veränderungen des Kriegsbildes nachvollziehen zu können, ist ein Verständnis von Prozessualität und Wandel notwendig, denn ohne theoretischen Bezugsrahmen gibt es nur ad hoc - Erklärungen von Einzelereignissen, nicht jedoch ein systematisches Verständnis von sozialen Phänomenen und historischen Trends. Um Beobachtungen zu sozialen Prozessen theoretisch fassen zu können, bietet sich der Rückgriff auf Erkenntnisse und Annahmen der Theorie des sozialen Konstruktivismus. Entscheidend ist dabei die Erkenntnis, dass mit der traditionellen Frage nach der Ursache, nicht nach dem Prozess zu unterschiedlichen Zeitpunkten sich Unterschiede eines Systems feststellen lassen, doch der Veränderungsprozess selber entzieht sich gänzlich der Analyse. Sozialer Wandel kann damit lediglich post festum festgestellt[5] und nicht explizit zum Gegenstand der Forschung gemacht werden. Deswegen kommt es darauf an, von der einseitigen Kausalanalyse - das Erstellen von allgemeinen Sätzen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge - zu einer Prozessanalyse überzugehen. Dadurch kann der Übergang von der Analyse der Strukturen oder Handlungen der Akteure auf die Prinzipien der sie erzeugenden oder verändernden Praxis vollzogen werden.
2.3.1 Grundannahmen des Konstruktivismus
In dem Konstruktivismus als Theorie der Internationalen Beziehungen ist eine Reihe von unterschiedlichen Ansätzen subsumiert. Als kleinster gemeinsamer Nenner fungiert die Ausgangsannahme, dass Realität nicht unmittelbar vorgegeben ist, sondern, dass „soziale Welt“ durch die Art und Weise der Interaktion mit anderen, auf der Grundlage geteilter Vorstellungen über „Welt“ und wie wir unsrer Umwelt erfahren, konstruiert wird. Je nach Standpunkt wird der Konstruktivismus als Methode (Chekel 1998:325), Forschungsansatz (Hopf 1998: 196) oder als „allgemeine theoretische Orientierung“ (Katzenstein/Keohane/Krasner 1998: 646) konzeptualisiert. Zwischen diesen Autoren besteht weitgehend Übereinkunft darüber, dass Konstruktivismus keine substanzielle, also keine inhaltlich angereicherte Theorie der Internationalen Beziehungen ist. In der Literatur besteht Konsens auch darin, dass der schnelle Einzug konstruktivistischer Ansätze in den Internationalen Beziehungen auf realhistorische und disziplinspezifische Gründe zurückzuführen ist (Ulbert 2003: 393).
Ende der 1980er Jahre setzte eine theoretische Debatte ein, die von Yosef Lapid als die „Dritte große Debatte“ bezeichnet wurde (Lapid 1989). Als konstitutiv für diese Debatte zwischen positivistischen und post - positivistischen Ansätzen galt die intensive Auseinandersetzung mit den wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Disziplin. Dabei wurden die zahlreichen Annahmen über die Beschaffenheit des Untersuchungsgegenstandes wie Anarchie oder Souveränität in Frage gestellt.
Die Ereignisse nach dem Ende des Ost-West-Konflikts beschleunigten zusätzlich die Suche nach neuen theoretischen Erklärungsmuster, denn mit dem Ende des Kalten Krieges haben viele Wissenschaftler der Internationalen Beziehungen nicht nur das „Ende der Geschichte“ (Fukuyama 1992), sondern auch das „Ende der Theorie“ (Allan 1992) beschworen. Vor diesem Hintergrund konnte sich Mitte der 1990er Jahre der von Nicholas Onuf (1989) verwandte Begriff „Konstruktivismus“ durchsetzen. Damit werden in den Internationalen Beziehungen drei zentrale Themenbereiche gekennzeichnet. Die gegenseitige Konstituierung von handelnden sozialen Akteuren und den sozialen Strukturen, die sie herstellen und die ihnen wieder als etwas scheinbar Objektives entgegentreten, die also zur Einschränkung ihrer Handlungsperspektiven beitragen. Die Bedeutung von Ideen, Interpretationen, durch die die materielle Welt erst ihren Sinn und ihre Bedeutung erhält. Und schließlich die Rolle von konstitutiven Regeln und Normen, sowie die endogene Herausbildung von Interessen und Identitäten (Krell 2003: 341f).
2.3.2 Akteur-Struktur-Debatte
Für die Fragestellung dieser Arbeit ist vor allem der erste Themenaspekt von Bedeutung. Checkel fasst dieser wie folgt zusammen:
„Constructivists emphasize a process of interaction between agents and structures; the ontology is one of mutual constitution, where neither unit of analysis – agents or structures – is reduced to the other (…)“ (Checkel 1998: 326).
Mit dieser Aussage betont Checkel das Anliegen konstruktivistischer Autoren die Interaktion zwischen Akteuren und Strukturen in den Mittelpunkt der theoretischen Analyse zu bringen.
Die Debatte um das Verhältnis zwischen Akteuren und Strukturen wurde in den Internationalen Beziehungen zunächst von Alexander Wendt in seinem Aufsatz „The Agent-Structure Problem in International Relations Theory“ thematisiert (Wendt 1987). Dabei ist die Akteur-Struktur-Debatte weder neu noch auf die Internationalen Beziehungen beschränkt. Sie ist in allen Sozialwissenschaften präsent und ist unter verschiedenen Namen anzutreffen. In der Soziologie wird diese Debatte seit Jahren als Mikro/Makro-Problematik diskutiert (Daase 1999: 41).
Kern dieser Problematik bildet der Umstand, dass aus sozialwissenschaftlicher Perspektive das Handeln von Akteuren immer in bestimmte Strukturen eingebettet ist. Daher gibt es prinzipiell zwei Herangehensweisen zur Erklärung sozialer Phänomene, nämlich durch akteursorientierte Handlungstheorien oder strukturorientierte Systemtheorien. Die einen argumentieren unter Bezugnahme auf die jeweiligen Akteure und deren Merkmale, wobei soziale Phänomene als Resultat der individuellen Handlungen von Akteuren (individualistische Erklärung) zu betrachten sind. Für die anderen stellen die Strukturen, in denen Handlungen eingebettet sind (strukturalistische Erklärung), den Ausgangspunkt dar (Ulbert 2003: 397).
Beiden Perspektiven wirft jedoch Wendt Reduktionismus vor, denn sie verkürzen unzulässig die Komplexität internationaler Politik. Er begründet dies dadurch, dass jede Entscheidung für eine Grundeinheit impliziert, dass eine davon der anderen ontologisch vorausgeht. Sie ist somit in gewisser Weise fundamentaler als die andere. Wendt behauptet, dass eine Entscheidung für eine Analyseebene nicht nur eine theoretische Vorentscheidung ist, die die Wirklichkeit verzerrt, sondern dass durch diese Herangehensweise die Merkmale und kausalen Wirkungen der jeweiligen Grundeinheiten nicht hinreichend erklärt werden können (Ulbert 2003: 399). Wendt versucht diese Problematik zu überwinden, indem er Anthony Giddens` Strukturierungstheorie aufgreift (Giddens 1984). Giddens hat vorgeschlagen, um eine Komplexitätsreduzierung zu vermeiden, so genannte „Strukturierungsprozesse“ zu untersuchen. Seine Theorie geht von der gegenseitigen Beeinflussung zwischen Akteur und Struktur aus. Diesen Ansatz der Strukturierung hat Wendt auf die Internationalen Beziehungen übertragen. Konkret bedeutet das, dass weder der Akteur, noch die Struktur als gegeben vorausgesetzt werden sollen. Wendt betont den gleichen ontologischen Status von Akteuren und Strukturen, ohne dass eines von beiden vorgezogen oder nachgeordnet wird. Beide Einheiten sind in diesem Sinne kodeterminiert und konstituieren sich gegenseitig (Wendt 1987: 339f).
Dies impliziert, dass Strukturen konstitutiv für Akteure und deren Interessen sind und dass Akteure durch ihr Handeln die Strukturen immer wieder reproduzieren und aufrechterhalten, aber auch verändern können. Es sind die Strukturen, materielle Rahmenbedingungen oder immaterielle Normen, die den Bezugspunkt von Entscheidungen und Handlungen der Akteure darstellen. Strukturen wirken dabei nicht nur verhaltensbeschränkend, durch sie werden vielmehr die jeweiligen Spielregeln festgelegt. Somit wird den Akteuren einen gewissen Handlungsrahmen mit einem Set von Handlungsmöglichkeiten vorgegeben, die dann die Grundlage für soziale Interaktion bilden (Wendt 1987: 356ff). Strukturen ermöglichen erst soziales Handeln, sie determinieren es jedoch nicht. Handeln ist nicht vorherbestimmt, wohl aber in seiner Prozesshaftigkeit ständig einer Eigenbeobachtung und Überprüfung des handelnden Subjekts unterworfen. Handeln ist deswegen sozial, weil es Regeln voraussetzt und gleichzeitig bestimmten Regeln folgt. Ein Akteur wird bestimmt durch die Fähigkeit und das Bewusstsein zu handeln, d.h. er ist sich der Alternativen zu den von ihm gewählten Handlungen bewusst und weiß generell, wie man handelt. Allerdings macht die Tatsache, dass es auch zu unbeabsichtigten Folgen von Handeln kommt, die Begrenztheit menschlicher Reflexivität deutlich. Die Wahl einer bestimmten Handlungsvariante wird aus der akteursbezogene Perspektive erklärbar, denn das Handeln der Akteure ist eigenverantwortlich und zielgerichtet vollzogen. Akteure sind durchaus in der Lage bewusste Entscheidungen zu treffen. Sie alleine entscheiden darüber, ob sie ihr Handeln veränderter Strukturen anpassen, d.h. auch ihr Verhalten schlussendlich auch ändern oder ob sie sich strukturellen Zwängen beugen oder gegen sie handeln (Aust 2001: 87f). Die Akteure treffen selber die Wahl, zu welcher von den strukturellen Handlungsmöglichkeiten sie letztendlich tendieren. Das Handeln der Akteure ist damit durch Reflexivität und Rationalität geprägt. Neben bewussten Versuchen der Akteure, auf die gesellschaftliche Wirklichkeit einzuwirken, strukturieren sie auch unbewusste Einflüsse sowie Einflüsse, die die Handlungsoptionen der Akteure berühren.
Durch die Betonung des Konstruktivismus auf die Struktur- und Akteursseite und die gleichzeitige Einbeziehung dieser beiden Perspektiven in die Analyse, trägt diese Theorie maßgeblich zur Erklärung von sozialen Prozessen. Zugleich werden auch die kausalen Faktoren auf beiden Ebenen nachvollziehbar. Soziale Prozesse können demnach nur in dem Interaktionsrahmen zwischen strukturellen Rahmenbedingungen und konkreten Akteurshandeln analysiert und erklärt werden.
3 Die State Failure – Debatte
Das Phänomen des „Staatszerfalls“ wird seit Beginn der 1990er Jahre vor allem im angelsächsischen Raum intensiv diskutiert. Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeiten liegt im Wesentlichen auf Definition und Analyse des Phänomens, doch eine einheitliche Definition konnte sich bisher nicht durchsetzen. Joschka Fischer beschrieb einst das Phänomen des Staatszerfalls als die „schwarzen Löcher der Ordnungslosigkeit, der Unterentwicklung und der Verzweiflung“. (Fischer 2001: 16) Ein ähnliches Verständnis hat auch der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros Boutros Gali, der Staatszerfall und seine Begleiterscheinungen wie folgt charakterisiert:
„A feature of such conflicts is the collapse of State institutions, especially the police and judiciary, with resulting paralysis of governance, a breakdown of law and order, and general banditry and chaos. Not only are functions of government suspended, its assets destroyed or looted and experienced officials are killed or flee the country. This is rarely the case in interstate wars. “ (Boutros Gali 1995: 9)
Für Staatsgebilde, deren Institutionen und Ordnungsmacht unter dem Druck und im Gewirr gesellschaftlicher Gewaltausbrüche ganz oder teilweise untergegangen sind, haben sich im Englischen die Bezeichnung “failed states” (“gescheiterte Staaten”) und im Französischen “ Etats sans gouvernement” (“Staaten ohne Regierungsgewalt”) eingebürgert. Doch nach Daniel Thürer sind beide Ausdrücke ungenau. Er ist der Auffassung, dass die Bezeichnung der Staatlichkeit als „gescheitert“ zu weit führt, denn auch das Gegenextrem, nämlich der aggressive, tyrannische oder totalitäre Machtstaat nach den normativen Maßstäben der modernen Völkerrechtsordnung auch als „gescheitert“ gilt. Die Formel „Staat ohne Regierungsgewalt“ ist für ihn demgegenüber zu eng, da im Staatsgebilde nicht nur die Regierung, sondern sämtliche Staatsfunktionen in sich zusammengebrochen sind. (Thürer 1999: 276f)
In einem Interview bezeichnet Ted Gurr, Mitglied der State Failure Task Force, den Begriff “state failure” als „umbrella term, that sometimes means whatever people want it to mean.” (Gurr, Interview mit Rachel Stohl) Dazu stellt Clapham zutreffend fest:
“the ‘failed state’ is one of those unsatisfactory categories that is named after what it isn`t, rather than what it is. The phrase carries embedded within it the conception of a global order that, at any rate, ought to be composed of states, and suggest that where this conception is not realised, something is gone wrong.” (Clapham 2000)
[...]
[1] Dieser Begriff ist aufgrund seiner Heterogenität in der Wissenschaft stark umstritten, deswegen wird er im Folgenden in Anführungszeichen verwendet.
[2] Dieser empirischen Feststellung liegt die Kriegsdefinition der Hamburger AKUF zugrunde. Demzufolge wird Krieg als einen bewaffneten Massenkonflikt definiert, der folgende Merkmale aufweist:
„(a) an den Kämpfen sind zwei oder mehr bewaffnete Streitkräfte beteiligt, bei denen es sich mindestens auf einer Seite um reguläre Streitkräfte (Militär, paramilitärische Verbände, Polizeieinheiten) der Regierung handelt;
(b) auf beiden Seiten muß ein Mindestmaß an zentralgelenkter Organisation der Kriegführenden und des Kampfes gegeben sein, selbst wenn dies nicht mehr bedeutet als organisierte bewaffnete Verteidigung oder planmäßige Überfälle (Guerillaoperationen, Partisanenkrieg usw.);
(c) die bewaffneten Operationen ereignen sich mit einer gewissen Kontinuierlichkeit und nicht nur als gelegentliche, spontane Zusammenstöße, d.h. beide Seiten operieren nach einer planmäßigen Strategie, gleichgültig ob die Kämpfe auf dem Gebiet einer oder mehrerer Gesellschaften stattfinden und wie lange sie dauern.“
1993 führte die AKUF noch die Kategorie der bewaffneten Konflikte ein. „Als bewaffnete Konflikte werden gewaltsame Auseinandersetzungen bezeichnet, bei denen die Kriterien der Kriegsdefinition nicht in vollem Umfang erfüllt sind. In der Regel handelt es sich dabei um Fälle, in denen eine hinreichende Kontinuität der Kampfhandlungen nicht mehr oder auch noch nicht gegeben ist.“ (http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/kriege_aktuell.htm)
Eine nähere Begriffsbestimmung wird im zweiten Teil dieser Arbeit vorgenommen.
[3] Bewusst wird in dieser Arbeit der Begriff „Gewaltökonomie“ in Abgrenzung zu dem Begriff „Kriegswirtschaft“ verwendet, da (1) der Verfasser die These vertritt, dass die Übertragung des Begriffes „Krieg“ auf die Konflikte in der „Dritten Welt“ vor dem Hintergrund der Staatszentriertheit dieses Begriffes problematisch ist und (2) kann mit dem Begriff „Gewaltökonomie“ die Tatsache verdeutlicht werden, dass in diesem wirtschaftlichen System Gewalt als Regulativum fungiert.
[4] Ab dem zweiten Teil dieser Arbeit wird auf den Begriff „Krieg“ als analytische Kategorie in Hinblick auf Konflikte in der „Dritten Welt“ verzichtet. Stattdessen wird der Begriff „innerstaatlicher Konflikt“ oder „bewaffneter Konflikt“ benutzt.
[5] Ein Beispiel stellt die Typologiebildung dar. Exemplarisch dafür sind die in der Forschung sowohl einflussreiche als auch stark umstrittene Konzepte von Münkler (2002) und Kaldor (1999, 2001), die auf eine diachrone Typologiebildung „neue Kriege“ - „alte Kriege“ zurückgreifen. Eine Variante „neuer Kriege“ präsentieren auch Bernhard Zangl und Michael Zürn (2003). Festzuhalten ist, dass während sich zur Beschreibung des Wandels Periodisierungen gut eignen, sie zu seiner Erklärung weniger beizutragen scheinen. Das liegt daran, dass der Typologiebildung nicht strukturelle Merkmale wie die Art der beteiligten Akteure, die Folgen der Kriege, ihre Dauer und ähnliche Parameter zugrunde liegen und sich aus der historischen Analyse nicht leicht Verallgemeinerungen ableiten lassen.
- Arbeit zitieren
- Georgi Iliev (Autor:in), 2005, Die Persistenz von Gewaltökonomien in innerstaatlichen Konflikten: Mechanismen und Ablaufdynamiken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41234
Kostenlos Autor werden











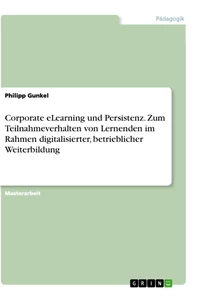

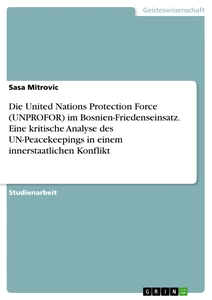
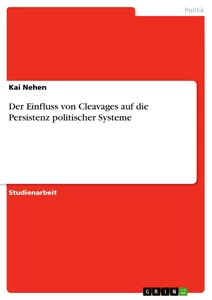







Kommentare