Leseprobe
Inhalt
I. Einleitung
II. Selbstbestimmung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung
1. Geistige Behinderung – Begriffsbestimmung und theoretische Grundlagen
1.1. Menschenbildannahmen in der (Geistig-)Behindertenpädagogik
1.2. Der Begriff „Geistige Behinderung“
1.3. Normalisierung der Lebenswelt
2. Aspekte der Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung
2.1. Zum Begriff der Selbstbestimmung
2.2. Zur Realisation von Selbstbestimmung
2.3. Selbstbestimmung als Herausforderung an die Professionellen
2.4. Das Empowerment-Konzept – Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen
3. Integration von Menschen mit geistiger Behinderung
3.1. Integration – eine Begriffsbestimmung
3.2. Prinzipien der Integrationspädagogik
III. Möglichkeiten und Hindernisse von Selbstbestimmung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung im Bereich von Beruflicher Bildung und Arbeit
1. Arbeit und Beruf – Bedeutung und Funktionen
1.1. Begriffsbestimmungen – Arbeit und Beruf
1.2. Funktionen von Arbeit und Beruf
1.3. Stellenwert von Arbeit und Beruf und Erwartungen daran von Menschen mit (geistiger) Behinderung
1.4. Krise des Arbeitsmarktes
1.5. Die Problematik des Übergangs von der Schule in den Beruf - Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt für alle?
2. Gesetzliche Grundlagen der Teilhabe am Arbeitsleben – Das Sozialgesetzbuch IX
2.1. Allgemeines
2.2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
2.3. Beschäftigungspflicht und sonstige Pflichten der Arbeitgeber
3. Berufliche Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung
3.1. Berufsvorbereitung in der Schule für geistig Behinderte
3.2. Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit geistiger Behinderung
4. Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
4.1. Aufgaben, rechtliche Grundlagen und Ziele der WfbM
4.2. Die WfbM als Sondereinrichtung unter den Aspekten Stigmatisierung, Integration, Normalisierung sowie Selbstbestimmung
5. Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt - Grundlagen
5.1. Grundannahmen
5.2. Integrationsfachdienste
5.3. Einstellung von Betrieben gegenüber der Integration von Menschen mit (geistiger) Behinderung
6. „supported employment“ – Unterstützte Beschäftigung
6.1. Grundlagen
6.2. Prinzipien unterstützter Beschäftigung
6.3. Erfahrungen und Folgerungen aus Unterstützter Beschäftigung
IV. Förderung von Selbstbestimmung und Integration beim Übergang von der Schule in den Beruf mit Hilfe Personenbezogener Planung – Das Beispiel der Lüneburger Assistenz gGmbH
1. Vorstellung der Untersuchung
1.1. Vorüberlegungen
1.2. Annäherung an das Forschungsfeld
1.3. Auswahl der Methode für die Datensammlung
1.4. Zur Durchführung von Interviews mit Menschen mit geistiger Behinderung
1.5. Die Gestaltung der problemzentrierten Interviews
1.6. Ablauf der Untersuchung
1.7. Fixierung und Interpretation der erhobenen Daten
2. Die Lüneburger Assistenz gGmbH
2.1. Aufbau und Aufgaben der Lüneburger Assistenz gGmbH
2.2. Das Modellprojekt des Arbeitsvorbereitungsjahres
3. Personenbezogene Planung – Theoretische Grundlagen
3.1. Grundlagen Personenbezogener Planung
3.2. Kernaspekte Personenbezogener Planung
3.3. Auswirkungen Personenbezogener Planung auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen
4. Der Unterstützerkreis
5. Methoden Personenbezogener Planung
5.1. PATH
5.2. MAP (Making Action Plan)
5.3. Materialien und Durchführung von Persönlichen Zukunftsplanungen im Rahmen des AVJ
6. Gesamtauswertung der problemzentrierten Interviews
6.1. Gesamtauswertung der Daten über die derzeitigen TeilnehmerInnen des AVJ
6.2. Gesamtauswertung der Daten über die AbsolventInnen des AVJ
7. Einzelauswertung der Datensammlung
7.1. Marc: „[] mein Lehrer von der Berufsschule kannte da irgendwie einen [].“
7.2. Anja: „und dann musste ich nach Lebenshilfe rüber, und das war, fand ich auch gar nicht gut. [] aber ich bin, jetzt macht mir das auch Spaß.“
7.3. Luisa: „Doch, macht Spaß. Also ohne rumzuheulen, das mach ich nicht.“
7.4. Sergej: Das „ist zwar anders, aber das gefällt mir nicht.“
7.5. Alex: „Ähm, ich mach mit meinem Vater meistens Wurst, oder helf ihm mit.“
7.6. Mirja: „Meine Mutter will, dass ich hier arbeite.“
7.7. Kai: „Muss ich mal sehen, wie das läuft. Genau weiß ich das noch nicht.“
7.8. Aimo: „Weil das so nette Leute sind [..].“
7.9. Mirco: „Gut. Das ist die richtige Arbeit für mich.“
V. Zusammenfassung und Fazit der Arbeit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Das Normalisierungsprinzip
Abbildung 2 Gründe für den allgemeinen Arbeitsmarkt
Abbildung 3 Identität und mögliche Störungen)
Abbildung 5 Making Action Plan (MAP
I. Einleitung
„Ich gehe meine eigenen Wege,
ein Ende ist nicht abzusehen,
eigene Wege sind schwer zu beschreiten,
sie entstehen ja erst beim Gehen“
Heinz Rudolf Kunze
Wohin gehe ich und wie sieht der Weg dorthin aus? Dies sind Fragen, die sich jeder Mensch in seinem Leben mehrere Male stellt, und auf die man zunächst häufig noch keine Antwort weiß. Solch existentiellen Fragen tauchen meist zum ersten Mal auf, wenn der Schulabschluss näher rückt. Hiermit geht der Übergang in das Arbeits- und Berufsleben einher und häufig rückt auch der Auszug in die erste eigene Wohnung näher. Die nicht einfache Entscheidung für einen Beruf fällt in eine Zeit des Erwachsenwerdens, die von den meisten Jugendlichen als spannend und aufregend, häufig aber auch als schwierig wahrgenommen wird. Weitreichende Entscheidungen müssen allmählich selber getroffen und die Folgen mehr oder weniger selber getragen werden. Dies trifft allerdings nicht auf alle Jugendlichen zu. Für die meisten jungen Menschen mit einer geistigen Behinderung war und ist der Lebensweg noch immer recht genau vorgezeichnet. Sie machen ihren Schulabschluss und beginnen dann überwiegend, in einer Werkstatt für behinderte Menschen zu arbeiten. Der Auszug von zu Hause erfolgt auch heute meist nicht in eine selbst ausgesuchte Wohnung, sondern in eine Wohngruppe, in der gerade ein Zimmer frei ist. Sowohl „Integration“ in die Gesellschaft als auch „Selbstbestimmung“ in grundsätzlichen Entscheidungen ist für diese Personengruppe somit noch keine Selbstverständlichkeit. Beide Begriffe sind daher handlungsleitend für die Sonderpädagogik. In Kapitel II erfolgt eine Begriffsbestimmung der Begriffe „geistige Behinderung“, „Selbstbestimmung“ sowie „Integration“. Es wird außerdem auf das Normalisierungsprinzip, Möglichkeiten der Realisierung von Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung sowie das Empowerment-Konzept eingegangen.
Seit einiger Zeit wird ein vorgezeichneter Lebenslauf, der einer Einbahnstrasse ähnelt, von vielen Personen mit geistiger Behinderung, ihren Familien und Bekannten und Fachleuten nicht mehr vorbehaltlos akzeptiert. Besonders die SchülerInnen, die in ihrer Schulzeit eine Integrationsklasse besucht haben, und somit die Separierung in einer Sonderschule nicht erlebt haben, wünschen sich auch im beruflichen Bereich keine Aussonderung. Um sowohl Schulabgängern als auch Beschäftigten in den Werkstätten für behinderte Menschen Möglichkeiten der Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen, wurde das Konzept der Arbeitsassistenz in Deutschland aufgegriffen. Dieses ist unter dem Begriff „supported employment“ im englischsprachigen Raum bereits länger bekannt. In Kapitel III erfolgt ein Überblick über die derzeitigen Möglichkeiten, die Personen mit geistiger Behinderung in Bezug auf Arbeit und Beruf zurzeit in Deutschland haben. Die Darstellung schließt sich an das vorangegangene Kapitel an und, die vorhandenen beruflichen Möglichkeiten werden im Hinblick auf die Begriffe „Selbstbestimmung“ und „Integration“ vorgestellt. Im Zusammenhang mit dem Ziel der Integration von Menschen mit geistiger Behinderung wird hier außerdem auf den Begriff der „Stigmatisierung“ bzw. „Entstigmatisierung“ eingegangen, da diese zu letzterem beiträgt.
Ein weitgehend selbstbestimmtes Leben beinhaltet, dass immer wieder Entscheidungen mit mehr oder weniger weitreichenden Folgen getroffen werden müssen. Dies gilt auch und gerade für die Entscheidung im Hinblick auf den Arbeitsplatz. Schwierigkeiten bei wichtigen Entscheidungen bestehen häufig darin, dass man zum einen zur Realisierung der angestrebten Ziele häufig Unterstützung von anderen Personen benötigt. Zum anderen ist man sich oft aber auch noch gar nicht sicher, welche Ziele man überhaupt anstreben möchte. Letzteres trifft besonders auf Personen zu, die es bisher kaum gelernt haben, Entscheidungen zu treffen, da ihnen in der Vergangenheit selten Wahlmöglichkeiten gegeben wurden. Dieses Problem ist besonders häufig bei Menschen mit geistiger Behinderung zu beobachten, da diesen auch heute noch oft nicht zugetraut wird, Entscheidungen selber treffen zu können. Zur Unterstützung der Erarbeitung von Zukunftsplänen und deren Realisierung wurde das Konzept der Personenbezogenen Planung Ende der Achtziger Jahre in den USA entwickelt. Es soll dazu dienen, zu verhindern, dass nicht die Person selber mit ihren Wünschen und Bedürfnissen, sondern die Unterstützungsangebote der vorhandenen Einrichtungen der Behindertenhilfe das Leben von Menschen mit Behinderungen bestimmen. Zusammen mit nahestehenden Menschen, den sogenannten Unterstützern, werden Zukunftspläne für eine bestimmte Person entwickelt. Diese sogenannte Hauptperson steht im Mittelpunkt, und ihre Wünsche und Vorstellungen sollen handlungsleitend sein. Die gemeinsam erarbeiteten Zukunftspläne werden dann schrittweise gemeinsam umgesetzt. Grundsätzlich soll so eine erweiterte Selbstbestimmung der betreffenden Person erreicht werden und durch die Einbeziehung der Unterstützer wird sie stärker in die Gemeinschaft integriert.
In Kapitel V erfolgt eine Darstellung, am Beispiel der Lüneburger Assistenz gGmbH, wie das Konzept der Personenbezogenen Planung eingesetzt wird, um SchülerInnen bei ihrem Übergang von der Schule in den Beruf mehr Selbstbestimmung und Integration zu ermöglichen. In dem von der Lüneburger Assistenz gGmbH angebotenen Modellprojekt „Arbeitsvorbereitungsjahr“ arbeitet diese mit der dortigen Schule für geistig Behinderte und einer Berufsschule zusammen, um den Schülerinnen den Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Arbeitsweise mit dem Konzept der Personenbezogenen Planung wurde in einem Experteninterview mit einer Mitarbeiterin der Lüneburger Assistenz gGmbH erarbeitet. Die so erhaltenen Informationen werden in diesem Kapitel dargestellt, wobei zusätzlich grundlegende Aspekte aus der entsprechenden Fachliteratur einfließen. Den zweiten Schwerpunkt des Kapitels stellt die Auswertung von Interviews mit Jugendlichen dar, welche zurzeit das Arbeitsvorbereitungsjahr absolvieren bzw. dieses letztes Jahr beendet haben. Der Schwerpunkt des Forschungsinteresses lag hier auf der Ermittlung der subjektiven Sichtweise der Jugendlichen auf ihre aktuelle Lebenssituation, insbesondere in beruflicher Hinsicht, sowie deren Zukunftsvorstellungen.
Der Ablauf der Untersuchung, die verwendeten Methoden sowie die leitenden Fragestellungen werden in Kapitel IV vorgestellt. Den Schluss der Arbeit stellt das Kapitel VI dar, in dem ein Fazit der vorangegangen Kapitel gezogen wird.
Über jeden Teilaspekt dieser Arbeit beziehungsweise über jedes Kapitel für sich könnte jeweils alleine eine Examensarbeit geschrieben werden. Die Darstellung erfolgt daher beschränkt auf die wichtigsten Aspekte. Während zu den Themenbereichen „Integration“, „Selbstbestimmung“ sowie „Arbeit von Menschen mit geistiger Behinderung“ umfangreiche Literatur vorhanden ist, beschränkt sich diese zu dem Thema „Personenbezogene Planung“ auf wenige deutschsprachige Artikel. Hier wurde daher auf englische Literatur zurückgegriffen, die im Text selber auf Deutsch übersetzt zitiert und im Originallaut als Fußnote dargestellt wird.
II. Selbstbestimmung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung
Mit den Begriffen „Integration“, „Selbstbestimmung“ sowie „Normalisierung“ ist ein Perspektivwechsel in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung verbunden. Im Sinne eines Paradigmenwechsels ist ein verändertes Verständnis von Pädagogik notwendig. Statt eine pauschale Typologisierung von Menschen mit Behinderungen vorzunehmen, sollen die unterschiedlichen Förderbedürfnisse des Einzelnen erkannt werden. In den Mittelpunkt des Interesses tritt somit die einzelne Person mit ihren jeweiligen Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten. Behinderung wird nicht mehr personen- und schädigungsbezogen verstanden, sondern in ihrer Herausbildung im wechselseitigen Zusammenspiel von Person und sozialer Umwelt. Die Zielperspektive ist daher, die Lebensbedingungen aller Menschen so zu verändern, dass sich Personen mit Behinderung weniger fremdbestimmt erleben und ihnen ein integrierteres Leben ermöglicht wird (vgl. Osbahr 2000, 15).
Während sich die Ausführungen in den sich anschließenden Kapiteln auf den Bereich der beruflichen Bildung und Arbeit von Menschen mit geistiger Behinderung beschränken, sollen in diesem Kapitel eine allgemeine Einführung in die Problematik sowie die notwendigen Begriffsbestimmungen erfolgen. Die Begriffe, deren Verständnis zunächst unter Punkt 1 geklärt werden muss, sind „geistige Behinderung“, „Selbstbestimmung“ sowie „Integration“. Aufbauend auf einer Darstellung von dem humanistischem sowie dem konstruktivistischem Menschenbild in der Sonderpädagogik erfolgt eine Bestimmung des Ausdrucks „geistige Behinderung“. Daran schließt sich ein kurzer Überblick über das Normalisierungsprinzip an, welches Grundlage jeglichen pädagogischen Umgangs mit Menschen mit geistiger Behinderung ist.
Unter Punkt 2 wird dann der Begriff der Selbstbestimmung erörtert und anschließend auf die Möglichkeiten der Realisierung in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung eingegangen. Einen wichtigen Aspekt in diesem Zusammenhang stellen die hieraus resultierenden Herausforderungen an die Professionellen dar. Mit dem Konzept des Empowerments, welches benachteiligten Gesellschaftsgruppen mehr Einfluss und Selbstbestimmung in ihrem Leben ermöglichen soll, wird das Kapitel zur Selbstbestimmung beendet. Unter Punkt 3 folgen dann eine Definition des Begriffs „Integration“ sowie ein kurzer Überblick über die Prinzipien der Integrationspädagogik.
1. Geistige Behinderung – Begriffsbestimmung und theoretische Grundlagen
Die Hauptbegriffe dieser Arbeit sind „Selbstbestimmung“ sowie „Integration“. In diesem Kapitel soll der Begriff der „geistigen Behinderung“ bestimmt werden. Die Grundlage jeder Definition von „geistiger Behinderung“ ist ein mehr oder weniger explizit deutliches Menschenbild des Definierenden. Unter Punkt 1.1. wird zunächst ein kurzer Überblick über solche Menschenbilder in der Sonderpädagogik, auf dessen Basis die Realisierung eines selbstbestimmten, integrierten Lebens von Menschen mit Behinderungen möglich, und dessen Unterstützung unumgänglich ist. Geeignet hierfür erscheinen zum einen das Menschenbild, welches in der Humanistischen Psychologie entwickelt wurde, und zum anderen das Menschenbild aus konstruktivistischer Sicht. Darauf aufbauend werden unter Punkt 1.2. verschiedene Definitionen von „geistiger Behinderung“ vorgestellt. Einen Aspekt dieser Erörterung stellt die grundsätzliche Problematik der Kategorisierung mit Hilfe von Begriffen dar, auf die erst eingegangen wird, bevor dann das dieser Arbeit zugrunde liegende Verständnis von „geistiger Behinderung“ folgt. Unter Punkt 1.3. erfolgt eine kurze Darstellung des Normalisierungsprinzip ein, welches grundlegend für die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung ist.
1.1. Menschenbildannahmen in der (Geistig-)Behindertenpädagogik
Menschenbilder stellen Hilfskonstruktionen dar, um die menschliche Existenz besser erfassen und einordnen zu können. Ihre Darstellung dient somit der eigenen wissenschaftlichen und ideologischen Standortbestimmung (vgl. Vernooij 2000, 11). Aber was genau wird unter dem Begriff „Menschenbild“ überhaupt verstanden? Kollbrunner beschreibt, dass die Frage nach dem jeweiligen Menschenbild die Frage „nach der expliziten und impliziten Anthropologie, nach der mehr oder weniger versteckten „menschenkundlichen Haltung“, die der bestimmten Theorie oder Schule zugrunde liegt“ (ebd. 1989, 195) sei. rogers drückt diesen Sachverhalt folgendermaßen aus:
„Wie sehen wir den anderen? Gestehen wir jedem Menschen seinen ihm gemäßen Wert, seine ihm gemäße Würde zu? […] Neigen wir dazu, Individuen als Menschen von Wert zu behandeln, oder entwerten wir sie insgeheim durch unsere Einstellungen und unser Verhalten? Nimmt in unserer Philosophie der Respekt vor dem Individuum den ersten Rang ein? Achten wir seine Befähigung und sein Recht zur Selbstlenkung, oder glauben wir im Grunde, dass sein Leben am besten von uns geleitet würde? Bis zu welchen Grad haben wir das Bedürfnis und den Wunsch, andere zu beherrschen? Sind wir damit einverstanden, dass das Individuum seine eigenen Werte auswählt und erwählt? Oder werden unsere Handlungen von der (meist unausgesprochenen) Überzeugung geleitet, dass das Individuum am glücklichsten wäre, wenn es uns gestatten würde, seine Werte, Maßstäbe und Ziele für es auszusuchen?“ (ebd. 1972, 35).
Ein reflektierter Umgang in der pädagogischen Arbeit mit Menschen mit Behinderungen im Sinne von Selbstbestimmung bzw. Empowerment setzt ein Bild vom Menschen voraus, welches mit diesen Zielvorstellungen kongruent ist. Bestimmte Menschenbilder, wie es beispielsweise dem Behaviorismus zugrunde liegt, stehen einer Annahme der Fähigkeit zu Selbstbestimmung von Menschen mit geistige Behinderung und damit ihrer Realisierung eher entgegen (vgl. Borchert 2000, 47 ff.).
Völker beschreibt, dass sich aus humanistischer Sicht die menschliche Existenz nur dann verstehen lässt, wenn „der ganze Mensch als handelndes Subjekt betrachtet wird, als biologisches, psychisches und soziales Wesen“ (ebd. 1980, 20). Zum Ausgangspunkt der Forschung wird daher zum einen der Mensch als Ganzheit gemacht, wobei alle psychischen Prozesse aufeinander bezogen werden und zum anderen die Einheit des Menschen mit seiner Umgebung (vgl. ebd. 1980, 20). Diese beiden Aspekte werden auch von anderen Autoren betont. Bugental (1964, zitiert nach: Quitmann 1985, 16 f.) nennt folgende Prinzipien, die Aufschluss über das Menschenbild der Humanistischen Psychologie geben:
1. In seiner Eigenschaft als menschliches Wesen ist der Mensch mehr als die Summe seiner Teile[1].
2. Menschliche Existenz ist immer an zwischenmenschliche Beziehungen gebunden[2].
3. Der Mensch lebt bewusst, unabhängig davon, wie viel menschliches Bewusstsein aktuell zugänglich ist[3].
4. Der Mensch ist in der Lage, zu wählen und Entscheidungen zu treffen[4].
5. Menschen leben auf ein Ziel bzw. Werte hin, die Grundlage ihrer Identität sind[5].
Charlotte Bühler (1967, 85; zitiert nach: Kollbrunner 1989, 196) beschreibt, dass der Mensch aus humanistischer Sicht ein Lebewesen ist, welches sich selbst aktiviert und drei Ziele in seinem Leben verfolgt. Ein Ziel stellt die Aktualisierung der eigenen Kräfte und Möglichkeiten dar. Das Erreichen gewisser Dinge in der Außenwelt ist das zweite Ziel und drittens schließlich das Finden von Sinn und Erfüllung im Leben, indem die eigene Aktivität und Aktualisierung ausgebreitet und differenziert wird. Ein wichtiger Begriff der Humanistischen Psychologie ist der der Autonomie, unter dem Völker das Streben eines Organismus versteht, unabhängig von äußerer Kontrolle zu werden, indem es die Umwelt beherrscht (vgl. ebd. 1980, 16). Krone hingegen verwendet den Ausdruck der Selbstverwirklichung, welche für ihn die Entwicklung und Differenzierung der jeweils vorhandenen Anlagen sowie „die Entfaltung des ganzen Potentials menschlicher Fähigkeiten“ bedeutet (ebd. 1992, 71).
Die erkenntnistheoretischen Grundpositionen, die unter dem Begriff systemisch-konstruktivistisch zusammengefasst werden, lassen sich aus den Systemtheorien, der Kybernetik, dem Konzept der Autopoiese sowie dem Konstruktivismus herleiten (vgl. Balgo 2002, 77). Die Kernannahme all dieser Konzepte besagt, dass Menschen sich selbst erhaltende und selbst organisierende Systeme sind. Die Wirklichkeit wird vom Menschen nicht objektiv so wahrgenommen wie ist, sondern der Mensch organisiert und konstruiert sich diese, und zwar aufgrund seiner individuellen neuronalen Struktur. Die so entstehende Subjektivität wird dadurch aufgehoben, dass der Mensch in Gemeinschaften lebt, die er mitgestaltet. Da uns die äußere Realität sensorisch und kognitiv unzugänglich ist, sind wir mit der Umwelt lediglich strukturell verbunden, indem wir Impulse von außen in unserem Nervensystem umwandeln. Dieses geschieht auf der Grundlage der jeweils biografisch geprägten kognitiven und emotionalen Strukturen. Das bedeutet schließlich, dass Menschen von außen nicht determiniert werden können, sondern höchstens pertubiert, d.h. gestört, werden können (vgl. siebert 1999, 7). Aufgrund dieser Annahme wird Lernen nicht als rein innerpsychischer Vorgang verstanden, sondern als eine kognitive Bearbeitung der Differenz zwischen System und Umwelt. Lernen ist somit kein mechanischer und quantitativ messbarer Prozess des Wissenserwerbs, sondern ein selbsttätiger Prozess der Bedeutungszuschreibung. Der konstruktivistische Lernbegriff ist somit anschlussfähig an die humanistische Sichtweise (vgl. ebd. 1999, 17).
1.2. Der Begriff „Geistige Behinderung“
Osbahr beschreibt, dass Definitionen als „gedankliche Arbeitsinstrumente“ (ebd. 2003, 119) dienen. Sie seien daher auch nie richtig oder falsch, können aber „für die Sonderpädagogik brauchbare Erkenntnishilfen […] für die Beschreibung und lösungsorientierte Bearbeitung komplexer Fragestellungen im Beobachtungsbereich „Menschen mit geistiger Behinderung in ihrer Lebenswirklichkeit““ (ebd. 2003, 119) sein. Der Begriff „Definition“ bedeutet übersetzt „Begriffsbestimmung“ und ist verwandt mit dem Verb „definieren“ und dem Adjektiv „definitiv“. „Definieren“ hat inzwischen die Bedeutung von „begrifflich bestimmen“, stammt aber von dem lateinischen Ausdruck „definire“ ab, der „abgrenzen“ bedeutet und mit dem Begriff „finis“, also „Grenze“, verwandt ist (vgl. Drosdowski 1989, 118). Der Sinn des Definierens oder einer Definition besteht somit darin, einen Gegenstand oder Aspekt der wahrgenommenen Realität einzuordnen und gegen andere abzugrenzen. Osbahr weist darauf hin, dass jede Definition abhängig ist von den Unterscheidungen und Bezeichnungen, die der jeweilige Beobachter macht. Sie muss sich daher in sozialen Prozessen bewähren. Jede Definition wird sich verändern, weil immer wieder neue Beobachtungen ins Blickfeld kommen (vgl. ebd. 2003, 120). Auch die Definitionen des Begriffs der Behinderung im Allgemeinen, sowie der geistigen Behinderung im Speziellen, sind laufend Veränderungen unterworfen. Es gibt keine Definition, die als allgemeingültig angesehen werden kann. Daher ist in wissenschaftlichen Arbeiten eine genaue Darstellung des jeweiligen Begriffsverständnisses nötig, um dieses für den Leser transparent und damit diskutierbar zu machen. Mühl stellt dar, dass dem Begriff „geistige Behinderung“ nur eine Übergangsfunktion zukomme, wie anderen früheren Begriffen ebenfalls, da die ursprünglich beabsichtigte Verringerung von Stigmatisierung und Etikettierung heute schon wieder verloren gegangen sei. Geistige Behinderung hebe somit ein negatives Merkmal hervor und wird durch einen neuen Begriff ersetzt werden müssen (vgl. ebd. 2000, 45).
Eine Beschreibung oder Definition von geistiger Behinderung wird normalerweise von den Fachleuten, also von außen, vorgenommen. Dies birgt nach Speck die Gefahr, dass Menschen mit geistiger Behinderung zum bloßen Objekt von Erklärungen werden (Speck, 1999, 43). Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang, dass aus der subjektiven Sicht von Betroffenen selber, die „Behinderung eines Menschen nichts weniger [bedeutet] als einen nicht wegzudenkenden Bestandteil seiner individuellen Existenz. Unabschüttelbar gehört sie zu seiner persönlichen Identität“ (Saal 1995, 47). Eine Begriffsbestimmung und auch der Gebrauch des Begriffes an sich werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus Gründen der Verständigung und der nur so möglichen politischen Parteinahme von einem Großteil der Fachleute als nötig angesehen (vgl. Theunissen 2002, 96).
Verschiedentlich werden neue Begriffe, die noch nicht negativ besetzt sind, vorgeschlagen, und die den Begriff der „geistigen Behinderung“ ablösen sollen. Zu nennen ist hier zum einen der Ausdruck „Menschen mit Lernschwierigkeiten“, der von Betroffenen des Vereins „People First!“ aus dem englischsprachigen Raum übernommen wurde, wo sich diese selber als Personen mit „learning difficulties“ bezeichnen. Der Begriff geistige Behinderung wird von ihnen abgelehnt, da sie ihn als diskriminierend ablehnen (vgl. Freudenstein u.a. 1999; Roebke 2000). Zum anderen wird seit einiger Zeit im Rahmen des Konzeptes „supported living“ von „Menschen mit Unterstützungsbedarf“ gesprochen. Hiermit ist eine umfassendere Personengruppe als mit dem Begriff „geistige Behinderung“ gemeint, denn hierzu zählen alle die Menschen, die für ein weitgehend selbstbestimmtes Leben mehr oder weniger viel Unterstützung durch andere Personen benötigen. Dieser Unterstützungsbedarf kann seinen Grund in einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung haben oder in anderen Einschränkungen (vgl. Lindmeier, Lindmeier 2001, 46; O`Brien 1993). Beide Begriffe wären aber auch wiederum nur vorübergehend nicht stigmatisierend für die betreffenden Personen, ebenso wie alle vorangegangenen Ausdrücke. Für die folgenden Darstellungen bezeichnen beide Ausdrücke außerdem die Personengruppe nicht deutlich genug. Beispielsweise kann eine Person mit Down-Syndrom zwar in Bezug auf ihren Arbeitsplatz womöglich einen ähnlich großen Unterstützungsbedarf haben, wie jemand mit einer Lernbehinderung oder einer körperlichen Beeinträchtigung. Die Einstellung von potentiellen Arbeitgebern gegenüber dem betreffenden Bewerber und die Reaktion auf ihn wird aber in den meisten Fällen eine andere sein, ebenso wie die benötigte Unterstützung. Daher beschränken sich die Ausführungen im Folgenden auf den Personenkreis von Menschen mit geistiger Behinderung, wobei dieser Ausdruck auch verwendet wird.
Der Ausdruck „geistige Behinderung“ wurde in Anlehnung an die englische Bezeichnung „mentally handicapped“ von der Bundesvereinigung Lebenshilfe 1958 eingeführt und hat sich seitdem bis in schulrechtliche und sozialpolitische Regelungen durchgesetzt. Er ersetzte negativ besetzte Bezeichnungen aus der Vergangenheit wie „Schwachsinn“, „Idiotie“ oder „Geistesschwäche“ (vgl. Mühl 2000, 45). Wie bereits angedeutet wurde, gibt es bis heute weder eine einheitliche Definition des Begriffs der geistigen Behinderung noch des Begriffs der Behinderung (vgl. Bleidick, Hagemeister 1998, 18). Aus diesem Grund ist diese Erörterung überhaupt nötig (vgl. Sander 1994, 99). Aber über welches Verständnis des Begriffs Behinderung bzw. geistige Behinderung herrscht in der Fachwelt zumindest weitgehend Übereinstimmung? Wie die beiden Begriffe Behinderung bzw. geistige Behinderung definiert werden, verdeutlicht das jeweils zugrundeliegende Menschenbild des Definierenden, und damit häufig auch den wissenschaftlichen Hintergrund der jeweiligen Person. Speck beschreibt, dass der sogenannte medizinisch-biologische Ansatz zuallererst den physischen Abweichungen und Besonderheiten gilt, wohingegen der psychologische Ansatz sich mit der Eigenheit der beobachtbaren Verhaltensweisen beschäftigt. Der sozialwissenschaftliche Ansatz interessiert sich für Behinderung im gesellschaftlichen Bedingungssystem sowie der pädagogische Ansatz für die Möglichkeiten der Erziehung (vgl. ebd. 1999, 43). Bleidick definiert den Begriff Behinderung aus pädagogischer Sicht, in Abgrenzung beispielsweise zu sozialrechtlichen Definitionen, folgendermaßen: „Als behindert im pädagogischen Sinne gelten Kinder, Jugendliche und Erwachsene, deren Lernen und deren soziale Eingliederung erschwert sind“ (Bleidick 1998, 29).
Seit der Einführung des Begriffs der „Behinderung“ lassen sich deutliche Veränderungen im Verständnis des Behinderungsbegriffs erkennen. Zunächst standen defizitorientierte Beschreibungen von geistiger Behinderung im Vordergrund. Häufig wurde der Teilbegriff „geistig“ im Sinne von Intelligenz und kognitiven Funktionen verstanden, so dass es nahe lag, geistige Behinderung als Intelligenzminderung zu definieren. Nach Bach galten die Personen als geistig behindert, deren „Lernverhalten nicht nur vorübergehend wesentlich hinter der am Lebensalter orientierten Erwartung liegt und durch ein Vorherrschen des anschauend-vollziehenden Aufnehmens, Verarbeitens und Speicherns von Lerninhalten und eine Konzentration ihrer Lerninteressen auf direkter Bedürfnisbefriedigung Dienendes gekennzeichnet ist“ (ebd. 1979, 3). Die Definition des Deutschen Bildungsrats, ebenfalls aus den siebziger Jahren, legte ihren Schwerpunkt auf die voraussichtlich lebenslange Abhängigkeit der betreffenden Personen: „Als geistigbehindert gilt, wer […] in seiner psychischen Gesamtentwicklung und seiner Lernfähigkeit so sehr beeinträchtigt ist, dass er voraussichtlich lebenslanger, sozialer und pädagogischer Hilfen bedarf. Mit den kognitiven Beeinträchtigungen gehen solche der sprachlichen, sozialen, emotionalen und der motorischen Entwicklung einher“ (ebd. 1974, 37). Ziemen beschreibt, dass diese Definition des Bildungsrates das Resultat von Beobachtungen ist, „die jedoch nur im Vergleich zu fiktiven Normvorstellungen Geltung beanspruchen können und vor allem die psychologische und soziale Ebene des Menschen berücksichtigen, jedoch ausschließlich vom defizitären Verständnis ausgehen“ (ebd. 2001, 270 f.).
Während sowohl Bach als auch der Deutsche Bildungsrat bei der Definition von geistiger Behinderung von der Person selbst ausgehen, beschreibt Elbert in den achtziger Jahren, dass geistige Behinderung durch Prozesse von außen formiert werde: „Durch die Forderung nach lebenslangem Schutz und Hilfe für die „Geistigbehinderten“ legitimieren sich medizinisch-psychiatrische und sonderpädagogische Theorien. Menschen mit geistiger Behinderung wird die Fähigkeit zu autonomem Handeln abgesprochen und letztlich werden sie „zum Objekt korrigierender Erziehungseinflüsse“ (Elbert 1982, 40). Einer defizitären Sicht von geistiger Behinderung entspricht die Auffassung, dass zu dieser Behinderung unabdingbar fehlende oder gestörte Verhaltensweisen gehören. Ausgehend von der Theorie der self-fulfilling-prophecy aus, ist die negative Folge dieser Zuschreibungs- und Etikettierungsprozesse, dass sich der betreffende Mensch störend und defizitär verhalten wird. Die betreffende Person verhält sich so, wie es von der Außenwelt vorhergesehen wurde (vgl. Osbahr 2003, 112).
Die frühere Orientierung an Defiziten wandelt sich heute mehr und mehr zugunsten einer Orientierung am ganzen Menschen, und auch der Begriff der geistigen Behinderung wird nicht mehr unwidersprochen akzeptiert. Boban und Hinz bezeichnen die unterschiedlichen Begriffsverständnisse als defektologische Haltung, welche von einer dialogischen Haltung derzeit abgelöst werde. Erstere zeichne sich dadurch aus, dass sie geistige Behinderung als Zustand ansieht. Dieser Zustand beruhe auf einem organischen Defekt und ziehe Defizite in der Entwicklung nach sich. Dieser Haltung liege eine „immanente Theorie der Andersartigkeit von Menschen mit „geistiger Behinderung“ zugrunde, die u.a. auch lebenslangen Schutz und separate Beschulung begründet“ (Boban, Hinz 1993, 337). Die dialogische Haltung hingegen sehe geistige Behinderung als Prozess an, bei dem sich innere und äußere Bedingungen beeinflussen, auf denen die Entwicklung der jeweiligen Person basieren. Das Kind wird als autonomes Subjekt gesehen, dessen Kompetenzen im Vordergrund stehen (vgl. Boban, Hinz 1993, 336).
Diese veränderte Sichtweise von Behinderung wird in der Definition von Speck deutlich, welcher Behinderung als ein komplexes Phänomen versteht, das nicht allein in der Person begründet ist. Stattdessen resultiere Behinderung aus drei Teilbegriffen: der organischen Schädigung, aus individuellen Persönlichkeitsfaktoren sowie aus sozialen Bedingungen und Einwirkungen (vgl. ebd. 1999, 39). Ebenso beschreibt Mühl, dass geistige Behinderung „als weitreichende Lernbeeinträchtigung beschrieben werden kann, die mit einer Hirnschädigung einsetzen kann und all jene Bereiche der Entwicklung und Sozialisation betrifft, die in hohem Maße von Lernprozessen abhängig sind“ (ebd. 2000, 52). Im Alltag ergibt sich hieraus eine Beeinträchtigung der Erlebens- und Handlungsfähigkeit und damit einhergehend eine eingeschränkte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben (vgl. ebd. 2000, 52).
Speck beschreibt, dass der Begriff der „Behinderung“ kein wissenschaftlicher sei, weil man ihn nicht definitiv von einer „Nichtbehinderung“ abgrenzen kann (vgl. ebd. 1991, 103). „Behinderung“ lässt sich nach ihm als Prozess und Ergebnis ansehen, also als ein dynamisches Geschehen. Die „Abweichungen“ werden von der sozialen Umwelt kategorisiert und bei einer Person festgestellt. Wenn diese Feststellung geschehen ist, ist die Auffälligkeit evident geworden. In einem Prozess, der durch die ständige Wechselwirkung zwischen dem Selbst der betroffenen Person und der sozialen Umwelt in Gang gesetzt wird, bildet sich schließlich das aus, was als „Behinderung“ erlebt wird. Aus seinem ökologisch-systemischen Verständnis von geistiger Behinderung stellt er diese als spezielle pädagogische Aufgabe dar (vgl. ebd. Speck 1991, 163 ff.). Bächtold beschreibt, dass in einem solchen Verständnis Behinderung dann vorliegt, wenn eine Person aufgrund einer Schädigung oder Beeinträchtigung „ungenügend in sein vielschichtiges Mensch-Umfeld-System integriert ist und wenn die sozialen Beziehungen durch soziale Abhängigkeit und Fremdbestimmung gekennzeichnet sind“ (ebd. 1992, 5).
Diese Dreiteilung des Behinderungsbegriffs, die Speck benennt, entspricht weitgehend der Sichtweise der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Behinderung in der „International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)“ in Form eines mehrdimensionalen Konzepts beschreibt. Behinderung ist vor allem durch folgende drei Ebenen gekennzeichnet:
- „impairment“, betreffend organische Schädigungen und funktionelle Störungen
- „activity“, Aktivitäten, die Menschen auch mit Schädigungen und Störungen ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten erlauben
- und drittens „participation“, soziale Teilhabe am Leben der Gesellschaft (vgl. Cloerkes 2001, 6; DIMDI 2002, 14ff.).
Diese Einteilung löste die ältere Fassung, die ICIDH von 1980, ab. Während in dieser ein kausaler Zusammenhang von Schädigung, Beeinträchtigung und sozialer Benachteiligung unterstellt wurde, wird in der neuen Fassung die defizitorientierte Sichtweise aufgegeben. Es geht stattdessen um ein prozesshaftes Geschehen mit den genannten Dimensionen, wobei sogenannte Kontextfaktoren berücksichtigt werden. Jede Dimension lässt sich positiv oder negativ ausdrücken. Die ICF betont den gesellschaftlichen Zusammenhang, in dem Menschen mit Behinderung leben, sowie ihre positiven Möglichkeiten zu aktiver und selbstbestimmter Teilhabe (vgl. Cloerkes 2001, 5).
Der zentrale Ansatzpunkt der ICF ist nach Lindmeier somit das Konzept der Partizipation. Es wird damit „anerkannt, dass die erschwerte Teilhabe am Leben der Gesellschaft die eigentliche Behinderung darstellt und zum zentralen Ansatzpunkt der Hilfen werden muss. Die Eingliederung in die Gesellschaft wird damit zum zentralen Auftrag der Rehabilitation“ (ebd. 2002, 422).
Diese stärker individualisierende Sicht von Menschen mit Behinderungen drückt sich u.a. auch darin aus, dass im Gegensatz zu früher in der Sonderpädagogik nicht mehr von „Geistigbehinderten“ gesprochen wird, sondern von „Menschen mit geistiger Behinderung“. Zum einen versucht man so deutlich zu machen, dass die geistige Behinderung nur einen Teilaspekt der Persönlichkeit darstellt. Zum anderen wird vermieden, in verallgemeinernder Form von „den Geistigbehinderten“ zu sprechen (vgl. Mühl 2000, 45).
Verschiedentlich wird der Begriff der geistigen Behinderung aber generell abgelehnt und ein völliger Verzicht auf die Verwendung von jeglichen Kategorien gefordert, so z.B. von Georg Feuser (1996b). Ein Verzicht auf den Begriff der geistigen Behinderung gilt für ihn allerdings nur unter der Voraussetzung, dass niemand mehr durch negative Zuschreibungen ausgesondert wird. Alle Mitglieder einer Gesellschaft haben die gleichen Rechte, was für ihn beispielsweise auch die gleiche Teilhabe an Bildungsgütern bedeutet (vgl. ebd. 1996b, 22). Nach seiner Auffassung entsteht geistige Behinderung erst in der Kommunikation, also in der gemeinsamen Wirklichkeitskonstruktion(vgl. 1996b, 22f.). Aus konstruktivistischer Sicht ist geistige Behinderung „als Folge fehlender Passung der Bedingungen beteiligter Personen zu begreifen“ (Osbahr 2003, 115). Konstruktivistische Annahmen stützen sich auf die Selbstorganisationstheorien, die besagen, dass jeder Mensch ein komplexes sinnverarbeitendes und selbstreferentielles System ist (vgl. Maturana, Varela 1987, 98 ff.). Feuser macht auf Grundlage dieser Annahme deutlich, dass geistige Behinderung ein gesellschaftliches Konstrukt darstellt bzw. eine Zuschreibung an eine Personengruppe ist: „Es gibt Menschen, die wir aufgrund unserer Wahrnehmung ihrer menschlichen Tätigkeit, im Spiegel der Normen, in dem wir sie sehen, einem Personenkreis zuordnen, den wir als „geistigbehindert“ bezeichnen“ (vgl. Feuser 1996b, 18; Hervorhebung im Original). Geistige Behinderung stellt für ihn entgegen der üblichen Sichtweise kein Defizit dar, sondern ist „Ausdruck der Aneignung (organisch) beeinträchtigender, (sozial) behindernder und mithin »isolierender« Bedingungen durch einen konkret unter diesen Bedingungen handelnden Menschen, als Strukturbildung [.] nach Maßgabe möglicher Austauschfunktionen“ (ebd. 1996a).
„Behinderung bedeutet in diesem Sinne, dass die Realität der konstruierten Welt Menschen den Eintritt verwehrt oder zumindest sehr erschwert“ (Grampp 1997, 1). Im Gegensatz zum allgemeinen Verständnis von geistiger Behinderung stellt diese aus konstruktivistischer Sicht somit kein Defizit, sondern eine Kompetenz dar (vgl. Feuser 1996b, 23). Osbahr erläutert diese Kompetenz näher als Fähigkeit eines Menschen, unter den vorfindbaren Bedingungen sinnvoll zu leben. Diese Ausgangsbedingungen seien „als beeinträchtigend zu charakterisieren, und der betreffende Mensch hat auf jeder Systemebene veränderte Zustände und Prozesse in seine selbst- und umfeldbezogenen Lebensvorgänge zu integrieren“ (Osbahr 2003, 115). Glasersfeld benutzt hierfür den Begriff der Viabilität, welche „sich immer und ausschließlich nur auf die Fähigkeit bezieht, innerhalb der Bedingungen und trotz der Hindernisse zu überleben, welche die Umwelt oder „Wirklichkeit“ dem Organismus als Schranken in den Weg stellt“ (ebd. 2000, 25).
Geht man davon aus, dass menschliche Entwicklung generell auf Autonomiegewinn ausgerichtet ist, ist es nötig, Lebensbedingungen für Menschen mit geistiger Behinderung zu schaffen, in denen ihnen Möglichkeiten gegeben werden, schrittweise selbst Entscheidungen zu treffen. Das Ziel sonderpädagogischer Arbeit muss somit sein, Einfluss auf die Umweltbedingungen zu nehmen, unter denen Menschen mit geistiger Behinderung aufwachsen, so dass sich diese als weniger hinderlich erweisen. Die entscheidenden Begriffe, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind, sind „Integration“ sowie „Selbstbestimmung“, auf die in den folgenden Kapiteln näher eingegangen wird.
1.3. Normalisierung der Lebenswelt
Der Begriff „Normalisierung“ lässt sich in der Sonderpädagogik zurückführen auf ein Gesetz, welches 1959 von einem Ausschuss in die dänische Sozialgesetzgebung eingefügt wurde. Es hatte das Ziel, „dem geistig Behinderten ein so normales Leben wie möglich zu gestatten“ (Labrégère 1986, 64). Bank-Mikkelsen formulierte dieses Gesetz in der Folgezeit zum „Normalisierungsprinzip“ weiter aus und machte den ideologischen Hintergrund dieser Absicht deutlich. Hierdurch machte er die damalige Stellung von Menschen mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft bekannt. In den sechziger Jahren wurde das Normalisierungsprinzip zu einem inhaltlichen Begriff, der bis heute eine maßgebliche Rolle in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung, zunächst in Schweden, später insgesamt in Europa und Nordamerika, spielt. Der o.g. dänische Ausschuss sprach in seiner Fassung des Normalisierungsprinzips noch von der Normalisierung allgemeiner Lebensbedingungen. Der Schwede Nirje konkretisierte das Prinzip schließlich in acht Leitideen des Normalisierungsprinzips (vgl. Ericcson 1986, 33 ff.).
Thimm stellt das Normalisierungsprinzip als Dreieck dar, dessen Eckpunkte die Perspektiven von Normalisierung aufzeigen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 Das Normalisierungsprinzip (Thimm 1994, 68)
Thimm benennt drei Eckpfeiler der Normalisierung, die sich jeweils unterschiedlichen Ebenen der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung zuordnen lassen: Gemeindeebene, institutionelle Ebene sowie praktische Ebene. Organisatorisch sollen die Hilfen dezentralisiert und kommunalisiert werden. Dies betrifft in erster Linie Entscheidungen auf Landes- bzw. Gemeindeebene. Auf institutioneller Ebene ist dafür zu sorgen, dass sich die angebotenen Hilfen daran orientieren, welches Leben in der jeweiligen Gesellschaft als normal gilt. Auf der praktischen Ebene innerhalb der Einrichtungen werden dann Selbstbestimmung, Selbsthilfe sowie die Beteiligung der Betroffenen umgesetzt.
Die Formulierung des Normalisierungsprinzips ist vor dem Hintergrund der Kritik an der damaligen Unterbringung von Menschen mit geistiger Behinderung in Anstalten zu sehen, wo diesen Menschen in den vierziger Jahren ein sehr niedriger Lebensstandard und einfachste Lebensbedingungen zugemutet wurden (vgl. Ericcson 1986, 33 ff.). Sie lebten fern vom Alltag der sozialen Gemeinschaft und wurden wie stationär zu betreuende Patienten behandelt. Ihre Umwelt war relativ künstlich gestaltet und die Menschen waren einer totalen Kontrolle durch die professionellen Helfer unterworfen. Im Gegensatz zu einem auch nur annähernd selbstbestimmten Leben, waren sie „zu einem weitgehend passiven und fremdbestimmten Leben verurteilt, isoliert von ihren Familien und von der Gemeinschaft der Nichtbehinderten“ (Wember 2003, 44). Es wurde daraufhin ein Leben gefordert, das so weit wie möglich einem Leben entspricht, welches in der jeweiligen Gesellschaft als normal gilt. Nirje hat diese Forderung nach normalen Lebensmustern und Lebensbedingungen auch für Menschen mit geistiger Behinderung in jenen acht Lebensbereichen konkretisiert, die für die westlichen Industriegesellschaften typisch sind. Vor dem Hintergrund des Lebens in Anstalten, das v.a. durch eigene Zeitstrukturen und fehlende Lebensinhalte geprägt war, wurden von ihm folgende Forderungen für das Leben von Menschen mit geistiger Behinderung aufgestellt:
1. Normaler Tagesrhythmus
2. Normaler Wochenrhythmus
3. Normaler Jahresrhythmus
4. Orientierung am Lebenszyklus
5. Respektierung von Bedürfnissen
6. Leben in einer „bisexuellen“ Welt
7. Normaler wirtschaftlicher Standard
8. Standards von Einrichtungen für Behinderte (vgl. Thimm 1994b, 19ff.)
Das Normalisierungsprinzip vertritt den Standpunkt, dass der Mensch mit geistiger Behinderung als „vollwertiger Bürger gesehen [wird] und […] als solcher das Recht [hat], unter „normalen Formen und Bedingungen des täglichen Lebens“ in der Gemeinschaft zu leben“ (Ericcson 1986, 37). Wird das Normalisierungsprinzip als Leitprinzip in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung anerkannt, akzeptiert man nach Ericcson damit auch, dass die Art der angebotenen Hilfe zu einem weitestgehend normalen Leben beitragen muss. Wenn sie diesen Anspruch nicht erfüllt, ist sie hierzu also nicht passend, und es müssen dann andere Hilfen entwickelt werden (vgl. ebd. 1986, 37). Hilfen, die auf den einzelnen zugeschnitten sind, stellen eine Voraussetzung für ein weitgehend normales Leben dar. Hingegen besteht „[b]ei anonymer Planung […] die große Gefahr, dass den individuellen Bedürfnissen nicht entsprochen werden kann“ (ebd. 1986, 40).
In Deutschland wurde das Normalisierungsprinzip Mitte der siebziger Jahre relevant, als in der 1975 veröffentlichten Psychiatrie-Enquete die Enthospitalisierung, also die Ausgliederung von Menschen mit geistiger Behinderung aus den psychiatrischen Anstalten, gefordert wurde. Mit dieser Vorgabe gingen die Bundesländer unterschiedlich um, und generell kann man sagen, dass „die „Normalisierung“ [...] bis heute nicht flächendeckend abgeschlossen [ist]; sie wird in den letzten Jahren vor allem unter dem Stichwort der Lebens- und Wohnqualität diskutiert und wissenschaftlich untersucht“ (Schildmann 2002, 213). Zu bedenken ist, dass nicht nur die nach außen hin sichtbaren Lebensumstände zu einem normalen Leben beitragen. Gerade im Umgang mit Menschen mit schwereren Beeinträchtigungen spielt das Recht auf eine veränderte Beziehung zwischen Person mit Behinderung und Außenstehenden eine wesentliche Rolle. Nach Nirje plädiert das Normalisierungsprinzip dafür, „dass die Entscheidungen, Wünsche und Hoffnungen geistig behinderter Menschen sowie deren Selbstbestimmung nicht nur respektiert, sondern auch akzeptiert werden“ (Nirje 1994, 22). Es muss dem Menschen daher möglich sein, auf sein tägliches Leben wirklichen Einfluss zu nehmen. Er muss somit die Gelegenheit bekommen seine persönlichen Bedürfnisse und Wünsche zu artikulieren. Normalisierung darf aber auch nicht nur auf die konkrete Lebenssituation des Einzelnen bezogen werden, wobei bestimmte Rechte, die jeder andere erwachsene Mensch für sich in Anspruch nehmen kann, ausgeklammert werden. Thimm beschreibt daher, dass Normalisierung auch bedeutet, Mitbürger mit geistiger Behinderung gleichberechtigt in alle Überlegungen, Planungen und Entscheidungen mit einzubeziehen, die unser eigenes Leben betreffen, also in Bezug auf politische Entscheidungen, in den Schulen, in der Arbeitswelt und im Alltag (vgl. 1986, 27).
Es gibt viele Möglichkeiten, ein Leben zu beschreiben, das in einer bestimmten Gesellschaft als normal gilt. Die acht Forderungen von Nirje sind eine Möglichkeit davon. Es reicht nach Ericcson aber nicht aus, nur von diesen eher organisatorischen Aspekten des Lebens auszugehen, besonders bei dem Punkt des „normalen wirtschaftlichen Standards“. Dieser sollte nicht so zu verstehen sein, dass die finanziellen Mittel gerade eben so das Auskommen sichern. Ebenso wichtig ist die Teilhabe an den qualitativen Aspekten des Lebens. Dies bedeutet, dass die wirtschaftlichen und materiellen Bedingungen einen Standard bieten müssen, der die betreffende Person in die Lage versetzt, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und dieses entsprechend der restlichen Bevölkerung in Anspruch zu nehmen (vgl. ebd. 1986, 38).
Die Forderung nach Normalisierung ist ursprünglich von Fachleuten formuliert worden, nicht von den Betroffenen selbst. Die Vorgabe des Normalisierungsprinzips, dass Menschen mit geistiger Behinderung ein Leben führen können sollen, das in der jeweiligen Gesellschaft als normal gilt, ist somit als Norm von außen vorgegeben worden. Die Frage, ob auch aus der Sicht der Betroffenen durch eine Normalisierung der Lebensumstände eine Steigerung der Lebensqualität erreicht wird, kann nur von diesen beantwortet werden, und wird deutlich bejaht: „Befragungen über die sozialen Bedingungen haben ergeben, dass geistig behinderte Menschen ihr Leben als umso besser einschätzen, je unabhängiger sie wohnen und je anspruchsvollere Arbeiten sie verrichten können“ (Nirje 1994, 21).
2. Aspekte der Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung
Im folgenden Kapitel wird unter Punkt 2.1. zunächst der Begriff der Selbstbestimmung und seine Bedeutung für die Geistigbehindertenpädagogik vorgestellt. Im Anschluss unter Punkt 2.2. folgt ein Überblick darüber, wie sich Selbstbestimmung für den genannten Personenkreis realisieren lässt und schließlich, welche Herausforderungen dies an die Fachleute stellt. Der Punkt 2.3. beinhaltet eine kurze Darstellung des Empowerment-Konzepts, welches entwickelt wurde, um benachteiligten Bevölkerungsgruppen mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen.
2.1. Zum Begriff der Selbstbestimmung
Das Selbstbestimmungsprinzip wird in der Geistigbehindertenpädagogik als notwendige Ergänzung zu den Begriffen Normalisierung und Integration angesehen (vgl. Lindmeier 1999, 209). Selbstbestimmung wird in den letzten Jahren sowohl von Fachleuten als auch von Menschen mit geistiger Behinderung selber verstärkt eingefordert. Von der Realisierung des Selbstbestimmungsprinzips erhofft man sich eine Verbesserung der Integration von Menschen mit geistiger Behinderung und „neue Formen des Gemeinsinns“ (Lindmeier 1999, 210).
Das Recht auf Selbstbestimmung war ein zentraler Punkt der Duisburger Erklärung, die im Anschluss an einen Kongress zum Thema Selbstbestimmung 1994 verabschiedet wurde: „Wir möchten mehr als bisher unser Leben selbst bestimmen. Dazu brauchen wir andere Menschen. Wir wollen aber nicht nur sagen, was andere tun sollen. Auch wir können etwas tun!“ (Bundesvereinigung Lebenshilfe 1996, 10)
Dieser Anspruch von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung macht einen grundlegenden Perspektivwechsel in der Erziehung und Begleitung von eben diesen Personen deutlich. Diesen Perspektivenwechsel kann man in groben Zügen folgendermaßen darstellen:
Von der lebenslangen zur altersgemäßen
Fremdbestimmung durch Þ Selbstbestimmung
StellvertreterInnen Þ des eigenen Lebens.
Vom Behandeln und Fördern zum gemeinsamen
durch Fachleute Þ Verhandeln im Dialog.
Von Defiziten Þ zu den Rechten.
(vgl. osbahr 2003, 193)
Aber was ist genau unter dem Begriff Selbstbestimmung zu verstehen? Die Bedeutung des Begriffs der Selbstbestimmung scheint auf den ersten Blick schnell deutlich zu sein. Es handelt sich um ein zusammengesetztes Wort aus den Wortteilen „Selbst“ und „Bestimmung“, und bedeutet somit, dass man über sich und sein Leben selbst bestimmt, also Wahlmöglichkeiten vorhanden sind und man dementsprechende Entscheidungen trifft. Wahrscheinlich jeder (nichtbehinderter) erwachsener Mensch, der in einem demokratischen Staat lebt, würde von sich spontan sagen, dass er über sein Leben selbst bestimmt. Bei genauerer Betrachtung wird allerdings deutlich, dass es im Leben von allen Menschen immer wieder Einschränkungen von außen gibt, also Fremdbestimmung stattfindet. Kein Mensch kann jederzeit völlig frei, ohne den Rest der Gesellschaft zu beachten, seine Selbstbestimmung ausüben. Der „Mensch ist nie bloß Individuum, er ist immer auch Teil einer sozialen Umwelt, die ihn stützt“ (Herzog 1991, 396, vgl. Cohn 1988, 120ff.). Am Beispiel der beruflichen Arbeit lässt sich dieses verdeutlichen. Wenn sich eine Person dafür entscheidet, eine bestimmte Arbeitsstelle antreten zu wollen, weil sie sich von der Arbeit für sich etwas Wichtiges erwartet, begibt sie sich zugleich in eine Fremdbestimmung durch den zukünftigen Arbeitgeber. Dieser bestimmt, was die betreffende Person zu tun hat, wann sie arbeitet, wie viel sie verdient, welche Aufstiegschancen sie hat usw. Weiß sagt hierzu, dass es „kennzeichnend für die Existenz jeden Menschens ist, dass er sein ganzes Leben lang in unterschiedlicher Gewichtung in einem spannungsvollen Zusammenhang von Autonomie und Abhängigkeit, von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung steht“ (Weiß 2000, 121).
Steiner stellt die beiden Begriffe Selbst- und Fremdbestimmung einander gegenüber. Seiner Ansicht nach muss Selbstbestimmung im Sinne von „Autonomie“ definiert werden, worunter er das Recht, seine Angelegenheiten selbst zu ordnen versteht. „Selbstbestimmung grenzt sich damit sehr deutlich von Fremdbestimmung ab, ist quasi ein Gegenbegriff zu jeglicher Fremdbestimmung“ (Steiner 1999, 2). Er betont aber, dass „Selbstbestimmung […] nie ein Alles-Oder-Nichts-Prinzip oder gar ein Synonym zu Selbstverwirklichung [ist]. Selbstbestimmung heißt, sich für eine Möglichkeit zu entscheiden und zwar in Abwesenheit institutionalisierter Zwänge und bevormundender Fachlichkeit“ (ebd. 1999, 10). Es steht somit „außer Frage, dass die Idee der Selbstbestimmung als rigider Egoismus und Individualismus aufs Schärfste zurückgewiesen und verworfen werden muss“ (Theunissen, Plaute 1995, 54).
Selbstbestimmung wird in unserer Gesellschaft verschiedenen Personengruppen in unterschiedlichem Maße zugestanden. Bei Kindern und Jugendlichen bis zu einem bestimmten Entwicklungsstand wird die Selbstbestimmung von beteiligten Erwachsenen, Eltern, Lehrkräfte usw., in unterschiedlichen Lebenssituationen völlig selbstverständlich mehr oder weniger stark eingeschränkt. Dies wird damit begründet, dass die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und deren Konsequenzen auch abzusehen, schrittweise gelernt werden muss (vgl. Mühl 1997, 312). Der Schulabgänger beispielsweise kann für sich entscheiden, dass es richtig ist, aus der Heimatstadt wegzuziehen und somit Familie und Freunde vorübergehend zu verlassen, um in einer anderen Stadt seine Ausbildung anzufangen. Dies kann er aber nur, weil er es von Kindheit an gelernt hat, Entscheidungen, die langsam immer schwerwiegender wurden, selber zu treffen. Fremdbestimmung ist somit ein „notwendiges Bestimmungsstück von Erziehung“ (Mühl 1997, 312). Die Fähigkeit hierzu ist somit in unserer Gesellschaft ein entscheidendes Kriterium des Erwachsenseins: „Erwachsenwerden heißt im weiteren Sinne ein höchstmögliches individuelles Maß an Mündigkeit und Autonomie zu erlangen, d.h. möglichst selbständig und selbstbestimmt leben zu können“ (Harnack 1997, 49).
In dieser Definition von Erwachsenwerden gehören Selbständigkeit und Selbstbestimmung offensichtlich zusammen. Wenn man sich auf solche Definitionen von geistiger Behinderung bezieht, in denen als Kennzeichen dieser Personengruppe die lebenslange Abhängigkeit von Hilfe benannt wird, liegt der Schluss nahe, dass das Konzept des Erwachsenwerdens, für diesen Personenkreis kein realisierbares Ziel darstellt.
Menschen mit geistiger Behinderung gehören noch immer zu den gesellschaftlichen Gruppen, die in hohem Maße Fremdbestimmung, und zwar häufig lebenslang, erfahren. Es hat sich gezeigt, dass das Ausmaß der Fremdbestimmung umso höher ist, je schwerer die Behinderung der betreffenden Person eingeschätzt wird. Daher ist es sinnvoll, den Zielaspekt der Selbstbestimmung für diesen Personenkreis besonders herauszustellen. Bei erwachsenen Menschen ohne Behinderung erscheint dieses nicht notwendig, weil bei ihnen Selbstbestimmung wie selbstverständlich vorausgesetzt wird (vgl. Mühl 1997, 313). Geht man davon aus, dass geistige Behinderung im Wechselspiel von inneren und äußeren Einflüssen sich entwickelt, kann man von folgenden Überlegungen ausgehen: Da Selbstbestimmung ein relativer Begriff ist, gibt es auch nicht das absolute Maß an Selbstbestimmung. Wie bereits dargestellt, sind alle Menschen in Strukturen eingebunden, welche die Berücksichtigung der Interessen anderer einfordern. Man kann somit sagen, dass die Handlungsräume jeder Person unterschiedlich groß sind und dass durch Veränderungen der Lebenssituation Entscheidungsräume erweitert oder verkleinert werden (vgl. Niehoff-Dittmann 1996, 58). Die Ausübung von Selbstbestimmung muss zunächst gelernt werden, auch wenn das Potential zur Selbstbestimmung grundlegend jeder Mensch aufweist. Von einer Person mit geistiger Behinderung, der bisher keine Möglichkeit zu diesem Lernprozess gegeben wurde, kann daher nicht erwartet werden, dass sie diese Fähigkeit spontan zeigt, was aber nicht heißen darf, dass sie diese Fähigkeit nicht lernen kann (vgl. Osbahr 2003, 24). Bei einer solchen Einschätzung einer Person setzt dann aber ein Teufelskreis ein. Eine bestimmte Person hat Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung, woraufhin die andere Person stellvertretend wählt. Wenn aber Entscheidungen immer von anderen Personen getroffen werden, gibt es keinen Grund für die behinderte Person, selbst zu wählen. Sie muss somit keine Verantwortung übernehmen und Risiken eingehen. Dadurch gibt es keine Möglichkeit für die betreffende Person, Entscheidungsfähigkeit stufenweise zu erlernen (vgl. Niehoff-Dittmann 1996, 56). Selbstbestimmung beginnt nicht erst bei weitreichenden Entscheidungen, die die gesamte Lebenssituation betreffen, sondern bei alltäglichen „kleinen“ Entscheidungen, die normalerweise kontinuierlich getroffen werden. Beispiele sind die Wahl der Kleidung, des Frühstücks, die Entscheidung „Lesen oder Fernsehen?“ usw. Menschen mit geistiger Behinderung aber werden auch solche Entscheidungen häufig abgenommen. Selbstbestimmt leben zu können, heißt also für Menschen mit geistiger Behinderung wie für alle Menschen, dass sie ihre eigenen Lebensziele in freier Entscheidung verwirklichen können und dadurch Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu übernehmen (vgl. Harnack 1997, 53).
Bei Menschen mit Behinderungen, v.a. körperlicher oder geistiger Behinderung, ist zu beachten, dass Selbstbestimmung nicht mit Selbständigkeit gleichgesetzt wird. Auch bei Tätigkeiten, bei denen eine Person Unterstützung benötigt, sei es für einen körperlich beeinträchtigten Menschen manuelle Hilfe oder für Menschen mit geistiger Behinderung Begleitung bei einem Behördenbesuch, kann diese Person nach dem beschriebenen Begriffsverständnis Selbstbestimmung ausüben. Umgekehrt kann sie allerdings auch ein relativ großes Maß an Selbständigkeit erlangt haben, diese aber nicht in Selbstbestimmung umsetzen, wenn von den entsprechenden pädagogischen oder pflegerischen Kräften keine Gelegenheit hierzu gegeben wird (vgl. Frühauf 1994, 54 f.). Grundlegend steht hinter einem solchen Verständnis von Selbstbestimmung ein Menschenbild, das darauf vertraut, dass menschliche „Entwicklung […] auf Zuwachs an Autonomie angelegt [ist], auch die Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung!“ (Hahn 1994, 81).
Die beiden Begriffe Selbstbestimmung und Autonomie werden teilweise synonym verwendet. Der Mensch gilt dann als autonom, wenn er die Möglichkeit hat, Entscheidungen selbst zu treffen, also selbst zu bestimmen, wobei dies aber nie in völliger sozialer Unabhängigkeit möglich sei. Welche Folgen ein Entzug von Selbstbestimmung hat, wird daran deutlich, dass in allen Kulturen hierin eine Bestrafungsform besteht, um auf diese Weise der Person eine Einschränkung des Wohlbefindens zuzuführen. Hahn erklärt dies damit, dass in selbst getroffene Entscheidungen immer individuelle Bedürfnisse eingehen, und somit Selbstbestimmung eine grundlegende Bedeutung für die Befriedigung von Bedürfnissen hat (vgl. Hahn 1994, 82f.).
In jede Entscheidung gehen Erfahrungen in Bezug auf die Entscheidungssituation ein, die vorher gemacht wurden, wodurch das Ergebnis einer Entscheidung von der betreffenden Person als sinnvoll angesehen wird. Dies ist dann der Fall, wenn zwischen dem Ergebnis einer Entscheidung und der Realisierung der zugrundeliegenden Zielvorstellung Einklang besteht. Diesen Einklang können wir nach Hahn am besten herstellen, wenn wir die Entscheidung selbst treffen können und andere nicht mit- oder fremdbestimmen. Andere Personen kennen unsere Ziele nicht oder nur ungenügend und stehen deshalb ihrer Verwirklichung vielleicht im Wege. Daher „ist die Sinnhaftigkeit menschlichen Wirkens wesenhaft in Selbstbestimmung gebunden. Menschliches Dasein ist aus diesem Grund durch das Streben nach größtmöglicher Freiheit gekennzeichnet, weil sich darauf die subjektiv erkennbare Sinnhaftigkeit des Lebens gründet“ (Hahn 1994, 83 f.).
Fremdbestimmung zeigt sich immer noch gerade in der Geistigbehindertenpädagogik in vielen Bereichen: das Verständnis dessen, was unter geistiger Behinderung verstanden wird, wird von Fachleuten, nicht von Betroffenen formuliert und überwiegend sind es Menschen ohne Behinderung, die das Leben, Lernen und Arbeiten von Menschen mit geistiger Behinderung bestimmen. Man kann also sagen, dass noch immer überwiegend für Menschen mit geistiger Behinderung gedacht, geplant und gesorgt wird (vgl. Harnack 1997, 51).
2.2. Zur Realisation von Selbstbestimmung
Zwei wichtige Aspekte in Bezug auf die Realisierung von Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung werden in den beiden folgenden Zitaten deutlich. Beide beschreiben den nötigen Wandel in der Einstellung gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung in unserer Gesellschaft:
„Menschen mit Behinderungen wollen nicht länger so leben, wie es die Nichtbehinderten vorschreiben, sondern selbstbestimmt. Und das verlangt von der nichtbehinderten Gesellschaft ein grundsätzlich neues Bild von Menschen mit Behinderungen“ (Zemp 1995, 9). Seifert beschreibt, dass Menschen mit geistiger Behinderung vieles nicht zugetraut wird. „Sie werden zu angepasstem Verhalten erzogen, sind gewöhnt, dass andere den Alltag für sie gestalten und alle Entscheidungen für sie treffen“ (ebd. 1995, 28).
Während Zemp allgemein einen Wandel in der Gesellschaft fordert, beschreibt Seifert konkreter, wie sich die Gesellschaft gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung verhält, und dass dieses Verhalten Folgen hat, für die Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung. Dies sind Folgen die, im Zuge einer self-fulfilling-prophecy, auch heute noch bei vielen Fachleuten das Bild bestätigen, das sich diese von geistiger Behinderung machen. Zu nennen wären hier Aspekte wie Abhängigkeit, Hilflosigkeit, kindliche Verhaltensweisen usw. Diese werden Definitionen von geistiger Behinderung deutlich, welche teilweise noch aus den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts stammen. Einen Überblick über solche Beschreibungen von geistiger Behinderung gibt Thimm (vgl. ebd. 1994b, 8 ff.).
Weiß verweist darauf, dass der Zusammenhang von Autonomie und Abhängigkeit entwicklungspsychologisch eine wichtige Rolle spielt (vgl. ebd. 2000, 121). Aus psychoanalytischer Sicht kann sich das kindliche Selbst nur in der Beziehung zu anderen differenzierend ausbilden. Dies geschieht in einem spannungsvollen Prozess zwischen Selbstbehauptung und wechselseitiger Anerkennung von Mutter und Kind. Ist dieses Gleichgewicht von Autonomie und Abhängigkeit gestört, entstehen schon im Kindesalter Verhältnisse, die durch Herrschaft und Unterwerfung geprägt sind und somit der Ausbildung von Identität entgegenstehen. Hahn macht in dem Zusammenhang deutlich, dass Menschen, die ständig fremdbestimmt werden, sich selbst nicht kennen lernen und Fremddefinitionen zu Eigen machen (vgl. ebd. 1996, 26). Zu einer ähnlichen Annahme kommen Speck und Peterander, allerdings aufgrund von konstruktivistisch-systemtheoretischen Positionen (vgl. ebd. 1994, 116f).
In der Vergangenheit führte der verhaltenspsychologische Ansatz, welcher den Eindruck erweckte, als könnten Menschen, v.a. Menschen mit geistiger Behinderung, nur über äußere Konditionierung lernen, dazu, die Selbstbestimmung bei diesen Personen zu missachten. Erst als sich kognitionswissenschaftliche Erkenntnisse verbreiteten, wurde es möglich, die Autonomie auch von Menschen mit geistiger Behinderung adäquat zu begründen und erklären (vgl. Speck 1996, 15). Den Erwachsenenstatus von Menschen mit geistiger Behinderung zu beachten und diese nicht zu infantilisieren, scheint allerdings noch immer schwierig für viele Familien und Professionelle zu sein. Entsprechend von Definitionen von geistiger Behinderung, die als Hauptmerkmal die lebenslange Abhängigkeit benennen, werden Menschen mit geistiger Behinderung als ewige Kinder angesehen und somit in ihren Selbstbestimmungsmöglichkeiten begrenzt (vgl. Theunissen, Plaute 1995, 57). Aber auch wenn Selbstbestimmung von einer Einrichtung proklamiert wird, ist dies noch keine Garantie dafür, dass die betreffenden Personen wirklich über sich selbst bestimmen können. Theunissen bezeichnet dies mit heimlicher Fremdsteuerung, die zeigt, dass mangelndes Vertrauen in die Ressourcen von Menschen mit geistiger Behinderung vorherrschend ist (vgl. Theunissen, Plaute 1995, 59). Unter dem Begriff der Entpädagogisierung wird gefordert, dass es bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung nicht in erster Linie darum gehen darf, von außen Ziele zur Steigerung von Kompetenzen zu setzen. Schließlich besteht für Erwachsene ohne Behinderung auch nur die Möglichkeit und das Angebot der Weiterbildung und Weiterentwicklung, aber keinerlei Zwang oder Pflicht. Es darf somit nicht um eine Förderung um jeden Preis gehen, sondern vor allem um das wirkliche Akzeptieren der jeweiligen Person. Die Annahme von Angeboten zur Förderung soll daher von der betreffenden Person freiwillig erfolgen (vgl. Lindmeier 1999, 210 f.).
Wahrscheinlich kennt jeder, der schon mal mit Menschen mit geistiger Behinderung zu tun hatte, Menschen aus diesem Personenkreis, die scheinbar gar keine Wahlen treffen können, und die nicht wissen, wie sie sich bei Wahlmöglichkeiten entscheiden sollen. Seligmann hat diesen Zustand als „erlernte Hilflosigkeit“ (ebd. 1986) bezeichnet. Dem kann nur entgegengewirkt werden, indem die pädagogische Praxis auf eine weitgehende Selbstentscheidung und Situationskontrolle ausgerichtet ist. So verstanden, ist auch die Förderung von Selbstbestimmung, wie sie im Titel dieser Arbeit benannt wird, kein Widerspruch in sich. Der Ausdruck ist insofern passend, solange Menschen mit geistiger Behinderung noch immer zu wenige Möglichkeiten bekommen, zu lernen, Selbstbestimmung auszuüben. Selbstbestimmung ist aber letztlich nicht von außen bestimmbar und kann schon gar nicht verordnet oder durch irgendein Fördertraining einfach hergestellt werden. Den Begriff der Förderung beziehe ich somit nicht auf bestimmte Fähigkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung, die direkt gefördert werden sollen. Bundschuh u.a. benennen bei einem solchen Verständnis des Begriffs der Förderung außerdem die Gefahr des fremdbestimmten Umgangs mit Behinderung (vgl. ebd. 2002, 84). Ein anderes Verständnis von Lernen und somit von Förderung ergibt sich aus konstruktivistischer Sicht. Osbahr schreibt hierzu, dass Lernen aus konstruktivistischer Sichtweise nur von der jeweiligen Person, also vom einzelnen lebenden System, „selbst individuell vollzogen oder hervorgebracht werden. Lernen ist so der selbsttätige Prozess, in welchem das lebende System mit „Störungen“ umgeht, und ist zu verstehen als sinn-konstituierende Wirklichkeitsaneignung eines lebenden Systems. Dieser Prozess kann von außen nicht direkt instruiert, sondern nur angeregt und begleitet werden“ (ebd. 2003, 103).
Das Verständnis des Begriffes der Förderung, welches dieser Arbeit zugrunde liegt, bezieht sich somit im Kontext von Selbstbestimmung auf die Umweltsituation, die so gestaltet sein soll, dass Selbstbestimmung ermöglicht und angeregt sowie Fremdbestimmung weitestgehend vermieden wird. Solange dies noch nicht überall verwirklicht ist, müssen wir als Fachleute die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung beachten und so die Entscheidungsfähigkeit fördern. Wenn diese weitestgehend entwickelt ist, wird die betreffende Person voraussichtlich ihr Mit- bzw. Selbstbestimmungsrecht auch in stärker restriktiven Lebenssituationen in Zukunft einfordern.
Auf der anderen Seite ist allerdings auch die Gefahr zu sehen, dass im gutgemeinten Sinne von Normalisierung und Integration von den betreffenden Personen zuviel verlangt wird. Das eventuelle Scheitern würde dann womöglich als Bestätigung des generellen Nicht-Könnens ausgelegt. Osbahr fordert in diesem Zusammenhang, dass die Sonderpädagogik Selbstbeschreibungen und Forderungen von Menschen mit Behinderungen ernster denn je nehmen sollte. Seiner Meinung nach, hat sie „einen Beitrag zu leisten, um Leitideen wie Normalisierung der Lebensbedingungen, personale und soziale Integration und Selbstbestimmung der Verwirklichung näherzubringen“ (ebd. 2003, 21; Hervorhebungen im Original).
Osbahr schlägt vor, dass ein „Arbeitsprogramm Selbstbestimmung“ sowie „adäquate theoretische Modelle der sonderpädagogischen Aufgabenbeschreibung und Problembearbeitung entwickelt“ (ebd. 2003, 21) werden, in dem folgende Ausgangsthesen grundlegend sind:
„Menschen mit Behinderungen verfügen über Möglichkeiten der Selbstbestimmung in bedeutsamen Bereichen ihrer eigenen Lebensführung. Wichtig ist, dass Menschen mit Behinderungen befähigt werden, diese Möglichkeiten zu entwickeln und zu nutzen. Dabei geht es um geeignete Unterstützungsangebote. Aufgabe von Sonderpädagogik und Sozialpolitik ist ebenso, gesellschaftliche Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt(er) leben können“ (vgl. ebd. 2003, 21).
2.3. Selbstbestimmung als Herausforderung an die Professionellen
Im vorangegangenen Kapitel ist deutlich geworden, dass es in erster Linie der Gesellschaft obliegt, ihr Selbstverständnis von der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung so zu gestalten, dass deren Selbstbestimmung verwirklicht werden kann. Dies setzt grundlegende Veränderungen im Denken und in der Beziehungsgestaltung zu den betreffenden Personen voraus. „Selbstbestimmung ermöglichen setzt die Bereitschaft voraus, sich auf einen Dialog einzulassen, in dem wir über die Bedürfnisse und Intentionen unseres Gegenübers etwas erfahren.“ (Hahn 1996, 26)
Grundlegende Voraussetzung für die Realisation von Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung ist die Wertschätzung und Achtung der betreffenden Person als Partner. Hierzu gehört das Aufgeben von Machtpositionen, die man als Professioneller einnehmen kann, was noch nicht überall selbstverständlich ist. Es ist eben einfacher, Menschen mit geistiger Behinderung zu befürsorgen und ihren Alltag nach den eigenen wohlgemeinten Vorstellungen zu gestalten, statt sie hierin einzubeziehen und ihre Entscheidungen dann auch zu respektieren. Die Forderung nach mehr Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung trifft somit unmittelbar das Selbstverständnis ihrer Betreuer. Der Begriff des Betreuers wird daher teilweise durch den neuen Begriff Begleiter bzw. Assistent ersetzt. „Es geht nicht mehr darum, den Alltag für geistig behinderte Menschen oder bestenfalls mit ihnen zu gestalten. Die Wünsche der Betreuten sind nach der neuen Philosophie primärer Orientierungspunkt“ (Seifert 1995, 27; Hervorhebung im Original). Hähner sagt hierzu, dass sich somit der Einfluss der Professionellen auf den einzelnen behinderten Menschen minimiert. Seine Entscheidungen, seine Lebensplanung sowie seine persönliche Entwicklung müssen respektiert werden, solange nicht Rechte und Freiheiten anderer Menschen in Frage gestellt werden (vgl. ebd. 1998, 148). Dies bedeutet nach Osbahr allerdings auch, dass mit zunehmender Selbstbestimmung Risiken oder Unwägbarkeiten zunehmen und dass individuelle Unterschiedlichkeiten somit auf allen Ebenen deutlicher zutage treten (ebd. 2003, 213). Das Konzept der Assistenz, wie es in der Arbeit mit Menschen mit Körperbehinderungen entwickelt wurde, muss im Rahmen der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung um den Aspekt der Begleitung erweitert werden. Dies ist nötig, da diese meist Schwierigkeiten haben, ihren eigenen Hilfebedarf einzuschätzen und andere Personen anzuleiten (vgl. ebd. 1998, 53). Begleitung heißt somit nicht einfach Unterordnung des Professionellen, also keine Umkehrung der bisherigen Machtverhältnisse. Stattdessen soll eine „dialogische Begleitung“ (Lindmeier 1999, 212) entwickelt werden, innerhalb dessen das Handeln davon geleitet ist, sich auf die andere Person einzustellen (vgl. ebd. 1999, 212).
Cloerkes stellt dar, dass die Forderung nach Emanzipation und Autonomie dem berufsspezifischen Interesse der Professionellen gegenübersteht. Dieses sei darauf gerichtet, dass es möglichst viele Menschen mit Behinderung gibt und dass man von ihnen gebraucht wird. Als Folge davon würde sich der berufliche „Marktwert relativieren bzw. unbequeme Veränderungen der gewohnten Berufspraxis“ (ebd. 2001, 60 f.) erzwungen werden. Wenn man als Professioneller davon überzeugt ist, dass Menschen mit geistiger Behinderung zu einer wesentlich größeren Entscheidungsfähigkeit als bisher kommen können, muss man entsprechende Rahmenbedingungen und Hilfen ermöglichen. Dies setzt „ein pädagogisches Konzept voraus, das sich, von der Empowerment-Philosophie durchdrungen, an den Leitprinzipien der Entwicklungs- und Altersgemäßheit, der Subjekt- und Kommunikationszentrierung sowie der Ganzheitlichkeit und des handelnden Lernens in realen Lebenswelten zu orientieren hat“ (Theunissen, Plaute 1995, 21).
Mühl betont, dass, wenn mit der Schwere der Behinderung das Maß an Fremdbestimmung zunimmt, die Fachleute ganz besonders darauf zu achten haben, der betreffenden Person „„Selbstbestimmung in sozialer Integration“ zu vermitteln“ (ebd.1994, 95). Gerade Personen, die bislang solche Entscheidungen nie treffen durften, brauchen Zeit, für solche Entscheidungen, die wir ihnen geben müssen; Zeit, um zunächst die Wahlmöglichkeiten zu erkennen, die Entscheidung dann zu treffen und um schließlich ihre Entscheidung, deutlich zu machen. Der letzte Punkt ist dann der Entscheidende auf Seiten der jeweiligen Bezugsperson. Es kommt darauf an, die jeweiligen Ansätze von Willensbekundungen zu erkennen, ernst zu nehmen und aufzugreifen, besonders bei Menschen, die nicht oder kaum über Lautsprache verfügen (vgl. Theunissen, Plaute 1995, 65). Zu Recht weist Wilken allerdings auch darauf hin, dass „Selbstbestimmung auch als Selbstbestimmungszwang und damit als Überforderung erlebt werden“ kann (ebd. 1996, 45). Dies erfordert somit einen pädagogischen Mittelweg, der den aktuellen Willen zur eigenen Entscheidung und die jeweilige Entscheidungsfähigkeit berücksichtigt. Wahrscheinlich kennt Jeder den zeitweiligen Wunsch, eine bestimmte Entscheidung nicht allein treffen zu müssen und sie jemand anderes zu übertragen. Solche Momente wird es gerade bei Menschen häufiger geben, die es bisher nicht gewohnt waren, Entscheidungen selbst zu treffen und dies teilweise womöglich zunächst auch als anstrengend empfinden. Meiner Ansicht nach, sollte man auch in diesem Fall die Selbstbestimmung der betreffenden Person beachten und ihre Entscheidung, eben nicht selbst entscheiden zu wollen, berücksichtigen. Hierbei ist allerdings ganz deutlich die Gefahr zu sehen, dass man diesen Mittelweg verlässt, und beispielsweise aus Zeitgründen nicht lange genug auf die Signalisierung der Entscheidung wartet, sondern vorzeitig wieder selbst bestimmt, mit der Begründung, die betreffende Person möchte dies gerade so.
2.4. Das Empowerment-Konzept – Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen
Im vorigen Kapitel ist deutlich geworden, dass weitgehende Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung zum einen grundlegende Veränderungen auf Seiten der Professionellen verlangt. Auf der anderen Seite werden aber auch von den betreffenden Personen selber Entscheidungen, Fähigkeiten und Kompetenzen eingefordert. An diesem Punkt setzt das Konzept des Empowerments an, welches von einer Einschätzung der Stärken und Ressourcen der betreffenden Person ausgeht (vgl. Bradl 2002, 293). Empowerment kann mit dem Begriff „Selbstbemächtigung“ bzw. „Selbst-Ermächtigung“ übersetzt werden (vgl. Cloerkes 2001, 60). Theunissen beschreibt, dass, der Begriff für eine neue Philosophie des Helfens steht. Zugleich gilt Empowerment aber auch als ein neues Programm oder Konzept. Der Begriff werde zudem „im reflexiven und transitiven Sinne benutzt (sich selbst befähigen und ermächtigen; aber auch jemanden dazu verhelfen, sich zu emanzipieren)“ (ebd. 2001, 251). Der Wortteil „power“ beziehe sich zum einen auf politische Macht, zum anderen auf persönliche Stärke, Kompetenz und Alltagsbewältigung, so dass durch den Begriff sowohl mikro- als auch makrosystemische Ebenen erfasst werden (vgl. ebd. 2001, 251).
Das Konzept des Empowerments ist nicht auf die Sonderpädagogik beschränkt, sondern entwickelte sich aus der Praxis von Selbsthilfeinitiativen und Projekten mit den unterschiedlichsten Adressaten wie Arbeitslose, sozial Benachteiligte, psychisch Kranke, Menschen mit Behinderungen oder alleinerziehende Mütter (vgl. Theunissen, Plaute 1995, 11). Das Ziel des Konzepts ist die Überwindung von sozialen Ungerechtigkeiten, Benachteiligung und Ungleichheiten. Die betreffenden Personengruppen sollen eine größtmögliche Kontrolle über ihre eigenen Lebensumstände durchsetzen. „Empowerment ist somit das Markenzeichen für eine Neubestimmung des professionellen Handelns in sozialen Arbeitsfeldern, die ebenso revolutionär wie provokativ anmutet – revolutionär, da sie mit dem alten Paradigma administrativ-bevormundender und kontrollierender Fürsorglichkeit bricht, provokativ, weil sie die Expertenposition nicht mehr den helfenden Sozialberufen, sondern ihren Adressaten zuspricht“ (Theunissen, Plaute 1995, 11). Mit Empowerment werden daher alle Möglichkeiten und Hilfen bezeichnet, die es den betreffenden Personen ermöglichen, mehr Kontrolle über ihr Leben zu bekommen, indem sie im Austausch mit anderen ihre eigene Stärke erkennen und sich die betroffenen Personen selber gegenseitig ermutigen, ihr Leben und ihre soziale Umwelt zu gestalten (vgl. Niehoff 1998, 56). Nach Cloerkes geht es somit darum, die Selbstbestimmung der Personen (wieder-)herzustellen sowie sich von Fremdbestimmung zu emanzipieren. Als Konsequenz dieses neuen Denkens beschreibt er, dass somit die Helfer, also auch Sonderpädagogen, lediglich Dienstleistungen an Menschen mit Behinderungen erbringen. Die bisher herrschenden Machtverhältnisse werden dadurch grundlegend verändert, beziehungsweise umgekehrt (vgl. ebd. 2001, 60). Alle Maßnahmen haben sich an der Betroffenenperspektive, der Interessenlage und den speziellen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen zu orientieren. Die Auswahl der Maßnahmen ist nur in Kooperation mit den Betroffenen legitim.
Das Konzept setzt „auf die Verantwortlichkeit der Betroffenen und wendet sich gegen die Verhaltenserwartungen des medizinischen Modells, wie sie in der Rolle des Patienten definiert sind“ (Theunissen, Plaute 1995, 19). Eine entscheidende Voraussetzung für gelingende Empowermentprozesse ist das Vertrauen von Seiten der Fachpersonen in die Fähigkeiten und Ressourcen der betreffenden Person. Es ist daher nötig, Menschen mit Behinderung nicht mehr defizitär zu betrachten, sondern als kompetente Person wahrzunehmen, und sie dabei zu unterstützen, ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten zu entfalten (vgl. ebd. 1995, 13).
Vorbild für die deutsche Rezeption des Empowerment-Konzepts innerhalb der Sonderpädagogik ist die amerikanische Independent-Living-Bewegung. Diese entwickelte sich zu Beginn der 60er Jahre und unterhält heute zahlreiche Beratungs- und Dienstleistungszentren, in denen Menschen mit Behinderungen ihre Angelegenheiten in eigenverantwortlicher Regie selbst managen und sich selbst beraten (vgl. ebd. 1995, 15).
Das Konzept des Empowerments wurde zunächst im Zusammenhang mit dem Personenkreis der körper- bzw. sinnesbeeinträchtigten Menschen entwickelt und verbreitet. Theunissen und Plaute beschreiben, dass viele Eltern und Vertreter der traditionellen Behindertenhilfe dem Konzept in Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung eher skeptisch gegenüberstehen. Es werde die Gefahr genannt, dass die Bedürfnisse und Fähigkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung falsch eingeschätzt werden könnten, was zu einer Überforderung und womöglich Vernachlässigung führen könnte. Diese Befürchtungen hängen auch damit zusammen, dass in Nordamerika und Skandinavien Personen mit geistiger Behinderung bezeichnet werden, die in Deutschland der Gruppe der Menschen mit Lernbehinderung zugerechnet werden. Wenn dann konkrete Berichte aus diesen Ländern nach Deutschland kommen, kann dies zu falschen Einschätzungen des Unterstützungsbedarfs der betreffenden Personen führen. Scheitern dann entsprechende Versuche, v.a. mit Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, ist die Gefahr groß, dass diese Personen wiederum nicht von Veränderungen in der Behindertenarbeit profitieren, sondern erneut ausgegrenzt werden (vgl. ebd. 20 f.). Die Autoren warnen außerdem davor, dass das Konzept des Empowerments falsch verstanden werden könnte. „Geistig behinderte Menschen können nicht einfach unter der Parole der Selbstbestimmung in die „Normalität“ entlassen werden und sich damit selbst überlassen bleiben“ (ebd. 1995, 23). Stattdessen ziele Empowerment vielmehr darauf ab, die Hilfen so zu organisieren, dass die Möglichkeiten der Selbstbestimmung in sozialer Bezogenheit als auch mehr individuelle Autonomie realisiert werden können (vgl. ebd. 1995, 23). Grundlegend wird die Fähigkeit hierzu im Empowerment-Konzept bei jedem Menschen vorausgesetzt, womit aber nicht ausgeschlossen wird, dass diese Fähigkeit bei einzelnen Menschen sozusagen verschüttet ist und erst entwickelt werden muss (vgl. Theunissen, Plaute 1995, 61). Genau hierin besteht daher die Aufgabe der Professionellen, wie ich es im vorangegangenen Kapitel dargestellt habe, nämlich geeignete Prozesse zu initiieren, die es den betreffenden Personen ermöglichen, ihre Lebensumstände weitestgehend selbst in die Hand zu nehmen (vgl. Niehoff 1998, 56 f.).
3. Integration von Menschen mit geistiger Behinderung
Im folgenden Kapitel wird zunächst unter Punkt 3.1. der Begriff „Integration“ aus Sicht der Sonderpädagogik vorgestellt, wobei auf die Ziele einer schulischen Integration und dessen gesamtgesellschaftliche und individuelle Bedeutung eingegangen wird. Unter Punkt 3.2. werden dann die Prinzipien der Integrationspädagogik kurz dargestellt. .
3.1. Integration – eine Begriffsbestimmung
Allgemein wird mit dem Begriff „Integration“ in der Pädagogik überwiegend die gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und ohne Behinderung bezeichnet. Dies wird auch in der häufigen Verwendung des Begriffes Integration im Zusammenhang mit dem Begriff „Kinder“ deutlich, wie in der folgenden Definition: „[Integration] meint die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher. Die I. Behinderter ist ein Thema weitreichender interaktiver und institutioneller Konsequenzen, das die Schullandschaft nachhaltig ändern wird“ (Martens 1994, 161). Sonderschulen sollen nach dem Integrationsgedanken soweit wie möglich überflüssig werden, d.h. die Regelschulen sollen in die Lage versetzt werden, SchülerInnen mit Behinderung aufzunehmen und angemessen zu fördern. Im Sinne des Normalisierungsprinzips sollen Kinder mit Behinderungen die Institutionen besuchen, die den üblichen am Nächsten kommen, also den örtlichen Kindergarten, die Grundschule usw. (vgl. Möckel 1997, 45). Eine Integration im vorschulischen und schulischen Bereich soll letztlich einer gesellschaftlichen Integration auch im Erwachsenenleben dienen. Schon 1973 sagt hierzu der Deutsche Bildungsrat „dass die Integration Behinderter in die Gesellschaft eine der vordringlichen Aufgaben jedes demokratischen Staats ist […] [und hierzu] die Selektions- und Isolationstendenz im Schulwesen überwunden und die Gemeinsamkeit im Lehren und Lernen für Behinderte und Nichtbehinderte in den Vordergrund gebracht werden [sollen]; denn eine schulische Aussonderung der Behinderten bringt die Gefahr ihrer Desintegration im Erwachsenenleben mit sich“ (Deutscher Bildungsrat 1973,16). Ohne den beständigen Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen kann die Gesellschaft nicht lernen, „Menschen zu akzeptieren, welche anders, langsamer oder in ungewohnten Formen leben und lernen“ (Ginnold 2000, 9).
In der Pädagogik wurde der Begriff „Integration“ zunächst nur im Zusammenhang mit entwicklungs- und persönlichkeitspsychologischen Zusammenhängen verwendet (vgl. Kobi 1997, 74). Nach Markowetz nimmt der Integrationsbegriff heute eine zentrale Rolle in der Auseinandersetzung um das gegliederte Schulwesen ein und hat sowohl eine personale als auch soziale Bedeutung. Aus Sicht der Behindertensoziologie handelt es sich bei Integration um einen Interaktionsprozess, der zur Entstigmatisierung beiträgt und auf soziale Zuschreibungsprozesse verzichtet. Integration bedeutet letztlich, dass alle Menschen mit Behinderung, unabhängig von Art und Schwere, in allen Lebensbereichen die gleichen Zugangsmöglichkeiten haben sollen wie Menschen ohne Behinderung (vgl. ebd. 2001, 173). Jede Form der Aussonderung widerspricht dabei dem Grundgesetz, nämlich dem Artikel 3, Absatz 3, Satz 2: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“. Somit haben alle Menschen mit Behinderungen, unabhängig von Art und Schwere dieser, den gesetzlich verankerten Anspruch auf die gleichen Möglichkeiten und Chancen zur Teilhabe in der Gesellschaft wie nichtbehinderte Personen (vgl. Markowetz 2001, 173).
Semantisch betrachtet sind die Begriffe Integration und integrieren aus den lateinischen Wörtern integrare (deutsch: heil, unversehrt machen; wiederherstellen; ergänzen), integralis (deutsch: ein Ganzes ausmachend) sowie integratio (deutsch: Wiederherstellung eines Ganzen) hervorgegangen. Diese drei Begriffe wiederum leiten sich etymologisch vom Ausdruck integer ab, welches soviel wie unberührt, unversehrt oder ganz bedeutet (vgl. Drosdowski 1989, 307). Die beiden Begriffe Integration und integrieren werden heute in verschiedenen Bedeutungen in vielen Wissenschaftsbereichen, z.B. der Pädagogik, der Mathematik oder der Soziologie, und der Alltagssprache verwendet. Im Duden werden folgende, für die Pädagogik relevante, Bedeutungen angegeben: „1. (Wieder)herstellung einer Einheit (aus Differenziertem) […] 2. Einbeziehung, Eingliederung in ein größeres Ganzes […] 3. (Soziol.) a) Verbindung einer Vielheit von einzelnen Personen od. Gruppen zu einer gesellschaftlichen u. kulturellen Einheit; b) Zustand, in dem sich etwas befindet, nachdem es integriert [.] worden ist […] 6. (Psych.) Einheit im Aufbau der Persönlichkeit u. ihrer Beziehung zur Umwelt“ (Drosdowski 1994, 1719).
Der Begriff Integration bezieht sich also sowohl auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene, als auch auf die Ebene der individuellen Persönlichkeit. Ein wichtiger Aspekt ist zum einen der Begriff der Einheit bzw. Ganzheit, der sowohl gesellschaftlich als auch personal gedeutet werden kann, und zum anderen der zeitliche Aspekt, der in dem Ausdruck „Wiederherstellung“ deutlich wird. Es kann also nach der ursprünglichen Bedeutung des Wortes nur integriert werden, was vorher differenziert wurde. Die Begriffe Integration oder integrieren würden somit ihre gesellschaftliche Relevanz verlieren, wenn die vorangegangene Differenzierung, in sogenannte „Behinderte“ und „Nichtbehinderte“, nicht stattgefunden hätte. Hieran setzt auch die Kritik an dem Begriff „Integration“ an. Von verschiedenen Autoren wird der Begriff der Integration durch den aus dem englischsprachigen Raum kommenden Begriff Inklusion oder „inclusion“ ersetzt, welcher ihrem Begriffsverständnis nach eine umfassendere Bedeutung hat. Der Begriff der „Integration“ impliziert einen vorherigen Ausschluss aus der Gemeinschaft, wohingegen der Ausdruck „inclusion“ eben diesen nicht beinhaltet. Lindmeier und Lindmeier beschreiben, dass es im Sinne von Inklusion nicht mehr darum gehe, einzelne Personen in eine Gesellschaft zu integrieren, welche „davon prinzipiell nicht [tangiert ist], sondern um eine Gesellschaft, die offen ist für unterschiedliche Menschen und ihre Bedürfnisse und Interessen“ (ebd. 2001, 43). Feuser allerdings verwendet den Begriff der „Integration“ einige Jahre zuvor bereits in eben diesem Sinne und bezeichnet hiermit eine Pädagogik, die es ermöglicht, dass „alle Kinder in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau und mittels ihrer momentanen Denk- und Handlungskompetenzen und mit einem gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten“ (Feuser 1994, 217). Hinz betont in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass unter dem Begriff Integration mehr „als das Beisammensein von Kindern mit und ohne Behinderungen [zu verstehen sei]. Es geht auch nicht um ein bloßes Hinzufügen von Kindern, die vorher ausgeschlossen waren, zu einem unveränderten Ganzen, sondern um einen Ansatz, der alle Kinder, alle mit Schule befassten Personen und die Gesellschaft als ganzes betrifft und insgesamt zur Entwicklung von etwas Neuem führt“ (ebd. 1993, 52; Hervorhebungen im Original). Reiser stellt ebenfalls dar, dass beide Bedeutungsvarianten gleich sind, dass es nämlich um die Herstellung einer Einheit ginge (vgl. ebd. 2003, 305).
3.2. Prinzipien der Integrationspädagogik
Ausgehend von dem dargestellten Verständnis des Begriffes Integration wird nun näher darauf eingegangen, welche Prinzipien in der Integrationspädagogik entwickelt wurden, um das Ziel der Integration zu erreichen. Es lassen sich folgende Prinzipien herausarbeiten, die inzwischen in den meisten Publikationen zur Integrationspädagogik enthalten sind. Die Literaturangaben sind daher nur beispielhaft anzusehen.
Der wichtigste Kerngedanke, aus dem jegliche Theorie und Praxis der Integrationspädagogik abgeleitet wird, ist, dass Integration ein Grundrecht darstellt, welches auf dem ethischen Imperativ unserer Verfassung fußt, nämlich dem Benachteiligungsverbot im Artikel 3 des Grundgesetzes (vgl. Dietze 1994, 121). Das Prinzip der Integrationspädagogik ist somit die Nichtaussonderung von Menschen mit Behinderungen (vgl. Ginnold 2000, 39). „Das Prinzip der Nicht-Aussonderung und größtmöglichen Integration in das Leben der Gemeinde erteilt jeglicher zwangsweisen Aussonderung und Institutionalisierung Behinderter eine klare Absage und bekräftigt die Forderung nach gemeindeorientierten Unterstützungsdiensten, durch die behinderten Menschen eine echte Wahlmöglichkeit mit dem größtmöglichen Selbstbestimmungsrecht eingeräumt wird, so dass uns ein gleichberechtigtes Leben in der von uns frei gewählten Umgebung ermöglicht wird“ (Miles-Paul 1999, 224). Gerade in Bezug auf Schule und Arbeitsleben wurde immer wieder formuliert, dass Integration unteilbar ist. Die Integrationspädagogik geht davon aus, dass jeder Mensch mit Behinderung, unabhängig davon welcher Art und welcher Schweregrad diese Behinderung ist, in die Gesellschaft integriert werden kann. Es darf auf keinen Fall eine Unterscheidung, z.B. im schulischen Bereich, in solche Kinder geben, die „integrierbar“ sind und solche, die es nicht sind, z.B. Schüler mit schwerer geistiger Behinderung (vgl. Muth 1991, 2).
Die Grundlage von Integration ist ein ökosystemischer Behinderungsbegriff, der neue Handlungsmöglichkeiten für die Nichtaussonderung erschließt. Ausgehend von einem solchen Behinderungsbegriff, wird nicht das einzelne Kind betrachtet, sondern beispielsweise die Aufgabe des Schuleintritts und das Problem der noch nicht alltäglichen Einschulung eines Kindes mit Behinderungen in eine Grundschule statt in eine Sonderschule (vgl. Hildeschmidt, Sander 1994, 269).
Integration kann in vielfältigen Organisationsformen stattfinden und ist nicht auf eine einzige mögliche Form beschränkt. Integrativer Unterricht beispielsweise findet bereits in Form von Integrationsklassen, Einzelintegration, Kooperation, Förder- und Diagnoseklassen, ausgelagerten Klassen u.a. statt (vgl. Muth 1994, 23). Um ein Gelingen der Integration zu gewährleisten, und dieses nicht beispielsweise durch Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen, z.B. auf Seiten der Lehrkraft zu gefährden, arbeiten alle Personen, die an integrativen Prozessen beteiligt sind, freiwillig mit (vgl. meyer, Heyer 1994, 228).
In der praktischen Arbeit, vor allem in der Diagnostik, stehen die Fähigkeiten, und nicht die Defizite der betreffenden Person im Vordergrund, entsprechend einem veränderten Verständnis von Diagnostik. Im Gegensatz zur früheren Auslesediagnostik und Zuordnung zu (Sonder-)Schultypen geht es um die individuelle Förderung des Schülers (vgl. Belusa, Eberwein 1994, 260 f.).
Die Leitvorstellung aller integrativen Bemühungen und Grundlage aller integrationsorientierten Reformen ist das Normalisierungsprinzip. Dies bedeutet in seiner Fortführung, dass sich somit die Institutionen an die Bedürfnisse der einzelnen Personen anpassen müssen, und nicht die Personen an die Institution (vgl. Walther 1998, 95). Ebenfalls aus dem Normalisierungsprinzip abgeleitet ist die wohnortnahe Integration, also die Regionalisierung und Dezentralisierung aller personellen und materiellen Hilfen für Menschen mit Behinderungen (vgl. Begemann 1991, 57ff.).
Die Eltern werden von den beteiligten Fachleuten als Expertinnen und Experten für ihr Kind angesehen. Integrative Prozesse werden nach Möglichkeit mit ihnen geplant, durchgeführt und reflektiert. Das Gleiche gilt für Menschen mit Behinderungen selber, welche das Recht auf Selbstbestimmung haben (vgl. Rosenberger 1994, 413)
III. Möglichkeiten und Hindernisse von Selbstbestimmung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung im Bereich von Beruflicher Bildung und Arbeit
Im vorangegangenen Kapitel wurden die theoretischen Grundlagen von Selbstbestimmung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung dargestellt. Einen wichtigen Bereich des Lebens in dieser Gesellschaft stellt das Arbeits- und Berufsleben dar. Dieser ist gesellschaftlich sehr wichtig und hoch angesehen, wodurch gerade hier eine Integration von Menschen mit Behinderungen als besonders unumgänglich erscheint. Zugleich ist Arbeit aber auch ein Bereich, der sich für integrative Prozesse besonders gut eignet, da es in einem Betrieb mit Kollegen vielfältige Möglichkeiten des Kontakts und des Aufeinanderzugehens gibt.
Es wurde in den entsprechenden Kapiteln deutlich, dass die Selbstbestimmung eines jeden Menschen immer wieder mehr oder weniger stark von außen eingeschränkt wird. Dies trifft insbesondere auf den Bereich der Arbeit und des Berufs zu. Beispielsweise ist es nötig, um einen bestimmten Beruf zu erlernen, einen geforderten Schulabschluss zu haben, und die Ausübung einer Arbeit ist vom Arbeitgeber abhängig oder bei Selbständigen von Auftraggebern. Neben diesen direkt erfahrbaren Einschränkungen auf die Selbstbestimmung eines jeden Menschen spielen aber auch weitreichendere wirtschaftliche Faktoren wie die zunehmende Arbeitslosigkeit mitsamt deren Ursachen eine Rolle.
In diesem Kapitel soll nun darauf eingegangen werden, welche Möglichkeiten der beruflichen Bildung und Arbeit für Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland vorhanden sind. Eine wichtige Frage ist bei dieser Betrachtung, inwieweit diesem Personenkreis Möglichkeiten sowohl der Selbstbestimmung als auch der Integration zugestanden werden. Im Rahmen dieser Arbeit kann dieser Aspekt nur überblicksweise dargestellt werden.
Unter Punkt 1 wird zunächst die Bedeutung und Funktion von Arbeit und Beruf dargestellt. Daran schließen sich unter Punkt 2 die gesetzlichen Grundlagen der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen an, welche in erster Linie im Sozialgesetzbuch IX verankert sind. Punkt 3 stellen dann die Möglichkeiten der beruflichen Bildung für Menschen mit geistiger Behinderung dar, woraufhin unter Punkt 4 auf eine Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen eingegangen wird. Im Anschluss erfolgt unter Punkt 5 eine grundlegende Darstellung der Möglichkeiten und Schwierigkeiten einer Beschäftigung von Menschen mit geistiger Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Unter Punkt 6 wird schließlich das Konzept der Unterstützten Beschäftigung vorgestellt.
1. Arbeit und Beruf – Bedeutung und Funktionen
In diesem Kapitel werden zunächst unter Punkt 1.1. die Begriffe Arbeit und Beruf dargestellt und voneinander abgegrenzt. Anschließend folgt unter Punkt 1.2. ein Überblick über die Funktionen und Bedeutungen Arbeit und Beruf in unserer Gesellschaft im Allgemeinen sowie unter Punkt 1.3. der Bedeutung dieses Lebensbereiches speziell für Menschen mit geistiger Behinderung. Daran schließt sich unter Punkt 1.4. eine Darstellung der derzeitigen Krise des Arbeitsmarktes und dessen Folgen an. Unter Punkt 1.5. wird dann auf die spezielle Problematik eingegangen, dass nicht mehr nur Erwachsene zusehends von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Inzwischen meistern immer mehr Jugendliche bereits die sogenannte erste Schwelle nicht, nämlich den Einstieg in das Arbeits- und Berufsleben. Somit sind die Bedingungen für einen Übergang von der Schule in den allgemeinen Arbeitsmarkt gerade für Jugendliche mit geistiger Behinderung in besonderem Maße erschwert.
1.1. Begriffsbestimmungen – Arbeit und Beruf
Die beiden Begriffe „Arbeit“ und „Beruf“ stehen in engem Zusammenhang, unterscheiden sich jedoch semantisch im Deutschen. Im englischsprachigen Raum wird für beide Bedeutungen der Begriff „job“ benutzt, der jedoch im Deutschen im Sinne von „Gelegenheitsarbeit“ oder „Beschäftigung“ verstanden wird, nicht jedoch im Sinne von „Beruf“ (vgl. Drosdowski 1989, 314). Allgemein wird der Begriff „Arbeit“ in mehreren Wissenschaftsgebieten in verschiedenen Bedeutungen benutzt, z.B. im physikalischen Sinne, in biologischen oder wirtschaftlichen Zusammenhängen. Aus soziologischer Sicht wird unter Arbeit eine geistige und bzw. oder körperliche Tätigkeit verstanden, die bewusst und gezielt ausgeführt wird und aus welcher ein Produkt hervorgeht. Dieses Produkt kann sowohl materiell als auch immateriell sein. Es dient mittelbar, z.B. über Entlohnung, zur Sicherung der eigenen materiellen und geistigen Existenz. Diese Unterscheidung in geistige und körperliche Arbeit ist allerdings erst in neuerer Zeit durch die fortschreitende Arbeitsteilung bedeutsam geworden. Der Begriff der Arbeitsteilung wird teilweise synonym mit Berufsdifferenzierung gebraucht, meint aber allgemein „die Ausdifferenzierung von ursprünglich ganzheitlichen Produktionsprozessen in einzelne Arbeitsschritte, die dann von verschiedenen Menschen realisiert werden“ (Reinhold 2000, 31). Die Ausformung von Berufen auf breiter Basis setzte mit der Industrialisierung ein. Im letzten Jahrhundert wurden dann, durch den sich immer stärker entwickelnden Dienstleistungssektor, immer neue Tätigkeitskomplexe beruflich gefasst (vgl. Reinhold 2000, 23 ff.).
Der Begriff des „Berufs“ ist enger gefasst als der der „Arbeit“ und hat für den einzelnen Menschen eine höhere Bedeutung. Ein Beruf ist dadurch charakterisiert, dass er die Basis für eine dauerhafte Versorgungs- und Erwerbschance darstellt. Der Unterschied zur Arbeit besteht also zunächst in der zeitlichen Komponente. Eine Tätigkeit, die heute entlohnt wird, während der Lohn am nächsten Tag durch eine völlig andere Tätigkeit zustande kommt, ist daher Arbeit, aber noch kein Beruf. Teilweise wird der Begriff des „Berufs“ auch im Sinne von „Berufung“ verstanden, und hat dann eine stark religiös oder sozial motivierte Komponente. Der dritte Aspekt, der den Beruf charakterisiert, ist die Gesamtheit der erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zu einer bestimmten Leistungserstellung notwendig sind und die der Berufsinhaber auf sich vereinigt. Diese Leistungen dienen dem Erwerb von Lebensunterhalt. Fertigkeiten oder Fähigkeiten anderer Art, z.B. im künstlerischen oder handwerklichen Bereich, die nicht zum Lebensunterhalt beitragen, zählen somit nicht zum Beruf (vgl. Reinhold 2000, 24).
Ellger-Rüttgardt weist darauf hin, dass Definitionen von Arbeit als Arbeit zur Sicherung des Lebensunterhalts für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen, besonders mit schweren Beeinträchtigungen, nicht passend sind. Sie schlägt daher vor, den Arbeitsbegriff weiter zu fassen, so dass „auch stark leistungseingeschränkte Personen zur Arbeitswelt gehören“ können, die ihren Lebensunterhalt nicht alleine bestreiten können (ebd. 2000, 315). Sie trifft daher eine Unterscheidung von Erwerbsarbeit und Eigenarbeit. Unter letzterer versteht sie jegliche Form von bewusst ausgeführten Tätigkeiten. Nur mit dieser Unterscheidung können sich auch Menschen als tätig verstehen, die weniger leistungsfähig sind. Dies würde beispielsweise Personen betreffen, die in Tagesförderstätten beschäftigt sind, da ihre Arbeitsleistung nicht den höheren Anforderungen der WfbM entspricht, und die nach der herkömmlichen Definition keine Arbeit ausüben. Die jeweiligen Tätigkeiten können nach Ellger-Rüttgardt dennoch als Arbeit bezeichnet werden (vgl. ebd. 2000, 315).
1.2. Funktionen von Arbeit und Beruf
Eine der bekanntesten und umfassendsten Studien zu den Auswirkungen von Arbeitslosigkeit ist die sogenannte Marienthalstudie aus den dreißiger Jahren. Als Ergebnis dieser Studie beschreibt Jahoda, dass Arbeit offizielle Bedeutung für die Menschen und die Gesellschaft hat, wie sie aus den Definitionen im obigen Kapitel ersichtlich wird. Dies sind die Produktion von Gütern und Dienstleistungen sowie die Sicherung des Lebensunterhalts. Neben diesen Funktionen hat Arbeit aber auch entscheidende Wirkungen auf der psychologischen Ebene jedes einzelnen Menschen, die besonders aufgrund des Wegfalls bei Arbeitslosigkeit deutlich werden. Jahoda nennt in diesem Zusammenhang folgende Aspekte: Zum einen zwingt Erwerbsarbeit dem Menschen bestimmte Kategorien der Erfahrung auf. Dem Tag wird eine Zeitstruktur gegeben und die Arbeit erweitert die sozialen Beziehungen über Familie und Nachbarschaft hinaus. Zum anderen bindet Erwerbsarbeit die Menschen in die Ziele und Leistungen der Gemeinschaft ein und weist ihnen einen sozialen Status zu. Arbeit klärt somit außerdem die persönliche Identität eines jeden Einzelnen. Anhand dieser Funktionen wird Erwerbsarbeit als wichtiger gesellschaftlicher und sozialer Faktor im Leben von unbezahlter Arbeit abgegrenzt, wie sie beispielsweise in Form von Freiwilligenengagement oder Hausarbeit verrichtet wird (vgl. ebd. 1983, 4 f.). Für Menschen mit Behinderungen, denen Arbeit als Erwerbsarbeit zum Lebensunterhalt nicht ermöglicht wird, da sie den hohen Anforderungen der Wirtschaft nicht genügen, sollen diese Funktionen in Werkstätten für behinderte Menschen erfüllt werden.
Im Alltagsverständnis besitzt der Beruf ein hohes Ansehen. Mit einem Beruf werden von den meisten Menschen bestimmte Fähigkeiten, z.B. zur rationalen Problemlösung, und Tugenden, wie beispielsweise Verantwortungsbewusstsein oder Arbeitsbereitschaft, verbunden. Einem Beruf werden aber auch positive Auswirkungen auf die Selbstverwirklichung oder das Prestige zugeschrieben (vgl. Hörning 1981, 13). Erwerbsarbeit und Beruf weisen Unterschiede in ihren Funktionen auf, welche Reinhold in drei Komponenten darstellt: Zunächst stellt der Beruf in einer Gesellschaft, die arbeitsteilig organisiert ist, einen Komplex spezialisierter Tätigkeiten dar. Diese Tätigkeiten sind die Grundlage einer kontinuierlichen Versorgungs- und Erwerbsmöglichkeit. Sie werden aber nicht zum Selbstzweck ausgeführt, sondern die jeweilige Person hat eine innere Bindung an diese spezialisierte Tätigkeit. Diese Bindung wiederum geht zurück auf Ausbildung, spezielle Kenntnisse sowie Erfahrung und ermöglicht der Person eine gewisse Sinnerfüllung. Der dritte Punkt ist, dass ein Beruf der Person eine soziale Position im Gesellschaftsgefüge zuweist (vgl. Reinhold 2000, 25 f.).
Jeder Mensch in unserer Gesellschaft sammelt von seiner Kindheit an Erfahrungen und Vorstellungen dessen, was einen Beruf ausmacht. Im Alltagsverständnis geht man von Folgendem aus:
- dass man einen Beruf hat oder haben sollte,
- dass man den größten Teil seines Lebens seinem Beruf nachgeht,
- dass die jeweiligen beruflichen Tätigkeiten den eigenen Neigungen und Fähigkeiten entsprechen sollten,
- dass mit unterschiedlichen Berufen auch ein unterschiedliches Einkommen und unterschiedlich viel Macht verbunden ist
- und schließlich, dass Berufe den besten Schutz gegen Risiken auf dem Arbeitsmarkt bieten (vgl. Hörning 1981, 11).
Der Beruf ist somit für die meisten Menschen das wichtigste Mittel zur Sicherung der eigenen Existenz. Wichtiger noch scheint aber eine zweite Funktion zu sein, nämlich dass er der Befriedigung persönlicher Bedürfnisse dient. Dies wird daran deutlich, dass Entscheidungen, die den Beruf betreffen, wie z.B. Arbeitsplatzwechsel oder gar Berufswechsel, nicht alleine von materiellen Überlegungen bestimmt werden, sondern auch von Faktoren wie z.B. Berufsstolz oder Betriebsverbundenheit. Der Beruf bestimmt außerdem, stärker als andere soziale Tatbestände, das Leben des Einzelnen. Einfluss üben beispielsweise das verfügbare Einkommen, der für den Beruf nötige Wohnort oder die sozialen Kontakte aus (vgl. Hörning 1981, 14).
Zwierlein (1997, 20 f.) verdeutlicht die Bedeutung von Arbeit[6], indem er auf das Bedürfnis-Modell von Maslow zurückgreift, welches fünf Ebenen aufweist. Er beschreibt, dass sich auch die Bedeutung von Arbeit für den Menschen den fünf Stufen des Modells zuordnen lässt, und sich somit auch für die Erwerbsarbeit fünf Sinndimensionen zeigen. Die materielle Existenzsicherung durch Arbeit ist Teil der untersten Stufe, der Stufe der physiologischen Bedürfnisse wie beispielsweise Nahrung oder Wärme. Auf der zweiten Stufe, den Sicherheitsbedürfnissen, steht Arbeit insofern, als sie zur Sicherheit des Lebens beiträgt, zugleich aber auch ein „sicherer“ Arbeitsplatz gewünscht und gesucht wird. Die nächste Stufe, die Bedürfnisse nach sozialer Kommunikation und Kooperation, kann Arbeit durch Kontakte zu Kollegen, Kunden etc. befriedigen. Auf der Stufe der Ich-Bedürfnisse kommen die mit der Arbeit verbundenen Möglichkeiten von Anerkennung und Geltung zum Tragen. Spätestens ab dieser Stufe entspricht dieses Verständnis von Arbeit der oben genannten Definition von Beruf. Die letzte Stufe des Modells von Maslow ist die Selbstverwirklichung. Diese kann in vielfältiger Weise durch Arbeit bzw. Beruf umgesetzt werden, sofern Freiräume für Kreativität, Übernahme von Verantwortung u.a. gegeben sind. Wichtig zu bedenken ist hierbei nach Zwierlein aber auch, dass Arbeit nur einen Teil zur Befriedigung all dieser Bedürfnisse beiträgt. Er wendet sich entschieden gegen solche Aussagen, die besagen, dass es ohne Arbeit auch keinen Lebenssinn gebe. Der Mensch gewinnt seiner Meinung nach nicht allein durch Arbeit und Leistung Identität und Lebenssinn und er „bleibt auch dann noch Mensch, wenn er noch nicht arbeitet, nicht mehr arbeitet, arbeitslos oder arbeitsunfähig ist“ (ebd. 1997, 26). Dies ist ein Aspekt, der schon immer für die Sonderpädagogik eine große Bedeutung hatte, heute aber aufgrund der anhaltenden Arbeitsmarktkrise für immer größere Bevölkerungsteile eine neue, wichtige Erkenntnis sein muss.
Die materielle Existenzsicherung ist in unserer Gesellschaft auch dann zumindest grundlegend gegeben in Form von Arbeitslosen- oder Sozialhilfe, wenn jemand nicht arbeiten kann oder keine Arbeit bekommt. Aus den Bedürfnissen, die Arbeit und Beruf befriedigen, wird aber deutlich, dass diese im Falle von Erwerbslosigkeit nicht berücksichtigt werden. Arbeitslosigkeit bedeutet daher in unserer Gesellschaft für die Betroffenen zunächst eine finanzielle Verschlechterung der Lebensumstände, aber auch „eine Gefährdung des sozialen Ansehens und damit auch der Selbstachtung“ (Montada 1997, 3). Wie bereits beschrieben, darf die Bedeutung von Arbeit an sich allerdings auch nicht überbewertet werden. So betont Speck, ähnlich wie Zwierlein, dass wir nicht „leben […], um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Der Stellenwert der Arbeit bemisst sich demnach nicht in Leistung, Produktivität und Wirtschaftlichkeit an sich und für sich, sondern im umfassenden Sinn von Leben“ (Speck 1991, 400).
1.3. Stellenwert von Arbeit und Beruf und Erwartungen daran von Menschen mit (geistiger) Behinderung
Die im vorangegangenen Kapitel dargestellten Funktionen von Beruf in unserer Gesellschaft spielen im Leben auch und gerade für Menschen mit Behinderungen eine sehr wichtige Rolle. Im Folgenden wird näher auf die besondere Bedeutung von Arbeit für Menschen mit geistiger Behinderung eingegangen. Außerdem werden mögliche Gründe dargestellt, warum Einige aus diesem Personenkreis einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anstreben.
Die materielle Existenz von Menschen mit Beeinträchtigungen ist in Deutschland, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, über Renten, Arbeitslosenunterstützung oder Sozialhilfe zumindest grundlegend gesichert. Sie sind daher nicht grundsätzlich darauf angewiesen, erwerbstätig zu sein. Arbeit und Beruf haben aber eben, wie bereits dargestellt, weitere Funktionen, die über die reine Existenzsicherung hinausgehen. Der Stellenwert von Arbeit kann gerade für Menschen mit Behinderung besonders hoch sein. Behinderungen gehen zum einen häufig mit sozialer Isolation einher und zum anderen mit einer geringen Selbstachtung des Betroffenen. Eine geregelte Arbeit bedeutet somit, Kontakte am Arbeitsplatz zu haben, und damit einer sozialen Isolierung entgegenzuwirken. Weiter kann eine Berufstätigkeit dem Leben insgesamt einen Sinn geben und über die Tätigkeit auch Selbstvertrauen vermitteln. Diese Funktionen üben sowohl eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt als auch eine in einer Werkstatt für behinderte Menschen aus. Erstere birgt gewisse Risiken für die betreffende Person. Mühling beschreibt, dass eine misslingende Arbeitsplatzsuche das ohnehin bedrohte Selbstbewusstsein weiter gefährdet. Fachleute gehen daher häufig davon aus, dass „die in vielen Fällen mit einer Behinderung einhergehende Bedrohung von Selbstbild und Identität zu einer Steigerung der Kosten führt, die durch Frustrationserlebnisse bei Absagen entstehen“ (ebd. 2000, 119). Zu bedenken ist aber, dass es auf der anderen Seite gerade für Menschen mit bedrohtem Selbstbild einen besonders hohen Stellenwert haben kann, im Berufs- und Arbeitsleben Anerkennung zu bekommen (vgl. ebd. 2000,119). Schumann beschreibt, dass die berufliche Rolle eine neue Identität schafft und daher einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu Normalisierung und einem selbstbestimmten Leben ermöglicht (vgl. ebd. 1998, 186).
Da Behinderungen häufig mit sozialer Ausgrenzung einhergehen, kann über die Kontakte am Arbeitsplatz die soziale Integration der Person verbessert werden. Dies hat wiederum eine hohe Bedeutung, da eine gelungene soziale Integration zu einer positiven Identitätsentwicklung beiträgt (vgl. Mühling, 2000,121). In Übereinstimmung mit diesen theoretischen Annahmen haben Schabmann und Klicpera in einer Untersuchung festgestellt, dass Menschen mit geistiger oder Lernbehinderung hoch motiviert sind, wenn sie erst einmal den Sprung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geschafft haben. Sie sehen außerdem wesentlich mehr Vorteile als Nachteile in dieser Beschäftigung (ebd. 1998).
Aber welches sind nun die wichtigsten Beweggründe, die WfbM zu verlassen, bzw. bereits nach der Schulzeit eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anzustreben? Nach Schabmann und Klicpera sind die am häufigsten genannten Motive zum einen das Erleben größerer persönlicher Freiheit, die der betreffenden Person dann durch die Umwelt eher zugestanden wird und zum anderen positive Auswirkungen auf das Selbstbild. Die betreffenden Personen weisen eine größere Selbstsicherheit auf. Entscheidend ist aber auch die Freude an der Arbeit und die Möglichkeit, selbst für den eigenen Lebensunterhalt aufzukommen (s. Abbildung 2). Eine wichtige Rolle spielen auch die Kontakte zu anderen Personen. Besonders für Personen, die zuvor in einer speziellen Einrichtung für Menschen mit Behinderungen beschäftigt waren, stellt dies eine Überwindung des Status des Behinderten dar. Geringfügige Unterschiede ergeben sich für Menschen, die bereits in einer WfbM beschäftigt waren und solchen, auf die dieses nicht zutrifft. Letztere nennen häufiger das Anliegen, etwas Nützliches für die Gesellschaft beitragen zu wollen, wohingegen für ehemalige WfbM-Beschäftigte die Freude an der Tätigkeit wichtiger zu sein scheint (vgl. Schabmann, Klicpera 1998).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Was ist an der Arbeit motivierend? Vergleich zwischen Personen, die zuvor in Werkstätten für Behinderte gearbeitet haben und solchen, die keine derartigen Erfahrungen haben (Ankerpunkte: 0 = “nicht wichtig”, 1 = “eher nicht wichtig”, 2 = “eher wichtig”, 3 = “wichtig”)
Abbildung 2 Gründe für den allgemeinen Arbeitsmarkt (Schabmann, Klicpera 1998)
1.4. Krise des Arbeitsmarktes
Aus den dargestellten Funktionen und Bedeutungen von Arbeit und Beruf ist deutlich geworden, dass beides einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Sie wird somit zu Recht als Arbeitsgesellschaft bezeichnet. Nun ist das Problem der immer größer werdenden Arbeitslosigkeit in Deutschland aber nicht zu übersehen, weswegen für immer mehr Menschen die Funktionen, die Arbeit ausübt, nicht mehr erfüllt werden. Im Rahmen dieser Arbeit ist in dem folgenden Unterkapitel nur ein kleiner Einblick in die derzeitige Arbeitsmarktproblematik möglich.
Während es früher ein Privileg war, nicht arbeiten zu müssen, wenn man über genügend Geld verfügte und sich somit nicht die Hände schmutzig machen musste, gilt es heute hingegen aufgrund der Krise des Arbeitsmarktes fast schon als Privileg, Arbeit zu haben. Seit Beginn der neunziger Jahre verschärfte sich die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt erheblich. Immer mehr Menschen, auch aus solchen Berufsgruppen, die bislang überwiegend sichere Arbeitsplätze hatten, sind von Arbeitslosigkeit betroffen. Als Ursache wird aus Fachkreisen zum einen die schwache Konjunktur genannt, welche wiederum durch die zunehmende Globalisierung bedingt sei, und zum anderen die zunehmende Rationalisierung aufgrund technischer Fortschritte (vgl. Hinz, Boban 2001, 38 f.). Besonders gravierend sind die Veränderungen und der Stellenabbau in Arbeits- und Produktionsbereichen, in denen an die Arbeitnehmer in der Vergangenheit eher geringe Anforderungen gestellt wurden, beispielsweise im Montage- und Fertigungsbereich. Dies hat zur Folge, dass Menschen mit Behinderungen überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind. „Als Trend ist festzustellen, dass technischer und arbeitsorganisatorischer Wandel genau die Berufe tangiert, die traditionell Behinderten offen standen und auf die das Netzwerk an Rehabilitationseinrichtungen immer noch vorbereitet“ (Biermann 2003, 842).
Laut der Europäischen Kommission hatten 2003 lediglich 38% der Personen mit Behinderungen im Alter von 16 bis 34 Jahren ein eigenes Arbeitseinkommen, im Vergleich zu 64% der Personen ohne Behinderungen im gleichen Alter (vgl. Europäische Kommission 2003, zitiert nach Doose 2003, 3).
Arbeitsplätze, die geringe Qualifikationen an die Arbeitnehmer stellen, werden entweder völlig durch Maschinen ersetzt oder aber aufgrund der wesentlich geringeren Lohnkosten ins Ausland, v.a. in Länder der Dritten Welt, verlegt. Dies „verschärft entsprechend den existentiellen Problemdruck für niedrigqualifizierte Lohnabhängige. Andererseits erhöht sich der Anteil von Arbeitskräften mit mittlerer und hoher Qualifikation, so dass verallgemeinernd von einer tendenziellen Höherqualifizierung im Rahmen allerdings stark polarisierender Prozesse gesprochen werden kann“ (Krauss 1996, 37). Einen weiteren Grund für die steigende Arbeitslosigkeit sieht Barloschky darin, dass die reale Arbeitszeitverkürzung in Europa seit den sechziger Jahren nicht mit der gesellschaftlichen Produktivitätssteigerung Schritt halten konnte. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass immer mehr Waren in immer kürzerer Zeit hergestellt werden können. Gleichzeitig ist die Arbeitszeit pro Arbeitnehmer aber nicht in dem Maße gesunken, dass diese Produktivitätssteigerung ausgeglichen wird. Aus diesen beiden Entwicklungen resultieren somit weniger vorhandene Arbeitsplätze als vorher. Das Ergebnis wird „jobless growth“ genannt, oder anders ausgedrückt, die „Arbeitsplatzlücke ist eine Folge der eigenen „Stärke““ (Barloschky 2000, 2).
Aktuell gibt es in Deutschland über vier Millionen Arbeitslose, und viele Arbeitsmarktforscher sind der Meinung, dass sich die Arbeitslosenzahlen dauerhaft auf einem hohen Niveau halten werden. Das bedeutet, dass im Monat Mai 2004 10,3% der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter von einem entscheidend wichtigen Lebensbereich längerfristig ausgeschlossen sind, der normalerweise einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe an der Gesellschaft beisteuert (vgl. agentur für Arbeit 2004). Schumann fordert daher das „Menschenrecht auf Arbeit“ und eine gerechte Verteilung von Arbeit für alle Menschen. Für ihn geht von einer solch hohen und konstanten Arbeitslosigkeit in der Bevölkerung eine Gefahr für die Gesellschaft insgesamt aus, die nur mit einer „Umverteilung der Erwerbsarbeit […] die fortschreitende Zerstörung menschlicher Möglichkeiten und die weitere Spaltung der Gesellschaft aufgehalten werden [kann]“ (ebd. 1998, 191).
Statistisch gesehen sind Menschen mit Behinderung besonders von Arbeitslosigkeit betroffen. Schon 1991 stellte Speck heraus, dass das Risiko, entweder gar keinen oder zumindest keinen adäquaten Arbeitsplatz zu finden und somit länger arbeitslos zu bleiben, bei Menschen mit Behinderungen eindeutig größer ist als bei nichtbehinderten Personen (vgl. ebd. 1991, 397). Dies war aufgrund der mehr oder weniger stark verringerten Leistungsfähigkeit schon immer ein Problem für Menschen mit Behinderungen. Besonders unter den aktuellen Bedingungen aber, wo sich das Verhältnis von Arbeitssuchenden und freien Arbeitsplätzen stark zu Ungunsten der Arbeitnehmer verschoben hat, haben die Arbeitgeber in den meisten Arbeitsbereichen die freie Auswahl. Hier haben Menschen mit Behinderungen weniger Chancen auf einen Arbeitsplatz als leistungsstarke Arbeitnehmer. Jacobs stellt heraus, dass aufgrund der herrschenden Produktionsverhältnisse jeder Unternehmer in Deutschland gezwungen ist, das sogenannte Gewinnmaximierungsprinzip zu realisieren. Hierfür muss er aber in erster Linie Arbeitnehmer bekommen, die ökonomisch möglichst rentabel einsetzbar sind. „Das setzt vor allem voraus, dass die Arbeitskraft so billig wie möglich, so qualifiziert, mobil und so disponibel wie für den Arbeitsplatz notwendig ist“ (Jacobs 1997b, 97).
1.5. Die Problematik des Übergangs von der Schule in den Beruf - Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt für alle?
Der Übergang von der Schule in den Beruf stellt für alle Jugendlichen eine große Herausforderung auf dem Weg zum Erwachsenwerden dar. Für die meisten Jugendlichen mit Behinderung stellt dieser Übergang aber eine besondere Hürde dar, die nur mit Hilfe Anderer (Lehrer, Berufsberater usw.) gemeistert werden kann (vgl. Ginnold 2000, 7). Arbeit und Beruf bestimmen in unserer Arbeits- und Leistungsgesellschaft maßgeblich den Sozialstatus, die Selbstachtung und persönliche Identität jedes Menschen. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung sagt zu der geringen Integration von Menschen mit Behinderungen in das Arbeitsleben aus, dass „Integration und Normalisierung […] Konzepte [sind], die sich in allen Lebensbereichen verwirklichen lassen, wenn die Bereitschaft besteht, Menschen mit Behinderungen als selbständige, aktive Partner bei der Rehabilitation und in der Gesellschaft zu sehen und Voraussetzungen für ein Höchstmaß an Unabhängigkeit in der eigenen Lebensplanung und -gestaltung zu schaffen“ (BMA 1998, 116). Die Hilfen zur Eingliederung und die Forderungen des Normalisierungsprinzips dürfen nach Ansicht des Bundesministeriums auf keinen Fall als einseitige Aufforderung zur Anpassung an Menschen mit Behinderungen missverstanden werden. Zu beachten sei, dass Integration immer ein wechselseitiger Prozess ist, an dem sich sowohl Menschen mit und als auch ohne Behinderungen gleichermaßen beteiligt sind (vgl. ebd. 1998, 116).
Während früher in Bezug auf Arbeitslosigkeit überwiegend von Erwachsenen gesprochen wurde, die zumindest den ersten Einstieg in die Arbeitswelt bereits mindestens einmal geschafft haben und nach einigen Jahren Arbeit arbeitslos wurden, betrifft Arbeitslosigkeit heute immer stärker auch schon Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt. Diese Problematik verschärft sich noch mal für die Schulabgänger mit geistiger Behinderung, die nicht in eine Werkstatt für behinderte Menschen eintreten möchten.
Stadler stellt fest, dass der Übergang von der Schule in das Erwachsenenleben für Jugendliche generell zunehmend schwieriger wird. Es sind daher Brücken und Begleiter für diesen Übergang notwendig. Er fordert, sich den Problemen der nachwachsenden Generation zu stellen und insbesondere zur Lösung der Arbeitsmarktprobleme beizutragen (vgl. ebd. 1996, 281). Die zunehmende Jugendarbeitslosigkeit birgt besondere Schwierigkeiten in sich, da auch heute noch die Gefahr von Arbeitslosigkeit für diejenigen wesentlich geringer ist, die eine Berufsausbildung haben und den ersten Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt geschafft haben. Stange beschreibt, dass in diesem Wettlauf um Ausbildungsplätze in erster Linie die Haupt- und Sonderschüler verlieren und somit bereits an der ersten Schwelle scheitern. Jugendliche aber, die keine oder nur eine niedrige berufliche Qualifizierung aufweisen, sind gezwungen, als Un- oder Angelernte solche Arbeit anzunehmen, die besonders stark belastend ist und bei der sie, aufgrund der bereits beschriebenen wirtschaftlichen Veränderungen, in hohem Maße von Arbeitslosigkeit bedroht sind (vgl. ebd. 2003, 822). Dies trifft nach Ginnold insbesondere auf Jugendliche mit Behinderungen zu, für die der Übergang ins Arbeitsleben besonders schwierig ist. Dies wird zum einen mit dem geringerwertigen Sonderschulabschluss bzw. dem fehlenden anerkannten Schulabschluss bei SchülerInnen der Schule für geistig Behinderte, begründet. Zum anderen stehen diesen SchülerInnen bei weitem nicht so viele Möglichkeiten nach der Schule offen wie Jugendlichen ohne Behinderungen (vgl. ebd. 2000, 23). Nach Jacobs hat sich die Hauptschule zwar inzwischen zu einer Restschule deformiert, trotzdem ist dieser Schulabschluss in den meisten Betrieben inzwischen Voraussetzung für eine Berufsausbildung. Hieran zeigt sich deutlich, wie stark das betriebswirtschaftliche Denken, welches nur von den Aspekten Optimierung und Qualifizierung geleitet ist, auf formale Schulabschlüsse fixiert ist (vgl. ebd. 1997a, 94).
Die Hürde des Übergangs in die Arbeitswelt wird scheinbar noch dadurch erhöht, dass „sich die Schule vorrangig als ein zeitlich abgegrenztes Sozialisationssystem [versteht], dessen Zuständigkeit für die Schülerschaft bei deren Entlassung endet“ (Jacobs 1997b, 106; Hervorhebungen im Original). jacobs betont daher, dass die allgemeinbildende Schule diese kritische Phase des Übergangs als pädagogisches Problemfeld nicht vernachlässigen darf (vgl. ebd. 1997b, 106). Zu beachten ist schließlich, dass diese Phase der Berufsfindung und des Eintritts in die Arbeitswelt in eine Phase des Erwachsenwerdens und der Ablösung von den Eltern fällt, in der häufig auch nichtbehinderte Jugendliche besondere Unterstützung benötigen. Diese schwierige Zeit der Berufsfindung fällt zusammen mit der Phase, in der es im Wesentlichen „um den Aufbau von Ich-Identität, um die Übernahme gesellschaftlicher Rollen, um (soziale) Verantwortung und um Zukunftsplanung [geht]; kurzum: es geht um Selbstbestimmung auf dem Wege des Erwachsenwerdens“ (Theunissen, Plaute 1995, 120). Dies trifft auch und gerade auf Schüler mit geistiger Behinderung zu. Die Bedeutung einer Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern in dieser Phase stellt Schmid heraus. Für ihn sind in diesem Lebensabschnitt zwei Lebenswirklichkeiten für die Jugendlichen von Bedeutung, nämlich Elternhaus/Familie sowie Schule. Der Bereich Eltern/Familie wird besonders durch die drei Bereiche Verarbeitungs- und Loslösungsproblematik, Elternbildung bzw. –Information zum Übergang Schule/Arbeitswelt sowie die Einstellung der Eltern und des Jugendlichen zur Berufsfindung geprägt. Die Lebenswirklichkeit Schule wird vor allem durch die Bereiche Schülerorientierte Planung, Unterricht sowie Mit- und Selbstbestimmung der Schülerinnen und Schüler im Schulalltag bestimmt (vgl. ebd. 2003, 11). Biermann betont, dass besonders die Berufseinmündung eine krisenhafte Erfahrung darstellen und zu Brüchen in der Biografie führen kann (vgl. ebd. 2003, 842). Die an sich schon gravierende Problematik des Übergangs von der Schule in das Arbeitsleben, beinhaltet für einige SchülerInnen mit Lernbehinderung besondere Schwierigkeiten. Für diese Jugendlichen kommt erschwerend hinzu, dass sie sich „als Träger eines diffusen Behinderungsphänomens in einer Grauzone von gesetzlichen Ansprüchen im beruflichen Sozialisationsprozess zwischen der Gruppe der sogenannten Nichtbehinderten und der Gruppe der sogenannten Schwerbehinderten bewegen“ (Jacobs 1997a, 96). Letztere haben Anspruch auf den ihnen vorbehaltenen Schutz durch das Schwerbehindertengesetz, der diesen Jugendlichen teilweise vorenthalten bleibt. Auf der anderen Seite fehlen ihnen gleichzeitig die Chancen und Möglichkeiten für eine volle Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, wie sie den meisten nichtbehinderten Schulabgängern zuteil wird (vgl. ebd. 1997a, 96).
Trotz dieser Schwierigkeiten, die gerade SchülerInnen mit Behinderungen beim Eintritt in das Arbeitsleben entgegenstehen, sollte aus integrativer Sicht alles für einen Berufseintritt in den ersten Arbeitsmarkt getan werden. Ginnold betont, dass, wenn man Integration als Weg zu einer Nichtaussonderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ansieht, es auch im Bereich des Arbeitslebens um eine konsequente Nichtaussonderung gehen muss, „d.h. um einen Prozess des gemeinsamen Lebens, Lernens und Arbeitens – und zwar von Anfang an und in allen Lebensbereichen!“ (ebd. 2000, 196).
2. Gesetzliche Grundlagen der Teilhabe am Arbeitsleben – Das Sozialgesetzbuch IX
Da Personen mit Behinderungen Nachteile im Arbeits- und Berufsleben haben, und sie den Anforderungen der Wirtschaft nicht vollständig entsprechen oder spezielle Hilfsmittel für die Ausübung der Tätigkeit benötigen, stehen sowohl ihnen selber als auch den Betrieben finanzielle und materielle Hilfen zur Eingliederung zu. Diese sind in erster Linie im Sozialgesetzbuch IX beschrieben, auf dessen Kernaspekte, die im Zusammenhang mit dieser Arbeit relevant sind, im Folgenden eingegangen wird. Unter Punkt 2.1. werden kurz die Neuerungen im SGB IX vorgestellt. Ein wichtiger Aspekt, der einen veränderten Umgang mit Menschen mit Behinderungen, deutlich werden lässt, ist die Terminologie, deren Veränderungen und neuen Begriffe im Vergleich zu den alten Gesetzestexten dargestellt werden. Unter Punkt 2.2. wird dann kurz aufgezeigt, welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im SGB IX vorgesehen sind. Dies erfolgt recht allgemein gehalten und zeigt im Wesentlichen die Neuerungen gegenüber den früheren Gesetzestexten auf. Die Pflichten, die der Gesetzgeber den Arbeitgebern auferlegt, werden dann unter 2.3. dargestellt.
2.1. Allgemeines
Im Artikel 3 des Grundgesetzes (GG) heißt es, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Im Artikel 12 GG ist festgelegt, dass jeder Deutsche das Recht hat, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsplatz frei zu wählen, wobei die Berufsausübung allerdings durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden kann (vgl. Hesselberger 2001, 83ff.). Die Sozialgesetzbücher, insbesondere das Sozialgesetzbuch IX zielen darauf ab, für Menschen mit Behinderungen die Umsetzung und Einhaltung dieser Grundrechte zu ermöglichen.
Das SGB IX steht in Verbindung mit dem Benachteiligungsverbot im Grundgesetz, mit internationalem Recht, u.a. der Resolution 48/96 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 20.12.1993 zur Herstellung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen, sowie auf europäischer Ebene mit dem Diskriminierungsverbot in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (vgl. Lachwitz, Welti 2002, 2).
Im SGB IX wird der Begriff „Rehabilitation“ nur noch für die medizinischen Leistungen verwendet. Die gesetzlichen Leistungen, die bisher als Leistungen zur beruflichen und sozialen Eingliederung bezeichnet wurden, heißen nun Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Mit dem Begriff der Teilhabe (Partizipation) soll stärker der Aspekt der aktiven Mitbestimmung und Mitwirkung betont werden. Eingliederung hingegen kann eher als passives "eingegliedert werden" verstanden werden (vgl. Grampp 2003, 284).
Die Ziele der Rehabilitation werden im §1 des SGB IX neu definiert und im Vergleich zum alten Recht präziser formuliert: „(1) Die Förderung der Selbstbestimmung behinderter Menschen, (2) die Förderung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und (3) die Vermeidung einer Benachteiligung im Verhältnis zu nichtbehinderten Menschen“ (Neumann 2004, 59; Hervorhebungen im Original). Die zwei letztgenannten Ziele beziehen sich auf das Grundrecht des Art. 3 Abs. 3 GG, das Diskriminierungsverbot, und setzen dieses um. Das erste Ziel hingegen, die Förderung der Selbstbestimmung, greift weiter. Es verweist nach Neumann auf solche Lebensbereiche, die in den Freiheitsgrundrechten und in ihrer Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützt sind. „Die Pflicht aller staatlichen Gewalt, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen, bedeutet für das leistende Handeln, dass der einzelne sowohl Ausgangspunkt als auch Ziel und Zweck des Handelns ist“ (ebd. 2004, 59).
Im Sinne des SGB IX sind diejenigen Personen von Behinderung betroffen, deren „körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“ (§2 Abs. 1 SGB IX). Als schwerbehindert gelten die Personen, denen ein Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 50 zuerkannt wurde. Personen mit einem GdB von weniger als 50, aber mindestens 30, können auf Antrag vom Arbeitsamt Schwerbehinderten gleichgestellt werden (Kossens u.a. 2002, 6). Mit diesem Behinderungsbegriff soll das Ziel der Partizipation in den verschiedenen Lebensbereichen stärker in den Vordergrund rücken.
Alle Leistungen, die nach dem SGB IX gewährt werden bzw. nach den Leistungsgesetzen, die für die einzelnen Rehabilitationsträger gelten, verfolgen den Zweck die Ziele, die im §1 SGB IX genannt werden, zu erreichen. Mit den Leistungen soll somit die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen oder von Behinderung bedrohter Menschen am Leben in der Gesellschaft gefördert und Benachteiligungen vermieden werden oder diesen Benachteiligungen entgegengewirkt werden (Kossens u.a. 2002, 6). Das bedeutet, dass für den Gesetzgeber den beiden Ansprüchen Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft oberste Priorität zukommt. Diejenigen Personen, die behindert sind oder von Behinderung bedroht sind sollen nichtbehinderten Personen so ähnlich wie möglich gestellt werden, so dass sie möglichst uneingeschränkt am allgemeinen gesellschaftlichen Leben teilnehmen können (vgl. ebd. 2002, 19). Der Anspruch auf diese Leistungen ist im Paragraphen 4 SGB IX beschrieben. Die Leistungen verfolgen vier Ziele und umfassen alle notwendigen Sozialleistungen, unabhängig von der Ursache der Behinderung. Mit ihnen soll erstens die Behinderung abgewendet, beseitigt, gemindert, ihre Verschlimmerung verhütet oder ihre Folgen gemildert werden. Zweitens sollen sie dazu dienen, die Einschränkung der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten und den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern. Das dritte Ziel ist, die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern. Viertens soll die persönliche Entwicklung ganzheitlich gefördert werden und die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht bzw. erleichtert werden (vgl. Kossens u.a. 2002, 6 f.).
2.2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Nach §33 SGB IX werden umfassende Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht. Diese sollen dazu dienen „die Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern“ (Kossens u.a. 2002, 21). Diese Leistungen beinhalten insbesondere Hilfen, die nötig sind, um eine geeignete Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu ermöglichen bzw. zu erhalten. Zu den gesetzlich verankerten Leistungen zählen u.a. Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung, berufliche Ausbildung und Überbrückungsgeld, aber auch Reisekosten, Haushaltshilfen oder Kinderbetreuungskosten (vgl. ebd. 2002, 21 f.).
Neu im SGB IX ist, dass die Personen, die Anspruch auf Leistungen haben, erstmals ein Wahlrecht zwischen Geld- und Sachleistungen haben. Nach §9 Abs. 2 SGB IX können Sach- und Dienstleistungen zur Teilhabe, die beispielsweise durch ambulante Dienste erbracht werden, auf Antrag auch als Geldleistung erbracht werden. Dies gilt aber nur unter der Voraussetzung, dass „die Leistungen hierdurch voraussichtlich bei gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgeführt werden können“ (Lachwitz, Welti 2002, 22).
Leistungen werden aber nicht nur an die Person mit Behinderung selber erbracht. Arbeitgeber können ebenfalls Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben beantragen. Diese umfassen insbesondere finanzielle Hilfen, um die verringerte Leistungsfähigkeit oder einen finanziellen Mehraufwand seitens des Arbeitgebers auszugleichen. Zu diesen Leistungen zählen beispielsweise Ausbildungszuschüsse, Eingliederungszuschüsse, Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb oder teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probebeschäftigung (vgl. Kossens u.a. 2002, 23).
Im §33 Abs. 8 SGB IX wird das Recht auf eine Arbeitsassistenz bestätigt. Die Übernahme der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz gehört somit zu den Hilfen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes. Arbeitsassistenz war zunächst im Jahr 2000 als Leistung der Hauptfürsorgestellen, die jetzt als Integrationsämter bezeichnet werden, in das damalige Schwerbehindertengesetz eingefügt worden und ist nun in den Leistungskatalog der Rehabilitationsträger übernommen. Die Kostenübernahme ist für eine Dauer von bis zu drei Jahren vorgesehen. Wenn allerdings eine längere Arbeitsassistenz nötig ist, besteht hierauf seitens des Arbeitnehmers ein Anspruch gegen das zuständige Integrationsamt (vgl. Neumann 2004, 294).
2.3. Beschäftigungspflicht und sonstige Pflichten der Arbeitgeber
Den Arbeitgebern werden im SGB IX nicht nur finanzielle und materielle Unterstützung gewährleistet, wenn sie Menschen mit Behinderungen einstellen. Es werden ihnen auch Pflichten auferlegt, deren Wirksamkeit allerdings umstritten ist, und die im Folgenden dargestellt werden.
Das SGB IX beinhaltet, ebenso wie das vorangegangene Schwerbehindertengesetz, nicht nur Rechte bzw. Leistungen für Arbeitgeber, sondern erlegt diesen auch Pflichten auf, vor allem in Form einer Beschäftigungspflicht. Nach §71 ist der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen verpflichtet, sofern er über mindestens 20 Arbeitsplätze verfügt. Die Arbeitsplätze sind zu mindestens fünf Prozent mit Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung zu besetzen, wobei schwerbehinderte Frauen besonders zu berücksichtigen sind (vgl. Kossens u.a. 2002, 41)
Arbeitgeber, sowohl öffentliche als auch private, müssen eine Ausgleichsabgabe zahlen, wenn sie dieser Beschäftigungspflicht nicht nachkommen. Die Quote der Arbeitsplätze, die mit schwerbehinderten Arbeitnehmern besetzt waren, lag 1999 bei 3,7% und stieg im Jahr 2000 und 2001 auf 3,8%. Von den insgesamt 187.400 Firmen und Behörden, die 1999 beschäftigungspflichtig waren, haben drei Viertel die angehobene Beschäftigungsquote von inzwischen sechs Prozent nicht erreicht. 71200 der entsprechenden Arbeitgeber haben sogar überhaupt keinen einzigen schwerbehinderten Arbeitnehmer beschäftigt. Bei diesen handelte es sich überwiegend um Arbeitgeber, die weniger als hundert Arbeitsplätze hatten. Die Beschäftigungspflicht wurde weder von öffentlichen noch von privaten Arbeitgebern voll erfüllt (vgl. Neumann, Pahlen 1992, 4 f.). Der öffentliche Dienst hat bei der Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen eine Vorbildrolle, die von der Bundesregierung immer wieder betont wird und ihren Ausdruck in den Verweisen in ihren Stellenanzeigen auf die Bevorzugung von schwerbehinderten Bewerbern bei gleicher Eignung findet. Trotzdem lag auch im öffentlichen Dienst die Beschäftigungsquote 1996 nur bei 3,8% in Ostdeutschland und bei 5,5% in Westdeutschland (vgl. Mühling 2000, 153).
Bei den Zahlen zu den beschäftigten Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung in großen Betrieben ist außerdem noch zu beachten, dass 80% der Beschäftigten nicht als Schwerbehinderte neu eingestellt wurden. Die Beschäftigungszahlen sind daher schlechter zu bewerten, als sie zunächst erscheinen. Diese 80 % schwerbehinderte Beschäftigte haben während eines bereits bestehenden Arbeitsverhältnisses einen Antrag auf die Anerkennung einer Schwerbehinderung gestellt, was häufig im Einverständnis der Arbeitgeber erfolgte. Hingegen können scheinbar weder finanzielle Anreize noch gesetzliche Auflagen dazu beitragen, in nennenswertem Umfang die Neueinstellung von Menschen mit Behinderungen zu fördern (vgl. Hinz, Boban 2001, 41 f.). Aber nur über Neueinstellungen gelingt es, Personen mit bereits vorhandenen Behinderungen aus der Schule bzw. aus den Werkstätten für behinderte Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.
Für die Arbeitgeber sind die Möglichkeiten der Erfüllung der Pflichtquote sowie der Mehrfachanrechnung auf die Quote keine wichtigen Bedingungen zur Einstellung von Menschen mit Behinderungen. Dies stützt die Berechtigung zur häufig geäußerten Kritik, dass die Ausgleichsabgabe als Eingliederungsinstrument zu kurz greift, bzw. zu niedrig ist (vgl. Neumann, Pahlen 1992, 4 f.; Mühling 2000, 138).
3. Berufliche Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung
Für die meisten Jugendlichen steht zwischen Schule und eigenständiger Arbeit zunächst eine Phase der beruflichen Bildung oder, wie es Biermann ausdrückt: “Berufsbildung ist als Gelenk zwischen dem staatlich gesicherten und mit hohen Bildungszielen bedachten Schulwesen zu sehen und dem Arbeitssektor und der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung“ (ebd. 2003, 842). Unter Punkt 3.1. wird zunächst die Berufsvorbereitung innerhalb der Schule für geistig Behinderte vorgestellt. Der Anspruch und die Ziele der Werk- bzw. Abschlussstufe der Schulen für geistig Behinderte werden dargestellt, und es wird kurz auf die Frage eingegangen, inwieweit die Schulen die SchülerInnen auf den Sonderarbeitsmarkt vorbereiten. Darauf folgen nötige Veränderungen im Unterricht, um die SchülerInnen auch auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt adäquat vorzubereiten. Unter Punkt 3.2. werden die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen für die betreffenden SchülerInnen in Form der Förderlehrgänge, der berufsbildende Bereich in den Werkstätten für behinderte Menschen sowie neue Wege in der beruflichen Bildung dieser Personengruppe dargestellt.
3.1. Berufsvorbereitung in der Schule für geistig Behinderte
Die Berufsschulpflicht kann in den meisten Bundesländern von SchülerInnen der Schulen für geistig Behinderte in dieser erfüllt werden. Die Schulzeit beträgt somit 12 Jahre. Die Abschluss- oder Werkstufe hat daher eine Brückenfunktion zwischen allgemeinbildender Schule und Arbeitsleben. Ihre pädagogische Aufgabe ist es, die Jugendlichen „ganzheitlich und umfassend auf ihr Leben als Erwachsene vorzubereiten“ (Hensch 1994, 27). Der Unterricht in der Abschlussstufe zielt also nicht alleine auf eine Vorbereitung auf das Arbeitsleben und schon gar nicht auf bestimmte Berufe ab, sondern auf die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit der Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsbemühungen aus den vorangegangenen Stufen sollen somit fortgesetzt und ergänzt werden. Das Hineinanwachsen der Jugendlichen in die Erwachsenenwelt soll unterstützt werden und sie sollen auf jene Lebenssituationen vorbereitet werden, „in die sie als handelnde und erlebende Erwachsene gestellt werden“ (Niedersächsisches Kultusministerium 1994, 5). Nach hensch gehen die Rahmenrichtlinien der Abschlussstufe in Niedersachsen vom Normalisierungsprinzip aus, „d.h. sie sind auf einem allgemeinen und ganzheitlichen pädagogischen Niveau verfasst“ (ebd. 1994, 28). Mühl beschreibt, dass die Abschluss- oder Werkstufe die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf das Erwachsenenleben in allen Lebensbereichen vorbereitet, also neben der Arbeit auch auf die anderen relevanten Lebensbereiche wie Wohnen, partnerschaftliches Zusammensein mit anderen, auf Freizeit und das Sichzurechtfinden in der Öffentlichkeit. Die berufliche Vorbereitung soll allgemein dazu dienen, mit der Situation und den Problemen des Arbeitslebens vertraut zu machen (vgl. ebd. 1997, 40).
Seit einiger Zeit werden Veränderungen in der Berufsvorbereitung in der Schule für geistig Behinderte gefordert. Es wird kritisiert, dass die Schulen zu sehr auf eine Beschäftigung in den Werkstätten für behinderte Menschen vorbereiten, und zu wenig auf eine auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Noch 1990 beschrieben Brüggenwirth u.a., dass die Werkstufe die SchülerInnen auf den Lebensbereich Arbeit und Beruf vorbereiten soll und zwar in enger Kooperation mit der WfbM. Die Autoren schränken zwar ein, dass dies nicht zu einem Abhängigkeitsverhältnis von der Schule zur WfbM führen dürfe, schlagen aber lediglich vor, dass die Schule der WfbM neue Tätigkeitsfelder benennen könne. Praktika oder sogar ein Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt werden in keiner Weise erwähnt (vgl. ebd. 1990, 29). In den letzten Jahren kommt es zunehmend häufiger vor, dass Integrationsfachdienste, auf die weiter unten noch eingegangen wird, Jugendliche mit geistiger Behinderung dabei unterstützen, einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erlangen. Diese Jugendlichen sind aber häufig jahrelang in der Schule auf eine Beschäftigung in der WfbM vorbereitet worden (vgl. Lindmeier, Oschmann 1999, 355). Wenn man dem Integrationsgedanken folgt und somit eine Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu einer wirklichen Wahl- und Handlungsalternative werden soll, müssen die SchülerInnen bereits im Rahmen der beruflichen Grundbildung in der Schule hierauf vorbereitet werden. Dies stellt einen ganzheitlichen Prozess dar, der auch andere Handlungsfelder wie das Wohnen oder die Freizeitgestaltung umfasst (vgl. ebd. 1999, 362). Im Zuge dieser Bestrebungen muss sich die Berufsvorbereitung in der Schule für geistig Behinderte verändern, um die SchülerInnen entsprechend den anderen Anforderungen auf das Arbeitsleben vorzubereiten. Die Schule hat sich dann den folgenden Aufgaben einer unmittelbaren Arbeits- und Berufsorientierung zu stellen:
- Orientierung an den Bedingungen realer Arbeit,
- Intensivierung der Kooperation mit den Eltern,
- Intensivierung der Kooperation mit anderen Institutionen, die an der beruflichen Integration beteiligt sind,
- sowie eine Entwicklung von beruflichen Perspektiven für den jeweiligen Schüler, die individualisiert und kompetenzorientiert im Sinne einer individuellen Entwicklungsplanung (IEP) erfolgt (vgl. ebd. 1999, 350 f.).
Schartmann fordert, dass eine Vorbereitung auf eine berufliche Integration nicht auf die Abschlussstufe beschränkt bleiben darf. Stattdessen müsse sie sehr früh einsetzen. Am sinnvollsten erachtet er ein diesbezügliches pädagogisches Konzept, das bereits in der Unter- und Mittelstufe umgesetzt wird. Seiner Meinung nach muss eine berufliche Integration „bei jeder erzieherischen Interaktion, bei jedem erzieherischen Handeln mitgedacht werden, der Unterricht muss auf die spätere Integration und die dafür erforderlichen Kompetenzen bezogen sein“ (Schartmann 2000).
Dieser Forderung wird insbesondere in den speziellen Rahmenrichtlinien für die Abschlussstufe in Niedersachsen nachgekommen. Der Unterricht umfasst hier neben den Inhalten der allgemeinen Rahmenrichtlinien der Schule für geistig Behinderte, die weiterhin ihre Gültigkeit behalten, die Lernbereiche Ich-Erfahrung, Wohnen, Freizeit, Arbeit und Beruf, Öffentlichkeit sowie Umwelt und Umweltschutz. Um der zunehmenden Unabhängigkeit und dem Alter der SchülerInnen zu entsprechen, baut der Unterricht in der Abschlussstufe auf den Prinzipien Selbsttätigkeit und Lebensnähe auf, die konsequent in allen Phasen des Unterrichts umgesetzt werden sollen. Konkret soll der Unterricht in lernbereichsübergreifenden Projekten verwirklicht werden und auf dem Prinzip der Erwachsenenpädagogik aufbauen (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 1994, 6 f.). Von den meisten Integrationsfachdiensten werden berufsvorbereitende Elemente wie unterstützte Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, projektorientierter Unterricht und Arbeitsprojekte mit Ernstcharakter, Trainingsmaßnahmen in den Bereichen Wohnen und Freizeit als fester Bestandteil einer schulischen Vorbereitung auf ein Leben in beruflicher und sozialer Integration befürwortet (vgl. Lindmeier, Oschmann 1999, 361).
3.2. Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit geistiger Behinderung
Das Ziel jeglicher beruflicher Bildung von Menschen mit Behinderungen stellt die Teilhabe am Arbeitsleben dar, wobei eine Ersteingliederung von einer Wiedereingliederung unterschieden werden kann. Diese Arbeit beschränkt sich auf den ersten Aspekt, und zwar speziell bezogen auf Jugendliche mit geistiger Behinderung. Reguläre Ausbildungen nach der Handwerksordnung, aber auch abgestufte Teilausbildungen, wie sie für Auszubildende mit Behinderungen vorgesehen sind, kommen für diese Zielgruppe aufgrund der Anforderungen in der Berufsschule normalerweise nicht in Frage. Ihre Ausbildung erfolgt daher zum einen in Form von sogenannten Förderlehrgängen, und zum anderen, für die meisten Abgänger der Schule für geistig Behinderte, in den Werkstätten für behinderte Menschen. Beide Ausbildungsmöglichkeiten werden im Folgenden kurz dargestellt. Im Zuge der Integrationsbestrebungen sind erweiterte Ausbildungsmöglichkeiten für den Personenkreis entstanden, die den dritten Unterpunkt in diesem Kapitel bilden (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 2002b, 405).
3.2.1. Grundlagen
Auch wenn es vermehrt Bestrebungen gibt, Schulabgänger der Schule für geistig Behinderte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln, findet für die meisten Jugendlichen die Ausbildung im Berufsbildungsbereich der WfbM statt (vgl. Mühl 2002, 75). Grundsätzlich bestehen für diese Personengruppe aber auch rechtliche Grundlagen in Anlehnung an das Berufsbildungsgesetz, §§ 44, 48 bis 48b BBiG, sowie an die Handwerksordnung, §§ 41, 42b bis 42d HwO. Diese werden aber bisher nur unzureichend genutzt (vgl. Leinemann 2002; Musielak 1995).
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass eine Vermittlung der Schulabgänger direkt von der Schule in den allgemeinen Arbeitsmarkt auf mehr oder weniger große Schwierigkeiten stößt. Den Jugendlichen fehlen bestimmte Grundqualifikationen und Arbeitserfahrungen. Daraus kann man schließen, dass in der Schule für geistig Behinderte, ebenso wie in der WfbM, „derzeit keine geeignete Vorbereitung für Integration in dem allgemeinen Arbeitsmarkt stattfindet“ (Lindmeier, Oschmann 1999, 360). Zwischen allgemeinbildender Schule und Eintritt in das Arbeitsleben sind daher in den meisten Fällen berufsvorbereitende Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen geschaltet. Diese sind allerdings nur dann als sinnvoll anzusehen, wenn gewährleistet ist, dass auf jeden Jugendlichen individualisierend eingegangen wird, und ein Großteil der Berufsvorbereitung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt stattfindet (vgl. ebd. 1999, 360).
Förderlehrgänge dienen einer intensiven Vorbereitung auf das Arbeitsleben, indem sie berufliche Basisqualifikationen vermitteln, die Jugendlichen verschiedene Berufsfelder kennen lernen und sich dann für einen Bereich entscheiden. Der sogenannte F-Lehrgang wird in vier verschiedenen Formen, F1 bis F4, angeboten, die sich in ihrer Dauer unterscheiden und vor allem den unterschiedlichen Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht werden sollen und sich somit an unterschiedliche Zielgruppen richten:
- Der F1-Lehrgang ist für Jugendliche, die an sich für eine Berufsausbildung in Betracht kommen, jedoch eine besondere Förderung aufgrund ihrer Behinderung benötigen. Die Dauer beträgt bis zu 12 Monate.
- Die Lehrgänge F2 und F3 werden für die Schulabgänger angeboten, die keine reguläre Berufsausbildung absolvieren können, in der WfbM jedoch unterfordert wären. Sie dauern bis zu 24 Monate (F2) bzw. bis zu 36 Monate (F3).
- Der F4 ist für solche Personen, die aufgrund der Dauer ihrer medizinischen Rehabilitation auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht wettbewerbsfähig sind. Der Lehrgang hat eine Dauer von bis zu 6 Monaten. (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 2002b, 340).
Die Ableistung der Berufsschulpflicht ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt. In manchen Ländern ist sie bereits mit dem Besuch der Abschlussstufe der Schule für geistig Behinderte erfüllt, in anderen hingegen besteht für die Jugendlichen die Pflicht zum Besuch der Berufsschule. Teilweise kann dieser auch in der WfbM erteilt werden (vgl. Mühl 2002, 75).
3.2.2. Berufliche Bildung in Werkstätten für behinderte Menschen
Anspruch auf berufsbildende Leistungen in einer WfbM haben die Personen, die nach dem SGB IX Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben haben und sich und andere nicht gefährden. Am Anfang einer Beschäftigung in einer WfbM findet ein Eingangsverfahren statt, welches dem Teilnehmer der berufsbildenden Maßnahme, der Werkstatt sowie dem Rehabilitationsträger dient. Das Ziel dieses Eingangsverfahrens ist zunächst festzustellen, ob die Werkstatt überhaupt die richtige Einrichtung zur Teilhabe am Arbeitsleben für die betreffende Person darstellt, und welche berufsbildenden Leistungen und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Werkstatt in Betracht kommen. Darüber hinaus sollen aber auch weitergehende Möglichkeiten zur beruflichen Bildung und zum Übergang in eine andere berufsbildende Maßnahme innerhalb und auch außerhalb der Werkstatt geprüft werden. Konkret wird in dieser Zeit für jeden Teilnehmer ein Eingliederungsplan erstellt, der Vorschläge für die weitere Teilhabe am Arbeitsleben enthält (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 2002a).
Ähnlich wie die Rahmenrichtlinien der Abschlussstufe der Schule für geistig Behinderte benennt das Rahmenprogramm als Ziel für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich in der WfbM neben der Teilhabe am Arbeitsleben auch die Entwicklung der Persönlichkeit der Beschäftigten. Die jeweiligen Bildungsmaßnahmen sollen die beruflichen und die lebenspraktischen Fähigkeiten der Teilnehmer entwickeln und auf geeignete Tätigkeiten entweder in der WfbM oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten. Auf die Möglichkeit des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wird noch einmal explizit verwiesen, indem gesagt wird, dass die Berufsbildungsmaßnahmen so gestaltet werden müssen, dass es Teilnehmern möglich ist, aufbauende oder ergänzende Bildungsangebote von Berufsschulen, Berufsbildungswerken, sonstigen Reha-Einrichtungen, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern wahrnehmen zu können. In Einzelfällen sollen auch Maßnahmen geboten werden, die Berufsbildungsabschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung ermöglichen. Konkret entwickeln und verbessern die Bildungsmaßnahmen der Werkstatt die Kompetenzen der Teilnehmer in folgenden Bereichen: Kulturtechniken, Kernqualifikationen, Arbeitsprozesse sowie Schlüsselqualifikationen. Berufliche Bildung setzt die Förderung in allen vier Bereichen voraus. Erst in der Verbindung der Bereiche entsteht eine berufsqualifizierende Kompetenz. Die Methoden zum Erarbeiten der genannten Bereiche sollen selbstgesteuerte Lernprozesse initiieren und kooperatives Lernen und Handeln fördern (vgl. Neumann 2004, 686).
In einigen Bundesländern, nämlich Bremen, Niedersachsen, Hessen und Hamburg, besuchen die Berufsanfänger der WfbM während ihrer Ausbildungsphase zusätzlich in Teilzeitform die zuständige Berufsschule. Dieser Schulbesuch soll dazu dienen, die neuen Bildungsbedürfnisse in Bezug auf Beruf und Privatleben ausreichend bearbeiten zu können. Es wird davon ausgegangen, dass dies allein durch berufsvorbereitende Maßnahmen noch während der Schulzeit und innerhalb der WfbM nicht hinreichend geschieht (vgl. Schwarzmüller 2000, 1).
Im Hinblick auf eine Eingliederung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wird die Berufsvorbereitung in der WfbM von verschiedenen Autoren kritisiert. So beschreibt Schartmann, dass man aus dem aktuell vorliegenden Forschungsstand schließen kann, dass ein Übergang von der Schule in den allgemeinen Arbeitsmarkt besser gelingt als von der WfbM. Die bisher vertretene These, dass Menschen mit geistiger Behinderung zunächst im Berufsbildungsbereich der WfbM qualifiziert werden müssen, damit sie später in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden können, ist somit widerlegt (vgl. ebd. 2000). Doose beschreibt sogar, dass die Fähigkeiten und Qualifikationen, welche die Beschäftigten aus der WfbM mitbringen, sich häufig als unzureichend und teilweise sogar als kontraproduktiv für eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erweisen (vgl. ebd.1996).
3.2.3. Neue Wege in der beruflichen Bildung für Menschen mit geistiger Behinderung
Über den idealen Weg von Jugendlichen mit geistiger Behinderung in das Berufs- und Arbeitsleben herrscht noch keine Einigkeit. Die Diskussion bewegt sich im Wesentlichen zwischen der Forderung nach anerkannten Berufsausbildungen für diesen Personenkreis und einer flexiblen Berufsvorbereitung, die ihren Schwerpunkt auf die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen legt. Wie in den vorangegangenen Kapiteln deutlich wurde, ist die berufliche Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung organisatorisch in einem Schnittfeld verschiedener Einrichtungen angesiedelt.
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert, dass zum einen die angestrebten Bildungsprozesse inhaltlich abgestimmt werden und zum anderen die verschiedenen Systeme im Rahmen eines Gesamtkonzeptes anerkannter Berufsausbildungen vernetzt werden. Sie argumentiert, dass auch Personen mit geistiger Behinderung das uneingeschränkte Grundrecht auf Arbeit und Ausbildung haben wie alle BürgerInnen. Da ihnen die bisherigen anerkannten Ausbildungen aber weitestgehend nicht zugänglich sind, wird gefordert, dass neue Ausbildungswege erschlossen werden (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe 1997, 1).
Wenn die Abschlussstufe mit der berufsbildenden Phase stärker verbunden wird, würde ein Zeitraum von insgesamt fünf Jahren für die Berufsvorbereitung vorhanden sein. Kritisiert wird von der Lebenshilfe im Rahmen dieser Überlegungen in erster Linie, dass Jugendlichen, die in eine WfbM eintreten, dort lediglich höchstens zwei Jahre für ihre Ausbildung zugestanden werden. Hingegen durchlaufen alle anderen Schulabgänger normalerweise dreieinhalb Jahre Ausbildung (Bundesvereinigung Lebenshilfe 1997, 3). Eine Projektgruppe der Bundesvereinigung Lebenshilfe forderte in diesem Zusammenhang die Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen mit geistiger Behinderung, die zu anerkannten Berufsbezeichnungen führen würden. Es werden drei Möglichkeiten genannt, wie diese Ausbildungen umgesetzt werden könnten: 1. integrative Berufsausbildung von behinderten und nichtbehinderten Jugendlichen, 2. überbetriebliche Ausbildung in einem Berufsbildungswerk oder 3. Berufsausbildung in einer berufsvorbereitenden Sondereinrichtung und berufliche Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule (vgl. ebd. 1997, 10).
Die Annahme, dass anerkannte Berufsausbildungen zu einer leichteren Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt führen, ist aber schon lange nicht mehr unumstritten. Schon 1974 hielt es der Arbeitsmarkt- und Berufsforscher Mertens für nötig, von der traditionellen Berufsorientierung des Bildungssystems abzukehren. Er beschreibt, dass der extrem hohe Grad an Arbeitsteilung und der rasche Wandel von Arbeitsplatzverhältnissen es kaum noch möglich machen, berufliche Bildung unmittelbar auf gegebene Arbeitsplätze auszurichten. Die jeweiligen Inhalte wären jeweils nur auf wenige Arbeitsplätze anwendbar, und sie wären einem so raschen Wandel unterworfen, dass jeglicher Lehrplan o.ä. hinter der Wirklichkeit zurückbleiben müsste. Die Lösung sieht Mertens daher in Schlüsselqualifikationen, die es dem Berufstätigen ermöglichen, den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden (vgl. Mertens 1974, zitiert nach Hörning 1981, 24 f.). Klüssendorf bestätigt diese Annahme in jüngster Zeit und stellt fest, dass neben den fachlichen Kompetenzen zunehmend die Schlüsselqualifikationen eine zentrale Rolle beim Zugang und auch beim Fortbestehen eines Beschäftigungsverhältnisses spielen. Auch er begründet dies in erster Linie mit einer sich stetig weiterentwickelnden Automatisierung von einfachen Routinetätigkeiten sowie mit der „deutlichen Entwicklung hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft, der „sinkenden Halbwertszeit“ von fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten und einschneidenden Veränderungen in den Unternehmensstrukturen“ (ebd. 2003, 21).
Die Notwendigkeit des Erwerbs von Schlüsselqualifikationen macht deutlich, dass jeglicher vorbereitenden Qualifizierung, die nicht am eigentlichen Arbeitsplatz durchgeführt wird, Grenzen gesetzt sind. Die nötigen Qualifikationen beziehen sich nämlich nicht nur auf die fachlichen Anforderungen an sich, sondern auch auf Fähigkeiten wie Konfliktbewältigung und Kommunikation. Klüssendorf stellt dar, dass die Erfahrungen mit Unterstützter Beschäftigung zum einen gezeigt haben, dass Menschen mit geistiger Behinderung durchaus in der Lage sind, sich die benötigten Fähigkeiten anzueignen und zum anderen hierin auch „Chancen im Hinblick auf ihre Persönlichkeitsentwicklung zu sehen sind“ (ebd. 2003, 21).
Eines der ersten Bundesländer, in denen Anfang der achtziger Jahre integrative Klassen eingerichtet wurden, war Hamburg. 1998 gab es hier 462 Integrationsklassen in 53 Schulen. 1996 wurde bereits der vierte Jahrgang aus Integrationsklassen der Sekundarstufe I aus der Schule entlassen. So bestand für Hamburg schon früh die Schwierigkeit, diese Jugendlichen nach Beendigung der allgemeinbildenden Schule angemessen auf einen Beruf vorzubereiten. Aufgrund der Erfahrung der integrativen Beschulung besteht sowohl bei den Jugendlichen als auch ihren Familien überwiegend der Wunsch, eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufzunehmen und nicht in die Sondereinrichtung WfbM zu gehen. Zurzeit gibt es für die Schulabgänger zwei Möglichkeiten der beruflichen Vorbereitung an Berufsschulen. Zum einen wurde 1993 an einer Gewerbeschule mit den Schwerpunkten Gartenbau und Floristik eine Berufsvorbereitungsklasse eingerichtet. Der Unterricht dort findet in Vollzeitform statt und es werden SchülerInnen mit Behinderung gemeinsam mit SchülerInnen unterrichtet, die noch nicht berufsreif sind bzw. die keinen Hauptschulabschluss haben. Zum anderen wurde ein Jahr später eine Alternative zu dieser Berufsvorbereitungsklasse entwickelt, in Form eines integrativen Förderungslehrgangs. Beide Angebote stellen konzeptionell die Fortsetzung der Integration im vorschulischen und schulischen Bereich dar (vgl. Sturm, Glenz 1998).
Weitere Angebote existieren sowohl für SchulabgängerInnen aus Integrationsklassen als auch für ehemalige SchülerInnen der Schule für geistig Behinderte. Zu nennen wären in diesem Zusammenhang zum einen der Fachdienst der Hamburger Arbeitsassistenz, das Ambulante Arbeitstraining sowie die Maßnahme „Berufsvorbereitung und berufliche Teilqualifikation BV-TQ“ (vgl. ebd. 1998).
4. Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
Der größte Anteil der arbeitenden Personen mit einer geistigen Behinderung ist zurzeit auf dem sogenannten Sonderarbeitsmarkt beschäftigt. Unter Punkt 4.1. wird zunächst vorgestellt, welche Aufgaben die Werkstätten als Institutionen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu erfüllen haben. Hierbei wird auf die rechtlichen Grundlagen der Werkstätten eingegangen sowie die Ziele, die in den Gesetzestexten formuliert sind. Im Anschluss erfolgen eine Darstellung des Personenkreises, für den die Werkstätten eingerichtet wurden, und die damit einhergehenden Schwierigkeiten der Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Beschäftigung möglichst vieler Menschen mit schweren Beeinträchtigungen. Den letzten Punkt stellt eine kurze Darstellung der Tagesförderstätten dar.
Unter Punkt 4.2. erfolgt dann eine Betrachtung der WfbM unter den Gesichtspunkten Stigmatisierung, Normalisierung sowie Integration. Grundlage dieses Punktes ist die These von Markowetz ein, dass eine gelungene Integration von Menschen mit Behinderungen zu deren Entstigmatisierung beiträgt. Deren Darstellung bildet die theoretische Grundlage für die darauf folgenden Kapitel 5 und 6 zur Beschäftigung von Menschen mit geistiger Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bzw. zum „supported employment“.
4.1. Aufgaben, rechtliche Grundlagen und Ziele der WfbM
Die Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Teil eines umfassenden Systems zur Unterstützung der beruflichen und sozialen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Zurzeit gibt es ca. 650 anerkannte oder vorläufige Werkstätten in der Bundesrepublik mit knapp 200.000 Plätzen. Träger von den WfbM sind in der Regel Wohlfahrtsverbände, die Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., kirchliche Organisationen und Kommunen. Die meisten WfbM besitzen Zweigwerkstätten und Außenstellen als ausgegliederte Betriebsteile (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 2002b, 460 ff.).
Die rechtliche Grundlage der Werkstätten für behinderte Menschen bilden das Sozialgesetzbuch IX und die Werkstättenverordnung (WVO). Weitere relevante gesetzliche Grundlagen sind die zweite Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) sowie das Arbeitsförderungs-Reformgesetz (AFRG). Nach § 17 und 18 der Werkstättenverordnung muss jede Werkstatt über mindestens 120 Arbeitsplätze verfügen, in der Aufbauphase über mindestens 60. Außerdem benötigen sie eine Anerkennung durch die Bundesagentur für Arbeit (früher: „Bundesanstalt für Arbeit“) im Einvernehmen mit dem örtlichen Sozialhilfeträger. Diese wird nur erteilt, wenn die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind (vgl. Neumann, Pahlen 2002, 1000 ff.).
Entsprechend dem Programmsatz des neuen SGB IX, welches besagt, dass behinderte Menschen nicht mehr Objekt von Fürsorge sein sollen, sondern den Anspruch auf selbstbestimmte Teilhabe haben, wurde der Name der Werkstatt für Behinderte in Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) umgewandelt. Außerdem werden die Teilhabeleistungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und in Sondereinrichtungen wie WfbM, Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke aufgehoben und in den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zusammengefasst (vgl. Neumann, Pahlen 2003, 205 ff.).
Die Leistungen, welche in anerkannten WfbM erbracht werden, sollen nach Paragraph 39 SGB IX dazu dienen, „die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der behinderten Menschen zu erhalten, zu entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen, die Persönlichkeit dieser Menschen weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu ermöglichen oder zu sichern“ (Kossens u.a. 2002, 25). Anders benennt fünf Ziele der Werkstätten für behinderte Menschen, nämlich gesellschaftliche und berufliche Integration, Unterstützung der Selbstbestimmung, finanzielle Sicherung, berufliche Bildung und Entwicklung von Persönlichkeit und Identität sowie die Sicherung des Rechts auf berufliche Rehabilitation. Aus diesen Zielen leitet er vier Aufgaben ab, die die WfbM erfüllen muss: arbeitspädagogische Qualifizierung der Fachkräfte, Eingliederung und Emanzipation, berufliche Bildung und Weiterbildung sowie wirtschaftliche Kraftentwicklung (vgl. ebd. 1996, 16 ff.).
Im Gegensatz zum Paragraphen 33 SGB IX, in dem die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben festgelegt sind und in dem nur von der Erwerbsfähigkeit gesprochen wird, sollen in der WfbM Erwerbs- als auch Leistungsfähigkeit gefördert werden. Hiermit soll deutlich gemacht werden, dass die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen nicht abhängig vom Erreichen der Erwerbsfähigkeit sein soll (vgl. Neumann, Pahlen 2003, 205 ff.). Es wird davon ausgegangen, dass „Arbeit für Menschen mit Behinderungen sinnstiftend und persönlichkeitsfördernd ist“ (Hagen 1998 316). Die Einrichtung von Werkstätten für behinderte Menschen geht auf diese Überzeugung zurück und ist Grundlage für die WfbM.
Nach §41 Abs. 1 SGB IX werden Leistungen im Arbeitsbereich einer WfbM für solche Menschen mit Behinderungen erbracht, bei denen eine „1. Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder 2. Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen“ (Neumann, pahlen 2002, 26). Einschränkungen des Personenkreises werden in § 136 Abs. 2 Satz 2 SGB IX vorgenommen. Personen, die eine Arbeit in einer WfbM aufnehmen möchten, dürfen nicht sich selbst oder andere gefährden. Eine weitere Einschränkung des Personenkreises wird in Bezug auf die Pflegebedürftigkeit gemacht, da keine außerordentliche Pflegebedürftigkeit vorliegen darf (vgl. Neumann, Pahlen 2002, 792). Ebenso wie im früheren Schwerbehindertengesetz wird also eine Einschränkung des in Frage kommenden Personenkreises vorgenommen, wobei die zugrundeliegenden Kriterien nicht eindeutig und somit teilweise Auslegungssache sind. Speck beschreibt, dass sich die Werkstätten primär am Markt orientieren. Dies bedeutet, dass Faktoren wie Produktion, Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb als Normen berücksichtigt werden müssen (vgl. ebd. 1991, 401). Die Bundesanstalt für Arbeit betont daher auch, dass die WfbM wirtschaftliche Arbeitsergebnisse erzielen muss, da sie nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen organisiert ist und ein unternehmerisches Profil aufweist (vgl. ebd. 2001, 462). Trotzdem ist die WfbM nicht mit einem erwerbswirtschaftlichen Betrieb vergleichbar. Sie benötigt daher staatliche und gesellschaftliche Unterstützung.
Der Begriff WfbM kennzeichnet eine große Vielfalt an Arbeitsmöglichkeiten, beispielsweise eine Beschäftigung im Montagebereich ebenso wie auf einem Bauernhof (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe 2000, 1). Nach §5 Abs. 1 und 2 WVO soll die Werkstatt über ein möglichst breites Angebot an Arbeitsplätzen verfügen, um Art und Schwere der Behinderung, der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit, Entwicklungsmöglichkeit sowie Eignung und Neigung der behinderten Menschen soweit wie möglich Rechnung zu tragen. Die Arbeitsplätze sollen in ihrer Ausstattung möglichst denjenigen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt entsprechen (vgl. neumann, Pahlen 2002, 983).
Die nach dem SGB IX zu erbringenden Leistungen sollen dazu dienen, es Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, eine den Neigungen und Eignungen entsprechende Beschäftigung aufzunehmen, auszuüben und zu sichern sowie an arbeitsbegleitenden Maßnahmen teilzunehmen. Ausdrücklich wird in § 41 Abs. 2 SGB IX der Übergang „geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen“ (Neumann, Pahlen 2002, 26) genannt, den die WfbM zu unterstützen und fördern hat. Unabhängig von der erbrachten Leistung erhält der Mitarbeiter einer WfbM das Arbeitsförderungsgeld ausgezahlt. Dieses ist sozialversicherungspflichtig, zählt allerdings nicht als Arbeitsentgelt (vgl. Kossens u.a. 2002, 251). 2002 verdiente ein Arbeitnehmer in einer WfbM im Durchschnitt 159,81 Euro monatlich, mit einer Schwankungsbreite von 105,86 Euro in Brandenburg bis 228,60 Euro im Saarland. In diesen Zahlen sind auch die Entgelte der Personen enthalten, die im Eingangs- oder Berufsbildungsbereich der WfbM arbeiten. Die durchschnittlichen Entgelte im Arbeitsbereich liegen etwas höher (vgl. Bundesministerium für Arbeit 2003).
Da die Beschäftigung im Arbeitsbereich einer WfbM an Mindestvoraussetzungen seitens des Beschäftigten gebunden ist, wurden Tagesförderstätten eingerichtet. An diese werden solche Personen vom Kostenträger verwiesen, die den Mindestanforderungen der WfbM nicht entsprechen. Der Auftrag an die Tagesförderstätten ist, die Personen mit schwerer, meist geistiger, Behinderung so zu fördern, dass sie in Zukunft in einer WfbM beschäftigt werden können. Aufgrund der hohen Anforderungen in einer WfbM ist dieses Förderziel allerdings für viele nicht realistisch. Hierdurch entsteht für diese Personen in den Tagesförderstätten dauerhaft die Situation, von gesellschaftlicher Arbeit ausgeschlossen zu werden und „ein Leben lang mit dem Attribut des „Nicht-Könnens“ versehen“ (Hagen 1998, 315) zu werden. Wenn schon die WfbM als Sondereinrichtung kritisiert wird, kann man zumindest sagen, dass „hier eine Teilhabe an produktiver Arbeit ermöglicht wird und insofern ein Mindestmaß an Normalität erreicht wird. Dieses Mindestmaß wird Menschen mit schwerer geistiger Behinderung vorenthalten, wenn sie ein Leben lang über Beschäftigungstherapie nicht hinausgelassen werden“ (ebd. 1998, 315).
Hagen macht anhand der Darstellung von zwei Personen, die in einer Tagesförderstätte beschäftigt sind, deutlich, „dass Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderungen einen Arbeitsbeitrag leisten können, wenn es ihnen nur zugetraut wird. Es gibt niemanden, der nicht arbeiten kann, der nicht etwas beizutragen hätte. […] In Tagesförderstätten darf es keine Mindestanforderungen an das Klientel geben. Es muss stattdessen verstärkt über Möglichkeiten der Sensibilisierung der Professionellen im Erkennen vorhandener Kompetenzen bei dem Klientel nachgedacht werden“ (ebd. 1998, 318).
4.2. Die WfbM als Sondereinrichtung unter den Aspekten Stigmatisierung, Integration, Normalisierung sowie Selbstbestimmung
Im folgenden Kapitel erfolgt zunächst unter Punkt 4.2.1. eine Betrachtung der WfbM unter den Aspekten der Integration, Normalisierung und Selbstbestimmung. Unter Punkt 4.2.2. wird der Begriff der „Stigmatisierung“ eingeführt, und anschließend dargestellt, inwieweit Sondereinrichtungen wie die WfbM zur Stigmatisierung der in ihr Beschäftigten beitragen. Unter Punkt 4.2.3. wird die These von Markowetz dargestellt, nach der eine gelungene Integration zur Entstigmatisierung beiträgt.
4.2.1. Die WfbM unter den Aspekten Integration, Normalisierung und Selbstbestimmung
Im vorschulischen und schulischen Bereich wurde im Zuge der Integrationsbestrebungen seit Anfang der achtziger Jahre bereits vielen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen die Gelegenheit gegeben, gemeinsam zu lernen. Als in der Vergangenheit der Ausbau von Sonderschulen forciert wurde, geschah dies unter der Annahme, dass SchülerInnen mit Behinderung in Sondereinrichtungen am besten auf ein integriertes Leben als Erwachsene vorbereitet werden würden. Die Integrationsbewegung hat diese Annahme von Anfang an abgelehnt, und deutlich gemacht, dass Integration nicht durch Separierung erreicht werden kann (vgl. Schuchardt 1996, 19). Der Grundgedanke, der hinter der Zuweisung in eine WfbM steckt, ist der, dass Personen, die eine dauerhafte Unterstützung benötigen, diese auch nur in einer entsprechend ausgestatteten Sondereinrichtung bekommen könnten (vgl. Doose 1999a, 218). Dies hat zur Folge, dass sich an jeder Schwelle (Grundschule/Sekundarstufe/Berufsschule/Arbeitsleben) das allgemeine Vorurteil wiederholt, die „Eingliederung in die Gesellschaft, so das zugrundeliegende Paradoxon, könne am besten durch die Ausgliederung vorbereitet werden“ (Doose 1999a, 217). Schumann stellt dar, dass sich in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen die Erwartungen noch immer an der Idee des Beschützens und Schonens in Familie und Institutionen orientieren. Es wird davon ausgegangen, dass Menschen mit Behinderungen hilflos und schonungsbedürftig seien. Dies dient als Begründung dafür, dass sie lebenslang auf Betreuung in geschützten Räumen angewiesen seien, „vor allem auch, weil die Welt „draußen“ so grausam und herzlos ist“ (ebd. 1998a, 16). Wie bereits darrgestellt, ist eine Folge dieser Zuschreibungen, die sich im Selbstbild niederschlagen, die erlernte Hilflosigkeit. Diese wiederum führt in der Regel zu permanenter Abhängigkeit und Fremdbestimmung. „Das „Projekt berufliche Eingliederung“ bricht mit dieser Logik“ (ebd. 1998, 186).
Hinz und Boban beschreiben, dass, ausgehend von der Theorie integrativer Prozesse, die Werkstätten dem Schema von Aussonderung und Differenzierung verhaftet sind. Ihre Entstehung stand im Zusammenhang mit der damals geringen Integrationsbereitschaft des ersten Arbeitsmarktes. Dominierend war in der freien Wirtschaft zu dieser Zeit der Anspruch an Anpassung und Gleichheit, den die Werkstätten ergänzten und entlasteten (vgl. ebd. 2001, 402). Der Sinn und die Erfolge der Werkstätten sollen damit in keiner Weise negiert werden. So betont Speck, dass, auf jeden Fall von einer großen Leistung der Sozialpolitik zu sprechen sei wenn man den Ist-Zustand mit den Problemen in Bezug auf Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten vor dreißig Jahren vergleicht. Zu fragen ist seiner Ansicht nach allerdings, ob das Geschaffene dem entspricht, was ursprünglich intendiert war (vgl. ebd. 1991, 399) und insbesondere, ob es den heutigen Ansprüchen genügt. Einem Verständnis von Integration, wie es in Kapitel I. dargestellt wurde, steht eine Sondereinrichtung wie die Werkstatt für behinderte Menschen entgegen. Zu bedenken ist, dass 93% aller Arbeitnehmer mit geistiger Behinderung in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind. Die Übergangsquote von der WfbM in den allgemeinen Arbeitsmarkt liegt nur bei ungefähr einem Prozent, so dass man sagen kann, dass der berufliche Weg von Menschen mit geistiger Behinderung für die Meisten vorgezeichnet ist (vgl. Schartmann 2000). Eine Beschäftigung in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes eignet sich aber für integrative Prozesse wesentlich besser, da diese ein von der Gesellschaft sehr hoch bewertetes Umfeld darstellt, im Gegensatz zu dem gesellschaftlich ausgegrenzten Bereich einer WfbM (vgl. Hinz, boban 2001, 402).
Dieser vorgezeichnete Weg in das Arbeitsleben widerspricht, neben dem Integrationsgedanken, auch dem Normalisierungsprinzip sowie der Forderung nach Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung. Das Normalisierungsprinzip fordert, dass der Standard für sämtliche Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen dem Standard entsprechender öffentlicher Einrichtungen entsprechen muss. Das bedeutet somit, dass es für Menschen mit Behinderungen die gleiche Skala an zur Verfügung stehenden beruflichen Möglichkeiten geben muss, wie für Menschen ohne Behinderungen (vgl. Thimm 1994b, 19ff.). Angesichts der wenigen Möglichkeiten der Beschäftigung für Menschen mit geistiger Behinderung ist dieses Kriterium aber bei weitem noch nicht erfüllt. Auch wenn die Selbstbestimmung im beruflichen Bereich bei jedem Menschen mehr oder weniger stark eingeschränkt ist, ist diese bei Personen mit geistiger Behinderung aufgrund der wenigen vorhandenen Wahlmöglichkeiten kaum verwirklicht. Dies betrifft sowohl die vorhandenen Wahlmöglichkeiten innerhalb der WfbM, die nur eingeschränkte Arbeitsmöglichkeiten bietet, als auch insbesondere die Möglichkeit der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
4.2.2. Die WfbM unter dem Aspekt der Stigmatisierung
Der Begriff des Stigmas wurde von goffman geprägt, der hierunter eine Eigenschaft einer Person versteht, die von dessen Umwelt als „zutiefst diskreditierend“ (ebd. 1975, 11) wahrgenommen wird. Als Folge dieser diskreditierenden Zuschreibung von außen wenden sich die Mitmenschen von einer Person ab, obwohl diese eigentlich ohne Schwierigkeiten in den sozialen Verkehr hätte aufgenommen werden können, der für die jeweilige Gesellschaft typisch ist. Der Anspruch, den seine anderen, nicht diskreditierenden Eigenschaften an die Anderen stellen, wird somit gebrochen. Das betreffende Individuum „hat ein Stigma, das heißt, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten“ (ebd. 1975, 13). Dieses Stigma wirkt ebenso wie ein Vorurteil auf der Ebene der Einstellungen, beinhaltet somit noch kein tatsächliches Verhalten. Dieses ist in dem Begriff der Stigmatisierung enthalten, welcher das Verhalten auf Grund eines zueigen gemachten Stigmas bezeichnet. Wenn eine Person erst einmal stigmatisiert ist, tendieren die Mitmenschen dazu, dieser Person weitere negative Eigenschaften oder Unvollkommenheiten zu unterstellen. Dies wird meist noch durch bestimmte Bezeichnungen wie bspw. Krüppel oder Schwachsinniger unterstrichen (vgl. Cloerkes 2000; Goffman 1972, 14).
Der Prozess der Stigmatisierung hat tiefgreifende Auswirkungen bzw. Folgen für den Betroffenen. Auf der Ebene der gesellschaftlichen Teilhabe wird die Person isoliert und leidet unter Kontaktverlust. Auf der Ebene der Interaktionen herrschen Spannung, Unsicherheit sowie Angst vor. Schließlich drohen dem Stigmatisierten erhebliche Gefährdungen auf der Ebene der Identität (vgl. Cloerkes 2000). Die betreffende Person übernimmt das Stigma als Teil der eigenen Identität und gemäß einer selbsterfüllenden Prophezeiung entspricht sie diesem Merkmal, wodurch andere Entwicklungsmöglichkeiten schließlich verhindert werden (vgl. Hinz, boban 2001, 96 f.).
Bei den Auswirkungen von Stigmatisierung auf die Identität der betroffenen Person, bezieht sich Thimm (1975; zitiert nach Cloerkes 2000) auf das Konzept der balancierten Ich-Identität von Krappmann (1969; zitiert nach Cloerkes 2000). Krappmann unterscheidet eine persönliche Identität, in welcher sich eine Person als einzigartig zeigt, von einer sozialen Identität, mit der das Individuum den Erwartungen seines Gegenübers entspricht (s. Abbildung 3). Eine Ich-Identität ergibt sich erst aus einem ausbalancierten Verhältnis von persönlicher und sozialer Identität. Jede Teilnahme an einer Interaktion macht somit den Umgang mit widersprüchlichen Anforderungen notwendig. Dies birgt nach Thimm die Gefahr einer Nicht-Identität, und zwar durch Aufgabe der persönlichen Identität bzw. durch Aufgabe der sozialen Identität. Die Folge hiervon ist im ersten Fall Konformismus bzw. Ritualismus und im zweiten Fall resultieren Kontaktstörungen und in Folge dessen ein Rückzug aus der fehlenden Balance zwischen persönlicher und sozialer Identität (s.u.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 Identität und mögliche Störungen nach Thimm (Cloerkes 2000)
Menschen werden normalerweise nicht von einem Tag auf den anderen stigmatisiert, sondern in die Rolle eines Stigmatisierten sozialisiert. Dies geschieht erstens in der primären Kindheitssozialisation, wenn das Stigma zu diesem Zeitpunkt bereits vorhanden ist. Zweitens geht diese Sozialisation in den Interaktionen mit den Mitmenschen fortlaufend vonstatten und drittens schließlich „als Klient von speziellen Organisationen, in denen eine neue soziale Identität konstruiert wird“ (Cloerkes 2000).
Stigmatisiert werden kann nach Goffman theoretisch jeder Mensch aufgrund jeder Eigenschaft (vgl. ebd. 1977, 56 ff.). Hohmeier verwendet den Begriff des Stigmas daher auch nicht für ein Merkmal an sich, sondern für dessen negative Definition bzw. dessen Zuschreibung. Er stimmt Goffman zu, dass im Prinzip jedes Merkmal zu einem Stigma werden kann, betont jedoch, dass sich einige Merkmale eher dafür anbieten als andere (vgl. Hohmeier 1975). Die Andersartigkeit, die von den Mitmenschen antizipiert wird, und schließlich als Stigma angesehen wird, trifft insbesondere Menschen mit Behinderungen in Sondereinrichtungen. Sowohl der Besuch einer Sonderschule als auch eine Beschäftigung auf dem Sonderarbeitsmarkt hat für die betreffende Person eine stigmatisierende Wirkung (vgl. Mühling 2000, 150). Menschen mit Behinderung, die in einer Sondereinrichtung wie der WfbM beschäftigt sind, werden in unserer Gesellschaft somit zwei Stigmata zugeschrieben. Zum einen gilt die Behinderung an sich als Stigma und zum anderen die Beschäftigung in der Werkstatt, die das erste Stigma noch betont. So bestärkt der geringe Lohn für die Arbeit in einer WfbM in der Bevölkerung die Ansicht, „dass von Beschäftigten der Behindertenwerkstätten nur geringe Produktivität und Flexibilität zu erwarten sei“ (Mühling 2000, 149). Hinz und Boban stellen als Ergebnis einer Untersuchung fest, dass „das institutionalisierte Stigma in der Werkstatt für Behinderte kaum in Frage zu stellen oder zu relativieren ist“ (ebd. 2001, 401). Weiter führen sie aus, dass die Situation bei den Personen, deren Stigma nicht offensichtlich ist, wie bei Personen, die sich im sogenannten Grenzbereich zwischen einer geistigen und einer Lernbehinderung befinden, besonders problematisch sein kann. Diese Person wird besonders darauf achten, dass ihr Stigma nicht entdeckt wird. Dies führt zu einer allseitigen Verunsicherung, die eine soziale Einbindung gefährdet (vgl. ebd. 2001, 402).
4.2.3. Entstigmatisierung durch Integration
Ausgehend von den Fragen, wie Menschen mit Behinderungen mit den Zuschreibungen umgehen, und wie Identität entsteht, stellt Markowetz die These der Entstigmatisierung durch Integration auf: „Eine gelungene soziale Integration behinderter Menschen trägt ganz entscheidend zur Identitätsentwicklung bei, verhindert »beschädigte Identität« und führt zu Entstigmatisierung“ (ebd. 2000, 114). Er stellt dar, dass im „Handlungsfeld Integration“ alle Beteiligten die Möglichkeit haben, zu kooperieren und sich selbst und den Kooperationspartner kennen zu lernen (vgl. ebd. 2000, 114). Integration wird hier als Prozess angesehen, in dessen Verlauf sich Einstellungen verändern und sich so soziale Vorurteile vermeiden lassen. Es geht also um Prozesse, die sich in einer dynamischen Balance von Annäherung und Abgrenzung vollziehen (vgl. Hinz, Boban 2001, 97).
Man kann daher davon ausgehen, dass eine erfolgreiche Integration einen grundlegenden Bestandteil der Entstigmatisierung von Menschen mit Behinderungen darstellt. Die Folge ist ein positiveres Selbstbild, welches wiederum Einfluss und Widerstand auf das Fremdbild ausübt und dieses verändern kann. Das Fremdbild bleibt somit nicht länger ein hypothetisches Konstrukt, sondern es wird praktisch nachvollziehbar und überprüfbar. Sogenannte beschädigte Identitäten sind somit unter integrativen Bedingungen reversibel, und das Bild vom Behinderten wird insgesamt realitätsgerechter. Markowetz stellt die Zusammenhänge des Prozesses der Entstigmatisierung durch Integration folgendermaßen dar:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dialogische Validierung identitätsrelevanter Erfahrungen als Entstigmatisierungsprozess und Voraussetzung für die Entfaltung „unbeschädigter Identitäten“
Mit Validierung bezeichnet Markowetz jenen Prozess, in dem vor allem solche Haltungen, Zuschreibungen oder Einstellungen auf deren Richtigkeit und damit auf ihre Haltbarkeit zu überprüfen sind, die bereits von den jeweiligen Interaktionspartnern internalisiert worden sind. Notwendig ist hierzu, diese im Dialog mit der betreffenden Person zu hinterfragen, nicht aber der völlige Verzicht auf Bewertungen und Zuschreibungen, denn diese verdeutlichen erst, was uns an der anderen Person befremdet und beschäftigt.
[...]
[1] „Man, as man, supercedes the sum of his parts.“
[2] „Man has his being in a human context.“
[3] „Man is aware.“
[4] „Man has choice.“
[5] „Man is intentional.“ (ebd. 1964, 24 (1))
[6] Zwierlein verwendet den weiteren Begriff der „Arbeit“ bzw. „Erwerbsarbeit“, den er nicht genau definiert und teilweise im Sinne der obigen Definition von „Beruf“ verwendet.
- Arbeit zitieren
- Katja Döling (Autor:in), 2004, Förderung von Selbstbestimmung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41064
Kostenlos Autor werden







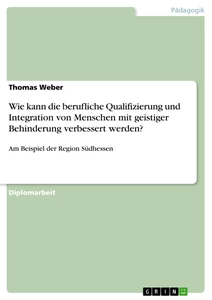

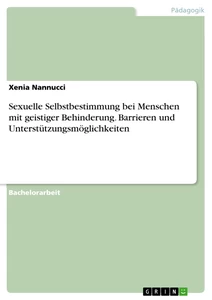







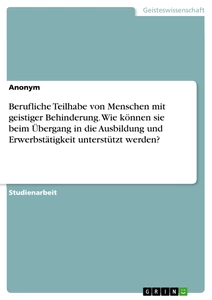




Kommentare