Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung – Was ist ein Hypertext?
2. Das Konzept Hypertext
2.1 Die historische Entwicklung der Hypertextidee
2.2 Das Verhältnis von Hypertext und traditionellem Text
2.2.1 Vorbemerkungen und Begriffsklärungen
2.2.2 Methodisches
2.2.3 Funktion
2.2.3.1 Kommunikation von Wissen
2.2.3.2 Der/die aktive Nutzer/in
2.2.3.3 Fazit - Funktion
2.2.4 Struktur
2.2.4.1 Die äußere Struktur
2.2.4.2 Die innere Struktur
2.2.4.3 Ordnungsmöglichkeiten
2.2.4.3.1 Achse
2.2.4.3.2 Hierarchie
2.2.4.3.3 Netzwerk
2.2.4.4 Fazit - Struktur
3. Probleme und Lösungen
3.1 Kohärenz
3.1.1 Kohärenz im traditionellen Text
3.1.2 Kohärenz im Hypertext
3.1.3 Anleitung zur Kohärenzbildung
3.1.3.1 Hypertextinhärente Maßnahmen
3.1.3.1.1 Knoten
3.1.3.1.2 Links
3.1.3.1.3 Fazit - hypertextinhärente Maßnahmen
3.1.3.2 Metainformationen
3.1.3.2.1 Navigation
3.1.3.2.2 Rezipient/inn/enführung
3.1.2.3 Fazit - Metainformationen
3.1.4 Fazit – Kohärenz
4. Hypertextanalyse
4.1 Wie analysiert man ein Netzwerk aus Assoziationen?
4.1.1 Unfassbar?
4.1.2 Höhere Aktivität = größere Subjektivität?
4.2 Fragen an den Hypertext
4.2.1 Struktur
4.2.1.1Entspricht die äußere Struktur dem Hypertextprinzip?
4.2.1.2 Welche innere Struktur hat der Hypertext?
4.2.2 Funktion
4.2.2.1 Werden die Grundfunktionen des Mediums erfüllt?
4.2.2.2 In welchen Kommunikationssituationen könnte der Hypertext genutzt werden?
4.2.3 Kohärenzbildung
4.2.3.1 Wie wird die Kohärenzbildung hypertextinhärent unterstützt?
4.2.3.2 Welche Kohärenz unterstützenden Metainformationen sind vorhanden?
4.3 Das Analysemodell
4.3.1 Auswahl des Analyseobjekts
4.3.1.1 Das World Wide Web
4.3.1.1.1 Kurze Geschichte des WWW (vgl. Münz 2001b+c)
4.3.1.1.2 WWW und Hypertext
4.3.1.2 „Hypertextsorten“
4.3.2 Vorgehensweise
4.4 Analyse des Hypertexts „Wikipedia"
4.4.1 Oberflächenanalyse
4.4.1.1 Ist es ein Hypertext?
4.4.1.2 Wozu dient dieser Hypertext?
4.4.2 Analysierende Rezeption
4.4.2.1 Erste Orientierung und Themensuche
4.4.2.2 Genauere Orientierung innerhalb des Themenbereichs
4.4.2.2 Inhaltliche Erforschung der Knoten und Links
4.4 Fazit Analysemodell
5. Schluss
6. Literatur
6.1 Primärliteratur
6.2 Sekundärliteratur
6.3 Interessante Hypertexte im WWW
7. Anhang
7.1 Screenshots
7.2 Rezipierte Knoten
1. Einleitung – Was ist ein Hypertext?
Das Wort „Hypertext“ findet sich im Allgemeinen eher selten im Wortschatz des österreichischen Durchschnittsbürgers wieder. Zumindest erntete ich in meinem Bekanntenkreis hauptsächlich fragende Blicke, wenn ich von meinem Diplomarbeitsthema berichtete: „Hypertext“ – klingt irgendwie abstrakt, vielleicht hat man das Wort im Informatikunterricht schon mal gehört, könnte also was mit Computern zu tun haben, muss aber nicht unbedingt sein... Auch als ich das erste Mal auf den Begriff „Hypertext“ traf, hörte es sich zunächst nach etwas an, womit ich mit Sicherheit noch nie näher zu tun hatte. Doch nach der Lektüre einer kurzen Begriffsdefinition war schnell klar – Hypertexte sind für mich nichts Neues, ganz im Gegenteil, ich nutze sie andauernd: für mein Studium, zur Unterhaltung oder einfach aus Interesse. Und nicht nur ich, fast jeder in meiner Umgebung ist ein Hypertextexperte, ohne es zu wissen. Das Bezeichnende ist ein großes Unbekanntes, das Bezeichnete hingegen pure Alltäglichkeit.
Das „WWW“ ist das Schlüsselwort – „Texte im Internet“. Natürlich ist, wie wir sehen werden, längst nicht jede Website auch ein Hypertext, doch fast jeder weiß, wie man sich von einer Website zur nächsten klickt, auf der Suche nach einer bestimmten Information. Man liest nicht im Internet, man surft - ziellos - oder man sucht[1] und findet (manchmal). Doch warum landet man manchmal irgendwo und weiß nicht, wie man dorthin kam oder wie man wieder zurückfindet? Und warum sind manche Websites so schrecklich ermüdend, dass man sie allerhöchstens ausdrucken kann, weil das Lesen am Bildschirm so anstrengt?
Das sind alles alltägliche Fragen, die scheinbar nichts mit grauer Theorie, und dem Titel dieser Diplomarbeit „Linguistische Qualitätskriterien für Hypertexte“ zu tun haben. Doch gerade diese Fragen und Probleme des/der durchschnittlichen Hypertextnutzer/s/in sind es, die mich zu dieser Arbeit motiviert haben. Natürlich stelle ich nicht den Anspruch, sie alle zu lösen, aber ich versuche vielleicht einen Schritt näher zu einem Hypertextverstehen zu kommen. Im zweiten Kapitel meiner Arbeit versuche ich, besser zu verstehen, was nun genau ein Hypertext ist und was ganz sicher kein Hypertext ist. Denn es muss klar sein, woraus etwas besteht, um zu wissen woran es ihm mangeln könnte. Im dritten Kapitel will ich mehr über die Probleme herausfinden, die Hypertextnutzer/innen plagen, will verstehen, wodurch sie hervorgerufen werden und was sich dagegen unternehmen lässt. Und im vierten Kapitel soll all jenes, was ich in den zwei vorhergehenden Kapiteln herausgefunden habe, einen Schritt von der Theorie zur Praxis machen. Ich werde versuchen, alles was nötig ist, um einen Hypertext zu verstehen, in einem Analysemodell zu bündeln. Dieses Analysemodell werde ich auch gleich ausprobieren, um zu sehen, ob ich mit seiner Hilfe einen konkreten Hypertext tatsächlich besser verstehen kann.
2. Das Konzept Hypertext
In diesem Kapitel möchte ich versuchen, den für diese Arbeit geltenden Hypertextbegriff zu definieren. Es soll hier vorerst recht theoretisch um den Begriff Hypertext gehen, sozusagen um eine Definition des Konzepts Hypertext. Im Laufe der Arbeit werde ich natürlich noch auf konkretere Aspekte des Mediums eingehen.
Schon dass der Umfang der Literatur zum Thema Hypertext recht groß ist, macht klar, dass es schwierig ist, eine eindeutige Antwort auf die Frage „Was ist Hypertext?“ zu finden. Denn nicht nur jede/r Autor/in hat eigene Vorstellungen davon, was Hypertext ausmacht, auch technisch hat sich seit der Entwicklung eines abstrakten Konzepts Hypertext vieles geändert, wodurch das Medium immer wieder in ein neues Licht gerückt wurde.
Es soll nun versucht werden, eine Begriffsdefinition vorzunehmen, indem einige wichtige Texte zur Hypertexttheorie aufgearbeitet werden. Dadurch möchte ich versuchen, die grundlegendsten Eigenschaften dieses Mediums aufzuspüren, um herauszufinden, was Hypertext ausmacht. Denn nur wenn definiert ist, was Hypertext ausmacht, kann auch herausgefunden werden, was Hypertext gut macht. Es ist natürlich klar, dass sich nicht sagen lässt: „Wenn ein Hypertext diese und jene Eigenschaften besitzt, ist er ein guter Hypertext“. Denn schließlich kann ich nur auf einer sehr allgemeinen Ebene arbeiten, wenn ich versuchen möchte, generelle linguistische Qualitätsmerkmale für Hypertexte zu definieren. Auf dieser allgemeinen Ebene kann nicht darauf eingegangen werden, dass jeder Hypertext zu einem anderen Zweck, für unterschiedliche Rezipient/inn/en in verschiedenen Kommunikationssituationen produziert wird. Es kann mir also gar nicht darum gehen, ein allgemein gültiges Raster zu erstellen, nach dem Hypertexte bewertet werden können, sondern vielmehr darum, herauszufinden, was Hypertexten gemein ist und wie diese Grundeigenschaften Hypertexte gestalten können. Davon ausgehend möchte ich versuchen, zu einem Werkzeug für die Hypertextanalyse zu gelangen. Mit „Analyse“ ist nicht „Bewertung“ gemeint, sondern das Sichtbarmachen der Einzelteile, die einen Hypertext ausmachen, und der Wirkungsweise dieser Einzelteile im konkreten Hypertext.
Um dem Konzept Hypertext auf die Spur zu kommen, ist es wichtig einen Einblick in die geschichtliche Entwicklung von Hypertexten zu nehmen. Denn so kann gezeigt werden, worin die Motivation bestand ein neues Medium zu entwickeln. Deshalb möchte ich zu Beginn dieses Kapitels die Entstehungsgeschichte von Hypertext von der Grundidee bis zur heutigen Form skizzieren.
Danach wird das Verhältnis des Konzepts Hypertext zum Konzept Text untersucht, denn der Blick auf ein bereits bekanntes Medium kann helfen, die Sicht auf das neue Medium zu klären.
2.1 Die historische Entwicklung der Hypertextidee
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der absolute Urahn des heutigen Hypertexts wurde bereits im 16. Jahrhundert vom Ingenieur Agostino Ramelli erfunden. Sein so genanntes „Bücherrad“ (vgl. Schwichtenberg 2003) sollte es dem/der Leser/in ermöglichen, die schweren Folianten der damaligen Zeit effizienter zu nutzen, indem sie aufgeschlagen auf eine einem Mühlrad ähnelnde Konstruktion gelegt wurden, um sie so gleichzeitig bzw. rasch nacheinander zu lesen.
Dies zeigt, dass es schon früh den Bedarf gab, Informationen anders als in den üblichen Systemen, wie z.B. Bibliotheken, zu verwalten, um sie besser zugänglich zu machen. Die Geburtsstunde des eigentlichen Hypertexts war aber weitaus später, und zwar 1945 mit dem Erscheinen des mittlerweile beinahe legendären Artikels „As We May Think“ (Bush 1945). Es blieb jedoch bei einer Kopfgeburt, denn der Autor, Vannevar Bush, verwirklichte seine Hypertextmaschine „Memex“ nie.
Dennoch besteht sein Aufsatz nicht bloß aus schwammiger Theorie, sondern zeichnet ein genaues Bild der „ mem ory ex tender“. Die Maschine sollte auf der Basis von Mikrofilmen funktionieren, einer Technologie, die es erlaubt, Informationen in stark verkleinerter Form zu speichern und durch Projektion wieder in Normalgröße abzurufen. Die Memex sollte aussehen wie ein gewöhnlicher Schreibtisch, versehen mit durchsichtigen Bildschirmen, auf die die im Inneren aufbewahrten Mikrofilme projiziert werden könnten.
Die Hauptmotivation für die Entwicklung solch einer Maschine war, dass die Mittel des Aufzeichnens und Abrufens von Informationen von den damals bereits zu einer unübersichtlichen Menge gewachsenen Erfindungen, Entwicklungen und Forschungsergebnissen überrollt wurden:
The summation of human experience is being expanded at a prodigious rate, and the means we use for threading through the consequent maze to the momentarily important item is the same as was used in the days of square rigged ships[2]. (Bush, S.1)
Das Wichtigste an der neuen Maschine sollte aber rückblickend nicht die Idee einer verbesserten Möglichkeit zur Speicherung von Informationen sein, sondern die Möglichkeit diese Informationen an den/die individuelle/n Nutzer/in anzupassen.
Denn Vannevar Bush sah das Hauptproblem der Informationsspeicherung im alphabetischen oder numerischen Indexieren der Bibliotheken und Archive:
The human mind does not work that way. It operates by association. With one item in its grasp, it snaps instantly fo the next that is suggested by the association of thoughts...” (S.11)
Dieses Zitat beinhaltet meiner Ansicht nach einige Kernpunkte des Hypertextkonzepts: assoziatives Verknüpfen von Daten zur Verwaltung, Speicherung und auch Generierung von Informationen. Nach Bush sollte der/die Nutzer/in durch die Memex in der Lage sein, die gespeicherten Informationen nach Belieben miteinander zu verbinden, und so eine ganz persönliche, assoziative Ordnung in eine große Menge an Daten zu bringen.
„As We May Think“ beschreibt somit einige der wichtigsten Möglichkeiten, die der moderne Hypertext bietet: effektive Speicherung, assoziative Verknüpfung und Neupositionierung von Informationen.
Memex sollte auf ihren Nachfolger fast zwanzig Jahre warten müssen. Erst 1963 wurde es möglich eine von Memex inspirierte Maschine zu bauen (vgl. Münz 2001). Douglas C. Engelbart entwickelte das Hypertext-System „Augment“, die erste Hypertextmaschine, die tatsächlich realisiert wurde. Gerade durch diesen enormen Schritt vom theoretischen Konzept zu einer konkreten Maschine ist Augment große Bedeutung zuzumessen:
Richtungsweisend wurden die eingesetzten Werkzeuge, die den heutigen Standards von Personalcomputern und individuellen Arbeitsplatzrechnern entsprechen: Maus als Eingabemedium, Mehrfenstertechnik mit ‚paralleler’ Verarbeitung, […]Verknüpfung heterogener Materialien über Zeiger, intensiver, integrierter Einsatz von Graphik… (Kuhlen, S.69)
Zwar sollten noch etliche Jahre vergehen, bis Computer für den persönlichen Gebrauch weite Verbreitung finden würden, dennoch ist eine Verbindung zwischen Engelbarts Augment und den heutigen PCs nicht zu leugnen.
Jedes Medium ist an ein „Werkzeug“ gebunden: Sprache an den Körper, Schrift an Stift und Papier oder auch Meißel und Marmor. Der Hypertext zählt zu den so genannten „tertiären Medien“(vgl. Schmitz 1995, S.9), welche durch ein technisches Gerät hergestellt und auch empfangen werden. Mit Engelbarts Erfindung wurde der Computer zum Werkzeug, mit dem Hypertext realisiert werden konnte.
Wurde der PC, wie wir ihn heute kennen, also nur gebaut, um dem Hypertext einen Rahmen zu geben, oder entstand der Hypertext als nützliches Medium erst durch die Entwicklung des Computers? Meiner Auffassung nach stehen diese beiden Aspekte in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Die Entwicklung des PC wurde sicherlich unter anderem durch das Problem der Informationsüberfülle, und vielleicht auch inspiriert durch die Memex – Idee, angetrieben. Andererseits entstand die große Fülle an Hypertexten gerade durch die Möglichkeit einen Computer auf den eigenen Schreibtisch stellen zu können.
Mitte der 1960er gab es diese Möglichkeit allerdings noch nicht, was Raum ließ für Visionen darüber, in welcher Form Hypertext in der Zukunft verbreitet werden könnte. Ted Nelson, der Erfinder der Begriffe „Hypertext“ und „Hypermedia“, stellte sich damals Hypertext als eine Art Gedächtnis der gesamten Menschheit vor.
We are striving to create a unified, universal literature, available to everyone both as readers and contributors, instantly available everywhere, with the ability to publish connections freely. (Nelson 1993)
Er wollte sein Projekt Xanadu[3] auf der ganzen Welt verbreiten und jeder Mensch sollte die Möglichkeit bekommen, in den eigens dafür errichteten „Informationsstationen“ am weltumspannenden Hypertext teilzuhaben (vgl. Porombka 2001, S.88f). Diese Vorstellung änderte sich natürlich durch die Verbreitung des Personalcomputers, schließlich muss heute noch kaum jemand sein Haus verlassen, um einen Hypertext zu benutzen. Dennoch wurde Nelsons Grundidee eines globalen Hypertexts durch die Entwicklung des World Wide Web wieder aufgenommen. Ted Nelson sieht dies allerdings nur höchst ungern so. Schließlich wurde sein Projekt Xanadu durch das WWW nahezu überrannt, und vieles, was für Nelson an einem Hypertext essenziell ist, wird im WWW so gut wie gar nicht verwirklicht. Seine Kritik ist somit verständlich: „The Web isn’t hypertext, it’s DECORATED DIRECTORIES!“ empört er sich auf seiner Homepage[4]. Dass Ted Nelson trotzdem eine Homepage besitzt, zeigt, dass das WWW zwar mit Sicherheit nicht der in Erfüllung gegangene Traum aller Hypertexttheoretiker/innen ist, dennoch aber die größte und gebräuchlichste Plattform für Hypertexte darstellt. Auf das WWW werde ich später in dieser Arbeit genauer eingehen. Hier möchte ich mit einer kurzen Zusammenfassung des eben Erläuterten schließen.
Das Konzept Hypertext entwickelte sich also aus Vannevar Bushs Idee einer neuen, auf assoziativen Verknüpfungen beruhenden Art der Informationsverwaltung, zugeschnitten auf den/die jeweilige/n Benutzer/in. Realisiert wurde es erstmals durch Douglas Engelbart, der eine konkrete Maschine entwickelte, die im Stand war, ein solches Konzept zu verwirklichen und weiterentwickelt von Ted Nelson, der die Vision eines weltweiten Hypertexts hatte, der von der gesamten Menschheit gelesen und geschrieben werden konnte.
Heute ist das WWW die Hauptplattform für Hypertexte, von Vannevar Bushs Vorstellung von Hypertexten ist es dennoch relativ weit entfernt, denn statt der individuellen Verwaltung von Daten stehen der weltweite Austausch und die Verbreitung von Informationen im Vordergrund.
2.2 Das Verhältnis von Hypertext und traditionellem Text
2.2.1 Vorbemerkungen und Begriffsklärungen
Der Hypertext ist wie schon erwähnt ein enger Verwandter des traditionellen Texts, wie sich auch aus der Namensgebung herauslesen lässt. Dass das Wort „Hypertext“ das Wort „Text“ beinhaltet, ist sicher nicht bedeutungslos. Denn ob etwas ein Text ist oder nicht, bestimmt im Grunde immer der/die Rezipient/in.
[…] dass Textualität prinzipiell nie einem sprachlichen Gebilde eignet oder nicht eignet, sondern immer nur einem sprachlichen Gebilde von einem Rezipienten unterlegt oder unterstellt wird, und dass demnach kein sprachliches Gebilde davor geschützt ist, als Text aufgefasst zu werden (Nussbaumer 1991, S.132)
Hypertext heißt also deshalb Hypertext, weil er in irgendeiner Weise von seinen Erfindern mit Text in Verbindung gebracht wurde. Das erklärt sich wohl auch daraus, dass die in Hypertexten verwalteten Informationen hauptsächlich schriftlich festgehalten werden.
Schon Vannevar Bushs Memex sollte hauptsächlich ein Mittel zur Verwaltung von Schriftstücken sein, obwohl der Erfinder auch damals schon andere Medien mit einbeziehen wollte: „Books of all sorts, pictures, current periodicals, newspapers...“ (Bush 1945, S.12). Zugegeben, heutige Hypertexte sind in der Lage, weitaus vielfältigere Medien als bloß Text und Bild zu beinhalten. Die meisten gebräuchlichen PCs können problemlos Animationen, Audiodaten und Videos speichern und wiedergeben. Häufig wird hier auch von „Hypermedia“, als von Hypertext zu unterscheidender Begriff gesprochen. Ich möchte es in dieser Hinsicht jedoch mit George Landow halten:
Hypermedia simply extends the notion of the text in hypertext by including visual information, sound, animation, and other forms of data. […] I shall use the terms hypermedia and hypertext interchangeably. (Landow 1992, S. 4)
Die Möglichkeit der Verwendung und Kombination unterschiedlicher Medien ist natürlich ein wichtiger Bestandteil von Hypertexten[5]. Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich mich dennoch hauptsächlich mit der Stellung der geschriebenen Sprache im Hypertext befassen.
An dieser Stelle erscheint es mir wichtig, etwas genauer auf den in dieser Arbeit verwendeten Textbegriff einzugehen. Es ist nicht ganz einfach, eine Definition des Begriffs „Text“ zu geben, da er auf viele Formen sprachlicher Gebilde zutreffen kann. Im „Studienbuch Linguistik“ wird „Text“ folgendermaßen definiert:
Ein Text ist eine komplex strukturierte, thematisch wie konzeptuell zusammenhängende sprachliche Einheit, mit der ein Sprecher eine sprachliche Handlung mit erkennbarem kommunikativem Sinn vollzieht. (Linke/Nussbaumer/Portmann 1996, S.245)
Diese Definition bezieht sich auf jegliche Form von Texten, und schließt im Grunde auch den Hypertext mit ein. Das zeigt, dass nicht nur Texte ein Bestandteil von Hypertexten sind, sondern dass auch Hypertext eine Form von Text ist. Dadurch wird natürlich wiederum die Nähe der beiden Konzepte betont, dennoch ist es nötig, die oben zitierte Definition etwas zu spezifizieren bzw. einzuschränken, um einer allgemeinen Verwirrung zuvorzukommen.
Deshalb werde ich in dieser Arbeit den Begriff „traditioneller Text“ verwenden, womit ich mich auf schriftliche Gebilde von zumindest mehreren Sätzen Länge beziehe. Ob diese nun auf Papier oder im elektronischen Medium zu finden sind, ist unerheblich, denn wie wir sehen werden, ist es keineswegs das Trägermedium, das einen Hypertext ausmacht.
Die angesprochene Verbindung zwischen traditionellem Text und Hypertext wird in der Hypertextliteratur durchaus erwähnt und recht unterschiedlich bewertet. Versucht man nun herauszufinden, wie genau das Verhältnis zwischen traditionellem Text und Hypertext ist, könnte man viel über das Konzept Hypertext erfahren. Ein direkter Vergleich zwischen den beiden Medien wird hier nicht angestrebt, da es sich ja im Grunde nicht um zwei völlig entgegengesetzte Medien handelt, sondern eher um eine ganz spezielle Verbindung. Doch gerade dieser Umstand kann nützlich sein, um eine genaue Definition von Hypertext zu erreichen. Denn je näher zwei zu vergleichende Dinge einander sind, desto genauer können ihre spezifischen Merkmale herausgearbeitet werden.
Dass ich in dieser Arbeit die Position des traditionellen Texts im Hypertext untersuche, hat natürlich auch mit meinem Ziel, linguistische Qualitätskriterien für Hypertexte zu finden, zu tun. Denn dies würde mir wohl kaum gelingen, wenn ich mich auf die Unterschiede von Hypertexten und Datenbanken oder die informationstechnologische Definition von Hypertexten konzentrieren würde. Um linguistische Qualitätskriterien für Hypertexte zu finden, muss ich mich mit dem Hypertext als sprachliches Gebilde beschäftigen.
Um dem Konzept Hypertext also auf den Grund zu kommen, wird nun die Stellung, die dem traditionellen Text im Reich des Hypertexts von den verschiedenen Autor/inn/en jeweils zugesprochen wird, näher untersucht.
2.2.2 Methodisches
An dieser Stelle möchte ich noch einiges zu meiner Vorgehensweise erklären. Denn wenn auch schon gesagt ist, dass ich den Hypertext in Relation zu traditionellem Text setzen möchte, ist doch noch nicht alles gesagt. Schließlich können Hypertexte wie traditionelle Texte auf mehreren Ebenen untersucht werden: semantisch, grammatisch, sozio- oder psycholinguistisch, semiotisch, etc.
Die jeweils gewählte Untersuchungsperspektive ergibt sich meiner Ansicht nach aus den Zielen einer Arbeit. Da es das Ziel meiner Arbeit ist, linguistische Qualitätskriterien für Hypertexte festzulegen, möchte ich textlinguistisch an die Sache herangehen. Denn die Textlinguistik beschäftigt sich mit dem sprachlichen Gebilde Text als Ganzes, und als ein Ganzes muss ich auch den Hypertext auffassen. Schließlich versuche ich in dieser Arbeit eine Vorstellung des Konzepts Hypertext als Ganzes zu erringen, um dadurch bestimmen zu können, welche Einzelteile dieses Ganze zu dem machen was es ist – ganz im Sinne des hermeneutischen Zirkels.
Aus dieser Grundposition ergeben sich zwei große Bereiche die für die Untersuchung des Konzepts Hypertext wichtig sind: die Struktur und die Funktion des Mediums. Denn diese beiden Gesichtspunkte scheinen mir eine Schlüsselrolle in der Textlinguistik und auch beim Thema Hypertext zu spielen. Der Bereich der Textstruktur ist einer der wichtigsten Arbeitsbereiche der Textlinguistik:
Andererseits untersucht die Textlinguistik den Bau und die Struktur von Texten, d.h. sie geht der Frage nach, welche sprachlichen Bauelemente Texte konstituieren, wie die einzelnen Elemente (z.B. Sätze, Textabschnitte) systematisch zusammenhängen und wie sie zu Texten verbunden werden. (Linke/Nussbaumer/ Portmann 1996, S. 212)
Aber auch das Konzept Hypertext wird, wie wir sehen werden, häufig über die spezifische neue Struktur des Mediums definiert.
Der Bereich der Funktion erscheint mir deshalb so wichtig, weil, wie schon im Unterkapitel über die historische Entwicklung des Hypertexts verdeutlicht wurde, jedes neue Medium aus einer bestimmten Motivation, einem Bedarf heraus entwickelt wird. Es muss eine, bzw. mehrere Funktionen erfüllen, die kein anderes Medium in derselben Art und Weise erfüllen kann. Ein Hypertext muss somit in der Lage sein, bestimmte Funktionen zu erfüllen, um als Hypertext gelten zu können. Es ist folglich für eine Begriffsbestimmung, wie für die Erstellung linguistischer Qualitätskriterien, unerlässlich, die spezifischen Funktionen des Mediums zu definieren.
2.2.3 Funktion
Der Begriff der Textfunktion hat in der Textlinguistik mehrere Bedeutungen. Ich möchte den Begriff hier aber nicht als Mittel zur Klassifizierung von Textsorten verwenden[6], denn gleich wie traditionelle Texte werden konkrete Hypertexte aus unterschiedlichen Intentionen heraus, zur Erfüllung verschiedenster Ziele verfasst. Natürlich spielt bei der Analyse eines Hypertexts auch das konkrete Ziel des Hypertexts bzw. die Intention des/der Autor/s/in eine Rolle. Dem werde ich mich aber erst später in dieser Arbeit, im Rahmen der tatsächlichen Hypertextanalyse, widmen. Doch auch dann soll keine Aufstellung der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten für Hypertexte vorgenommen werden, sondern nur auf den jeweiligen Hypertext eingegangen werden.
Die Untersuchung der Hypertextfunktion möchte ich aber eine Ebene höher ansetzen, da schließlich das Gesamtkonzept Hypertext erschlossen werden soll. Es geht also nicht um die Funktion eines Hypertexts in einer konkreten Kommunikationssituation, sondern um die Funktion eines ganzen Mediums. So etwas lässt sich nicht gerade leicht bestimmen, auch nicht für traditionellen Text. Gerade die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten macht es schwer, jegliche Form von Hypertexten unter einen Hut zu bringen.
Einen recht generalisierten und gerade deshalb hier recht nützlichen Ansatz zur Beschreibung der Funktion traditionellen Texts bringt Christoph Sauers Forderung nach „Anwendbarkeit“ für einen verständlichen Text:
Ein Text ist anwendbar, wenn der Leser nach Abschluß der Lektüre imstande ist, bestimmte Folgehandlungen zu vollziehen, bei denen eine mentale Repräsentation des Globalinhalts Bestandteil der Wissensvoraussetzungen dieser Handlungen ist. ( Sauer 1995, S. 166 )
Sauers Feststellung bezieht sich natürlich auf den traditionellen Text, ist aber auch für den Hypertext nicht ohne Bedeutung:
Whatever the reader’s goals may be, text processing amounts to constructing a mental representation based on verbal information. Hypertexts share this general mechanism with traditional, so-called linear texts. ( Espéret 1990, S.152)
Hypertext hat also auch funktional gesehen einiges mit dem traditionellen Text gemein. Trotzdem muss es, wie schon erwähnt, spezifische Funktionen geben, die nur von Hypertexten erfüllt werden können. Hier sollte festgehalten werden, dass Hypertexte natürlich nicht einfach nur bestimmte Funktionen haben müssen, sondern bestimmte Funktionen für jemanden. Dieser jemand ist der/die Rezipient/in des Hypertexts. Hypertexte haben auch auf der Produktionsseite wichtige Funktionen, z.B. als so genannte Autorensysteme, welche zur Erstellung traditioneller Texte dienen sollen[7], doch in dieser Arbeit soll die Rezipient/inn/enseite behandelt werden. Es geht darum, was einen Hypertext ausmacht und was ihn anwendbar macht, und zwar für den/die Rezipienten/in. Auch Hypertextanalyse ist im Grunde nichts anderes als Hypertextrezeption, nur mit einem genaueren Blick.
2.2.3.1 Kommunikation von Wissen
Was ein Hypertext nun einem/r Rezipienten/in nutzen kann, das über die Funktionen eines traditionellen Texts hinausgeht, ist auch für viele Hypertexttheoretikern/innen eine wichtige Frage. Leider gibt es darauf nicht annähernd eine einstimmige Antwort (gäbe es die, wäre die Sache allerdings nur halb so spannend). Der Mehrwert von Hypertexten wird von den verschiedenen Autor/inn/en sehr unterschiedlich eingeschätzt, trotzdem lassen sich einige zentrale Punkte feststellen, um die es sich immer wieder dreht.
Ein Ausgangspunkt ist die Ansicht, dass Hypertext das können soll, was traditioneller Text kann, nur eben besser:
Like many other computer applications, hypertext shares many features with the traditional technology it is supposed to enhance, that is, printed text. (Rouet / Levonen 1990, S.12 )
Wenn man nun davon ausgeht, dass traditioneller Text imstande sein soll, bei dem/der Rezipienten/in eine mentale Repräsentation des Rezipierten herzustellen – wie kann ein Hypertext so etwas besser machen? Eine Antwort gibt Ted Nelson in einem Interview, auf die Frage, welche Inspiration ihn zur Entwicklung von Hypertexten geleitet habe:
…you were trying to take theses thoughts which had a structure, shall we say, a spatial structure all their own, and put them into linear form. Then the reader had to take this linear structure and recompose his or her picture of the overall content, once again placed in this nonsequential structure. [...] Why couldn’t that all be bypassed by having a nonsequential structure of thought which you presented directly? ( Whitehead 1996)
Nelson nimmt also an, dass Gedanken räumlich oder zumindest nicht-sequentiell strukturiert sind und dass Hypertexte in der Lage sein sollten, diese Struktur nachzuahmen, was dem/der Autor/in wie auch dem/der Rezipienten/in die Arbeit erleichtern müsste. Die mentale Repräsentation die der/die Autor/in von etwas besitzt, kann also auf direkterem Weg zu dem/der Rezipienten/in gelangen. Diese Ansicht wird von Norbert Streitz, einem frühen deutschen Hypertexttheoretiker, geteilt. Auch er geht davon aus, dass Hypertexte eine gute Möglichkeit bieten könnten, um Wissen besser als bisher zu kommunizieren:
Um dieses Potential voll nutzen zu können, sind Hypertextsysteme zu entwickeln, die Dokumentstrukturen unterstützen, die Wissensstrukturen adäquat repräsentieren können. Auf diese Weise werden Autoren in die Lage versetzt, in größerem Ausmaße als bisher Teile ihrer Wissensstrukturen explizit kommunizierbar zu machen. […] Der Leser erhält dann eine explizitere Präsentation dieser Strukturen als dies bisher möglich war. (Streitz 1990, S.17)
Zu dieser Position, die vor allem zu Beginn der 1990er zur Zeit der großen Hypertexteuphorie vertreten wurde[8], wurden schon bald darauf von mehreren Seiten Gegenstimmen laut. Beispielsweise von Stefan Freisler, der die Annahme, dass Wissen netzwerkartig im Gehirn gespeichert werde, längst nicht für bewiesen hält (vgl. Freisler 1994). Ebenso wenig wie die Position, dass Hypertexte zu einer besseren Wissenskommunikation befähigen könnten. Dies sieht auch Andrew Dillon, in einem recht kritischen Aufsatz über die „Hypertextmythen“, ähnlich:
…a learner may be able to reproduce the teacher’s knowledge representation as manifest in both hypertext and paper forms, but this is no guarantee of meaningful learning having occured. (Dillon 1996, S.29)
Die Frage, ob Hypertext den/die Nutzer/in zu besserer Wissensaufnahme bzw. zu besserem Lernen befähigt, beschäftigt verständlicherweise viele der Hypertexttheoretiker/innen. Leider lassen auch die verschiedenen empirischen Studien keinen eindeutigen Schluss zu. Rainer Kuhlen spricht beispielsweise davon, dass einige Studien darauf schließen ließen, dass Hypertexte besser für die Wissensaneignung geeignet wären, andere Studien aber auf das genaue Gegenteil hindeuteten (Kuhlen 1991, S.8).
Auch Peter Foltz’ Studie beschäftigt sich mit der Kommunikation von Wissen. Unter anderem wurden auch Unterschiede in der Wissensaneignung beim Lesen eines traditionellen Texts und zwei verschieden gestalteten Hypertexten untersucht. Doch solche Unterschiede ließen sich kaum feststellen:
Thus, the hypertexts were of no greater help to the readers than the linear text in their search for information. [...] These results are similar to other studies in finding few comprehension differences between hypertext and linear text. ( Foltz 1996, S.123)
Daraus lässt sich nun schließen, dass Hypertexte nicht unbedingt so etwas wie die erhofften „Übertexte“ sind, die die Möglichkeiten der Wissensvermittlung revolutionieren. Es stellt sich also die Frage, ob Hypertexte überhaupt irgendeinen Mehrwert gegenüber traditionellem Text besitzen, oder ob sie nur aus einer überzogenen Hoffnung auf direkte Übertragung mental gespeicherter semantischer Netze heraus entstanden sind. Vielleicht waren die anfänglichen Ansprüche an das neu entstandene Medium doch etwas zu hoch, und wahrscheinlich ist es einfach fruchtbarer nicht nach Eigenschaften zu suchen, in denen Hypertext den traditionellen Text derart übertrifft, dass er ihn eigentlich komplett ersetzen müsste, sondern nach solchen, die dem/der Nutzer/in einfach die eine oder andere neue Möglichkeit bieten.
2.2.3.2 Der/die aktive Nutzer/in
Schon Foltz, dessen Studie doch ein eher ernüchterndes Ergebnis brachte, versuchte herauszufinden, wofür sich Hypertexte nun eigentlich wirklich eigneten. Seine Erkenntnis war, dass Hypertexte erstens einen schnelleren Zugriff auf spezifische Informationen liefern könnten und zweitens die Möglichkeit böten, Informationen zu präsentieren, die im traditionellen Text nur schwierig zu präsentieren seien. In diesem Zusammenhang spricht er vor allem von Texten, die in Beziehung zu verschiedenen Argumenten und Gegenargumenten zu sehen sind, also in größeren Kontexten aus denen heraus sie sich erst richtig verstehen ließen. Auch der „personalisierte Text“ ist für Foltz eine Möglichkeit, Hypertext sinnvoll zu nutzen. Damit meint er die Fähigkeit eines Hypertexts, sich an den/die jeweilige/n Nutzer/in anzupassen. Anpassen in dem Sinn, dass Nutzer/innen mit unterschiedlichem Vorwissen unterschiedliche Versionen eines Hypertexts zu sehen bekommen könnten (vgl. Foltz 1996, S.131f).
Diese und ähnliche Möglichkeiten die Hypertext bietet, werden natürlich auch von anderen Autor/inn/en wahrgenommen. Häufig werden sie unter den Stichworten der Interaktivität oder des größeren Handlungsfreiraums zusammengefasst.
Einen guten Ausgangspunkt zur näheren Betrachtung dieses Themas bietet Rainer Kuhlen, mit der Feststellung zweier Grundprinzipien des Konzepts Hypertext. Und zwar der Prinzipien der direkten Manipulation und des kooperativen Dialogs.
Der Begriff der direkten Manipulation ist gleichzusetzen mit dem Grundgedanken, informationelle Einheiten, die aus textlichen, grafischen oder audiovisuellen Inhalten bestehen, über Verknüpfungen miteinander zu verbinden. Der/die Rezipient/in kann dadurch, dass er/sie sich mithilfe der Verknüpfungen einen individuellen Pfad durch den Hypertext bahnt, die Hypertexteinheiten leicht in neue Kontexte stellen.
Die Verknüpfungen eines Hypertexts sollten nicht-deterministisch sein, das bedeutet, dass von einer Einheit beliebig viele Verknüpfungen weggehen, wie auch zu ihr hinführen können.
Dadurch ergibt sich die Möglichkeit einer freien „Bewegung“ des/der Nutzer/s/in durch den hypertextlichen Raum. Diese Möglichkeit vergrößert aber auch die Gefahr, dass es bei dem /der Benutzer/in zu einer Orientierungslosigkeit kommt. Den/die Benutzer/in aber nur auf das Nachvollziehen der vorgegebenen Navigationsangebote des Systems zu beschränken, wäre nach Kuhlen auch nicht im Sinn der Hypertextidee.
Die Lösung für diese Problematik sieht er im zweiten Grundprinzip des Hypertexts, im kooperativen Dialog . Die direkte Manipulation soll durch dialogische Aspekte ergänzt werden. Das System soll nicht nur in der Lage sein, zu reagieren, sondern als Dialogpartner von sich aus aktiv werden und passende Manipulationsvorschläge machen, um dem/der Benutzer/in etwas von seiner/ihrer kognitiven Last abzunehmen. (Kuhlen 1991, S.15-17)
Rainer Kuhlen sieht den Nutzen von Hypertexten also hauptsächlich darin, dass der/die Nutzer/in Informationen nicht nur rezipieren, sondern auch manipulieren kann. Im Gegensatz zum traditionellen Text soll ein/e Hypertextnutzer/in die bereitgestellten Informationen also leichter in verschiedene Kontexte stellen bzw. aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. Um den/die Rezipienten/in dabei zu unterstützen, sollte ein Hypertextsystem fähig sein in Dialog mit ihm/ihr zu treten.
Dieser Dialog, wie Kuhlen ihn sieht, ist bis heute eigentlich im Großteil der Hypertextsysteme nicht erreicht. Dass Hypertexte bis zu einem gewissen Grad in der Lage sein könnten, zu erkennen, welche Ziele der/die Rezipient/in verfolgt und ihm/ihr daraufhin entsprechende Hilfestellungen zu geben, ist meiner Ansicht nach nicht völlig unmöglich, aber leider wurden viele nützliche Ansätze früher Hypertexttheoretiker/innen einfach nicht weiterverfolgt.
Das Stichwort des Mensch-Maschine-Dialogs bedarf dennoch genauerer Erklärung. Auch wenn die Forderung nach einem Hypertext, der den/die Nutzer/in bei der Informationssuche aktiv unterstützt, nicht wirklich erfüllt wurde, so lassen sich doch dialogische Prinzipien bei der Hypertextrezeption erkennen. Hypertexte sind aufgrund technischer Beschränkungen natürlich nicht in der Lage ein einem natürlichen Dialog gleichkommendes Gespräch zu führen. Der Dialog wird hier eher als die Fähigkeit des Hypertexts gesehen, auf Eingaben des/der Nutzer/s/in in irgendeiner Form zu reagieren. Ulrich Schmitz charakterisiert den Mensch-Maschine-Dialog folgendermaßen:
Unter den Gesichtspunkten der Gesprächsanalyse betrachtet ist der ‚Dialog’ also ganz einfach strukturiert. Es gibt ein wohldefiniertes Hin und Her, das jeweils eine Variante aus einer je nach Komplexität des Programms mehr oder minder großen Menge von Alternativen realisiert. (Schmitz 1998, S.228)
Der Mensch-Maschine Dialog, wie ihn Schmitz sieht, ist also deutlich von den „dialogischen Prinzipien“ Kuhlens zu unterscheiden. Schmitz definiert die Aktion des Nutzers und die darauf folgende Reaktion des Hypertexts als Dialog. Kuhlen geht da weiter, und fordert: „…daß das System nicht nur reagieren kann, sondern im Sinne eines Dialogpartners von sich aus aktiv werden und passende Manipulationsvorschläge machen kann.“ (Kuhlen 1991, S.17)
Das Wort Dialog ist in Schmitz’ Zitat also wohl ganz bewusst unter Anführungszeichen gesetzt, da es sich nicht wirklich um das handelt, was bei einem Dialog zwischen zwei menschlichen Individuen passiert. Das, was ein Hypertext seinem/r jeweiligen Nutzer/in präsentiert, ist schon im Vornherein durch den/die Produzent/en/in festgelegt. Auch wenn unterschiedliche Personen verschiedene Varianten eines Hypertexts zu sehen bekommen, hat der/die Produzent/in die ‚Reaktionen’ des Hypertexts auf die Eingaben des/der Nutzer/s/in vorher programmiert. Es müsste sich also im Grunde wenn schon, dann um einen indirekten Dialog zwischen dem/der Produzent/en/in und dem/der Nutzer/in handeln. Doch auch dies ist nicht unbedingt eine haltbare Definition der Verbindung zwischen Nutzer/in und Produzent/in eines Hypertexts. Warum wird das Rezipieren eines Hypertexts nun als Dialog bezeichnet, wenn er im Grunde kaum etwas mit einem herkömmlichen Dialog gemein hat? Ganz einfach, weil der/die Nutzer/in das Rezipieren eines Hypertexts häufig als Dialog empfindet. :
Der Knopfdruck ist zugleich eine Botschaft […] Das Wort Suchen steht nicht nur als Mitteilung da, sondern dient zugleich als Knopf, mit dem man seine Bedeutung in die Tat umsetzen kann. […] Das erinnert an Sprachmagie: durch Aktivierung von Sprache ändert sich die Wirklichkeit. (Schmitz 1998, S.230)
Der/die Nutzer/in übermittelt dem Hypertext also eine Botschaft und erhält darauf eine Reaktion. Für Schmitz ist dies ein klarer Fall von einem Sprechakt, allerdings musste er erst eine neue Klasse von Sprechakten festlegen, um diese Dialogsituation erklären zu können. Diese Klasse nennt er Computive:
„weil sie nur in computervermittelter Kommunikation vorkommen und folglich berechneten und berechenbaren Routinen folgen. Deshalb sind sie sowohl in ihrer illokutionären Rolle als auch in ihrem propositionalen Gehalt eindeutig festgelegt.“(Ebda.)
Dass bei Hypertexten hinsichtlich des festgelegten propositionalen Gehalts ein etwas anderes Maß anzulegen ist als bei Suchmaschinen, ist Schmitz klar. In Hypertexten sei die Kommunikationssituation indirekter, denn der/die Nutzer/in weiß nicht was ihn/sie hinter einem markierten Wort tatsächlich erwartet, möchte mehr darüber erfahren, läuft aber auch Gefahr, enttäuscht zu werden. Verknüpfungen führen meist zu weiteren Informationen, welche durch das markierte Wort (den so genannten Anker) aber meist nur zu erahnen sind.
Der/die Nutzer/in eines Hypertexts befindet sich also in einer anderen Kommunikationssituation als die Gesprächspartner/innen in einem herkömmlichen Dialog, aber auch als der/die Leser/in eines traditionellen Texts. Der Mensch-Maschine Dialog, wie ihn Schmitz sieht, ist deutlich von den „dialogischen Prinzipien“ Kuhlens zu unterscheiden. Schmitz definiert die Aktion des Nutzers und die darauf folgende Reaktion des Hypertexts als Dialog. Kuhlen geht da weiter und fordert: „…daß das System nicht nur reagieren kann, sondern im Sinne eines Dialogpartners von sich aus aktiv werden und passende Manipulationsvorschläge machen kann.“ (Kuhlen 1991, S.
In diesem Zusammenhang fällt auch häufig das Schlagwort der Interaktivität – inwiefern interagiert der/die Nutzer/in mit dem Hypertext? Er/sie hat auf jeden Fall eine aktivere Rolle als der/die Leser/in des traditionellen Texts. Beim Hypertext Lesen müssen Entscheidungen getroffen werden: darüber welchen Verknüpfungen man nachgehen will und welche man übergehen kann. Der Prozess des Fortschreitens im Text geht von einer vorher festgelegten Reihenfolge des/der Autor/s/in in die Kontrolle des/der Nutzer/s/in über (vgl. Rouet/Levonen 1996, S.12) George Landow sieht gar die Grenzen zwischen dem/der Leser/in und dem/der Autor/in verschwimmen:
For example, if one possessed a hypertext system in which our putative Joyce article was linked to all the other materials it cited, it would exist as part of a much larger system, in which the totality might count more than the individual document; the article would now be woven more tightly into its context than would a printed counterpart. As this scenario suggests, hypertexts blurs the boundaries between reader and writer... ( Landow 1992, S.5)
Der/die Nutzer/in kreiert nach Landow also einen neuen Gesamttext, dadurch, dass er/sie nur Verknüpfungen von persönlichem Interesse nachgeht, und somit jede/r Leser/in zumindest im Kopf einen neuen Text erstellt.
Interaktivität ist ein häufig erwähntes Schlagwort, wenn es um Hypertexte geht. Für Hans-Jürgen Bucher stellt genau die von Landow angesprochene neue Rolle des/der Leser/s/in diese Interaktivität dar:
Man kann die Rezeption nicht-linearer Kommunikationsangebote deshalb als eine Form des Problemlösens auffassen. Dabei setzt sich der Nutzer mit dem rezipierten Kommunikationsbeitrag aktiv auseinander, sodass sich auch von daher die Redeweise von der Interaktivität begründen läßt. […] Im Rückblick wird vom Nutzer ein Zusammenhang der bereits rezipierten Teile des Kommunikationsangebotes hergestellt, im Vorgriff bildet er Hypothesen – die so genannten Fortsetzungserwartungen - , wie es weitergehen könnte. (Bucher 2001a, S.144)
Die Interaktivität des/der Nutzer/s/in besteht also im Grunde darin, dass er/sie im Hypertext größere Eigenständigkeit als im traditionellen Text besitzt, aber nur insofern, dass er/sie aufgrund der bereits rezipierten Informationseinheiten entscheiden muss, welchen Verknüpfungen nachgegangen wird.
Das allein ist jedoch für andere Autor/inn/en noch lange keine Interaktivität. So beispielsweise Karin Wenz:
Die Interaktion entpuppt sich jedoch meist als Etikettenschwindel, denn sie ist nur im Bereich dessen möglich, was durch den Programmierer im Programm vorgegeben ist. Deshalb sprechen einige der Hypertextautoren denn auch von Transaktivität… […] Es ist paradox, dass die Aufforderung an den Leser zu handeln, in einem Raum der begrenzten Möglichkeiten stattfindet. (Wenz 2001, S.95f)
Ob man von einer Interaktivität des/der Nutzer/s/in sprechen kann, hängt also auch stark davon ab, wie man Interaktivität letztendlich definiert. Aus der Sicht des/der Rezipienten/in entsteht eine Interaktion wohl dadurch, dass der/die Rezipient/in dem Hypertextsystem im Grunde kommunikative Fähigkeiten unterstellt.
Was meiner Ansicht nach nicht zu leugnen ist, ist die größere Aktivität des/der Rezipienten/in beim Nutzen eines Hypertexts. Deshalb spreche ich im Zusammenhang mit traditionellem Text meist von dem/der Leser/in und beim Hypertext von dem/der Nutzer/in. Der/die Nutzer/in des Hypertexts hat eigenständige Entscheidungen zu treffen, welchen Verknüpfungen er/sie folgen möchte.
Nach Bush sollte der/die Hypertextnutzer/in weitaus aktiver sein und mehr Freiheiten besitzen als es heute bei Hypertexten im World Wide Web der Fall ist. (Vgl. Bush 1945, S. 7)
Der/die Nutzer/in der Memex hätte auch die Möglichkeit haben sollen, neue Verknüpfungen zwischen Informationseinheiten zu erstellen, und auch eigene Einheiten zum Hypertext hinzuzufügen. Dies ist heute leider in den wenigsten Hypertexten realisiert, weshalb die Aktivität des/der Nutzer/s/in weitgehend darauf beschränkt ist, auszuwählen, welche der vorgegebenen Informationseinheiten er/sie lesen möchte.
Aber auch diese, bereits etwas beschränkte Form der Interaktivität, ist nicht ganz problemlos zu erreichen. Silke Müller-Hagedorn stellt beispielsweise fest, dass das alleinige Aufrufen von Verknüpfungen für den/die Nutzer/in oft keinen größeren, sondern einen begrenzten Handlungsspielraum gegenüber traditionellem Text darstellt. Zurückzuführen sei dies darauf, dass der/die Nutzer/in keine Hilfsmittel vom Hypertext bekommt, die ihm/ihr dabei helfen könnten, sich ein Gesamtbild des Texts zu machen. Dadurch sei der/die Nutzer/in genötigt, den vorgegebenen Verknüpfungen quasi blind zu folgen. Nur durch Hilfsmittel[9], die dem/der Nutzer/in eine Vorstellung davon geben könnten, was ihn/sie hinter einer Verknüpfung erwartet, könne ein aktiver Umgang des/der Rezipienten/in mit dem Hypertext ermöglicht werden. (Vgl. Müller-Hagedorn 2002)
Der/die Nutzer/in eines Hypertexts wird also stärker gefordert, als der/die Leser/in eines traditionellen Texts. Der/die Nutzer/in muss sich zwischen verschiedenen Wegen entscheiden und Zusammenhänge zwischen autonomen Informationseinheiten erkennen, bzw. bilden. Diese höhere Aktivität kann bei dem/der Nutzer/in aber auch nachteilige Folgen haben. In diesem Zusammenhang fällt häufig das Schlagwort vom cognitive overhead:
Mit der Komplexität eines Hypertexts erhöht sich selbstverständlich der kognitive Ballast (‚cognitive overhead’) des Leseprozesses, indem die Leser mehr und mehr Entscheidungen auf einer Meta-Ebene fällen müssen. (Ansel - Suter 1995, S.9)
Um den cognitive overhead möglichst gering zu halten, sollten im Hypertextsystem in irgendeiner Form Hinweise darauf enthalten sein, was der/die Rezipient/in von den noch nicht rezipierten Informationseinheiten erwarten kann. Zielführende Aktivität ergibt sich also aus einer stärkeren Eigenständigkeit, jedoch nicht einer völligen Führungslosigkeit des/der Rezipienten/in. Wie genau der/die Rezipient/in vom Hypertextsystem geführt werden kann, ohne seine Eigenständigkeit zu verlieren, wird an späterer Stelle noch diskutiert werden.
2.2.3.3 Fazit - Funktion
Geht man nun davon aus, dass die generelle Funktion traditioneller Texte darin besteht, bei dem/der Rezipienten/in eine mentale Repräsentation des Globalinhalts des Texts zu erzeugen, so ist die Funktion der Hypertexte jener traditioneller Texte sicher sehr ähnlich.
Anders als beim traditionellen Text gibt es beim Hypertext den Globalinhalt nicht. Natürlich entwickelt auch jede/r Leser/in eines traditionellen Texts eine ganz eigene mentale Repräsentation des Textinhalts, beispielsweise werden von geübten Leser/innen häufig ganze Kapitel oder einzelne Textpassagen beim Lesen übersprungen, da sie für die persönliche Kommunikationssituation gerade nicht relevant sind. Beim Hypertext werden solche Strategien zum Prinzip erhoben. Jede/r Nutzer/in soll in die Lage versetzt werden, aus der Menge der gebotenen Informationseinheiten einen individuell relevanten Globalinhalt zusammenzusetzen.
Wie wir schon festgestellt haben, kann man von Hypertexten nicht erwarten, dass sie den Wissenserwerb durch direkte Übertragung semantischer Netze revolutionieren werden. Hypertexte werden traditionelle Texte auch nicht verdrängen, sondern als gleichberechtigtes Mittel zur Kommunikation von Information neben ihnen bestehen.
Sie bieten die Möglichkeit große Mengen an Information zu speichern und sie dem/der Nutzer/in auf eine sehr spezifische Art zugänglich zu machen. Der/die Nutzer/in kann sich aus einem Hypertext jene Informationen heraussuchen, die ihn/sie interessieren, und das auf eine einfache und rasche Weise. Eine sinnvolle Verknüpfung der Informationseinheiten bietet dem/der Nutzer/in zudem die Möglichkeit, Zusammenhänge zwischen diesen Einheiten nachzuvollziehen, größere Kontexte zu erkennen und verschiedene Perspektiven einzunehmen.
Auch wenn die Freiheiten der Rezipient/inn/en durch die Vorgaben der Produzent/inn/en begrenzt sind, so sollten sie zumindest das Gefühl bekommen, sich frei im Hypertext bewegen zu können:
…true hypertext should also make users feel that they can move freely through the information, according to their own needs. [...] (Nielsen 1995, S.4)
Denn auch diese gefühlte Freiheit ist eine wichtige Funktion des Hypertexts:
From such a view, hypertext’s intrigue comes from its creative or at least flexible view of texts. They are not objects to be read word for word, or line for line, and certainly not page for page. Texts are points in a space that a learner can explore. (Perfetti 1996, S. 157)
Hypertexte werden von dem/der Nutzer/in häufig auf diese räumliche Art und Weise empfunden - Hypertexte sollen nicht nur gelesen, sondern erforscht und erlebt werden. Sie verlangen nach einem/einer aktiven Nutzer/in, der/die sich nicht nur informieren lassen will, sondern große Informationsmengen erkunden möchte, um sich Wissen selbsttätig zu erarbeiten.
Nach Rainer Kuhlen ergibt sich beim Benutzen eines Hypertexts aus der Suche nach einer ganz bestimmten Information ein Mitnahmeeffekt, bei dem der/die Nutzer/in andere zum Thema passende Daten findet. Oder auch der Serendipity – Effekt, bei dem der/die Suchende von einem anderen Thema so in Anspruch genommen wird, dass er die ursprüngliche Suche vergisst. Auch einfache Assoziationen werden gefördert:
Wenn dadurch längere Assoziationsketten aufgebaut werden, tritt der für „Browsing“- Effekte typische Fall auf, daß nicht mehr gezielt nach Information gesucht wird, sondern man sich vom Reizangebot trieben läßt, bis kein starker Anreiz mehr vorhanden ist, weiteren Angeboten zu folgen. (Kuhlen 1991, S.130)
Diese Effekte lassen sich zwar auch beim Stöbern in thematisch geordneten Bibliotheken beobachten, beim Hypertext werden sie jedoch für den/die Benutzer/in vereinfacht und somit unterstützt.
Für meine Arbeit ergibt sich also, dass Hypertexte dem/der Nutzer/in die oben genannten Möglichkeiten bieten sollten, um als Hypertexte gelten zu können. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass mit den spezifischen Möglichkeiten spezifische Probleme entstehen können, denen der/die Hypertextproduzent/in entgegenwirken muss. Erst wenn man solche Maßnahmen erkennen kann, kann man auch von einem guten Hypertext sprechen.
2.2.4 Struktur
Dass Hypertexte eine spezielle Struktur haben, wurde schon im vorangegangen Textabschnitt deutlich. So wurde bereits erwähnt, dass Hypertexte aus netzwerkartig verknüpften Texteinheiten bestehen und dass der/die Nutzer/in den Hypertext wie einen Raum erforschen muss, statt sich von einem zweidimensionalen traditionellen Text leiten zu lassen. Die Begriffe „Netzwerk“ und „Räumlichkeit“ fallen häufig in Verbindung mit Hypertexten und deuten bereits ihre spezifische Struktur an. Doch allein mit der Nennung und näheren Definition dieser Begriffe kann man die Struktur von Hypertexten bei weitem nicht ausreichend erfassen. Denn die Hypertextstruktur nimmt einen wichtigen Platz im Konzept Hypertext ein. Sie bestimmt maßgeblich die Beschaffenheit einzelner Hypertexte, aber auch die spezifischen Eigenschaften des Hypertexts im Allgemeinen.
Die Bedeutung, die der Struktur der Hypertexte beigemessen wird, spiegelt sich auch in der Vielzahl der zum Teil recht widersprüchlichen Texte der Hypertexttheoretiker/innen zu diesem Thema wider. Was nun die Struktur eines Hypertexts ist, wie sie beschaffen sein sollte und welche Auswirkungen sie auf den Hypertext und letztendlich auf den/die Nutzer/in hat, soll in diesem Abschnitt untersucht werden.
Wenn man sich mit der Struktur von Hypertexten befasst, läuft man Gefahr, sich im Dickicht der Fachliteratur erst mal zu verirren. Denn unter dem recht allgemeinen Begriff „Struktur“ werden verschiedenste Aspekte behandelt. Meiner Ansicht nach kann deshalb eine überblickende Betrachtung der unterschiedlichen Thesen nur durch die Annahme verschiedener Ebenen, auf denen Struktur eine Rolle spielt, ermöglicht werden.
In diesem Abschnitt ist der traditionelle Text noch immer von großer Bedeutung, denn die meisten Autor/inn/en verwenden ihn auch im Bereich der Struktur um die Merkmale des Hypertexts durch einen Vergleich zu definieren. Um also eine gute Basis für eine vergleichende Einordnung verschiedener Strukturaspekte zu schaffen, sollen hier allgemeine Ebenen festgelegt werden, die sowohl Hypertexte als auch traditionelle Texte betreffen.
Der Begriff der Struktur kann sowohl auf das Medium im Allgemeinen, wie auch auf jeden Hypertext und traditionellen Text im Speziellen angewandt werden. Mit „Struktur“ kann die äußerlich sichtbare Anordnung der Wörter, Sätze und Textpassagen im jeweiligen Medium gemeint sein, aber auch eine innere, thematische, Ordnung der Elemente in einem konkreten traditionellen Text oder Hypertext. Ich möchte dieses Kapitel deshalb in die Unterkapitel äußere Struktur und innere Struktur teilen.
2.2.4.1 Die äußere Struktur
Wenn ich hier von der äußeren Struktur der Hypertexte spreche, beziehe ich mich auf die grundlegende Art der Anordnung von Textteilen, wie sie für jeden Hypertext gültig ist. Auf jene Anordnung, die im Grunde äußerlich sichtbar ist. Natürlich ist es so, dass beim traditionellen Text die Anordnung der Textteile für den/die Benutzer/in viel leichter auf Anhieb zu erkennen ist. Denn im Trägermedium Computer kann man den Hypertext nicht „auf einmal“ sehen, sondern klickt sich von einem Textteil zum nächsten[10]. Dennoch ist auch für den/die Rezipienten/in schnell erkennbar, dass Hypertexte aus miteinander verknüpften Textteilen bestehen. Bei der Beschreibung der äußeren Hypertextstruktur sind sich im Grunde auch alle Hypertexttheoretiker/innen einig: Hypertexte sind aus abgeschlossenen Texteinheiten (Knoten) und Verknüpfungen zwischen ihnen (Kanten) aufgebaut:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der traditionelle Text hingegen besteht aus einer vorgegebenen Reihenfolge aneinander anschließender Textpassagen:
Ted Nelson prägte diese Sichtweise durch seine Aussage:
…by ‚hypertext’ I mean non-sequential writing – text that branches and allows choices to the reader, best read at an interactive screen. As popularly conceived, this is a series of text chunks connected by links which offer the reader different pathways. (Nelson 1987, 0/2)
Nelsons Ausdruck „nicht-sequenziell“ wird in der deutschen Literatur meist durch den Ausdruck „nicht-linear“ ersetzt. :
Von den vielen Definitionsvorschlägen für Hypertext ist nach unserer Einschätzung die Kennzeichnung von Hypertext als ein Medium der nicht - linearen Organisation von Informationseinheiten am treffendsten. […] Wir verwenden die Bezeichnungen ‚linear’ und ‚sequentiell’ hier als synonym.
(Kuhlen 1991, S.27)
Doch eine strikte Trennung zwischen traditionellem Text als rein linearem Medium und Hypertext als rein nicht-linearem Medium ist nicht wirklich zu halten. Dies zeigt sich schon darin, dass viele Autor/inn/en die Nicht-Linearität des Hypertexts durch das Beispiel der Fußnote im traditionellen Text zu erklären versuchen:
The same is true of footnotes in traditional printed texts, since readers have to determine upon reaching the footnote marker whether to continue reading the primary stream of text or to branch off to pursue the footnote. Therefore hypertext is sometimes called the ‘generalized footnote’. (Nielsen 1995, S.2)
Traditioneller Text ist also in dem Sinn linear, dass er auf eine Rezeption vom Anfang bis zum Schluss konzipiert ist. Der/die Leser/in wird in einer vorgegebenen Reihenfolge von einem Textteil zum nächsten geführt. Beim Hypertext gibt es keine vorgegebene Reihenfolge, es besteht die Notwendigkeit, sich zwischen verschiedenen Textteilen zu entscheiden, so wie der/die Leser/in entscheiden muss, ob er/sie einer Fußnote nachgehen möchte oder nicht. Hier zeigt sich die oben erwähnte Unstimmigkeit: Ist nun ein traditioneller Text, der viele Fußnoten enthält, auch nicht-linear? Rainer Kuhlen sieht dies folgendermaßen:
Im jeweils konkreten Fall sind […] die Grenzen fließend, d.h. sowohl Texte enthalten in bestimmtem Ausmaß nicht-lineare Strukturen und Hypertexte ebenso lineare. Das widerspricht aber nicht der allgemeinen Aussage, daß das Grundprinzip von Text Linearität und das von Hypertext Nicht-Linearität ist. (Kuhlen 1991, S. 27f)
Doch traditioneller Text kann nicht nur nicht-lineare Elemente enthalten, sondern sogar entgegen der Linearität konzipiert sein. Beispielsweise sind ganze Textsorten wie Kochbücher oder Lexika nicht-linear aufgebaut. Nicht - Linearität ist also nicht auf Hypertexte beschränkt, sondern lässt sich auch in traditionellen Texten finden. Die äußere Struktur aus Knoten und Kanten ist allerdings beim Hypertext einzigartig. Denn auch wenn ein gedrucktes Lexikon thematisch nicht-linear aufgebaut ist, so ist dennoch zumindest die äußerlich sichtbare Abfolge der Textteile linear aufgebaut. Diese rein äußerlichen Aspekte, die sich aus dem jeweiligen Trägermedium ergeben, beeinflussen auch die Art wie Hypertexte im Gegensatz zu traditionellen Texten rezipiert werden. Die Realisierung von Hypertexten im elektronischen Trägermedium macht aus der Fußnote einen gleichberechtigten Textteil:
A hypertext version of a note differs from that in a printed book in several ways. First, it links directly to the reference symbol and does not reside in some sequentially numbered list at the rear of the main text. Second, once opened and either superimposed upon the main text or placed along side it, it appears as an independent, if connected, document in its own right and not as some sort of subsidiary, supporting, possibly parasitic text. (Landow 1992, S. 6f)
Die äußere Struktur aus Knoten und Kanten erleichtert im Grunde die Realisierung nicht-linearer Texte. Das Grundkonzept der Nicht-Linearität ist also schon im traditionellen Text angelegt, doch mithilfe der Struktur aus Knoten und Kanten, realisiert im elektronischen Medium, lässt es sich besser verwirklichen.
Auf der Ebene der äußeren Struktur ist der traditionelle Text also von sequentieller Abfolge geprägt, und somit linear. Der Hypertext ist äußerlich hingegen in mehrere miteinander verknüpfte Einheiten geteilt, und somit nicht-linear. Dennoch existieren traditionelle Texte, die auf der Ebene der inneren Struktur nicht-linear aufgebaut sind. Muss ein Hypertext nun innerlich nicht-linear sein, um ein richtiger Hypertext zu sein? Ein traditioneller Text auf dem Computerbildschirm ist noch kein Hypertext. Entscheidend ist das Vorhandensein abgeschlossener Textsegmente und der Verknüpfungen zwischen ihnen. Doch was ist, wenn diese Verknüpfungen wiederum einen linearen Weg nehmen? Kann man von einem Hypertext sprechen, wenn durch die Kanten einfach ein Knoten an den anderen gereiht wird? Diese Fragen führen uns von der Ebene der äußeren Textstruktur zu jener der inneren Textstruktur.
2.2.4.2 Die innere Struktur
Im Bereich der inneren Struktur von traditionellen Texten und Hypertexten geht es nun um das, was praktisch hinter dem sichtbaren Text steht. Diese innere Struktur kann aus mehreren Perspektiven untersucht werden.
Aus der Sicht der Textlinguistik ist in Bezug auf die lineare Organisation eines Texts zwischen Linearisierung und Linearität zu unterscheiden – je nach dem, ob der Text als Prozess oder als Resultat, das heißt Produkt eines Kommunikationsvorgangs betrachtet wird. (Prokopczuk / Tiutenko 2001)
Eine ähnliche Unterscheidung trifft Nussbaumer mit dem „Text auf dem Papier“ und dem „Text im Kopf“:
Das, was sich allererst als Text im Kopf des Rezipienten ausbildet, will ich den Text II nennen. Das Gebilde hingegen, das in unserem Fall auf dem Papier notiert und das als solches ein Objektivgebilde, allen seinen Rezipienten gleicherweise gegeben ist, will ich den Text I nennen. (Nussbaumer 1991, S.136)
Die innere Struktur des Hypertexts lässt sich also in das, was der/die Autor/in als ordnendes Prinzip verwendet, und in jene Strukturen, die der/die Rezipient/in beim Lesen bildet, aufteilen.
Beschäftigt man sich mit der inneren Struktur des Hypertexts aus der Sicht des/der Rezipient/in, stößt man auf stark unterschiedliche Auffassungen des Konzepts der Nicht-Linearität im Hypertext. Andrew Dillon ist beispielsweise der Ansicht, dass traditioneller Text deshalb nicht unbedingt ein lineares Medium ist, weil der Großteil der Leser/innen ohnehin nicht- lineare Lesestrategien verwenden, und in traditionellen Texten nur Teile lesen oder Sprünge machen (vgl. Dillon S.30). Rainer Kuhlen ist wiederum der Ansicht, dass der Leseprozess für den/die Rezipienten/in beim Hypertext genauso linear ist wie beim traditionellen Text:
Die faktischen Pfade, die ein Hypertextleser real in einer bestimmten Hypertextsitzung durch Auswahl der Angebote einschlägt, sind im Sinne des reinen Abfolgearguments natürlich linear. Eine Hypertextbasis stellt sich aber nicht als linear organisiert dar. (Kuhlen 1991, S.33)
Es lässt sich nun nicht bestreiten, dass geübte Leser/innen traditionelle Texte auch entgegen der materialen Linearität rezipieren. Ebenso wenig kann man widerlegen, dass der/die Nutzer/in für sich selbst beim Lesen eines Hypertexts einen linearen Lesepfad schafft.
Im Grunde ist meiner Ansicht nach eine Untersuchung des Leseprozesses nicht unbedingt nützlich für das Aufspüren von allgemeinen Strukturen, die Hypertexten zugrunde liegen. Natürlich ist die Rezipient/inn/enseite der Ausgangspunkt für die Analyse von Hypertexten. Ich möchte hier auch nicht ignorieren, dass Rezipient/inn/en Hypertexte anders lesen und zum Teil andere Lesestrategien finden müssen als in traditionellen Texten. Doch diese Thematik wurde schon im Bereich der Textfunktion behandelt, und wird auch später in dieser Arbeit wieder aufgenommen werden. An dieser Stelle geht es aber noch immer darum zu klären, wie die dem Hypertext zugrunde liegende Struktur aussehen muss, damit tatsächlich von einem Hypertext gesprochen werden kann. Dies ist meiner Ansicht nach durch die Untersuchung des Rezeptionsprozesses nicht wirklich fassbar. Deshalb möchte ich mich hier den statischen Produkten Hypertext und traditioneller Text zuwenden, um deren Strukturunterschiede festlegen zu können.
Dass Hypertexte aus Knoten und Kanten bestehen, ist eigentliche eine unumstrittene Feststellung. Wie diese Knoten und Kanten hingegen angeordnet sein sollten, um einen richtigen Hypertext zu ergeben, ist nicht so ganz einfach festzulegen. Fest steht, dass häufig das Stichwort der Linearität gefallen ist, und dass die Nicht-Linearität so etwas wie dass oberste Strukturprinzip im Hypertext zu sein scheint. Es wurde bereits festgehalten, dass Linearität nicht gezwungenermaßen an die physischen Struktur aneinander gereihter Textpassagen gebunden ist und Nicht-Linearität nicht an jene aus Knoten und Kanten.
Die Vermutung, dass man Linearität und Nicht-Linearität auf der Ebene der inneren Struktur von traditionellem Text und Hypertext finden kann, liegt nahe. Ob nun Hypertexte auf dieser Ebene tatsächlich nicht-linear geordnet sind, ist nicht ganz einfach festzustellen. Denn Probleme mit dem Linearitätsbegriff und verschiedenste Lösungsansätze tauchen in der Hypertextliteratur immer wieder auf. Beispielsweise sieht Landow die Grundstruktur des Hypertexts als multilinear (vgl. Landow 1992, S.4) Nickl und Wright sprechen hingegen von einer polylinearen Textorganisation (vgl. Nickl/Wright 2001, S.88).
Hans-Jürgen Bucher geht hingegen soweit, für einige innerlich nicht-linear aufgebaute gedruckte Texte den Begriff Hypertext zu verwenden:
Heutige Printmedien sind dagegen segmentierte Informationsangebote für eine selektive Lektüre. Sie verfügen dafür über einen breiten Vorrat an operationalen Zeichen und Verweisen […] Aufgrund dieser beiden Informationsebenen, der inhaltlichen und der operationalen, ist eine modern gestaltete Tageszeitung als Hypertext charakterisierbar. (Bucher 1998, S.64)
Bettina Ansel Suter legt eine Art Mischform, die Proto-Hypertexte, fest. Dazu gehören Texte, für die eine „komplexe Vernetztheit“ charakteristisch ist, z.B. das gedruckte Lexikon oder die Bibel. Nicht-lineare Inhalte sind nach Ansel Suter nichts Neues, aber erst der Computer sei als Medium selbst nicht-linear und ermögliche somit einen neuen Umgang mit den im Hypertext dargestellten Inhalten. (vgl. Ansel Suter 1995, S.10f).
Dem widerspricht hingegen die Feststellung von Angelika Storrer, dass das Buch im Sinne der medialen Linearität sehr wohl nicht-linear sei, da die Daten in unterschiedlicher Abfolge rezipiert werden könnten. Nicht auf der Ebene der medialen Linearität, sondern auf jener der konzeptionellen Linearität liege der wesentliche Unterschied zwischen traditionellem Text und Hypertext. Diese Ebene der konzeptionellen Linearität entspricht vielleicht am besten der Ebene der inneren Struktur von Hypertexten. Storrers Klärungsversuch erscheint mir überhaupt der fruchtbarste Ansatz zur Lösung der Linearitätswirren. Sie versucht nicht allein traditionellem Text Linearität und Hypertext Nicht-Linearität zuzusprechen, sondern definiert verschiedene Stufen der Sequenziertheit. Sie legt also innerhalb jener „fließenden Grenzen“, die Kuhlen erwähnte, konkrete Kategorien fest.
Sie unterscheidet zwischen monosequenzierten, mehrfachsequenzierten und unsequenzierten Texten (Text bezieht sich hier sowohl auf traditionellen Text als auch auf Hypertext). Diese verschiedenen Kategorien werden hauptsächlich nach den Lesewegen, die vom Autor angelegt wurden, unterschieden. So gibt es in monosequenzierten Texten einen vorgegebenen Lesepfad – diese Texte sind für eine Lektüre von Anfang bis Ende ausgelegt. Bei mehrfachsequenzierten Texten existieren hingegen mehrere verschiedene Lesewege, von denen sich der/die Rezipient/in den für ihn/sie am besten geeigneten aussuchen kann. Beim unsequenzierten Text hingegen gibt es überhaupt keine vorher festgelegten Lesepfade. Die Textteile können in beliebiger Reihenfolge rezipiert werden und sind thematisch durch Verweise miteinander verknüpft.
Diese drei Kategorien kommen sowohl bei traditionellen Texten als auch bei Hypertexten vor. Den Sequenziertheitsstufen lassen sich auch bestimmte Textsorten zuordnen. Unter die monosequenzierten Texte fallen hauptsächlich erzählende und argumentative Texte, aber auch Informationstexte, bei denen die vorgegebene Textführung die Kohärenzbildung unterstützen soll. Mehrfachsequenziert sind hingegen bestimmte Informationstexte wie Reiseführer oder Computerhandbücher, aber auch mehrfachadressierte Lehrbücher und Monographien. In die Kategorie der unsequenzierten Textsorten fallen Wörterbücher und Lexika. Diese Textarten lassen sich als traditionelle Texte wie auch als Hypertexte realisieren. Monosequenzierte Texte sind als Hypertexte zwar nicht unbedingt typisch, lassen sich aber nach Storrer sinnvoll in ein hypertextuelles Umfeld einbinden. So kann ein monosequenzierter Fachartikel mit dem ihm zugrunde liegenden Datenmaterial verknüpft werden. Natürlich ist der traditionelle Text das typische Mittel zur Realisierung monosequenzierter Texte. Der Hypertext hingegen eignet sich am besten für mehrfachsequenzierte und unsequenzierte Texte. (vgl. Storrer)
Man könnte diese unterschiedlichen Stufen der Sequenziertheit als Gradmesser für die Linearität bzw. Nicht - Linearität eines traditionellen Texts oder Hypertexts sehen.
Mir erscheint diese Kategorisierung deshalb sinnvoll, weil alle drei Sequenziertheitsstufen auf der Ebene der inneren Struktur liegen, und somit sowohl in einer physischen Struktur aneinander gereihter, gedruckter Textteile als auch in einer Struktur aus digitalen Knoten und Kanten realisierbar sind.
2.2.4.3 Ordnungsmöglichkeiten
Der Hypertext unterscheidet sich vom traditionellen Text dadurch, dass die innere Struktur mit Hilfe der äußeren Struktur aus Knoten und Kanten expliziter gemacht werden kann. Beim traditionellen Text liegt die innere Struktur hingegen praktisch unsichtbar hinter der äußeren Struktur:
Traditionelle, klassische Dokumente, wie z.B. auf Papier gedruckte Bücher, sind durch im Prinzip hierarchische Organisationsstrukturen charakterisiert, die eine sequentielle Produktion, Präsentation und Rezeption von Informationen nahe legen. Damit ist nicht gesagt, daß der Text – aus textlinguistischer oder kognitionswissenschaftlicher Sicht – keine internen Strukturen hat, die Netzwerkcharakter aufweisen. Sie sind vorhanden, werden aber nicht explizit kommuniziert. (Streitz 1990, S.13)
Nach Nussbaumer ist die Struktur, die hinter der äußeren Erscheinung des traditionellen Texts liegt, eher hierarchischer Natur:
Das, was einen Text II zusammenhält, ist eine Struktur hinter der Linearität des Texts I, darstellbar etwa als hierarchischer Baum von sich überlagernden propositionalen Hyper- und Hypo-Themen. (Nussbaumer 1991, S.152)
Welche Struktur einem traditionellen Text zugrunde liegt, ist meiner Ansicht nach wiederum vom jeweils konkreten Fall bzw. der Textsorte abhängig. Hypertexte bieten jedenfalls die Möglichkeit, das ihnen zugrunde liegende Ordnungsprinzip auch explizit darzustellen. Natürlich liegt jedem traditionellen Text und auch jedem Hypertext eine andere Struktur zugrunde. Dennoch lassen sich bestimmte Grundformen festlegen, die auch den oben genannten Stufen der Sequenziertheit entsprechen und in der Hypertextliteratur immer wieder auftauchen. Diese Grundformen wären: die Achse, der Baum (die Hierarchie) und das Netzwerk. Häufig wird der Begriff „Hypertext“ rein über eine Netzwerkstruktur definiert. Ob Achsen- und Baumstruktur auch einen Platz im Konzept Hypertext einnehmen können, oder ob sie dem Prinzip der freien Navigation entgegenstehen, soll nun durch eine nähere Beschäftigung mit den jeweiligen Ordnungsprinzipien und Möglichkeiten sie in Hypertexten umzusetzen, herausgefunden werden.
2.2.4.3.1 Achse
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Achsenstruktur ist jene Form, die am stärksten am Prinzip der Monosequenziertheit festhält. Es gibt einen „Hauptlesepfad“, von dem der/die Nutzer/in immer wieder auf verwandte Texteinheiten zugreifen kann.
The simplest, most limited form of such translation preserves the linear text with its order and fixity and then appends various kinds of text to it, including critical commentary, textual variants, and chronologically anterior and later texts. In such a case, the original text, which retains its old form, becomes an unchanging axis from which radiate linked texts that surround it, modifying the reader’s experience of this original text-in-a-new-context. (Landow 1992, S.35)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Landow bezieht sich hier auf die verschiedenen Möglichkeiten bereits bestehende traditionelle Texte in Hypertexte zu konvertieren. Die einfachste Möglichkeit wäre also die Einbindung eines traditionellen monosequenzierten Texts in einen neuen Kontext. Dies soll durch die Verknüpfung mit Texteinheiten, die den Haupttext kommentieren oder beschreiben, aber auch mit anderen traditionellen monosequenzierten Texten, die in Relation zum Haupttext stehen, erreicht werden. Der Unterschied zu traditionellen monosequenzierten Texten liegt bei der hypertextuellen Form darin, dass der Kontext, in dem sich der traditionelle Text genauso befindet wie der Hypertext, beim Hypertext dem/der Rezipienten/in direkt zugänglich gemacht wird.
Landow spricht hier vom „text-in-a-new-context“, womit wohl gemeint ist, dass der/die Hypertextproduzent/in die Möglichkeit hat, den traditionellen Text in einen neuen Kontext zu stellen. Natürlich steht auch der traditionelle Text immer in einem gewissen Kontext, es gibt immer andere verwandte oder widersprechende traditionelle Texte, die, vor allem (literatur-) wissenschaftlich gesehen, für ein gutes Verständnis notwendig sind. Der/die Autor/in eines traditionellen Texts kann dies durch Fußnoten und Verweise klarmachen, doch durch das Medium Hypertext entsteht die Möglichkeit, den Kontext dem/der Nutzer/in direkt zugänglich zu machen:
Scholarly articles situate themselves within a field of relations, most of which the print medium keeps out of sight and relatively difficult to follow, because in print technology the referenced (or linked) materials lie spatially distant from the references to them. Electronic hypertext, in contrast, makes individual references easy to follow and the entire field of interconnections obvious and easy to navigate. (Landow 1992, S.5)
Bei der Achsenstruktur gibt es einen linearen Lesepfad, der zwar durch Texteinheiten ergänzt wird, aber trotzdem immer als „Haupttext“ in der Mitte steht. Die Achsenstruktur ist deshalb meiner Ansicht nach nur dann nutzbringend in einem Hypertext zu verwenden, wenn der lineare Haupttext selbst tatsächlich das Thema des Hypertexts ist. So sind beispielsweise literarische Editionen durchaus mit Mehrwert als Hypertexte mit Achsenstruktur zu realisieren (siehe auch: Schmidt / Müller 2001).
2.2.4.3.2 Hierarchie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wie schon oben bei den Zitaten von Streitz und Nussbaumer klar geworden ist, wird die hierarchische Struktur im Grunde dem traditionellen Text zugeschrieben. Auch Kuhlen ordnet die Hierarchie zunächst dem traditionellen Text zu:
Eine strikte Monohierarchie ist eindeutig linear abarbeitbar: die Abarbeitung beginnt bei dem jeweils links stehenden Knoten, verfolgt dessen tiefere Ebenen bis zu den jeweiligen Endknoten und setzt sie an dem auf einer Ebene höher stehenden rechten Knoten fort. Aus der logischen Struktur des Texts kann also seine physische Linearität abgeleitet werden. Kuhlen 1991, S.29) (Kuhlen 1991, S.29)
Auffällig ist, dass Kuhlen hier von einer Monohierarchie spricht, den Begriff Hierarchie also in verschiedene Abstufungen aufspaltet. Als Monohierarchie kann man beispielsweise ein traditionelles Buch sehen, dass durch Kapitel und Unterkapitel zwar hierarchisch geordnet ist, aber dennoch einen einzigen, optimalen Leseweg vorsieht. Wenn man den Begriff Hierarchie also über solch eine Monohierarchie definiert, lässt er sich natürlich nicht mit Storrers Mehrfachsequenziertheit gleichsetzen. Jakob Nielsen spricht beispielsweise von einer strict hierarchy, die er dem outliner [11] zuschreibt:
But that format is typically restricted to a strict hierarchy. A chapter heading in an outliner can be viewed as having pointers to the section headings it contains, and these section headings again have pointers to the headings of the subsections they contain. But a chapter heading in an outliner cannot have a pointer to a subsection in another chapter even though that subsection may be relevant to its topic. That limitation is why outliners are not hypertext. (Nielsen 1995, S.11)
Fasst man den Begriff Hierarchie auf diese Weise auf, bringt eine Hierarchie im Hypertext dem/der Nutzer/in nicht unbedingt einen Vorteil im Gegensatz zum traditionellen Text. Doch eine Hierarchie kann sich auch anders als als Monohierarchie gestalten, zum Beispiel als
Polyhierarchie:
Wir sind allerdings der Ansicht, daß ein streng hierarchischer Aufbau einer Hypertextbasis, in der also auch keine Querverweise zu anderen Ästen des Baumes erlaubt sind, dem Prinzip der Nicht-Linearität von Hypertexten widerspricht. Die Organisation einer Hypertextbasis ist […] in Analogie zu einem Netzwerk zu sehen, dessen polyhierarchische Strukturen natürlich nicht eindeutig linear abgebildet werden können. (Kuhlen 1991, S.33)
Meiner Ansicht nach ist eine Netzwerkstruktur nicht polyhierarchisch gegliedert, denn auch Kuhlen selbst sieht das Netzwerk als „n:m Struktur der Relationierung“ (Ebda), also als die Möglichkeit jeden Knoten mit jedem anderen Knoten beliebig zu verknüpfen. Ich möchte den Begriff Polyhierarchie hier also anders als Kuhlen verwenden, und zwar als eine Kombination mehrerer hierarchisch geordneter Lesewege, die sich auch Knoten teilen können[12]. Es ist diese Form der Polyhierarchie, die ich mit dem Begriff der Mehrfachsequenziertheit gleichsetzen möchte. Herrstrom und Massey haben ein Ordnungsprinzip entwickelt, welches meiner Auffassung einer Polyhierarchie sehr nahe kommt. Es ist dies die „hierarchical array“, eine hierarchische Anordnung der Texteinheiten, die aber auch freie Navigation zulassen soll:
Our hypertext net ist hierarchical in that its information modules, the nodes of the system, are tiered according to level of detail. The user can move directionally ‚up’ and ‚down’ levels of detail, but the user can also move to any intersection of the hierarchy, skipping levels or jumping across from one level to another. (Herrstrom / Massey 1995, S.50ff)
[...]
[1] Viele Menschen suchen nicht bloß, sie „googeln“.
[2] Square rigged ships: Segelschiffe, die bereits im 15.Jh. gebräuchlich waren.
[3] Der Name „Xanadu“ geht zurück auf einen legendären Ort, der im Gebiet des Himalajas vermutet wird und die Sommerresidenz des Kublai Khan gewesen sein soll. Bekannt wurde er durch ein Gedicht Samuel Coleridges in dem er als paradiesischer Platz beschrieben wird.
[4] http://ted.hyperland.com/buyin.txt
[5] Zum Aspekt der Synästhetisierung, der Kombination und Verschmelzung verschiedener Medien in Hypertexten: Freisler 1994; Cölfen 2003; Schmitz 2003.
[6] Wie z.B. bei Brinker 1997
[7] nähere Ausführungen zur Textproduktion mit Hypertexten bieten u.a.: Kuhlen 1991 S.9-11; Pohl 2002; Rothkegel 1997.
[8] Beispielsweise auch von Nielsen 1995, S.90f
[9] Was diese Hilfsmittel sind, und wo und wie man sie einsetzen sollte, ist natürlich ein für diese Arbeit besonders interessanter Aspekt. Doch in diesem Abschnitt soll vorerst nur geklärt werden, welche Aufgaben ein Hypertext erfüllen sollte, und welche Probleme dabei auftreten könnten. Schlüsse daraus, die uns zu einer konkreten Umsetzung der angeschnittenen Theorien und zu einer Lösung der Probleme führen könnten, werden später noch gezogen.
[10] Deshalb wird auch von zahlreichen Autor/inn/en empfohlen, in jedem Hypertext eine Übersicht über die jeweilige Anordnung der Textteile zu geben, worauf ich noch bei der Beschreibung verschiedener Navigationshilfen zurückkommen werde.
[11] Outliners sind Computerprogramme, die Mitte der 1980er ähnlich wie Hypertexte zur Informationsrepräsentation, aber vor allem zur Informationsverwaltung entwickelt wurden. Näheres dazu in: Winer 1999.
[12] Würde man hier nun wie bei Kuhlen angesprochen mehrere Querverweise zwischen den Ästen anlegen, also auch Verknüpfungen zwischen gleichrangigen Ebenen, könnte man vielleicht eher von einem Netzwerk sprechen. Wie genau die Netzwerkstruktur beschaffen ist, wird im nächsten Abschnitt näher besprochen.
- Arbeit zitieren
- Magdalena Mayer (Autor:in), 2004, Linguistische Qualitätskriterien für Hypertexte - Wie kann man sie finden, wie lassen sie sich nutzen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40632
Kostenlos Autor werden








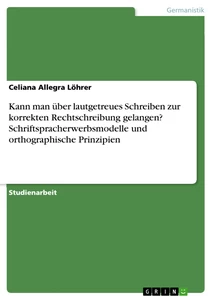










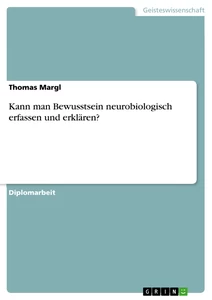


Kommentare