Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung und Exkurs in die Geschichte
2. Vorstellung der bilingualen Modelle aus Schweden und Hamburg
2.1 Schweden
2.2 Hamburg
3.1 Kritik Dillers
3.2 Kritik Coninx`
3.3 Kritik der Bundesgemeinschaft der Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder e.V.
4. Eigene Stellungnahme
5. Literatur
1. Einleitung und Exkurs in die Geschichte
Die Diskussion um die gebärdensprachlich orientierte Erziehung gehörloser Schüler, also die Diskussion darüber, ob gehörlose Kinder die Gebärdensprache erlernen und im Unterricht anwenden sollen oder nicht, geht zurück auf die Anfänge institutionalisierter Erziehung Hörgeschädigter Ende des 18. Jahrhunderts. Schon damals war die Hörgeschädigtenpädagogik beherrscht durch einen Methodenstreit zwischen Anhängern lautsprachlich und Anhängern gebärdensprachlich orientierter Erziehung gehörloser Kinder.
Das auf die Gebärdensprache ausgerichtete Konzept, auch die Französische Methode genannt, wurde 1770 von Abbé de l`Epée (1712-1789) eingeführt[1]. Er gründete in Paris ein privates Taubstummeninstitut, an dem er seine Schüler mittels eines gebärdensprachlichen Zeichensystems unterrichtete. Unterstützt wurde diese gebärdensprachliche Kommunikation durch das Handalphabet und die Schrift. Die Lautsprache hatte im Institut von Abbé de l`Eppée so gut wie keine Bedeutung, auch als es nach seinem Tod durch Abbé Sicard (1742-1822) weitergeführt wurde. Der Französischen Methode gegenüber stand ein deutsches Konzept, das durch Samuel Heinicke mit Gründung des „Kürfürstlich-Sächsischen Instituts für Stumme und andere mit Sprachgebrechen behaftete Personen“ 1778 in Leipzig eingeführt wurde. Heinicke vertrat die Meinung, die Lautsprachvermittlung habe an erster Stelle zu stehen. Entsprechend betonte er die Notwendigkeit der alltagsorientierten Artikulation und bahnte das Lesen mit der Ganzheitsmethode (eine Methode, bei der das Kind mittels ganzer Wörter und nicht einzelner Buchstaben das Lesen lernt) an. Dem Absehen der Laute vom Mund und dem Schriftbild maß er eine minimale Bedeutung zu, die Gebärde lehnte er ganz ab.
So unterschiedlich und gegensätzlich die beiden Schulen in Paris und Leipzig mit den dort praktizierten Methoden auch waren, so hatten sie doch eines gemeinsam: Sie waren erfolgreich und diese Erfolge ebneten einer
institutionalisierten Bildung und Erziehung Gehörloser den Weg. Man orientierte sich methodisch an einem der beiden Konzepte, wobei zunächst eine vermehrte Ausrichtung an der Französischen Methode festzustellen war. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte sich dann in den deutschsprachigen Ländern die lautsprachig orientierte Erziehung Hörgeschädigter durch.
Damit waren aber die Diskussionen um die Gebärdensprache und darüber, welche der beiden Methoden die bessere sei, noch lange nicht beendet. Ohne sich auf Kompromisse einzulassen, kämpften Anhänger beider Konzepte gegeneinander, oft in kontroverser und grotesker Weise, die nicht mehr sachlich genannt werden kann[2]. Ein, wenngleich auch nur vorläufiges Ende fand diese Auseinandersetzung auf dem II internationalen Taubstummenlehrerkongress 1880 in Mailand, bei dem sich die Lautsprachvertreter in Europa durchsetzten. Das zeigen insbesondere zwei der acht verabschiedeten Beschlüsse:
„I. In der Überzeugung der unbestrittenen Überlegenheit der Lautsprache gegenüber der Gebärdensprache, insofern jene die Taubstummen dem Verkehr mit der hörenden Welt wiedergibt und ihnen ein tiefes Eindringen in den Geist der Sprache ermöglicht, erklärt der Kongreß: daß die Anwendung der Lautsprache bei dem Unterricht und in der Erziehung der Taubstummen der Gebärdensprache vorzuziehen sei...
II. In der Erwägung, daß die gleichzeitige Anwendung der Gebärdensprache und des gesprochenen Wortes den Nachteil mit sich führt, daß dadurch das Sprechen, das Ablesen von den Lippen und die Klarheit der Begriffe beeinträchtigt wird, ist der Kongreß der Ansicht: daß die reine Artikulationsmethode vorzuziehen ist.“ (Treibel, zit. n. Schumann 1940, 407)[3]
Die diesen Beschlüssen zugrundeliegende Annahme, die Gebärdensprache beeinflusse die Entwicklung der Lautsprache negativ, bestimmt auch heute noch die Diskussion um die Erziehung hörgeschädigter Kinder im Allgemeinen und insbesondere die Diskussion um eine bilingualen Erziehung grundlegend. Auch die erwähnte Tatsache, dass die Diskussion so kontrovers und oft auch wenig sachlich geführt wird, hat sich bis heute nicht verändert. Ohne wissenschaftlich fundierte Beweise werden Konzepte entwickelt, dargestellt und im Gegenzug niedergemacht.
Die Forderungen des Mailänder Kongresses wurden teilweise übertrieben umgesetzt. Gehörlosenschulen entwickelten sich zu reinen Sprech- und Sprachschulen. Vermittelt wurde nur noch, was für die Ausprägung der Sprechfähigkeit von Bedeutung war[4], um die allgemeine Bildung der Kinder kümmerte man sich nicht. Die ausschließliche Konzentration auf die Vermittlung der Lautsprache führte folglich auch zu einer Vernachlässigung der Schrift und vor allem zu einem konsequenten Ausschluss der Gebärde. Eine endgültige Ausrichtung an der Lautsprache fand dann die deutsche Hörgeschädigtenpädagogik durch die Erfolge Johannes Vatters (1842-1916), für den die Entwicklung der Sprechfertigkeit gehörloser Schüler ebenfalls primäre Bedeutung hatte.
Im Gegenzug dazu entwickelte sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Gebärdenbewegung. 1848 gründete sich in Berlin der erste deutsche Taubstummenverein, 1853 erschien die erste Zeitschrift für Gehörlose. Zunächst noch angetrieben vor allem durch Hörgeschädigtenpädagogen, die 1846 auf der ersten Taubstummenlehrerversammlung dazu Anregung fanden[5], forderten nach und nach vermehrt auch die Gehörlosen selbst ihre Rechte und damit auch das auf Gebärdensprache ein, so dass die Diskussion um den Einsatz der Gebärdensprache im Unterricht nie wirklich einschlief.
2. Vorstellung der bilingualen Modelle aus Schweden und Hamburg
Ich beziehe mich in meiner Arbeit zunächst grundlegend auf die Ansätze von Dr. phil. G. Diller,[6], Prof. Dr. F. Coninx[7] sowie auf Auszüge aus dem Memorandum zur Früherkennung und Frühförderung hörgeschädigter Kinder der Bundesgemeinschaft der Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder e.V.[8].
Da sich die Kritik der meisten Autoren auf die bilingualen Modelle aus Hamburg und Schweden bezieht, stelle ich diese Konzeptionen zunächst vor.
2.1 Schweden
Nach dem Reichstagsbeschluss vom 14.5.1981 sind in Schweden Gehörlose als Minderheit mit einer eigenen Sprache und Kultur anerkannt. Das Ziel der Bildung hörgeschädigter Kinder ist die Fähigkeit, beide Sprachen situationsangemessen anwenden zu können. Dies geschieht für Gehörlose an speziellen Schulen, während Schwerhörige an Regelschulen in „separaten„ Hörklassen“ unterrichtet werden, die sich allerdings mehr und mehr zu eigenständigen, von der Normalschule abgetrennten Klassen entwickeln. Der Gebärdensprache kommt die Aufgabe der Muttersprache zu, auf der aufbauend Schwedisch als Zweitsprache gelernt werden soll. Die Ausrichtung des Unterrichts erfolgt demnach fast ausschließlich gebärdensprachlich mit gehörlosen und gebärdensprachlich sehr kompetenten hörenden Lehrkräften. In der Erziehung hat die Befähigung zur Sprache Vorrang gegenüber dem Sprechen, was zur Folge hat, dass die Lautsprache in den Hintergrund gedrängt wird. Schwedisch wird fast nur in Form von Schriftsprache angeboten, Artikulationsunterricht erfolgt nur nach individueller Neigung des Kindes.
2.2 Hamburg
Der 1993 begonnene Hamburger Schulversuch[9] basiert auf dem „Konzept zur Zweisprachigkeit Gehörloser als Grundlage eines bilingualen Schulversuchs“[10]. Ziel ist die emotionale, soziale und geistige Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes. Der Gehörlose soll sich als selbstbewusste, unabhängige Persönlichkeit in die Welten der Gehörlosen und der Hörenden integrieren. Als äußerst wichtig wird daher die Anerkennung der Gehörlosen als eine selbstständige Sprach- und Lebensgemeinschaft angesehen.
Das bilinguale Konzept sieht einen zweisprachigen Spracherwerb von Anfang an vor, der allerdings auf Basis der Gebärdensprache zu erfolgen hat, da man davon ausgeht, dass deren Entwicklung naturgemäß schneller und früher vonstatten geht. In diesem Zusammenhang wird auf Modelle in Schweden und Frankreich (Poitiers) verwiesen, bei denen der Erwerb der Landessprache über die geschriebene Form gefördert wird. Da der Spracherwerb nur bedingt über die gebärdensprachlich nicht von Anfang an ausreichend kompetenten Eltern erfolgen könne, sieht man die Notwendigkeit einer sehr frühen Integration in die Gehörlosengemeinschaft. Außerdem müssen nach Ansicht der Hamburger Arbeitsgruppe beide Sprachen bereits in der Frühförderung vertreten sein, wobei der Gebärdensprache die Aufgabe einer altersgemäßen, leistungsfähigen kommunikativ-sprachlichen Entwicklungsförderung und eines Fundaments für den Aufbau der Lautsprache zukommt.
Für die Umsetzung in das Hamburger Schulmodell bedeutet dies, dass Gebärdensprache und Lautsprache nach dem Immersionsmodell (Bereicherungsmodell, bei dem beide Sprachen als gleichwertig anerkannt und parallel angewandt werden) unterrichtet werden, wobei davon ausgegangen wird, dass sich die Gebärdensprache schneller und effizienter entwickelt und sie deshalb die Lautsprache fördern kann. Des weiteren werden je nach Situation unterstützende Zeichensysteme wie LBG (Lautbegleitende Gebärden) und PMS (Phonembestimmtes Manualsystem) genutzt. Unterrichtet werden die Kinder von einer hörenden und einer gehörlosen Lehrkraft. Die gehörlose Kraft unterrichtet die Kinder zudem gesondert in Deutscher Gebärdensprache (DGS) und der Kultur der Gehörlosen. Auch die Hör- und Sprecherziehung erfolgt separat, allerdings sehr reduziert. Selbst im Deutschunterricht wird wenig gesprochen, da die Sprache überwiegend auf dem schriftlichen Weg mit Unterstützung verschiedener manueller Systeme angebahnt wird. Die Priorität dieses Konzeptes liegt weniger auf einer adäquaten Lautsprachvermittlung als auf der generellen Befähigung zur Kommunikation und somit der Förderung der Gesamtpersönlichkeit des gehörlosen Kindes. Dies hat zur Folge, dass der Förderung der Lautsprache, sei es in individuellen Förderstunden als auch im spontanen Lernprozess wenig Raum gewährt wird.
3.1 Kritik Dillers
Dillers Ablehnung eines bilingualen Konzepts beruht unter anderem in seiner skeptische Einstellung gegenüber der Leistungsfähigkeit der Gebärdensprache, die er anhand eines Zitates von Schulte begründet: Die Deutsche Gebärdensprache sei in ihrem augenblicklichen Entwicklungsstadium noch nicht als vollwertig zu bezeichnen, da sie noch keine lexiko-semantischen und syntaktisch beschreibbare und lernbare Strukturen aufweise[11] und somit auch nicht geeignet für einen Einbezug in den Unterricht gehörloser Schüler sei.
Des weiteren sieht er Mängel und Widersprüche innerhalb des bilingualen Konzeptes, wie es von der Hamburger Arbeitsgruppe vorgestellt und von der Hamburger Gehörlosenschule versuchsweise seit 1993 praktiziert wird. Besonders bemängelt er hier, dass in dem angeblich bilingualen Konzept die Gebärdensprache die Funktion der Basissprache einnimmt.
Er wirft der Hamburger Arbeitsgruppe vor, dass es ihr nicht um eine wirkliche Zweisprachigkeit im Sinne einer gleichwertigen Sprachvermittlung gehe. So würde beim Hamburger Schulversuch durch die Konzentration auf die Gebärdensprache bei der Lautsprache starke Abstriche gemacht: sprachliches Ziel sei lediglich ein “Grundbestand sprachlicher Äußerungen“[12], also nur derjenigen Sprechhandlungen, die für die alltägliche Kommunikation ausreichend seien. Dies sei auch im reduzierten Gebrauch der Lautsprache im Unterricht zu erkennen. In allen Fächern, mit Ausnahme des Faches Deutsche Lautsprache, hat die Deutsche Gebärdensprache führenden Charakter und soll Fundament der Lautsprache sein. Der Umfang der Lautsprache werde also im Vergleich zu anderen Gehörlosenschulen nochmals reduziert[13]. Diller geht davon aus, dass allein auf quantitativer Ebene die Lautspracherwerbsmöglichkeiten im Unterricht so gering sind, dass unter diesen Bedingungen selbst Hörende Schwierigkeiten hätten die Lautsprache zu erwerben[14].
Ebenso merkt er an, dass die zusätzliche Nutzung unterstützender Hilfsmittel wie die lautbegleitenden Gebärden (LBG) und das Phonembestimmte Manualsystem (PMS) zu ähnlichen Situation wie bei der Total Communication (ein Konzept, vorwiegend in Amerika praktiziert, bei dem sämtliche Kommunikationsmittel vermischt wurden) führen würde. Die schulische Situation im Hamburger Schulversuch verlange den Kinder ein „intelligentes code-switching“ ab, dass die Kinder, da sie die Lautsprache nicht spontan erwerben könnten, überfordere und so unter starken Druck setze.
Diller bemängelt auch, dass die Hörgerätenutzung einen niedrigen und diskriminierenden Stellenwert einnehme. Seiner Ansicht nach übten Hörgeräte keinen Zwang auf die Kinder aus, solange man ihnen deren Notwendigkeit zeige, indem man ihnen das Hören bewusst mache. Dies gelinge nicht, wenn wie im Hamburger Schulversuch im Unterricht nur gebärdet werde und so wenig akustische Reize angeboten würden. Die geringe akustische Aktivierung der Hörnerven sei generell ein gravierender Mangel der bilingualen Förderung eines Kindes, wie sie von der Hamburger Arbeitsgruppe gefordert werde. Denn wenn dem Kind schon in der Phase der Frühförderung Inhalte hauptsächlich in der Gebärdensprache vermittelt würden, werde die sensible Phase der Hörnervreifung nicht voll ausgenutzt. Diller geht nämlich davon aus, dass sich eine „reine“ Gehörlosigkeit nur dann entwickelt, wenn die Hörreste nicht aktiviert werden und das zentrale Nervensystem nicht stimuliert wird, so dass es sich nicht voll ausbilden kann[15]. Eine Gehörlosigkeit hinge somit nach Diller nicht nur vom Ausmaß der Hörschädigung ab, sondern auch davon, in welcher Weise die Umwelt damit umgehe. Deshalb kritisiert er auch, dass die Vertreter der Gebärdensprache generell der Funktion der apparativen Versorgung eine geringe Bedeutung beimessen und vor allem auch dem Einsatz des Cochlear-Implantats skeptisch gegenüber stehen würden, welches die Voraussetzungen für einen lautsprachlichen und muttersprachlichen Spracherwerb verbessere.
Auch die muttersprachliche Erziehung komme so nach Diller im Hamburger Modellversuch zu kurz. Schließlich sei die Mutter-Kind-Interaktion für die sprachliche und soziale Entwicklung des Kindes äußerst wichtig. Da aber nur 5-10% aller gehörlosen Kinder auch gehörlose Eltern haben, sei davon auszugehen, dass die meisten Eltern zum Zeitpunkt wenn der Hörschaden festgestellt werde, nicht ausreichend kompetent in der Gebärdensprache seien, um mit dem Kind zu kommunizieren. Und auch bei einem schnellen Gebärdenspracherwerb der Familienmitglieder, der aber aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht immer möglich sei, werde die Lautsprache weiterhin primäre Kommunikationsform der Familie bleiben. Eine mangelnde Sprachkompetenz führe bei den Eltern zu einem unsicheren Sprechverhalten sowohl in der Gebärdensprache als auch in der Lautsprache, womit sie in beiden Sprachen einer sprachlichen Vorbildfunktion nicht gerecht werden könnten und damit einen reduzierten Spracherwerb des Kindes eher förderten als ihm entgegenzuwirken. Um dies zu verhindern und dem Kind gebärdensprachlich kompetente Vorbilder zu geben, sei nach Ansicht der Hamburger Arbeitsgruppe die Mitarbeit Gehörloser innerhalb der Familie notwendig. Dies führe aber zu einer Kommunikation „über 3 Ecken“[16] und zu einem unnatürlichen Sprachverhalten in der gesamten Familie. Ein natürlicher und spontaner Spracherwerb sei so auch im außerschulischen Bereich nicht mehr möglich.
[...]
[1] Leonhardt, A. (1999). Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik. München Basel. S. 191 ff
[2] s. Leonhardt. S. 199
[3] s. Leonhardt. S. 199
[4] s. Leonhardt. S. 200
[5] s. Leonhardt. S. 201
[6] Diller, G. (1994). Bilingualismus. Ein Beitrag zur Diskussion einer zweisprachigen Erziehung Gehörloser. In: Hörgeschädigtenpädagogik (48) 1, 18-33
[7] Coninx, F (1994). Erziehung hörgeschädigter Kinder zur Lautsprache – warum, wann und wie?. In: Berufsverband Deutscher Hörgeschädigtenpädagogen (Hrsg.): Von der Taubstummenbildung zur Hörgeschädigtenpädagogik. Erziehung zur Sprache im Wandel. Frankenthal: Pfalzinstitut für Hörsprachbehinderte, 52-71
[8] MEMORANDUM zur Früherkennung und Frühförderung hörgeschädigter Kinder (1993). Bundesgemeinschaft der Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder e.V. (Hrsg.). 4. überarbeitete und erweiterte Auflage. Hamburg
[9] Günther, K.-B. (1997). Schulversuch Bilingualer Unterricht an der Hamburger Gehörlosenschule. In: Kaul, Th./Becker, C. (1998) Gebärdensprache in Erziehung und Unterricht. Hamburg, S21-47
[10] s. Memorandum
[11] s. Diller. S. 23
[12] s. Diller. S. 20
[13] s: Diller. S. 21
[14] s. Diller. S. 27
[15] s. Diller. S. 19
[16] s. Diller. S. 24
- Arbeit zitieren
- Lea Gregor (Autor:in), 2001, Kritik an der bilingualen Erziehung hörgeschädigter Kinder, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40449
Kostenlos Autor werden









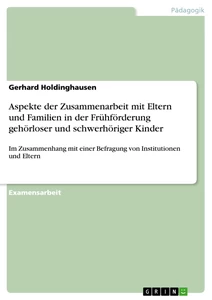










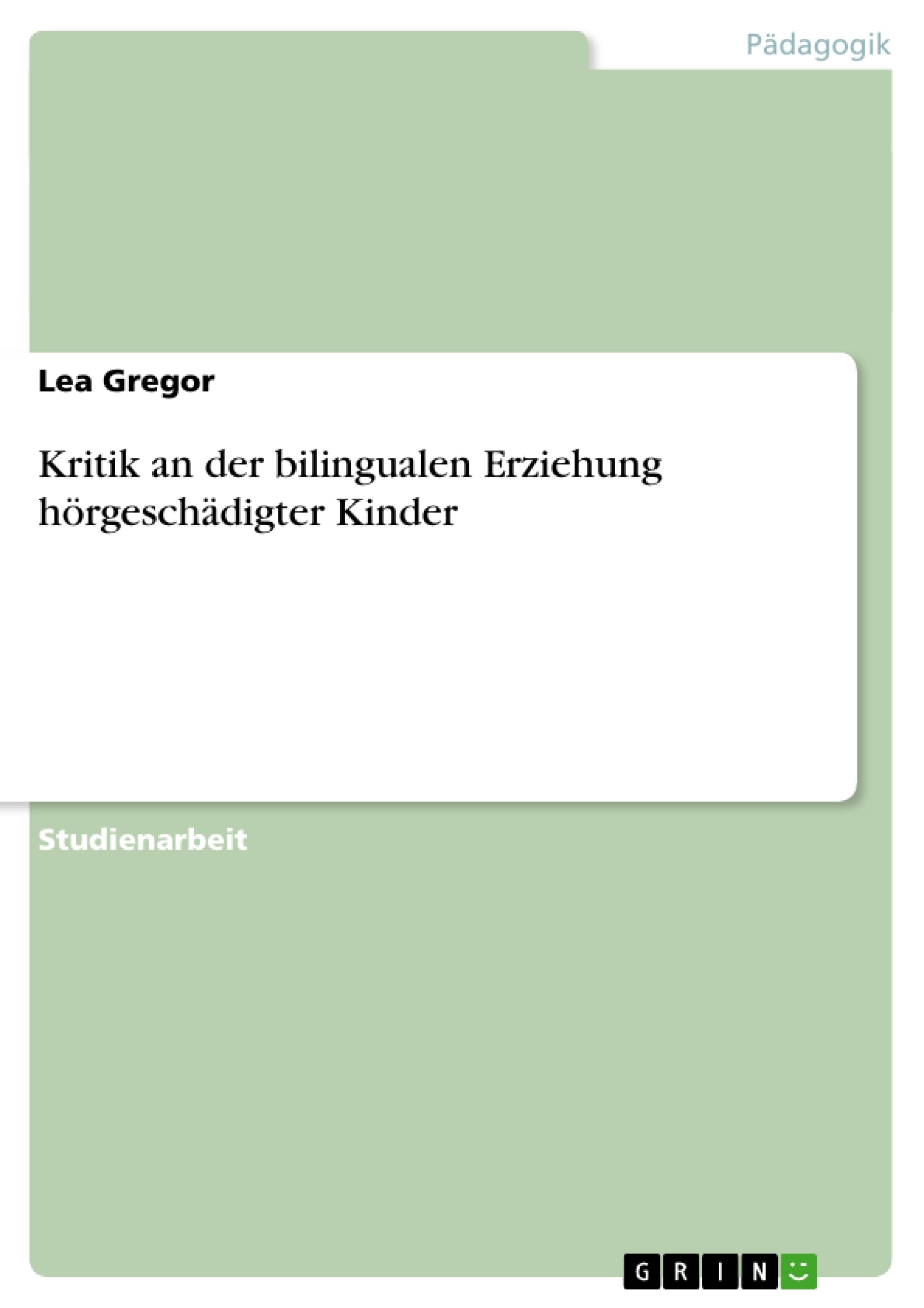

Kommentare