Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Einblicke in die Theorie
1.1 Der Systembegriff
1.2 Was bedeutet das Zauberwort „systemisch“?
1.3 Entwicklungsgeschichte der systemtheoretischen Grundlagen
1.4 Luhmanns Theorie sozialer Systeme
1.5 Das Mitglied-Konzept
2. Einblicke in die Praxis
2.1 Gegenüberstellung traditioneller Beratungsansätze und des systemischen Ansatzes
2.2 Der Gegenstand systemischer Beratung- ein systemischer Prozess
2.3 Grundhaltungen des systemischen Beraters
2.4 Leitlinien der systemischen Beratung
2.4.1 Hypothetisieren
2.4.2 Zirkularität
2.4.3 Neutralität und Neugier
2.4.4 Ressourcen- und Lösungsorientierung
2.4.5 Kundenorientierung
2.5 Elemente eines Beratungsgespräches
2.5.1 Ankoppeln
2.5.2 Klärung des Beratungskontextes
2.5.3 Vom Problem zum Anliegen und Auftrag
2.5.4 Systemische Interventionsmöglichkeiten
2.5.4.1 Fragen
2.5.4.2 Reflektieren und Empfehlen
3. Darstellung der Praxisimplikationen am ausgewählten Fallbeispiel
3.1 Dokumentation des Verlaufs der durchgeführten Beratung
3.1.1 Das Erstgespräch
3.1.2 Die zweite Beratungssitzung
3.1.3 Die dritte Beratungssitzung
3.2 Abschlussreflexion der gesamten Beratungssequenzen
Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Einleitung
Das Anliegen meiner Arbeit ist es, die Lücke zwischen Systemtheorie und systemischer Beratung zu schließen, indem ich sie zu einer Einheit zu konzipieren versuche. Denn die systemische Beratung versteht sich als eine Umsetzung systemischen Denkens; sie setzt systemisches Gedankengut in den praktischen Umgang mit sozialen Systemen und Kommunikationen um. Darum sollen im Folgenden Theorie und Praxis unbedingt gemeinschaftlich konzeptualisiert werden, ohne aber an irgendeiner Stelle ihre Gewissheit und Absolutheit zu postulieren. Sicherlich hat jedes andere Beratungsmodell mit der hinter ihr stehenden Theorie, „durch eine andere Brille gesehen“, seine Berechtigung und seinen Gebrauchswert, darum möchte ich auch die systemische Beratung nicht als die einzig Richtige darstellen, denn das würde dem systemisch konstruktivistischen Grundgedanken widersprechen. Meine Intention ist es vielmehr, eine Anregung zu geben, einmal durch die „systemische Brille“ zu schauen und den Nutzen dieser besonderen Theorie für die systemische Beratung erkennen zu lassen.
Man hat es aber in der systemischen Praxis weder mit technischen Arbeitsabläufen, noch mit linearen Abfolgen und einfachen Korrelationen zu tun. Auch ist die ihr zugrunde liegende Systemtheorie komplex und zirkulär, was eine vollständige Darstellung des systemischen Denkens und der systemischen Beratung in einer strikten linearen Weise unmöglich macht. Darum strebe ich vielmehr Wege des Verstehens an, ohne die Komplexität durch tradierte Ursache- Wirkungs- Erklärungen reduzieren zu wollen.
In einem ersten Schritt wird von mir der Versuch unternommen, die Systemtheorie als ein interdisziplinäres Paradigma einzuführen, um eine Vertrautheit mit dem systemischen Denken anzustreben (1. Kapitel). Dabei werde ich den Systembegriff zu klären suchen, wobei ich schon gleich Anknüpfungen für die systemische Praxis mit einflechte, um den Gegenstand nicht zu abstrakt zu halten. Diese Praxisimplikationen erscheinen kursiv gedruckt, um sie von ihrem theoretischen Rahmen abgrenzen zu können.
Im Anschluss werde ich die besondere Sichtweise, mit der auf diesen „Gegenstand geschaut wird, die „systemische Sicht der Dinge“, zu klären versuchen. Es folgt eine Skizzierung der Entwicklung wesentlicher systemtheoretischer Grundlagen, wobei ich besonderes Augenmerk auf Maturanas Autopoiesekonzept lege, da nach einer darauffolgenden Übertragung des Autopoiesebegriffs Luhmanns auf soziale Systeme, beide unterscheidbaren Ansätze in einem Konzept, dem Mitgliedkonzept von Kurt Ludewig untergebracht wurden. Er versucht sowohl den Ansatz Luhmanns, der soziale Systeme aus Kommunikationen bestehend sieht, als auch Maturanas Ansatz, der soziale Systeme aus Individuen bestehend sieht, zu betrachten.
Nach der Darstellung des theoretischen Hintergrundwissen erfolgt dessen Implikation in die Praxis (2. Kapitel), beginnend mit der Gegenstandsbestimmung Ludewigs „klinischer Theorie“, darauf aufbauend folgen Grundhaltungen und Prämissen des Beraters, die für die praktische Tätigkeit von unabdingbaren Nutzen scheinen. Der anschließende methodische Rahmen der systemischen Beratung umfasst einen kommentierten Ablauf eines Beratungsgespräches, der mit einer Fülle von Interventionsmaßnahmen angereichert ist. Im Anschluss verdeutliche ich die Praxisimplikationen anhand eines von meinen Kommilitoninnen und mir durchgeführten Beratungsgespräches (Kapitel 3).
Systemische Therapie wird in dieser Arbeit größtenteils synonym zur systemischen Beratung verstanden, da es keine grundsätzliche theoretische und methodische Unterscheidung gibt. Die Unterschiede ergeben sich vielmehr aus den vielfältigen Anwendungsbereichen und ihren besonderen Eigen-Logiken. So spricht man z.B. im Management auch nicht unbedingt von systemischer Therapie, wobei dieser Begriff in der Psychotherapie hingegen sicherlich gängiger sein wird. Dennoch wird in dieser Arbeit der Begriff Therapie von mir zum größten Teil, mit Ausnahme der theoretischen Gegenstandsbestimmung Ludewigs (siehe 2.1), durch den Begriff der Beratung ersetzt. Therapie ist ein Begriff der aus der Medizin stammt, und meines Erachtens nach, mit deren hierarchischen Ärzte-Patientenstrukturen überfrachtet ist.
Der traditionelle Therapiebegriff legt den Schwerpunkt auf Veränderung bzw. Symptombeseitigung im Sinne von Heilung, hierbei wird jedoch „...systemisch gesprochen – die systemnotwendige Perspektive der Nichtveränderung , - psychologisch gesprochen – die Angst vor der Veränderung nicht berücksichtigt.“ Therapie ist, legt man die Theorie selbstreferentieller Systeme zugrunde (vgl. S. 16f. & 30f.), nur als Eigenleistung des Systems möglich. Unter diesem Gesichtspunkt ist es somit unmöglich, intentional in ein operativ geschlossenes System einzugreifen, im Sinne von Heilung oder noch überspitzter ausgedrückt, im Sinne einer Reparatur. Die gegenwärtige Struktur des Systems bestimmt, welche Einflüsse von außen wirken und welche nicht. Darum unterliegt der Begriff Therapie, meiner Meinung nach, (mehr) der Paradoxie verändernd wirken zu wollen, obwohl man dies für unmöglich hält. Der Begriff Beratung impliziert, so denke ich, vielmehr den „Anstoß des Steines“, der nur dann ins Rollen gerät, wenn die Klienten dies zulassen; sie selbst entscheiden, welche Veränderungen wirken und welche „draußen“ bleiben. Der Begriff „Berater“ drückt somit vielleicht besser aus, dass der professionelle Helfer sich nicht als verdienter Verursacher von Heilung versteht, sondern als Mitgestalter eines nicht zu kontrollierenden Prozesses.
Inspiriert für die Erstellung dieser Arbeit wurde ich durch den Besuch eines Curriculums zur systemischen Beratung, welches ich als Anlass nahm, mich in diesem Gebiet intensiv zu beschäftigen und um den Versuch zu wagen, die Theorie über die Praxis, die ich innerhalb zweier Jahre erlernte, selbst in die Praxis umzusetzen. Trotz der erworbenen Fülle an theoretischem Wissen darüber, was unter systemischer Beratung zu verstehen ist, stiegen Zweifel in mir auf, inwiefern ich eigentlich die Kompetenz eines „systemischen Beraters“ aufweise. Um ein Missverständnis vorzubeugen wurde dieser Zweifel nicht dadurch geweckt, dass ich in irgendeiner Form die Wirksamkeit der systemischen Beratung anzweifele, da ich sie für eine enorme Bereicherung unserer Hilfsangebote, dem das für mich überzeugendste theoretische Gerüst überhaupt zugrunde liegt, ansehe. Die Frage danach, ob ich als Berater die Prinzipien, Grundhaltungen und Interventionsmaßnahmen in dem Sinne verinnerlicht habe, dass ich diese Fachkompetenz mit meinen individuellen Systemkompetenzen so in Einklang bringen kann, dass mein Agieren hilfreich für andere Menschen sein kann, war für mich Anlass, dieses zu überprüfen. Die Perspektive der Selbstreferenz, also die Frage danach, ob das eigene System kompetent für sein eigenes Prozessieren ist, war mitunter ausschlaggebend für diese Form der Selbsterfahrung. Denn die Fähigkeiten eines Beraters lassen sich nicht auf eine technisch versierte Annahme fertiger Muster reduzieren, man muss der Vielfalt der unterschiedlichen Systeme mit Flexibilität begegnen können und vielmehr starre, vorgegebene Haltungen verlernen, als Vorgegebenes zu adaptieren.[1]
1 Einblicke in die Theorie
Die Systemtheorie ist eine Wissenschaft der Komplexität, innerhalb derer Systeme immer konstruierte Gebilde darstellen. Obwohl ich mich in meinen Darstellungen oft des Ausdruckes >ist< bediene, dient dieser lediglich der Vereinfachung der Schreibweise, als Leser sollte man stets mitbedenken, dass es sich hierbei fortlaufend um meine Konstruktionen handelt. Aufgrund der Komplexität dieser Thematik, bin ich gezwungen immer wieder >komplexitätsleistende Komplexitätsreduzierung< zu betreiben.
Darum enthält das von mir skizzierte, für die systemische Praxis notwendige theoretische Fundament, nur einen Teil der sehr viel mehr umfassenderen Theorie. Ich konzentriere mich auf wesentliche Kernaspekte und eröffne in diesem Sinne „Einblicke“ und liefere keinen vollständigen „Überblick“. Vieles, was mir noch darzustellen wichtig erschien, musste ich angesichts der Umfangbeschränkung entfallen lassen. Ein grundsätzliches Problem, dem sicherlich nicht nur ich unterliege, sondern ein Jedermann, der es sich zu Aufgabe macht, diese Thematik schriftlich zu erfassen.
1.1 Der Systembegriff
Ein kurzer Exkurs in die Vergangenheit soll einen ersten Eindruck vom Gebrauch des Systembegriffs vermitteln, der durch die gesamte Geschichte hindurch immer wieder zum Tragen kam und somit keinesfalls eine „Modeerscheinung“ der neueren Wissenschaften darstellt.
Eine Analyse der Begriffsgeschichte zeigt, dass sich die Verwendung des Wortes „System“ bis in die Antike Griechenlands zurückverfolgen lässt. Ludwig von Bertalanffy besagt, „daß die Idee des Systems in gewissem Sinne so alt ist wie die abendländische Philosophie“ (vgl. Reiter u.a. 1988, S.289). Schon Aristoteles hat den Systembegriff auf den Menschen übertragen, indem er konstituierte, was ein System ist. Nach seinen Auffassungen ist es „nicht mehr nur irgendein zusammengesetztes Gebilde, bei dem die Art und Weise des Zusammengesetztseins keine Rolle spielt, sondern System bedeutet ein Gebilde, dessen einzelne Teile durch eine bestimmte Ordnung des Zusammengesetztseins ein Ganzes bilden“( vgl. ebd., S.289).
Aristoteles Betrachtungsweise von den „Problemen der Ganzheit“ und der „Ordnung des Zusammengesetztseins“ sind zwar in den Entwicklungen der Wissenschaften in den Hintergrund gerückt und größtenteils in Vergessenheit geraten, jedoch in neuen Formulierungen wieder durchaus aktuell geworden.
Mit dem, was in der heutigen Diskussion unter System „verstanden“ wird, hat dieses Beispiel gemein, dass der Begriff eine Ganzheit meint, deren Elemente in einer bestimmten Relation zueinander stehen.
Dennoch kann man den Systemgedanken „im eigentlichen Sinne“ als ein spätes Produkt der Wissenschaftsentwicklung der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts ansehen. Er kennzeichnet eine wissenschaftliche Neuerung, die sich in einer anderen Betrachtungsweise der Welt manifestierte, welche sich gänzlich von der vorherrschenden klassisch analytischen Weltsicht unterschied. Dieser Paradigmenwechsel wurde hervorgerufen durch die biologische Kritik an der Physik, vielmehr an der Newtonschen Physik, innerhalb derer man glaubte, die Welt in deduktiver Weise mathematisch beschreiben zu können. Diese Sichtweise legt nahe, es gäbe eine statische Gültigkeit von Naturgesetzen, die auf jedes Phänomen anwendbar sei. Innerhalb der Newtonschen Physik ging man davon aus, dass egal wann und an welcher Stelle man am Einzelphänomen aber auch am Ganzen ansetzt, man immer wieder auf die Gesetze des Kosmos trifft. Diesem Weltbild entspricht der Versuch, nach Gesetzmäßigkeiten der Natur zu suchen, indem man Einzelphänomene isoliert, um sie zu untersuchen, zu beschreiben und zu erklären.
Viele damalige Biologen argumentierten, dass sich Leben niemals real auf isoliert auftretende chemische und physikalische Vorgängen von Organismen reduzieren ließe. Innerhalb der Biologie führte diese Kritik zu einer veränderten Sichtweise vom Einzelphänomen hin zum System, also zur Vernetzung von Einzelphänomenen (vgl. Kneer/Nassehi 1994, S.18). Diesen Paradigmenwechsel hat man vor allem Ludwig von Bertalanffy zu verdanken, den man als Begründer einer interdisziplinären „Allgemeinen Systemtheorie“ bezeichnen kann.
Die Arbeiten v. Bertalanffys waren, weit über den Bereich seiner Einzelwissenschaft hinaus, für die Weiterentwicklung der „allgemeinen Systemtheorie“ von immenser Bedeutung. Er sah eine Notwendigkeit darin, eine interdisziplinäre Theorie mit einem interdisziplinären Systembegriff zu konzipieren, da er schon in den fünfziger Jahren erkannte, dass sich systemtheoretisches Denken in den unterschiedlichsten Wissenschaften, wie Ökonomie, Soziologie, Pädagogik, Psychologie, Medizin, Psychatrie, Neurologie und Politikwissenschaften manifestieren würde (vgl. Kneer/Nassehi 1994, S.19f.). Ihm war es ein Anliegen, gemeinsame Gesetzmäßigkeiten der verschiedenen Wissensgebiete herauszuarbeiten, indem er deren allgemeine Prinzipien beobachtete.
„Wir können uns die Frage vorlegen, ob es nicht Prinzipien gibt, die für Systeme schlechthin gelten, gleichgültig ob diese physikalischer, biologischer oder sozialer Natur sind. Wenn wir uns diese Frage vorlegen und uns entsprechend definieren, so finden wir, daß es Modelle, Prinzipien und Gesetze gibt, die für verallgemeinerte Systeme zutreffen, unabhängig von der besonderen Art dieser Systeme“ (v. Bertalanffy 1972, S. 8).
Tatsächlich hat der Systembegriff in verschiedenen Disziplinen Fuß gefasst. Die Systemtheorie hat sich zu einer Metatheorie entwickelt, die unterschiedliches Wissen der Wissenschaften integriert und in den verschiedensten Bereichen, die von v. Bertalanffy benannte wurden, anwendbar ist. Gerade diese Tatsache erschwert es, bzw. macht es sogar unmöglich, eine allgemeine anwendbare Definition des Systembegriffs zu konstruieren, die Unmögliches zum Ziel hätte: Gemeinsamkeiten in den unterschiedlichsten Systemen und ihren Strukturen zu konstruieren. Man muss mit unterschiedlichen Definitionen operieren (lernen), die in ihren unterschiedlichsten Ausführungen von großem Nutzen sein können, man darf aber nicht deren Absolutheit postulieren. So scheint die Definition v. Bertalanffys nach wie vor hilfreich und nützlich. Nach ihm ist ein System eine Menge (im mathematischen Sinne) von Elementen, zwischen denen Wechselbeziehungen bestehen.
Diese Definition macht auf wichtige Aspekte aufmerksam. Zum einem muss man, um ein System zu erkennen, nicht nur seine Elemente sondern auch die zwischen ihnen bestehenden Beziehungen kennen. Zweitens ist ein System eine Ganzheit mit eigenartigen Eigenschaften. Ferner bildet, durch diese Definition, ein System eine Grenze aus, die zwischen dem System, d.h. seinen Elementen und Relationen und der Umwelt des Systems, d.h. allem was nicht zum System gehört, verläuft (denn wenn alles zu System gehören würde und es keine Grenze gäbe, dann gäbe es schlussfolgernd nur ein einziges System). Welchen Sinn diese Grenze macht und wo sie genau zu ziehen ist, bleibt jedoch unklar. Darum kann auch diese Definition nicht als absolut angesehen werden. Neuere systemische Sichtweisen basieren zudem auf dem Postulat, dass das Verhalten von Elementen sich erst aus den Relationen, also aus den Interaktionen und Beziehungszusammenhängen zwischen diesen Elementen erklärt, nicht aber aus ihren inneren Eigenschaften heraus (vgl. Bamberger 2001, S.5). v. Bertalanffys Definition besagt zwar, dass Systeme ihre spezifischen eigenartigen Merkmale aufweisen und dass man die zwischen ihnen bestehenden Beziehungen kennen muss, bezieht aber nicht mit ein, dass sich die Eigenschaften (Merkmale) der einzelnen Elemente erst aus den Beziehungszusammenhängen und Interaktionen (also aus den Relationen) ergeben. Die emergenten Eigenschaften von Systemen werden nicht berücksichtigt. Emergenz meint, dass sich die Eigenschaften komplexer Systeme nicht aus den Systemelementen, sondern nur aus ihrem Zusammenwirken erklären lassen. Meines Erachtens nach lassen sich die emergenten Eigenschaften eines Systems sehr gut durch den Satz „das Ganze ist nicht mehr aber anders als die Summe seiner Teile“ ausdrücken.
„Interaktionsmodi und Eigenschaften von Objekten sind untrennbar miteinander verknüpft. Daher hat es wenig Sinn zu behaupten, dass Objekte unabhängig von ihren aktuellen Interaktionen (in einem Milieu) Eigenschaften >an sich< besäßen. Diese ergeben sich vielmehr aus der Interaktion und verändern sich zusammen mit den Interaktionsmodi. Neue Eigenschaften (Qualitäten) emergieren- sowohl in den Komponenten als auch im System- durch den Prozess der Systembildung oder >Relationierung<. Objekte werden erst zu Komponenten von Systemen, wenn sie bereits neue Interaktionsmodi und Eigenschaften ausgebildet, sich also erneuert haben“ (Ludewig 1997, S.87).
Beispielhaft möchte ich diesen Gesichtspunkt anhand der „Schizophrenie“ erläutern. In diesem Sinne erscheint eine „Schizophrenie“ weniger als Symptom eines Krankheitsbildes, sondern vielmehr als eine meist sinnvolle Verhaltensweise im Zusammenleben mit anderen Menschen in einem bestimmten Lebenskontext. Die Schizophrenie ergibt sich gerade aus diesem Zusammenleben, durch die bestimmten Relationen innerhalb des Systems.
Um ein weiteres Beispiel der Emergenz aufzuzeigen, kann man ebenso auf einer anderen Ebene ansetzen. Auf der molekularen Ebene kann Wasser auch als ein System beschrieben werden. Wasser wird zwar aus dem Element Wasserstoff und dem Element Sauerstoff gebildet, sobald aber die Systembildung zustande gekommen ist, entsteht eine neue Einheit, deren Eigenschaften nicht auf der Summe der Eigenschaften der einzelnen Elemente beruht.
Wenn man an dieser Stelle die wirklichkeitskonstruktivistische Perspektive (v. Foerster, Watzlawick, Maturana & Varela u.a.) heranzieht, sind die Eigenschaften, die sich aus dem Zusammmenwirken der Elemente ausbilden, zudem als Konstruktionen im sozialen System zu verstehen. Das, was man als Eigenschaften von Gegenständen und Menschen versteht, sind eigentlich die Konstruktionen des Beobachters. So können Eigenschaften von Menschen auch nie so gesehen werden, als wenn sie >in ihm liegen<.
Für die systemische Arbeit bedeutet dies, dass Eigenschaften und Beziehungen interdependieren und zugleich, dass die beobachtbaren Eigenschaften immer Konstruktionen des Beobachters selbst sind. Ein systemischer Berater kann seine Verantwortung nicht auf eine objektive Realität abwalzen. Er erforscht statt einer objektiven Realität, die biologische Struktur dessen, der sich seine Welt erschafft. Er selbst konstruiert sich eine Akt des Beobachtens. Ziel muss es nun sein, personale Eigenschaften zu relativieren und zu verflüssigen, um so wieder mehr Komplexität und damit verbunden mehr zukünftige Verhaltensalternativen für die Klienten zu ermöglichen.
Um deutlich zu machen, was ein System ist, scheint es an dieser Stelle sinnvoller, den Versuch ein System zu definieren aufzugeben, da >der< Systembegriff, aufgrund der zu erfassenden Vielschichtigkeit, nicht existiert. Auf der Suche nach ihm wird man immer wieder auf Unvollständigkeit stoßen. Darum halte ich es an dieser Stelle für sinnvoller, prägnante Aspekte, die Systeme kennzeichnen, deutlicher hervorzuheben.
Systeme entstehen durch eine Unterscheidung von System und Umwelt, folglich durch die Wahrnehmung einer Differenz. Nach Bateson sehen wir nicht Dinge an sich, sondern Dinge als etwas von ihrem Hintergrund verschiedenes. Dies nennt Batesons eine Unterscheidung treffen. Eine Unterscheidung zwischen System und Umwelt, also zwischen den Elementen, die >innen< und >außen< sein sollen, kann nur ein Beobachter subjektiv treffen. Er entscheidet darüber, was dazugehört und was nicht. Nehmen wir an, ein Beobachter steht vor einem großen Parkplatz eines Kaufhauses, um auf seine Frau zu warten, die gerade die Einkäufe erledigt. Er wartet und lässt seinen Blick schweifen. Auf einmal sticht ihm ein roter Porsche inmitten der andern Autos ins Auge, welchen er schon seit geraumer Zeit selbst gerne besitzen würde. In diesem Moment wird das Auto (System) vom Hintergrund (Parkplatz) abgegrenzt. Unser Beobachter nimmt subjektiv diesen Unterschied zur Umwelt wahr. So entsteht in der Welt des Betrachters das Auto. Vorher war es für ihn nicht existent. Jemand, der sich vielleicht nicht für Autos interessiert, würde diese Unterscheidung nicht treffen, für ihn bliebe der Parkplatz, mitsamt des roten Porsches, Umwelt. Mit der Subjektivität des Betrachters ist hier die spezifische Art und Weise gemeint, wie er sich seine Wirklichkeit konstruiert. Eine wesentliche Einflussgröße für die systemische Perspektive ging mit dem radikalen Konstruktivismus einher, der von der Annahme ausgeht, dass Wirklichkeiten erst durch das Denken, Erleben und das Handeln der beteiligten Menschen hervorgebracht werden. Heinz von Foerster postuliert, dass die Umwelt, wie wir sie wahrnehmen, unsere Erfindung ist. Wirklichkeit kann entsprechend nur im Zusammenhang mit dem Beobachter von Wirklichkeit verstanden werden (s.o.). Es interessieren folglich nicht objektive Gegebenheiten, sondern wie jemand seine Wirklichkeit konstruiert. Diese subjektive Wirklichkeit, aus systemischer Sicht eine subjektive Unterscheidung zwischen System und Umwelt, ist Ausdruck des Weltverständnisses und der Lebenskultur des jeweiligen Beobachters. Unterscheidungen entstehen also durch die kognitive Tätigkeit eines Systems. Ein Beobachter kann immer eine Vielzahl von Unterscheidungen treffen. Er muss, um handlungsfähig zu sein, aus dieser Vielzahl der Möglichkeiten die für ihn relevanten Unterschiede auswählen und die bestehende Komplexität reduzieren. Aufbauend auf diese Überlegungen, lässt sich nachvollziehen, dass Bateson Information als einen „Unterschied, der einen Unterschied ausmacht“ definiert (Bateson 1972; zit. n. de Shazer 1998, S. 170).
Da der radikale Konstruktivismus jedoch an anderer Stelle von mir ausführlicher erörtert wird (siehe S.30), soll die kurze Hinführung zum Verständnis des Phänomens der Grenzbildung, durch einen Beobachter, vorerst Genüge tun.
Die Konstruktion eines Systems durch einen außenstehenden Beobachter stellt allerdings nur die eine Seite der Medaille dar. Das System „außenstehender Beobachter“ sieht sich logischerweise nicht immer im Stande, überall und jeden Ortes Unterscheidungen zu treffen. Kommen wir an dieser Stelle zum Beispiel des Beobachters und „seines Autos“ zurück: Wenn er seinen Blick von „seinem“ Auto wegrichtet, oder die Augen schließt und träumt..., existiert dann das System Auto etwa nicht mehr?
„Als Ausgangsleistung jeder systemtheoretischen Analyse, hat, darüber besteht heute wohl fachlicher Konsens, die Differenz von System und Umwelt zu dienen. Systeme sind nicht nur gelegentlich und adaptiv, sie sind strukturell an ihrer Umwelt orientiert und könnten ohne Umwelt nicht bestehen. Sie konstituieren und erhalten sich durch Erzeugung und Erhaltung einer Differenz zur Umwelt, und sie benutzen ihre Grenzen zur Regulierung dieser Differenz“(Luhmann 1984, S. 35).
Luhmann weist also darauf hin, dass die Abgrenzungsleistung zur Umwelt auch eine Leistung des Systems ist. Auch das System differenziert zwischen dem, was dazu gehört und dem, was draußen bleibt, also für es selbst die Umwelt darstellt. Das, was ein System ist, wird also nicht nur, wie es durch die obigen Ausführungen erscheinen mag, über seine Außenwelt definiert, sondern auch durch seine Innenwelt. Das System unterscheidet selbst, welche Elemente und Operationen zu ihm gehören und welche nicht. Diese Operation orientiert sich an der Frage „Wer sind wir, wer sind wir nicht?“ Damit stehen seine Grenzen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Sinn des Systems. Jedes System weist somit seine spezifische Sinnstruktur auf, die die Grenzziehung zur Umwelt bestimmt.
Für die beraterische Tätigkeit folgt aus der Differenz zwischen System und Umwelt die Konsequenz, dass die Umwelt stets mitberücksichtigt werden muss, da wohlmöglich ausschlaggebende Wechselwirkungen mit ihr einhergehen. Wenn dies der Fall sein sollte, so muss der Berater seine konstruierte Unterscheidung zwischen Umwelt und System revidieren und neue relevante Personen mit in das System einbeziehen, um Veränderungen im System bewirken zu können. Unter dem systemischen Gesichtspunkt ist auch die Beratung als ein autonomes System zu verstehen, das einer eigenen operativen Logik folgt, in der der Berater miteingeflochten ist. Darum erscheint die Arbeit mit zusätzlichen Beobachtern (Reflecting Team) durchaus hilfreich.
Der Beobachter, als Teil der Umwelt, trägt den einen Teil, das System selbst, den anderen Teil zur Systembildung bei.
Das System Auto kann diese systemhervorbringende, sinnhafte Unterscheidung jedoch nicht leisten. Es kann nicht sagen, das gehört dazu (zu mir) und das nicht. Unterscheidungsfähigkeit und Beschreibungsfähigkeit sind also die zentralen Elemente eines beobachtenden Systems, unabhängig davon, ob ein System aus der Innenperspektive heraus, ausgehend von seiner spezifischen Sinnstruktur, seine eigene Grenzziehung bestimmt, oder das System aus der Außenperspektive, durch einen externen Beobachter, konstruiert wird.
Folglich kann man also eine Unterscheidung zwischen lebenden und nicht lebenden Systemen treffen. In ihnen gelten völlig andere Dynamiken. Diese Aussage möchte ich an drei Kriterien erläutern.
1. Ludewig (1997, S. 91) besagt, „Komponenten, Relationen und Grenzen entstehen gleichzeitig und begründen die selbstrefentielle Organisation des Systems.“ Somit lassen sich Grenzziehungen, wie auch Komponenten und Relationen nur auf das selbstrefentielle Operieren eines Systems zurückführen (vgl. ebd. , S.90). Ohne die Fähigkeit des selbstreferentiellen Operierens kann man keine Grenzen konstruieren.
Unter Selbstreferenz versteht man, dass ein System in seiner Dynamik immer wieder auf sich selbst zurückkommt, an sich selbst anschließt. Ein System kann nur mit seinen Eigenzuständen operieren. Es arbeitet selbstreferentiell, indem es seine Eigenzustände rekursiv reguliert, es stützt sich dabei nicht auf äußere Bedingungen. Die Dynamik der Selbstreferenz ist somit vorstellbar als ein Wechselspiel zwischen Struktur und Prozess. Ein intern sattfindender Prozess nimmt die momentane Struktur des Systems zum Ausgangspunkt und wird durch sie bestimmt, was zur einer veränderten Struktur führt, die wiederum Ausgangsbasis für einen weiteren internen Prozess darstellt, usw. Unter Referenz ist allgemein das operative Handhaben einer Unterscheidung zu verstehen. Bei dem Prozess der Selbstreferenz ist die Unterscheidung zu sich selbst gemeint, während mit Hilfe der Fremdreferenz, eine Spezialform der Selbstreferenz, eine Unterscheidung zur Umwelt für den innersystemischen Prozess nutzbar gemacht wird. Die Wahrnehmung der Umwelt bauen Systeme in die internen Strukturen ein, diese wird also intern abgebildet und findet demnach auf der Grundlage der internen Systemverhältnisse statt, so dass Umweltreize wirken können, da auch diese Prozesse sich an sich selbst anschließen. Lebende Systeme >wissen< also um ihre Existenz in einer Umwelt, nichtlebende Systeme hingegen nicht, da sie nicht in der Lage sind selbstreferentiell zu operieren.
Für den Berater bedeutet diese theoretische Überlegung, einen möglichen Eingang in die Fremdreferenz zu finden, um so auf der Grundlage der internen Systemverarbeitung, Veränderungen im System zu bewirken.
2. Auf ein weiteres Kriterium, das besagt, wann eine Entität oder ein vorhandenes System ein Lebewesen ist oder nicht, weisen Maturana und Varela (1984, S.48) hin, die sagen „...daß wir eine Idee, und sei sie nur implizit, von seiner Organisation haben. Es ist diese Idee, welche bestimmen wird, ob wir die Frage nach der Lebendigkeit eines Wesens bejahen oder verneinen.“ Die Organisation besteht ihrer Meinung nach darin, dass sich Lebewesen selbst erzeugen und selbst erhalten. Zu dem Moment der Selbstreferenz kommt noch das Moment der Selbsterzeugung und der Selbsterhaltung. Ein kurzer Exkurs soll das Konzept der so bezeichneten Autopoiese verdeutlichen: Wenn zum Beispiel bei einem Autounfall sowohl der Insasse als auch das Auto eine Beule davontragen, ist die Beule des Insassen wahrscheinlich nach zwei Wochen verschwunden, die des Autos, solange man es nicht in die Werkstatt bringt, nicht.
Der Unterschied ist also der, dass lebende Systeme eine Eigendynamik aufweisen, sich permanet selbst (wieder)herstellen und ihre Organisation aufrecht erhalten, nichtlebende Systeme jedoch nicht (vgl. S. 26 f.).
3. Heinz von Foerster konstituierte für die Unterscheidung zwischen lebenden und nicht lebenden Systemen die Begriffe triviale und nicht - triviale Maschine (vgl. Schlippe/Schweitzer 2002, S. 55). Durch die Einführung dieser Begriffe zeigt er ebenso die Notwendigkeit auf, sich endlich vom linearen Ursache- Wirkungs- Denken zu verabschieden, da man es bei Lebewesen nicht mit technischen Apparaten zu tun hat, die sich mit einfachen Korrelationen und linearen Abfolgen exakt messen und planen lassen. Das Verhalten trivialer Maschinen ist dadurch gekennzeichnet, dass es für einen Beobachter potentiell völlig durchschaubar und steuerbar ist. Man ist als Beobachter in der Lage, bestimmten Eingangszuständen bestimmte Ausgangszustände zuzuordnen. Triviale Maschinen funktionieren nach dem einfachen Prinzip der Kausalität. Eine bestimmte Ursache x hat eine bestimmte Wirkung y zur Folge. Ein triviales System ist in seiner Funktion also vorhersagbar und seine Verknüpfungen eindeutig. Viele Maschinen und Geräte folgen diesem Prinzip: drehe ich den Zündschlüssel meines Autos (Ursache), springt mein Auto an (Wirkung), schalte ich mein Autoradio per Knopfdruck an (Ursache), ertönt Musik (Wirkung), drücke ich auf die Hupe (Ursache), höre ich mein Hupsignal (Wirkung), usw. Alle diese Wirkungen sind für einen Autofahrer nicht überraschend, sondern eindeutig vorhersehbar. Heinz von Foerster definiert triviale Systeme dadurch, dass sie synthetisch determiniert, analytisch bestimmbar, vergangenheitsunabhängig und voraussagbar sind (vgl. Barthelmess 2001, S. 15). Heinz von Foerster relativiert diese Aussage in späteren Ausführungen jedoch, indem er behauptet, dass triviale Maschinen, im Sinne von realen Maschinen, lediglich eine Fiktion seien. Denn der Begriff „Maschine“ ist leicht substanziell aufzufassen, obwohl dieser Begriff nur die operative Funktionseinheit, die ein Input- Output-Verhältnis herstellt, bezeichnet. Das kann zwar unter bestimmten Bedingungen auf eine reale Maschine, wie das Radio zutreffen, wobei man aber bei diesem die Funktionseinheit auch nicht direkt erkennen kann. Foerster (1997) verdeutlicht diese Aussage an dem Beispiel eines Steines: Wenn jemand einen Stein in der Hand hält, diese öffnet und der Stein zu Boden fällt, ist nicht der Stein trivial, vielmehr ist das Verhältnis von Input, also dem Öffnen der Hand, und Output, das Fallen des Steines, das Triviale. Als Begründung für die Trivialität kann in diesem Fall die Gravitation herangezogen werden. Somit lässt sich sagen, dass Trivialität immer nur in einem bestimmten Kontext gilt. In Foersters Beispiel stellt die Gravitation, ohne den Einfluss anderer relevanter Bedingungen, den entscheidenden Kontext dar.
Nichttriviale Systeme, wie Organismen, physische Systeme und soziale Systeme weisen eine Eigendynamik auf, die nicht voraussagbar und beeinflussbar ist, da sie mehrere innere Zustände aufweisen, während triviale Maschinen nur einen inneren Zustand haben. Von diesen inneren Zuständen hängen die jeweiligen Operationen des Systems ab. Ein derartiges System stellt bei jedem Umweltkontakt (Input) gleichzeitig einen Kontakt zu sich selbst her und verändert somit immer wieder von Neuem seine innere Struktur. Diese schafft wieder eine neue Ausgangsbasis für die nächste Wirkungsweise, die wiederum die nächste Ausgangsbasis für die nächste Wirkungsweise darstellt usw. (vgl. Barthelmess 2001, S. 17). Damit verweist er, wie Ludewig, auf die Selbstreferenz von lebenden Systemen. Lebende Systeme verfügen also über eine unzählige Bandbreite von Möglichkeiten auf Umweltkontakte zu reagieren. Hat eine Person zum Beispiel schlecht geschlafen, ist zu spät zur Arbeit gekommen und befindet sich aufgrund dessen in einer sehr schlechten Verfassung, kann man ihr einen urkomischen Witz erzählen und man bringt sie nicht zum Lachen. Trifft man diese Person aber abends in einer geselligen Atmosphäre und erzählt ihr diesen urkomischen Witz, kann es sein, dass sie sich vor Lachen krümmen muss.
Nichttriviale Maschinen lassen sich durch vier Merkmalen kennzeichnen. Sie sind, wie triviale Systeme auch, synthetisch determiniert, hingegen aber analytisch unbestimmbar, vergangenheitsabhängig und unvoraussagbar (vgl. ebd., S. 17).
Für die praktische Arbeit in der Beratungssituation bedeutet dies, dass das System niemals entsprechend der Planungen und Absichten des Beraters reagiert. Die gegenwärtige Struktur des Systems legt fest, welche Veränderungen möglich sind und wie es in bestimmten Situationen reagiert, welche für den Berater unvorhersehbar sind und in ihn das sogenannte Therapeutendilemma versetzen: “Handele wirksam, ohne je im voraus zu wissen wie, oder zu welchem Ergebnis es führen wird!“ (Ludewig 1988, S.237 )
Innerhalb sozialer Systeme, wenn man davon ausgehen würde, dass sie wirklich existieren, würden sich ab einem gewissen Komplexitätsgrad Subsysteme ausbilden (vgl. Schlippe/Schweitzer 2002, S. 57). Je mehr Elemente (Interaktionen) innerhalb des Gesamtsystems nun gebildet werden, desto mehr Relationen entstehen, wobei irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem nicht mehr alle Elemente in Verbindung gebracht werden können. An diesem Punkt angelangt, unterliegt das System einem Selektionszwang. Damit ist gemeint, dass das System die Umweltkomplexität insofern verarbeitet, als dass sie nur spezifische sinnvolle Umwelteinflüsse, damit meine ich auch Einflüsse aus der Innenwelt des Gesamtsystems, aufnimmt und andere außen vorlässt, schlussfolgernd also emergente Eigenschaften besitzt. Emergenz bedeutet hier, die selektive Verknüpfung von Elementen des Systems.
Es bilden sich also Systeme im System. Auf diese Art und Weise wird der Unterschied weiter unterschieden, was genau genommen bedeutet, dass die Differenz zur „Umwelt“ (Innenwelt des Gesamtsystems) intern weiter differenziert wird. Diese Differenz basiert, wie schon erwähnt, auf der spezifischen Sinnverarbeitung der unterschiedlichen Systeme. Die Subsysteme besitzen unterschiedliche Blickwinkel zum Restsystem. Unterscheidungskriterien hierbei können zum Beispiel das Alter der Zielgruppe sein, differente Hobbys und Vorlieben, unterschiedliche Aufgabenbereiche innerhalb eines großen Unternehmens, usw. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten der Subsystembildung. Innerhalb einer Schulklasse können sich zum Beispiel unterschiedliche peer-groups bilden. Nach außen hin kann man diese Schulklasse wiederum als Teil eines größeren Systems sehen, in das es eingebettet ist. So ist die Schulklasse wiederum Teil der Schule, diese ist Teil des Schulsystems, das Schulsystem ist Teil unseres Bildungssystems, usw.
Systeme bilden Subsysteme aus, um ihre stabile Struktur zu erhalten, denn bei einem zu hohen Vernetzungsgrad ohne Subsystembildung sinkt ihre Stabilität (vgl. Schlippe/Schweitzer 2002, S. 57). Jedoch erhöhen Systeme durch die Subsystembildungen ihren Komplexitätsgrad, was aber zum Ziel hat, ihre Umweltkomplexität besser zu verarbeiten. Subsystembildung bedeutet somit nicht die Komplexität zu steigern, sondern eine andere Art von Komplexität herzustellen, die intern organisiert und handhabbar ist. Systeme weisen immer eine Komplexitätsunterlegenheit gegenüber der noch viel komplexeren Umwelt auf, auch dann, wenn die Systeme noch so stark ausdifferenziert sind. Dieser Komplexitätsunterschied besitzt jedoch für soziale Systeme einen sinnvollen Bestandteil, denn er dient ihnen dazu, mit internen und externen Einflüsse verschiedenartig zu operieren. Interne Einflüsse sind für das System relevanter als externe. Systeme reagieren auf viele externe Veränderungen bemerkenswert gering, sie bleiben sogar oftmals völlig ungeachtet.
Je mehr Subsysteme sich innerhalb eine Gesamtsystems gebildet haben, umso komplexer ist jedoch die Struktur, mit der ein Berater konfrontiert wird.
Auch wenn das System nicht alle Möglichkeiten der Verknüpfungen wählt, also viele Beziehungsalternativen ungeachtet bleiben, sind diese dennoch als potenzielle Möglichkeiten vorhanden. Diese Handlungsmöglichkeiten und Freiheitsgrade des Systems, das >Auch- anders- möglich- Sein<, bezeichnet man als Kontingenz (vgl. Barthelmess 2001, S. 29-31).
Für den Berater bedeutet dies, dass er versuchen muss, nicht genutzte kontingente Möglichkeiten zu aktivieren und zu erschließen.
Um den Versuch der Begriffsbestimmung an dieser Stelle abzuschließen, möchte ich kurz auf die mit diesem Unterfangen verbundenen Schwierigkeiten aufmerksam machen. Da der Gegenstand, den ich an dieser Stelle zu klären suchte, sehr komplex und zirkulär >ist< und sich Klärungsversuche niemals durch lineare Verkettungen (wie es die Schriftsprache erzwingt) vollständig darstellen lassen, war ich gezwungen, in meinen Ausführungen, die oben schon benannte „komplexitätsleistende Komplexitätsreduzierung“ zu betreiben und mich zudem oftmals der Kybernetik 1. Ordnung zu bedienen, die der Vorstellung unterliegt, sagen zu können, wie ein System >wirklich ist<. Außerdem hätte ich wider des systemischen Denkens gehandelt, wenn ich versucht hätte, den Systembegriff ausschließlich ontologisch zu definieren, auch wenn dies an einigen Stellen sicherlich so erscheinen mag. Meine gesamten Ausführungen müssen daher als Beschreibungen und nicht als faktische Darstellungen verstanden werden.
Ich hoffe aber, an dieser Stelle zumindest wichtige Aspekte, die ein System >kennzeichnen<, aufgezeigt zu haben, wobei ich in meinen Ausführungen zum Ende hin verstärkt soziale Systeme unter die Lupe genommen habe, da gerade sie es >sind<, die mein folgendes Gegenstandsfeld ausmachen.
Im Folgenden werden sich für den Leser sicherlich noch weitere system- kennzeichnende Aspekte herauskristallisieren.
1.2 Was bedeutet das Zauberwort „systemisch“?
Das Wort „systemisch“ hat zur Zeit Hochkonjunktur. Oft genug wird „systemisch“ als Füllwort benutzt, um im Trend der Zeit bestehen zu können.
Man hat auf die Frage, was unter „systemisch“ zu verstehen ist, wohl so viele Antworten, wie es Menschen gibt, die sich mit diesem Denkansatz befassen. Die Einen glauben, systemisches Denken könne Ordnung und Struktur in das menschliche Chaos bringen, die Anderen glauben, durch lösungsorientierte Beratung gleich zu einer Lösung des Problems schreiten zu können, ohne überhaupt am >Problem< ansetzen zu müssen.
Auszugehen davon ist aber, dass alle mit ihren mannigfaltigen Vorstellungen mehr oder weniger Recht haben und Teilaspekte eigentlich immer auf die Systemtheorie zutreffen (vgl. Schlippe/Schweitzer 2002, S. 50-51).
So kann man wohl behaupten, dass es den > einen< systemischen Denkansatz ebenso wenig gibt, wie es die > eine< Definition für ein System gibt, da „systemisch“ ein Adjektiv zu „System“ ist und ebenso eine allgemeine Bezeichnung mit einer kaum abgrenzbaren Bedeutung darstellt. Schlussfolgernd resultiert daraus, dass das Gegenstandsfeld ebenso komplex und zirkulär ist, wie sein Gegenstand selbst.
Das Adjektiv „systemisch“ kennzeichnet aber im Verständnis aller neueren Systemtheoretiker eine allgemeine Sichtweise der Welt, die mit Hilfe eines konstruktivistischen Verständnisses von Systemen diese zur Einheit ihres Denkens macht. Systemisches Denken macht sich demnach die Grundfragen menschlicher Existenz zu ihrem Aufgabenfeld und versucht diese mit Hilfe der systemwissenschaftlichen Erkenntnisse zu beantworten. Dieser Denkansatz setzt auf der metatheoretischen Ebene des Erkennens und des Seins an. Systeme gelten als Konstrukte der menschlichen Erkenntnis (Kognition). Aufgrund ihrer Abhängigkeit von ihrer Kognition gibt es keine linear-kausalen Verkettungen, sondern Erkennen folgt der zirkulären Bewegung von Beobachten und Denken. Jeder Mensch ist demzufolge der Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeit. Bezogen auf die Ontogenese, die Frage nach dem Sein, unterliegen Systeme immer einem strukturellen Wandel, „entweder ausgelöst durch aus dem umgebenden Milieu stammende Interaktionen oder als Ergebnis der inneren Dynamik einer Einheit“(Maturana/Varela 1987, S. 84). Diese Überlegung kann man sehr schön durch die Metapher des Mobiles verdeutlichen. Die systemische Betrachtungsweise sieht jedes Ereignis, jede Kommunikation und jeden Teil eines Klientensystems mit anderen vernetzt. Zieht man an einem Strang, ist das ganze Mobile in Bewegung. Der Zusammenhang der wechselseitigen „Verstörung“ wird in der systemischen Betrachtungsweise ausdrücklich mit einbezogen. Demzufolge versucht man aus dieser Perspektive herauszufinden, welche Elemente des Mobiles mitbetrachtet und welche Elemente ggf. irritiert werden müssen. Dieser Denkrahmen bietet vor allem der systemischen Beratung die Möglichkeit, die zwischen-menschlichen Zusammenhänge einzuordnen und nach Möglichkeiten, die zur Überwindung eines Problems dienen können, zu suchen. Systemisch verweist hier demzufolge auf einen allgemeinen theoretischen Rahmen, als auch auf die darauf gestützten Anwendungsformen der systemischen Praxis (vgl. Ludewig 2002, S.16-17).
Im direkten Umfeld des Adjektivs >systemisch< liegen Konzepte wie Kybernetik, Synergetik, Selbstorganisation, Selbstreferenz und radikaler Konstruktivismus. Diese Ansätze variieren alle ein Thema und unterscheiden sich meist nur im Sprachgebrauch ihrer Ursprungsdisziplinen. Diese Konzepte möchte ich im Folgendem in einem historischem Abriss skizzieren.
1.3 Entwicklungsgeschichte der systemtheoretischen Grundlagen
Wie schon in meinen obigen Ausführungen skizziert, setzte sich das systemtheoretische Denken in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in mehreren Wissenschaftszweigen durch. Man darf dieses Denken aber nicht als einheitlich betrachten. Vielmehr umfasst es unterschiedliche Ansätze, Konzepte und Theorien mit unterschiedlichsten Schwerpunkten. Systemisches Denken war und ist heftig in Bewegung. An dieser Stelle würde es kaum möglich sein, den gesamten Abriss der unterschiedlichsten Auffassungen zu skizzieren, da dies sicherlich den Rahmen meiner Arbeit sprengen würde. Vielmehr konzentriere ich mich auf prägende der Geschichte entwachsenen Konzepte, die auch in jüngster Zeit besonders diskutiert wurden/ werden und einem auch heute noch hilfreich zur Seite stehen können, wenn man sich bezüglich der „alten Ideen“, wie z.B. der Kybernetik 1. Ordnung, auch stets der „neueren Ideen“ besinnt. Wenn man sich mit diesem Bewusstsein beispielhaft der Kybernetik bedient, um in komplexen Situation handlungsfähig zu bleiben, muss man sich dabei stets die „neuere Idee“ vor Augen halten, dass die zwischenmenschliche Wirklichkeit immer mehr beinhaltet, als die Informationen, die durch diese Theorie erfasst werden kann. Dennoch hilft sie, die Komplexität der „realen“ Situation sinnvoll zu reduzieren, ohne dass wichtige Wechselwirkungen ausgeklammert werden.
Systemische Geschichtsschreiber bezeichnen die Phase zwischen 1950 und 1980 oftmals als die Kybernetik 1. Ordnung (vgl. Schlippe/Schweitzer 2002, S. 53). Die Kybernetik wurde in den 50er Jahren von den anfänglichen systemtheoretischen Wellen aufgegriffen und genoss große Anerkennung. Der Begriff wurde 1948 von dem amerikanischen Mathematiker Norbert Wiener geprägt, der sich mit der wissenschaftlichen Untersuchung systemischer Prozesse unterschiedlichster Natur befasste. Der Kybernetik liegt die Annahme zugrunde, dass Steuerung, Kontrolle und Regelung bei Maschinen, Organismen und sogar bei sozialen Systemen möglich sei. Vor allem Gregory Bateson erkannte die Bedeutung der Kybernetik für das Verständnis aber auch für die Beeinflussung komplexer menschlicher Beziehungen. So wurde das Konzept der Kybernetik auch schon sehr früh in die Familientherapie aufgenommen.
Das ursprüngliche Anliegen war es, objektive Aussagen über Systeme und ihr Verhalten zu machen (vgl. Simon et al. 1999, S. 192).
Die kybernetische Analysemethode schien der komplexen Wirklichkeit angemessener, als die vorherrschende Ursache-Wirkungs-Erklärung. Beziehungen als dauerhafte Interaktionen konnten mit der vorherrschenden Denkweise nicht hinreichend beschrieben werden. Bei der Frage nach den Beweggründen von Menschen für bestimmte Verhaltensweisen schien ein einfaches „weil“ im Laufe der Entwicklung unangemessen. Es wurde deutlich, dass im Bereich der Kommunikation keine einzelnen Ursachen als Begründung herangezogen werden konnten, da die letzte Information immer nur den Endauslöser darstellt und die Vergangenheit im gegenwärtigen Verhalten immer vorausgesetzt ist. Auch kann die Interaktion zwischen zwei Personen nicht auf eine von beiden reduziert werden, da jeweils ein Verhalten das andere bewirkt und umgekehrt. Als Beispiel kann hier eine Lehrer-Schüler- Beziehung dienen. Ein Lehrer ärgert sich über das desinteressierte Verhalten eines Schülers und fordert diesen heraus, etwas zum Unterrichtsgeschehen beizutragen. Der Schüler seinerseits hat Angst, etwas falsch zu machen, zieht sich zurück und schweigt, woraufhin der Lehrer noch mehr Beteiligung einfordert. Daraufhin fühlt der Schüler sich noch mehr unter Druck gesetzt und hüllt sich noch mehr in Schweigen. In diesem „Teufelskreis“ wird die Zirkularität einer solchen Situation verdeutlicht. Das Verhalten des Einzelnen ist sowohl Ursache als auch Wirkung. Ein zwischenmenschlicher „Teufelskreis“ kann als ein kybernetischer Regelkreis beschrieben werden. Meine Überlegungen stützen sich hierbei auf ein berühmtes Beispiel von Bateson, der sehr anschaulich anhand einer Thermostatsregelung Rückkopplungsschleifen und zirkuläre Vernetzungen zu beschreiben versucht, die ich an dieser Stelle auf eine zwischenmenschliche Beziehung übertragen habe (vgl. Barthelmess 2001, S. 13).
Ursachebeschreibungen würden diesem Teufelskreis nicht annähernd gerecht werden. Interessant an dieser Denkweise ist, dass sich beide Personen gegenseitig regulieren, sie sich aber beide hilflos in ihrer Einflussnahme bezogen auf die andere zeigen. Die Kybernetik kann helfen, die impliziten Regeln und Wechselwirkungen zu erkennen und zu deuten.
Wenn man auf diese Phase zurückschaut, fällt auf, dass dieses Konzept dem Glauben unterliegt, man könne sagen, wie ein System >wirklich ist<. Zudem glaubte man in dieser Zeit daran, Systeme von außen steuern, regulieren und kontrollieren zu können. Diese Prämisse war eng verwoben mit dem der Kybernetik zugrundeliegenden Homöostasekonzept, dessen Kernfrage es war, wie Systemparameter unter wechselnden Umweltbedingungen konstant gehalten werden können, also die Frage nach der Möglichkeit der Erhaltung eines Gleichgewichtszustandes. Homöostase wird durch negatives Feedback sichergestellt. Dies bedeutet, dass eine Abweichung vom Gleichgewichtszustand wahrgenommen wird, die daraufhin durch eine regulierende Handlung in Richtung des Sollzustandes korrigiert wird. Wenn zum Beispiel die Batterie unseres Autos fast leer ist, laden wir sie wieder auf, der Sollzustand wird also wieder hergestellt.
Positives Feedback hingegen bedeutet, dass auf die Rückmeldung einer Abweichung vom Sollzustand, die darauf folgenden Handlungen das System noch weiter vom Gleichgewichtszustand, wohlmöglich in Richtung Eskalation, entfernen (vgl. Schlippe/Schweitzer 2002, S. 61).
Auf Familiesysteme wurde das Konzept der Homöostase erstmals von Don. D. Jacksons im Jahre1957 angewandt. Er verwendete den Begriff vorrangig, um pathologische Mechanismen, bzw. Systeme zu beschreiben. Da derzeit aber nur der Fokus auf Mechanismen der Strukturerhaltung und nicht auf die der Strukturveränderung gerichtet wurde, entfachte in letzter Zeit zunehmend eine Diskussion darüber, ob dieser Begriff überhaupt noch einen sinnvollen Platz in der systemischen Therapie und Beratung einnehmen kann (vgl. Simon et al. 1999, S. 135).
Der Begriff Struktur hat in der neueren Systemtheorie mittlerweile keine vorrangige Bedeutung mehr, da auch Strukturen der Veränderung unterliegen, obwohl sie ja gerade Stabilität erklären sollen. Nach Maturana sind Strukturen Bestandteile und Relationen, die in konkreter Weise eine bestimmte Einheit konstituieren und ihre Organisation (Autopoesie) verwirklichen. Menschliche Veränderung bedeutet Veränderung von Strukturen, wobei die Organisation aber erhalten bleibt (vgl. Maturana/Varela 1984, S. 54).
Der in dieser Phase einhergegangene Glaube, dass komplexe Systeme plan- und steuerbar sind, erwies sich sehr bald als Irrglaube. Zumal im Bereich der Familientherapie die Vorstellung der guten „normativen“ Familie zunehmend hinterfragt wurde. Welcher Therapeut kann sich anmaßen, einer Familie homöostatische Mechanismen aufzuzwingen und sie in die Richtung zu zwingen, die er für richtig und normativ hält? Das Homöostasekonzept setzt einen Idealzustand voraus, den die Klienten zu erreichen haben, sie scheinen also ständig korrekturbedürftig. Positive Konnotation (s. S. 97) wäre demnach gar nicht möglich. Auch ist der Glaube daran, eine Kontrolle über mögliche entstehende Muster zu besitzen, nicht mehr vertretbar. Das System sucht sich den eigenen Bedingungen gemäß einen neuen Attraktor[2], wie es sich letztendlich verhält, ist nicht von außen bestimmbar (vgl. Schlippe/Schweitzer 2001, S. 64).
Man entfernte sich von dem Homöostasekonzept und es wurde als Zentralbegriff nach und nach abgelöst. Grund hierfür waren die wissenschaftlichen Entwicklungen in den unterschiedlichen Bezugswissenschaften.
Die mit dem Homöostasemodell einhergegangene Vorstellung, dass Ordnung immer nur von außen hergestellt werden kann, ließ viele Wissenschaftler der Frage nachgehen, ob es überhaupt noch eine andere Form von Ordnung gäbe und wenn ja, wie Systeme ihre eigene Ordnung organisieren.
Chemiker gingen lange Zeit davon aus, dass jede chemische Reaktion zweier oder mehrerer Stoffe zu einem zeitunabhängigen statischem Endergebnis führen würde. Erst Ilya Prigogine gelang das Unglaubliche. Er entdeckte Ende der 70er Jahren, wie Strukturen aus Unordnung und Chaos, fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht selbstorganisiert entstehen können. Das meint, dass in offenen Systemen aus Abweichungen von einem stabilen Gleichgewichtszustand, unter Energieverbrauch, neue Ordnungen, sogenannte dissipative[3] Strukturen, entstehen (vgl. Kriz 1999, S. 61f.).
Der Erkenntnisgewinn für eine Übertragung auf Familiensysteme lag darin, dass gerade die zufälligen Abweichungen vom Gleichgewicht, Familien und Individuen in neue, nicht voraussagbare Zustände versetzen. Die Abweichung wurde also zum wesentlichen strukturierenden Faktor. Während das Homöostasekonzept davon ausging, dass jegliches Verhalten zielgerichtet sei, wird hier der ziellose Charakter von Veränderungen postuliert (vgl. Simon et al. 1999, S. 112). Zufällige Verhaltensweisen können somit eine neue Form der Stabilität erzeugen, sofern das System sich vorher vom Gleichgewichtszustand entfernt hat. Diese neue Form der Stabilität ist unvorhersehbar und unerforschbar. Das System kann unterschiedlichste Zustände einnehmen, die sich jeglicher Kontrolle von außen entziehen. Interventionen von außen sind demnach vielmehr als Anregungen zu verstehen und nicht als die Möglichkeit einer gezielten Veränderung. Hier wird wieder einmal deutlich, wie wenig hilfreich es war, mit dem Ursache- Wirkungs-Denken zu operieren.
Ab diesem Zeitpunkt interessierte man sich nicht mehr in dem Maße wie vorher für das Gleichgewicht, sondern vielmehr für die Veränderungen in Systemen, welche spontan und oft irreversibel von einem Zustand in den nächsten rutschen. Diesen Vorgang bezeichnet man als Phasenübergang. Der Schlüsselbegriff „Homöostase“ wurde durch den Schlüsselbegriff „Ordnung durch Fluktuation[4]“ ersetzt (vgl. Schlippe/Schweitzer 2002, S. 51).
Kurze Zeit später wurde zudem in der Physik die „Synergetik“, die „Lehre vom Zusammenwirken“, als ein interdisziplinärer Ansatz von Hermann Haken entwickelt. Hier untersuchte man, wie in einem System die Elemente zusammenwirken und miteinander kooperieren und ihr Verhalten selbst organisieren, so dass sich für das Ganze eine Struktur ergibt, die neue Eigenschaften aufweist. Haken sagt, dass die spontane Entstehung geordneter Strukturen in offenen Systemen kein Einzelphänomen ist, sondern überall in der Natur und Technik vorzufinden ist, also überall dort ein Übergang von Chaos zur Ordnung stattfindet, ohne dass irgend jemand von außen diese Ordnung vorgibt (vgl. Simon et. al 1999, S. 318). So kann man sagen, dass „ein >kooperatives Verhalten< der Teile zur Selbstorganisation des Gesamtsystems beiträgt“ (vgl. Schlippe/Schweitzer 2002, S64). Diese spontan entstandenen Strukturen und Regelmäßigkeiten können, mittels Variationen der Randbedingungen, so verändert werden, dass das System in einen neuen qualitativen Zustand übergeht (Phasenübergang).
Das Konzept der Synergetik besagt zudem, dass die Ordnung in verschiedenen Systemen durch sogenannte „Ordner“ bestimmt wird. Damit sind bestimmte Strukturen gemeint, die zwar durch die Elemente erzeugt werden, sie aber wiederum „versklaven“, indem sie dem Verhalten der Elemente ihre Ordnung aufzwingen. Hierbei haben wir es mit einem zirkulären Wechselwirkungsprozess zu tun. Übertragen auf ein Gespräch, kann man die Sprache als einen langsam veränderlichen Ordner ansehen, der jedem Menschen, der sich seiner bedient, seine Gesetzmäßigkeiten aufzwingt. Die Menschen stellen die schnell veränderlichen Größen dar, die von der langlebigen Größe Sprache versklavt werden. Die Sprache kann sich aber ohne das Vorhandensein der Menschen nicht erzeugen; Sprache und Menschen bedingen sich demnach gegenseitig.
Übertragen auf den Beratungskontext bedeuten die Erkenntnisse der Synergetik, dass man den Versuch wagen sollte, mittels „Verstörung“, Instabilität in das System „einzuschleusen“, damit das System in einen neuen Ordnungszustand übergehen kann. Welches dieser neue Zustand letztendlich sein wird, ist jedoch nicht von außen determinierbar. So können kleine Einflüsse große Wirkungen auf das System haben und große Einflüsse gegebenenfalls gar nichts bewirken. Die Provokation des Phasenüberganges in einen neuen qualitativen Zustand stellt, innerhalb einer Beratung, den energieaufwendigsten Schritt dar (vgl. Schlippe/Schweitzer 2001, S. 65f.).
Die synergetische Systemkonzeption weist große Vorteile auf, da sie ihre Brauchbarkeit in vielen Bereichen belegen konnte, gleichwohl hat sie aber einen vordergründigen Nachteil, denn die synergetischen Konzepte wurden lange Zeit nur mit komplizierten Differentialgleichungen und mathematischen Formalismen verfasst. Wahrscheinlich ist dies auch einer der Gründe, warum die gegenwärtigen systemwissenschaftlichen Diskussionen vorrangig durch das Konzept der „Autopoise[5]“ bestimmt werden.
Dieser Begriff wurde Anfang der 70er Jahre von Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela eingeführt, um zunächst die Funktion lebender Zellen zu beschreiben, insbesondere ihre Abgrenzung (durch die Membran) und ihre autonome operative Selbstproduktion der Bestandteile (z.B. Zellkern) mittels eben dieser Bestandteile. Entsprechend definieren sie „Autopoise“, ihr Kriterium für alles Lebende, als einen selbstreferentiellen Erzeugungsprozess von Bestandteilen, die wiederum rekursiv an der Produktion der Bestandteile mitwirken. Das heißt, die Bestandteile eines lebenden Systems produzieren sich durch ein Netzwerk von Prozessen, das seinerseits durch die Bestandteile dieses lebenden Systems selbst erzeugt ist. Autopoietische Systeme zeichnen sich demnach durch eine operationale Geschlossenheit aus. Geschlossen deshalb, da ihr einziger Zweck darin besteht, sich selbst zu reproduzieren. Sie können also nur mit ihren Eigenzuständen operieren und nicht mit systemfremden Bestandteilen. Damit besitzen autopoietische Systeme keine „objektiven“ Input- und Outputoberflächen. Gegenüber der operationalen Geschlossenheit kennzeichnen sie sich zudem durch eine materielle und energetische Offenheit aus. Die Formen des Austausches zwischen System und Umwelt werden von der geschlossenen Organisationsweise des autopoietischen Systems festgelegt. Hier wird deutlich, dass autopoietische Systeme zwar autonom, aber nicht autark sind. Autark aus dem einfachen Grunde nicht, da sie auf materielle und energetische Zufuhren aus ihrer Umwelt angewiesen sind. Autonom deswegen, da die Aufnahme bzw. Abgabe von Materie und Energie allein von den internen Systemoperationen bestimmt wird.
Maturana und Varela definieren autopoietische Systeme dadurch, dass sie invariant (unveränderlich) bezüglich ihrer Organisation (Autopoiese), aber variabel (veränderlich) bezüglich ihrer Strukturen seien (vgl. Simon et al. 1999, S. 39). Die Entstehung und Aufrechterhaltung eines lebenden Systems setzt also eine Strukturveränderung voraus, bei der aber die Organisation bewahrt wird. Mit dem Begriff „Struktur“ beschreiben die Autoren die Bestandteile und Relationen, „die in konkreter Weise eine bestimmte Einheit konstituieren und ihre Organisation verwirklichen. So besteht die Organisation zur Steuerung des Wasserpegels in einem Spülkasten des Wasserklosetts aus den Relationen zwischen einem Gerät, das fähig ist, den Wasserfluß zu unterbinden. Im häuslichen WC wird diese Geräteklasse heute mit einem System aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff und Metall verwirklicht, das aus einem Schwimmer und einem Durchflussventil besteht. Diese besondere Struktur könnte aber dadurch verändert werden, daß der Kunststoff durch Holz ersetzt wird, ohne daß damit die Organisation, die das Ding zu einem Spülkasten macht, betroffen wäre“ (Maturana/Varela 1987, S. 54).
[...]
[1] In meiner Arbeit entschied ich mich, um die Lesbarkeit nicht zu sehr zu beeinträchtigen, für die männliche Form, womit aber natürlich beide Geschlechter gemeint sind.
[2] „Attraktor“ (ein aus der Chaostheorie übernommener Begriff) ist ein Synonym für „Eigenverhalten“. Das Eigenverhalten eines Systems ist das Ergebnis der selbstreferentiellen Operation des operational geschlossenen Systems, mit denen es seine Identität herstellt.
[3] von lat. dissipare= zerstreuen, verbrauchen
[4] von lat. fluctuatio= unruhig Bewegung
[5] von griech. autos= selbst, poiesis= Produktion, Arbeit
- Arbeit zitieren
- Silke Modder (Autor:in), 2003, Theoretische Grundlagen systemischen Denkens und mögliche Implikationen für die Praxis an ausgewählten Beispielen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39749
Kostenlos Autor werden


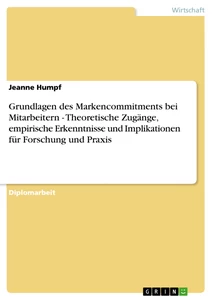







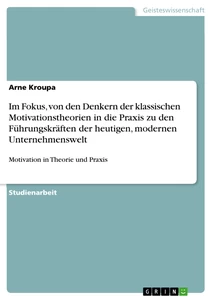










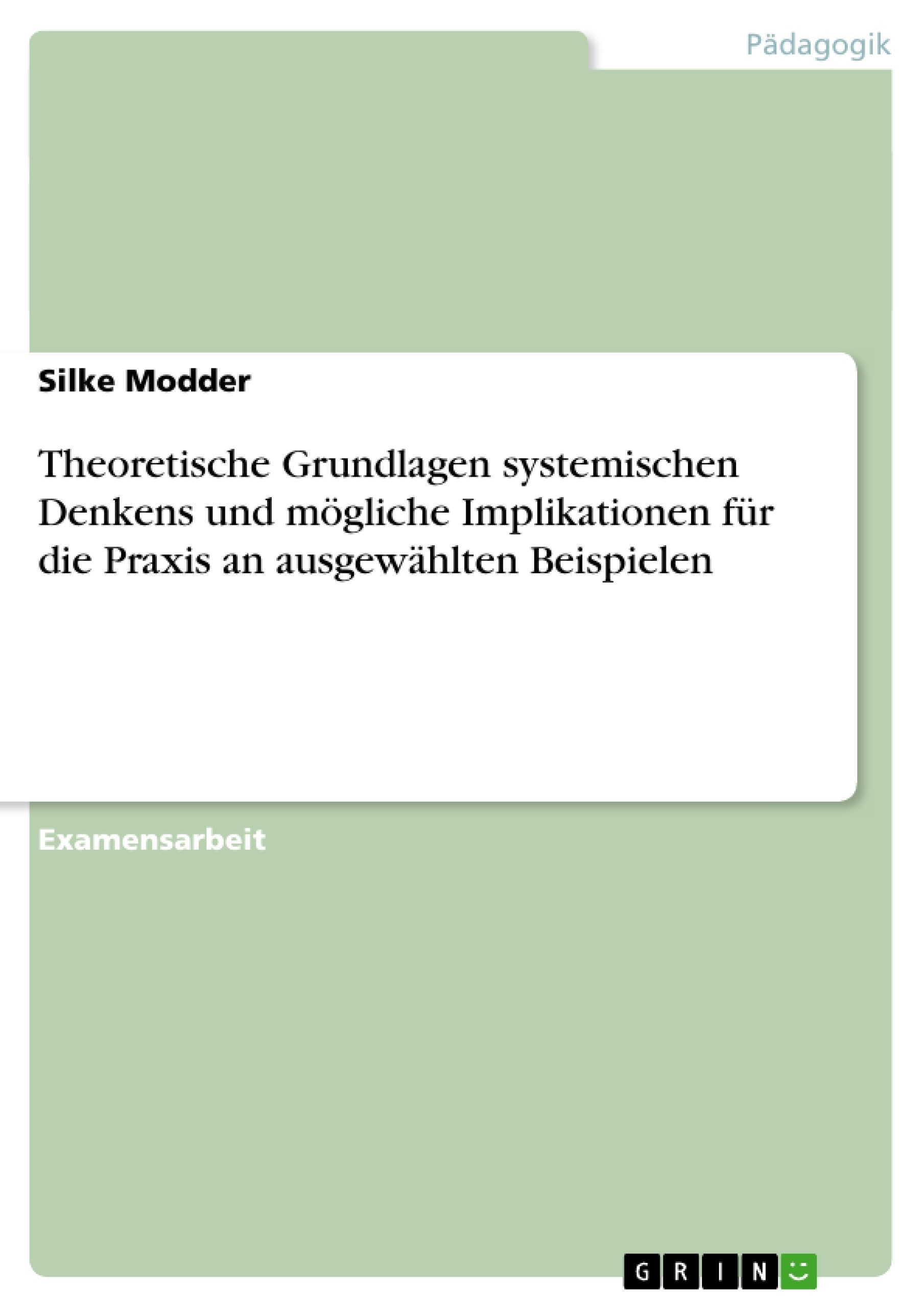

Kommentare