Leseprobe
Inhalt
Einleitung
I
1. Psychologische und arbeitspsychologische Aspekte von Stress und Stressbewältigung
1.1 Begriffsklärung
1.2 Stimuluskonzepte
1.3 Reaktionskonzepte
1.4 Transaktionale Konzepte
1.4.1 Das P-E-fit-Modell
1.4.2 Der transaktionale Ansatz von R. S. Lazarus
1.4.3 Ungewissheit
1.5 Spezifische Stressoren am Arbeitsplatz
1.6 Ressourcen bei der Stressbewältigung
1.6.1 Situationskontrolle
1.6.2 Soziale Unterstützung
1.7 Strategien zur Stressvermeidung und Stressbewältigung
1.8 Zusammenfassung
2. Schizophrene Psychosen
2.1 Begriffsklärung vor dem historischen Hintergrund
2.2 Epidemiologie
2.3 Symptome und Diagnoseleitfaden
2.4 Verlauf und Prädiktoren
2.5 Ätiologie
2.5.1 Ansätze der Schizophrenieforschung und Modellvorstellungen
2.5.2 Vulnerabilitätstheorie als integratives Modell
2.6 Therapeutische Ansätze
2.7 Zusammenfassung
3. Hilfen auf dem Weg in berufliche Integration für psychisch kranke Menschen
3.1 Überblick über die Hilfelandschaft
3.2 Aspekte der berufsbezogenen Rehabilitation
3.2.1 Das Bedürfnis nach Arbeit
3.2.2 Das Recht auf Arbeit
3.2.3 Gewinn und Belastungen durch Arbeit
3.2.4 Die tatsächliche Arbeitssituation psychisch kranker Menschen
3.3 Berufliche Rehabilitation
3.3.1 Zielgruppe und Zielsetzung
3.4 Das Berufliche Trainingszentrum
3.4.1 Zugangsvoraussetzungen und Zusammensetzung des Personenkreises
3.4.2 Leistungsangebote und Ablauf der Maßnahme
3.4.3 Multiprofessionalität der Betreuer
3.4.4 Ergebnisse der Maßnahme
3.5 Zusammenfassung
II
1. Untersuchung und Methode
2. Auswertung der Gespräche
2.1 Zusammenhang von Stress und Erkrankung; Relevanz des Themas
2.2 Auswirkungen von Stress
2.2.1 Angenehme Auswirkungen von Stress
2.2.2 Unangenehme Auswirkungen von Stress
2.3 Welche Situationen führen zu bzw. sind Stress?
2.3.1 "Angenehme" Reize, die zu Belastungen führen
2.4 Maßnahmen zur Stressprävention
2.5 Maßnahmen zur Reaktion auf Stress / Copingstrategien
2.6 Erfahrungen und Umgang mit Stress im Beruflichen Trainingszentrum
2.6.1 Stress im BTZ
2.6.2 Intervention bei Stress
2.6.3 Thematisieren von Stress im BTZ
2.6.4 Der Stressbewältigungsplan
2.6.5 Umsetzung der Präventions- und Reaktionsstrategien
3. Diskussion
4. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Andere Quellen
Anhang
Leitfaden für die Experteninterviews mit Mitarbeitern
Leitfaden für die Experteninterviews mit Teilnehmern
Transkription Gespräch MA I
Transkription Gespräch MA II
Transkription Gespräch MA III
Transkription Gespräch TN I
Transkription Gespräch TN II
Transkription Gespräch TN III
Transkription Gespräch TN IV
Leitfaden für den Stressbewältigungsplan
Einleitung
Arbeit und Berufstätigkeit sind immer in einem gewissen Maße mit Stress verbunden. In aktuellen Erklärungsansätzen für die Entstehung und den Verlauf von schizophrenen Psychosen spielt Stress eine wichtige Rolle. Ziel dieser Diplomarbeit ist es zu untersuchen, welchen Stellenwert das Thema "Stress und Stressbewältigung" in der beruflichen Rehabilitation schizophren Erkrankter hat, ob und welche Strategien zur Stressvermeidung und Stressbewältigung von den Nutzern der beruflichen Rehabilitation angewendet werden, wie effektiv diese sind und welche Unterstützung die professionellen Rehabilitationsmitarbeiter anbieten können.
Dazu wurden im Beruflichen Trainingszentrum Köln Interviews mit Teilnehmern einer berufsrehabilitativen Maßnahme und mit Mitarbeitern dieser Einrichtung geführt.
In Teil I wird ein theoretischer Zugang zu dieser Fragestellung eröffnet. Zunächst sollen allgemeine psychologische und arbeitspsychologische Aspekte von Stress und Stressbewältigung vorgestellt werden. Anschließend sollen die Besonderheiten von Menschen mit Schizophrenien und die Bedeutung von Stress für diese Erkrankung dargestellt werden. Das nächste Kapitel informiert über Hilfen auf dem Weg in berufliche Integration für psychisch Kranke und stellt die Einrichtung für berufliche Rehabilitation vor, in der die Interviews durchgeführt wurden. In Teil II werden die in den qualitativen Interviews erhobenen Daten ausgewertet. Das Vorgehen bei der Durchführung und die Kriterien für die Auswertung der Interviews sollen im ersten Kapitel diese Teils erläutert werden. Danach erfolgt die Auswertung der Gespräche. In der abschließenden Diskussion sollen die Ergebnisse der Auswertung in Beziehung zu den in den theoretischen Kapiteln aufgeworfenen Fragen gesetzt werden. In Teil III finden sich die Literatur- und Quellenangaben. Die Interviewleitfäden und die Transkriptionen der Gespräche bilden Teil IV als Anhang im zweiten Band.
I
1. Psychologische und arbeitspsychologische Aspekte von Stress und Stressbewältigung
Die psychologische und arbeitspsychologische Literatur zum Thema Stress und Stressbewältigung ist sehr umfangreich. Es existieren viele Stresskonzepte: "In kaum einem anderen Bereich der Belastungs-Beanspruchungsforschung gibt es eine solche Vielfalt von nicht miteinander übereinstimmenden Konzepten, Inkonsistenzen innerhalb einzelner Konzepte und inkonsistenter Begriffsverwendung wie in der Stressdiskussion." (Ulich, 2001, S. 451) Um einen Überblick über die historische Entwicklung der Stressforschung und ihre aktuellen Ausprägungen zu erhalten, sollen hier nach einer ersten Begriffsklärung zunächst die drei großen Klassen von Stressmodellen vorgestellt werden, die die meisten Autoren von Übersichtsartikeln unterscheiden (vgl. Frey et al., 1992; Gebert & v. Rosenstiel, 2002; v. Rosenstiel, 1992; Schmale, 1995). Im Anschluss daran sollen spezifische Stressoren in der Arbeitswelt, Ressourcen in der Stressbewältigung und mögliche Strategien zur Stressvermeidung und -bewältigung beschrieben werden.
1.1 Begriffsklärung
Unter "Belastungen" werden objektive, von außen auf den Menschen einwirkende Größen verstanden, die zunächst unabhängig von ihrer Wirkung auf den jeweiligen Menschen betrachtet werden(Gebert & v. Rosenstiel, 2002, S.120).
Unter "Beanspruchung" wird die Art und Intensität dieser Wirkung auf den Menschen, also die Folgen der Belastung für den Menschen verstanden (ebd.).
Mit Frey et al. lassen sich Begriffe, die synonym oder annähernd synonym verwandt werden, in zwei Gruppen aufteilen. Zum einen sind dies Begriffe, die sich auf die Umwelt beziehen (Belastung, Belastungsfaktor, Load, Stressor, Stressfaktor), zum andern Begriffe, die sich auf die Person beziehen (Beanspruchung, Fehlbeanspruchung, Beanspruchungsfolge, Stress, Stressreaktion, Strain) (1992, S.428).
1.2 Stimuluskonzepte
Bei den Stimuluskonzepten werden Reize der Umwelt als Stressoren verstanden. Ein früher Ansatz ist die Life-Event-Forschung, die den Einfluss verschiedener bedeutender Lebensereignisse auf die körperliche und geistige Gesundheit der Menschen untersuchte. Dabei wurden Listen verschiedener lebensverändernder Ereignisse von Testpersonen oder von "Experten" bezüglich der notwendigen Anpassungsleistung bewertet. Die Addition dieser Punkte für aktuelle Lebensereignisse ergab die Belastung für eine Person. Dabei wurde nicht zwischen angenehmen und unangenehmen Ereignissen unterschieden ("Social Readjustment Rating Scale" 1967 von Holmes & Rahe; "Schedule of Recent Experiences" 1974 von G.W. Brown). Kritikpunkte an dieser Vorgehensweise sind die enge soziokulturelle Gebundenheit der Punktwerte und die vernachlässigte qualitative Bewertung der Ereignisse durch die Personen (vgl. Schmale, 1995, S.213 ff.; Zimbardo & Gerrig, 1999, S.376 ff.). Zimbardo & Gerrig kritisieren die Retrospektivität der Life-Event-Forschung: "Dadurch können Verzerrungen im Gedächtnis entstehen, die sich auf das Resultat der Erinnerung verfälschend auswirken" (1999, S.378) Sie führen an, dass "die meisten aktuellen Untersuchungen nur auf einen schwachen positiven Zusammenhang zwischen einschneidenden Lebensereignissen und Krankheit" hindeuten. (ebd.)
Nicht nur einschneidende Lebensereignisse, sondern auch situative Bedingungen, die über einen längeren Zeitraum fortbestehen, können Spannungsreaktionen hervorrufen (vgl. I.1.5, Spezifische Stressoren am Arbeitsplatz).
Als Ertrag der Stimuluskonzepte wird die Möglichkeit beschrieben, "bestimmte Stressorenklassen [zu] finden, ... die mit ziemlicher Regelmäßigkeit bei größeren Personengruppen als Stressoren wahrgenommen werden" (Udris & Frese, 1992, S.429). Diese Befunde "haben in jedem Falle prophylaktische Bedeutung, denn sie liefern die Basis für die allgemeine Planung und Installation arbeitsorganisatorischer Maßnahmen zur Vermeidung psychosozialer Störungen" (Schmale, 1995, S. 215).
1.3 Reaktionskonzepte
Die Reaktion des Organismus auf Stressoren ist Gegenstand des Stresskonzeptes von Hans Selye. Grundlage seiner Überlegungen ist das Konzept der Homöostase, das besagt, dass in einem Organismus Vorgänge stattfinden, die dem Aufrechterhalten des Gleichgewichtes des inneren Milieus dienen. Dieses Gleichgewicht wird als lebensnotwendig erachtet: "Um gesund zu bleiben, darf nichts im Organismus weit von der Norm abweichen; geschieht dies aber dennoch, wird das Individuum krank oder stirbt sogar" (Selye, 1981, S.180 f.). Selye definiert Stressoren als endogene oder exogene Reize, "die grundsätzlich mit Bewältigung jeder erhöhten Anforderung an die Lebenstätigkeit verbunden sind, insbesondere mit der Anpassung an neue Situationen" (S.169). Dabei "ist es sogar unerheblich, ob der vorliegende Reiz angenehm oder unangenehm ist (s.u. Eustress / Distress; BO); es kommt nur auf das durch sie verursachte Ausmaß der Anforderung an Anpassung oder Wiederanpassung an" (ebd.). Diese Reize gefährden also die Homöostase und veranlassen den Organismus, diese wiederherzustellen. Die Reize haben zwar einerseits verschiedene spezifische Wirkungen, andererseits rufen sie jedoch einheitliche biologische Reaktionen hervor. Er definiert: "Stress ist die unspezifische Reaktion des Organismus auf jede Anforderung" (Selye, 1981, S.170) und nennt die einheitliche physiologische Reaktion das "Allgemeine Adaptionssyndrom" (AAS). Das AAS ist in drei Phasen unterteilt: Die Alarmreaktion, die durch eine allgemeine Aktivierung und Abwehrbereitschaft gekennzeichnet ist, das Resistenzstadium, in dem die Widerstandskraft gegen den Stressor erhöht bleibt und das Erschöpfungsstadium, in dem die Anpassungsmechanismen mit pathogenen Folgen zusammenbrechen (vgl. Gebert & v. Rosenstiel, 2002, S.127 f.).
Selye nimmt eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Stressreizen und Stresswirkungen vor, nämlich zwischen "Eustress" und "Distress", demnach können "die typischen Stressreaktionen ... sowohl durch schädliche Einwirkungen [ Distress] als auch durch als angenehm erlebte Ereignisse ausgelöst werden [ Eustress ]" (Nitsch, 1981a, S.55). Darüber hinaus kann "in Abhängigkeit von den jeweils vorliegenden Bedingungen ... Stress mit erwünschten [Eustress] oder unerwünschten [Distress] Folgen verbunden" sein (Selye, 1981, S.171).
Für Selye ist diese "unspezifische Reaktion ein im Grunde biologisch sinnvolles Anpassungsgeschehen" (Nitsch, 1981a, S.55). Allerdings können jedoch "unzureichende, überschießende oder falsche Reaktionen auf Stressoren" (Selye, 1981, S.180) den Ausbruch von sog. "Anpassungskrankheiten" positiv beeinflussen. Anders akzentuiert beschreibt Schmale, dass die neurophysiologische Reaktion auf Stressoren die Stoffwechselrate erhöht und so Energien mobilisiert werden. Diese Energien dienten in der "Frühgeschichte der Menschheit" dazu, Angriffs- oder Fluchtverhalten zu initiieren. Dieses Verhalten wird durch gesellschaftliche und kulturelle Normen gehemmt. Die Unterdrückung und der Versuch der Kontrolle der Energien wirken dann erneut als Stressoren und haben auf Dauer vegetative Störungen bzw. Anpassungskrankheiten zur Folge (1995, S. 212).
Die Kritik an den Reaktionskonzepten bezieht sich darauf, dass auch gleiche körperliche Auswirkungen unterschiedliche Ursachen haben können und deshalb keine verlässlichen Parameter für Stress darstellen. Außerdem bleibt bei dieser rein physiologischen Betrachtungsweise die (psychologische) Bedeutung der stressauslösenden Ereignisse unbeachtet.
1.4 Transaktionale Konzepte
Transaktionale Konzepte, also Beziehungskonzepte, gehen von einer Inkongruenz zwischen den Anforderungen der Umwelt und den Kapazitäten des Individuums aus, wobei ein entscheidender Faktor die Bewertung der Anforderungen und der Kapazitäten durch das Individuum selbst ist. Diese Inkongruenz muss nicht objektiv gegeben sein, Stress entsteht vielmehr durch Wahrnehmungen, Interpretationen und antizipierten Misserfolg (vgl. Udris & Frese, 1992, S.429).
1.4.1 Das P-E-fit-Modell
Ein transaktionales Stressmodell ist das "Person-Environment-Fit-Modell" (P-E-fit-Modell). Die zugrundeliegende Überlegung ist, dass Stress immer dann entsteht, wenn "individuelle Handlungsvoraussetzungen und situative Handlungsbedingungen instrumentell (Diskrepanz zwischen Fähigkeiten und Anforderungen) oder motivational (Diskrepanz zwischen Bedürfnissen und Befriedigungsmöglichkeiten) im Ungleichgewicht stehen" (Nitsch, 1981b, S. 26). Es kann also einen situativen "fit", eine Entsprechung zwischen den Merkmalen der Person und den Merkmalen der Umwelt geben, die keine Stressreaktion hervorruft, ein "mis-fit", eine Nichtentsprechung zwischen diesen Merkmalen, induziert Stress. In Anlehnung an Gebert & v. Rosenstiel (2002, S.122 f.) lässt sich das P-E-fit-Modell wie folgt systematisieren:
a) Ein mis-fit kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten entstehen:
- die leistungsbezogenen Anforderungen entsprechen nicht den Fähigkeiten und Fertigkeiten und/ oder
- die in der Situation gegebenen Ressourcen und Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung entsprechen nicht der gewünschten Bedürfnisqualität oder -intensität.
b) Es besteht die Möglichkeit eines objektiven und eines subjektiven mis-fits. Für die entstehende Beanspruchung ist nicht die tatsächliche Diskrepanz der Situations- und Personenmerkmale entscheidend, sondern vielmehr die Kognition der Relation, die sich in der Bewertung der Situation niederschlägt.
c) Es können also durch Fehlkognitionen hohe Grade der Beanspruchung und damit der Angespanntheit entstehen.
d) Es gibt zwei Möglichkeiten zur Reduktion des mis-fits:
- Veränderung der objektiven Bedingungen der Situation oder der Person
- Veränderung der Kognition
e) Sinkt die P-E-Differenz, so sinkt auch der Grad der Anspannung; bleibt die P-E-Differenz gleich, so wirkt diese Konstellation längerfristig pathogen
Entscheidend für die Ausprägung der Beanspruchung und somit der Angespanntheit sind somit
- die Ausprägung von Situations- und Personenmerkmalen, sowie davon unabhängig
- die Relation zwischen diesen Merkmalen.
Kritisch wird angemerkt, dass das P-E-fit-Modell nur schwierig empirisch zu stützen ist, da die Korrelationen zwischen Stressoren und Anspannung nur sehr bedingt aussagekräftig sind, weil sie durch unterschiedliche Wahrnehmungs- und Erlebnisprozesse (z.B. Coping-Stile, s.u.) interindividuell erheblich beeinflusst werden. So lassen sich auch kaum prognostische Aussagen treffen, eben weil auch gleiche mis-fit -Konstellationen verschiedene Konsequenzen nach sich ziehen können.
1.4.2 Der transaktionale Ansatz von R. S. Lazarus
Einem anderen transaktionalen Ansatz, dem Stress-Modell von Lazarus, ging die Erkenntnis voraus, dass der physiologische Mechanismus der Stressreaktion auch durch die bloße Vorstellung eines Stressors ausgelöst werden kann (vgl. Schmale, 1995, S. 215). Lazarus betrachtet den Zusammenhang von Kognition und Emotion. Er geht von einer wechselseitigen Beeinflussung aus und hebt den kausalen Einfluss kognitiver Prozesse auf die emotionale Reaktion hervor (vgl. Lazarus & Launier, 1981, S.234 f.). Für diesen kognitiven Prozess unterscheidet Lazarus vier Stufen des Prozessablaufes, die jedoch nicht linear aufeinander folgen, sondern die miteinander verwoben sind und ständig Einfluss aufeinander nehmen:
- Primäre Bewertung (primary appraisal)
- Sekundäre Bewertung (secondary appraisal)
- Bewältigungsversuch (coping)
- Neubewertung (reappraisal) (vgl. ebd.; Schmale, 1995, S.216).
Bei der "Primären Bewertung" findet ein mentaler Vorgang statt, bei dem ein Ereignis auf seine Bedeutung für das Wohlbefinden der Person hin kategorisiert wird. Das Ereignis kann als irrelevant, als günstig/positiv oder als stressend empfunden werden. Wird das Ereignis als stressend eingeordnet, so treten "drei Formen auf, nämlich ... Schädigung/Verlust, Bedrohung und Herausforderung, wobei alle drei eine gewisse negative Bewertung des eigenen gegenwärtigen oder zukünftigen Wohlbefindens einschließen, Herausforderung aber die am wenigsten negative und am meisten positive Gefühlstönung aufweist" (Lazarus & Launier, 1981, S. 235).
Unter Schädigung/Verlust wird eine bereits eingetretene Schädigung verstanden. Bedrohung meint eine Schädigung, die noch nicht eingetreten ist, aber antizipiert wird. Verlust und Bedrohung sind häufig miteinander vermischt, wenn z.B. ein traumatisches Erlebnis eintritt und dieses vorhersehbare schwerwiegende Folgen für die Zukunft des Betroffenen mit sich bringt. Lazarus & Launier werten den Unterschied zwischen Bedrohung und Herausforderung als " eine Frage positiver gegenüber negativer Tönung ..., d.h., ob man in der Bewertung die potentielle Schädigung bei einer Transaktion hervorhebt (Bedrohung) oder die schwer erreichbare, vielleicht risikoreiche, aber mit positiven Folgen verbundene Meisterung oder den Nutzen (Herausforderung)" (ebd., S. 236). Dann stellt sich allerdings die Frage, ob die Bewertung einer Situation als Herausforderung gleich zu setzten ist mit der Coping-Strategie (s.u.) "Abwehr durch Leugnung" (vgl.: ebd.). Schmale betont den Wert von Herausforderungen, da nur sie ermöglichen, die Grenzen der eigenen Reaktionsfähigkeit kennen zu lernen (indem man sie möglicherweise überschreitet) und somit die zukünftige Einordnung von Situationen als stressrelevant bzw. stressirrelevant erleichtert wird (vgl.: 1995, S. 216). Dieses Konzept von Herausforderung erinnert an das Konzept des "Eustress" von Selye, in dem die Stressreaktion angenehme Folgen hat.
In der "Sekundären Bewertung" findet ein Abwägen der subjektiv als vorhanden erlebten Ressourcen und Möglichkeiten der Bewältigung (coping resources and options) statt. Diese sekundäre Bewertung kann vor, nach oder zeitgleich mit der primären Bewertung stattfinden. Lazarus & Launier betonen, "dass sekundäre Bewertung sowohl für die Gestaltung der Bewältigungsmaßnahmen der unter psychologischem Stress stehenden Person bedeutsam ist, als auch für die Ausformung der primären Bewertungsprozesse selbst" (1981, S. 238). Diese Bewertungsprozesse können sowohl bewusst als auch unbewusst ablaufen. Sie können unwillkürlich und besonders in antizipatorischen Situationen auch willkürlich geschehen.
Die Vielzahl möglicher "Coping - Strategien" fasst Lazarus in vier Klassen zusammen:
- Informationssuche
- direkte Aktion
- Unterlassen einer Handlung bzw. Aktionshemmung
- intrapsychische Bewältigungsprozesse.
Die Informationssuche soll dazu verhelfen, durch neue Fähigkeiten oder Erkenntnisse besser auf die Situation reagieren zu können.
Die direkte Aktion zielt auf eine Veränderung der Situation, letztlich auf die Beseitigung des Stressors hin.
Das Unterlassen einer Handlung zielt durch die Hemmung einer intendierten Aktion ebenfalls auf die Beseitigung des Stressors bzw. auf die Reduktion seiner Wirkung ab.
Intrapsychische Bewältigungsprozesse umfassen alle bewussten kognitiven Bemühungen, eine Situation anders zu bewerten bzw. die Aufmerksamkeit bewusst zu lenken (z.B. Bagatellisierung, Leugnung ) (vgl.: ebd. ; Schmale, 1995, S.217 f.).
Alle diese Prozesse können entweder mit dem Ziel stattfinden, die (gestörte) Transaktion, also die (gestörte) Person-Umwelt-Beziehung zu verbessern (Problemlösungsstrategien, "instrumentelle Funktionen"), oder eine Regulierung der Emotionen anstreben ("palliative Funktionen").
Bei der "Neubewertung" werden die Informationen, die beim Einsatz eines Bewältigungsprozesses gewonnen wurden, rückgekoppelt. Das Reizgeschehen und die eigene Reaktionskapazität werden mit Hilfe der gewonnenen Erfahrungen kognitiv neu eingeordnet.
Lazarus definiert Stress also als die "Antizipation einer empfundenen Unfähigkeit zu adäquater Verarbeitung subjektiv erlebter Anforderungen, begleitet von einer Antizipation möglicher als negativ empfundener Folgen bei inadäquater Verarbeitung" (zitiert nach: ebd., S.216).
Nach Gebert & v. Rosenstiel (2002, S. 127) weist Lazarus darauf hin, dass als erste Reaktion auf bedrohliche Situationen direkte Aktionen als instrumentelle Funktionen, nämlich Angriff und Flucht, ausgelöst werden. Die ausschließlich intrapsychische Anpassung ist somit ein Notbehelf, wenn der eigentliche Impuls durch äußere Faktoren blockiert wird:
Ausschließlich intrapsychische Anpassungen sind im Vergleich zu Angriffs- und Fluchtverhalten weniger effektiv, da der Bedrohungsauslöser objektiv nicht beseitigt wird, die Anlässe für erforderliche Coping-Prozesse sich also eher wiederholen können und damit – vermittelt über die Parallelität der jeweils induzierten physiologischen Prozesse – insgesamt ein höherer Dauer-Energie-Verschleiß stattfindet (ebd.).
Dieser Umstand ist ein Hinweis auf die Struktur pathogener Prozesse, also eine Erklärung dafür, dass und wie Stress pathogen wirken kann (siehe auch I.1.2 und I.1.3).
Die Kritik an Lazarus´ Modell besagt, dass es nur unzureichend operationalisierbar ist, da nur introspektive Möglichkeiten zu Erforschung der Coping-Mechanismen eingesetzt werden können. Außerdem werden implizit Verhalten, verbale und physiologische Reaktionen des Individuums zur Definition von Stress herangezogen, somit greift die Kritik an den Reaktionskonzepten auch hier (vgl. z.B. Schmale, 1995)
1.4.3 Ungewissheit
Eine andere Definition von Stress führt McGrath an (vgl.: Gebert & v. Rosenstiel, 2002, S. 131 f.): Er versteht unter Stress "eine Funktion des Produktes aus der Gewichtigkeit der Folgen von leistungsbezogenem Erfolg und der subjektiven Ungewissheit des Eintretens von Erfolg bzw. Misserfolg" (zitiert nach: ebd.). Ungewissheit (und damit einhergehend Stress) wird dann als hoch erachtet, wenn die Höhe des (wahrgenommenen) eigenen Fähigkeitsniveaus nicht größer oder kleiner (vgl. oben mis-fit), sondern gleich der Höhe der (an- oder wahrgenommenen) Anforderungen der Situation ist (fit), wenn der Ausgang der Situation von Bedeutung ist. Im Gegensatz zu den Überlegungen des P-E-fit-Modells senkt also nach McGrath ein mis-fit die Ungewissheit und damit die Intensität des erlebten Stress, hier wirkt die Inkongruenz von Anforderungen und Fähigkeiten also stressmindernd.
Dieser Widerspruch ist auflösbar, wenn man verschiedene Ebenen unterscheidet, auf denen fits / mis-fits in verschiedenen Richtungen auf die Erregung (arousal) wirken: so kann Stress sowohl dadurch entstehen, dass ein mis-fit als sehr groß erlebt und eine Überforderung angenommen wird, als auch dadurch, dass bei einer vermeintlichen Gleichheit von Anforderungen und Ressourcen der Ausgang einer Situation ungewiss ist.
McGrath weist darauf hin, dass Ungewissheit auch in Bezug auf das zeitliche Eintreten kritischer Situationen Bedeutung hat: Die Nicht-Vorhersagbarkeit von kritischen Situationen führt zu einer dauerhaften Anspannung. Die Vorhersagbarkeit einer Situation hingegen ermöglicht Prävention und somit Situationskontrolle (s. u. I.1.6.1 Situationskontrolle) (vgl.: ebd.).
1.5 Spezifische Stressoren am Arbeitsplatz
Udris & Frese führen an, dass es sich mittlerweile durchgesetzt habe, nur bedrohliche (mit antizipierter Schädigung verbundene) und aversive (Abneigung hervorrufende) Reize als Stressoren zu bezeichnen. Diese Aussagen stehen im Gegensatz zu den angeführten Stimuluskonzepten, die allgemein lebensverändernde Ereignisse als Stressoren betrachten, und zu dem Stresskonzept von Selye, der die Art und Weise des Reizes zunächst als unerheblich für das Einsetzen der Stressreaktion beschreibt. Lazarus & Launier (1981; vgl. 2.4.2) werten "Herausforderungen" eindeutig als stressinduzierend.
Für die Untersuchung von Stressoren am Arbeitsplatz ist fast immer die Betrachtung von "Mikrostressoren" (daily hassels) bedeutender als die Betrachtung großer, negativer Ereignisse. Viele " 'große', negative Ereignisse sind oft überhaupt nur deshalb als stressende Lebensereignisse zu interpretieren, weil sie zu täglichen Mikrostressoren führen" (Udris & Frese, 1992, S.431). Entscheidend ist die Kumulation solcher kleinen Ereignisse, um einen dauerhaften Zustand von erfahrenem Stress hervorzurufen. Bisher ist allerdings nicht bekannt, wie genau verschiedene Belastungen und ihre Wirkungen zusammen wirken.
Stressoren am Arbeitsplatz können sein:
- Stressoren in der Arbeitsaufgabe (Über-, Unterforderung in quantitativer oder qualitativer Hinsicht; Störungen des Arbeitsablaufes etc.)
- Physikalische Stressoren (Lärm, Dreck etc.)
- Zeitliche Stressoren (Nacht- und Schichtarbeit etc.)
- Stressoren in der sozialen und organisatorischen Situation (Rollenkonflikt und Rollenambiguität; soziale Stressbedingungen; zwischenmenschliche Konflikte; Umstellungsprozesse; Angst vor Arbeitsplatzverlust etc.) (vgl.: ebd. ).
1.6 Ressourcen bei der Stressbewältigung
Für die Bewertung und Bewältigung von Anforderungen sind Ressourcen notwendig. Udris & Frese unterscheiden zwischen inneren und äußeren Ressourcen. Unter inneren Ressourcen können Ressourcen innerhalb der Person, also z.B. die Kompetenz zur Arbeit, soziale und betriebspolitische Kompetenzen (nicht nur im Umgang mit Kollegen, sondern auch im Durchsetzen von Interessen) verstanden werden. Unter äußeren Ressourcen können die Ressourcen der (Arbeits-) Umwelt verstanden werden, so z.B. die Gegebenheit der Möglichkeit der Beeinflussung von Belastungen ("Situationskontrolle") oder inner- und außerbetriebliche soziale Netze ("Soziale Unterstützung") (vgl. S. 435 f.). Exemplarisch sollen hier "Situationskontrolle" und "Soziale Unterstützung" näher erläutert werden.
1.6.1 Situationskontrolle
Unter Situationskontrolle wird die Möglichkeit verstanden, durch eigenes Handeln direkt oder indirekt verändernden Einfluss auf potentielle Stressoren zu nehmen bzw. sich geeignete Fluchtmöglichkeiten zu verschaffen. Diese Situationskontrolle variiert dabei in einem Kontinuum zwischen vollkommener Kontrolle und totaler Nicht-Kontrolle.
Die Situationskontrolle ist von objektiven und subjektiven Charakteristika abhängig.
Unter objektiven Charakteristika können beispielsweise der Umfang der technologischen Freiräume, die Art der Machtverteilung oder die Erkennbarkeit zeitlicher und funktionaler Bedingungen der Stressoren verstanden werden. Als subjektives Charakteristikum kann die Eigenwahrnehmung der betroffenen Person als eher extern oder eher intern kontrollierter Person bedeutsam sein: Die Person, die sich als extern kontrolliert wahrnimmt, nimmt das Verhalten der Umwelt als vom eigenen Handeln unabhängig wahr. Somit nimmt sie auch ihre Stresskontrolle subjektiv als gering wahr. Die sich als intern kontrolliert wahrnehmende Person nimmt die Abhängigkeit der Reaktion der Umwelt vom eigenen Handeln an und erlebt somit subjektiv eine höhere Situationskontrolle (vgl. Gebert & v. Rosenstiel, 2002, S. 135).
1.6.2 Soziale Unterstützung
Soziale Unterstützung nimmt die Funktion eines Stressmoderators ein. Sie kann also Einfluss darauf haben, ob und wie eine Situation als Stress oder stressinduzierend wahrgenommen wird und welche Auswirkungen der wahrgenommene Stress auf eine Person hat. Unabhängig von unterschiedlichen theoretischen Stressmodellen fassen Udris & Frese die Literatur über Soziale Unterstützung wie folgt zusammen:
"Wer soziale Unterstützung hat,
- erlebt bzw. erfährt weniger Stress,
- leidet weniger unter Stress bzw. kann besser damit umgehen,
- ist (physisch und psychisch) gesünder bzw. weniger beeinträchtigt" (1992, S.436 f.).
Die stressreduzierenden Effekte von Sozialer Unterstützung finden nach Nitsch (1981a, S. 125 f) auf drei Ebenen statt:
- Instrumentelle Unterstützung
- Emotionale Unterstützung
- Stressrelativierung durch sozialen Vergleich
Instrumentelle Unterstützung bezeichnet Hilfen auf der Ebene von Problemlösestrategien, im Vorfeld, während oder nach dem Eintreten einer stressenden Situation.
Emotionale Unterstützung bezieht sich auf die Zuwendung von anderen Personen, die Sicherheit vermitteln und die die Konzentration von der stressenden Situation ablenken kann.
Stressrelativierung durch sozialen Vergleich ermöglicht die Einschätzung und Bewertung der eigenen Situation im Vergleich mit der Situation anderer. Durch die Feststellung, dass es vergleichbaren anderen Personen schlechter geht bzw. andere eine vergleichbare Situation gemeistert haben, kann eine Minderung von Stress eintreten.
Eine weitere Differenzierungsmöglichkeit bietet die Unterscheidung zwischen einer individuumsorientierten und einer systemorientierten Sichtweise auf soziale Unterstützung am Arbeitsplatz (vgl.: Udris & Frese, 1992, S. 437):
Eine individuumsorientierte Sichtweise betrachtet Personen als Rollenträger. Die Einbindung in Vertrauensbeziehungen (innerhalb des Arbeitsbereiches und im privaten Bereich) kann den Charakter von stressreduzierenden Ressourcen haben. In der systemorientierten Betrachtung kommt der Arbeitsorganisation eine bedeutende Rolle zu, durch die sowohl Unterstützungsquellen, also Coping-Ressourcen, als auch Unterstützungsbarrieren geschaffen werden können.
1.7 Strategien zur Stressvermeidung und Stressbewältigung
Da Stress durchaus eine wichtige und sinnvolle Rolle in der Entwicklung von Individuen und somit der Gesellschaft einnimmt, kann und sollte eine völlige Abwesenheit von Stress nicht das Ziel sein. "Gesonderte Maßnahmen zur Stressreduktion werden also erst dann erforderlich sein, wenn Stress zu einer erhöhten Gefährdung der physischen, psychischen und sozialen Existenz und Handlungsfähigkeit einer Person führt und die negativen Nebenwirkungen stressreduzierender Maßnahmen nicht deren positive Effekte übersteigen" (Nitsch, 1981c, S. 565). Deshalb kann die Einführung von "Antistressoren" sinnvoll sein: Diese sollen bei gleichbleibenden persönlichen und Umweltbedingungen zu positiven Erfahrungen oder Erwartungen führen (hierbei spielt soziale Unterstützung eine wichtige Rolle) und die Sinnhaftigkeit von Anstrengungen vermitteln, wenn diese einem "übergeordnetem" sozialen oder persönlichen Ziel dienen (vgl.: ebd., S. 566).
Strategien zur Stressreduktion bzw. zur Stressbewältigung in Arbeitssituationen können grundsätzlich an vier Punkten ansetzen: Auf institutioneller Ebene im Bereich der Stressoren (a) und im Bereich der (Coping-) Ressourcen (b), auf individueller Ebene im Bereich der Stressreaktionen (c) und im Bereich der Ressourcen (d) (vgl. Udris & Frese, 1992, S.440 f.).
a) Auf institutioneller Ebene können Stressoren erfasst und verringert werden. Mögliche Nachteile sind Stressorenverschiebungen (die Reduktion eines Stressors erschafft neue Stressoren), die Verringerung des Gefühls der Herausforderung und das Übergehen individueller Voraussetzungen und Vorlieben. Dies würde eine Stressreduktion im Sinne der Stimuluskonzepte bedeuten.
b) Als Ressourcen auf institutioneller Ebene können (größere) Situationskontrollspielräume eingerichtet werden. Die Stärkung von institutionellen Ressourcen sollte durch die Stärkung individueller Ressourcen ergänzt werden, da sonst Belastungsverschiebungen eintreten können. So kann z.B. die Erweiterung von Entscheidungsfreiräumen zu einer Entscheidungsunsicherheit führen, die als neue Belastung erlebt wird. Es ist also notwendig, neben einer Veränderung der Situationsgegebenheiten auch eine Veränderung der Personenmerkmale vorzunehmen, damit nicht ein –wahrgenommener oder tatsächlicher – mis-fit durch einen neuen ersetzt wird.
c) Auf individueller Ebene können Stressmanagementprogramme durch Stressimmunisierung und Entspannung zu einer Reduktion von Stressreaktionen führen. Stressimmunisierung kann z.B. durch den Gebrauch von trainierten Selbstinstruktionen geschehen: Eine Problemlösungsstrategie könnte sein, auftretende Probleme in einzelne, überschaubare Teilprobleme aufzugliedern und diese Schritt für Schritt zu bearbeiten. Ein solches Vorgehen kann im Sinne Lazarus´ als intrapsychische instrumentelle Funktion verstanden werden. Entspannungstechniken können in diesem Sinne als intrapsychische palliative Funktion verstanden werden.
d) Im Bereich der individuellen Ressourcen können Qualifizierungsprogramme zur Förderung individueller und sozialer Kompetenzen eingesetzt werden.
1.8 Zusammenfassung
Die vorgestellten Ansätze zur Definition und zur Erklärung von Stress benennen bestimmte Reize, die als Stressoren wirken können, sie veranschaulichen körperliche Reaktionen auf Stressoren und versuchen, die kognitive Bewertung von Situationsgegebenheiten und eigenen Fähigkeiten zu integrieren. Aus der offensichtlich hochgradigen Individualität von Stresserleben ergibt sich, dass ein Modell, das der Lebens- und Erlebenswirklichkeit von Menschen gerecht werden soll, die Mehrdimensionalität von Umwelteinflüssen und deren individuelle Wahrnehmung berücksichtigen muss. Gleiche Umweltbedingungen können bei unterschiedlichen Menschen die gleiche Reaktion, gleiche Umweltbedingungen können aber eben auch bei demselben Menschen zu unterschiedlichen Zeiten vollkommen unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. So müssen auch individuelle Erfahrungen und Bewertungen sowie die Wechselwirkung zwischen einer Person und ihrer Umwelt berücksichtigt werden. Diesem Anspruch werden am ehesten die transaktionalen Konzepte gerecht. Darüber hinaus sollte nicht im Vorfeld ausgeschlossen werden, dass auch Reize, die nicht offensichtlich bedrohlicher Natur sind, als Stressoren wirken können. Außerdem scheint die Operationalisierung von Stressempfinden über körperliche Variablen (Pulsrate etc.) nicht überzeugend, da auch gleiche körperliche Erscheinungen unterschiedlichen Ursprungs sein können und die individuellen körperlichen Voraussetzungen einen aussagekräftigen interpersonalen Vergleich erschweren. Für diese Untersuchung soll deshalb die Erlebnisqualität der Betroffenen bzw. derjeniger, die die Betroffenen betreuen und somit beobachten, ausschlaggebend für die Betrachtung des Phänomens "Stress" sein.
Vor dem eröffneten theoretischen Hintergrund ist von besonderem Interesse, ob die Interviewpartner ein eigenes, individuelles Stresskonzept haben, ob sie (tatsächlich) nur aversive oder bedrohliche Reize als Stressoren empfinden oder ob auch positiv bewertete Ereignisse stressinduzierend wirken, welche Coping-Strategien die Betroffenen anwenden und welche Coping-Strategien die Betreuer empfehlen und mit den Teilnehmern entwickeln und wie diese Strategien in das alltägliche Handeln integriert werden.
2. Schizophrene Psychosen
Menschen mit Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis stellen eine bedeutende Gruppe der Patienten in psychiatrischen Einrichtungen und Rehabilitationseinrichtungen dar.
Dieses Kapitel hat zum Ziel, Schizophrenien als Phänomen, als Konzept und als Konstrukt vorzustellen. Zunächst erfolgt eine Begriffsklärung vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung. Danach soll die gesellschaftliche Bedeutung der schizophrenen Psychosen anhand von epidemiologischen Daten verdeutlicht werden. Im folgenden sollen Symptomgruppen und diagnostische Kriterien, der Verlauf und Prädiktoren für den Verlauf der Erkrankung vorgestellt werden. Der nächste Abschnitt fasst verschiedene ätiologische Ansätze zusammen und zeigt ein integratives Erklärungsmodell für die Entstehung schizophrener Psychosen auf. Therapeutische Ansätze für die Behandlung von Psychosen und hier insbesondere die Bedeutung der arbeitsbezogenen Rehabilitation bilden den Abschluss dieses Kapitels.
2.1 Begriffsklärung vor dem historischen Hintergrund
Der deutsche Arzt Emil Kraepelin fasste am Ende des 19. Jahrhunderts eine Gruppe von Krankheitsbildern zu der Gruppe der "Dementia praecox" zusammen. Er verwendete also eine Prognose zur Klassifikation der Erkrankungen. Diese Vorgehensweise ist nicht nur deshalb zu kritisieren, weil die Grundannahme falsch war (schizophrene Erkrankungen führen eben nicht zu einem vorzeitigen Verlust der Intelligenz), sondern auch deshalb, weil der Ausgang einer Krankheit ungewiss ist und somit nicht als Klassifikationsprinzip herangezogen werden kann (vgl. Cancro, 1984, S. 2; Finzen, 2000, S. 21; Häfner, 2000, S. 55 f., Scharfetter, 1990, S. 26 ff.). Eugen Bleuler, ein Arzt aus Zürich, erkannte, dass die Erkrankung nicht zwangsläufig eine ungünstige Prognose haben muss. Er stellte die Spaltung geistiger Funktionen als Hauptsymptom heraus und schlug infolgedessen die Bezeichnung "Gruppe der Schizophrenien" vor (vgl. ebd.). Die von Bleuler ausgearbeiteten Grundsymptome haben fast in der gesamten westlichen Psychiatrie Anwendung gefunden (vgl. ebd.). Ein aktuelles medizinisches Schizophreniekonzept wird mit dem Diagnosemanual ICD 10 im Kapitel 3.3 vorgestellt.
Die antipsychiatrische Bewegung bezweifelt die Validität des Konzeptes der Schizophrenie als Krankheit. Szasz bezeichnet die nichtorganischen Geisteskrankheiten als bloße Normabweichungen, die keinen medizinisch-pathologischen Gehalt haben und lehnt die diagnostischen Kriterien als nach den Bedürfnissen der Psychiater konstruiert ab (vgl. Lehmann, 1984, S. 26 f.).
Die Sozialpsychiatrie entwickelte einen sozialen Krankheitsbegriff: "Psychische Krankheiten, insbesondere Schizophrenie, wurde von ihren Vertretern vorrangig als sozialer Prozess verstanden" (Finzen, 2000, S. 32).
Die Ablehnung der Schizophrenie als Krankheit wird dem Leid der Betroffenen nicht gerecht und kann den Zugang zu benötigten Hilfen verwehren. Weder eine einseitig biologistisch-medizinische Sichtweise noch eine einseitig "sozialwissenschaftliche" Sichtweise wird der Vielschichtigkeit der Schizophrenien gerecht. Ein integrativer Ansatz, der die verschiedenen Zugänge kombiniert, ist erforderlich ( s.u. I.2.5 Ätiologie).
2.2 Epidemiologie
Die Inzidenzraten, also die Anzahl der Neuerkrankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, liegen bei der Anwendung gleicher Erhebungsmethoden und einer relativ engen Definition der Krankheit laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation in verschiedenen Ländern und Kulturen etwa gleich bei zehn Neuerkrankungen auf 100 000 Einwohner pro Jahr (vgl. Häfner, 2000, S. 189). Als Lebenszeitprävalenzrate, also als die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis zu erkranken, wird ein Wert von 1 % angegeben (vgl. Babigain, 1984, S. 39; Bosshard et al., 1999, S. 172; Scharfetter, 1990, S. 121; etwas höher [1,1 – 2,0 %] bei Alanen, 2001, S. 50). Alanen stellt heraus, dass Patienten mit Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis in Finnland 10 % aller Erwerbsunfähigkeitsrenten beziehen, obwohl sie nur 5 % der Bevölkerungsgruppe, die an psychischen Erkrankungen leidet, ausmachen (2001, S. 52). Nach Babigain stellt die Schizophrenie "vom Standpunkt der direkten Behandlungskosten, der Einbuße an Produktivität und der Ausgaben für staatliche Versorgungseinrichtungen die teuerste aller psychiatrischen Erkrankungen dar" (1984, S. 42). Die Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis haben also auch eine enorme volkswirtschaftliche Bedeutung.
2.3 Symptome und Diagnoseleitfaden
Die Aufzählungen und Systematisierungsansätze von Symptomen der Schizophrenien in der Literatur sind sehr vielfältig. Mindestens genauso vielfältig stellen sich das Vorhandensein und die Ausprägung von Symptomen bei Betroffenen tatsächlich dar. Da die gängigen psychiatrischen Diagnosesysteme (DSM, "Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders" der American Psychiatric Association und ICD, "International Classification of Diseases" der Weltgesundheitsorganisation) die Schizophrenien symptombasiert definieren, bietet es sich an, die Symptomsystematisierung eines dieser Manuale darzustellen.
Die ICD-10 unterteilt die Symptome in neun Gruppen. Für die Diagnose einer Schizophrenie müssen entweder ein Symptom aus den Gruppen 1 bis 4 oder mindestens zwei Symptome der Gruppen 5 bis 8 ständig über einen bestimmten Zeitraum vorhanden sein. Es gelten feste Ausschlusskriterien für die Diagnose (so darf beispielsweise nicht gleichzeitig eine eindeutige Gehirnerkrankung, eine Intoxikation oder ein Entzug vorliegen). Die Diagnose kann weiterhin in verschiedene Unterformen differenziert werden, für die weitere diagnostische Kriterien angegeben werden (beispielsweise paranoide Schizophrenie, hebephrene Schizophrenie usw., für diese Differenzierung ist auch die neunte Symptomgruppe relevant), außerdem kann das Verlaufsbild der schizophrenen Störung klassifiziert werden (kontinuierlich, episodisch usw.) (vgl. Dilling et al., 2000, S. 103 ff.).
Die neun Symptomgruppen sind:
1. Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung oder Gedankenentzug, Gedankenausbreitung.
2. Kontrollwahn, Beeinflussungswahn, Gefühl des Gemachten, deutlich bezogen auf Körper- oder Gliederbewegungen oder bestimmte Gedanken, Tätigkeiten oder Empfindungen; Wahnwahrnehmungen.
3. Kommentierende oder dialogische Stimmen, die über den Patienten und sein Verhalten sprechen, oder andere Stimmen, die aus einem Teil des Körpers kommen.
4. Anhaltender, kulturell unangemessener oder völlig unrealistischer (bizarrer) Wahn, wie der, eine religiöse oder politische Persönlichkeit zu sein, übermenschliche Kräfte und Fähigkeiten zu besitzen ... .
5. Anhaltende Halluzinationen jeder Sinnesmodalität, begleitet entweder von flüchtigen oder undeutlich ausgebildeten Wahngedanken ohne deutliche affektive Beteiligung, oder begleitet von anhaltenden überwertigen Ideen, täglich über Wochen oder Monate auftretend.
6. Gedankenabreißen oder Einschiebungen in den Gedankenfluss, was zu Zerfahrenheit, Danebenreden oder Neologismen führt.
7. Katatone Symptome wie Erregung, Haltungsstereotypien oder wächserne Biegsamkeit (...), Negativismus, Mutismus und Stupor.
8. "Negative" Symptome wie auffällige Apathie, Sprachverarmung, verflachte oder inadäquate Affekte, zumeist mit sozialem Rückzug und verminderter sozialer Leistungsfähigkeit. Diese Symptome dürfen nicht durch eine Depression oder eine neuroleptische Medikation verursacht sein.
9. ... ( ebd.: S.104 f.)
Abgesehen davon, "dass der Prozess der Festlegung einer von Menschenhand gezogenen Grenzlinie mit Sicherheit auch zu falschen Klassifikationen " ( Cancro, 1984, S.2) führen kann, scheint die Funktion der Diagnosesysteme für Bock inzwischen insofern verändert, als sie nicht mehr nach "absoluten und eindeutigen Erklärungsmustern" (1999, S. 47) suchen, sondern "eher die Funktion der Klassifizierung und Ordnung von Symptomen" (ebd.) erfüllen. Damit wären die Diagnosesysteme zu einem Hilfsmittel für die Verständigung zwischen Wissenschaftlern "degradiert" (so zum Beispiel um die Reliabilität von epidemiologischen Untersuchungen [s. o.] annähernd zu gewährleisten). Finzen merkt an, dass in der ICD-10 der Begriff "Krankheit" durch den Begriff "Störung" ersetzt wurde. Die Diagnose nimmt somit keine klare Einordnung eines Menschen als "schizophren" vor, sondern "die Diagnose ist auf diese Weise zum Konstrukt geworden, zur Arbeitshypothese" (2000, S. 66). Da sich diese Psychopathologie auf die Krankheit und nicht auf den Kranken richtet, plädiert Scharfetter für eine (therapierelevante) "Ich-Psychopathologie", die "in den Mittelpunkt ihres Interesses die Frage nach dem Selbst-Ich-Erleben des Menschen, nach des Patienten eigenem Verständnis (Deutung) des Zusammenhanges von Erleben und Verhalten" (1990, S. 70) stellt. So warnen auch Bock, Dörner und Naber vor den Gefahren einer "pathologisierenden Psychiatrie", die bei der Konzentration auf die pathologischen Kriterien den Blick auf die je individuellen Besonderheiten und Bedürfnisse der Betroffenen verliert, und fordern eine "anthropologische Psychiatrie", die sich auf die Gesamtwirklichkeit des Menschen bezieht (vgl. 2004, S.11 ff.).
In einer individuums- und ressourcenorientierten Psychiatrie, also einer Psychiatrie, die "klassischen sozialpädagogischen Werten" verbunden ist, sind die Diagnosesysteme nur als Hilfskonstrukt zu betrachten. Allerdings eröffnen standardisierte medizinische Diagnosen auch die Möglichkeit "der Entlastung und dem Schutz vor Alltagsanforderungen" (Dörner, 2004, S.21) und ermöglichen den Zugang zu Hilfeleistungen und –systemen durch Gutachten für beispielsweise Krankenkassen und andere Versicherungsträger. Andererseits hat die Diagnose "psychische Erkrankung" ein erhebliches Potential, Stigmatisierungsprozesse auszulösen.
Eine weitere Möglichkeit zur Systematisierung der möglichen Symptome von Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis bietet die Unterteilung in positive und negative Symptome. "Geben die positiven Symptome anscheinend ein Übermaß oder eine Verzerrung normaler Funktionen wieder, so scheinen die Negativsymptome für eine Verminderung oder den Verlust normaler Funktionen zu stehen" (Bosshard et al., 1999, S. 145). Soweit die Literatur diese Einteilung übernimmt (hier: Alanen, 2001; Bosshard et al., 1999; Scharfetter, 1990; Wienberg, 1997), herrscht relative Einigkeit über die Zuordnung folgender Symptome:
Positive Symptome: Wahnphänomene, Halluzinationen;
Negative Symptome: (sozialer) Rückzug, Passivität / Apathie / Initiativverlust.
Bei der Zuordnung anderer Symptome herrscht weniger Übereinstimmung. Allerdings gilt es bei dieser Zuordnung zu bedenken, dass alle Symptome unabhängig voneinander oder mehrere Symptome aus den verschiedenen Gruppen gleichzeitig auftreten können. Werden die Positivsymptome und ein Teil der Negativsymptome als morbogen, also unmittelbar krankheitsbedingt angesehen, so können ein anderer Teil der Negativsymptome als Reaktion auf Krankheits- oder Anstaltserleben, also als sekundäre Negativsymptome bezeichnet werden. Eine genaue Zuordnung ist jedoch kaum möglich (vgl. Bosshard et al., 1999, S. 146; Wienberg, 1997, S. 26 f.).
Als ein übergreifendes Kennzeichen von Menschen mit schizophrenen Psychosen können Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Anforderungs- und Stresssituationen angesehen werden:
Persons with schizophrenia often report chronic difficulty coping effectively with both major and minor stresses (...). They may possess a relatively limited repertoire of coping strategies (...) and tend to avoid rather than actively attempt to solve problems (...). As a matter of coping style they thus may spend relatively little time thinking or talking about how to resolve a dilemma, and/or be less likely to actively and constructively respond to the stressor. Beyond being intuitively a matter of concern, maladaptive coping patterns in schizphrenia are of larger importance because they have been linked to symptom exacerbation and failure to sustain community tenure (...). (Lysaker et al., 2004, S. 73)
Abgesehen von dieser Darstellung der Symptome und Symptomgruppen darf nicht übersehen werden, dass die Erkrankung an einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis für die Betroffenen vor allem bedeutet, ein "Leben mit der Schizophrenie" (Zaumseil & Leferink, 1997, S. 8) zu führen. Dies bedeutet - neben dem Erleben und Erleiden der Symptome und der Therapien – auch: "die Führung des Lebensalltages, die Entwicklung eines krankheitsangemessenen Lebensstils, die Einbindung der Krankheit in die Biographie und die persönliche Identität, die 'Rechtfertigung' des eigenen Lebens gegenüber den anderen, bestimmte Formen der Interpretation der Krankheit" (ebd.).
2.4 Verlauf und Prädiktoren
Der Verlauf psychotischer Erkrankungen gestaltet sich genauso individuell wie das Auftreten und die Ausprägung von Symptomen. Da Langzeituntersuchungen "enorme und völlig uneinheitliche Entwicklungsmöglichkeiten dieser verwirrenden Erkrankung ergeben" (Ciompi, 1982, S. 252) haben, schlägt Ciompi eine grundsätzliche Dreiteilung des Verlaufes der Krankheit (bzw. des Verlaufes des Lebens eines an einer Schizophrenie erkrankten Menschen) vor:
1. Die Phase von der Geburt bis zum Krankheitsausbruch (= prämorbide Phase)
2. die akut psychotische Phase
3. die chronische Phase (ebd., S. 259).
In der prämorbiden Phase "entwickelt sich die besondere Verletzlichkeit für Schizophrenie durch ein Wechselspiel von (angeborenen und erworbenen) biologischen sowie psychosozialen Einflüssen und Bedingungen" (Wienberg, 1997, S. 33 f.) (s.u.: Vulnerabilitätstheorie, die Ciompis Phasenmodell zugrunde liegt). Wie genau günstige und ungünstige Faktoren miteinander oder gegeneinander wirken, ist nicht bekannt.
Die Phase der akuten psychotischen Dekompensation "bricht ... bevorzugt in Stress- und Überforderungssituationen jeder Art aus; sie kann einmalig und völlig reversibel sein oder aber sich zunehmend einschleifen, wiederholen und schließlich in Form von bestimmten 'Residualzuständen' chronisch werden" (Ciompi, 1982, S. 260).
Die chronische Phase "umfasst die langfristige Entwicklung nach dem Durchleben einer oder mehrerer akutpsychotischer Phasen" (Wienberg, 1997, S. 34) und ist ein "kaum vorhersehbarer, offener Lebensprozess" (ebd.). Da die Unterschiede zwischen "chronischer psychischer Erkrankung" und "psychischer Behinderung" nicht eindeutig festgelegt und die Übergänge fließend sind, werden in dieser Arbeit die Begriffe synonym gebraucht (vgl. z.B. Bosshard et al., 1999, S. 31 f.; Ronge, 1997, S. 811 f.; zum juristischen Behinderungsbegriff s.u. I.3.2.2).
Der Ausbruch einer schizophrenen psychotischen Erkrankung, also der Eintritt in die zweite Phase dieses Phasenmodells, liegt im Durchschnitt im dritten Lebensjahrzehnt, wobei Frauen durchschnittlich später als Männer erkranken (Häfner, 2000, S. 123/205). "Drei Viertel aller Neuerkrankungen und vier Fünftel aller Neuerkrankungen der Männer ereignen sich damit zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr, jener Periode im Lebenszyklus, in der die Mehrheit der Menschen in entwickelten Ländern Schule und Ausbildung abschließt, das Elternhaus verlässt, in den Beruf eintritt und eine Familie gründet oder wenigstens eine Partnerschaft begonnen hat" (ebd., S. 130).
Da das Zusammenspiel verschiedener Faktoren immer höchst individuell abläuft und in der Gesamtheit wohl nicht zu fassen ist, kann die Angabe über Prädiktoren für einen guten Verlauf, also eine kurze, wenig belastende akute Phase ohne anhaltende Schädigung und häufige, schwere Rückfälle, oder einen schlechten Verlauf keine Allgemeingültigkeit beanspruchen.
In verschiedenen Studien wurden prädiktive Faktoren für einen positiven Verlauf ermittelt: Abwesenheit von Kernsymptomen oder ihre nur geringe Dauer, akuter Krankheitsbeginn im Unterschied zu allmählichem Auftreten, Erstmanifestation in höherem Alter, geringere Isolationstendenz, Vorhandensein affektiver Ausdrucksfähigkeit, eine heterosexuelle Paarbeziehung vor Krankheitsausbruch und 'Normalität' zwischenmenschlicher Kontakte ganz allgemein wie auch eine Arbeitsstelle und ein befriedigendes finanzielles Auskommen vor der Erkrankung (Alanen, 2001, S. 55).
2.5 Ätiologie
Es existiert keine hinreichende Erklärung für das Entstehen einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis. Obwohl viele Forschungsergebnisse auf mögliche Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichsten Faktoren und dem Auftreten der Erkrankung hindeuten, ist eine eindeutige kausale Zuordnung nicht möglich. In Abschnitt I.2.5.1 werden einige Ergebnisse der Schizophrenieforschung aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Schulen und die daraus resultierenden Modellvorstellungen der Schizophrenien zusammengefasst. Im Abschnitt I.2.5.2 wird mit dem Vulnerabilitäts - Stressbewältigungsansatz ein Modell vorgestellt, das die Integration der verschiedenen Ansätze ermöglicht.
2.5.1 Ansätze der Schizophrenieforschung und Modellvorstellungen
Die biomedizinische Forschung konnte trotz familiärer Häufungen von Schizophrenien keine eindeutigen Rückschlüsse auf die tatsächliche Vererbung der Krankheit ziehen. Allerdings wird der genetischen Prädisposition von vielen Autoren insofern eine Beteiligung an der Entstehung von Psychosen eingeräumt, als das Vorhandensein gewisser Genomkonstellationen in Zusammenhang mit Umweltfaktoren einen Einfluss auf eine Vulnerabilität (s.u.) haben kann.
Weitere biomedizinische Forschungen beschäftigen sich mit der Suche nach hirnphysiologischen Veränderungen oder Störungen des (Hirn-) Stoffwechsels als Verursacher der Krankheit. Wurden in der Tat Veränderungen in der Entwicklung bzw. dem Aufbau der Gehirne und dem Neurotransmitterhaushalt Schizophrener gefunden, so sind diese jedoch nicht schizophreniespezifisch und können nicht als pathogen oder als Folge der Erkrankung bzw. als überhaupt mit der Erkrankung in Zusammenhang stehend bewertet werden.
Aus psychoanalytischer und individualpsychologischer Sicht wurden eine Reihe von Konzepten entwickelt, die die Ursache der Schizophrenien in einer "tief verwurzelten Störung der Persönlichkeitsentwicklung" (Alanen, 2001, S. 57) sehen. Nach Finzen können diese psychologischen Konzepte schizophrenes Verhalten zu verstehen helfen und sie in ihren inneren Zusammenhängen als sinnvoll interpretieren. Sie können jedoch keinen Beitrag zur Erklärung der Verursachung der Krankheit leisten (2000, S. 81). Arieti räumt den psychologischen Ursachen eine wichtige Rolle ein, betont jedoch die biologische Prädisposition (1985, S. 116).
Einen interaktionellen Ansatz vertritt die Familienforschung. Phänomene, die in Familien mit schizophren erkrankten Mitgliedern (jedoch nicht nur dort!) gefunden wurden, sind:
- Die Beziehungsfalle, also das regelmäßige Auftreten von Double-Bind-Situationen, in denen widersprüchliche Signale ausgesandt werden,
- die gebundene Familie, in der kaum Kontakte zur Außenwelt gepflegt und Abgrenzungen zwischen den Rollen der einzelnen Familienmitgliedern kaum vorgenommen werden,
- die weiche Realität, in der kein Konsens über familiäre Regeln und somit Konfusion herrscht,
- Expressed Emotions, womit ein hohes Niveau des (besonders negativen) gefühlsmäßigen Engagements innerhalb einer Familie gemeint ist (vgl.: Bosshard et al., 1999, S. 178 f.).
Zaumseil & Leferink betonen, dass eine Verursachung der Schizophrenie durch diese Phänomene nicht nachgewiesen werden konnte, wohl aber ein deutlicher Zusammenhang zwischen Expressed Emotions und der Häufigkeit von Rückfällen vorliegt (1997, S.15). Alanen (2001) führt die enge Verwandtschaft von psychoanalytischen und familiendynamischen Forschungen an und sieht die Entwicklungsstörung (bei nicht organisch erklärbaren Psychosen) als im zwischenmenschlichen Bereich begründet an, wobei die prädisponierende Rolle genetischer Faktoren bedeutend bleibt. Er erinnert an den systemischen Zirkel: "Es bestehen nicht nur Einflüsse der Eltern auf ihre Kinder, sondern diese beeinflussen auch ihre Eltern, und erwachsene Schizophrene bedeuten auch erheblichen Stress für ihre Angehörigen; dies kann auch in umgekehrter Richtung gelten" (S.109).
Die Inzidenzrate für Schizophrenien liegt in der sozialen Unterschicht um das Dreifache, die Prävalenzrate um das Neunfache über der in Mittel- und Oberschicht (vgl. Finzen, 2000, S. 77). Diese Daten werden als das Ergebnis eines sozialen Drifts angesehen, der auch über mehrere Generationen erfolgen kann. Damit ist eine soziale "Abwärtsbewegung" von Menschen, die eine erhöhte Verwundbarkeit und dadurch verringerte soziale Durchsetzungsfähigkeit besitzen, gemeint (vgl. ebd.). Allerdings können die Lebensbedingungen in diesem Milieu ungünstige Auswirkungen auf Ausprägung und Verlauf einer Erkrankung haben (vgl. Arieti, 1985, S. 117 ff.; Bosshard et al., 1999, S. 179 f.).
Die Übertragung des Labeling - Approach , also der Verursachung von abweichendem Verhalten durch gesellschaftliche Etikettierung, auf die Schizophrenien war nicht erfolgreich. Etikettierungsprozesse lösen keine Psychose aus, "die Art und Weise des Umgangs der Umwelt mit den Kranken [hat jedoch] wesentlichen Einfluss auf den Krankheitsverlauf..." (Finzen, 2000, S. 76). So trägt die Diagnose einer psychischen Erkrankung natürlich ein erhebliches Stigmatisierungspotential in sich.
2.5.2 Vulnerabilitätstheorie als integratives Modell
Da keiner der vorgestellten Ansätze eine hinreichende Erklärung für das Entstehen einer so vielfältig ausgestalteten Gruppe von Erkrankungen und auch keine hinreichende Erklärung für den Ausbruch einer konkreten Psychose bietet, ist es sinnvoll, von einer multifaktoriell begründeten Krankheit auszugehen. Eine Möglichkeit, die Einzelergebnisse der verschiedenen ätiologischen Forschungen zu integrieren, stellt die Vulnerabilitätstheorie nach J. Zubin dar. Grundsätzlich geht dieser Ansatz von einer Trennung zwischen schizophrener Erkrankung und Disposition hierzu aus. "Während die Krankheit ein episodisches Geschehen sei, mit einem Wechsel zwischen florider Symptomatik und Vollremission, wäre Vulnerabilität durch Zeitstabilität charakterisiert" (Olbrich, 1990, S. 19) und unterscheidet sich damit vom medizinisch/biologischen Krankheitsverständnis, das einen steten Krankheitsprozess mit Phasen der Remission annimmt.
Unter Vulnerabilität versteht Zubin eine "Schwellensenkung des Individuums. Die Absenkung besteht vor allem gegenüber sozialen Reizen, die dadurch zu Stressoren werden und in der Lage sind, psychotisches Geschehen (über Zwischenschritte) auszulösen" (ebd.). Die Schwellensenkung bezieht sich auf die Fähigkeit des Individuums, Reize/Stressoren aus der Umwelt so zu verarbeiten, dass eine Störung der psychischen Homöostase vermieden oder möglichst schnell beseitigt werden kann. Der vulnerable Mensch kann Störungen des inneren Gleichgewichts nicht so begegnen wie der nicht vulnerable, so dass schon ein relativ niedriges Erregungsniveau zu Spannungszuständen bis hin zum Ausbruch einer psychotischen Phase führen kann: "Unter Vulnerabilität selbst verstehen wir jene, eine Person charakterisierende Eigenschaft, die sich unter bestimmten provozierenden oder auslösenden Umständen in der Entwicklung einer Krankheitsepisode manifestiert" (Zubin, 1990, S.49). Die Ausprägung der je individuellen Vulnerabilität kann sowohl von biologischen (genetischen, neuropsychologischen, anatomischen und metabolischen) als auch von umweltbedingten (ökologischen, entwicklungs- und lerntheoretischen) Faktoren beeinflusst werden. Die Vulnerabilität ist also zum Teil angeboren und zum Teil erworben. Ein hervorstechendes Merkmal der Menschen mit erhöhter Verletzlichkeit ist die "Schwierigkeit der Verarbeitung komplexer Informationen, mit anderen Worten eine ausgeprägte Belastungs- und Stressempfindlichkeit" (Ciompi, 1982, S. 267).
Zubin sieht spezifische Stressoren als Auslöser von psychotischen Phasen an: "Denkbar wären äußere Ereignisse, wie z.B. ein dramatisches Lebensereignis, ein inneres Geschehen, vielleicht eine mit Stress zusammenhängende Veränderung im Immunsystem oder wie auch immer geartete länger anhaltende Irritationen oder Störungen, die schließlich einen kritischen Schwellenwert erreichen, der genügt, eine Episode in Gang zu setzen" (1990, S. 50) (s.o.: I.1.2 Stimuluskonzepte, I.1.3 Reaktionskonzepte, I.1.4 Transaktionale Konzepte). Treten diese spezifischen Stressoren nicht auf, so kann die Vulnerabilität verborgen bleiben und es entwickelt sich kein Phänotyp der Erkrankung.
Es hängt von verschiedenen Moderatorvariablen ab, ob die Konfrontation mit einem spezifischen Stressor bei einer vulnerablen Person eine Krankheitsphase auslöst und wie diese Krise dann verläuft. Solche Moderatorvariablen können die persönlichen Lebenserfahrungen des Betroffenen, beispielsweise bekannte und bewährte Coping-Strategien, der sozioökonomische Status, beispielsweise das Wissen um und der Zugang zu Hilfsangeboten, oder soziale Netzwerke des Betroffenen, die soziale Unterstützung, die er erfährt, sein. Während die Vulnerabilität selbst nicht beeinflussbar ist, bieten die Moderatorvariablen Möglichkeiten des Einflusses auf die psychische Gesundheit.
Diese Vulnerabilitätstheorie ermöglicht es, die unter I.2.5.1 auszugsweise vorgestellten Erkenntnisse der unterschiedlichen Forschungsansätze zusammen zu führen. Sie betont die Individualität der Entwicklung der Betroffenen und erklärt ihre Lebensgeschichten nicht zu unendlichen Krankengeschichten, da die Grundeigenschaft der Betroffenen eben nicht die Erkrankung, sondern eine Grundeigenschaft der Betroffenen die erhöhte Verletzlichkeit ist. Durch die Moderatorvariablen ist der Mensch seiner Verletzlichkeit nicht vollkommen machtlos ausgeliefert, sondern ist in der Lage, Einfluss auf seine psychische Gesundheit zu nehmen. Kennt ein Betroffener die für ihn spezifischen Stressoren und ihre Wirkung, so kann er möglicherweise auch diese Variablen aktiv verändern.
2.6 Therapeutische Ansätze
Schizophrene Psychosen sind behandelbar. Allerdings führen die therapeutischen Bemühungen nicht zu einer Heilung, sie können lediglich das Auftreten und die Ausprägung der Symptome beeinflussen, Hilfestellung beim Umgang mit der Erkrankung bieten und die Rezidivprophylaxe unterstützen (vgl. Finzen, 2000, S. 125 ff.; Rahn, 1999, S.274 ff.). Aus den unter I.2.5.1 vorgestellten verschiedenen ätiologischen Ansätzen und Krankheitsmodellen resultieren ebenso vielfältige wie unterschiedliche Ansätze der Behandlung von Schizophrenien. Da jedoch für sich genommen keines dieser ätiologischen Modelle eine hinreichende Erklärung für das Auftreten einer Psychose darstellt, kann auch keine einseitig orientierte Behandlungsmethode zum Erfolg führen. Sinnvoll sind deshalb therapeutische Verfahren, die verschiedene Ansätze kombinieren. Sie tragen nicht nur der multifaktoriellen Verursachung und Beeinflussung des Verlaufes (vgl. Rahn, 1999, S.275), sondern auch den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen (durch relative methodische Offenheit) Rechnung. Im Sinne der Vulnerabilitätstheorie schlägt Rahn eine Zuordnung der verschiedenen Therapieverfahren in zwei Kategorien vor: "Die eine Gruppe bilden jene Verfahren, die die Stressbelastung des Betroffenen verringern helfen, die zweite solche, die die Verbesserung der Stressbelastungsfähigkeit zum Ziele haben" (1999, S. 278).
Verfahren, die die Stressbelastung reduzieren, sind
- Selbstheilungsversuche mit sozialem Rückzug
- Neuroleptikatherapie
- Soteria-Konzept, Angehörigenarbeit nach dem Expressed Emotions- Konzept
- Familientherapie nach dem strukturellen Modell
- Rehabilitation nach dem Lebensraum-Modell.
Verfahren, die die Stressbelastungsfähigkeit verbessern, sind
- Selbstheilungsversuche mit kognitiver Umstrukturierung
- psychoanalytische und psychotherapeutische Techniken
- kognitives Training
- Angehörigenarbeit nach dem Selbsthilfe-Netzwerk-Konzept
- systemische Familientherapie
- Rehabilitation mit soziotherapeutischen Techniken (vgl. ebd.).
Diese Einteilung erscheint unter Beachtung der in I.1.6 formulierten Möglichkeiten des Umgangs mit Stress sinnvoll. Eine eindeutige Zuordnung der einzelnen Verfahren zu den beiden Kategorien erweist sich jedoch als problematisch, da beispielsweise die Neuroleptikatherapie nicht nur die Stressbelastung durch Symptomunterdrückung reduziert, sondern auch den Betroffenen "dickfelliger" gegenüber Reizen macht, also die Stressbelastungsfähigkeit erhöht (vgl. auch Finzen, 2000, S. 129).
Auf die einzelnen therapeutischen Verfahren soll hier nicht eingegangen werden, allerdings soll die besondere Bedeutung der Rehabilitation im Allgemeinen und der beruflichen Rehabilitation im Besonderen für die Behandlung schizophren Erkrankter erläutert werden. "Ziel der Rehabilitation ist die Erhaltung von Fähigkeiten während der Erkrankung, die Wiederherstellung von Fähigkeiten, die durch die Krankheit beeinträchtigt sind, und die Entwicklung und Förderung solcher Fähigkeiten, die ersatzweise an die Stelle verlorener oder behinderter Fähigkeiten treten können" (Häfner, 2000, S. 350). Hier gilt es zu bedenken, dass gerade im Bereich der psychischen Erkrankungen eine klare – inhaltliche und zeitliche - Unterscheidung zwischen Therapie und Rehabilitation nicht möglich ist. So verlaufen pharmakologische und psychotherapeutische Maßnahmen oftmals parallel zu Rehabilitationsmaßnahmen, da die Rehabilitation oftmals erst durch die (medikamentöse) Rezidivprophylaxe ermöglicht wird (vgl. Reker, 1998, S. 13). Gleichzeitig kann die Rehabilitation im Bereich Arbeit und Beschäftigung neben dem Versuch der gesellschaftlichen Wiedereingliederung selbst einen wichtigen Beitrag zur Rezidivprophylaxe, zum Aufbau sozialer Netzwerke, zur Verhinderung von Chronifizierungen und eine Alternative zur längerfristigen Übernahme der Patientenrolle darstellen, also therapeutische Ziele unterstützen (s.u. I.3.2.3). Alanen betont die Wichtigkeit der arbeitsbezogenen und sozialen Rehabilitation für einen dauerhaften Behandlungserfolg (vgl. 2001, S. 145, S. 159). Bullenkamp erkennt arbeitstherapeutische Maßnahmen als "notwendige Ergänzungen einer erfolgversprechenden psychopharmakologischen Langzeitbehandlung schizophrener Psychosen" (1998, S. 236). Andererseits verursachen die Medikamente oftmals unerwünschte Nebenwirkungen, die die rehabilitativen Maßnahmen stören oder unmöglich machen: Neben den extrapyramidalen Störungen, die Einschränkungen der Motorik verursachen, werden auch medikamentös bedingte Minderungen des Leistungsvermögens, insbesondere eine Verstärkung der sowieso oft vorhandenen Antriebsstörungen, beschrieben (vgl. ebd., S. 228 f.).
2.7 Zusammenfassung
Die Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis sind eine vielgestaltige Gruppe von Erkrankungen. Ebenso vielgestaltig wie die Ausprägung der Symptome und der Verlauf der Krankheit stellt sich der Diskurs über die Verursachung der Schizophrenien dar. Mit dem Vulnerabilitätsmodell wurde ein integratives Modell vorgestellt. In diesem Modell, in der Darstellung der Symptome, in der Beschreibung des Verlaufes der Erkrankung und bei den Therapieverfahren spielen Stressoren, die Fähigkeit oder eingeschränkte Fähigkeit, auf Stress im weitesten Sinne "gesundheitserhaltend" zu reagieren, und die Verbesserung dieser Fähigkeit eine entscheidende Rolle.
[...]
- Arbeit zitieren
- Benjamin Ochel (Autor:in), 2005, Stress und Stressbewältigung in der beruflichen Rehabilitation schizophren Erkrankter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38828
Kostenlos Autor werden








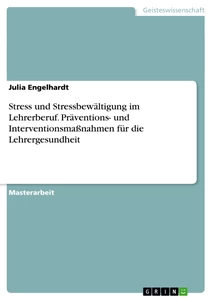











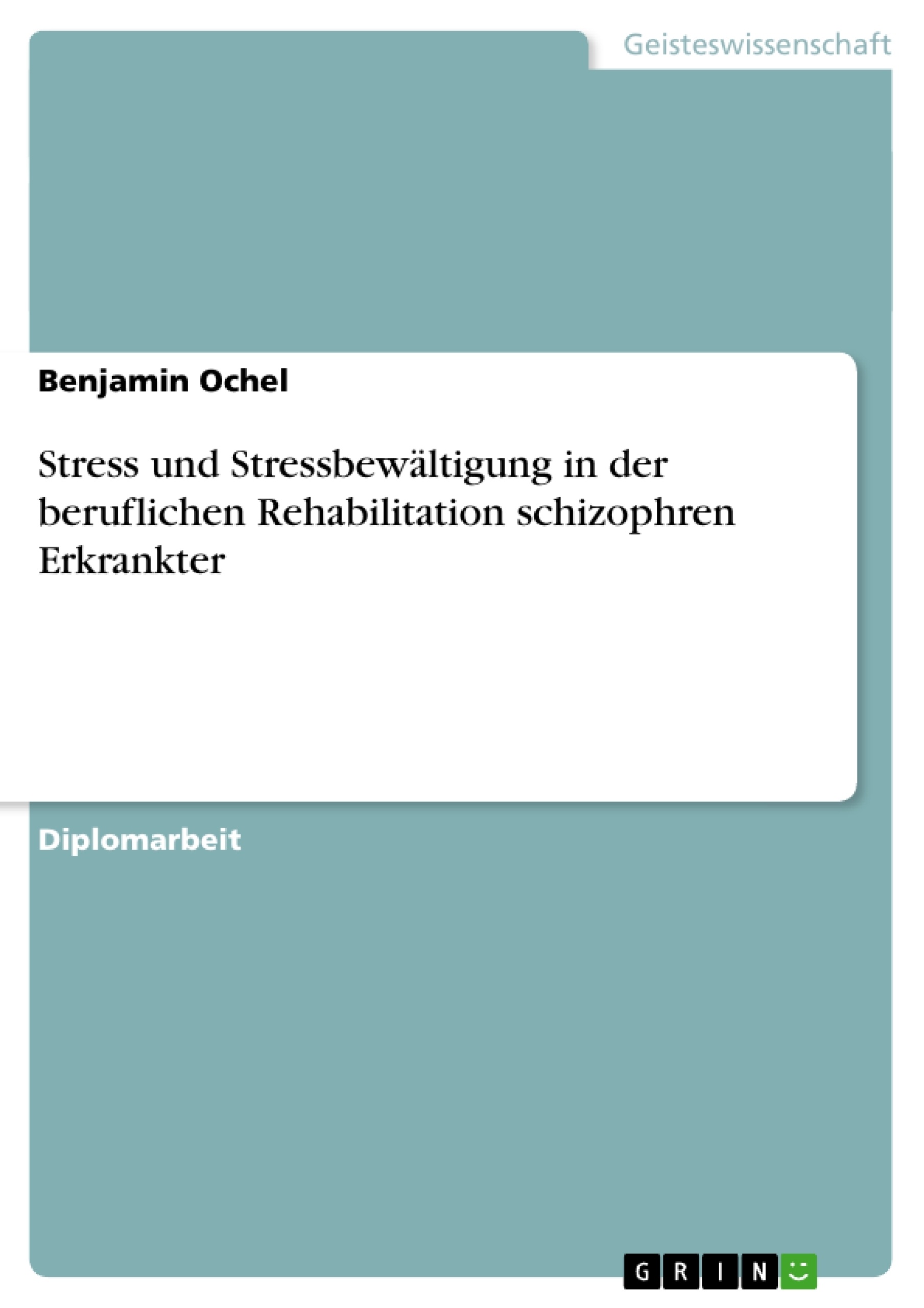

Kommentare