Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
1. Einleitung
2. Begriffsbestimmung
3. Vorbilder und Imitation
3.1. Frühste Kindheit und Kindheit
3.2. Adoleszenz
3.3. Erwachsenenalter
3.4. Neurobiologische Erkenntnisse
3.5. Zusammenfassung
4. Grundlegende Bedingungen für die Wirkung von Vorbildern
4.1. Aufmerksamkeit
4.2. Gedächtnis
4.3. Reproduktion des Verhaltens
4.4. Bekräftigungs- und Motivationsprozesse
4.5. Ähnlichkeit
4.6. Zusammenfassung
5. Situative und personale Determinanten von Vorbildern
5.1. Nähe
5.2. Physische Attraktivität
5.3. Macht und Charisma
5.4. Autorität
5.5. Extraversion
5.6. Erfolg
5.7. Zusammenfassung
6. Vorbilder und Handlungsmotivation
7. Vorbilder in konkreten Inhaltsbereichen
7.1. Aggression
7.2. Werther-Effekt
7.3. Prosoziales Verhalten und Altruismus
7.4. Einflussnahme durch gezielte Kommunikation
7.5. Zusammenfassung
8. Soziale Vergleiche mit Vorbildern
9. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Zusammenfassung
Vorbilder - „Sie sind nicht so wie wir, aber wie sie würden wir gerne sein..." (stern.de, 2003a). Vorbilder sind Personen, mit denen wir uns identifizieren und deren Ideale uns mustergültig und nachahmungswert erscheinen. Auch wenn die Abgrenzungen zwischen Vorbildern, Idolen, Stars und Leitbilder fließend sind, lassen sich deutliche Unterscheidungen erkennen. So beinhalten Leitbilder im Gegensatz zu Vorbildern zum Beispiel ein eher entpersonalisierteres und abstrakteres Konzept zukünftiger Lebensentwürfe, Wertesysteme, Kulturmuster oder Verhaltensbilder.
Der Identifikation mit einem Vorbild folgt die Imitation konkreter Verhaltensweisen und die Übernahme sozialer Attitüden, Werte und Normen. Die menschliche Nachahmung bzw. das menschliche Imitationsverhalten wird dabei als ein grundlegender Prozess und ein menschliches Bedürfnis verstanden, welches, häufig unbeabsichtigt, sowohl in den frühen Lebensphasen als auch im Erwachsenenalter eine entscheidende Rolle spielt. Während zunächst Bezugspersonen wie die Eltern oder Vertraute als Vorbilder für Imitationsverhalten fungieren, gewinnen später andere, auch zunehmend medial präsentierte Modelle an vorbildhafter Bedeutung. Die Imitation des Verhaltens von Vorbildern und die Übernahme von Einstellungen und Werten folgen dabei bestimmten Gesetzmäßigkeiten, wobei besonders die wahrgenommene Ähnlichkeit zum Modell von Bedeutung ist. Da aus diesen Gesetzmäßigkeiten zwar notwendige, nicht aber hinreichende Bedingungen abgeleitet werden können, werden Charakteristiken wie Nähe, physische Attraktivität, (charismatische) Macht, Extraversion, Erfolg und Autorität als günstige Faktoren für eine Vorbildwirkung beschrieben. Sowohl bei autoritären, extravertierten, charismatischen, erfolgreichen und physisch attraktiven Persönlichkeiten ist das all entscheidend Merkmal für das Wirksamwerden eines Vorbilds, dass es sich um Menschen handelt, die im gegebenen Augenblick (vermeintlich) ohne mit der Wimper zu zucken sagen oder handeln, wovor wir zögern würden.
Erfolgreiche Vorbilder sind ebenfalls fähig Individuen zu motivieren, Schwierigkeiten zu überwinden und selbst Erfolge zu erreichen. Besonders in Situationen, in denen ein Autostereotyp die Umsetzung von Fähigkeiten in konkreten Leistungen behindert. Zudem zeigt sich die Wirkung von Vorbildern in weiteren divergierenden Kontexten, wie in der Imitation von aggressiven Verhaltensweisen, bei der Unterlassung von prosozialem Verhalten und Altruismus, beim sogenannten Werther-Effekt sowie bei der Einstellungsänderung durch persuasive Kommunikation.
Schließlich können auch soziale Vergleiche mit Vorbildern auftreten. Soziale Vergleiche mit Vorbildern sind aufwärts gerichtet, weil das Vorbild bereits Erfolge erzielt hat, die das Individuum selbst noch nicht erreicht hat, vielleicht auch niemals erreichen wird. Der Vergleich mit einem relevanten und herausragenden Vorbild wirkt aber nur dann inspirierend und motivierend, wenn der Erfolg des Vorbilds als erreichbar eingestuft wird. Da das Verhältnis zu medial vermittelten Vorbildern meistens durch psychologische Nähe und Identifikation gekennzeichnet ist, profitiert das Individuen auch in solchen Konstellationen vom Erfolg seines Vorbilds, wobei hier noch zwischen Vorbildern aus dem Fact- und dem Fiction-Bereich unterschieden werden sollte.
Bei der Wirkung von Vorbildern handelt es sich generell um ein Phänomen, dem keine übergeordnete Theorie zugeordnet werden kann. Auch wenn vordergründig eine (sozial)psychologische Perspektive eingenommen wurde, erfolgte die Herangehensweise an das Thema interdisziplinär.
1. Einleitung
„Sie leuchten im Licht der Bühne, gleißen im Blitz der Kameras. Sie bauen Hütten im Urwald, erfinden die Welt neu, schießen Tore. Und sie nehmen uns fest in den Arm, bringen uns das Laufen bei. Sie sind nicht so wie wir, aber wie sie würden wir gern sein. Fragt man die Deutschen nach ihren Vorbildern und Idolen, schaut man tief in ihre Seele: Zu wem blicken wir auf? Wem eifern wir nach?" (stern.de, 2003a).
Als vorbildlich werden Personen, Handlungen oder auch klar zu bestimmende Personengruppen bezeichnet, die Ideale verkörpern - mustergültig und nachahmungswert erscheinen. Dabei können sowohl Menschen aus dem unmittelbaren Nahbereich zum Vorbild werden, als auch ausschließlich medial transportierte Personen. Dass mit dem Begriff auch von vermeintlich schlechten Vorbildern gesprochen wird, zeigt, dass Verhaltensweisen anderer Menschen unabhängig ihrer gesellschaftlichen Bewertung nachgeahmt werden (Arnold, 2000).
Noch heute bereitet das Vorbild-Postulat vielen Unbehagen. Das lässt sich in Teilen auf die Wirkungsweise und Handlungsreichweite von Vorbildern und daraus resultierende destruierende Folgen für Gesellschaften zurückführen (Riemer, 2011). Eines der schwerwiegendsten Beispiele in der deutschen Geschichte bezieht sich dabei auf die vermeintlich charismatisch paternalistische Führerfigur Adolf Hitler, seinem Unterbau und den daraus herausgegangenen verheerenden Folgen. Diesem Vorbild folgten viele Menschen, mit einer aus der heutigen Sicht erschreckenden Hingabe. In der Zeit des Drittens Reichs wuchs das Vorbild als eine ausgesprochen maskulin und autoritär besetzte Denkfigur, quasi „analog zum Einschüchterungswert" und spiegelte in fragwürdiger Weise vermeintlich eiserne Tugenden wider (Sprenger, 2007).
In den ersten zwei bis drei Nachkriegsjahrzehnten hatten es in der Gesamtbetrachtung Vorbilder möglicherweise leichter haften zu bleiben, da es keine allzu große Auswahl gab (Dürr, 2000). Diese „möglichen", besonders durch die Medien und die Politik getragenen Vorbilder, wurden im Folgenden vor allem durch die «68er-Bewegung» in Frage gestellt und kontrovers, teils hoch konfliktär diskutiert. Am Begriff des Vorbilds kritisierte die «68er-Bewegung», dass dieser im Dritten Reich primär dazu genutzt wurde, bedingungslosen Gehorsam einzufordern, und warnte vor dem autoritären Charakter des Einzelnen, da unter anderem unter lernpsychologischen Gesichtspunkten die Orientierung an einem Vorbild im Sinne eines Imitationslernens oder einer instrumentellen Verstärkung, (einfachsten) Lernmodellen ohne kritischer gedanklicher Kontrolle unterläge (Riemer, 2011, mehr hierzu siehe Kapitel 3., Vorbilder und Imitation, und 4., Grundlegende Bedingungen für die Wirkung von Vorbildern). Der Begriff des Vorbilds hat im 20. Jahrhundert also eine ambivalente Nutzung und Würdigung erfahren.
Dieser Tage wird es nahezu als selbstverständlich behandelt, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene Einstellungen und Verhaltensweisen von Verwandten, Freunden, Lehrern und anderen Personen ihres unmittelbaren Umfelds übernehmen. Und zunehmend wird auch auf die Vorbildwirkung von Stars und Idolen eingegangen (Arnold, 2000). Dennoch scheint es auf den ersten Blick wenig psychologische Theorien zu geben, die sich mit der Funktion und Charakteristik von Vorbildern beschäftigen. Schlägt man das Stichwortverzeichnis einschlägiger Lehrbücher auf, taucht der Begriff nicht einmal auf. Die Untersuchung des Vorbild-Phänomens beschäftigte in der Vergangenheit jedoch immer wieder Gelehrte und Forscher unterschiedlicher Wissens- und Forschungsfelder. Der Psychoanalytiker Siegmund Freud (1856-1939) beschreibt etwa die emotionale Identifizierung mit einem Vorbild als einen psychodynamischen Prozess, dessen Ziel die Angleichung des eigenen Ichs an das zum Vorbild genommene Ich und dessen Motive und Ideale darstellt. Und der kanadische Psychologe Albert Bandura geht in seiner Theorie vom «Lernen am Modell» davon aus, dass sich Menschen in ihrem Handeln zumindest implizit am Handeln ihrer Mitmenschen orientieren (siehe Kapitel 4., Grundlegende Bedingungen für die Wirkung von Vorbildern).
In der vorliegenden Arbeit wird das Konstrukt des Vorbilds insofern untersucht, als dass zunächst die verschiedenen Facetten des Begriffs beleuchtet werden. Nach einer Begriffsklärung (Kapitel 2., Begriffsbestimmung) - Was ist ein «Vorbild»?, Wer kann Vorbild sein?, Was unterscheidet Vorbilder von anderen?, Sind Begriffe wie «Star», «Idol» und «Leitbild» Synonyme? - wird im Folgenden auf den wichtigen Zusammenhang von Imitation und Vorbild in den verschiedenen Lebensphasen von der Kindheit über die Jugend bis ins Erwachsenenalter eingegangen (Kapitel 3., Vorbilder und Imitation). Da die Wahl eines Vorbilds ein äußerst persönlicher Akt ist, und sich aus diesen Gesetzmäßigkeiten zwar notwendige, nicht aber hinreichende Bedingungen ableiten lassen (Kapitel 4., Grundlegende Bedingungen für die Wirkung von Vorbildern), werden auch Determinanten wie «physische Attraktivität», «(Charismatische) Macht», «Extraversion» u.a. beschrieben, die eine Vorbildwirkung begünstigen können (Kapitel 5., Situative und personale Determinanten von Vorbildern). Dass Vorbilder generell fähig sind, Individuen zu motivieren, Schwierigkeiten zu überwinden und selbst Erfolge zu erreichen, wird besonders in Situationen, in denen ein Autostereotyp eine Person in ihrer Umsetzung von Fähigkeiten in konkreten Leistungen behindert, gezeigt (Kapitel 6., Vorbilder und Handlungsmotivation). Zudem zeigt sich die Wirkung von Vorbildern in weiteren divergierenden Kontexten, wie in der Imitation von «aggressiven Verhaltensweisen», bei der Unterlassung von «Prosozialem Verhalten und Altruismus», beim sogenannten «Werther-Effekt», sowie bei der «Einstellungsänderung durch persuasive Kommunikation» (Kapitel 7., Vorbilder in konkreten Inhaltsbereichen). Schlussendlich wird gezeigt, dass auch soziale Vergleiche mit Vorbildern auftreten können, und in diesem Zusammenhang werden einige Aspekte herausgearbeitet, wann wir eher gewillt sind, unser Verhalten an jenem eines Vorbilds zu orientieren (Kapitel 8., Soziale Vergleiche mit Vorbildern), bis abschließend Schlussfolgerungen für die Forschung und Praxis dargestellt werden (Kapitel 9., Schlussbetrachtung).
Die Herangehensweise an das Thema erfolgt interdisziplinär. Auch wenn vordergründig eine sozialpsychologische Perspektive eingenommen wird, werden immer wieder Forschungsergebnisse oder Denkweisen aus anderen Einzelwissenschaften in die Bearbeitung einzelner Themenbereiche mit einfließen. Beispielsweise werden Ergebnisse aus dem Bereich der Organisationspsychologie und der Führungsforschung herangezogen, um das Konstrukt «Charisma» näher zu erhellen; Bei der Beschreibung basaler Lernprozesse werden Aspekte aus der Neurowissenschaft herangezogen; Um die Wirkung medial etablierter Vorbilder zu erklären, werden Anleihen aus den Bereichen der Medienwissenschaft und Mediensoziologie in die Betrachtung einfließen. Weitere Beiträge zur Bearbeitung des Themas liefern zudem die Lernpsychologie, die Persönlichkeitspsychologie, die evolutionären Psychologie, die Pädagogik oder auch die Soziologie.
2. Begriffsbestimmung
Zwar hat der Vorbild-Begriff in den vergangenen Jahren eine semantische Veränderung erfahren (Fritzsche 2000b, in Lindner, 2007), doch kann ein Vorbild nach wie vor als eine Person gesehen werden, deren „... Lebensvollzug einen anderen Menschen so zu beeindrucken vermag, daß dieser sich - auf der Suche nach Wegen eigener Lebensführung - mit ihr identifiziert und in seinem Handeln bemüht [ist], ihr nachzufolgen" (Walrafen, 1971). Mit dem Begriff des Vorbilds verbindet sich also erst einmal eine an eine Person gebundene Vorstellung (Waldmann, 2000), an deren Verhalten sich andere Menschen orientieren und ihr Handeln an ihr ausrichten. Diese Orientierung geht weit über das hinaus, was zum Beispiel in Schule oder Elternhaus an Wissen und/ oder Können vermittelt wird. Häufig erfolgt eine Ausrichtung des eigenen Verhaltens dadurch, dass Verhaltensweisen imitiert und Einstellungen und Werte übernommen werden, wodurch Modelle als Vorbilder für andere Menschen richtungsweisend werden (Erb & Schumpe, 2011). Zu einem Vorbild können Menschen aus dem unmittelbaren Lebensumfeld einer Person («Nahbereich») oder aus der Ferne («Fernbereich») gewählt werden (Waldmann, 2000), deren Verhalten dann unbewusst nachgeahmt wird.
Vorbilder können insofern sogar depersonalisiert oder abstrakt repräsentiert sein, als dass sie nicht nur durch eine konkrete Person dargestellt werden, sondern in Form von Informationen über den herrschenden Konsens vorliegen (z.B. Umfrageergebnisse in den Medien zu aktuellen Themen, Gruppendruck durch normativen Einflusses, Gruppendruck durch informatorische Hinweisreize etc.; z.B. Thoben & Erb, 2010; Sherif, 1935). Der soziale Einfluss von Vorbildern findet demnach in den Bereichen Denken, Fühlen, Urteilen, Entscheiden und auch Handeln statt (Erb & Schumpe, 2011). Umgangssprachlich wird unter Vorbildern dagegen eher eine Person verstanden, die dem Betreffenden häufig nicht nahestehen, aber bewusst erwählt als Modell (Gutmann, 2010), als idealisiertes Muster oder Beispiel genutzt wird, weil sie großes Ansehen genießen, beispielsweise mediale Vorbildtypen (Waldmann, 2000). Dass der Begriff «Vorbild» in psychologischen Theorien nicht auftaucht, kann aber auch mit seiner Mehrdeutigkeit zu tun haben. Als „vorbildlich" werden Personen oder Handlungen bezeichnet, die Ideale verkörpern, mustergültig und nachahmenswert erscheinen. Die Vorstellung, dass es auch „schlechte Vorbilder" gibt zeigt jedoch, dass auch nur die schlichte Tatsache gemeint sein kann, dass Verhaltensweisen anderer Menschen nachgeahmt werden, unabhängig ihrer gesellschaftlichen Bewertung (Arnold, 2000).
Während Vorbilder im traditionellen Sinn Bestandteil einer eher bildungsbürgerlichen Kultur sind, sind «Idole» und «Stars» Elemente der medial-populären Kultur. Idole sind privat geschaffene und in Teilen öffentlich kommunizierte Versionen eines idealisierten Wesens, welches aus zumeist unzureichenden und leichtfertigen Gründen vergöttert wird (Hillmann, 1994). Ihre Überzeugungskraft ist daran gebunden, ob sie eine Geschichte anbieten, die sich als Projektionsfläche eigener Sehnsüchte, Hoffnungen und Erwartungen eignet und/ oder Lösungen für die eigene Situation anbietet. Charakteristisch für den Umgang mit Idolen ist die Gleichzeitigkeit von Distanz und Nähe: Auf der einen Seite ist das Idol über bestimmte Objekte und Praktiken fest im Alltag verankert, auf der anderen Seite ist der Zugang lediglich über mediale Transmitter möglich (Waldmann, 2000). Idole und Stars werden oft synonym verwendet (Scheller-Bötschi, 2006), wobei Stars aus dem Alltäglichen und Üblichen herausgehobene, übernatürliche und unnahbare Personen bekleiden, Ikonen in einem spezifischen Bereich sind, kulturelle Praktiken versinnbildlichen und für eine bestimmte Lebensform stehen (Waldmann, 2000, Hickethier, 1997). Ein Star ist eine personenbezogene Inszenierung, charakterisiert durch eine bestimmte körperliche Präsenz, ein spezifisches Auftreten und eine individuelle Mimik und Gestik, der nicht nur eine Rolle glaubhaft verkörpern kann, sondern es auch versteht ein Publikum zu faszinieren und auf seine Person zu fixieren (Hickethier, 1997). Die wirkliche Person des Stars bleibt dabei unsichtbar bzw. muss unsichtbar bleiben, um die aus Sicht seiner Anhänger angestrebte Funktion erfüllen zu können (Waldmann, 2000). Trotz der genannten inhaltlichen Differenzierungen können die verschiedenen Bezeichnungen als funktionale Äquivalente gesehen werden. Sie bieten personifizierte Inszenierungen bestimmter Lebensentwürfe und können damit zum Ausdruck einer praktizierten Lebenskunst werden (Waldmann, 2000). Idole und Stars können unter diesem Blickwinkel ebenso als Vorbilder gewählt werden, wie Menschen, Objekte, Informationen aus dem nahen und auch fernen Umfeld. Ziel ist es nicht, exakt genauso zu sein wie der Star, aber vielleicht möchte man genauso bewundert, so schön oder so berühmt werden - es ist die soziale Rolle die interessiert (Horx, Zinnecker & Cornelißen, 2002). Die soziale Beziehungsstruktur kann dann sowohl einseitig (Erb & Schumpe, 2011), als auch wechselseitig geordnet sein. Gemein ist diesen Konstruktionen von Vorbildern, dass sie häufig Teil der eigenen Selbstkonstruktion sind: Das Individuum identifiziert sich mit dem Vorbild, und einem bestimmten Vorbild nachzueifern wird zum definitorischen, altersunabhängigen (Horx, Zinnecker & Cornelißen, 2002) Merkmal der eigenen Person (Erb & Schumpe, 2011). Die Abgrenzungen zwischen Vorbildern, Idolen und Stars sind demnach fließend. Da die jeweiligen Begriffsverwendungen in der Regel auf den subjektiven Interpretationen der Beobachteten beruhen, stellt die Unterscheidung ein recht abstraktes Unterfangen dar (Wegener, 2008). Eindeutige Unterschiede lassen sich aber dahingehend treffen, dass eine Unterteilung in Vorbildern aus dem Nahbereich und medialen Vorbildern unternommen werden kann. Die Unterschiedlichkeit der Hintergründe, die einen Menschen zum medialen Vorbild machen, bringen ebenso unterschiedliche Entstehungshistorien mit sich, weswegen sich vier Typen medialer Vorbilder benennen lassen. Erstens können Albert Einstein, Mutter Teresa, Martin Luther King Jr. oder Albert Schweitzer durchaus als mediale Vorbilder bezeichnet werden. Die Ursache ihrer Popularität ist zumeist medienfern, die Erinnerungen an sie werden aber von den Medien transportiert und aufrechterhalten. Zweitens dienen jene Menschen als mediale Vorbilder, die zwar dem Medienbereich zuzuordnen sind bzw. medial gefördert werden, die an ihren Karrieren und ihrem Erfolg jedoch jenseits der medialen Landschaft aktiv arbeiten. Zu nennen wären hier Barack Obama, Michael Jackson oder Bruce Springsteen. Eine Sonderstellung nehmen - drittens - diejenigen Vorbilder ein, die zum Zeitpunkt ihres Ablebens noch keine Vorbilder bzw. nicht einmal prominent waren. Viele von ihnen starben in der Mitte ihres Lebens eines nicht natürlichen Todes. Anzunehmen ist, dass viele dieser «Legenden» in der Bedeutungslosigkeit versunken wären, hätte ihr früher Tod nicht Anlass zur Konstruktion eines Mythos gegeben. Der letzte mediale Vorbildtyp bezieht sich auf von den Medien selbst konstruierte Vorbilder, wie zum Beispiel„Boybands", „Deutschlands Superstars" oder „Germanys Next Topmodels", die innerhalb diverser Fernsehformate nach einem festgelegten Muster gesucht und durch Castingshows geprüft wurden.
Gewisse Überschneidungen bestehen auch zwischen Vor- und Leitbildern: Während das Vorbild für gewöhnlich bestimmte Personen sind, die beispielhaft wirken und auf deren Verhalten sich ausgerichtet werden kann, beinhalten Leitbilder eher entpersonalisiertere und abstraktere Konzepte über zukünftige Lebensentwürfe, Wertesysteme, Kulturmuster oder Verhaltensbilder (Schenk-Danzinger, 1972a).
3. Vorbilder und Imitation
Der Identifikation mit einem Vorbild folgt die Imitation konkreter Verhaltensweisen und die Übernahme sozialer Attitüden, Werte und Normen der Modellperson. Solche Übernahmen sind dabei Ausdruck des grundlegenden Mechanismus` der Anpassung an die (soziale) Umwelt (Erb & Schumpe, 2011). Unsere Neigung Interaktionspartner unbewusst nachzuahmen, bezeichnen Forscher dabei als Mimikry (vom englischen mimicry für «Nachahmung»), angelehnt an den gleich lautenden ökologischen Begriff. Der britische Naturforscher, Evolutionsbiologe und Entomologe H. E. Bates (1825-1892) beschrieb erstmals das Phänomen, dass einige Tierarten, die den gleichen Lebensraum wie ungenießbare Arten bewohnen, sich den optischen (z.B. Schmetterlinge und Schlangen) und akustischen Signalen (z.B. die Schwebfliege imitiert den Summton der Honigbiene) der toxischen Arten anpassen, um Räuber abzuschrecken («Bates`sche Mimikry»). Ungiftige Arten werden so zu Nachahmern der toxischen Vorbilder, wodurch Räuber, die gelernt haben das Vorbild zu meiden, auch den Nachahmern ausweichen (Smith & Smith, 2009). Die Fähigkeiten zu Mimikry und Nachahmung beschreibt daher eine adaptive Funktion, die den Menschen bereits in die Wiege gelegt worden ist und sich daher schon in frühester Kindheit zeigen.
3.1. Frühste Kindheit und Kindheit
Forscher gehen in einigen entwicklungspsychologischen Studien gar davon aus, dass bereits wenige Tage alte Babys, dank ihres gut ausgebildeten Wahrnehmungsapparats (vertiefend siehe Wilkening & Krist, 2002) durch Nachahmung einfache, mimische Gesten eines Interaktionspartners (Eltern/ Erwachsene), wie etwa das Mund öffnen oder das Zunge herausstrecken, lernen (Meltzoff & Moore, 1977). Ob es sich bei solch imitierenden Reaktionen um selektive Nachahmung handelt ist allerdings nicht eindeutig geklärt (Kaitz et al., 1988; Meltzoff & Moore, 1977). Dass Neugeborene ihre Zunge herausstrecken, wenn ein Erwachsener es ihnen vormacht, kann ebenso als Begleiterscheinung der Erregung gesehen werden, die der Erwachsene mit seinen Handlungen (Zunge herausstrecken) bei dem Säugling auslöst (Mussen et al., 1999), dennoch kommt dieser Nachahmung für den spezifisch menschlichen Bereich des Spracherwerbs eine besondere Bedeutung zu. Das Neugeborene ahmt bereits artikulationsartige Mundbewegungen des Gegenübers nach, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Stande ist, dargereichte Laute zu imitieren (Meltzoff & Moore, 1977). Da bei der sprachlichen Produktion nicht so sehr die Laute an sich zählen, sondern in erster Linie die sie erzeugenden Bewegungsmuster (Rizzolatti & Sinigaglia, 2008), sind neben dem kindlichen Stimmspiel in Monologen und Dialogen (vertiefend siehe u.a. Oller, 2000), insbesondere die Nachahmungsprozesse dem Lautinventar der Muttersprache wichtig (Conboy, Sommerville & Kuhl, 2008). Im ersten Halbjahr stützt sich das stimmliche Nachahmen auf die visuelle Wahrnehmung der entsprechenden Artikulationsbewegung (Legerstee, 1991), bis gegen Ende der Expansionsphase im spontanen Repertoire vokalähnliche Laute auftauchen (Kuhl & Meltzoff, 1996). In diesem Zeitraum beginnt auch die selektive Nachahmung Einjähriger von neuen Gesten, Geräuschen und anderen Verhaltensweisen, wobei tendenziell eher jene Verhaltensweisen imitiert werden, die sie bei sich selbst auch beobachten können (Mussen et. al., 1999). Verzögerungen bei der Nachahmung sind bereits vor dem ersten Geburtstag möglich (Meltzoff, 1988), zwischen dem ersten und den folgenden Lebensjahren werden sie jedoch immer häufiger (Mussen et al., 1999) und der Abstand zwischen der beobachteten Handlung und der Imitation vergrößert sich stetig. Bereits Kleinkinder übernehmen also schon während der frühen Phase ihrer Entwicklung Verhaltensweisen ihrer primären Bezugspersonen, so dass diese zum Vorbild ihres Imitationsverhaltens werden.
Die Gründe für das Nachahmungsverhalten von Kleinkindern liegen begründet in dem Wunsch, Reaktionsunsicherheiten zu vermeiden, in der sozialen Verstärkung, in dem Streben nach Ähnlichkeit mit einer anderen Person und in der Verfolgung eines bestimmten Ziels, welches an das Nachahmungsverhalten geknüpft ist. An welchen Personen das Kind sein Verhalten ausrichtet, hängt in erster Linie von seinem Wunsch nach Ähnlichkeit und dem Grad an emotionaler Erregung ab, den diese Person auslöst. Nachahmung fördert für Kinder die soziale Interaktion. Welches Verhalten nachgeahmt wird, hängt also zum einen von der Motivation ab, bestimmte Ziele zu erreichen, zum anderen von der Reaktionsbereitschaft des Nachgeahmten - denn Kinder imitieren häufiger ein Verhalten, für das sie gelobt worden sind, als ein Verhalten, das ignoriert wurde (Mussen et al., 1999). Umgekehrt imitieren Erwachsene im Zwiegespräch mit Kindern häufig die kindliche Sprache (Florack & Genschow, 2010), was sich äußerst positiv auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirkt (Berk, 2005). Generell scheint es also so, dass die Übernahme von Handlungen, die bei anderen beobachtet werden, eine grundlegende menschliche Verhaltensweise darstellt, so dass es nicht verwunderlich ist, dass Kinder im weiteren Verlauf ihrer individuellen Entwicklung durch die Imitationen der Verhaltensweisen ihrer direkten Bezugspersonen, meistens der Eltern, stetig dazu lernen (Erb & Schumpe, 2011). Sie nehmen dabei nicht nur die Menschen und deren Verhaltensweisen in ihrem Umfeld besser wahr, sondern durch die Wahrnehmung von Ähnlichkeiten zwischen den eigenen Handlungen und den Handlungen anderer lernen sie sich auf diese Weise auch selber immer besser kennen. Mit zunehmendem Alter entwickeln Kleinkindern daher auch die Fähigkeit der sogenannten «aufgeschobenen Nachahmung» - sie beginnen sich an das Verhalten von Vorbildern zu erinnern und dieses zeitverzögert zu kopieren, auch wenn die Modelle nicht anwesend sind (Berk, 2005). Meltzoff und Moore (1994) konnten mit ihrem Experiment aufzeigen, dass aufgeschobene Nachahmung bereits sechs Wochen nach der Geburt möglich ist. Kleinkinder, die den Gesichtsausdruck eines fremden Erwachsenen beobachteten, imitierten ihn, wenn sie mit dem gleichen Erwachsenen einen Tag später erneut zusammen waren. Die Forscher gehen davon aus, dass Babys Nachahmungen benutzen, um sich mit Menschen zu identifizieren und mit ihnen zu kommunizieren. Ab einem Alter von zwölf Monaten erinnern Kleinkinder dann auch Verhaltensweisen über etliche Monate hinweg und sind zunehmend dazu befähigt, diese in einem geänderten Kontext zu imitieren (Klein & Meltzoff, 1999) oder gar Handlungen nachzuahmen, die ein Vorbild nur ansatzweise, aber nicht voll ausgeführt hat (Meltzoff, 1995), bis sie im Alter von etwa zwei Jahren vollständige soziale Rollen nachahmen können.
3.2. Adoleszenz
Individuen übernehmen also schon während der frühen Phase ihrer Entwicklung Verhaltensweisen ihrer primären Bezugspersonen, meistens werden die Mütter und Väter zu Vorbildern ihres Imitationsverhaltens. Mit zunehmender sozialer Reife erfolgt dann die «Entsatellitisierung», als Phase der Lösung von der emotionalen Abhängigkeit von den Eltern (Ausubel, 1979). Weil Kommunikation erstmalig als Gestaltungsgröße erlebbar wird, und zwar nicht nur als Zuspruch oder Einvernahme durch Erwachsene, findet die Phase der naiven Imitation ein Ende (Gamm, 2000). Verwirrt, zornig und abgestoßen bemerken die Jugendlichen Verhaltensweisen in ihrer Herkunftsfamilie, die sie selber nicht an sich wissen möchten. Caine (1986) und Schlegel und Barry (1991) erklären diese konfliktträchtige Phase damit, dass bei nicht menschlichen Primaten und innerhalb nicht industrialisierter Kulturen die Jungen bzw. die Kinder die Familiengruppe typischerweise in der Pubertät verlassen, um unter anderem sexuelle Beziehungen zwischen engen Blutsverwandten zu vermeiden. Jugendliche in Industrienationen sind jedoch noch lange nachdem sie die Pubertät erreicht haben, finanziell abhängig von ihren Eltern, weswegen eine körperliche Distanzierung nicht möglich ist. Eine «psychologische Distanzierung» bietet demzufolge das moderne Substitut für eine körperliche Abwesenheit. Daraus resultiert die Notwendigkeit eines intergenerativen Umbruchs (Gamm, 2000). Der junge Mensch wendet sich langsam außerhäuslichen Vorbildern zu, dabei bietet die eigene «Peergroup» Orientierung («Gruppe von Ähnlich-Altrigen»; «Gruppe von Gleichgestellten», die sich ihre eigenen Wertvorstellungen und Verhaltensstandards schaffen, sowie eine soziale Struktur von Anführern und Gefolgsleuten haben, Berk, 2005). Die Peergroup ermöglicht die Erfahrung von Differenz (z.B. zu anderen Peergroups), aber auch von Partizipation und Erlebnisreichtum (Gamm, 2000). Peergroups organisieren sich häufig auf der Grundlage der Nähe («psychologische», wie auch «räumliche», siehe Kapitel 5.1., Nähe) und der Ähnlichkeit (in Alter, Geschlecht usw., siehe Kapitel 4.5., Ähnlichkeit). Über kurz oder lang entwickelt sich innerhalb dieser Gruppen eine «Peerkultur», typischerweise bestehend aus einem Jargon, Kleidervorschriften und einem gemeinsamen Ort. Die Mitglieder lernen viele soziale Fähigkeiten, wie Kooperation, Führungskompetenz und die Fähigkeit sich unterzuordnen, sowie Loyalität den kollektiven Zielen und dem Anführer gegenüber (Berk, 2005). Dabei kann zwischen «beliebten prosozialen Kindern» und «beliebten antisozialen Kindern» unterschieden werden. Es ist leicht vorstellbar, dass Jugendliche sich vor allem beliebte Gleichaltrige zum Vorbild nehmen, die über eine hohe «Peerakzeptanz» verfügen. Diese beliebten Kinder sind meistens freundlich und rücksichtsvoll oder aber verfügen über ein geschicktes, aber dennoch angriffslustiges Verhalten. Die «beliebten prosozialen Kinder» fördern dadurch die Nachahmung ihres Verhaltens durch andere Kinder, da sie von vielen, wegen ihrer schulischen und sozialen Kompetenz, gemocht werden. Im Kontakt mit Gleichaltrigen sind sie einfühlsam, freundlich, kooperativ aber dennoch bestimmt (Newcomb, Bukowski & Pattee, 1993), und häufig sind sie eher gute Schüler. Sicherlich werden sie für ihr Verhalten und ihre Leistung Anerkennung von Lehrern, Jugendlichen oder anderen bedeutsamen Personen erfahren, so dass sie zum Vorbild für andere werden. Im Gegensatz dazu zeigen «beliebte antisoziale Kinder», üblicherweise harte Jungs, ein fragwürdiges, häufig aggressives soziales Verhalten (Rodkin et al., 2000). Vielleicht sind sie gute Sportler, im schulischen Bereich zeigen sie jedoch eher schlechte Leistungen und widersetzen sich gar Autoritäten wie ihren Lehrern. Von ihren «Peers» werden sie allerdings als „cool" betrachtet (Berk, 2005). Im Verlauf dieser Arbeit wird noch detaillierter auf Bekräftigungs- und Motivationsprozesse (siehe Kapitel 4.4 ., Bekräftigungs- und Motivationsprozesse) eingegangen, die die Nachahmungswahrscheinlichkeit eines Verhaltens erklären können. An dieser Stelle sei jedoch ein Vorgriff erlaubt: Auch wenn das antisoziale Verhalten dieser Vorbilder sicherlich nicht durch positive, externe Verstärkungen belohnt wird, können Nachahmer in den Reaktionen (z.B. Angst, Respekt, Anerkennung) Dritter solche Verstärkungen erkennen - vielleicht beschäftigt sich der Lehrer intensiver mit diesem Schüler, die Klassenkameraden arbeiten ihm vielleicht zu, auf dem Schulhof oder in der Freizeit begegnet man dem beliebten antisozialen Kind vielleicht mit Respekt. Obwohl das Vorbild für sein Verhalten häufig sanktioniert wird, wird sein Verhalten vom Beobachtenden positiv bewertet - und er versucht sein Verhalten dem des Vorbilds anzugleichen. Eine Abgrenzung von vorbildhaften Bezugspersonen («reference models») gegenüber Rollenmodellen («role models») lässt sich dabei besonders auf die Arbeiten des Soziologen Robert K. Merton (1968) zurückführen. Bezugspersonen (z.B. Eltern) seien demnach Vorbilder für eine generelle Lebensführung und für die Internalisierung von Einstellungen und Wertesystemen. Rollenmodelle (z.B. Peers) können dagegen zu Imitationen spezifischer Verhaltensweisen (z.B. als Muster für gute schulische Leistungen oder aufmüpfiges Verhalten) anregen.
Der moderne Informationsfluss produziert auf verschiedenen Ebenen, unter anderem Politik, Wirtschaft oder Entertainment, neue Protagonisten und Stars (Riemer, 2011). Es verwundert daher nicht, dass die Identifikation mit Vorbildern (besonders, aber nicht nur) im Jugendalter im Rahmen ihrer Suche nach Selbstfindung und Orientierung vor allem bei Mädchen mit dem Aufbau imaginärer, sogenannter «parasozialer Beziehungen» einher geht, wohingegen Jungen eher ihren Stars und Idolen nacheifern. Parasoziale Beziehungen sind einseitige, nicht-reziproke, scheinbar zwischenmenschliche Bindungen, welche überwiegend junge Menschen (und Senioren) zu Medienpersonen aufbauen, besonders aus dem Fernseher. Solche Beziehungen entstehen infolge wiederholter oder regelmäßiger Begegnungen (sogenannter «Parasozialer Interaktionen»), bei der die Medienperson den Zuschauer adressiert, worauf dieser kognitiv, emotional und sogar konativ reagiert (Visscher & Vorderer, 1998).
Die mediale Darbietung der Lebensentwürfe von Idolen, Stars und Fernsehpersonen bietet dabei fantasieanregende und die eigenen Vorstellungen nährende Storys, die die Bezugspunkte für ein Experimentieren in imaginären Konstellationen sind. Heranwachsende beziehen sich dabei weniger nur auf ein Vorbild, sondern nutzen die Pluralität an Vorbildern um sich einen eigenen Lebensentwurf aufzubauen (Waldmann, 2000). So ist es vorstellbar, dass ein Junge im Bereich Sport Michael Ballack nacheifert, sich hinsichtlich seiner Berufswahl an seinem Vater orientiert und Kofi Annan seine Werte- und Moralvorstellungen prägt. Dabei ist die Wahl männlicher, möglicher Vorbilder bewusst gewählt. Jungen orientieren sich eher an gleichgeschlechtlichen Vorbildern, während Mädchen sowohl Männer als auch Frauen als Vorbilder wählen, wenn auch mit einer leichten Präferenz zum eigenen Geschlecht (Granzner-Stuhr & Payrhuber, 2008).
Forscher beschäftigten sich nicht zuletzt wegen der hohen gesellschaftlichen Bedeutung mit der Imitation von aggressiven Verhaltensweisen oder den Konsequenzen, die die Berichterstattung über Suizide hat, mit der Wirkungsweise, die parasoziale Vorbilder auf Kinder haben (siehe Kapitel 7., Vorbilder in konkreten Inhaltsbereichen). Bis vor kurzem wurde aber außer Acht gelassen, dass serielle Formate verschiedenster Genres auf der Beliebtheitsskala von Kindern und Jugendlichen ganz oben stehen. Dabei deuten bisherige Forschungsergebnisse auf eine intensive Beschäftigung von Jugendlichen in der Entwicklungsphase der Adoleszenz mit von ihnen bevorzugten vermeintlich harmlosen Medienformaten wie Daily-Soaps und Serien hin (Großegger & Heinzlmaier, 2007; Marci-Boehncke & Rath, 2006; Charlton & Neumann, 1990).
Im Vergleich zu anderen Medien (z.B. dem Radio) vermittelt das Fernsehen eine wirklichkeitsnahe Abbildung, und durch die mehrkanalige, audiovisuelle Vermittlung sowie die hohe technische Qualität bekommt der Zuschauer den Eindruck, Anteil an dieser inszenierten Wirklichkeit zu haben. Die spezielle Präsentationsform (z.B. Nahaufnahmen, bestimmte Kameraeinstellungen und Bildausschnitte) erwecken beim Zuschauer den Eindruck eines «face-to-face»-Kontaktes und durch die Trennung von Rolle und Darsteller, sind die Fernsehfiguren keine anonymen Persönlichkeiten mehr (Strobel & Faulstisch, 1998). Bei Fernsehpersonen kann dabei zwischen dem Fernsehstar, der seinen Status durch den Erfolg im Fernsehen erlangt hat (z.B. Showmaster oder Unterhaltungskünstler), den Fernsehprominenten im sogenannten «Fact-Bereich» (z.B. Moderatoren oder Journalisten), den Fernsehprominenten im «Fiction-Bereich» (z.B. Serienschauspieler, Filmschauspieler) und Personen des öffentlichen Lebens (z.B. Sportler, Künstler oder Politiker) unterschieden werden. Durch direkte Ansprache, Blickkontakte, spezielle Kameraeinstellungen, nehmen diese Personen in dem ihnen zur Verfügung stehenden Rahmen Kontakt mit dem Zuschauer auf (Strobel & Faulstich, 1998). Und so verwundert es nicht, dass Einigkeit darüber herrscht, dass der Fernseher zuverlässiger Lieferant für kommerzielle Werte, akzeptierte Kulturtechniken, Stereotype und damit auch für Vorbilder geworden ist (Gangloff, 2010). Granzner-Stuhr und Payrhuber (2008) stellten fest, dass besonders Fernsehstars aus dem Fiction-Bereich teilweise unbewusst auf jugendliche Rezipienten eine starke Vorbildwirkung aufweisen. Sie holen sich Tipps für die eigene Lebensgestaltung und denken über das Handeln und Verhalten der dargestellten Figuren und deren Rollen intensiv nach. Dabei ermöglichen diese Fernsehformate jungen Zuschauern eine starke emotionale, parasoziale Beziehung mit den Protagonisten aufzubauen. Anders als zum Beispiel bei Castingshow- Teilnehmern stehen Soap-Darsteller ihren Zuschauern täglich bzw. wöchentlich zuverlässig zur Verfügung (Gangloff, 2010). Da die Jugendlichen sich eine eigene, von den Eltern unabhängige Existenz aufbauen möchten, orientieren sie sich unter anderem an den Fernsehpersonen. Diese verkörpern den Idealtypus eines geglückten «Selbst» und machen die erstrebte Zukunft schon zum Teil greif- bzw. beobachtbar (Weiß, 2001; Vorderer, 1998). Das Ideal eines erfolgreichen Selbst ist aber nur eines von verschiedenen Beziehungsthemen, die eine parasoziale Beziehung bedingt. Eine weitere Erklärung könnte der Faktor der «psychologischen Nähe» (siehe Kapitel 5.1., Nähe) sein: Nach dem erstmaligen Kontakt zwischen einer Fernsehperson und dem Jugendlichen kann dieser über die fortlaufenden parasozialen Interaktionen entscheiden, die als Zwischenergebnis eine immer wieder neue, aktualisierte Beziehungskonstellation ergibt. Je häufiger solche Interaktionen stattfinden, desto stärker wirken sie sich auf nachfolgende Interaktionsprozesse und die Beziehung aus (Gleich, 1997). Für den Aufbau einer parasozialen Beziehung bedarf es weiterer Voraussetzungen: So konnten Payrhuber und Kollegen (2008) zeigen, dass jene Fernsehfiguren bevorzugt werden, die den eigenen Wertvorstellungen nahekommende Werte vermitteln. Visscher und Vorderer (1998) fanden heraus, dass Fernsehpersonen als „gute Menschen" erlebt werden müssen, um zum Vorbild zu werden. Marci-Boehncke und Rath (2006) postulieren, dass Jungen männliche und Mädchen sowohl männliche als auch weibliche Serienfiguren bevorzugen. Dies gilt auch für die Serienpräferenz: Jungen mögen Serien, in denen gleichgeschlechtliche Personen eine Hauptrolle bekleiden, während Mädchen beide Formen, mit einer leichten Präferenz zum eigenen Geschlecht, bevorzugen (Granzner- Stuhr & Payrhuber, 2008). Medieninhalte werden unter einer identitätstheoretischen Perspektive von den Rezipienten danach ausgesucht, ob die Formate einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leisten, zum Beispiel für eine Problembewältigung, oder ob soziale Vergleiche (siehe Kapitel 8., Soziale Vergleiche mit Vorbildern) und damit eine Einschätzung der eigenen Person ermöglicht wird (Vorderer, 1996). Dies kann unter anderem über die Identifikation mit einem Vorbild, mit der Projektion von eigenen Träumen oder mit der Legitimation der eigenen Lage zum Ausdruck kommen (Burkart, 2002). Die Fernsehpersonen können demzufolge zum Vorbild für den intimsten Bereich des Privatlebens werden (Visscher & Vorderer, 1998). So konnten Witzel und Kollegen (2008) feststellen, dass, seit dem es Arztserien gibt, besonders die Rechtsmedizin für Medizinstudenten an Attraktivität zugenommen hat. Das Vorbild muss für den Jugendlichen eine persönliche Relevanz aufweisen und der Jugendliche sollte über ein Verhaltensrepertoire verfügen, dass es ihm ermöglicht, die Rolle des Vorbilds zu übernehmen, sich in das Vorbild hineinzudenken («role-taking»), um dessen Handeln erfolgreich umzusetzen (Fromm, 1999). Dass eine parasoziale Beziehung Reaktionen von Rezipienten auch außerhalb von der Rezeptionssituation beeinflussen können, zeigten Six und Gleich (2000) in ihrer Studie.
Durch die komplexen, hormonellen Veränderungen markiert die Pubertät den Beginn der Geschlechtsreife und des «Wachstumsschubs». Adoleszente setzen sich deshalb stark mit ihrem Körper auseinander. Besonders gegenwärtig wird viel Wert auf Fitness und äußere Erscheinungen gelegt, so dass Jugendliche sich ständig mit der Umwelt vergleichen. Dabei können sowohl Mädchen als auch Jungen gleichermaßen unzufrieden mit ihrem Körper sein: Jungen, weil sie glauben, dass sie den muskulösen Körperbau ihrer Vorbilder nicht erreichen und Mädchen, weil sie glauben, den gängigen Schönheitsidealen nicht gerecht zu werden (Woolfolk, 2008) - sie fühlen sich entweder zu dick, zu klein, zu hässlich oder aber schlimmstenfalls alles gleichzeitig (Gangloff, 2008). Jones (2004) fand heraus, dass eine solche Unzufriedenheit mit dem eigenen Körperbau durch Gespräche mit Freundinnen zusätzlich forciert wird. Seit 2006 ist darüber hinaus die Unzufriedenheit mit ihrem Gewicht junger (normalgewichtiger) Frauen, besonders bei den zwischen 16 und 17-Jährigen, deutlich gestiegen. Als Ursache dafür wird die Castingshow Germany`s Next Top Model mit Heidi Klum diskutiert, in welcher ein Schönheitsideal propagiert wird, das jenseits der Normalität liegt. Besonders Mädchen identifizieren sich stark mit den Protagonistinnen, bauen gar eine parasoziale Beziehung mit ihnen auf und eifern ihren neuen Idolen Sara Nuru, der Gewinnerin der „Topmodel"-Staffel 2009, und Heidi Klum nach. In diesem Format (wie auch in Dieter Bohlens Deutschland sucht den Superstar) werden Alltagsmenschen zu Vorbildern dafür, dass Beste für einen Traum zu geben, immer an sich zu glauben, fleißig und zielstrebig zu sein (Gangloff, 2010; Gangloff, 2008).
Aber auch andere Fernsehformate wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Zeichentrickserien wie Totally Spies, Powerpuff Girls, Kim Possible oder auch Barbie definieren das gängige Klischee und Schönheitsideale, und werden darüber hinaus durch Berichte über die Brustvergrößerungen von Idolen wie Rihanna oder Victoria Beckham ergänzt. Solche Schönheitsideale sind auf gesunde Weise kaum zu erreichen (zum Beispiel lässt sich die Figur von Barbie nur dadurch erreichen, indem die untersten Rippen entfernt werden) und bieten darüber hinaus den Nährboden für Essstörungen.
3.3. Erwachsenenalter
Während in der frühsten Kindheit und Kindheit häufig die Bezugspersonen mit der Funktion als Vorbilder dienen, Reaktionsunsicherheiten zu vermeiden, sich besser kennen zu lernen, soziale Rollen u.v.m zu erlernen, dienen Jugendlichen besonders ihre Peergroup oder auch Idole und Stars als Vorbilder. Dabei haben diese Vorbilder die Funktion bei der Suche nach Selbstfindung und Orientierung und/ oder bei der Integration in die soziale Umwelt zu unterstützen. Die Imitation von Verhaltensweisen im Erwachsenenalter erfüllt dagegen eine differenzierende Aufgabe: In einer sozialen Gemeinschaft sind gegenseitige Sympathien und Hilfsbereitschaft unentbehrlich, gar überlebenswichtig; außerdem unterliegen wir einem ureigenen Bedürfnis nach Harmonie und Symmetrie. Mit der Nachahmung von Verhaltensweisen eines Gegenübers folgen wir demnach nicht nur unserem Bedürfnis, gleichzeitig übernimmt das Verhaltensmimikry eine wichtige zwischenmenschliche Aufgabe, in dem es Vertrauen schafft, Sympathien aufbaut, Hilfsbereitschaft fördert, usw.
Im Erwachsenenalter neigen Menschen daher eher dazu ihnen ähnliche Personen unbewusst nachzuahmen. Gesprächspartner passen sich zum Beispiel häufig dem Sprechtempo (Webb, 1969, 1972), Rhythmus, Wortschatz und Satzbau, Grammatik (Bock, 1986, 1989; Levelt & Kelter, 1982), Tonlage (Neumann & Strack, 2000) und Akzenten (Giles & Powesland, 1975) ihres Gegenübers an. So konnten Levelt und Kelter (1982) zeigen, dass die Syntax der Antwort von der Syntax der Frage abhängig ist und Neumann und Strack (2000) bemerkten in ihren Untersuchungen, dass Versuchspersonen die Stimmlage einer Person imitierten, obwohl diese gar nicht anwesend war.
Die menschliche Imitation beschränkt sich nicht nur auf die Sprache und die verbale Nachahmung, sondern auch auf innere Prozesse, wie der emotionalen Befindlichkeit oder der Grundstimmung eines Gegenübers. Schachter und Singer konnten dieses Phänomen bereits 1962 belegen. In einem Experiment injizierten sie ihren Versuchspersonen Adrenalin, wodurch es zu einer gesteigerten Aktivität kam, und ließen sie dann mit einem Verbündeten des Versuchsleiters interagieren, der entweder albern oder böse und aufgebracht war. Anschließend mussten die Versuchspersonen ihre Gefühle beschreiben. Obwohl alle die gleiche Aktivierung aufwiesen, schilderten sie in Abhängigkeit des jeweiligen Mitarbeiters, völlig unterschiedliche Emotionen. Die Forscher erklärten ihr Ergebnis damit, dass auf Grund der gesteigerten Aktivierung die jeweilige Emotion für die Versuchspersonen mehr salient wurde, sie den Mitarbeiter imitierten, was bei ihnen eine spezifische Emotion auslöste. Das Stimmungen leicht, schnell und subtil imitiert werden, fanden auch Neumann und Strack (2000) heraus, indem sie aufzeigten, dass lediglich das Zuhören eines fröhlichen oder traurigen Sprechers die Stimmung ihrer Probanden beeinflusste, obgleich ihnen weder diese noch der affektive Zustand des Redners bewusst war. Und Friedmann und Riggio (1981) postulierten, dass allein das Sitzen in einem Raum mit Personen ausreicht, um deren Stimmung einzufangen und zu imitieren.
Da Stimmungen sich in der Mimik niederschlagen, passen sich Interaktionspartner selbst äußerlich an (Florack & Genschow, 2010). Dimberg fand 1982 mit Hilfe Elektromyographie (EMG) heraus, dass sich die Mimik von Menschen unmerklich in den Muskelkontraktionen ihrer Beobachter widerspiegeln (nach Florack & Genschow, 2010). Häufig gezeigte Gesichtsausdrücke aktivieren bestimmte Muskelpartien, wodurch die beteiligten Blutgefäße besser durchblutet werden. Ähnlich wie bei einem Krafttraining stärken die wiederholt dargebotenen Gesichtsausdrücke die jeweilige Muskulatur, wodurch sich die Mimik tatsächlich verändern und sich anpassen kann. Zajonc und Kollegen (1987) berichteten dazu über den erstaunlichen Effekt, dass sich langjährige Partner einander angleichen. Die Forscher erklärten dieses Phänomen damit, dass verheiratete Paare häufiger die gleichen Emotionen teilen, sich also gegenseitig als Vorbilder nehmen und, dass die gegenseitige Imitation der Mimik das soziale Wohlbefinden in engen Beziehungen erhöht. Sicherlich kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Paare auch mehr Möglichkeiten haben, sich zu imitieren, wodurch sich ähnliche Gesichtslinien und Ausdrücke bilden können (nach Florack & Genschow, 2010).
Erste Hinweise darüber, ob sich Menschen sympathischer finden, wenn sie ihr Verhalten gegenseitig imitieren, lieferte LaFrance im Jahr 1979. Sie stellte fest, dass Schüler und Lehrer ihre Beziehung als umso harmonischer einschätzten, je stärker die Schüler Mimik und Körperhaltung ihrer Lehrer nachahmten. Chartrand und Bargh führten Ende der 1990er Jahre mehrere Experimente durch, in denen sie zeigen konnten, dass die Interaktion zwischen Versuchsleiter und Probanden harmonischer verlief, wenn der Versuchsleiter diese imitierte. Außerdem wirkte er sympathischer auf die Teilnehmer und wurde mehr geschätzt (Bernieri, 1988), so dass auch an dieser Stelle die Schlussfolgerung naheliegt, dass Mimikry das harmonische Miteinander ebenso wie den sozialen Anschluss fördert (Florack & Genschow, 2010). In diesem Zusammenhang konnten auch Maurer und Tindall (1983) belegen, dass Berater, die ihre Klienten imitierten, von diesen mehr gemocht werden.
Lakin (2008) geht davon aus, dass wir unsere Mitmenschen vor allem dann nachahmen, wenn wir sozialen Anschluss suchen. Insbesondere wenn Menschen sich ausgeschlossen fühlen, imitieren sie ihren Gegenüber deutlich mehr. Der Drang zur Mimikry wächst allerdings auch in jenen Situationen, in denen uns Nähe aus anderen Gründen wichtig ist, wie zum Beispiel innerhalb intimer Gespräche (Florack & Genschow, 2010). Dass ein Zusammenhang von Mimikry und sozialem Zusammenhalt besteht, zeigen auch die Studienergebnisse von Van Baaren und Kollegen (2003). Die Forscher fanden heraus, dass Kulturen, die sich eher über das Kollektiv definieren, wie zum Beispiel Japaner, stärker zur Nachahmung neigen, als Menschen aus Kulturen, die vor allem Leistung und Unabhängig schätzen - wie zum Beispiel die USA. Forscher, die sich mit Gesten und Körperhaltungen beschäftigen, argumentieren, dass Imitation Zuneigung und Rapport begünstigt. Im Umkehrschluss führt «antimimicking» oder Situationen, in denen das gegenteilige Verhalten gezeigt wird, zu einem Absinken der Sympathie (Dabbs, 1969). Um mit ihrer Umwelt zu harmonisieren, passen sich Menschen daher wie ein Chamäleon («Chamäleon-Effekt») an. Meistens geschieht das aber auf einem «Mikro-Level», das für das Auge kaum oder gar nicht zu erkennen ist. Mittels «Elektromyografie» (kurz EMG) konnten Berger und Hadley (1975) aber zeigen, dass, wenn Versuchspersonen andere beim Armdrücken zuschauten, sich bei ihnen genau jene Muskeln regten, die beim Armdrücken beteiligt sind, und Untersuchungen um Pulvermüller (nach Florack & Genschow, 2010) konnten in diesem Zusammenhang zeigen, dass allein das Lesen von Wörtern wie laufen oder greifen ausreicht, um die für diese Tätigkeiten zuständigen Hirnareale zu aktivieren.
3.4. NeurobiologischeErkenntnisse
Da das Lernen durch Nachahmung bei Menschen von ganz besonderer Bedeutung zu sein scheint und sich durch die Imitation eines anderen Menschen viele Ideen, Moden und Gebräuche, Sprüche, Speisen, Laster und Modeerscheinungen verbreiten, beschäftigen sich in jüngster Zeit auch zunehmend neurologische Forscher mit diesem Phänomen. Die voran beschriebenen Studien legen nahe, dass beim Betrachten von Bewegungen auch jene Hirnregionen aktiv werden, die die entsprechende eigene Motorik koordinieren (Florack & Genschow, 2010). Die Neurologen Nishitani und Riitta (2000) fanden diesbezüglich heraus, dass allein die Beobachtung einer Bewegung den «primärmotorischen Kortex», also das Zentrum für Kontrolle, Koordination und Ausführung von Bewegungen, und Teile des «Broca-Areals», welches die zum Sprechen benötigten Muskeln über den «motorischen Kortex» kontrolliert, aktivieren und folgern aus diesen Befunden, dass sich in diesen Hirnarealen die Koordinationsstelle für ein System sogenannter «Spiegelneuronen» befindet. Spiegelneuronen könnten demnach eine neuronale Basis für das «Lernen am Modell» (siehe Kapitel 4., Grundlegende Bedingung für das Lernen von Vorbildern) liefern, da sie dann reagieren, wenn eine bestimmte Tätigkeit ausgeführt oder wenn jemand bei der Ausführung einer Tätigkeit beobachtet wird. Dieser im Gehirn ablaufende Vorgang des Spiegelns einer Tätigkeit trägt zur Nachahmung, zum Erlernen von Sprache und Empathie bei (Myers, 2008). Die besondere Bedeutung der Sprachregion, also des Broca-Areals, könnte daher rühren, dass die Kommunikation unserer Vorfahren vermutlich auf Bewegungen der Hände und Füße beruhte, so dass seine Entwicklung als die Ausbildung sprachlicher Kommunikation auf Grund des evolutionären Drucks verstanden werden kann (Rizzolatti & Arbib, 1998).
Aus dem Wechselspiel zwischen den sozialen und Umweltfaktoren bilden sich im Laufe des Lebens komplexe Netzwerkbildung auf der Ebene des Gehirns heraus, was später Persönlichkeit genannt wird. Forscher, die sich mit der sozialen Konfiguration im Kindes- und Jugendalter und der neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung beschäftigt haben, gelangen trotz ihrer unterschiedlichen Fragestellungen und Methoden zu durchaus homogenen Befunden: In diesem Sinne besteht für das menschliche Gehirn geradezu eine Programmierung in der Weise, in gefährdeten oder verunsichernden Situationen auf jene tief verwurzelten Verhaltensweisen zurückzugreifen, die sie im Laufe ihrer Individualentwicklung durch Vorbilder gelernt haben (Riemer, 2011).
3.5. Zusammenfassung
Zusammenfassend handelt es sich bei der Orientierung an Vorbildern um eine adaptive menschliche Verhaltensweise, die soziales Lernen, soziale Interaktion und subjektives Wohlbefinden betrifft und deswegen für die Entwicklung jedes einzelnen und darauf aufbauend für die Entwicklung von Gruppen, Organisationen und der Gesellschaft unerlässlich ist (Riemer, 2011). Die Imitation ist dabei häufig ein unbeabsichtigtes Phänomen, das den Beobachtern nicht bewusst ist. Wie gezeigt werden konnte, spielt die Identifikation mit Vorbildern und die Imitation von Verhaltensweisen sowohl in den frühen Lebensphasen als auch im Erwachsenenalter eine entscheidende Rolle. Während zunächst Bezugspersonen wie die Eltern oder andere Vertraute als Vorbilder fungieren, gewinnen später andere Menschen an vorbildhafter Bedeutung. Solche Prozesse beinhalten dann sicherlich nicht nur bewusst und rational begründete Entscheidungen, sondern umfassen auch affektive und unbewusste Komponenten. Als Lebewesen zeichnet den Menschen also die besondere Fähigkeit aus, durch die Identifikation mit Vorbildern, mit denen eine positive emotionale Beziehung besteht, in konkreter und im Laufe des Lebens zunehmend auch in kognitiv-wertebezogener, differenzierterer Weise zu lernen (Schenk-Danzinger, 1972a).
4. Grundlegende Bedingungen für die Wirkung von Vorbildern
Die Orientierung am Vorbild kann und wird an dieser Stelle als «Soziales Lernen» verstanden werden. In einem ersten Gedankengang kann damit sicherlich der Erwerb prosozialer Verhaltensmuster (z.B. Einübung der sozialen Kompetenz oder Aspekte der Teamfähigkeit) verbunden werden; inhaltlich wird damit jedoch nicht das abgedeckt, was Sozialpsychologen unter diesem Konstrukt verstehen: Unter sozialem Lernen wird mitunter eher verstanden, dass das Repertoire der erworbenen bzw. erwerbbaren Verhaltensweisen erheblich durch Variablen der sozialen Umwelt mitbestimmt werden. Mit der Orientierung an Personen wie auch an Gruppen und deren tatsächlichen wie mutmaßlichen Reaktionen ist das menschliche Verhalten eine Verhaltenskonsequenz sozialer Sanktionen. Dabei bewirken soziale Modelle und Kommunikationsprozesse, dass Individuen die Konsequenzen ihres Verhaltens nicht sofort und nicht selbst erfahren müssen (vertiefend siehe Fischer & Wiswede, 1997).
[...]
- Arbeit zitieren
- Simone Engels (Autor:in), 2012, Vorbilder. Eine interdisziplinäre Untersuchung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388272
Kostenlos Autor werden









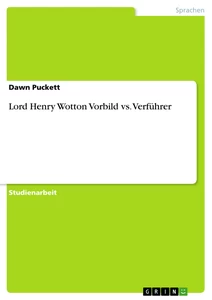





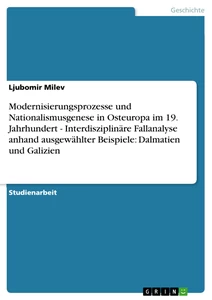
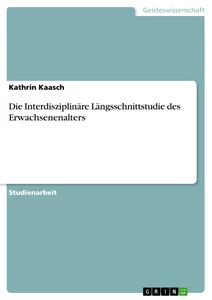



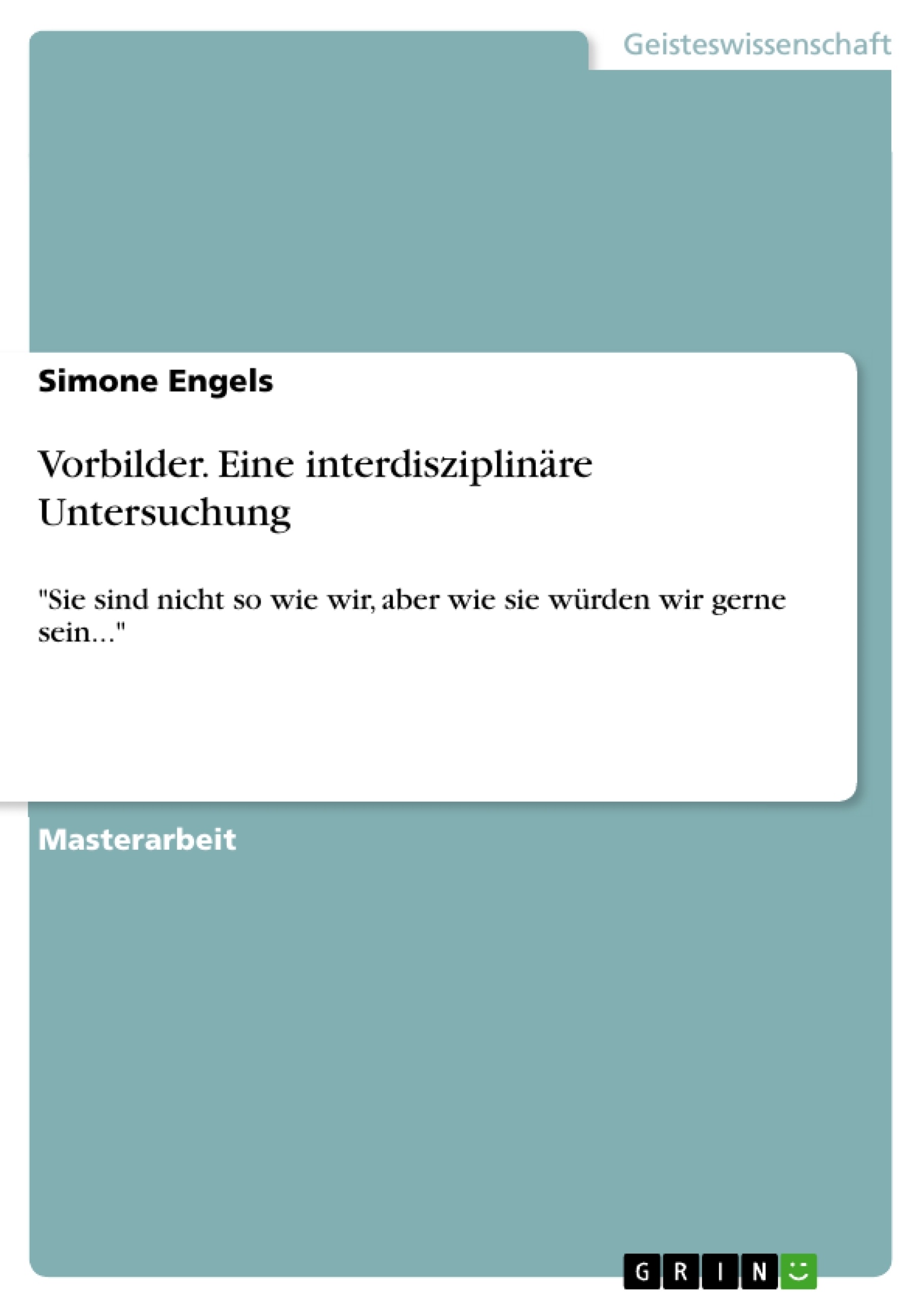

Kommentare