Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Körper, Gewalt und Macht im Geschlechterverhältnis
2.1 Interpersonale Machtbeziehungen
2.2 Gesellschaftliche Machtverh ä ltnisse
2.3 Habituskonzept
2.3.1 Herkunft und Ausarbeitung des Begriffs
2.3.2 Praktischer Sinn und soziale Felder
2.3.3 Das Habituskonzept in der Körpersoziologie
2.3.4 Praktische Anerkennung
2.3.5 Symbolische Gewalt
2.3.6 Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit als soziale Praxis
2.3.7 Die männliche Herrschaft
2.3.8 Geschlechtslogik männlichen Gewalthandelns
3 Die weibliche Beschneidung
3.1 Begrifflichkeit
3.2 Beschreibung der Praxis
3.3 Formen von weiblicher Genitalbeschneidung
4 Folgen der Beschneidung für betroffene Mädchen und Frauen
4.1 K ö rperliche Komplikationen
4.2 Psychologische und sexuelle Folgen
4.3 Die Klitoris und ihre Bedeutung f ü r die weibliche Sexualit ä t
5 Begründungsmuster weiblicher Genitalbeschneidung
5.1 Die Bedeutung von Tradition und Religion
5.2 Sexualit ä t und Heiratsf ä higkeit
5.3 Die weibliche Beschneidung als Ü bergangsritus
5.4 Die weibliche Beschneidung als Form von Gewalt an Frauen
5.5 Abschaffungsstrategien
6 Fazit
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die weibliche Beschneidung ist eine folgenreiche Menschenrechtsverletzung und Ausdruck von Unterdrückung, Erniedrigung, Fremdbestimmung und ökonomischer Ausbeutung von Mädchen und Frauen. Gleichzeitig hat sie aber in praktizierenden Gesellschaften eine wichtige soziale Bedeutung. Die Beschneidung stellt einen traditionellen Brauch dar - als dieser kann er jedoch nicht mehr nur betrachtet werden. Die World Health Organization (WHO) nimmt an, dass ihre globalen Auswirkungen ein ernsthaftes Problem für die öffentliche Gesundheitsvorsorge darstellen: Die Beschneidung von Mädchen und Frauen ist somit zu einem Problem modernen Gesellschaften geworden. Lange Zeit wurde darüber diskutiert, ob man überhaupt eingreifen darf. Inzwischen hat sich das Augenmerk von dieser Frage zu dem Problem verlagert, wie man die Praxis beenden kann. Zentrale Voraussetzung für den Versuch, Strategien für die Aufklärung und Abschaffung der Beschneidung zu entwickeln, ist ein Verständnis dafür, welche persönliche und eine ganze Gemeinschaft umfassende Dynamik herrscht, die dazu führt, dass die Beschneidung an jungen Mädchen und Frauen gefordert und durchgeführt wird. Dies schließt auch die Frage ein, wie physische, strukturelle und symbolische Gewalt miteinander verknüpft sind und welche Gründe es für Frauen gibt, die Praxis zu unterstützen und durchzuführen. Ziel dieser Arbeit ist es, die Beweggründe der Frauen detailliert herauszuarbeiten, um nachvollziehen zu können, warum der Brauch, der ihre eigene Gesundheit derart gefährdet, von ihnen akzeptiert und reproduziert wird. Dazu werden zunächst grundlegende Erkenntnisse zum Zusammenhang von Macht, Gewalt und dem Körper im Geschlechterverhältnis dargelegt und anschließend mit Bourdieus Habituskonzept verknüpft. Die symbolische Gewalt, die eng mit der Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit und der männlichen Herrschaft zusammenhängt, wird darüber hinaus näher betrachtet. Anschließend erfolgt die Betrachtung des Phänomens der weiblichen Beschneidung: Zunächst werden die verschiedenen Formen der Beschneidung beschrieben, um daran anknüpfend ihre unterschiedlichen Folgen für die Betroffenen darzulegen. Im Anschluss werden die verschiedenen Begründungsmuster ausführlich - mit Bezug auf die Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil - analysiert. Die Auswertung der Begründungsmuster wird deutlich zeigen, weshalb die Frauen mit der Beschneidung ihrer eigenen Genitalien einverstanden sind und gleichzeitig partiell dazu beitragen, diesen Brauch fortzuführen. Auch die Frage, ob sie autonom handeln, wird letztendlich zu beantworten sein. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird abschließend skizziert, was Aufhebungsstrategien leisten müssen, um eine nachhaltige Verbesserung der Situation der betroffenen Mädchen und Frauen zu erreichen.
2 Körper, Gewalt und Macht im Geschlechterverhältnis
Macht lässt sich als ein Phänomen verstehen, das in jedem gesellschaftlichen Bereich zu finden ist, insbesondere dann, wenn verschiedene Interessen einander gegenüberstehen. So ist beispielsweise zur Aufrechterhaltung hierarchischer Verhältnisse die Demonstration sowie Anwendung von Macht wesentlich. Max Weber (1972: 28) definiert Macht als „Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.“ Macht gilt innerhalb dieser Definition als „soziologisch amorph“, was bedeutet, dass jedes Individuum potentiell Macht erlangen kann (ebd.). Soziologisch relevant sind Machtverhältnisse nur dann, wenn die Machtunterworfenen die bestehenden Machtverhältnisse selbst mitgetragen haben und diese durch deren Überzeugung gestützt werden; Macht also in Gestalt von Herrschaft auftritt (Meuser 2017: 67). Herrschaft definiert Weber (1972: 28) als „die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden.“ Körpersoziologische Analysen von Macht und Herrschaft machen deutlich, dass „das Mittragen der Machtverhältnisse durch die Machtunterworfenen vor allem auf einer präreflexiven Basis erfolgt“, was bedeutet, dass die „Überzeugungen“ und der „Gehorsam“ nur eingeschränkt in einem „kognitiven Sinne“ begriffen werden können (Meuser 2017: 68). Die Analyse von Macht- und Herrschaftsverhältnissen muss daher neben der Funktionsweise dieser auch die „amorphen“ interpersonalen Machtbeziehungen berücksichtigen, gesellschaftliche Macht thematisieren sowie körpersoziologisch fundiert sein (ebd.).
2.1 Interpersonale Machtbeziehungen
Betrachtet man interpersonale Machtbeziehungen, sind vor allem die vier Grundformen der Macht nach Heinrich Popitz (1992: 23ff.) aufschlussreich. Er unterscheidet „vier Grundformen der Macht“: die Aktionsmacht, die instrumentelle Macht, die autoritative Macht und die Macht des Datensetzens (Meuser 2017: 68). Die Aktionsmacht stellt dabei die Basis anderer Machtformen dar und ist die „direkteste Form von Macht“, die ein Mensch erfahren kann; der Körper nimmt hierbei einen zentralen Stellenwert ein (ebd.). Nach Popitz ist das menschliche Dasein von der entscheidenden Tatsache der körperlichen Verletzbarkeit, der „Verletzungsoffenheit“, bestimmt (Dackweiler/Schäfer 2002: 11). Die Befähigung, die „Verletzungsoffenheit“ anderer Menschen zu missbrauchen, um Macht zu gewinnen, diese schließlich zu steigern und „auf Dauer zu binden“, bezeichnet er als „Verletzungsmächtigkeit“ (ebd.). Der menschliche Körper ist somit verletzungsoffen und verletzungsmächtig; sowohl das Zufügen, als auch das Erleiden von Gewalt ist möglich. Sowohl die „Verletzungsoffenheit“ als auch die „Verletzungsmächtigkeit“ sieht Popitz als Teil der conditio humana, die beide die „fundamentalen Modi von Vergesellschaftung“ bilden (Meuser 2017: 69). Machtausübung ist immer ein Eingriff in „körperliche Integrität, ökonomische Subsistenz und gesellschaftliche Teilhabe“; Gewalt definiert Popitz als eine „Machtaktion, die zur absichtlichen körperlichen Verletzung führt“ (Meuser 2017: 68; Dackweiler/Schäfer 2002: 11). Damit stellt Popitz den Körper ins Zentrum seiner Definition von Gewalt und sieht sie immer in einem macht- und herrschaftssoziologischem Zusammenhang (Inhetveen 2017). In diesem Zusammenhang stellt er fest, dass Menschen Macht über andere Menschen ausüben, weil sie andere verletzen können. Der Körper nimmt in diesem Konzept somit eine ausgeprägte Stellung ein (ebd.). Unter den Durchsetzungsformen von Macht steht für Popitz Gewalt an bedeutender Stelle. Die direkte Aktionsmacht verweist dabei auf „die Fragilität und Ausgesetztheit“ des Körpers, der man immer unterliegt, weil es nicht möglich ist, sich in der Beziehung zu einer anderen Person aus dem eigenen Körper zurückzuziehen; es ist unmöglich, die eigene Verletzlichkeit oder Gewaltfähigkeit aufzuheben (Meuser 2002: 44; Inhetveen 2017: 102). Aktionsmacht ist somit auf „körperliche Kopräsenz in sozialer Interaktion angewiesen“ (Meuser 2017: 68). Das macht sie zu einer unmittelbar sichtbaren und körperlich spürbaren Macht, die durch die grundlegende Verletzungsmächtigkeit und -offenheit zwar nicht in dauerhafte Überlegenheit gebunden ist, potentiell aber jedem Menschen die Möglichkeit gibt, „temporär und situativ“ Macht auszuüben; Gewalt also zu einer „Jedermanns- Resource“ macht (ebd.; Trotha 1997a: 18). Hier wird die Allgegenwärtigkeit von Gewalt nochmals deutlich, um in den Worten von Heinrich Popitz (1992: 50) zu sprechen:
„Der Mensch muss nie, kann aber immer gewaltsam handeln, er muss nie, kann aber immer töten - einzeln oder kollektiv - gemeinsam oder arbeitsteilig - in allen Situationen, kämpfend oder Feste feiernd - in verschiedenen Gemütszuständen, im Zorn, ohne Zorn, mit Lust, ohne Lust, schreiend oder schweigend (in Todesstille) - für alle Zwecke - jedermann.“
Aus geschlechtertheoretischen Perspektive fällt auf, dass die soziale Ordnung einer Gesellschaft für Popitz keine Geschlechterordnung ist und alle Menschen sowohl Opfer- als auch Täterpositionen innehaben können (Bereswill 2011). Teresa Wobbe (1994: 191) ergänzt diese Lücke seiner machttheoretischen Perspektive um die Erkenntnis, dass soziokulturelle Deutungssysteme von Zweigeschlechtlichkeit verschiedene „leibgebundene Subjektpositionen“ mit sich bringen, die im Umgang mit der Verteilung von Verletzungsmächtigkeit und Verletzungsoffenheit zwischen den beiden Geschlechtern handlungsleitend sind. „Der Mensch“, von dem Popitz spricht, erreicht seine Aktionsmacht im Kontext einer „symbolischen Ordnung der Geschlechter, die Frauen und Männern nicht gleichermaßen Spielräume im Umgang mit Macht und Gewalt zugesteht“ (Bereswill 2011: 201). Aus diesem Grund sind Frauen und Männer nicht aus Prinzip Opfer oder Täter wegen ihrer Geschlechterzugehörigkeit oder ihrem körperlichen Zustand: Vielmehr nehmen sie derartige Positionen ein oder weisen sie zurück, da das gesellschaftliche Verhältnis zu Macht und Gewalt ein Teil der gesellschaftlichen Organisation von Geschlechterverhältnissen ist (ebd.). Geschlecht, genauer die soziale Ordnung der Geschlechter, gilt als grundlegendes Strukturmerkmal von gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen. Soziale Ordnungen können Gewalt zwar einschränken, benötigen dazu aber eine eigene Gewalt; Machtverhältnisse werden anhaltend von Gewalt begleitet (Hagemann-White 2002: 29). Hannah Arendt (1985) betont, dass Macht durch „zusammenwirkendes Handeln von Menschen“ entsteht und dass Gewalt den Gegenbegriff zu Macht bildet, da diese sich mit Herrschaft oder Tyrannei „paart“ (Hagemann-White 2002: 29). Gewalt lässt erkennen, dass „Macht verloren gegangen und Herrschaft, das Streben nach Dominanz ohne Anerkennung an deren Stelle getreten ist“ (ebd.). Schlussendlich bedeutet auf Gewalt zu zeigen gleichzeitig auch immer, Machtverhältnisse zur Diskussion zu stellen (ebd.). So ist die wissenschaftliche Untersuchung von Gewalt im Geschlechterverhältnis intensiv mit dem geschlechterpolitischen Ziel verknüpft, „Gewalt gegen Frauen weltweit als Menschenrechtsverletzung zu bekämpfen und Gewalt im Geschlechterverhältnis als ein strukturelles Phänomen zu analysieren (Bereswill 2011: 202; Hagemann-White 2002). Gesellschaft wird als Strukturzusammenhang verstanden, als ein soziales Gefüge, das nach eindeutigen Regeln organisiert ist; Frauen und Männer werden als soziale Gruppen angesehen, die in einer hierarchisch strukturierten Beziehung zueinander stehen. So ist beispielsweise das eheliche Abhängigkeitsverhältnis kein nur individueller Konflikt - es ist Ausdruck der „institutionellen Machtvoraussetzung“ von Geschlechterverhältnissen und -beziehungen (Knapp 1992; Bereswill 2011: 203).
2.2 Gesellschaftliche Machtverhältnisse
Aus körpersoziologischer Sicht stellt sich die Frage, wie gesellschaftliche Machtverhältnisse in die Körper der Individuen eingeschrieben werden. Nach Michel Foucault (1992) fand ein Bruch zwischen früheren Formen der Machtausübung und der „modernen“ Macht statt, da letztere das Verhältnis des menschlichen Körpers zum Staat veränderte. Beginnend im Europa des 18. Jahrhunderts zielte die Macht weniger auf den menschlichen Körper ab wie beispielweise durch körperliche Strafen, sondern durch ihn hindurch; der Körper wurde aus einem Objekt der Macht, die von oben herab zu körperlicher Unterordnung und Gehorsam zwingt, zum „Medium und ultimativen Effekt einer Macht“ umgewandelt, die eher undurchsichtig und durch „Beherrschung und Unterwerfung von innen“ arbeitet (Foucault 1977; 1980: 96; 1992: 174ff.). Um die Körper durch eine Anordnung von „nicht zentralisierten, nicht autoritären Techniken und Institutionen zu normalisieren“, wirkt diese Macht von unten (Boddy 2002: 163). Foucault (1992: 38) bezeichnet dies als eine „Mikrophysik der Macht“, die zeigt, wie der Körper im Zusammenhang zur gesellschaftlichen Ordnung geformt wird (Meuser 2017: 68). Die Resultate dieser Techniken, unsere Körper und unser Selbst, werden positiv erlebt, selbst dann, wenn sie dazu benutzt werden, „Verhältnisse von Dominanz und Unterordnung zu erhalten“ (Bordo 1993: 26). Demzufolge ist in modernen Staaten die Macht nicht das erworbene Privileg der dominanten Klasse, „sondern vielmehr die Gesamtwirkung ihrer strategischen Positionen - eine Wirkung welche durch die Position der Beherrschten offenbart und gelegentlich erneuert wird“ (Foucault 1992: 38). Die „extremste Form“ der Macht findet sich in Körper, Techniken und lokalen Institutionen „mit nachforschender Macht“ an der Stelle wieder, an der „ihre Intention, wenn sie eine hat, komplett in reale und effektive Praktiken gekleidet ist“ (Foucault 1980: 96f.; Boddy 2002: 164). Danach ist der Körper die „eingeschriebene Oberfläche der Ereignisse“, ähnlich wie ein lebendes Verzeichnis von „Geschichte, Kultur und Macht“ (Foucault/Bouchard 1977; Boddy 2002: 164). Der Körper stellt einen wesentlichen Faktor zur Durchsetzung von Macht dar, da sich Machtstrategien gezielt auf ihn richten; seine Kontrolle und Disziplinierung erfolgen sowohl durch Überwachung als auch durch Stimulation (Meuser 2017). Foucaults historischer Ausgangspunkt war zwar der Westen, seine Perspektive lässt sich aber auf alle Gesellschaften übertragen: Macht wirkt gewissermaßen immer von unten, da „das Selbst und die Körper im dynamischen Zusammenspiel zwischen Handelnden, sozialen Institutionen, kulturellen Bedeutungen, Konventionen und Beschränkungen“ und „im Zusammenspiel zwischen Subjekten und ihrer menschlich gemachten Umwelt - der Objekte, der Räume, der anderen Menschen“ entstehen; nach Bourdieu (1976; 1987) demnach im praktischen Handeln in der Welt (Boddy 2002: 164). Norbert Elias (1976) beschreibt ebenfalls, welche Auswirkungen Macht auf die Körper der Individuen hat; wie auch bei Foucault ist die Zentralität des Körpers bedeutend. Die zunehmend „verstärkte und verfeinerte Affektkontrolle“ führte zu dem zivilisierten Körper, der heute als selbstverständlich wahrgenommen wird (Meuser 2017: 69). Diese Kontrolle und die daraus entstandenen Fremdzwänge werden von den Individuen in Selbstzwänge umgewandelt, die dann Ausdruck in körperlichen Emotionen wie Scham und Peinlichkeit finden; für Elias ist dies die „Grundvoraussetzung für die Ausbildung eines zivilisierten Habitus“ (ebd.: 69).
2.3 Habituskonzept
Elias und Foucault sehen den Ort für Macht in den Körpern der Individuen; Pierre Bourdieu hat eine ähnliche Sichtweise und legt diese in seinen herrschaftstheoretischen Analysen dar. Sozial eingestimmte physische und kognitive Gefühle des Körpers antizipieren kulturelle Praktiken, die nicht „einfach von außen dem Körper eingeprägt“ werden (Boddy 2002: 164). Der Körper und das Selbst werden „im Handeln mit einer bekannten, bedeutsamen Welt geformt, im Handeln mit Anderen, denen ähnlich verkörperte Dispositionen von Kindheit an eingeimpft sind“ (Bourdieu 1987). Diese Verbindung zwischen einer strukturierten und einer strukturierenden Ordnung bezeichnet Bourdieu als Habitus (Meuser 2017).
2.3.1 Herkunft und Ausarbeitung des Begriffs
Das lateinische Wort habitus ist die Übersetzung des griechischen hexis; nach Aristoteles wird damit der Begriff der Haltung benannt. Diese Haltung ist eine „erworbene ethische Einstellung, die mit einer Haltung des Körpers verbunden ist“ (Gebauer 2017: 27). Basierend auf Arbeiten des Kunsthistorikers Erwin Panofsky entwickelte Pierre Bourdieu sein soziologisches Konzept des Habitus, das seine bereits existierenden Gedanken über „den Zusammenhang von subjektiver Weltsicht und objektiven Sozialstrukturen in der traditionellen algerischen Gesellschaft begrifflich fasst“ (ebd.). Im Einklang mit den Erkenntnissen von Panofsky zeigt sich auch bei Bourdieu die Überlegung, dass den „kulturellen Produktionen“ eines bestimmten Zeitabschnitts „ein gemeinsames generierendes Prinzip zugrunde liegt“ (ebd.). Dieses Prinzip bezeichnet Bourdieu als strukturierende Struktur; eine „Art innere Steuerungsinstanz des kulturellen Handelns“ (ebd.). Diese stellt den Kern des Habituskonzepts dar, die Bourdieu mit einer generativen Grammatik vergleicht und „sozial erworben und kulturspezifisch“ ist (ebd.). Überträgt man diese Annahme auf soziales Handeln, bedeutet dies, dass jede*r Handelnde*r über eine Individualität infolge der eigenen Herkunft, Lerngeschichte und Umgebung, in der er*sie aufgewachsen ist, verfügt. Die Erfahrungen der Welt sind „körperlich verankert“, d.h. es sind inkorporierte Strukturen, die die Wahrnehmung der Individuen organisieren und beurteilen; diese wirken sich auf zukünftige Handlungen sowie innere Einstellungen und Vorlieben aus. Unter dem entsprechenden gesellschaftlichen Einfluss werden diese einverleibten Strukturen durch soziales Handeln schließlich zu sozialen Strukturen (ebd.). Habitus bezeichnet sowohl das „Eigene als Subjekt“ als auch ein „soziales Vermögen“: In jedem sozialen Handeln sind subjektive Beiträge vorhanden, die „als inkorporierte Strukturen von den Existenzbedingungen geprägt sind“, unter denen die Subjekte ihren Habitus erlangt haben (ebd.: 28). Markus Schwingel (1995: 56) nennt in diesem Zusammenhang drei analytische Aspekte der Dispositionen des Habitus:
„1. Die Wahrnehmungsschemata, welche die alltägliche Wahrnehmung der sozialen Welt strukturieren [...], 2. die Denkschemata, zu denen (a) die Alltags-Theorien und Klassifikationsmuster zu rechnen sind, mit deren Hilfe die Akteure die soziale Welt interpretieren und kognitiv ordnen, (b) ihre impliziten ethischen Normen zur Beurteilung gesellschaftlicher Handlungen, d.h. ihr Ethos, und (c) ihre ästhetischen Maßstäbe zur Bewertung kultureller Objekte und Praktiken, kurz ihr Geschmack, 3. Schließlich die Handlungsschemata (Hervorh.i.O.), welche die (individuellen und kollektiven) Praktiken der Akteure hervorbringen.“
Subjektive und soziale Strukturen bilden im Habitus ein Geflecht; sie greifen ineinander, sind aber nicht kausal miteinander verbunden. Diese Verbindung geschieht im Körper, der zweiseitig ist: „nach außen auf die Welt und nach innen auf das Subjekt gerichtet“ (Gebauer 2017: 28). Im sozialisierten Körper vereinen sich kognitive, evaluative, motorische und emotionale Schemata als Ausdruck des Habitus (Funder/Sproll 2012). Aus der biologischen Eigenschaft des Menschen entsteht das Verhältnis von Körper und Welt, nämlich dieser gegenüber „offen, also ihr ausgesetzt und somit von ihr formbar zu sein“ (Bourdieu 2001: 172). Hierbei handelt es sich immer um den einen Körper, der durchgehend einheitlich ist, von außen behandelt und als Objekt angesehen wird, dabei gleichzeitig vom Subjekt „erfahren und gefühlt“ wird (Gebauer 2017: 28). Als „realer Akteur, d.h. als Habitus, mit seiner eigenen Geschichte und den von ihm verkörperten Eigenschaften“ stellt der Körper „ein Prinzip der Vergesellschaftung “ dar (Bourdieu 2001: 171). So wie der Körper in der Welt besteht, besteht die Welt im Körper und begreift diese durch ihn (ebd.: 167).
2.3.2 Praktischer Sinn und soziale Felder
Als körperliche Wesen bilden Menschen einen Sinn dafür aus, was in einer Situation zu tun ist; zum einen für das, was von der Situation und dem Moment und zum anderen vom Habitus der Handelnden gefordert wird. Bourdieu bezeichnet diesen Sinn als „praktischen Sinn“ (sens pratique), der in Form von praktischem Handeln in sozialen Situationen verändernd auf die Praxis einwirkt (Gebauer 2017: 29). In jedem Feld wirkt der Habitus entsprechend der feldspezifischen Gesetzmäßigkeiten - in den unterschiedlichen Feldern werden vielfältige soziale Spiele gespielt; „es ist aber immer dieselbe Anlage des Spielers, die sich den Regeln des jeweiligen Felds anpasst und in Übereinstimmung mit dem Spiel handelt“ (ebd.: 29). Diese Übereinstimmung deutet Bourdieu als Resultat von „Herkunft und Ausbildung, Übung und Kenntnis, die im Körper verankert sind“ (ebd.: 29).
Während der Habitus als „Leib gewordene Geschichte“ verstanden werden kann, erklärt Bourdieu (1985: 69) das soziale Feld als „Objektivierung in den Institutionen.“ Im Feld wirken „objektivierte dingliche und strukturelle Bedingungen, die wiederum mit den Dispositionen der Individuen korrespondieren und über soziale Praxis vermittelt sind (Funder/Sproll 2012: 42).
Die Entstehung von Feldern basiert auf gesellschaftlichen Differenzierungsprozessen; die Gesellschaft bzw. der soziale Raum ist in unabhängige Felder und Unterfelder gegliedert, die wissenschaftlich, ökonomisch, politisch, juristisch, ästhetisch, religiös oder sportlich sein können und jeweils eigene spezifische Grundgesetze hat. Die verschiedenen Felder sind in keiner Weise gleichberechtigt, vielmehr sind sie hierarchisch strukturiert (ebd.). Innerhalb und zwischen den Feldern existieren Macht- und Positionskämpfe, die Auskunft über die „dominanten gesellschaftlichen Strukturprinzipien“ geben, also über diejenigen, die eine „gesamtgesellschaftliche Bedeutung haben“ (Barlösius 2006: 97). Felder sind somit sozial strukturiert. Den einzelnen Akteur*innen wird unterschiedlich viel Kapital, also Macht, zugesprochen; im internen Kampf haben sie dadurch unterschiedlichen Einfluss auf die „Durchsetzung der einzig legitimen Sichtweise des Feldes“ inklusive des jeweiligen Grundgesetzes (Funder/Sproll 2012: 42). Nach Wacquant (1996: 37) sind die innerhalb der Felder entstehenden Kräfte weder die „additive Summe von anarchischen Handlungen noch das integrierte Ergebnis eines planvollen gemeinsamen Vorgehens“, sondern vielmehr das Ergebnis von Konflikten und Kämpfen. Die Struktur des Feldes kann sich in Abhängigkeit zu den Distributionen und dem Gewicht bestimmter Kapitalformen verändern. Mit anderen Worten: Die Struktur der Felder ist historisch formbar, so „dass sich überhaupt jedes Feld als eine Struktur von Möglichkeiten - Belohnungen, Gewinnen, Profiten oder Sanktionen - darstellt, aber immer auch eine gewisse Unbestimmbarkeit impliziert“ (ebd.: 38).
Das vom Habitus produzierte Handeln schafft eine strukturierte Struktur, die für alle Teilnehmer*innen und Beobachter*innen objektiv gegeben ist, von ihnen beurteilt werden kann und Rückschlüsse auf die „soziale Herkunft, Zugehörigkeit und eine Antizipation des zukünftigen Handelns eines Subjekts“ ermöglicht (ebd.). Die strukturierte Struktur lässt ein sich wiederholendes Muster des Habitus erkennen; gleichzeitig ist sie die „produktive Veränderung im Sinne einer Anpassung an neue Gegebenheiten, die Modifikation und Fortentwicklung des Habitus erfordern“ (ebd.). Bei der Erzeugung des Habitus gibt es keine „Bewegungslosigkeit“, er ist nicht deterministisch feststehend, sondern „in unaufhörlichem Wandel begriffen“ (Bourdieu 1989: 406). Der Wandel des Habitus ist in „Abstimmung mit ökonomisch und kulturell verfügbaren Ressourcen und Bedingungen sowie Handlungs- und Erfahrungsgrenzen des jeweiligen Akteurs oder der jeweiligen Gruppe“ möglich (Funder/Sproll 2012: 44) Wenn aber die Handelnden nicht in der Lage sind, ihren eigenen Habitus auf ein „grundlegend verändertes Feld“ anzupassen, kommt es zu einer „Lähmung“, dem sogenannten Hysterisis-Effekt (Gebauer 2017: 29).
2.3.3 Das Habituskonzept in der Körpersoziologie
Der Habitus-Begriff vereint den „inneren mit dem äußeren Aspekt des handelnden Menschen, seine subjektiven Einstellungen mit den gesellschaftlichen Strukturen, die individuellen Lebensgeschichten mit den objektiven Positionen der Akteure im gesellschaftlichen Raum“ (Gebauer 2017: 29f.). Mit Bourdieus Habituskonzept eröffnen sich der Soziologie und Philosophie drei bedeutsame Neuerungen:
- Dem Körper wird mit seiner gesamten Komplexität als „materieller, sozial geformter, als fühlender und als rational die Handlungspraxis bewältigender Anteil des Menschen“ eine zentrale Rolle für das gesellschaftliche Sein zugesprochen (ebd.: 30).
- Wenn der Körper des Menschen sowohl einen Innen- als auch einen Außenaspekt hat, bildet dieser „eine Klammer zwischen diesen beiden Seiten“, die bislang voneinander getrennt gedacht wurden; den „traditionellen Dualismus von Körper - Geist oder Leib - Seele“ versucht das Habituskonzept somit zu überwinden (ebd.).
- Bourdieu geht davon aus, dass ein einheitlicher Habitus existiert, der sich mit dem praktischen Sinn auf die verschiedenen Handlungsfelder einstellt. Der Frage nach der Einheitlichkeit der handelnden Personen hinsichtlich der Vielzahl und Differenz der Bereiche sozialen Handelns wird somit überwunden (ebd.).
Soziales Handeln und Urteilen wird nicht kognitiv von Regeln geführt, sondern vielmehr vom „sozialen Geschmack“, was die vorstehende Rolle des Körpers weiter hervorhebt (ebd.). Das Konzept des Geschmacks übernimmt Bourdieu aus der Kantschen Ästhetik und deutet dieses soziologisch um: Dabei ist der Geschmack die Fähigkeit, das kulturelle Kapital in praktisches Urteilen umzusetzen. Das Subjekt hat bestimmte Vorlieben und handelt entsprechend dieser; Dingen, die es nicht mag, bleibt es fern oder beurteilt sie negativ (ebd.). Geschmackswahlen werden als „sinnlich geleitete Präferenzen nach dem Schema von Mögen vs. Nicht-Mögen“ verwirklicht; darüber hinaus sind sie „klassen- und gruppenspezifisch, historisch wandelbar und besitzen eine Art verpflichtender Allgemeinheit gegenüber Mitgliedern derselben Gruppe oder Klasse“ (ebd.: 30). Sie stehen zwar in enger, aber nicht direkter Verbindung mit dem ökonomischen Kapital (ebd.).
Basierend auf ihren Geschmackspräferenzen entstehen je nach „Verfügung über kulturelles und ökonomisches Kapital“ bestimmte Lebensstile, die kennzeichnend für den Habitus einer Gruppe oder Klasse sind; diese wirken abgrenzend, als sogenannte Distinktionen, im Vergleich zu anderen Gruppen und Klassen (ebd.). Die höchste soziale Klasse gibt mit ihrem „legitimen Geschmack“ die grundlegende Orientierung für die Erzeugung von Distinktionen vor. Abgelehnt werden dabei Objekte, die sich „unmittelbarer, ‚grober’ Sinnenlust“ anbieten“ (ebd.: 30). Mittels ihrer Körpersinne schaffen die Akteure eine differenzierte Gesellschaft und werden gleichzeitig selbst ein Teil von ihr (ebd.). Durch die Entstehung des Habitus nehmen die gesellschaftlichen Zusammenhänge in den sozialen Subjekten Form an, sie werden sichtbar. Die hierarchische Struktur der Gesellschaft offenbart sich in körperlichen Verhaltensweisen, u.a. im Auftreten, in den geläufigen Umgangsformen, im der Art und Weise des Sprechens und Sich Kleidens, in den Essgewohnheiten, in der Zuwendung zum eigenen Körper (beispielsweise in der Körperpflege oder der Gestaltung des Körpers durch Fasten, Training oder Meditation), in der Aufmerksamkeit auf körperliche und psychische Leiden (oder die Nichtbeachtung dieser) (ebd.).
2.3.4 Praktische Anerkennung
Das Konzept des Habitus beschreibt die „soziale Ordnung als eine Ordnung zivilisierter Körper“ und stellt dar, wie gesellschaftliche Verhältnisse und Strukturen in die Körper der Individuen eingeschrieben werden (Meuser 2017). Die Menschen werden „in eine soziale Welt hineingeboren und wenden kognitive Strukturen auf sie an, die aus eben diesen Strukturen der Welt hervorgegangen sind“ (Funder/Sproll 2012: 53). Als Folge ergibt sich eine Übereinstimmung von objektiven und kognitiven Strukturen als eigentliche Basis einer realistischen Theorie von Herrschaft und Politik (ebd.). Die Wirkung gesellschaftlicher Machtverhältnisse verknüpft Bourdieu in dem Begriff der „symbolischen Gewalt“, die von ihm als „Zwang durch den Körper“ beschrieben wird; „alle Macht hat eine symbolische Dimension“ (Bourdieu 1997: 158; 165). Zusätzlich stellt er fest, dass Machtverhältnisse auf die Zustimmung der Beherrschten angewiesen sind; eine freiwillige Entscheidung ist diese Zustimmung allerdings nicht, sondern die Konsequenz aus „der unmittelbaren und vorreflexiven Unterwerfung der sozialisierten Körper“ (ebd.). Zwang und Zustimmung schließen einander nicht aus; durch Inkorporierung werden vielmehr „habituelle Dispositionen“ hervorgebracht, „die ein vorreflexives Einverständnis der Beherrschten mit ihrer Lage erst ermöglichen“ (Meuser 2017: 70). Bourdieu (1997b: 217) bezeichnet dies als „praktische Anerkennung“:
„Die praktische Anerkennung, durch die die Beherrschten oft unwissentlich und manchmal unwillentlich zu ihrer eigenen Beherrschung beitragen, indem sie stillschweigend und im vorhinein die ihnen gesteckten Grenzen akzeptieren, nimmt häufig die Form einer körperlichen Empfindung an (Scham, Schüchternheit, Ängstlichkeit, Schuldgefühl), die nicht selten mit dem Gefühl eines Regredierens auf archaische Beziehungen, auf Kindheit oder familiäre Umgebung einhergeht. Sie setzt sich in sichtbare Symptome wie Erröten, Sprechhemmung, Ungeschicklichkeit, Zittern um: Weisen, sich dem herrschenden Urteil, sei es auch ungewollt, ja, widerwillig zu unterwerfen, Weisen, das unterirdische Einverständnis - wenngleich manchmal in innerem Konflikt, ’innerlich gespalten’ - zu erfahren, das einen Körper, der sich den Anweisungen des Bewußtseins und des Willens entzieht, mit der Gewalt der den Gesellschaftsstrukturen inhärenten Zensuren solidarisiert.“
Die Herrschaftsbeziehungen, die solche Strukturen begünstigen, sind nach Bourdieu „im Dunkel der praktischen Schemata des Habitus“ verankert, also einverleibt, und somit somatisiert (Bourdieu 1997: 165; Meuser 2017: 70). Im Unterschied zu Weber sieht Bourdieu die Anerkennung der Legitimität von Herrschaft deshalb durch die „unmittelbare Übereinstimmung zwischen den einverleibten Strukturen [...] und den objektiven Strukturen“ als gegeben (Bourdieu 2001: 226f.). Die Beharrungskräfte des Habitus und seine „außerordentliche Trägheit“ einverleibter Strukturen bewirken, dass eine Beseitigung der äußeren Zwänge nicht zwangsläufig eine Befreiung der Subjekte nach sich zieht (ebd.: 220).
2.3.5 Symbolische Gewalt
„Gewalt ist bei Popitz immer körperlich, aber nie etwas allein Körperliches“, was bedeutet, dass Gewalt nicht nur den Körper, sondern auch immer die Person, das Selbst, verletzt (Inhetveen 2017: 102). Verletzungsoffenheit und Verletzungsmächtigkeit beziehen sich somit nicht nur auf den Körper, sondern auch auf alle anderen Aspekte des Menschen wie beispielsweise seine Psyche, seinen Geist und „all das, was seine Identität, sein Menschsein ausmacht“ (Sauer 2002: 85). Gewalt auf physische Wunden zu reduzieren würde bedeuten, die Vielzahl von möglichen Verletzungen zu ignorieren oder herunterzuspielen, die alle Dimensionen menschlichen Seins betreffen können, da diese, genau wie der Körper auch, jederzeit „verletzungsgefährdet“ sind und die Beschädigung jedes dieser Aspekte daher als Gewalt zu bezeichnen ist (ebd.). Gewalt ist eine Schädigung und Beeinträchtigung, die sich körperlich auswirken kann; dabei bleibt es in der Regel aber nicht:
„Abwertung und vorenthaltene Anerkennung hinterlassen langfristige psychische und mentale Schädigungen, und sie können zu Auto-Aggressionen und Selbstverletzung körperlicher wie psychischer Art führen. Ökonomische Benachteiligung, soziale Ausgrenzung und Armut können die individuelle Entfaltung stören oder blockieren. Die Verfügung(sgewalt) über Personen behindert die Herausbildung von Individualität und verhindert ein selbstbestimmtes Leben“ (Imbusch 1999: 158; Sauer 2002: 85).
Ein geschlechtssensibler Gewaltbegriff muss zusätzlich die Dimension symbolischer Gewalt nach Bourdieu einschließen, die zentral für seine Vorstellung von Macht und Herrschaft ist und für die Geschlechterforschung eine wichtige Bedeutung hat. Im Verständnis von Bourdieu wird symbolische Gewalt u.a. durch Sprache, Klassifikationen, Metaphern und Stereotypisierungen erzeugt und basiert dabei vor allem auf der Verkennung von Gewalt (Funder/Sproll 2012: 53).
Gewalt kann sich (wie bei Popitz) auf unterschiedliche Weise zeigen, etwa als physische, körperliche Einwirkung oder als politisch-polizeiliche Gewalt. Sie offenbart sich als strukturelle Gewalt; als „ein Zwang, der aus den ökonomischen Verhältnissen, den Institutionen oder allgemein aus sozialen Regeln und Normen erwächst“ (Funder/Sproll 2012: 49). Symbolische Gewalt bezieht sich immer auf einen Ausdruck von Gewalt, der nicht direkt bewusst und spürbar wird. Sie beschränkt sich nicht auf gesellschaftliche Teilbereiche, sondern existiert und wirkt in allen sozialen Feldern. Krais (2011) bezeichnet sie als zentrales Herrschaftsprinzip, da in einer modernen Gesellschaft, die auf Märkten und demokratisch verfassten Staaten gegründet wurde, Macht und Herrschaft überwiegend über symbolische Ordnung geschaffen wird. Die symbolische Herrschaft basiert auf der Verkennung und Anerkennung der Prinzipien, in deren Namen sie ausgeübt wird; als Beispiel führt Bourdieu die „männliche Herrschaft“ an (Bourdieu 1985: 171). Dabei geht es um die Durchsetzung spezifischer Sichtweisen und Wahrnehmungsmuster, die sowohl von Herrschenden als auch von den Beherrschten durch ihr Einverständnis anerkannt werden (Funder/Sproll 2012). Das Sonderbare an der symbolischen Gewalt besteht für Lothar Peter (2004: 48f.) darin, dass ihr „repressiver Charakter weder offensichtlich ist noch unmittelbar bewusstwird. Ihr eigentlicher Zweck, die „Aufrechterhaltung von Ungleichheit, Abhängigkeit und Fremdbestimmtheit im Interesse herrschender sozialer Klassen“, wird durch die symbolische Kodierung der Gewalt praktisch vergessen und nicht sichtbar (Funder/Sproll 2012: 49). Die „Vermittlung der Anerkennung“ äußerer Zwänge begründet Bourdieu mit dem Dispositionssystem des Habitus, demzufolge die „Bereitschaft zur Anerkennung“ von Macht in den Körpern eingeschrieben ist (ebd.: 49). Das Bewusstwerden und die Überwindung symbolischer Gewalt und die damit verbundenen Inkorporierungen von Machtbeziehungen ist daher nicht einfach zu bewältigen, da eine Infragestellung ihrer Legitimität und eine Transformation des Habitus (sowohl bei Beherrschten als auch bei Herrschenden) vorausgehen muss (ebd.). Die Tatsache, dass symbolische Gewalt Diskriminierung unsichtbar macht, erschwert diese Infragestellung und Transformation, vor allem im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis. Dualismen und die Heteronormativität der symbolischen Geschlechterordnung sind nach Bourdieu (2005: 178) „tief in den Dingen (den Strukturen) und den Körpern verankert und nicht aus einem bloßen Benennungseffekt hervorgegangen und daher auch nicht durch einen Akt performativer Magie“ aufzuheben. Auf der Suche nach Möglichkeiten für gesellschaftliche Veränderung ist folglich auch ein Blick auf gesellschaftliche, institutionelle und organisationale Bedingungen zu richten.
2.3.6 Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit als soziale Praxis
Besonders am menschlichen Körper ist, dass er stets auch geschlechtlich erfasst wird und wie kein anderes Medium dazu geeignet ist, die Geschlechterdifferenz zu symbolisieren (Meuser 2007). Die grundlegende soziale Unterscheidung von männlich - weiblich (gender) ist die Grundstruktur unserer Gesellschaft, „die das Handeln, die Geschlechtszugehörigkeit und personale Identität der großen Mehrheit ihrer Mitglieder bestimmt“ (Gebauer 2017: 28). Der Habitus als „generatives Prinzip“ vermittelt „zwischen der Sozialstruktur der Zweigeschlechtlichkeit und dem geschlechtsbezogenen Handeln der Akteure (doing gender)“ (Gebauer 2017: 28). Letztendlich ist Geschlecht „kein Rollenset und auch kein Identitätsmerkmal, sondern eine intersubjektive Interaktionsleistung [...]. Geschlecht ist nichts, was wir sind, sondern etwas, das wir tun“; demnach eine „Zuschreibung von Differenz, die in alltäglichen Interaktions- und wechselseitigen Interpretationsprozessen“ hergestellt wird (Bereswill 2011: 205f.) Geschlecht dient als grundlegendes Klassifikationsmuster, nach dem bzw. mittels dessen die sozialen Akteur*innen „die Bedingungen ihrer Existenz beständig praktisch (re-)produzieren“ (Dölling 2004: 77).
[...]
- Arbeit zitieren
- Anonym, 2018, Rituelle Gewalt an Frauen am Beispiel der weiblichen Beschneidung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388016
Kostenlos Autor werden






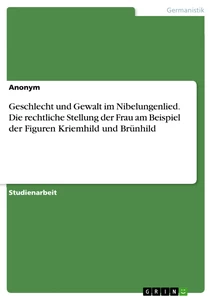










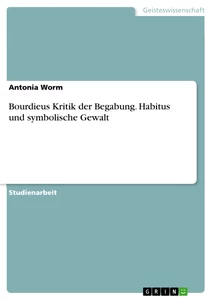

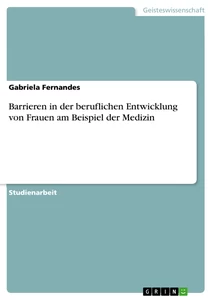
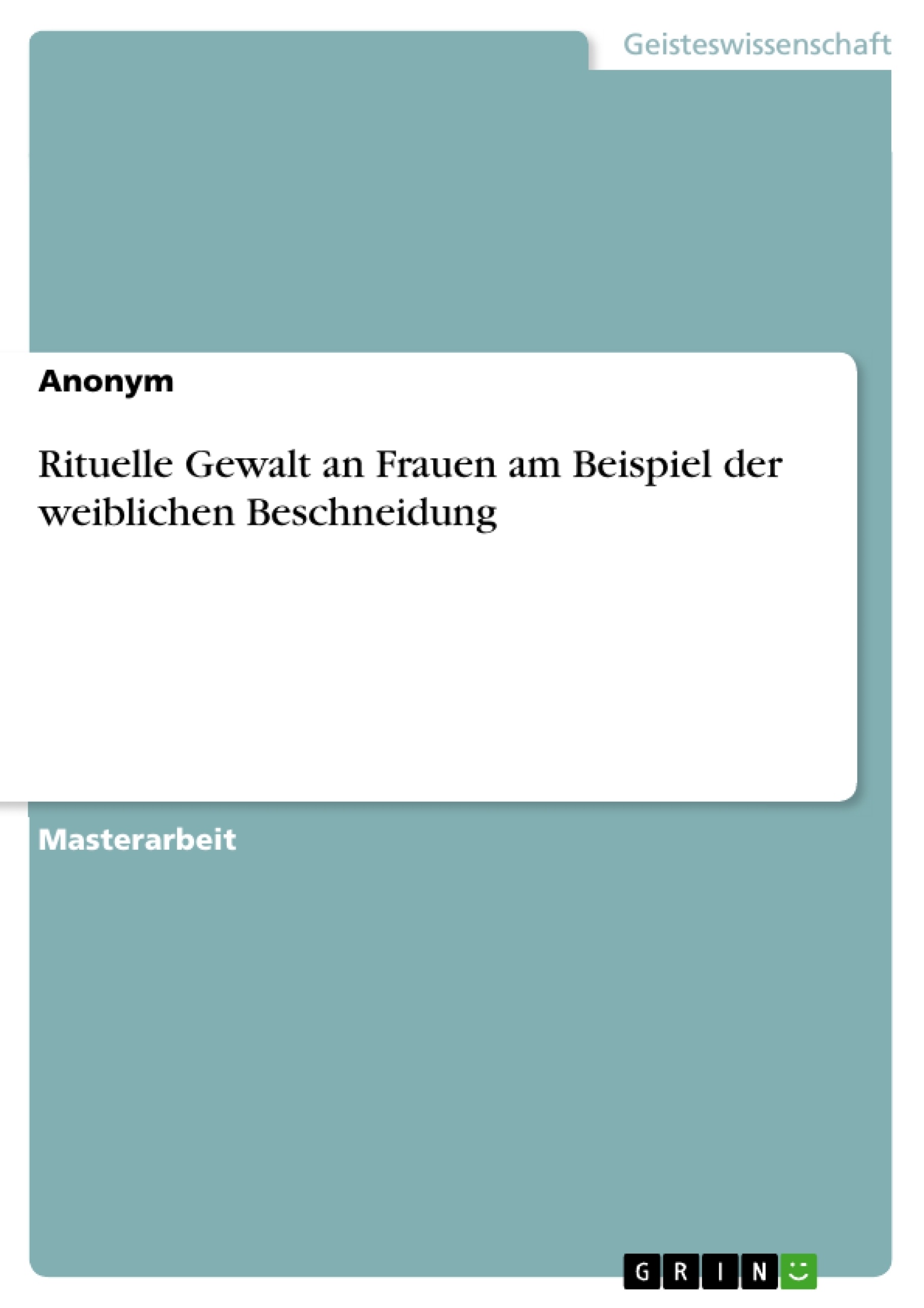

Kommentare