Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einleitung
1. Das psychische Kindheitstrauma – Ein Überblick
1.1 Begriffsbestimmung „Psychotrauma“
1.2 Epidemiologische Aspekte
1.3 Traumatische Situations- und Risikofaktoren
1.4 Schutzfaktoren (Salutogenese – Resilienz – Posttraumatic Growth)
1.5 Trauma und Entwicklung
1.6 Trauma und Bindung
1.7 Die strukturelle Dissoziationstheorie
1.8 Pathogene Dynamiken schwerer Kindheitstraumatisierungen im sozialen Nahraum
2. Klassifikation posttraumatischer Störungen – Möglichkeit eines klinischen Verlaufs in chronologischer Sequenz
2.1 Akute Belastungsreaktion (ICD-10 F43.0)
2.2 Anpassungsstörung (ICD-10 F43.2)
2.3 Posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10 F43.1)
2.4 Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung (ICD-10 F62.0)
3. Traumapädagogik – Eine junge Fachdisziplin im stationären Setting psychosozialer Handlungsfelder
3.1 Begriffsbestimmung „Gesundheitsförderung“
3.2 Begriffsbestimmung „Traumapädagogik“
3.3 Aufgaben und Zielsetzung der Traumapädagogik
3.4 Abgrenzung zur Traumatherapie
3.5 Die traumapädagogische Grundhaltung
3.6 Kernelemente traumapädagogischer Arbeit
3.7 Ausgewählte Methoden der Traumapädagogik
4. Traumapädagogik – Ein gesundheitsförderndes Gesamtkonzept innerhalb der stationären Kinder- und Jugendhilfe?
4.1 Ottawa-Charta versus Traumapädagogik
4.2 Evaluationsbezogene Erkenntnisse
5. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Ebenen der strukturellen Dissoziation (Huber 2011, S. 54)
Abb. 2: Bedürfnispyramide nach Maslow (vgl. Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V. et al. 2012, S. 18)
Abb. 3: Trauma-Entwicklungsheterotopie (Kreiner et al. 2015, S. 84)
Abb. 4: Das Differenzierungs-Dissoziations-Kontinuum (Watkins & Watkins 2008, S. 53)
Abb. 5: Rahmenmodell einer interdisziplinären Traumadiagnostik (Kreiner et al. 2015, S. 87)
Abb. 6: Zeitfenster des Lebensbuches (Krautkrämer-Oberhoff 2013, S. 128)
Abb. 7: Dalma und ihre „Schwestern“ (Baita 2014, S. 61)
Abb. 8: Veränderungen bei klinisch auffälligen Jugendlichen (Schmid et al. 2016, S. 56)
Abb. 9: Veränderungen der Bindungsprobleme (Schmid et al. 2016, S. 57)
Abb. 10: Veränderungen psychopathischer Persönlichkeitseigenschaften (Schmid et al. 2016, S. 58)
Abb. 11: Abnahme von Suizidgedanken (Schmid et al. 2016, S. 59)
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Entwicklungsaufgaben (Scherwath & Friedrich 2014, S. 35)
Tab. 2: Spektrum korrigierender Milieuerfahrungen (vgl. Schmid 2013 b, S. 57)
Einleitung
Nach dem Statistischen Bundesamt wurden 2013 in Deutschland 42.123 Kinder und Jugendliche gemäß § 42 SGB VIII in Obhut genommen und fremduntergebracht, was einen neuen Höchstwert darstellt. Viele von ihnen haben Vernachlässigung, häusliche Gewalt und sexuellen Missbrauch erfahren müssen. Sie waren in ihrem familiären Bezugssystem dauerhaft einem erhöhten Bedrohungs- und Erregungsniveau ausgesetzt. Ihre kindlichen Seelen sind von Bezugspersonen in ihrem unmittelbaren sozialen Nahraum zutiefst erschüttert und verletzt worden. Nicht selten werden diese frühen Grenzerfahrungen als existenziell lebensbedrohlich erlebt, überfordern das kindliche Verarbeitungssystem und führen häufig zur Ausbildung traumainduzierter psychischer Störungsbilder und Verhaltensauffälligkeiten.
Marc Schmid untersuchte in seiner repräsentativen Stichprobenstudie 689 Kinder und Jugendliche (480 Jungen, 209 Mädchen) in 20 Jugendhilfeeinrichtungen unter Zuhilfenahme von standardisierten klinischen Fragebögen (CBCL – Child Behavior Checklist/YSR – Youth Self-Report) zur Fremd- und Selbsteinschätzung sowie einem klinisch geführten Interview (DISYPS-KJ – Diagnostik-System für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10). Allgemein betrachtet sind etwa 60 Prozent der Heimkinder vor der stationären Jugendhilfemaßnahme Opfer von Missbrauch, Misshandlung oder Vernachlässigung geworden und gelten, aufgrund ihrer extremen psychosozialen Vorbelastungen, als Hochrisikopopulation. Diese schwerwiegenden psychosozialen Belastungsfaktoren begünstigen das Risiko an einer psychischen Störung zu erkranken entscheidend. In der untersuchten Stichprobe erfüllten ebenfalls 60 Prozent der Probanden die klinischen Voraussetzungen für eine kinder- und jugendpsychiatrische psychische Störung und ungefähr ein Drittel für mehrere psychische Störungen. Damit weisen 30 Prozent der Heimkinder so schwere Störungen auf, wie sie sonst nur bei zwei Prozent der Kinder aus der Allgemeinbevölkerung auftreten. Eine besonders hohe Prävalenz offenbarte sich bei der Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung und bei Störungen des Sozialverhaltens. Demzufolge zeigen eine Vielzahl der Heimkinder große Defizite im Bereich der sozialen und emotionalen Selbstregulierung und Selbststeuerung. Fortfahrend wurde in dieser Studie eine kinder- und jugendpsychiatrische Unterversorgung deutlich, da nur die Hälfte der untersuchten Kinder und Jugendlichen mit einer diagnostizierten psychischen Störung eine psychologische, psychotherapeutische oder kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung erhielten (vgl. Schmid 2007, S. 179ff.). Traumatisierte Mädchen und Jungen sind in der stationären Kinder- und Jugendhilfe eher die Regel als die Ausnahme.
Schlussfolgernd leisten die psychosozialen Fachkräfte der stationären Kinder- und Jugendhilfe einen Großteil der Traumaversorgung in Lebenswelt und -alltag fremdplatzierter Kinder und Jugendlicher. Somit ist das Thema „Trauma“ im Fachbereich der Kinder- und Jugendhilfe allgegenwärtig und erfordert traumaspezifisches Grundlagenwissen und Kompetenzen sowie professionelle traumasensible Interventionsmöglichkeiten.
„Fachkräfte aus dem Bereich der Sozialen Arbeit und (Heil-)Pädagogik gestalten den weitaus größten Anteil der Traumaversorgung im Kinder- und Jugendbereich, insbesondere im Bereich komplexer Problemlagen, bei denen sich die Traumaproblematik mit anderen Komorbiditäten und sozialen Benachteiligungsaspekten vermengt.“ (Gahleitner 2013, S. 52)
Trauma und Soziale Arbeit werden jedoch in der Fachwelt bisher nur bedingt zusammengedacht. Viele psychosoziale Fachkräfte schreiben einen qualifizierten Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen irrtümlich alleinig dem medizinisch-psychotherapeutischen Fachbereich zu. Folglich schlägt sich diese delegierende Grundhaltung auch in eine Geringschätzung und Abwertung der berufseigenen Kompetenzen nieder. Besonders ohnmächtig erleben sich dabei Fachkräfte in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Sie sind sich ihrer Wirkkraft im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen meist nicht bewusst und erleben auch die Wirkfaktoren des psychosozialen Alltags, gegenüber psychotherapeutischer Einzelsettings, fälschlich als nachrangig (vgl. Schulze 2014, S. 115).
Der Kinderpsychoanalytiker und Reformpädagoge Fritz Redl prägte die Begrifflichkeit des „Therapeutischen Milieus“ und äußerte bereits 1971 in seinem Buch Erziehung schwieriger Kinder: Beiträge zu einer psychotherapeutisch orientierten Pädagogik, dass… „[…] die Therapie hauptsächlich in Situationen des wirklichen Lebens stattfindet (beim Essen, Aufstehen, Schlafengehen, Spielen, Arbeiten und in allen andern Sektoren des Alltagslebens) und nicht vorwiegend in besonderen Situationen […].“ (Redl 1974, S. 42)
Auch der US-amerikanische Psychoanalytiker und Kinderpsychologe Bruno Bettelheim sah den Einfluss, den Kinder beim gemeinsamen Zusammenleben interpersonell aufeinander ausüben, als kraftvollstes therapeutisches Hilfsmittel an und argumentierte, dass… „[z]wischen der therapeutischen Wirksamkeit der Erlebnisse eines Kindes in der Einzelsitzung und in der Gruppe […] eine so enge Wechselbeziehung [besteht], daß es wenig sinnvoll ist, sich allgemein darüber zu äußern, welche von ihnen letzten Endes den Ausschlag geben.“ (Bettelheim 1971, S. 256)
In der gegenwärtigen Traumaarbeit besteht eine interdisziplinäre Einigkeit darüber, dass Alltagsstabilisierung aus dem sozialen und institutionellen Umfeld sowie die Qualität der im Alltag verankerten Beziehungen als wichtigstes Fundament der Traumaheilung angesehen werden (vgl. Schulze 2014, S. 120). „Jede psychische aufgebaute Stabilität geht verloren, wenn sie nicht sozial abgesichert ist“ (Roos 2008, S. 136).
Da die Jugendhilfe wesentlich (sozial-)pädagogisch und familienzentriert geprägt ist und überwiegend ressourcenorientierte Ansätze nutzt, bei denen spezifische Störungsbilder in den Hintergrund rücken, während sich die allgemeinen Fachkräfte des Gesundheitswesen mehrheitlich defizitorientiert an der krankheitswertigen Diagnose orientieren, so unterscheiden sich die Arbeits-, Denk- und Herangehensweisen der verschiedenen Berufsgruppen zum Teil beachtlich. Das kann einerseits zu parallelen Lösungen führen, andererseits zu unklaren Zuständigkeiten, die zu einem dauerhaften und destruktiven Verschieben von schwer traumatisierten Kindern und Jugendlichen mit einem speziellen Versorgungsbedarf führen kann und sich letzten Endes keines der Systeme mehr zuständig und verantwortlich fühlt. In solchen Fällen wird die Kinder- und Jugendhilfe oft zum „Sünden-“ oder „Prellbock“ degradiert (vgl. Fegert et al. 2013, S. 10). Fortfahrend ist davon auszugehen, dass die psychosoziale Belastung von Heimkindern durch den Ausbau der ambulanten Hilfen weiter zunehmen wird, da stationäre Jugendhilfemaßnahmen als letzte Instanz gelten und nur dann initiiert werden, wenn ambulante Hilfen scheitern (vgl. Schmid 2013 a, S. 36). Diese Entwicklung erhöht die Arbeitsbelastung und die fachlichen Anforderungen an psychosoziale Fachkräfte der Jugendhilfe.
Vor diesem Hintergrund zeichnete sich in den letzten Jahren ein traumapädagogischer Ansatz ab. Die Traumapädagogik bündelt eine Reihe pädagogischer Methoden, die sich an den Erkenntnissen der Psychotraumatologie und der Traumatherapie ausrichten und in sozialpädagogische Handlungsfelder übertragen werden (vgl. Schmid 2013 b, S. 56). Im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe kann Traumapädagogik als ein institutionelles Gesamtkonzept verstanden werden, da sie, neben alltäglichen Interventionen zwischen Professionellen und zu betreuenden Kind, auch die Selbstfürsorge der psychosozialen Fachkräfte und die Einrichtungsstruktur in den Blick nimmt (vgl. Bausum et al. 2013, S. 8).
Meine persönliche Motivation sich der Thematik des Traumas anzunehmen wurde bereits im Praxissemester des Bachelorstudiums geweckt, welches ich im Allgemeinen Sozialdienst eines Jugendamtes ableistete. Das halbjährige Praktikum ermöglichte mir zahlreiche Einblicke und Eindrücke aus der familiären und institutionellen Lebenswirklichkeit schwer belasteter Kinder. Die hohe Komplexität der Fallgeschichten aus der Kinder- und Jugendhilfe überraschten mich und sie verlangen nach einem engmaschig angelegten und interprofessionellen Netzwerk im Sinne eines ganzheitlichen biopsychosozialen Gesundheitsverständnisses. Die unterschiedlichen Professionen des Sozial- und Gesundheitssystems sollten über alle Grenzen hinweg als gleichwertiges Kollektiv kooperieren, um Kindern und Jugendlichen, die unsere Zukunft gestalten werden, die bestmögliche Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen.
Vertrauen ist keine Ware, die erkauft werden kann. Vertrauen ist ein persönliches Geschenk. Hilfebedürftigen Kindern ist der berufliche Habitus egal. Sie öffnen sich denjenigen Menschen, bei denen sie sich sicher, geborgen und aufgehoben fühlen, bei dem sie auf Verständnis stoßen sowie Annahme und Wertschätzung erfahren, der ihnen ehrliches Interesse und Aufmerksamkeit zugegen kommen lässt, unabhängig von beruflichen Qualifikationen oder therapeutischen Settings. Lebensraum und Bezugsperson(en), ob familiär oder professionell, bilden einen bedeutsamen Bestandteil im Leben traumatisierter Kinder und Jugendlicher. Deswegen ist eine Aufwertung und Stärkung der stationären Kinder- und Jugendhilfe durch die Gestalt einer Traumapädagogik dringend erforderlich, um den Bedürfnissen traumatisch belasteter Kinder und Jugendlicher fachlich gerecht zu begegnen.
Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus meinem Praktikum mündeten in eine Bachelorarbeit, die sich primär mit den psychosozialen Langzeitfolgen von sexualisierter Gewalt in der Kindheit und der Praxis der Ego-State-Therapie auseinandersetzte. Schlussendlich lag darin auch die Motivation den Masterstudiengang „Therapeutische Soziale Arbeit“ aufzunehmen und aktuell den Fokus auf die noch junge Fachdisziplin der Traumapädagogik zu legen. Die vorliegende Masterarbeit strukturiert sich in vier Teilabschnitte, richtet ihr Hauptaugenmerk auf die Traumapädagogik und widmet sich der wissenschaftlichen Fragestellung:
„Welchen gesundheitsfördernden Beitrag kann die Traumapädagogik in der psychosozialen Versorgung traumatisierter Kinder und Jugendlicher im Setting der stationären Kinder- und Jugendhilfe leisten?“
Das erste Kapitel der Arbeit liefert, unter Einbeziehung psychotraumatologischer Aspekte, einen allgemeinen Überblick über das psychische Kindheitstrauma. Dazu werden frühe Traumatisierungen in Zusammenhang mit der kindlichen Entwicklung sowie der Bindungstheorie betrachtet. Zusätzlich spielt die Dissoziationstheorie, die für das Verständnis von Traumata wesentlich ist, eine übergeordnete Rolle. Abschließend werden pathogene Dynamiken sequenzieller Traumatisierungen am Beispiel von sexueller Gewalt, häuslicher Gewalt und Kindesvernachlässigung im sozialen Nahraum und aus Sicht der kindlichen Opfer vorgestellt, damit das Ausmaß und die Tragweite dieser außerordentlichen Belastungen ansatzweise nachvollziehbar werden. Diese subjektive Auswahl prägender Kindheitsereignisse geht mit der Begründung einher, dass die Aufdeckung sexueller und häuslicher Gewalt sowie gravierender Kindesvernachlässigungen in der Regel dazu führt, dass Jugendämter familienersetzende Hilfen veranlassen.
Im zweiten Kapitel wird der Versuch unternommen, unter Zuhilfenahme international anerkannter Diagnoseklassifikationssysteme, posttraumatische Störungsbilder zu erfassen und dessen Pathogenese im Rahmen eines vorstellbaren und chronologisch geordneten Krankheitsverlaufs zu skizzieren.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich explizit mit der Traumapädagogik im stationären Setting des Kinder- und Jugendhilfesystems. Um den gesundheitsfördernden Wert und den daraus abzuleitenden gesundheitsfördernden Beitrag der Traumapädagogik im psychosozialen Versorgungsbereich für traumatisierte Kinder und Jugendliche zu ergründen, bedarf es einer Analyse des traumapädagogischen Grundverständnisses. Hierzu werden Haltungen, Prinzipien und Kernelemente der traumapädagogischen Arbeit vorgestellt. Abgerundet wird dieser Teilabschnitt durch subjektiv ausgewählte Methoden, die sich im Kontext von Traumapädagogik und integrativer Traumahilfe bewährt haben. Die Darstellung der Methoden strebt keine Vollständigkeit an. Sie werden bündig in ihrem Grundansatz abgebildet und aus salutogenetischer Perspektive in Zusammenhang mit Traumatisierungen betrachtet.
Im vierten Kapitel werden die Erkenntnisse aus dem vorangegangenen Kapitel in Relation zu den Forderungen der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung gesetzt und anschließend durch aktuelle Evaluationsstudien untermauert.
Das abschließende fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse dieser Arbeit bündig zusammen, stellt einen gesamtgesellschaftlichen Bezug her und widmet sich der Beantwortung der Ausgangsfrage nach dem salutogenen Versorgungsbeitrag einer psychosozialen Traumaarbeit im Setting der stationären Kinder- und Jugendhilfe.
1 Das psychische Kindheitstrauma – Ein Überblick
1.1 Begriffsbestimmung „Psychotrauma“
Die Begrifflichkeit des Traumas kommt aus dem Altgriechischen und wird mit Wunde oder Verletzung übersetzt. Im medizinischen Bereich bezieht sich der Terminus „Trauma“ auf eine rein körperliche Schädigung, während in der Psychologie die Verletzung der menschlichen Psyche gemeint ist und unverwechselbar Psychotrauma genannt wird (vgl. Scherwath & Friedrich 2014, S. 17). Fischer & Riedesser (2003, S. 82) definieren ein psychisches Trauma als ein… „vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.“
Huber veranschaulicht eine „Traumatische Zange“ durch die sich ein extrem stressreiches äußeres Ereignis als traumatisch charakterisieren lässt und sich klar von einem belastenden Lebensereignis abhebt und abgrenzt. Bestimmend ist der extreme Stressor, der von außen auf den Menschen einwirkt. Sind Menschen auf die jeweilige äußere Extremsituation nicht angemessen vorbereitet und werden alle Bewältigungsmechanismen überfordert, wird das menschliche Gehirn mit aversiven Reizen überflutet. Da unser Gehirn als zentrales Informationsverarbeitungssystem gilt, nehmen wir es als das eigene Selbst wahr und die jeweilige Extremsituation wird nun als lebensbedrohlich eingestuft. Folglich setzt diese Stressüberflutung eine Art Alarmzustand oder „Notfallprogramm“ in Gang, ausgelöst durch das Stammhirn (auch „Reptiliengehirn“ genannt), dem evolutiv ältesten menschlichen Gehirnteil, und stattet den Menschen mit zwei meist unbewussten und automatisch ablaufenden Reflexen des Fight or Flight aus, dem Kämpfen oder Fliehen. Führt einer der beiden Reflexe zum Erfolg, kann eine mögliche Traumatisierung noch abgewendet werden. Versagt die Fight-or-Flight-Reaktion, greift die „Traumatische Zange“ mit der Konsequenz des Freeze und Fragment (vgl. Huber 2009, S. 39ff.).
Die Freeze-Reaktion kann mit einer Schock- oder Lähmungsreaktion gleichgesetzt werden. Der Mensch wird handlungsunfähig und erlebt die Situation von nun an als traumatisch. Da die aggressiven Reize im Außen nicht mehr bezwungen werden können, versucht das Gehirn sie im Inneren unschädlich zu machen und schüttet eine Fülle an Endorphinen und Noradrenalin aus, um der akut erlebten Todesangst entgegenzuwirken. Die Ausschüttung der Endorphine, die wie Opiate wirken, gestatten dem Organismus sich zu betäuben, eine innere Distanz vom Erleben zu schaffen und löst letztendlich eine Entfremdung vom überwältigenden Geschehen aus, was wiederum den Vorgang des Fragment begünstigt, der mit dissoziativen Prozessen gleichgestellt werden kann. Das heißt, dass je nach Schwere und Dauer des Traumas die zusammenhängende traumatische Erfahrung in mehrere Einzelteile zersplittert wird. Abschließend werden diese Erinnerungsfetzen so verdrängt, dass ohne gezielte Anstrengungen kein vollständiges Bild der traumatischen Erfahrung mehr wahrgenommen und erinnert werden kann (vgl. Huber 2009, S. 43).
„Psychisches Trauma ist das Leid der Ohnmächtigen. Das Trauma entsteht in dem Augenblick, wo das Opfer von einer überwältigenden Macht hilflos gemacht wird.“ (Herman 2003, S. 53) Demzufolge lässt sich ein Trauma, aufgrund der in Körper und Seele erlebten Erstarrung und Hilflosigkeit, nach Fischer (2005, S. 12) als eine „unterbrochene Handlung“ definieren. Der „Zeigarnik-Effekt“ erklärt, dass bedeutende unterbrochene Handlungen verstärkten Wiederholungstendenzen und -zwängen unterliegen (vgl. Fischer & Riedesser 2003, S. 83). Das Trauma reinszeniert sich selbst und sucht in diesem Sinne „ununterbrochen“ nach Vervollständigung und Abschluss. Reinszenierungen beinhalten sowohl die Chance einen Heilungsprozess in Gang zu setzen und korrigierende Erfahrungen zu machen, als auch das Risiko erneuter traumatischer Erfahrungen durch Reviktimisierungen. Scherwath & Friedrich (2014, S. 27) bezeichnen diesen retraumatisierenden Wiederholungsvorgang, ohne begleitende therapeutische Integration des traumatischen Materials in das biografische Gedächtnis der Betroffenen, als „traumatische Schleife“.
Traumata lassen sich in zwei verschiedene Kategorien typisieren. Typ-I-Traumata (Monotraumatisierung) sind gekennzeichnet durch ein einmaliges Auftreten der traumatischen Erfahrung (z.B. Unfälle, Naturkatastrophen, Operationen, Überfälle, einmalige Misshandlung, Vergewaltigungen), während Typ-II-Traumata (Komplextraumatisierung) als mehrmalige und lang andauernde traumatische Erfahrungen (z.B. körperliche und seelische Misshandlung, Vernachlässigung, sexuelle Gewalt) charakterisiert werden (vgl. Garbe 2015, S. 29f.). Zusätzlich kann noch in apersonale Traumata (z.B. Naturkatastrophen) und personale Traumata (z.B. sexuelle Gewalt) untergliedert werden (vgl. Dittmar 2013 a, S. 35). Interpersonell verursachte Traumata wirken sich mit höherer Wahrscheinlichkeit tiefgreifender auf die Persönlichkeit eines Menschen aus und je schwerer und häufiger sie auftreten, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine posttraumatische Belastungsstörung (kurz PTBS) ausbildet (vgl. Kennerley 2003, S. 25).
Ausschlaggebend für das Definitionsverständnis von Traumata ist, dass traumainduzierte Symptome nicht die Folge des äußeren Ereignisses sind, auch wenn das äußere Belastungsausmaß einen wichtigen Faktor darstellt, sondern ein Trauma in erster Linie physiologischer Natur ist, sich im Nervensystem der Überlebenden verankert und dort nachhallt (vgl. Levine & Kline 2011, S. 22). Somit ist ein Trauma ein biologisches Ereignis und abhängig von der Bewertung und Reaktion des jeweiligen Nervensystems. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass ein Trauma sehr individuell zu betrachten ist und grundsätzlich jede Situation für ein Kind oder einen Erwachsenen traumatischen Gehalt aufweisen kann, vorausgesetzt sie wird als Bedrohung wahrgenommen und übersteigt die eigenen Bewältigungsfähigkeiten und zur Verfügung stehenden Ressourcen (vgl. Levine & Kline 2011, S. 36).
„Die persönliche Bedeutung, die eine traumatische Erfahrung für einen Menschen hat, ist ausschlaggebend, denn sie steht in enger Beziehung zu den Problemen des Menschen im Erwachsenenalter.“ (Kennerley 2003, S. 22) Kennerley (2003, S. 25) betont jedoch, dass traumainduzierte Folgesymptome nicht unausweichlich sind, denn positive Kindheitserfahrungen können trotz erlebter Traumata die Resilienz erhöhen. Beispielsweise bilden einige Kinder, die sexuelle Gewalt erleben mussten, in ihrem Lebensverlauf keine Folgestörungen aus, weil ihr persönliches Wohlbefinden von anderen Faktoren positiv beeinflusst wurde. Das bedeutet, dass ein Kindheitstrauma kein bestimmtes Folgeproblem auslöst, sondern vielmehr die Vulnerabilität eines Menschen allgemein erhöht und ihn empfänglicher für Schwierigkeiten werden lässt.
1.2 Epidemiologische Aspekte
Generell betrachtet erleiden zwischen 30 und über 60 Prozent aller Menschen in ihrem Lebensverlauf ein schweres Trauma (vgl. Huber 2009, S. 66). Epidemiologische Studien, die sich der Prävalenz psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen nach traumatischen Lebensereignissen widmen, sind erst ab einem Lebensalter von 12 Jahren verfügbar. Im deutschsprachigen Raum existieren drei relevante Studien, die ihren Blick auf die Prävalenz der PTBS im Jugendalter sowie im jungen Erwachsenenalter richten (vgl. Landolt 2012, S. 61).
(1) Die Bremer Jugendstudie von Essau et al. (1999) erzielte in der Gruppe der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen eine Lebenszeitprävalenz der PTBS von 1,6 Prozent. Eine hochgradige Komorbidität bestand mit depressiven und somatoformen Störungen sowie mit Substanzmittelmissbrauch. 22,5 Prozent der Befragten berichtete in ihrem Leben bereits ein traumatisierendes Erlebnis gehabt zu haben. Geschlechtsspezifisch betrachtet waren Mädchen deutlich häufiger sexueller Gewalt ausgesetzt, während Jungen bei physischer Gewalt und Unfällen deutlich stärker vertreten waren.
(2) Die repräsentative Stichprobenstudie von Perkonigg et al. (2000) untersuchte 14- bis 24-Jährige aus dem Raum München und erzielte vergleichbare Ergebnisse. Hier bejahten 26 Prozent der Männer und 17,7 Prozent der Frauen mindestens eine traumatische Lebenserfahrung. Die Lebenszeitprävalenz der PTBS betrug 1,3 Prozent. Die hohen Komorbiditäten waren auch in dieser Studie auffallend und konnten bestätigt werden. In einer Folgestudie von 2005 wurden die Probanden erneut untersucht. Bei 48 Prozent der Probanden war die PTBS nach wie vor vorhanden. Besonders bei denjenigen, die eine stärker ausgeprägte Vermeidungssymptomatik entwickelten sowie begleitend unter somatoformen Störungen oder Angststörungen litten. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die PTBS auch im Jugendalter im hohen Maße zur Chronifizierung tendiert.
(3) Eine weitere gesamtdeutsche epidemiologische Studie von 2008 ermittelte eine Einmonatsprävalenzrate der PTBS in der Alterseinteilung der 14- bis 29-Jährigen von ebenfalls 1,3 Prozent. Hier gaben 9,9 Prozent der Probanden an bereits mit mindestens einem traumatischen Erlebnis konfrontiert gewesen zu sein. (vgl. Landolt 2012, S. 61f.)
Weitere informative Daten und Fakten liefern die Polizeiliche Kriminalstatistik und das Statistische Bundesamt. Der Polizeilichen Kriminalstatistik ist zu entnehmen, dass im Jahr 2014 12.134 Fälle von sexueller Gewalt an Kindern (§§ 176, 176a, 176b StGB) in Deutschland registriert wurden und die Anzahl der Fälle erstmalig, nach einem stetigen Anstieg in den Jahren 2009 bis 2012, um -2,4 Prozent rückläufig sind. Natürlich muss von einem hohen Dunkelfeld ausgegangen werden (vgl. Bundesministerium des Inneren 2015, S. 8).
Das Statistische Bundesamt meldet, dass die Jugendämter in Deutschland 2014 rund 124.000 Verfahren zur Gefährdungseinschätzung des Kindeswohls durchführten, was einen Vorjahresanstieg von 7,4 Prozent darstellt. 18.600 dieser Verfahren wurden als eindeutige und akute Kindeswohlgefährdung erkannt. Bei den akuten Kindeswohlgefährdungen beläuft sich der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr auf 8,2 Prozent. In weiteren 22.400 Verfahren wurden latente Kindeswohlgefährdungen identifiziert, weil eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls nicht ausgeschlossen werden konnte. Bei den latenten Kindeswohlgefährdungen bemisst sich der Anstieg zum Vorjahr auf 4,7 Prozent. 63,6 Prozent der Kinder aus diesen zusammengerechneten 41.000 Verfahren wiesen Anzeichen von Vernachlässigung auf. 27,2 Prozent zeigten Anzeichen psychischer Misshandlung und bei 23,6 Prozent der Kinder wurden physische Misshandlungen festgestellt. In 4,6 Prozent der Fälle wurde sexuelle Gewalt diagnostiziert. Allerdings waren Mehrfachnennungen möglich. Die Gesamtzahl der Verfahren betraf Jungen und Mädchen in etwa gleich häufig. Kleinkinder waren aber im besonders hohen Maße betroffen. Fast jedes vierte Kind hatte das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet. Die drei- bis fünfjährigen Kinder waren von einem Fünftel der Verfahren betroffen. Grundschulkinder von sechs bis neun Jahren stellten einen Anteil von 22,2 Prozent und Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren einen Anteil von 18,3 Prozent. Jugendliche (14 bis 17 Jahre) waren von den einschätzenden Verfahren am wenigsten betroffen mit 15,3 Prozent (vgl. Statistisches Bundesamt 2015).
Zusammengefasst und im internationalen Kontext betrachtet, geht die aktuelle Studienlage bei Kindesvernachlässigung von einer Prävalenz der PTBS zwischen 20 bis 30 Prozent aus und bei physischer und sexueller Kindesmisshandlung von einer Prävalenz zwischen 18 bis 58 Prozent (vgl. Landolt 2012, S. 73).
1.3 Traumatische Situations- und Risikofaktoren
Pynoos, Steinberg & Wraith (2000, S. 271) fassen eine Liste präziser Beschreibungen von situativen Merkmalen traumatischer Erfahrungen zusammen, die bei Kindern in der Regel zu schwereren posttraumatischen Reaktionen und Symptomen führen:
direkte Lebensbedrohung
Verletzung der eigenen Person, unter Berücksichtigung des Ausmaßes körperlicher Schmerzen Zeuge sein von Verstümmelungen oder ungewöhnlichen Todesarten (besonders im Falle von Familienmitgliedern oder Freunden) eigenes Begehen gewalttätiger Handlungen gegen andere Hören unbeantworteter Hilfe- und Verzweiflungsschreie, Riechen schädlicher Gerüche Gefangen oder ohne Hilfe zu sein Nähe zu gewaltsamer Bedrohung Unerwartetheit und Dauer der Erfahrung(en) Ausmaß der Gewalt und des Gebrauchs einer Waffe oder eines verletzenden Gegenstandes Anzahl und Art der Drohung während einer gewaltsamen Episode Augenzeuge von Greueltaten zu sein Beziehung zum Täter und zu anderen Opfern Gebrauch körperlicher Nötigung Verletzung der körperlichen Integrität des Kindes Grad der Brutalität und Feindseligkeit Fischer & Riedesser (2003, S. 147ff.) differenzieren in soeben genannte Situationsfaktoren und Risikofaktoren. Situationsfaktoren gelten als weniger weit gefasst und beschreiben im engeren Sinne die Bedingungen einer traumatischen Situation. Traumatische Situationsfaktoren verstärken das Erkrankungsrisiko. Mit Risikofaktoren sind in erster Linie belastende Lebensereignisse gemeint, die sich einzeln auswirken können oder in ihrem gebündelten Zusammenwirken eine psychische Störung oder Fehlentwicklungen begünstigen. Besonders bei lang andauernden Komplextraumatisierungen können Situations- und Risikofaktoren verhängnisvoll zusammenwirken, aber auch Monotraumatisierungen können schlechter verarbeitet werden, wenn konfliktreiche und risikobehaftete Familienverhältnisse gegeben sind, die den Prozess der Traumaverarbeitung erschweren und unterbrechen. Die Wirkkraft eines einzelnen Risikofaktors wird als gering eingestuft, während bereits bei zwei Faktoren das Risiko von Entwicklungsstörungen um das Vierfache zunimmt. Demgemäß können schwierige soziale Lebensumstände zu einer allgemein traumatischen Lebenssituation beisteuern.
Egle & Hardt (2005, S. 40) haben eine Reihe gesicherter Risikofaktoren für die Entstehung psychischer und psychosomatischer Krankheiten im Kindesalter anschaulich zusammengestellt:
niedriger sozioökonomischer Status schlechte Schulbildung der Eltern Arbeitslosigkeit große Familien und sehr wenig Wohnraum Kontakte mit Einrichtungen der „sozialen Kontrolle“ (z.B. Jugendamt) Kriminalität oder Dissozialität eines Elternteils chronische familiäre Disharmonie mütterliche Berufstätigkeit im ersten Lebensjahr unsicheres Bindungsverhalten nach 12./18. Lebensmonat psychische Störungen der Mutter/ des Vaters schwere körperliche Erkrankungen der Mutter/ des Vaters chronisch krankes Geschwister Ein-Eltern-Familie/ alleinerziehende Mutter autoritäres väterliches Verhalten Verlust der Mutter Scheidung, Trennung der Eltern häufig wechselnde frühe Beziehungen sexueller und/oder aggressiver Missbrauch schlechte Kontakte zu Gleichaltrigen Altersabstand zum nächsten Geschwister < 18 Monate längere Trennung von den Eltern in den ersten 7 Lebensjahren hohe Risiko-Gesamtbelastung Jungen vulnerabler als Mädchen Huber (2009, S. 83) untergliedert in Faktoren, die sich vor und nach dem traumatischen Ereignis destruktiv auswirken und die Wahrscheinlichkeit an einer PTBS zu erkranken erhöhen:
Faktoren vor dem traumatischen Ereignis geringe soziale Unterstützung „Schicksalsschläge“ (adverse life events) Armut der Eltern vorherige Misshandlung in der Kindheit dysfunktionale Familienstrukturen familial-genetische Geschichte psychischer Störungen Introversion oder extrem gehemmtes Verhalten Geschlecht: weiblich schlechte körperliche Gesundheit vorherige psychische Störung Faktoren nach dem Trauma mangelnde soziale Unterstützung fortgesetzte negative Lebensereignisse mangelnde Anerkennung des Traumas durch andere sekundäre Stressfaktoren wie Schulwechsel, Umzug, Zerstörung des Zuhauses, wiederholte Bedrohungen, Angst vor dem Täter und finanzielle Probleme
1.4 Schutzfaktoren (Salutogenese – Resilienz – Posttraumatic Growth)
Abgesehen von der pathogenetischen Ausrichtung der Risikofaktoren, besteht spätestens seit dem Medizinsoziologen Aaron Antonovsky eine konträre salutogenetische Sichtweise, die ihr Augenmerk auf die gesundheitsfördernden und gesundheitserhaltenden Ressourcen und Faktoren eines Menschen legt, woraus letztlich die moderne Resilienzforschung hervorgegangen ist.
Das von Antonovsky in den 1970er Jahren entwickelte Konzept der Salutogenese geht davon aus, dass Menschen laufend mit belastenden Lebenssituationen konfrontiert sind. Die belastenden Reize (Stressoren) stehen den Widerstandsressourcen eines Menschen gegenüber. Folgendermaßen befinden sich Stressoren und Widerstandsressourcen in ständiger Wechselwirkung. Zu den allgemeinen Widerstandsressourcen zählen soziokulturelle, interpersonale, psychische, physische, persönliche und materielle Ressourcen. Zentrales Element der Salutogenese ist das Kohärenzgefühl (engl. „sense of coherence“), welches von Antonovsky als bedeutsamste Gesundheitsressource hervorgehoben wurde. Ob ein Mensch seine vorhandenen Ressourcen in ihrer vollen Wirksamkeit mobilisieren und entfalten kann, hängt wesentlich vom Gefühl der Kohärenz ab (vgl. Keupp 2009, S. 97). Das Kohärenzgefühl meint, …
-dass ein Mensch Lebensereignisse der inneren und äußeren Umwelt als strukturiert, vorhersehbar und erklärbar erlebt (Verstehbarkeit – Verstehensebene),
-dass er genügend Ressourcen zu Verfügung hat, um die Anforderungen seines Lebens zu bewältigen (Handhabbarkeit – Bewältigungsebene),
-dass er diese Lebensanforderungen als positive Herausforderungen interpretiert und deren Bewältigung als lohnend und sinnhaft wahrnimmt (Sinnhaftigkeit – Sinnebene) (vgl. Antonovsky 1997, S. 36).
Insofern kann ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl als ein positives Selbstbild eines Menschen aufgefasst werden. Das Vertrauen in sich selbst und in seine Fähigkeiten ist gefestigt. Die Welt wird als vertrauenswürdig wahrgenommen, man steht ihr offen und lebensbejahend gegenüber. Das eigene Denken ist positiv geprägt und mündet in optimistische Grundhaltungen. Die Einflussnahme auf das eigene Leben wird persönlich als hoch eingestuft. Es gibt erstrebenswerte Ziele im Leben, die erreicht werden wollen. Die Zuversicht, dass auch schwierige persönliche Problemkonstellationen gemeistert werden können und einen erfolgversprechenden Ausgang nehmen, ist hoch. In Notsituationen kann auf helfende Menschen aus dem sozialen Umfeld zurückgegriffen werden. Die innere Gewissheit, dass sich unterstützende Menschen in Krisenzeiten mobilisieren lassen, ruht tief.
„Wenn die Kohärenz verloren geht, führen traumatische Erfahrungen zu einem mangelhaft integrierten Selbstkonzept mit Brüchen im Selbst, dem Ich und den Objektbeziehungen.“ (Streeck-Fischer 2006, S. 132) Egle & Hardt (2005, S. 41) listen wissenschaftlich gesicherte Faktoren auf, die sich in Bezug auf psychische und psychosomatische Krankheiten als protektiv erwiesen haben bzw. deren Folgen abpuffern können:
dauerhafte gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson sicheres Bindungsverhalten Großfamilie, kompensatorische Elternbeziehungen, Entlastung der Mutter gutes Ersatzmilieu nach frühem Mutterverlust überdurchschnittliche Intelligenz robustes, aktives und kontaktfreudiges Temperament soziale Förderung (z.B. Jugendgruppen, Schule, Kirche) internale Kontrollüberzeugungen, „self-efficacy“ verlässlich unterstützende Bezugsperson(en) im Erwachsenenalter lebenszeitlich spätes Eingehen „schwer auflösbarer Bindungen“ (späte Familiengründung) geringe Risiko-Gesamtbelastung Jungen vulnerabler als Mädchen
Der Terminus der Resilienz, der mit dem Begriff der Salutogenese verwandt ist, bezieht sich primär auf die psychische Widerstandskraft und meint die Fähigkeit eines Menschen „erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Stressfolgen“ (Wustmann 2004, S. 18) umgehen zu können. „Salutogenese verhält sich zu Pathogenese wie Resilienz zu Vulnerabilität“ (Borst 2006, S. 197). Die viel zitierte Pionierstudie der Resilienzforschung von Emmy E. Werner untersuchte 698 Kinder des kompletten Geburtenjahrgangs 1956 auf der Hawaii-Insel Kauai. Fachkräfte aus der Medizin, der Psychologie und aus dem Sozialwesen dokumentierten die Entwicklung der ethnisch gemischten Kinder über einen Zeitraum von 40 Jahren. 30 Prozent der rund 700 untersuchten Kinder galten als Risikokinder. Sie wuchsen unter sehr schwierigen Lebensbedingungen auf. Armut, Scheidung, Krankheit der Eltern, Vernachlässigung und Misshandlungen prägten ihre Kindheit. Untersuchungen im Alter von 10 und 18 Jahren offenbarten, dass zwei Drittel von ihnen Lernprobleme aufzeigten, straffällig geworden sind oder an psychischen Symptomen litten. Das übrige Drittel der Risikokinder, etwa 70 Studienteilnehmer und somit 10 Prozent des gesamten Geburtenjahrgangs, entwickelten sich trotz widriger Umstände außerordentlich positiv. Ihr Lebensweg zeichnete sich durch eine erfolgreiche Schullaufbahn aus. Sie erlernten einen Beruf, wurden finanziell unabhängig und gründeten eine eigene Familie. Auch eine Vielzahl der Kinder und Jugendlichen, die zuvor durch Jugendkriminalität und Drogenkonsum aufgefallen waren, konnten sich später von der Last ihrer Kindheit befreien. Bedeutsame Wendepunkte in ihrer Entwicklung waren Ereignisse wie die Geburt ihres ersten Kindes, das Erleben einer beständigen Beziehung oder Heirat, eine feste Arbeitsstelle, berufliche Weiterbildungen oder religiöses Engagement (vgl. Wettig 2009, S. 131).
Die Ergebnisse aus der Resilienzforschung machen Mut, dass Kindheit nicht gleichgesetzt wird mit Schicksal, jedoch zeigen die Studien auch, dass sich die Mehrzahl der Kinder, die unter widrigen Lebensumständen aufwachsen, schlechter entwickeln, als Kinder unter günstigen Bedingungen. Ebenso behalten auch als resilient eingestufte Kinder seelische Narben zurück und werden in gewisser Weise geprägt. Dennoch muss anerkannt werden, dass einige Kinder auch ungünstige Lebenslagen um ein Vielfaches besser meistern als es die psychoanalytische Denkschule prophezeien würde. Eine generalisierte Unverwundbarkeit vor den Einflüssen des Lebens gibt es nicht. Dies zeigt deutlich auf, dass auch das Phänomen der Resilienz individuell zu betrachten ist (vgl. Nuber 2012, S. 129f.). Daher wird Resilienz als eine „variable Größe“ (Wustmann 2004, S. 30) bewertet und begreift sich als ein “dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess“ (ebd., S. 28).
Die Resilienzforschung liefert wichtige Erkenntnisse für die direkte pädagogisch-therapeutische Praxis in Hinblick auf die psychosoziale Entwicklung belasteter Kindheiten. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff (2011, S. 362) fassen sechs übergeordnete Faktoren zusammen, die für die Entstehung von Resilienz maßgeblich verantwortlich sind. Da Resilienz keine angeborene Größe darstellt, sondern im Lauf der Entwicklung erlernt werden kann, können die folgenden Schlüsselfaktoren bereits bei Kindern gezielt gefördert werden, um ihre psychische Widerstandskraft zu steigern bzw. ihre Vulnerabilität zu senken:
(1) Selbst- u. Fremdwahrnehmung (angemessene Selbsteinschätzung und Informationsverarbeitung),
(2) Selbststeuerung (Regulation von Gefühlen und Erregung),
(3) Selbstwirksamkeit (Überzeugung, Anforderungen bewältigen zu können)
(4) Soziale Kompetenz (Unterstützung holen, Selbstbehauptung, Konflikte lösen)
(5) Umgang mit Stress (Fähigkeiten zur Realisierung vorhandener Kompetenzen in der Situation)
(6) Probleme lösen (allgemeine Strategien zur Analyse und zum Bearbeiten von Problemen)
Daran anknüpfend wird das Konzept des posttraumatischen Wachstums (engl. "posttraumatic growth“) als Fortführung der Salutogenese und des Resilienzkonzepts aufgefasst (vgl. Hepp 2006, S. 151). Während sich die Konzepte der Salutogenese und Resilienz auf persönliche Dispositionen eines Menschen fokussieren, damit er schweren Lebensereignissen besser trotzen kann, bezieht sich posttraumatisches Wachstum auf transformative Veränderungen als Folge eines traumatischen Geschehens, ohne dabei das Trauma an sich bagatellisieren zu wollen (vgl. Zöllner, Calhoun & Tedeschi 2006, S. 39). Posttraumatisches Wachstum beruht auf der Annahme, dass traumatische Erschütterungen nicht nur Leid und negative Folgen hervorrufen, sondern auch zu positiven psychologischen Veränderungen beitragen können, die eine nachhaltige Wirkung entfalten und von Betroffenen als ein persönlicher Gewinn erfahren werden (vgl. ebd., S. 37).
„Ob eine Krise zu einer Chance für ein neues Erleben unserer Identität werden kann, ob wir aus einer Krise mit neuen Verhaltensmöglichkeiten, neuen Dimensionen des Selbst- und Welterlebens hervorgehen, […] das[s] hängt wesentlich davon ab, ob wir die Krise als eine Lebenssituation zu sehen vermögen, in der für unser Leben existentiell Wichtiges sich ereignet und entscheidet, oder ob wir die Krise nur als lästiges Beiwerk des Lebens sehen, das wir so rasch als möglich vergessen wollen.“ (Kast 2013, S. 14)
Calhoun & Tedeschi, die Vorreiter auf dem Forschungsgebiet des posttraumatischen Wachstums, verkünden, dass 30 bis 90 Prozent der Betroffenen von mindestens einem Aspekt posttraumatischer Reifung berichten. Sie stellen aber eindeutig klar, dass überwältigende Lebensereignisse für die meisten Betroffenen mit einer Vielzahl negativer Konsequenzen verbunden sind, was eher der Norm entspricht. Dementsprechend ist posttraumatisches Wachstum zwar verbreitet, darf aber keineswegs als universell angesehen werden (vgl. Calhoun & Tedeschi 2013, S. 13). Im Folgenden werden die fünf Bereiche vorgestellt, in denen sich positive Traumafolgen aufzeigen lassen:
(1) Intensivierte Wertschätzung des Lebens: Einige Menschen berichten nach schweren Traumata von einem tieferem Sinnerleben. Ihr Lebensfokus richtet sich neu aus. Den „kleinen Dingen im Leben“ wird eine erhöhte Bedeutsamkeit zugesprochen. Der neue Blick auf das Essentielle führt zu bedeutenden Veränderungen im Alltagserleben und kann als ein zentraler Baustein posttraumatischer Reifung nach einer Extremerfahrung angesehen werden.
(2) Intensivierung persönlicher Beziehungen: Manche Menschen erfahren auch eine neue Sensibilität im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie sprechen von einer Steigerung ihrer Empathiefähigkeit und einem allgemein erhöhten Mitgefühl für andere, besonders für notleidende Menschen. Dieser Aspekt des posttraumatischen Wachstums kann einerseits dazu führen, dass zu bestimmten Menschen eine stärkere Verbundenheit entsteht. Andererseits distanzieren und lösen sich Betroffene auch von bestehenden Beziehungen, denn in Situationen großer Verletzlichkeit kristallisiert sich besonders deutlich heraus, auf welche Menschen Verlass ist.
(3) Bewusstwerden der eigenen Stärke: Extremerfahrungen führen zu einem Bewusstwerden der eigenen Vulnerabilität. Paradoxerweise mündet diese Erkenntnis manchmal in ein gewachsenes Gefühl an innerer Stärke. Die traumatische Erfahrung hat dazu geführt, dass Betroffene sich darüber im Klaren sind, dass es für die eigene Sicherheit im Leben keine unumstößliche Garantie gibt und einschneidende Ereignisse jederzeit unerwartet eintreten können. Daraus ergibt sich die innere Gewissheit, dass auch künftige Problemlagen adäquat überwunden und gemeistert werden können.
(4) Entdeckung neuer Möglichkeiten: Hier zeigt sich posttraumatisches Wachstum durch die Entwicklung neuer Interessen, Wünsche und Zielvorstellungen, die ihren Ausdruck zum Beispiel in einem Berufswechsel finden können oder zu einem größeren sozialen Engagement beitragen.
(5) Intensiviertes spirituelles Bewusstsein: Der letzte Bereich bezieht sich auf veränderte religiöse oder spirituelle Lebens- und Weltanschauungen. Selbst zuvor atheistisch eingestellte Menschen finden zu einem tieferen Glauben. Dieser neu erworbene Glauben kann als ein standhaftes Fundament für einen Neubeginn dienen. (vgl. Zöllner, Calhoun & Tedeschi 2006, S. 38)
Speziell bei 6- bis 15-jährigen Kindern und Jugendlichen, die den Wirbelsturm „Floyd“ von 1999 in North Carolina überlebt haben, hat sich herausgestellt, dass das größte Potenzial posttraumatischen Wachstums bei denjenigen Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen war, die sich selbst eine hohe Problemlösefähigkeit zugeschrieben haben und von dieser überzeugt waren. So lässt sich abschließend festhalten, dass die Wahrscheinlichkeit posttraumatisches Wachstum zu erfahren am höchsten ist, wenn Menschen die auslösenden traumatischen Ereignisse häufig in ihrer gedanklichen Vorstellung nachvollziehen, damit sie besser verstanden und eingeordnet werden können (vgl. Gerrig & Zimbardo 2008, S. 486).
1.5 Trauma und Entwicklung
Die menschliche Entwicklung ist durch eine Reihe unterschiedlicher Entwicklungsaufgaben und -herausforderungen geprägt. Kinder, die dauerhaft einem erhöhten Bedrohungs- und Stressniveau ausgesetzt sind, fokussieren ihre Energien auf das Überleben. Für die eigene Persönlichkeitsentwicklung bleiben nur noch unzureichende Ressourcen verfügbar. Dadurch können Reifungs- und Entwicklungsprozesse gehemmt werden, völlig zum Erliegen kommen oder sogar einen Rückschritt in bereits bewältigte Entwicklungsphasen bedeuten. Weinberg (2010, S. 13) bezeichnet eine traumabedingte Entwicklungsstörung als eine „tief greifende Schädigung der Gesamtentwicklung.“
Der Entwicklungsstand zum Zeitpunkt der traumatischen Erfahrung(en) stellt eine beachtenswerte Größe dar. Kinder verfügen nach Levine & Kline (2011, S. 64) nur über „begrenzte motorische und sprachliche Ausdrucksfähigkeiten“. Ihre Schutzmöglichkeiten sind gegenüber älteren Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen noch weitaus geringer, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich Ängste, Rückzugstendenzen, aggressive Impulsdurchbrüche und Vermeidungsverhalten manifestieren (vgl. ebd., S. 64).
Die moderne Hirnforschung hat nachgewiesen, dass vor allem der informations- und erlebnisbedingte Input aus der unmittelbaren Lebensumwelt unser menschliches Gehirn in seiner neuronalen Vernetzung und Strukturbildung entscheidend beeinflusst. Der Begriff der Neuroplastizität beschreibt, dass das menschliche Gehirn in seiner Formbarkeit nutzungs- bzw. erfahrungsabhängig ist. Es gilt: Je jünger das Kind ist, umso höher ist seine neuronale Plastizität. Demgemäß formen alle grundlegenden Kindheitserfahrungen, ob positiver oder negativer Natur und je nach ihrer Auftretenshäufigkeit und dem Grad ihrer affektiven Aufladung, Reaktionsmuster aus (vgl. Besser 2013, S. 42f.).
„Im Gehirn werden in der Kindheit und Jugend die Nervenzell-Netzwerke angelegt, die später darüber entscheiden, wie eine Person ihre Umwelt einschätzt und interpretiert, wie sie Beziehungen gestaltet und wie sie mit den Herausforderungen umgeht, die das Leben bereithält.“ (Bauer 2010 a, S. 177)
Die folgende Tabelle verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Entwicklungsaufgaben und kindlicher Identitätsbildung. Störungen in den jeweiligen Entwicklungsphasen wirken sich negativ auf das Selbstbild eines Kindes aus. Erfolg oder Misserfolg einer anstehenden Entwicklungsherausforderung beeinflussen Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstwirksamkeit:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Entwicklungsaufgaben (Scherwath & Friedrich 2014, S. 35)
Kinder, die anhaltende bedrohliche Lebenserfahrungen machen mussten, mussten vielfach auf die angeborenen Überlebensreaktionen (Überregung, Unterwerfung, Erstarrung, Kampf- und Fluchtreaktionen) zurückgreifen. Das führt nachweislich zu neurobiologischen Veränderungen, die schwere psychische und kognitive Auffälligkeiten und Defizite zur Folge haben können. Durch die häufig ausgelöste Überflutung des Gehirns mit Stresshormonen, hauptsächlich durch Cortisol, werden bereits angelegte synaptische Verschaltungen gekappt und gleichzeitig wird der Aufbau neuer neuronaler Netze erschwert und verhindert. Dadurch werden Überlebensreaktionen automatisiert. Das Kind greift bereits in kleinen alltäglichen Stresssituationen reflexartig auf diese zurück (vgl. Besser 2013, S. 43).
„Die existenzielle Angst unter traumatischen Lebensbedingungen hinterlässt beim Kind offenbar eine Spur von tiefgreifenden Veränderungen im Gehirn und nachfolgend auch bei Organstrukturen, die durch die Steuerzentrale im Kopf in ihrem Ausbau geformt werden.“ (Krüger 2013, S. 44)
Kinder und Jugendliche benötigen für ihre emotionale, kognitive und soziale Entwicklung ein fürsorgliches Umfeld. Schlussfolgernd führen Kindheitstraumatisierungen häufig zu Entwicklungsverzögerungen und fehlenden positiven Bindungserfahrungen (vgl. Gahleitner; Loch & Schulze 2014, S. 8).
1.6 Trauma und Bindung
Die Mitte des 20. Jahrhunderts von John Bowlby und Mary Ainsworth begründete Bindungstheorie erklärt das menschliche Grundbedürfnis nach emotionaler Nähe und Verbundenheit und liefert für das Verständnis psychischer Traumatisierungen eine weitere bedeutsame Grundlage. Das Bindungs- und Fürsorgesystem ist evolutionsbedingt ein tief verankertes Handlungskonzept des Menschen und sichert in Form eines verinnerlichten Musters das Überleben des Menschen. Mutter und Vater prägen die ersten Bindungserfahrungen und sind als Hauptressource eines jeden Kindes anzusehen. Ihnen obliegt die verantwortungsvolle Aufgabe ein familiäres Klima zu schaffen, in welchem das Kind einen geschützten und entwicklungsfördernden Rahmen erfährt. Die Familie gilt als primäre Erziehungsinstanz.
Der Mensch ist ein hochgradig soziales Wesen und von Geburt an auf versorgende, liebevolle und unterstützende Bezugspersonen angewiesen. Erkenntnisse über Hospitalismus und Deprivation belegen, dass Kleinkinder ohne ausreichende emotionale Zuwendung durch eine Bezugsperson verkümmern und im schlimmsten Fall den Tod erleiden. Der Mensch ist nach seiner Geburt auf keine bestimmte Lebensform festgelegt. Er benötigt zum Aneignen der menschlichen Lebensweise eine langjährige Unterstützung und Lernhilfe durch seine Bezugsperson(en). Somit kann er nur durch soziale Interaktion zu einem Mensch im humanen Sinne werden. Innerhalb der ersten Lebensjahre wird über das Ausmaß seiner späteren Erziehbarkeit und Lernfähigkeit weitgehend vorentschieden. Frühe kindliche Entwicklungsversäumnisse können später nur schwer kompensiert werden. Daher wird einer dauerhaften, stabilen, verlässlichen und emotionalen Bindung, gerade zu Beginn eines noch jungen Lebens, eine besondere Wichtigkeit und Bedeutung beigemessen (vgl. Hobmair et al. 1996, S. 40ff.).
„Die wichtigsten Erfahrungen, die ein Kind im Lauf seiner Entwicklung macht und die den nachhaltigsten Einfluss auf die innere Organisation und Strukturierung seines Gehirns haben, sind Beziehungserfahrungen.“ (Hüther & Nitsch 2013, S. 27) Das Bindungsverhalten eines Kindes lässt sich als eine angeborene Tendenz verstehen, die Nähe zu einer Bezugsperson zu erhalten oder zu suchen und zeigt sich in Situationen der Unsicherheit und Angst besonders ausgeprägt. In ängstlichen Situationen wird das Kind Verhaltensweisen zeigen (Weinen, Anklammern, Nachlaufen), die ihm Nähe und Schutz durch seine Bezugsperson garantieren sollen. Bezugspersonen besitzen gegenüber dem kindlichen Bindungsverhalten ein komplementäres Fürsorgesystem, welches auf die Signale des Kindes antwortet und ihm Sicherheit, Trost und Beistand gewährt. Das Bindungsverhalten des Kindes und das Fürsorgesystem der Eltern bilden einheitlich das Bindungssystem (vgl. Butollo & Hagl 2003, S. 93).
Die Bindung zur Mutter ist die elementarste Bindungsform bei uns Menschen. Die Qualität der Bindung ist maßgebend, denn zwischenmenschliche Bindungsbeziehungen sind als hoch emotional zu bewerten. Kindern geht es nicht nur um die bloße körperliche Anwesenheit seiner Bindungsfigur, sondern dass diese auch mit ihren Gefühlen präsent ist, allen voran mit Liebe. Der Ausgangspunkt aller menschlichen Grundgefühle (Angst, Liebe, Wut, Trauer, Schuld, Scham) liegen in der Bindung. Demnach ist Bindung primär als ein beständiger Gefühlsaustausch zu charakterisieren (vgl. Ruppert 2010, S. 34). Die mütterliche Gefühlswelt liefert den ersten grundlegenden Stoff für die Identitätsentwicklung des Kindes (vgl. ebd., S. 45). Ruppert (2010, S. 46) beschreibt ein Kind in den ersten Lebensjahren deshalb als ein „Spiegel der Seele seiner Mutter“.
Für eine sichere Basis sind beide Elternteile zuständig. Die Ausbildung für eine ausgewogene und verbalisierungsfähige Bindungsdisposition im Erwachsenenalter wird vor allem vom väterlichen Part geleistet (vgl. Holmes 2008, S. VII). Während die Mutter-Kind-Bindung einen stärker versorgenden Charakter aufweist, gilt der Vater als zuverlässige Sicherheitsbasis und feinfühliger Begleiter, der das Kind in seinen Bestrebungen der Welterkundung ermutigt und unterstützt (vgl. Grossmann & Grossmann 2012, S. 231). Daraus ableitend ist das Vertrauen eines Kindes zu sich selbst und der Welt entscheidend davon abhängig, wie viel Vertrauen es zu den ersten Bindungspersonen, zu Mutter und Vater, aufbauen konnte. Diese ersten Bindungen formen das generelle Sicherheitsgefühl des Kindes und sind für seine seelische Stabilität zentral bedeutsam (vgl. Röhr 2010 a, S. 29).
„Wie immer die Beziehungen aussehen, die Kinder im Lauf ihrer Entwicklung zu anderen Menschen, aber auch zu anderen Lebewesen, eingehen, sie hinterlassen Spuren, die ihr späteres Verhalten bestimmen.“ (Hüther 2014, S. 102)
Im Verlauf der Bindungsforschung konnten vier unterschiedliche Bindungstypen im emotionalen Wechselspiel zwischen Kindern und deren Mütter ausfindig gemacht werden:
(1) Sichere Bindung: Sicher gebundene Kinder tragen ein gefestigtes Vertrauen in Bezug auf die Zuverlässigkeit ihrer Bezugsperson in sich. Kommt es zu einer vorübergehenden räumlichen Trennung zwischen Bezugsperson und Kind, verfällt das Kind keineswegs in Panik und erlebt seine Bezugsperson, trotz Abwesenheit, als verfügbar. Bei Rückkehr der Bezugsperson ist das Kind wieder entspannt, freundlich, kommunikativ und wendet sich vertrauensvoll an seine Bindungsperson. Die unliebsamen Gefühle des Kindes, die aufgrund der Trennungssituation entstanden, können durch liebevollen Trost der Bezugsperson leicht bewältigt werden.
(2) Unsicher-vermeidende Bindung: Der unsicher-vermeidende Bindungsstil führt dazu, dass Kinder bei Abwesenheit ihrer Bezugsperson keinerlei Reaktionen von Beunruhigung zeigen. Bei Rückkehr der Bezugsperson wird jegliche Nähe vermieden. Diese Kinder wurden in angstbesetzten und schutzbedürftigen Situationen von ihren Eltern häufig zurück- und abweisend behandelt. Aus diesen schmerzvollen Erfahrungen folgt die Konsequenz, dass sie ihre Verunsicherung und Angst nicht mehr signalisieren, obwohl sie innerlich unter extremen Stress stehen. Die Vermeidung von Nähe und das Verstecken der Gefühle soll das Risiko erneuter elterlicher Zurückweisungen und abwertender Reaktionen minimieren. Um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, drückt sich das Kind im verbalen Kontakt zur Bezugsperson kurz und höflich aus und verhält sich distanziert.
(3) Unsicher-ambivalente Bindung: Kinder die unsicher-ambivalent gebunden sind, erleben ihre Bezugsperson als nicht berechenbar. Sie können das Verhalten ihrer Bezugsperson in verschiedenen Situationen nicht abschätzen und antizipieren. Daraus folgt, dass diese Kinder in neuartigen und fremden Situationen sehr nervös sind. Sie stellen bereits vor der räumlichen Trennung Nähe zur Bezugsperson her, weil sie keine Zuversicht in die Verfügbarkeit ihrer Mutter entwickelt haben, dass diese wirklich wieder zurückkommt. Einerseits suchen unsicher-ambivalent gebundene Kinder die Nähe zu ihrer Bezugsperson, andererseits sind sie aber auch zeitgleich wütend über sie. Ihr Verhalten ist widersprüchlich und Ausdruck eines Annährungs-Vermeidungs-Verhalten.
(4) Desorganisierte Bindung: Der desorganisierte Bindungsstil lässt sich mit einem Zusammenbruch der Bindung vergleichen. Diese Kinder weisen ein widersprüchliches und verwirrendes Bindungsverhalten auf. Sie treten in ihrem Nähe- und Distanzverhalten äußerst zerrissen auf, zeigen unkontrollierte Wutausbrüche und erstarren in ihren Bewegungen. Das desorganisierte Bindungsmuster geht oft mit unverarbeiteten traumatischen Vorerfahrungen der Mutter einher. Das Kind gerät in einen unlösbaren Annährungs-Vermeidungs-Konflikt, da es bei seiner Bezugsperson Schutz suchen will und sich synchron dazu vor ihr schützen muss. Aus diesem Bindungsstil ergeben sich im späteren Verlauf häufig schwere Bindungsstörungen und dissoziative Störungen. In der Fachwelt wird ein Zusammenhang zwischen desorganisierter Bindung und ADHS diskutiert. (vgl. Biberacher 2013 a, S. 96ff.)
Langjährige innerfamiliäre Traumata wie Vernachlässigung oder jegliche Formen von Misshandlung und Gewalt durch eine nahstehende Bezugsperson, führen in der Regel zum Bruch des Bindungssystems, und, sollten keine kompensierenden Bindungsangebote zur Verfügung stehen, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem desorganisierten Bindungsmuster, aus denen heraus sich weitere psychopathologische Störungen entwickeln können.
„Traumatische Erlebnisse in der Kindheit […] sind immer eingewoben in einen Beziehungskontext und sind letztendlich der Zusammenbruch einer Beziehungsrelation, deren basales Versprechen phasengerechte Förderung und liebevolle Unterstützung war.“ (Peichl 2007, S. 52)
80 Prozent der körperlich und sexuell misshandelten Kinder haben ein desorganisiertes Bindungsmuster verinnerlicht (vgl. Huber 2009, S. 95). Der Bindungsforscher Karl Heinz Brisch (2013, S. 156) untermauert, dass die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen in Heimen „desorganisierte Verhaltensweisen in bindungsrelevanten Situationen“ zeigen. Fortfahrend gilt ein desorganisiertes Bindungsverhalten als ursächlicher Risikofaktor für die spätere Ausgestaltung der PTBS, der Borderline-Störung sowie der dissozialen Persönlichkeitsstörung (vgl. Peichl 2007, S. 43). Brisch nennt klassische Bindungsstörungen von Kindern und Jugendlichen mit denen sich Fachkräfte im pädagogischen Alltag überwiegend konfrontiert sehen:
(1) Kein Bindungsverhalten: Das Kind wendet sich auch in extremen Bedrohungssituationen an keine Bezugsperson.
(2) Undifferenziertes Bindungsverhalten: Das Kind zeigt soziale Promiskuität und stellt in Stresssituationen wahllos zu jedem, auch zu fremden Personen, Nähe und Körperkontakt her.
(3) Erhöhtes Unfallrisikoverhalten: Das Kind setzt sich absichtlich Gefahrensituationen aus, weil es die Erfahrungen gemacht hat, dass sich nur dadurch das Fürsorgeverhalten seiner Bindungsperson aktivieren lässt.
(4) Übermäßiges Klammern: Das Kind ist übertrieben ängstlich und auf die absolute Nähe seiner Bezugsperson angewiesen. Sein exploratives Verhalten ist eingeschränkt, da es an die Anwesenheit seiner Bezugsperson gekoppelt ist. Auf Trennung folgt massiver Widerstand des Kindes.
(5) Hemmungen im Beisein der Bindungsperson: Das Kind erstarrt in der Nähe seiner vertrauten Bezugsperson und wird erst wieder aktiv, wenn sie sich entfernt hat. Diese Reaktion tritt gehäuft bei Kindern nach körperlichen Misshandlungen und Gewaltanwendungen auf.
(6) Aggressive Interaktionsform: Das Kind versucht über provokative und aggressive Interaktionsformen (verbal und körperlich) Bindungskontakt herzustellen. Beim Gegenüber stößt es damit in der Regel auf Zurückweisung. Die zugrunde liegenden verdeckten Bindungswünsche und -bedürfnisse des Kindes werden nicht gesehen und bleiben somit unbeantwortet.
(7) Rollenumkehr: Diese Kinder sehen ihre Eltern nicht als sichere Basis an. Sie geben ihre eigenen Bindungs- und Schutzbedürfnisse auf und tragen Sorge und fürsorgliche Verantwortung für ihre Eltern. Diese Bindungsstörungen treten oft bei Kindern mit psychisch kranken Elternteilen auf. Die Rollen sind vertauscht.
(8) Psychosomatische Reaktionen: Diese Kinder neigen auf eine verwirrende und verunsichernde Bindungsgestaltung mit körperlichen Symptomen zu reagieren. (vgl. Brisch 2013, S. 160ff.)
(9) Sexualisieren sozialer Beziehungen: Sexuell missbrauchten Kindern wurde das Gefühl vermittelt, dass sie ausschließlich zum Sex zu gebrauchen sind. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie Aufmerksamkeit nur in sexueller Form erhalten. Diese Kinder versuchen daher Zuwendungen und Bindungskontakt über sexualisiertes Verhalten herzustellen (vgl. Bass & Davis 1995, S. 241).
Für die pädagogische Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen ist die Tatsache bedeutsam, dass das Bindungssystem während des ganzen Lebens offen und empfänglich für neue und somit für korrigierende Bindungserfahrungen bleibt (vgl. Brisch 2013, S. 154).
1.7 Die strukturelle Dissoziationstheorie
Der französische Psychotherapeut Pierre Janet prägte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Begriff der Dissoziation. Er beschrieb damit abgespaltene Gedankensysteme innerhalb der Persönlichkeit eines Menschen. Janet untersuchte echte multiple Persönlichkeiten, war aber gleichzeitig davon überzeugt, dass diese Persönlichkeitsmuster auch bei nicht multiplen Persönlichkeiten im Unbewussten existieren (vgl. Watkins & Watkins 2008, S. 45). Unter Dissoziation versteht man den „teilweise[n] oder völlige[n] Verlust der integrativen Funktionen von Bewusstsein, Gedächtnis, personeller Identität und der Selbst- und Umweltwahrnehmung“ (Peichl 2011 a, S. 78).
Neben Janet beschrieb Paul Federn, ein Schüler Sigmund Freuds, abweichend von der Meinung seines Mentors, dass das Ich kein theoretisches Konstrukt darstellt, sondern ein real erfahrbarer Gefühlszustand sei. Er stellte durch Beobachtungen fest, dass die Erfahrung des Selbstgefühls eines Menschen variieren kann, abhängig vom jeweils aktivierten Ich-Zustand. So erlebt sich ein Mensch in verschiedenen Situationen unterschiedlich. Federn ging davon aus, dass das Ich aus „Sub-Persönlichkeiten“ besteht, die durch ein Identitätsgefühl zusammengehalten werden. Nach modernerer Auffassung ist das freudsche Instanzenmodell des Es, Ich und Über-Ichs, welches das eine starre Ich voraussetzt, überholt und dem Ansatz eines multidimensionalen Selbst in Form von inneren Anteilen oder vielfältigen Ich-Zuständen (Ego-States) gewichen (vgl. ebd., S. 43). Auch der Hirnforscher Gerhard Roth schreibt dem Selbst keine eigenständige Wesenseinheit zu. Er beschreibt das Selbst als eine nacheinander erlebte Abfolge von Bewusstseinszuständen, die zu einer Scheininstanz integriert werden (vgl. ebd., S. 37).
Der Ansatz eines multidimensionalen Selbst sollte jedoch nicht fehlinterpretiert werden und dazu führen, dass Menschen nicht in der Lage seien, sich als ganzheitliche Person mit einmaliger Persönlichkeit zu erleben. Die Selbstidentität lässt sich vielmehr durch die Summe aller inneren Anteile begreifen (vgl. Peichl 2011 b, S. 28). Innere Anteile, Ich-Zustände oder Ego-States, wie auch immer wir sie nennen mögen, sind ebenfalls konzeptionell zu verstehen und bilden ein einfaches Konstrukt sowie Erklärungsmodell, um innere (An-)Teile benennen zu können und therapeutisch mit ihnen zu arbeiten. Für eine systemische Teilearbeit muss die Klientel also nicht zwangsläufig multipel oder schizophren sein (vgl. Reddemann 2011, S. 165). Ego-States sind somit „unterscheidbare, zeitüberdauernde Persönlichkeitsanteile oder Selbst-Zustände innerhalb des Selbstsystems“ (Peichl 2007, S. 104) und werden jeweils als ein „organisiertes Verhaltens- und Erfahrungssystem“ (Watkins & Watkins 2008, S. 45) verstanden.
Gemäß den obigen Ausführungen postuliert das Konzept der strukturellen Dissoziation, „dass sich die Vielfalt des Selbst strukturell in Form verschiedener Anteile in der Persönlichkeit (re)organisieren kann“ (Kissenbeck 2012, S. 264). Die strukturelle Dissoziation ist als eine spezielle Abwehrfunktion vor schweren traumatischen Erlebnissen zu deuten. Frühe Kindheitstraumatisierungen neigen zur chronischen Dissoziation. Betroffene Kinder bilden das Dissoziieren von Persönlichkeitsanteilen zu einer „Überlebensstrategie“ aus (vgl. Boon; Steele & van der Hart 2013, S. 36).
Breitenbach & Requardt (2014, S. 19) vertreten die These, dass pathologische Dissoziation und Trauma unweigerlich zusammengehören und insofern ein Geschehen darstellt, welches sich ausschließlich auf traumatisierende Erfahrungen beschränkt und als Überlebensleistung und Bewältigungsmechanismus angesehen werden kann.
„Aus psychologischer und neurobiologischer Sicht ist die Dissoziation ein Selbstschutz der Seele vor unerträglichem seelischem oder körperlichem Schmerz.“ (Bauer 2010 a, S. 167)
Nach dem Verständnis der strukturellen Dissoziation wird unterschieden in emotionale Persönlichkeitsanteile (EPs) und in anscheinend normale Persönlichkeitsanteile (ANPs). Weiterführend bringt die Theorie die Abspaltung und das Wiedererleben des Traumas mit emotionalen Systemen in Verbindung. Diese Systeme werden Aktionssysteme genannt. Sie regeln in einem breiten Spektrum von unterschiedlichen Lebenssituationen die mentalen und verhaltensmäßigen Aktionen und Reaktionen des Menschen. Die Aktionssysteme lassen sich erneut untergliedern in ein Verteidigungssystem und ein Alltagssystem. Das Verteidigungssystem ist defensiver Natur und für das Überleben des Individuum bei Gefahr und Bedrohung zuständig. Das Alltagssystem dient der Organisation des täglichen Lebens und gewährleistet das Überleben der Art oder Spezies. Strukturelle Dissoziation führt zur Aufteilung dieser inneren Systeme (vgl. Fritzsche & Hartman 2010, S. 56).
EPs sind Vertreter des Verteidigungssystems. Sie sind Träger des traumatischen Materials und ganz auf das Trauma fixiert. In ihnen befinden sich die Erinnerungen und unliebsamen Gefühle des Traumas. Sie agieren stets so, als würde die traumatisierende Situation gegenwärtig präsent sein (vgl. ebd., S. 56f.). EPs, die in der Kindheit entstanden, werden häufig mit den Synonymen „Kind-Zustände“ oder „Innere Kinder“ beschrieben (vgl. Chopich & Paul 2011, S. 20f.).
„Das traumatisierte Innere Kind wäre somit eine Kopie, ein Replikat der traumatischen Szene, eingefroren im Moment der Entstehung, ein Erlebens-Zustand, eine Verdichtung des persönlichen Gedächtnisses.“ (Peichl 2011 b, S. 101)
Diese hoch emotionalen Ego-States sind Teil des autobiografischen Gedächtnisses und zeitlich verortet. So besitzt jeder Ego-State seine eigene Entstehungsgeschichte, einen eigenen Charakter, ein eigenes Alter und eigene Bedürfnisse. Zusätzlich weist er eine eigene Wahrnehmung auf, zeigt eigene Affekte, verfügt über eigene Fähigkeiten, eigene Symptome und füllt eine eigene Funktion aus. Traumaassoziierte Ego-States entstehen um die Anpassungsfähigkeit auf eine Extrembelastung zu erhöhen und haben daher einen helfenden und problemlösenden Aspekt. Nach der Extrembelastung wird ein solcher Ego-State von Betroffenen oft als inadäquat und störend empfunden, jedoch bewahrt er seine Existenz, weil er in der Zeit seiner Entstehung erfolgreich war. Deshalb lassen sich Ego-States nicht einfach beseitigen oder eliminieren, besitzen aber die Fähigkeit zu lernen, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln (vgl. Fritzsche & Hartman 2010, 36f.).
Bestand zu Zeiten Pierre Janets noch die Vorstellung, dass sich die verschiedenen Persönlichkeitsaspekte mit ihren differenzierten Kognitions- und Gefühlsmustern ausschließlich durch Hypnose aktivieren lassen, so teilt man diese Vorstellung heute nicht mehr. Oft reicht es aus, Klienten anzuregen und einzuladen, sich eine frühere Version ihrer Selbst vorzustellen und anschließend mit ihr in Kontakt zu gehen (vgl. Reddemann 2011, S. 165f.).
Der ANP repräsentiert das Alltagssystem und sorgt dafür, dass Menschen trotz traumatischer Erschütterung handlungsfähig bleiben und ihre alltäglichen Lebensanforderungen meistern können. Deswegen hat es sich der ANP zur Aufgabe gemacht, durch phobische Vermeidung und mittels negativer dissoziativer Symptome (z.B. Amnesie, Depersonalisation, emotionale Betäubung) jegliche Assoziationen des erlebten Traumas in den Alltag zu unterbinden. Er sieht seine Alltagsstabilität durch die EPs in Gefahr und würde daher nie das traumatische Material der EPs integrieren wollen (vgl. Fritzsche & Hartman 2010, S. 57). Da der ANP nicht gewillt ist das Trauma in die Lebensrealität zu integrieren, bezeichnen ihn Fritzsche & Hartman (2010, S. 57) auch als einen „deutlich eingeschränkte[n], anscheinend funktionale[n] Aufgabenerfüller“. Peichl (2011 a, S. 126) sieht den ANP als „Fassade“ oder „Gastgeberpersönlichkeit“ an.
Demgegenüber möchten die EPs in ihrer Alarmfunktion ernsthaft wahrgenommen und gerettet werden. Da EPs in der Zeit ihrer Entstehung erstarrt und eingefroren sind, können sie sich nicht vorstellen, dass die Zeit vorangeschritten ist und möglicherweise eine Realität ohne Bedrohung existiert. EPs sehen sich folglich außerstande die Welt des ANP nach dem Trauma zu akzeptieren und zu integrieren (vgl. Fritzsche & Hartman 2010, S. 57). Festellend scheinen traumatisierte Menschen in zwei verschiedenen Welten existent zu sein. Einerseits innerhalb der Alltagsrealität (ANP), in der sie um Anpassung und Funktionalität ringen, und andererseits innerhalb einer hochgradig emotionalen und unkontrollierbaren Traumawelt, eingespeist durch ein oder mehrere Ego-State(s), die die traumatischen Erinnerungen zeitlos festhalten (EP) (vgl. Peichl 2011 a, S. 129f.).
„Traumatische Erfahrungen werden als Fremdkörper in die Psyche implantiert, die als mentale Zustände auftauchen, jedoch abgespalten von der übrigen Persönlichkeit wie Abteilungen existieren können.“ (Streeck-Fischer 2006, S. 132)
Je nach Schweregrad der inneren Aufspaltung wird zwischen primärer, sekundärer und tertiärer struktureller Dissoziation unterschieden. Die primäre strukturelle Dissoziation (1 ANP und 1 EP) ist nach Struktur und Ausmaß mit der einfachen PTBS vergleichbar. Die sekundäre strukturelle Dissoziation (1 ANP und mehrere EPs) tritt meist durch die Erfahrung wiederholter Traumata auf und orientiert sich an den Diagnosen der komplexen PTBS sowie der Borderline-Störung. Hier spricht man von teilabgespaltenen Selbstanteilen, die sich im Außen durch unterschiedliche Persönlichkeitszustände bemerkbar zeigen oder durch eine affektive Impulsivität gekennzeichnet sind. Spricht man hingegen von tertiärer struktureller Dissoziation (mehrere ANPs und mehrere EPs), so handelt es sich um das klinische Krankheitsbild der dissoziativen Identitätsstörung (früher: multiple Persönlichkeit) mit vollabgespaltenen Selbstanteilen (vgl. Peichl 2011 a, S. 129).
Abb. 1: Ebenen der strukturellen Dissoziation (Huber 2011, S. 54)
Die strukturelle Dissoziation ist im Bereich der Psychotraumatologie des Kindes- und Jugendalters noch verhältnismäßig wenig erforscht. Dissoziative Phänomene im Kindesalter sind einer Reihe von kindlichen Entwicklungsprozessen und Entwicklungsübergängen ausgesetzt. Das bedeutet, dass die emotionalen Persönlichkeitsanteile (EP) und die anscheinend normalen Persönlichkeitsanteile (ANP) ebenfalls einer Entwicklung unterliegen und in ihrer Ausgestaltung flexibel sind (vgl. Kissenbeck & Eckers 2011, S. 164f.). Deswegen unterscheidet sich die kindliche strukturelle Dissoziation in einigen Merkmalen, die im weiteren Verlauf im Jugend- und Erwachsenenalter abnehmen. Auch hier gilt erneut: Je jünger das Kind, desto höher seine Neuroplastizität. Daraus folgt, dass die Wahrscheinlichkeit einer spontanen Integration der inneren Zustände bei förderlichen Umfeld und stabilisierenden Bedingungen höher ist. Außerdem sind die Übergänge zwischen den einzelnen inneren Anteilen meist noch nicht so stark ausdifferenziert, sondern fließend und durchlässig. Das bedeutet, dass die Wechsel (Switches) zwischen den inneren Anteilen kaum wahrnehmbar sind, während sie bei Jugendlichen bereits deutlicher erkennbar werden (vgl. Kissenbeck 2012, S. 266).
[...]
- Arbeit zitieren
- Christoph Bärwald (Autor:in), 2016, Traumapädagogik in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387767
Kostenlos Autor werden








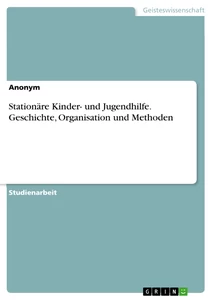



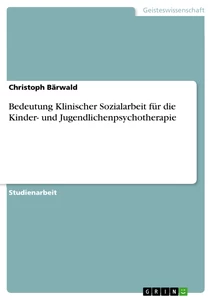







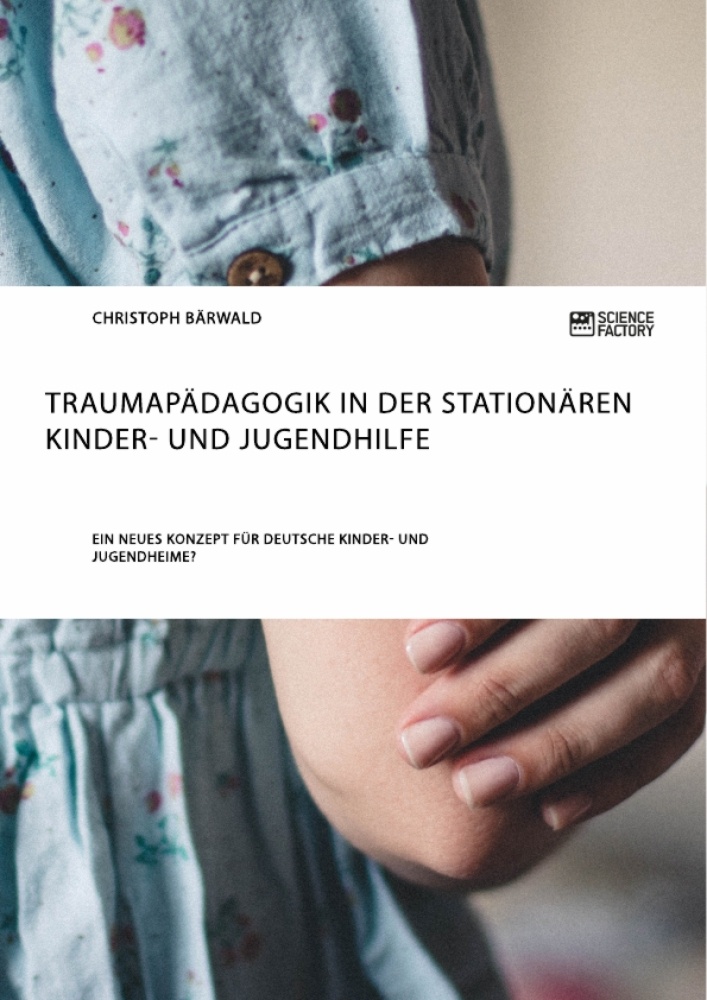

Kommentare