Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Zusammenfassung
Abstract
1 Einleitung
2 Patientenuniversität
2.1 Ziele der Patientenuniversität
2.1.1 Begriff der Gesundheitskompetenz
2.2 Zielgruppen der Patientenuniversität
2.3 Didaktisches Konzept der Patientenuniversität
2.4 Tutorenkonzept
3 Arzt-Patient-Interaktion
3.1 Modelle der Arzt-Patient-Beziehung
3.2 Partizipative Entscheidungsfindung
3.3 Grundhaltung einer patientenorientierten Arzt-Patient Kommunikation
3.4 Patienten- und arztzentrierte Gesprächsführung
4 Modellstudiengang HannibaL an der MHH
4.1 Ärztliche Kommunikation und Gesprächsführung
4.2 Wahlkurs „Patientenuniversität - Medizin erklären - medizinische Zusammenhänge patientengerecht vermitteln“
5 Zielsetzung der Arbeit und Forschungsfrage
6 Methodische Vorgehensweise
6.1 Datenerhebungsmethode - Leitfadeninterviews
6.2 Entwicklung und Aufbau des Leitfadens
6.3 Durchführung eines Pretests
6.4 Rekrutierung und Auswahl der Stichprobe
6.5 Beschreibung der Untersuchungsgruppe
6.6 Datenerhebung und -aufbereitung
6.7 Datenauswertung
7 Ergebnisse
7.1 Erfahrungen derTutoren aus der Patientenuniversität
7.2 Lerneffekte der Tutoren aus der Patientenuniversität
7.3 Empfehlungen zur Optimierung des Tutorenkonzeptes
7.4 Auswirkungen der Erfahrungen auf das aktuelle Kommunikationsverhalten
8 Diskussion
8.1 Methodenkritik
8.2 Ergebnisdiskussion
9 Fazitund Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Über die Schriftreihe
Die Schriftenreihe der Patientenuniversität an der Medizinischen Hochschule Hannover wird herausgegeben von Prof. Dr. rer. biol. hum. Marie-Luise Dierks und Dr. rer. biol. hum. Gabriele Seidel vom Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).
Ziel der Schriftenreihe ist es, Forschungsergebnisse zur Patientenorientierung und Gesundheitskompetenz einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. In der Schriftenreihe werden Doktorarbeiten, Master- und Bachelorarbeiten sowie Forschungsberichte veröffentlicht.
Über die Autorin
Eva-Magdalena Thalmeier, geboren 1989 in Freising, staatlich anerkannte Ergo- therapeutin, studierte Public Health an der MHH und arbeitete als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung.
Über das Buch
Die vorliegende Arbeit ist eine Version der Version der Magisterarbeit zum Master of Public Health (MPH) von Eva-Magdalena Thalmeier, verfasst im Studienschwerpunkt Patientenorientierung und Gesundheitsbildung, eingereicht bei Prof. Dr. rer. biol. hum. Marie-Luise Dierks (1. Gutachterin) und Prof. Dr. phil. Ulla Walter (2. Gutachter) am 03.08.2017 im Ergänzungsstudiengang Bevölkerungsmedizin und Gesundheitswesen (Public Health) an der MHH. Die Masterarbeit wurde im Jahr 2017 vom Prüfungsausschuss des Magisterstudiengangs Bevölkerungsmedizin und Gesundheitswesen (Public Health) der Medizinischen Hochschule Hannover angenommen.
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Ziele und Zielgruppen und Kursinhalte der Patientenuniversität (Dierks, Seidel, 2009a)
Tabelle 3: Merkmale der untersuchten Stichprobe
Tabelle 4: inhaltsanalytisches Ablaufmodell in Anlehnung an Schreier (2012)
Tabelle 5: Kodierleitfaden für den ersten Durchlauf der Auswertung
Tabelle 6: Kodierleitfaden für den zweiten Durchlauf der Auswertung
Tabelle 7: Überblick über fachliche und persönliche Lerneffekte
Tabelle 8: Soll-Ist-Vergleich zwischen Zielen des Tutorenkonzeptes und den Lerneffekten
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hintergrund
Die nun seit 10 Jahren etablierte Patientenuniversität, ein unabhängiges Bildungsangebot, hat das Ziel, die Gesundheitskompetenz der Menschen in der Region zu erhöhen. Hierfür wird eine innovative Lernarchitektur eingesetzt: Fachvorträge werden ergänzt durch ein interaktives Vertiefungsangebot „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“. Studierende der Humanmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover, die als Tutoren an den Lernstationen agieren, lernen dabei ihr medizinisches Wissen an die Teilnehmenden laiengerecht zu vermitteln. In der vorliegenden Arbeit werden die Erfahrungen und Verhaltensweisen ehemaliger Tutoren erfasst, um herauszufinden, ob die gemachten Erfahrungen einen Mehrwert und gegebenenfalls auch einen Einfluss auf ihr aktuelles Kommunikationsverhalten haben.
Material und Methoden
Im Rahmen eines qualitativen Forschungsdesigns wurden teilstrukturierte Leitfadeninterviews mit ehemaligen Tutoren der Patientenuniversität durchgeführt (N=9). Die Interviews wurden mit Hilfe der Software MAXQDA, auf Basis der qualitativen, zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Schreier (2012) ausgewertet.
Ergebnisse und Diskussion
Innerhalb der Patientenuniversität können die angehenden Mediziner etliche Handlungskompetenzen, wie die Verwendung einer laienverständlichen Sprache, erwerben. Die Tutoren erfahren ein praktisches Kommunikationstraining, dass sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, wodurch sich ein gesteigerter Lerneffekt einstellt und sich Auswirkungen auf das aktuelle Kommunikationsverhalten zeigen. Gesundheitsbildungseinrichtungen wie die Patientenuniversität können einen wertvollen Beitrag dazu leisten, die kommunikativen Kompetenzen der angehenden Mediziner realistischer zu schulen. Deshalb sollte zukünftig der Ausbau weiterer Gesundheitsbildungseinrichtungen fokussiert werden. Schlüsselwörter
Gesundheitskompetenz · Patientenorientierung · Arzt-Patient-Kommunikation · Gesundheitsbildung
Abstract
Background
Since its foundation ten years ago, the Patient University, an independent health education service, had the goal to increase the health literacy among people living in the area. Working with citizens called for an innovative learning concept: professional lectures complemented by interactive “learning stations” with medical students of the Medical School Hannover serving as tutors. In addition to educate patients, the goal for the tutors was to learn how to teach their medical knowledge to participants appropriately. The objective of this survey is to determine, if the experiences of alumni tutors while working for the Patient University had a benefit as well as an impact on their current communication skills with patients.
Materials und methods
In the context of qualitative research design, semi-structured guided interviews were carried out with alumni tutors of the Patient University (N=9). The interviews were analyzed with the software MAXQDA, on the basic of a qualitative summary content analysis by Schreier (2012).
Results and conclusion
Students who serve as tutors have the chance to acquire several skills and abilities while being part of the Patient University. Skills which can be very important for their future medical profession, most importantly communicating appropriately with patients and their relatives. The tutors received a hands-on communication training and due to its design as a long-time project, the training increased its learning effect on the student-tutors as well as an impact on the students’ current communication behavior and skills. Institutions for health service education such as the Patient University, can contribute to teaching prospective physicians the ability to communicate and emotional skills to work with patients in a more realistic environment. Therefore, the focus should be on the development of more institutions for health service education in the future.
Keywords
Health literacy · Patient orientation · Physician-patient-communications · Patient education
1 Einleitung
,,Das Wort verwundet leichter, als es heilt.“
(Goethe)
Obwohl längst bekannt ist, dass das Gespräch zwischen Arzt und Patient[1] der entscheidende Faktor für den Erfolg einer Behandlung sein kann, herrscht bei vielen Gesundheitsprofessionen der Grundsatz: „Nicht lang quatschen, lieber schnell machen!“ Rationalisierungen stehen im Vordergrund, die Behandlungsdauer jedoch im Hintergrund.
Wie wichtig die sprechende Medizin ist, konnten jedoch Schaeffer et al. (2016) jüngst in der ersten Studie zur Gesundheitskompetenz in Deutschland zeigen: Hausärzte sind nach wie vor die erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen, gefolgt von Fachärzten und Familienmitgliedern. Das persönliche Gespräch und die Ratschläge sind für die Befragten demnach von besonderer Bedeutung. So ist und bleibt das ärztliche Anamnesegespräch, zusammen mit der körperlichen Untersuchung, eines der wichtigsten diagnostischen Instrumente (Fritzsche et al., 2015), das weder durch „Dr. Google“ oder die High-Tech-Medizin ersetzt werden kann.
Obwohl das Spannungsfeld innerhalb der Arzt-Patienten-Beziehung empirisch nicht einfach zu messen ist, konnten Loh et al. (2007) und Farin et al. (2010) zeigen, dass ein patientenorientiertes Kommunikationsverhalten des Arztes mit günstigen Behandlungsergebnissen einhergeht. Auch Forscher der Universität Köln (Altin et al., 2016) konnten belegen, dass Patienten zufriedener sind, wenn der behandelnde Arzt Zusammenhänge verständlich erklärt, wichtige Punkte der Krankengeschichte kennt und genügend Zeit mit dem Patienten verbringt. Die Sicherstellung der Zufriedenheit des Patienten hat auch positive ökonomische Effekte (Ulin et al., 2015), da solche Patienten seltener andere Ärzte für eine Zweitmeinung aufsuchen. Eine gute Kommunikation ist ein Instrument, das für eine erfolgreiche Diagnosestellung, Therapietreue und Zufriedenheit der Patienten sorgen kann.
Dennoch werden die Kommunikationsfähigkeiten der angehenden Ärzte an den medizinischen Fakultäten bisher zu theoretisch und meist zu wenig klinisch integriert gelehrt, sodass eine verständliche Informationsvermittlung häufig nicht gewährleistet ist (Kiessling et al., 2010) und es zu Missverständnissen innerhalb der Arzt-Patient-Kommunikation kommt. Doch das soll sich ändern: Bund und Länder haben im März diesen Jahres den Masterplan Medizinstudium 2020 beschlossen, der die Studienzulassung reformieren, die Allgemeinmedizin stärken und die Praxisnähe vorantreiben möchte (Maibach-Nagel, 2017). Wie das praktisch funktionieren kann, machen einzelne Universitäten bereits schon seit Jahren vor.
Der an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) 2005 gegründete Modellstudiengang HannibaL lehrt bereits vermehrt praktische Fertigkeiten und eine patientenorientierte Kommunikation. Dabei führen die Medizinstudierenden zum Beispiel mit (Schauspiel)-Patienten Aufklärungs- und Anamnesegespräche unter „realen Bedingungen“ durch. Die ebenfalls an der MHH angesiedelte Patientenuniversität verfolgt seit dem Jahr 2007 einen neuen Ansatz, indem sie Studierende der Humanmedizin als Tutoren in der Gesundheitsbildung einsetzt.
Die nun seit 10 Jahren etablierte Patientenuniversität, ein unabhängiges Bildungsangebot, hat das Ziel, die Gesundheitskompetenz der Menschen in der Region zu erhöhen (Dierks et al., 2011). Hier wird eine innovative Lernarchitektur eingesetzt: Fachvorträge werden ergänzt durch das interaktive Vertiefungsangebot Lernen mit Kopf, Herz und Hand an ca. 12-15 Lernstationen pro Veranstaltungstermin. An den Lernstationen wirken Studierende der Humanmedizin als Tutoren mit. Die Studierenden erlernen durch die Teilnahme an der Patientenuniversität viele Fertigkeiten, wie zum Beispiel die Erprobung von unterschiedlichen Vermittlungstechniken, das Verständnis für individuelle Fragen und Probleme der Teilnehmenden, die Sicherheit im Umgang mit gesunden und kranken Menschen sowie den Umgang mit Nähe und Distanz. Darüber hinaus haben die Studierenden die Möglichkeit medizinische Gespräche mit den Teilnehmenden in einem geschützten Rahmen zu üben und medizinische Zusammenhänge in einer einfachen, anschaulichen Sprache zu erklären. Demzufolge richtet sich die Patientenuniversität nicht nur an interessierte Bürger, sondern ebenso an die Studierenden der Humanmedizin. Gegenstand der begleitenden Evaluationen zur Patientenuniversität waren bisher Teilnehmerbefragungen (Wrede, 2009, Weithe, 2011, Bedke, 2015). Die für das Konzept ebenso bedeutsame Zielgruppe der angehenden Humanmediziner wurde hingegen noch nicht befragt.
Die vorliegende Arbeit verfolgt daher das Ziel, die Erfahrungen, Einstellungen und Verhaltensweisen von ehemaligen Tutoren genauer zu erfassen. Dabei geht es darum herauszufinden, ob die gemachten Erfahrungen einen Mehrwert und gegebenenfalls auch einen Einfluss auf ihr aktuelles Kommunikationsverhalten haben. Die Erhebung findet in qualitativer Form statt, um die Thematik aus Sicht der ehemaligen Tutoren nachvollziehen zu können. Die Ergebnisse der Arbeit sollen die Einschätzung erleichtern, ob Initiativen zur Gesundheitsbildung einen Beitrag dazu leisten können, die kommunikativen und emotionalen Kompetenzen der angehenden Mediziner realistischer zu schulen.
Nach den Ausführungen zum theoretischen Hintergrund der vorliegenden Arbeit, in dem die Patientenuniversität (Kapitel 2), die Arzt-Patient-Interaktion (Kapitel 3) und der Modellstudiengang HannibaL (Kapitel 4) behandelt werden, folgt eine Ableitung der konkreten Fragestellungen in Kapitel 5. Die Methode des empirischen Teils wird im 6. Kapitel beschrieben, wofür qualitative leitfadengestützte Interviews mit insgesamt neun ehemaligen Tutoren der Patientenuniversität geführt und anschließend einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Schreier (2012) unterzogen wurden. Die Resultate der Auswertung werden in Kapitel 7 vorgestellt. Die Ergebnisse werden schließlich zusammengefasst, mit Aspekten des bisherigen Forschungsstandes in Beziehung gesetzt und diskutiert (Kapitel 8). Abschließend wird ein Fazit gezogen und innerhalb des Ausblicks der weitere Forschungsbedarf aufgezeigt (Kapitel 9).
2 Patientenuniversität
Die Patientenuniversität ist eine unabhängige Bildungseinrichtung, die seit dem Jahr 2007 an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) besteht. Sie ist dabei unabhängig und offen für „Jedermann“ und verfolgt das Ziel die Gesundheitskompetenz der Menschen in der Region zu erhöhen (Dierks et al., 2011).
Gegründet wurde die Patientenuniversität unter der Leitung von Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Schwarz und Prof. Dr. Marie-Luise Dierks. Die Anregung für dieses Bildungsangebot geht aus dem MiniMed-Schools Konzept hervor (Lindenthal, De Lisa, 2012). John Cohen gründete 1989 in Colorado die erste MiniMed-School, mit dem Ziel, das universitäre Wissen in laiengerechter Form der Bevölkerung zu vermitteln[2] (ebd.). Das überwiegend auf Vorträgen basierende MiniMed-Konzept wurde für die Patientenuniversität adaptiert und um ein neues didaktisches Mittel erweitert. Neben den ca. 45-minütigen Expertenvorträgen, haben die Teilnehmenden die Möglichkeit an sogenannten Lernstationen, die ein interaktives Vertiefungsangebot darstellen, Fragen zu stellen, Modelle zu betrachten oder mit Experten und anderen Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen (Dierks, Seidel, 2009a). In dieser Form ist die Patientenuniversität in Deutschland bisher einmalig. Dabei bietet die Patientenuniversität unterschiedliche Bildungsangebote an: Gesundheitsbildung für Jedermann, Große Künstler und ihre Erkrankungen und die mobile Patientenuniversität. Die vorliegende Arbeit bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Themenreihe Gesundheitsbildung für Jedermann (Dierks, Seidel, 2011).
Das unabhängige Bildungsinstitut wird durch Eigenmittel der MHH, Teilnehmerbeiträgen und Spenden finanziert (Dierks, Seidel, 2009a). Seit 2009 wird die Patientenuniversität durch einen Patientenvertreterbeirat und einen Teilnehmerbeirat unterstützt. Dieser Beirat (15 Personen), bestehend aus Teilnehmenden der Patientenuniversität, Vermittlern von Patientenberatung, Mitgliedern von
Selbsthilfegruppen und Mitarbeitern von Verbraucherzentralen, nimmt die Evaluationsergebnisse zur Kenntnis und ist an der Weiterentwicklung von Themen, Konzepten und Vermittlungsformen beteiligt (ebd.). In Zusammenarbeit mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung wurde das kumulierte Wissen aus der Patientenuniversität zusammengefasst und in drei Bücherbänden zur Bildungsreihe Gesundheitsbildung für Jedermann veröffentlicht (Homepage der Patienten Universität, Zugriff am 12.01.2017). Zudem erhielt die Initiative im Jahr 2009 den Oskar-Kuhn-Preis für eine gute Gesundheitskommunikation (Dierks et al., 2011).
Eine Befragung der Teilnehmer aus den Jahren 2007 bis 2011 (Responserate 42,7%) hat ergeben, dass diese „ihr Gesundheitswissen erhöhen konnten (95,7%), kritischer als zuvor mit Medikamenten umgehen (39,7%) und selbstbewusster bei Arztbesuchen auftreten (56,5%)“ (Seidel et al., 2016, S. 119). Die Teilnehmer konnten somit ihr Gesundheitswissen erhöhen und ihr Verhalten bei Arztbesuchen verändern. Auch die Gesundheitssystemkompetenz der Teilnehmer erhöhte sich: 78,9% der Befragten wissen eher, wo sie gute Gesundheitsinformationen finden und können sich besser vorstellen, wie verschiedene Behandlungseinrichtungen zusammenarbeiten (ebd.). An der begleitenden Evaluation wird jedoch auch deutlich, dass der Zugang zu Personen mit einem niedrigen Bildungstand noch geschaffen werden muss, denn knapp die Hälfte der Befragten, hatten eine hohe Schulbildung. Bei den Angaben der Befragten handelt es sich um Selbsteinschätzungen.
2.1 Ziele der Patientenuniversität
Die Patientenuniversität hat das übergeordnete Ziel der Gesundheitsbildung und des Empowerments[3]. Sie möchte demnach „auf der Basis strukturierter Bildungsangebote das universitäre Wissen und aktuelle Forschungsergebnisse aus den diversen Disziplinen der Medizin einschließlich der Versorgungsforschung nicht nur Expertenkreisen, sondern [auch] der Bevölkerung insgesamt in verständlicher Weise zur Verfügung zu stellen“ (Dierks, 2012, S. 95). Des Weiteren sollen Kenntnisse über das Gesundheitswesen, Patientenrechte oder Möglichkeiten der Vorbeugung von Erkrankungen verständlich gemacht werden. Grundlage für diese vielfältige Wissensvermittlung sind qualitativ hochwertige Gesundheitsinformationen von Experten aus unterschiedlichen Institutionen und Bereichen (Dierks et al. 2011). Daher gibt es auch etliche Kooperationen mit verschiedenen klinischen und theoretischen Institutionen der Hochschule, Selbsthilfegruppen, anderen Universitäten oder Versorgungs- und Beratungseinrichtungen (ebd.). Insgesamt haben in den Jahren 2007 bis 2011 über 300 Professionelle aus ca. 100 Kliniken, Instituten, Abteilungen und Schulen der MHH an den Veranstaltungen in der Reihe Gesundheitsbildung für Jedermann mitgewirkt, gelehrt und sind im Dialog mit den Teilnehmenden gestanden.
Grundsätzlich werden vier Bildungsziele innerhalb der Patientenuniversität verfolgt:
1. Erhöhung der Gesundheitskompetenz,
2. Stärkung der Bewältigungskompetenz,
3. Vermittlung der Systemkompetenz und
4. Erhöhung der Vermittlungskompetenz.
Besonders das erste Bildungsziel - Erhöhung von Gesundheitskompetenz - ist von großer Bedeutung, da der Begriff der Gesundheitskompetenz mittlerweile als eine der Schlüsseldeterminanten für eine stabile Gesundheitssicherung angesehen wird. Aktuell wird dem Beispiel anderer Länder gefolgt und ein nationaler Aktionsplan (NAP) zur Förderung der Gesundheitskompetenz erarbeitet, da die Förderung und Verbesserung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung ein breites, strukturiertes und aufeinander abgestimmtes Vorgehen verlangt (Schaeffer et al., 2016). Die Methode zur Umsetzung des Aktionsplans steht schon fest: Verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Lebens sollen in Sachen Patienteninformation und -beratung zusammenarbeiten, da die Verbesserung der Gesundheitskompetenz als gesamtgesellschaftliche Aufgaben angesehen wird. Der
Begriff der Gesundheitskompetenz wird daher im Nachfolgenden definiert und erste Ergebnisse von Studien vorgestellt.
2.1.1 Begriff der Gesundheitskompetenz
Es wird häufig vorausgesetzt, dass Bürger in der Lage sind, Entscheidungen für ihre oder die Gesundheit anderer zu fällen. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die Fähigkeiten, die man für ein kompetentes Handeln im Gesundheitssystem oder auf dem Gesundheitsmarkt benötigt, bereits vorhanden sind. Doch erste Ergebnisse aus der Forschung, die den Aspekt des kompetenten Handelns unter dem Begriff „Health Literacy“ bzw. „Gesundheitskompetenz“ untersucht, zeigen ein anderes Bild.
Definition Gesundheitskompetenz
Die vorhandenen Definitionen zu Gesundheitskompetenz (GK), international als „Health Literacy“ (HL) bezeichnet, sind bislang noch heterogen. Aus einer Public Health Perspektive ist jedoch ein „breites Verständnis von Gesundheitskompetenz erforderlich, das nicht nur die Gesundheitskompetenz Einzelner, sondern der Bevölkerung im Blick hat und die Befähigung (Empowerment) für gesundheitliche Entscheidungen umfasst“ (Jordan, Hoebel, 2015, S. 942). Dierks et al. (2012) definieren den Begriff der Gesundheitskompetenz wie folgt:
„Gesundheitskompetenz bezeichnet die kognitiven Fähigkeiten und sozialen Fertigkeiten eines Individuums, sich Zugang zu Informationen zu schaffen und nutzen können, das sie zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit beitragen. Gesundheitskompetenz schließt die Fähigkeit und das Vertrauen ein, Gesundheit im täglichen Leben zu managen, tragfähige gesundheitliche Entscheidungen zu treffen, Gesundheitsbelange zu kommunizieren und sich im Gesundheitssystem zu bewegen, dass es bestmöglich genutzt werden kann.“
Das bedeutet unter anderen, dass Bürger in der Lage sein müssen, Informationen zu finden und zu verstehen, über ein hinreichendes Verständnis von evidenzbasierter Medizin zu verfügen, etwas über Leitlinien zu wissen und sich gegenüber Professionellen im Gesundheitswesen entsprechend artikulieren zu können. Der Begriff umfasst daher eine Reihe an Kompetenzen und Fähigkeiten, die auf verschiedenen Ebenen von dem Individuum abverlangtwerden (ebd.).
Der HL Begriff hat sich in den letzten Jahren von einem rein über funktionale Fertigkeiten definierten Begriff hin zu einem umfassenden Konzept entwickelt. Die dabei entstandenen Modelle von beispielsweise Nutbeam (2000) oder Sorensen et al. (2011)[4] haben unterschiedliche Schwerpunkte und Theoriebildungen.
Das HL Konzept ist noch relativ jung, weshalb die Datenlage hierzulande bisher eher knapp ist und die Forschung zur Gesundheitskompetenz intensiviert werden sollte. Der Europäischen Health Literacy Survey (HLS-EU), an dem an 8 europäische Länder (Österreich, Bulgarien, Deutschland (nur NRW), Griechenland, Irland, Niederlande, Polen und Spanien) teilnahmen, lieferte erste repräsentative Daten für den Vergleich innerhalb Europas: Etwa jeder Zehnte EU-Bürger (12,4%) hat ein inadäquates Health Literacy-Niveau und mehr als jeder Dritte (35,2%) weist eine problematische Health Literacy auf (HLS-EU Consortium, 2012). Erste Ergebnisse für Deutschland erhoben unter anderem Jordan et al. (2012) und Schaefferet al. (2016), welche im Nachfolgenden zusammengefasst werden.
Ergebnisse erster Studien
In der vom Robert Koch-Institut durchgeführten telefonischen Befragung „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA) (2009), wurden etwa 25.000 Personen ab 18 Jahren, unter anderem zur ihrer Gesundheitskompetenz und ihrem souveränen Handeln im Gesundheitswesen befragt. Dabei kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der Erwachsenen nur eine ausreichende GK hat (Jordan et al., 2012). Es konnten vor allem signifikante Unterschiede bezüglich Bildung festgestellt werden. Bevölkerungsgruppen mit einer niedrigen GK sind häufig gekennzeichnet durch einen niedrigen Bildungsstand, einem niedrigen Einkommen und einem schlechteren körperlichen wie psychischen Gesundheitszustand. Daher gilt es insbesondere die GK von vulnerablen Bevölkerungsgruppen, wie älteren oder chronisch erkrankten Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und jüngeren Menschen mit niedrigem Bildungs- und Sozialstatus, zu stärken (Quenzel et al., 2016).
Die von Schaeffer et al. (2016) durchgeführte Studie (HLS-GER) zeigt ein ähnliches Bild. Von den 2000 Befragten verfügten 54,3% über eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz. Somit haben mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung Probleme im Umgang mit Gesundheitsinformationen. Auch hier konnten ebenfalls soziale Ungleichheiten zwischen Bevölkerungsgruppen aufgezeigt werden. Besonders Menschen mit niedrigem Sozialstatus (62%), mit höherem Lebensalter (66%) oder mit Migrationshintergrund (71%) verfügen über eine geringe Gesundheitskompetenz, was die Frage der gesundheitlichen Ungleichheit aufwirft. Des Weiteren finden 49,3% der Deutschen es schwierig zu beurteilen, wann sie eine zweite Meinung von einem Arzt einholen sollen. 44,5% haben Schwierigkeiten die Vor- und Nachteile von verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten zu beurteilen. Besonders in den Bereichen der Prävention und Gesundheitsförderung fallen den Befragten die gestellten Anforderungen schwer (ebd.). Eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz kann auch bedeuten, größere Orientierungsschwierigkeiten im Gesundheitssystem zu haben. Das heißt, Menschen mit einer geringen Gesundheitskompetenz schätzen ihren Gesundheitszustand schlechter ein, leiden häufiger unter chronischen Erkrankungen, wissen oft nicht, an wen sie sich mit einem gesundheitlichen Problem wenden sollen, nehmen häufiger Medikamente ein, gehen öfters ins Krankenhaus und nutzen häufiger den ärztlichen Notfalldienst. Somit wirkt sich eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz auch negativ auf wirtschaftlicher Ebene aus. Die Ergebnisse der HL-GER-Studie decken sich mit anderen internationalen Studien, wie zum Beispiel von Davis et al. (2006), Baker et al. (2007), oder Mitchell et al. (2012).
Die HLS-GER-Studie konnte außerdem zeigen, dass Hausärzte nach wie vor die wichtigste Anlaufstelle in Sachen Gesundheitsinformationen sind. Eine Forderung der Autoren ist daher auch unter den Gesundheitsberufen die Gesundheitskompetenz zu fördern (Schaeffer et al., 2016). Ärzte und Pflegende sollten in der Lage sein, Gesundheitsinformationen besser zu vermitteln und Nutzer darin zu unterstützen, mit ihnen umzugehen. Die Weiterentwicklung des Medizincurriculums ist daher eine wichtige Strategie, um die kommunikativen und didaktischen Kompetenzen der Ärzte zu stärken. Wie die Weiterentwicklung des Curriculums innerhalb des Modellstudienganges HannibaL an der MHH umgesetzt wird, zeigt Kapitel 4 (siehe Seite 28) auf.
2.2 Zielgruppen der Patientenuniversität
Die Patientenuniversität wendet sich an ein weites Spektrum von unterschiedlichen Zielgruppen: an Bürger, an Patienten und deren Angehörige, an Selbsthilfegruppenmitglieder und an Patientenvertreter (Dierks, Seidel, 2009a). Auch Professionelle aus dem Gesundheitswesen und angehende Mediziner hat das Gesundheitsbildungsmodell im Blick. Studierende der Humanmedizin der MHH lernen dabei ihr medizinisches Wissen an die Teilnehmenden laiengerecht zu vermitteln. Der Lerneffekt bei den studierenden Humanmedizinern findet primär auf der Ebene der Kommunikation und der Reflexion statt. Die Studierenden lernen mit Erkrankten und Gesunden zu kommunizieren und ihre eigene professionelle Haltung gegenüber den Patienten zu reflektieren (Dierks, 2012). Demzufolge will die Patientenuniversität also auch nach „innen“ etwas verändern.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über Ziele, Zielgruppen und Kursinhalte der Patientenuniversität. Für die vorliegende Arbeit ist die Zielgruppe der Humanmediziner von besonderer Bedeutung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Ziele und Zielgruppen und Kursinhalte der Patientenuniversität (Dierks, Seidel, 2009a)
2.3 Didaktisches Konzept der Patientenuniversität
Das didaktische Konzept der Patientenuniversität basiert auf der Vorstellung, dass Lernen auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet (Dierks, 2012). Die Ebenen beschreiben Lernen als funktionalen Wissenserwerb, als Selbstwahrnehmung und als Korrektur von Deutungsmustern und Wertmaßstäben (Siebert, 2006). Der Erwerb von Handlungskompetenzen ist sowohl für die Teilnehmenden, als auch für die Medizinstudierenden ein weiteres didaktisches Ziel. Dabei gilt die Teilnehmerorientierung als grundlegendes Prinzip, unabhängig davon auf welcher Ebene die Lernvermittlung gerade stattfindet. Eine vielfältige Wissensvermittlung soll über den Einsatz verschiedenster Medien (z.B. Plakate, Anschauungsmodelle, Experimente, Handouts) und einer Mischung verschiedener Lernformen (z.B. Diskussionen, Anschauen und Beobachten) sichergestellt werden. Auf diese Weise werden die verschiedenen Lerntypen angesprochen und das Prinzip Lernen mit Kopf, Herz und Hand eingehalten. Die Interaktion zwischen den Professionellen, den Tutoren und den Teilnehmenden sollen die aktive Verarbeitung der Lerngegenstände und die Einbindung der „Studierenden“ anregen. Somit sollen die Bereiche Verstehen, Kommunizieren, Handeln und Reflektieren innerhalb der Patientenuniversität abgedeckt werden (Seidel et al., 2016). Während des Lernprozesses sollte den Teilnehmenden jedoch ein großer Verhaltensspielraum gewährleistet werden, damit diese ihr Lerntempo selbst bestimmen können. Diese Form der Didaktik hat sich innerhalb der Erwachsenenbildung als eine bewährte Methode erwiesen (Luchte, 2001). Die offene Struktur der Lernstationen ermöglicht es den Teilnehmenden je nach eigener Schwerpunktsetzung so viel Zeit mit einem Thema zu verbringen, wie sie benötigen. Das Lernen auf den unterschiedlichen Ebenen findet dabei sowohl während der Vorträge, als auch während der Besuche der Lernstationen statt. Haben die Teilnehmenden an mindestens acht Abendveranstaltungen teilgenommen, erhalten sie ein Zertifikat, das als Anerkennung für ihre Teilnahme dienen soll (Dierks, Seidel, 2009b).
Die jährlich zweimal stattfindenden Themenreihen bestehen in der Regel aus ca. zehn Abendveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen, die nicht zwingend aufeinander aufbauen. Eine Veranstaltung dauert insgesamt ca. 2,5 Stunden und beginnt mit einem 45-minütigen Expertenvortrag, der durch eine anschließende Frage-Antwort-Runde abgerundet wird (Dierks et al., 2011). Die Besucher erhalten ein Skript von dem Vortrag zur Nachbereitung. Im Anschluss haben die Teilnehmenden an interaktiven Lernstationen die Möglichkeit die Vorlesungsinhalte zu vertiefen, denn die Lehr- und Lernforschung hat belegt, dass Wissen durch eigenes „Tun“ und vertiefende Angebote besonders gut integriert werden kann. An 15-20 Lernstationen präsentieren Wissenschaftler, Praktiker und Tutoren weiterführende Inhalte des jeweiligen Themas. Die Lernmaterialien an den Lernstationen sind vielfältig und können zum Beispiel ein Poster, Handouts, Kurzpräsentationen oder Experimente sein. Die Lernstationen selbst werden in Form von Tischen, Ständen oder Sitzgruppen gebildet. Sie laufen unter verschiedenen Überschriften und haben somit unterschiedliche Themenschwerpunkte (Dierks, 2012). Die Überschriften der Lernstationen sind für alle Veranstaltungen gleichbleibend, sodass sich die Teilnehmenden an den Überschriften der durchnummerierten Lernstationen orientieren können. An den Lernstationen liegen zusätzliche Informationsmaterialien wie Broschüren, Handouts, relevante Adressen und Literaturhinweise aus, die zur Nachbereitung und Vertiefung für das behandelte Thema dienen. An den Lernstationen werden den Teilnehmenden folgende Aspekte vermittelt:
- An der Lernstation Makroskopie und Mikroskopie lernen die Teilnehmenden den Aufbau von Organen und speziellen Zellen, anhand von Tierorganen und mikroskopischen Präparaten.
- An der Lernstation mit Modellen können die Teilnehmenden die Modelle selbst zusammenbauen, um sich ein praktisches Bild von der Lage der Organe zu machen.
- Ähnlich ist die Lernstation Experiment. Hier können die Besucher beispielsweise die Menge Blut, die das Herz pro Minute pumpt, abmessen.
- Bei der Lernstation Physiologie werden die Funktionen des Körpersystems und der Organe erklärt.
- An der Lernstation diagnostische Verfahren werden medizinische Geräte demonstriert und somit ein Blick „in den Körper“ ermöglicht.
- Die Lernstationen Therapieverfahren und Medikamente und ihre Wirkungen und Nebenwirkungen zeigen neueste Therapiemöglichkeiten und die Wirkungsweise von Arzneimitteln auf.
- An der Lernstation zur Prävention erhalten die Teilnehmenden Informationen, was sie für ihre Gesunderhaltung tun können und erlernen praktische Übungen zur Entspannung und Bewegung.
- Die Lernstation Empowerment/Patientenautonomie vermittelt praktische Tipps im Umgang mit Professionellen im Gesundheitswesen, gibt einen Einblick in die Rechte und Pflichten der Patienten und an welcher Stelle, qualitativ hochwertige Gesundheitsinformationen gefunden werden können.
- Die Lernstation Erste Hilfe vermittelt den Teilnehmenden schließlich Handlungskompetenzen für einen Notfall, dazu gehören Sofortmaßnahmen oder Rettungsketten (Dierks, 2012).
2.4 Tutorenkonzept
Die Tutoren an den Lernstationen sind überwiegend Studierende der Humanmedizin, aber auch Studierende des Studienganges Public-Health, angehende Diätassistenten, medizinisch technische Assistenten, Gesundheits- und Krankenpflegeschüler und Andere (Seidel et al., 2016). Bislang waren 93 Tutoren aus der Humanmedizin innerhalb der Patientenuniversität aktiv, manche von ihnen über mehrere Semester. Die Medizinstudierenden werden auf ihre Aufgabe gezielt vorbereitet und in der Durchführung supervidiert (Dierks, Seidel, 2009a). Im Rahmen eines mehrwöchigen Wahlkurses Patientenuniversität: Medizin erklären - medizinische Zusammenhänge patientengerecht vermitteln eignen sich die Studierenden theoretische Grundlagen der Kommunikation, der Informationsaufnahme und -Vermittlung, sowie Lerntheorien an (ebd.). Der Ablauf des Wahlkurses und seine Inhalte werden in Kapitel 4 (siehe Seite 32) nochmals näher beschrieben. Der Einsatz der Medizinstudierenden verfolgt drei unterschiedliche Ziele:
1. Ziel: Erhöhung der Vermittlungskompetenz
Die Studierenden lernen ihr Wissen an interessierte Personen in einfacher Sprache zu vermitteln. Dies fördert das Verständnis, dass die Information komplexer Sachverhalte Adressaten überfordern kann. Die Gesundheitsprofessionen sind angehalten, entsprechende Kompetenzen zu erwerben, indem sie für das Gegenüber angepasste Vermittlungsstrategien erarbeiten und sich Zeit für Informationen nehmen. Außerdem bietet die Tutorentätigkeit ihnen die Möglichkeit in einem „geschützten Rahmen“ ihr eigenes Kommunikationsverhalten nochmals zu üben und zu reflektieren, um so den Zugang auch zu gegebenenfalls schwierigen Gesprächspartnern zu finden.
2. Ziel: Dialog auf Augenhöhe
Im Dialog mit den Teilnehmenden, die den Tutoren nicht als Hilfesuchende, sondern als Lernende begegnen und einen Dialog auf Augenhöhe bietet, wird das Verständnis der Tutoren für die Anliegen potenzieller Patienten gefördert. Durch den Rollen- und Perspektivwechsel nehmen die Tutoren die Sicht der Laien ein und lernen Fragen zu beantworten, die einem anderen Denkmuster entspringen.
3. Ziel: Lernen durch Lehren
Durch ihre Lehrtätigkeit verfestigt sich bei den Studierenden der Humanmedizin das eigene Wissen. Durch die Vorbereitung auf die eigene Lernstation erlernen die Studierenden ihr bereits angeeignetes medizinisches Wissen im Kontext einer laiengerechten Wissensvermittlung wiederzugeben. Die reine Reproduktion des faktischen Wissens mit Fachtermini aus dem Studium wird also durch eine zusammenhängende Reproduktion in leicht verständlicher Sprache abgelöst.
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Patientenorientierung als Element der medizinischen Ausbildung wird innerhalb der Patientenuniversität gefördert, ebenso wie die Stärkung der erwähnten Vermittlungskompetenz (siehe Tabelle 1). Die Sensibilisierung von angehenden Medizinern für die Belange der Patienten trägt schließlich dazu bei, Themen wie die zunehmende „Kundenorientierung im Gesundheitswesen“ und die partnerschaftliche Kommunikation immer wieder zur Sprache zu bringen und zu reflektieren, denn die Beziehung zwischen Arzt und Patient ist elementar für den Verlauf einer Behandlung. Als eine wichtige Grundvoraussetzung für eine positiv geprägte Beziehung ist vor allem eine gelungene Kommunikation zwischen beiden „Partnern“. Daher wird innerhalb des nächsten Kapitels sowohl auf die Arzt-Patient-Beziehung, als auch auf verschiedene Kommunikationstechniken eingegangen.
3 Arzt-Patient-Interaktion
In den letzten Jahrzehnten hat sich ein Paradigmenwechsel von einem biomedizinischen zu einem biopsychosozialen Ansatz[5] vollzogen. Zunehmend hat sich bereits die Erkenntnis durchgesetzt, dass Gesundheit und Krankheit nicht nur biologische, sondern immer auch psychische, soziale und geistige Aspekte aufweisen und innerhalb der Behandlung berücksichtigt werden sollten. Somit hat auch innerhalb der Arzt-Patienten-Beziehung ein Paradigmenwechsel stattgefunden: Weg von einer paternalistischen und hin zu einer partizipativen Haltung (Hillebrand, 2008, Schmöller, 2008). Sowohl die Rolle des Patienten und des Arztes, als auch deren Kommunikationskultur unterliegen demnach einem Wandlungsprozess. Daher kann auch von einer allgemeinen Rollenverunsicherung gesprochen werden (Rockenbauch et al., 2009). Der Wandel bringt aufSeiten der Mediziner einen potentiellen Machtverlust mit sich, auf Seiten der Patienten eine gesteigerte Eigeninitiative. Die „neue“ Aufgabe der Ärzte ist es daher, Patienten in die Lage zu versetzen, eine informierte Entscheidung treffen zu können. Der Schlüssel dafür ist ein patientenorientiertes Gespräch auf Augenhöhe. Für die Patienten dahingegen ist die Steigerung der eigenen Gesundheitskompetenz bzw. der Gesundheitssystemkompetenz von Bedeutung. Viele Patienten informieren sich bereits vor dem Arztbesuch und möchten als „mündiger Patient“ an Behandlungsentscheidungen mit beteiligt werden, um informierte Entscheidungen treffen zu können (Braun, Marstedt, 2014). Doch wirkt sich das wachsende Informationsangebot und das gesteigerte Interesse der Bürger an Gesundheitsthemen nicht durchweg positiv auf das Arzt-Patienten-Verhältnis aus. Bei einer Befragung von 804 ambulant tätigen Ärzten, gaben mehr als die Hälfte (54%) an, dass diese Entwicklung teils positive und teils negative Aspekte mit sich bringt (Bittner, 2016). Die „kommunikative Wende“ erfordert daher neue Kompetenzen und Fähigkeiten auf beiden Seiten. Das asymmetrische Beziehungsmusterzwischen Arzt und Patient wird unter anderem von weiteren Faktoren, wie den rapi- den Weiterentwicklungen innerhalb der Medizin (neue technische Errungenschaften oder wissenschaftliche Erkenntnisse), oder der Zunahme chronischer Erkrankungen, die mit einer längeren Behandlungsdauer einhergehen, stark beeinflusst. Nach Fritzsche et al. (2015) beeinflussen jene und noch andere Faktoren die Asymmetrie in die jeweils gegensätzliche Richtung, was die ohnehin schon komplexe Beziehung zwischen Arzt und Patient vor weitere Herausforderungen stellt. Erschwerend geht der Wandel vom paternalistischen zum partizi- pativen Interaktionsstil auch noch mit etlichen Fragen, wie der Bereitstellung notweniger Rahmenbedingungen und Voraussetzungen einher (Schmacke et al., 2016).
Tatsache ist jedoch: „Im Kern ist und bleibt die Beziehung zwischen Arzt und Patient aufgrund eines grundlegenden Informations- und Kompetenzunterschiedes asymmetrisch“ (Fritzsche et al., 2015, S. 37). Um jedoch die Arzt-PatientenBeziehung besser nachvollziehen zu können, wird diese im nachfolgenden Kapitel wissenschaftlich eingeordnet.
3.1 Modelle der Arzt-Patient-Beziehung
Dem Paradigmenwechsel innerhalb der Arzt-Patient-Beziehung liegt ein „ganzes Geflecht gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Ursachen zugrunde, aus dem sich vielfältige Effekte, Wechsel- und Rückwirkungen ergeben“ (Baumgart, 2010, S. 6). Diese Vielfalt erschwert eine eindeutige Beschreibung und Deutung des Wandels. Womöglich werden deshalb in der Literatur idealtypische Konstruktionen in Form von verschiedenen Modellen beschrieben, die meist wenig mit der Realität zu tun haben, oder sich häufig miteinander vermischen. Die wissenschaftliche Einordnung der Arzt-Patienten-Beziehung kann jedoch zu einem besseren Verständnis des Wandels beitragen (ebd.).
Klemperer (2005a) beschreibt in seiner Systematik fünf Modelle und fasst Konzepte von Emanuel/Emanuel (1992) und Charles et al. (1997, 1999) zusammen. Elwyn et al. (1999)[6] haben das Spektrum der Arzt-Patient-Interaktion in einem Modell festgehalten und greifen dabei auf drei unterschiedliche Modelle zurück: erstens, das paternalistische Modell, zweitens, das Dienstleistungs- oder Konsumentenmodell und drittens, das partnerschaftliche Modell. Alle drei Modelle werden im Nachfolgenden kurz erläutert. Ein systematischer Überblick über die Modelle der Arzt-Patient-Beziehung (ergänzt nach Charles et al. 1999) und über die Vor- und Nachteile des jeweiligen Modells, befindet sich im Anhang[7].
Paternalistische Modell
Im paternalistischen Modell, dem traditionellen Beziehungsmusterzwischen Arzt und Patient, entscheidet der Arzt im wohlverstandenen Interesse des Patienten. Somit verhält sich der Patient passiv und dient lediglich als Informationsquelle für den Arzt (Fritzsche et al., 2015). Der Arzt hat die fachliche Autorität inne und leitet daraus den Anspruch ab, die Therapie im Wesentlichen zu bestimmen. Daher ist diese Beziehungskonstellation hierarchisch und extrem asymmetrisch und entspricht am ehesten dem altbekannten Bild des Arztes - dem „Halbgott in Weiß“ (ebd.). Das Modell beruht auf dem biomedizinischen Ansatz: Krankheiten können nur dann entstehen, wenn Funktionen des Körpers gestört sind, was anhand objektiver Kriterien (biochemisch oder physikalisch) bewiesen werden kann. Die subjektiv psychosozialen Kriterien, wie beispielsweise Stress, werden nicht berücksichtigt. Auch die Werte und Präferenzen des Patienten werden für die weiteren Behandlungsschritte nicht miteinbezogen. Das Bild der „Halbgötter in Weiß“ ist nicht nur veraltet, sondern auch rechtlich fraglich. Patienten haben durch das 2013 verabschiedete Patientenrechtegesetz ein Recht auf Mitbestimmung. In der bestehenden Literatur wird das Modell auch aufgrund der unzureichenden Beachtung der Patientenautonomie als nicht mehr zeitgemäß beschrieben, findet aber in der Akutmedizin durchaus seine Berechtigung (Faller, 2012).
Dienstleistungs- oder Konsumentenmodell
Beim Dienstleistungs- oder Konsumentenmodell ist der Arzt weiterhin Experte, doch liegt die Entscheidungskompetenz nun beim Patienten (Faller, 2012). Es knüpft an das Kundenmodell der freien Wirtschaft an. Dabei nimmt der Arzt die Rolle des Dienstleisters an, der Patient die des Kunden. Wie im paternalistischen Modell überwiegt der biomedizinische Ansatz, dass auch hier ein (Informations-) Austausch im eigentlichen Sinne nicht stattfindet. Der Patient weiß demnach, was seine Ziele sind und benötigt lediglich Informationen von dem Arzt, um eine Entscheidung treffen zu können (Fritzsche et al., 2015). Der Patient trägt letztendlich die alleinige Verantwortung für sein Handeln, was gleichzeitig die Gefahr eines überforderten Patienten mit sich bringt. Eine Abwandlung des Modells ist das autonome Modell, das wie der Begriff schon aussagt, von selbstständig orientierten Patienten ausgeht. Der Unterscheid zum Dienstleistung- oder Konsumentenmodell besteht jedoch darin, dass der Patient zwar allein entscheidet, sich aber dafür Informationen von dem Arzt oder von Dritten einholt (Dierks et al., 2001).
Partnerschaftliche Modell
Heutzutage gilt das partnerschaftliche Modell als angemessen, das von einer Kooperation zwischen zwei gleichberechtigten Partnern ausgeht. Jüngere und höher gebildete Befragte bevorzugen häufiger partnerschaftliche Konzepte als Ältere und Menschen mit geringerer Bildung (Klemperer, 2005a). Das Modell, das ursprünglich aus der Bildungsarbeit stammt, wurde ab Mitte der achtziger Jahre auf die Medizin übertragen und zunächst vor allem für Patienten mit chronischen Krankheiten weiter entwickelt (Rockenbauch et al., 2009). Das Verhältnis ist gekennzeichnet durch gegenseigten Respekt, Vertrauen und einem verantwortlichem Handeln für beide beteiligten Parteien (Fritzsche et al., 2015). Arzt und Patient diskutieren gemeinsam über Wertvorstellungen, Erwartungen, Befürchtungen und Ziele der Behandlung. Die gemeinsame und bestmögliche Lösung versuchen beide Gesprächspartner gleichermaßen über das sogenannte shared decision making (SDM) zu ermitteln (Faller, 2012). In Deutschland hat sich hierfür der Begriff der partizipativen Entscheidungsfindung (PEF) durchgesetzt, auf den im nächsten Abschnitt eingegangen wird.
3.2 Partizipative Entscheidungsfindung
Die Patientenbeteiligung bei medizinischen Entscheidungen wird international mit dem Begriff shared decision making (SDM) beschrieben und wurde erstmals Mitte der 1990er Jahre von einer kanadischen Arbeitsgruppe ausführlich und systematisch dargestellt (Loh et al., 2007). Charles et al. (1997/1999) benannten in diesem Zusammenhang erstmals vier Charakteristika der partizipativen Entscheidungsfindung (PEF):
1. Mindestens zwei Personen, der Arzt und der Patient, sind in den Entscheidungsprozess bzgl. einer Behandlung involviert.
2. Sowohl der Arzt als auch der Patient teilen ihre Informationen miteinander.
3. Arzt und Patient nehmen an dem Entscheidungsprozess teil, indem sie sich gegenseitig ihre Behandlungspräferenzen offen legen.
4. Arzt und Patient treffen eine Behandlungsentscheidung und stimmen darin überein, diese Behandlung durchzuführen.
Ergänzend können drei weitere Charakteristika der SDM von Legare' und Wittemann (2013) genannt werden. SDM ist: individuell ausgerichtet, nimmt Bezug auf publizierte Evidenz und berücksichtig die Erfahrungen der Therapeuten.
Innerhalb Deutschlands wird die PEF als ein Interaktionsprozess definiert, mit dem Ziel, unter gleichberechtigter und aktiver Beteiligung von Patient und Arzt auf Basis geteilter Information zu einer gemeinsam verantworteten Übereinkunft zu gelangen (Härter, 2004). Demzufolge verfolgt das Konzept primär drei Ziele:
1. höhere Therapietreue von Seiten der Patienten,
2. mehr Zufriedenheit auf Seiten des Arztes und des Patienten und
3. bessere Behandlungsergebnisse.
Um zu einer partizipativen Entscheidungsfindung zu gelangen, müssen sich der Patient und der Arzt gegenseitig ihr Wissen und ihre Wertevorstellungen mitteilen. Dies geschieht auf Grundlage des partnerschaftlichen Modells, welches charakterisiert ist durch den wechselseitigen Austausch von Wertevorstellungen, Zielen, Erwartungen und Befürchtungen (Loh et al., 2005). Damit steht SDM im
Gegensatz zu dem paternalistischen Verständnis, bei dem der Arzt alle Entscheidungen bezüglich der Behandlungsoptionen selbst trifft, ohne den Patienten mit einzubeziehen. Ein wichtiger Aspekt des ärztlichen Gesprächs besteht beim SDM darin, dem Patienten zu helfen seine Wertvorstellungen, Präferenzen und Wünsche zu konkretisieren und zu artikulieren. Der Arzt wiederum informiert in einer für den Patienten angemessenen Weise über die fachlichen Hintergründe. Dabei bleibt der Arzt Experte für das medizinische Wissen und der Patient wird als Experte für seine individuellen Präferenzen anerkannt. Eine Therapieentscheidung wird demnach zwischen „beiden Experten“ einvernehmlich gesucht und die Verantwortung für die jeweilige Entscheidung geteilt. Das Konzept verdeutlicht daher unter anderem noch einmal den Wandel innerhalb der Arzt-Pati- ent-Beziehung (Charles et al., 1997, 1999).
Loh et al. (2007) konnten bei 10 systematischen Übersichtsarbeiten zur PEF positive Effekte feststellen, die sich auf 256 randomisierte kontrollierte Studien bezogen. Die PEF-basierten Interventionen bewirkten:
- eine Zunahme des Wissens,
- eine realistischere Erwartung über Behandlungsverläufe,
- eine aktivere Beteiligung am medizinischen Behandlungsprozess,
- eine Verringerung von Entscheidungskonflikten,
- eine Abnahme der Unentschlossenheit der Patienten gegenüber Behandlungen und
- eine Verbesserung der Arzt-Patienten-Kommunikation und der Risikowahrnehmung der Patienten.
Die positiven Effekte der patientenorientierten Kommunikation und gemeinsamen Entscheidungsfindung konnten auch in späteren Studien belegt werden (Dwamena et al., 2012). Kahn et al. (2007) und Wolf et al. (2016) konnten außerdem zeigen, dass patientenorientierte Informationen zu einer Steigerung der Adhärenz führt. Der Grund hierfür liegt womöglich an einer Steigerung des Vertrauens in die gesundheitliche Versorgung, wodurch es auch zu einer Steigerung der Adhärenz und Motivation kommt (Meterko et al., 2010).
Womöglich sprechen sich daher in den seit 2001-2012 jährlich durchgeführten Erhebungen des Gesundheitsmonitors der Bertelsmann Stiftung relativ konstant etwas mehr als die Hälfte aller Befragten für die PEF als ihr Wunschmodell aus (Härter et al., 2017). Aber auch auf der Versorgerseite kann die Umsetzung der PEF zu Entlastungen führen. Farin (2014) konnte nachweisen, dass sich Ärzte durch die Beteiligung der Patienten entlastet fühlen. Außerdem konnten Missverständnisse, durch frühzeitiges Nachfragen, schneller geklärt werden.
Um die Umsetzung der PEF weiter zu fördern, kann sowohl auf der Arzt-, als auch auf der Patientenseite angesetzt werden. Laut Härter et al. (2004) kann die weitere Umsetzung der PEF durch drei Strategien erfolgen:
1. Schulung von Patienten und weiteren Multiplikatoren,
2. Entwicklung von medizinischen Entscheidungshilfen und
3. Aus-, Fort- und Weiterbildungsbildungsmaßnahmen der Medizinstudenten und der Ärzte.
Schulung von Patienten und weiteren Multiplikatoren
Hier geht es um Schulungsmaßnahmen mit dem Ziel, Gesprächs- und Handlungskompetenzen bei Patienten aufzubauen (Härter et al., 2004). Viele Gruppenprogramme zur Patientenschulung, Gesundheitsbildung und Psychoedukation werden besonders in der medizinischen Rehabilitation durchgeführt. Eine Bestandaufnahme von Reusch et al. (2013) zeigt, dass Schulungen entsprechend etablierter Qualitätsrichtlinien umgesetzt werden. Damit die Schulungen jedoch flächendeckend eingesetzt werden können, „fehlen ins besonders strukturelle Voraussetzungen im ambulanten Sektor“ (Dierks et al., 2012, S. 385). Auch Rathert et al. (2013) sehen im Bereich der Koordination der Versorgung weiteren Forschungsbedarf. Somit stellen Patientenschulungen einen möglichen, aber bislang eher einseitig beschrittenen Weg dar.
Entwicklung von medizinischen Entscheidungshilfen
Für eine Umsetzung der PEF können medizinische Entscheidungshilfen, sogenannten Patient Decicision Aids (PtDAs), hilfreich sein. Entscheidungshilfen können in unterschiedlicher Form vorliegen, wie zum Beispiel als Broschüre, Video oder Computerprogramm (Bieber et al., 2016). Sie informieren den Patienten über vorhandene Behandlungsoptionen und stellen systematisch Vor- und Nachteile der Optionen sowie Risiken und Nutzen gegenüber. Dabei sollten die medizinischen Entscheidungshilfen international anerkannten Qualitätsstandards (IPDAS-Kriterien) genügen (ebd.).
In Nordamerika und Großbritannien werden PtDAs bereits vermehrt eingesetzt. In Kanada aktualisiert beispielsweise das an die Universität in Ottawa angegliederte OHRI (Ottawa Hospital Research Institute) regelmäßig ein Verzeichnis mit über 100 englischsprachigen Entscheidungshilfen, die größtenteils online verfügbar sind (ebd.). Weitere Organisationen, wie zum Beispiel die FINDIM (Foundation for Informed Medical Decision Making) in Nordamerika oder das Unternehmen Health Dialogue in Boston, erstellen und vertreiben unterschiedlichste Entscheidungshilfen.
In Deutschland dahin hingegen werden medizinische Entscheidungshilfen bisher eher selten in der Regelversorgung eingesetzt. Das Interesse an medizinischen Entscheidungshilfen nimmt jedoch in den letzten Jahren zu, sodass sich teils Krankenkassen bei der Entwicklung und Verbreitung medizinischer Entscheidungshilfen (z. B. AOK: Entscheidungshilfe Brustkrebs) engagieren (Härter et al., 2017). Nationale Institutionen, wie das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) unterstützen Patienten bei Entscheidungen, indem sie evidenzbasierte Gesundheitsinformationen zur Verfügung stellen. Es bietet schon jetzt eine Reihe an hochwertigen und evidenzbasierten Patienteninformationen an und soll als ein nationales Gesundheitsportal dienen, das die erste Adresse für vertrauenswürdige Informationen wird (ebd.).
[...]
[1] Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.
[2] Derzeit existieren entsprechende Bildungsangebote rund 70mal in Ländern wie den USA, aber auch in England, Frankreich, Österreich, Irland oder Spanien (Dierks, M.-L., Seidel, G., 2009b).
[3] Empowerment bedeutet „Selbstbefähigung und Selbstbemächtigung, Stärkung von Eigenmacht, Autonomie und Selbstverfügung [...] [und] zieltauf die Herstellung von Selbstbestimmung über die Umstände des eigenen Alltags.“ (Ose und Hurrelmann, 2004, S. 398)
[4] Siehe Anhang Seite 102
[5] Das biopsychosoziale Modell (1977) wurde von dem Psychiater L. Engels geprägt und ist ein theoretisches Konstrukt. Dabei sind biologische, psychische und soziale Aspekte für den Menschen nicht eigenständige Konstrukte, sondern Teile eines verflochtenen Ganzen, die miteinander interagieren.
[6] Siehe Anhang Seite 103
[7] Siehe Anhang Seite 104
- Arbeit zitieren
- Eva Thalmeier (Autor:in)Marie-Luise Dierks (Reihenherausgeber:in)Gabriele Seidel (Reihenherausgeber:in), 2017, Studierende der Humanmedizin als Tutoren in der Gesundheitsbildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387583
Kostenlos Autor werden





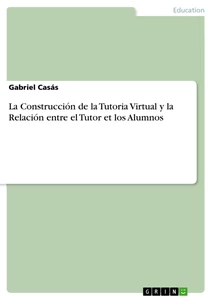



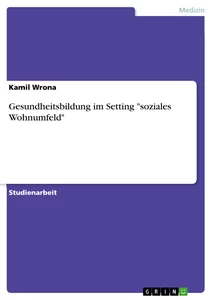












Kommentare