Leseprobe
Will man dem durchschnittlichen deutschen Schüleraufsatz glauben, haben sich schon die alten Griechen mit gar vielem beschäftigt, was uns auch heute noch bewegt. Oft mag man dem attischen Volk mit dieser Unterstellung bitterlich Unrecht tun, aber in zumindest einem Fall stimmt es wohl tatsächlich: der Demokratie.
Erstmals tauchte der Begriff Demokratie bei Herodot (ca. 450 v.Chr.) auf, und seitdem haben sich Heerscharen von Dichtern, Denkern und Doktoranden mit der Frage befaßt, was Demokratie eigentlich sei, wie man sie erklären könne, wie man sie definieren solle, welche Theorien maßgeblich seien und in welchem Verhältnis diese zueinander stünden. Die Zahl der Veröffentlichungen ist bereits Legion und füllt ganze Bibliotheken, und nun fügen sich in diesen Kanon zwei weitere Werke ein, die das Thema "Demokratietheorie" auf sehr unterschiedliche Weise ausleuchten und im Folgenden vorgestellt werden sollen.
Manfred G. Schmidt : Demokratietheorien. Eine Einführung.
Opladen: Leske + Budrich 1995, 407 S., DM 26,80
Schmidt, Professor für Politische Wissenschaften in Heidelberg, erläutert in seinem Buch klar strukturiert, was unter Demokratie verstanden wird und wurde und vor allem, welche Veränderungen die Demokratietheorie von der Antike bis zur heutigen Massendemokratie durchlief. Bereits der Titel gibt durch die bewußte Wahl des Plurals das Programm vor. Für Schmidt gibt es nicht nur eine Demokratie, "... sondern viele verschiedene Demokratien. Und es gibt nicht nur eine Demokratietheorie, sondern viele verschiedene Demokratietheorien." (S. 19). Diese Demokratietheorien unterteilt er in Vorläufer der modernen Theorie und moderne Ansätze selbst, wobei im Folgenden letztere weitgehend ausgeblendet werden und der Schwerpunkt bei den Klassikern liegen soll.
Denen widmet er sich bereits im ersten Kapitel, begonnen bei Aristoteles, über Montesquieu, Rousseau, Tocqueville und Mill bis hin zu schließlich Karl Marx. Diese auf den ersten Blick etwas willkürlich erscheinende Grenze bei Marx als letztem Vertreter der klassischen Theorie rechtfertigt Schmidt damit, daß allen von ihm klassisch genannten Vertretern gemein ist, ihre Theorien vor der allgemeinen Ausbreitung demokratischer Flächenstaaten entwickelt zu haben. Welcher Denker was als Demokratie bezeichnet und wie diese jeweils bewertet wird, wird ebenso dargestellt wie das Hauptproblem, von dem sich der jeweilige Autor leiten ließ. Außerdem erläutert Schmidt anhand der Autoren die Voraussetzungen für eine funktionierende Demokratie ebenso wie deren Vorzüge und Schwächen gegenüber anderen Staatsformen.
Bevor er jedoch mit deren Darstellung beginnt, stellt er eine grobe Klassifikation von Demokratieverständnis voran, in die er seine Protagonisten einordnen will. So unterscheidet Schmidt zwischen einem engeren Demokratieverständnis, dem beispielsweise Konservative zuneigen, während radikalere Vertreter der Linken eher eine "starke Demokratie" mit weitreichender Mitbestimmung (Barber 1994) bevorzugen. Mitten zwischen diesen Extrema verortet er einen gemäßigten Demokratiebegriffe vor allem der liberalen Theoretiker.
Als Ausgangspunkt der Darstellung vormoderner Theorien wählt Schmidt Aristoteles, der über den idealen Staat nachdachte und daraus die 'Lehre von der guten Staatsverfassung' ableitete. Der mächtige Demos, die – zumindest potentiell unbegrenzte – Souveränität des Volkes war herausragendes Kennzeichen des athenischen Staates und Kernpunkt der aristotelischen Lehre. Schmidt referiert ausführlich dessen Schema der Verfassungsformen, bei dem Demokratie bekanntlich als Verfassungsabweichung, als eine der pervertierten Formen, verstanden wird, und betont wiederholt, wie sehr es Aristoteles graute vor der radikalen Form der Volksversammlungsherrschaft. Zugleich verwehrt er sich aber gegen die pauschale Unterstellung, Aristoteles sei ein Gegner der Demokratie gewesen. Lediglich "eine beträchtliche Distanz" gegenüber extremen Ausformungen (28) sei ihm zuzuschreiben. Anschließend widmet er sich der tatsächlichen Funktionsweise der "attischen Demokratie", die er entromantisiert und nach heutigen Maßstäben nicht als echte, sondern nur als Vierteldemokratie – verunstaltet durch oligarchische Tendenzen und unzureichende Sicherungen gegen die Macht der Volksversammlungsmehrheit (35) – gelten läßt.
Immer wieder weist Schmidt hin auf die kritisch distanzierte Beurteilung der Demokratie nicht nur durch Aristoteles, sondern durch die Mehrheit der antiken Philosophen, die sich vor allem an dem Gleichheitsgrundsatz stießen. De facto brachte erst das 18. Jahrhundert und Montesquieu eine positivere Konnotation. Die fast 2000 Jahre bis zu Montesquieu und dessen Kritik am französischen Absolutismus reißt Schmidt nur an; einige Seiten widmet er Hobbes und seiner These, die Demokratie habe mehr Mängel als andere Staatsformen, und letztlich sei die Monarchie die beste aller Regierungen. Wirklich Neues bringt für Schmidt erst wieder der Baron de la Brède und vor allem dessen 1748 veröffentlichte Abhandlung "De l'Esprit des Loix". Auch Montesquieu wird noch nicht als Anhänger der Demokratie vorgestellt (womit Schmidt anderen Autoren widerspricht), sondern eher als Gefolgsmann einer konstitutionell-aufgeklärten Monarchie mit demokratischem Beiwerk. Dennoch wertet er den Begriff der Demokratie gegenüber anderen enorm auf und ist damit aus demokratie-theoretischer Sicht interessant. Relevant ist er vor allem wegen seiner Gedanken zur Machtkontrolle und Gewaltenbalancierung ("que le pouvoir arrête le pouvoir"), die letztlich in Verbindung mit der Monarchie zu einer "gemäßigten Demokratie" führten, die erstmals auch für Flächenstaaten anwendbar sei.
Dieser Idee der "gemäßigten Demokratie" steht Jean-Jacques Rousseau als Vertreter einer radikalen Volkssouveränitätslehre diametral entgegen. Als Fürsprecher der Identität von Regierten und Regierenden und "naiver Bewunderer" (Schmidt, S. 32) der athenischen Demokratie, die er mit den Worten umschrieb: "Bei den Griechen erledigte das Volk alle seine Obliegenheiten selbst; es war ununterbrochen auf dem Marktplatz versammelt. Es wohnte in einem milden Klima, war überhaupt nicht habgierig, ... seine große Angelegenheit war die Freiheit." (Gesellschaftsvertrag, III. Buch, 15. Kap.) verdammt er den Gedanken der Repräsentation und wird von Schmidt positioniert als Gegenpol zu den frühliberalen verfassungsstaatlichen Modellen bei Montesquieu und als. Die These jedoch, Rousseau sei ein Protagonist der direkten- oder Teilhabedemokratie, will Schmidt nur eingeschränkt gelten lassen, allerdings hat er dem nur das eher schwache Argument, die weibliche Bevölkerungshälfte sei bei Rousseau ausgeschlossen, entgegenzusetzen. Generell fällt auf, daß Schmidt Rousseau eher kritisch gegenübersteht, konstatiert er doch beispielsweise, daß dessen heutige Bedeutung sich eigentlich nicht durch die Qualität und Ergiebigkeit seiner wissenschaftlichen Demokratietheorie rechtfertigen lasse und Rousseaus Werk im Allgemeinen deutlich unter dem Niveau läge, was schon vor ihm erreicht wurde (Schmidt, S. 77).
[...]
- Arbeit zitieren
- Simone Prühl (Autor:in), 2004, Demokratietheorien im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38540
Kostenlos Autor werden
















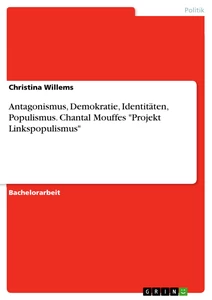


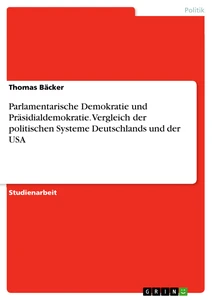


Kommentare