Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
1.1 Abgrenzung des Arbeitsvorhabens
2. Säkularisation, Staatskirchentum, Ultramontanismus, religiöse Erneuerung: Terminologische Vorbemerkungen
3. Das Bistum Limburg in nassauischer Zeit
3.1. Bistumsgründung
3.2. Bischof Peter Joseph Blum - „Die Morgenröthe eines schöneren Tages“
3.3. Revolution und nassauischer Kirchenstreit
4. Der Anschluss an Preußen aus kirchenpolitischer Sicht
4.1. Nassaus Rolle im Krieg von 1866
4.2. Bischof Blums Hirtenbrief vom 15. Oktober 1866
5. Das Glaubensleben der Diözesanen vor dem Kulturkampf.
5.1. Probleme der Forschung
5.2. Die Priester als „Milieumanager“
5.3. Volksmissionen
5.4. Bruderschaften und Vereine
5.5. Wallfahrten und Prozessionen
5.6. Orden und Kongregationen
5.6.1. Etablierte Orden in der Diözese
5.6.2. Arme Dienstmägde Jesu Christi
5.6.3. Barmherzige Brüder von Montabaur
6. Der Kulturkampf.
6.1. Historische Hinführung und Begriffsdefinition
6.2. Die Reaktion der Katholiken auf die „Klimawende“
6.3. Auswirkungen des Kulturkampfs im Bistum Limburg
6.3.1. Gemeindeleben
6.3.2. Bischof.
6.3.3. Orden und Kongregationen
6.3.4. Priesterausbildung
6.4 Die Koalition zwischen Klerus und Laien
6.5 Das Verhältnis der katholischen Laien zum Staat am Beispiel der Sedanfeier
6.6 „Nach Canossa gehen wir nicht“ - Die Beziehungen zwischen Klerus und Staat
7. Schlussbetrachtung
Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Dass im Laufe des 19. Jahrhunderts eine große Wende im deutschen Katholizismus eintrat, gilt in der historischen Forschung als unbestritten. Augenscheinlich wurde sie im „Kölner Ereignis“ (auch als „Kölner Wirren“ bezeichnet) von 1837[1] und der Massenwallfahrt zur Ausstellung des Heiligen Rocks nach Trier 1844. Diese Ereignisse führten eindrücklich vor, welch starken Rückhalt die katholische Kirche in der Bevölkerung zur Zeit des Vormärz hatte. Nur etwa 50 Jahre zuvor hatten die Aufklärer noch von einer Zukunft geträumt, in der die Religion auf eine moralische Sittenlehre reduziert und das Element des Konfessionellen keine Rolle mehr spielen sollte.
Doch die Entwicklung sollte in eine andere Richtung führen. Die Beamtenkirche des Absolutismus und der Aufklärung konnte sich nicht behaupten, zu tiefgreifend waren die Änderungen der äußeren Umstände. Der Nassauer Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897) hielt die von vielen Zeitgenossen empfundene Positionsverschiebung der katholischen Kirche in seiner volkskundlichen Schrift „Land und Leute“ 1850 folgendermaßen fest: „Von allen öffentlichen Autoritäten hat die Kirche allein vollwichtigen Erfolg aus unserer Revolution [von 1848] gewonnen. Alle andern Mächte schwächten sich gegenseitig: die Macht der Kirche ist um das Zehnfache gewachsen. Und obendrein ganz im Stillen. [...] Die Kirche wird schwach, sobald sie sich dem Volksleben entfremdet, darum waren die glänzendsten Perioden der theologischen Gelehrsamkeit nicht selten Perioden der Ohnmacht der Kirche. Sie wird stark und verjüngt sich, sobald sie wieder in unmittelbare Berührung mit dem Volk und seinen praktischen Bedürfnissen tritt.“[2] Riehl diagnostiziert, dass die starke Position der katholischen Kirche aus ihrer Rückkoppelung an die Bedürfnisse des „Volkes“ herrührt. Es ist dabei wichtig zu wissen, dass mit dem Volk im damaligen Sprachgebrauch die ländlich-bäuerliche und kleinstädtische Bevölkerung bezeichnet wurde[3], im Gegensatz zum „Bürgertum“ und den „unteren Schichten“.
Damit ist schon der Spannungsrahmen vorgezeichnet, in dem sich der neue Katholizismus innerhalb der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts bewegte. Denn es steht inzwischen auch außer Frage, dass eine Wechselwirkung bestand zwischen dem „Zeitgeist“ des 19.
Jahrhunderts mit seinen Chiffren „Aufklärung“, „Liberalismus“ und „Nationalismus“ und der innerkirchlichen Entwicklung. Die Folgen dieser Wechselwirkung für die katholische Kirche sind bekannt: Nach außen bemühte sie sich um eine radikale Abwehrhaltung[4], nach innen erhöhte sie ihre Sakralisierungsanstrengungen[5]. Somit kann die katholische Erneuerung nicht bloß als Defensiv-, sondern auch als Offensivreaktion auf eine sich verändernde, nämlich sich modernisierende Welt gesehen werden.
In Deutschland trafen liberal-nationale und katholische Auffassungen im großen „Kulturkampf“ aufeinander. Dieser ist wahrscheinlich nicht in erster Linie als Konfessionskonflikt zu sehen (obwohl es zu kurzsichtig wäre, das konfessionelle Element ganz auszublenden), sondern als ein Versuch zur Säkularisierung des Staates und der Gesellschaft. Das Bestreben, den Einfluss der Kirchen (und dabei v.a. der katholischen Kirche) einzudämmen traf dabei auf eine diametral entgegenlaufende breite Verdichtung des Glaubenslebens, eine „Rechristianisierung“[6].
Erschwert wird das Zustandekommen eines ausgewogenen Bildes durch die Problematik der Quellen. Der eigentliche Kulturkampf (als Säkularisierungsmaßnahme, nicht als Juristikum) wurde zwischen Liberalen und Katholiken vorzugsweise über die Publizistik geführt. Und er wurde vorwiegend polemisch geführt, mit Spott und Verachtung für die jeweils andere Seite. Das zeigt an, wie sehr sich beide Parteien subjektiv im Recht fühlten und welches Selbstvertrauen sie aus der Richtigkeit ihrer Position zogen. In der virtuellen Realität der kulturkämpferischen Rhetorik, so formulieren Christopher Clark und Wolfram Kaiser diesen Sachverhalt, schien es um einen Kampf bis auf den Tod zwischen zwei diametral entgegengesetzten soziokulturellen Systemen zu gehen. In Phasen besonderer Eskalation hätten die rhetorischen Scharfschützen, die an Vorurteile und Ängste appellierten und so die Emotionen in beiden Lagern aufstachelten, auf beiden Seiten eine wichtige Rolle gespielt.[7] Katholiken verdammten die moderne Welt, die Hinwendung allen Lebens und Denkens zu weltlichen Dingen und den Relativismus und Irenismus, der eine Verflachung des Glaubens zur Folge habe. Eindrucksvoll wurde das 1864 im „Syllabus Errorum“ von Papst Pius IX. fixiert. Der Syllabus stellt die schriftliche Fixierung von bereits zuvor artikulierten antimodernen und antiliberalen Positionen der katholischen Kirche dar. Liberale ächteten hingegen die vor-aufklärerischen Elemente des Katholizismus. Er trage zu Bevormundung, Aberglaube, Bildungsinferiorität und einer „Verdummung“ der Bevölkerung bei, stehe also im scharfen Gegensatz zum liberalen Kulturkonzept und sei überdies ein „Hemmschuh“ für den ökonomischen Fortschritt und ein allseits glückliches und produktives Leben.[8]
1.1 Abgrenzung des Arbeitsvorhabens
Meine Arbeit will durch Fokussierung auf ein einzelnes Bistum das einleitend angerissene Phänomen der Wende im deutschen Katholizismus, das ich als katholische Erneuerung bezeichnen will, präzisieren und anschließend untersuchen, wie Diözesanen und Geistliche auf den Kulturkampf reagierten. Dabei müssen Forschungsergebnisse aus Sozialgeschichte, Landesgeschichte und Kirchengeschichte miteinander kombiniert werden. Der Hauptbestandteil des Quellenmaterials für diese Arbeit ist unediert[9] und stammt aus dem Diözesanarchiv in Limburg. Den Mitarbeitern dort gebührt mein herzlicher Dank für ihre Unterstützung und Kooperation.
Das Phänomen Kulturkampf kann freilich nicht aus rein regionaler Sicht heraus erklärt und verstanden werden, sondern nur im nationalstaatlichen Zusammenhang. Jüngere Forschungen nehmen auch verstärkt eine komparative europäische Perspektive ein, um den Kulturkampf nicht mehr als isolierten deutschen Konflikt zwischen Staat und Kirche zu analysieren, sondern ihn einzureihen in europaweit zu beobachtende Prozesse des politischen und sozialen Wandels.[10] Solche Erwägungen berücksichtigend, kann eine Studie en détail aber doch Forschungstendenzen und -ergebnisse überprüfen, ergänzen und modellieren. Sie stellt eine direkte Rückkoppelung der These an das Geschehen dar. Bisherige „volksfrömmische“ Forschung in volkskundlichen Studien über das religiöse Verhalten in Brauchtum und Traditionsmustern konzentrierte sich allzu sehr auf das tatsächliche Volk im Sinne des Sprachgebrauch des 19. Jahrhunderts. Seit den 1970er
Jahren hat sich dagegen eine eigenständige historische Religionsforschung im Zuge der Sozialgeschichte etabliert.[11] Sie will weder volkskundliche Beschreibung noch theologische Kirchengeschichte sein, befindet sich also im Spannungsfeld zwischen Geschichtsschreibung „von unten“ und „von oben“. Im Idealfall sollten in einer Synthese die Wirkungsmöglichkeiten des „von oben“ mit den Verhaltensweisen „von unten“ abgeglichen werden. Mit der verstärkten Ausarbeitung der sozialgeschichtlichen Schule traten auch neue Personen und Gruppen in den Blickfokus der Wissenschaft. Angewandt auf die sozialgeschichtlich inspirierte Religionsgeschichte bedeutet das, dass man versuchte, weniger aus der Erforschung der Institutionen und leitenden Personen und dafür mehr aus der Erforschung von religiösen Verhaltensmustern breiterer Bevölkerungsschichten bzw. -gruppen Erkenntnisse über die Geschichte zu gewinnen. Besonderes Interesse kommt dabei der Frage zu, welchen Anteil die Religion im Leben unserer Vorfahren hatte. Die Religion hat im Laufe der Geschichte sehr viele Geschehnisse direkt beeinflusst, und im Zuge einer säkularisierten Gesellschaft, in der organisierte Glaubensformen immer mehr in den Hintergrund des kollektiven Bewusstseins treten, ist es für das historische Verständnis wichtig, die Rolle von Religion und Glauben aktiv zu erforschen und in allgemeinere Überlegungen mit einzubeziehen.
In der vorliegenden Arbeit wird vordergründig das Verhalten der Entscheidungsträger aus katholischer Kirche und Staat untersucht. Das liegt zunächst daran, dass diese Quellen verhältnismäßig leicht zugänglich und auswertbar sind. Diese Arbeit kann keine allumfassende Darstellung der Volksfrömmigkeit in der Region und ihren eventuellen Wandel liefern. Dazu wären gründlichere, zeitintensivere Forschungen (z.B. durch Auswertung von Visitations- und Polizeiberichten oder Erforschung von Formen populärer Frömmigkeit, wie sie sich in regionalen religiösen Bräuchen und Traditionen ausdrücken) nötig. Da der sozialhistorische Aspekt aber nicht vernachlässigt werden soll und darf, gebe ich in Kapitel 5 einen Überblick über die verschiedenen zeitgenössischen Ausformungen des öffentlichen katholischen Glaubensleben. Das Verhältnis der Laien zu ihren Geistlichen und der Katholiken zum Staat soll danach in der Besprechung der Auswirkungen des Kulturkampfes explizit behandelt werden.
Aufgrund der hierarchischen Organisationsstruktur der katholischen Kirche macht es darüber hinaus aber auch durchaus Sinn, näheres Augenmerk auf den Leiter des Bistums, den Bischof, zu lenken. Seine Person besitzt qua functionam einen besonderen Stellenwert in der Lebenswelt des Glaubens der Diözesanen. Er ist nicht nur Verwaltungsleiter und Vorgesetzter des Diözesanklerus, seine Stellung reicht weit darüber hinaus. Als Entscheidungsträger kann er in das unmittelbare Glaubensleben der Katholiken eingreifen, z.B. durch Reformen in der Liturgie und im Bereich der Seelsorge (Einführung von neuen Andachtsformen, Fasten- und Beichtvorschriften). Als „Oberhirt“ kommt ihm also auch die Rolle eines religiösen Führers zu. Überdies nimmt er in der an die Familie angelehnte Struktur der katholischen Kirche (wie sie sich in den Bezeichnungen Brüder, Schwestern, Kinder, Vater, Mutter ausdrückt) für seine Bistumsangehörigen die Vaterfunktion, also die des Familienpatriarchen, wahr.
Im Falle des dritten Bischofs von Limburg, Peter Joseph Blum (Amtszeit 1842-1884), wurde von der bisherigen Forschung noch kein angemessenes Charakterbild gezeichnet. Als ein früher Versuch dazu ist die Bistumsgeschichte von Matthias Höhler[12], Blums Sekretär in seiner Exilzeit, zu sehen. Sie ist aber weniger Produkt ausgewogener historischer Forschung, sondern eher zeitnahe Quelle eines Begleiters. Wie stark Höhler die Beurteilung des Bischofs beeinflusste, zeigt noch die 1955 erschienene Kurzbiographie von Ferdinand Ebert in den „Nassauischen Lebensbildern“[13]. Blums Persönlichkeit am Nähesten kam Klaus Schatz in seiner grundlegenden Bistumsgeschichte.[14] Seine Interpretationsmaxime und Basis jeder Beurteilung ist es, Blum eben nicht als Politiker, sondern vorrangig als Seelsorger zu betrachten. Es bleibt aber zu bedenken, ob solch ein (den Charakter Blums durchaus treffender) Ansatz den historischen Gegebenheiten angemessen entspricht, denn die Gefahr einer Entpolitisierung der historischen Person verkürzt ihre nach außen wirkenden Einflussmöglichkeiten, die eben nicht ausschließlich nur auf religiöse Verhaltensmuster beschränkt waren. Zudem ist Bischof Blum bisher nicht in die breite Rezeption der überregionalen Forschung vorgedrungen, obwohl er sicher „einer der engagiertesten und mutigsten deutschen Bischöfe des 19. Jahrhunderts“[15], und somit eine Schlüsselfigur war. Man muss sich also auch im Jahr 2006 noch dem Bedauern von Konrad Fuchs anschließen, der 1986 formuliert hatte, „daß sein [= Blums] Leben und Wirken bis heute nicht den Platz in der Geschichte gefunden haben, der ihnen gebührt“.[16]
Was den gewählten zeitlichen Rahmen 1860-1880 anbelangt, so ist er zu verstehen als der Zeitausschnitt, in dem sich die Wandlung des Katholizismus im Bistum Limburg in besonders starker Ausprägung zeigte. In diesen zeitlichen Rahmen fällt die Beilegung des nassauischen Kirchenstreits, die Annexion des Herzogtums Nassau durch Preußen, die Bildung des Deutschen Kaiserreiches und der Kulturkampf. Es wird aber von Nöten sein, diesen Hauptfokus gelegentlich zu durchbrechen, um vorherige Entwicklungen darzustellen und kurz über die weiterführenden Ereignisse zu berichten.
Die Arbeit wurde in ihrer Struktur chronologisch angelegt, um in der Schlussbetrachtung leichter ein Fazit ziehen zu können. Darin möchte ich zu einer Antwort auf die Frage gelangen, wie sich die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche im untersuchten Zeitraum auf das Leben, Denken und Handeln der Diözesanen auswirkte, wie es vom Klerus beeinflusst wurde und welchen Veränderungen es eventuell unterlag.
2. Säkularisation, Staatskirchentum, Ultramontanismus, religiöse Erneuerung: Terminologische Vorbemerkungen
Für die historischen Vorgänge, die in der vorliegenden Arbeit untersucht werden sollen, hat die Forschung einige feste Begriffe geprägt. Lange Zeit subsumierte man die religiöse Erneuerung, die sich im 19. Jahrhundert entwickelte, unter dem Begriff
„Ultramontanismus“. Aus dem im Ursprungssinn geographisch benutzten Begriff (synonym zu „transalpin“) wurde, wie Heribert Raab gezeigt hat, im Zuge des reichskirchlichen Episkopalismus im 18. Jahrhundert ein Schlagwort, dass nur aus der Negation lebte.[17] Ultramontane wurden seitdem die Anhänger der päpstlichen Infallibilität (Unfehlbarkeit) und der monarchischen Kirchenverfassungslehre, die dem Papst die oberste Jurisdiktion zuspricht, genannt. Raab sieht schon in diesem Entstehungsstadium die Basis dafür geschaffen, dass ein unüberbrückbarer terminologischer Gegensatz zwischen den „Curialistae“ (den Kurialen) und den „Nationalistae“ (den Nationalen) entdeckt und dem Bewusstsein eingeprägt wurde. Der Begriff wurde also einerseits vorwiegend abwertend und andererseits vor allem im kirchenorganisatorischen Zusammenhang gebraucht.[18]
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erlebte das Papsttum während der Französischen Revolution und der Zeit Napoleons eine Periode der Schwäche. Die radikale Aufklärung hatte versucht, den Einfluss der Religion auf den Menschen stark einzuschränken und sie mehr am Diesseits als am Jenseits zu orientieren. Die tradierten Verhaltensmuster gegenüber König und Kirche, denen man mit Achtung, Respekt und Ehrfurcht begegnete, waren mit der Französischen Revolution nach Jahrhunderten durchbrochen worden. Neues Idealbild des Zusammenlebens wurde der Vertrag zwischen mündigen Partnern. Er sollte das Konzept des Gottesgnadentums ablösen. In Reaktion auf diese Vorgänge entwickelte sich der Ultramontanismus weiter: In seiner Schrift „Du Pape“ (1819) übertrug Joseph de Maistre den monarchischen Souveränitätsbegriff auf den Papst, dessen Primat und Unfehlbarkeit er mit politischen und sozial-psychologischen Argumenten postulierte.[19] Die im Zeichen der Legitimität vollzogene Restauration des europäischen Staatensystems auf dem Wiener Kongreß kam dem ultramontanen Aufbruch entgegen, die Führer der antinapoleonischen Koalition wollten ihre Neuordnung auch durch die Autorität von Papst und Religion absichern.[20] Doch entgegen diesen scheinbar günstigeren äußeren Umständen veränderte sich nur wenig an der unter Napoleon vollzogenen Einbindung der katholischen Kirche in den Staat. Das napoleonische Konkordat bildete zunächst das Vorbild für die Regelung der Kirchenfrage als Vertragsabschluss zwischen Rom und den Staats- bzw. Landesherrn über die Verfasstheit der Kirche in einzelnen Territorien.
Vor der Wandlung des Papsttums zum Universalepiskopat einer Weltkirche, so wie es uns auch heute noch bekannt ist, waren nationale Zwischeninstanzen innerhalb der Kirchenhierarchie ausgeschaltet worden. In Deutschland war dieses Schicksal mit dem Ende der alten Reichskirche 1806 besiegelt. Die Säkularisation, d.h. die Übernahme von vorher von der Geistlichkeit regierten Territorien, beendete teils jahrhundertealte Regentschaften. In der hier betrachteten Region des 1806 gegründeten Herzogtums Nassau war es die Auflösung der Kurerzbistümer Mainz und Trier, deren Territorien zerteilt und verschiedenen Fürsten (u.a. eben auch den nassauischen Häusern) als Ausgleich für die linksrheinisch verlorenen Gebiete zugesprochen wurden. Diese radikal anmutende Einmischung des Staates in kirchliche Angelegenheiten kann aus kirchlicher Sicht auch positiv gesehen werden: „Ohne geistliche Staaten und ohne Reichtümer hatte die Kirche eine neue Chance für ihren geistlichen Auftrag.“[21] Die Säkularisation führte auch zur endgültigen Aufgabe des Prinzips Cuius regio eius religio, da nun vielfach Protestanten und Katholiken gemeinsam in einem Staat lebten. Säkularisation und Konkordatszeit führten zu einem neuen Erscheinungsbild der katholischen Kirche. Sie war nun im Staatskirchentum fest in die restaurierten Staaten eingebunden. Zuerst nur als Aufsicht des Landesherrn über die äußeren Kirchenverhältnisse intendiert, griff das Staatskirchentum auch zunehmend in innere Verhältnisse der katholischen Kirche ein.
Diese Eingriffe wurden aber von Seiten der katholischen Geistlichkeit immer weniger toleriert. Papst Gregor XVI. (1831-46) hatte eine weitere Steigerung der päpstlichen Autorität, die Erhaltung der kirchlichen Substanz, Vertiefung des religiösen Lebens aus dem Geist der spezifisch römischen Überlieferung, sowie die Abwehr von Neuerungen und Befreiung der Kirche von staatlichen Einwirkungen zu den Hauptanliegen seines Pontifikats gemacht.[22] Mit seinem Amtsantritt beginnt die Zeit eines starken Ultramontanismus, der seinen Höhepunkt in den Beschlüssen des Vatikanischen Konzils 1870 fand, das die Unfehlbarkeit der ex cathedra verkündeten Lehrmeinung des Papstes zum Dogma erhob. Damit wurde die katholische Kirche stärker als in den vorhergehenden Epochen aus Rom geleitet.
Zwischen den beiden Zeitpunkten von Säkularisation und Unfehlbarkeitsdogma liegt eine Entwicklung, in der das Papsttum sowohl beim Klerus als auch bei den Laien einen enormen Zuwachs an Ansehen und Beliebtheit verzeichnen konnte. Rudolf Lill erklärt diese „neuartige Aufwertung von Autorität und Tradition“ mit einer „radikalen Abwehrhaltung innerhalb der Kirche“, provoziert durch die Radikalisierung der Aufklärung durch die Revolution.[23] Tatsächlich wurde unter dem langen Pontifikat von Papst Pius IX. (1846-78) nach dem Untergang des Kirchenstaats der Papstkult spürbar mächtig. Er äußerte sich in häufigen Jubiläumsfeiern, dem freiwilligen Peterspfennig, der in einzelnen Gemeinden per Kollekte gesammelt wurde, in Pilgerfahrten nach Rom und in der Verbreitung von Papstbildern. Der Papst war den Katholiken damit ständig präsent und integratives Symbol (als „Märtyrer“ und „Gefangener“) geworden.
Wenn man auch aufgrund dieser Überlegungen den Ultramontanismus als einen Teilaspekt dem Wandel des deutschen Katholizismus, wie sie im einleitenden Zitat von Wilhelm Heinrich Riehl beschrieben wurde, hinzurechnen kann, ist mit diesem Begriff[24] das Phänomen noch nicht befriedigend begrifflich erfasst. Ich möchte dieses Phänomen als „religiöse Erneuerung“ bezeichnen. Damit wird m. E. am treffendsten die Dynamik bezeichnet, mit der die Bindung der Katholiken an ihre Kirche nicht etwa durch Reformen in Glaube und Organisationsform erreicht worden ist, sondern im Gegenteil durch stärkere Aufwertung von Bestehendem und Rückbesinnung auf Überliefertes. Im Phänomen dieser religiösen Erneuerung sollte sich dabei eine starke Überschneidung von klerikalhierarchischen mit Wünschen, Forderungen und Interessen der katholischen Laien zeigen.
Ganz vermieden werden kann und soll der Begriff Ultramontanismus aber deshalb nicht. Wenn in den folgenden Kapiteln von ihm die Rede ist, dann ist darunter die kirchlichreligiöse Ausrichtung nach Rom und an das Papsttum gemeint. Wenn diese Unterscheidung gemacht wird, darf man aber auch nicht verschweigen, dass Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts nicht so scharf trennten zwischen kirchlicher und politischer Wortbedeutung. Katholiken (dabei der Klerus stärker als die Laien), die in ihrem religiösen Denken und Empfinden nach Rom ausgerichtet waren, bezeichneten sich selbst gerne als „romtreu“, „Römlinge“ und eben auch „Ultramontane“ - ganz zu schweigen von dem Gebrauch dieser Begriffe bei Gegnern der katholischen Kirche, die mit ihnen ihre Kritik an der Bevormundung der Katholiken durch die Kirchenhierarchie auf den Punkt bringen konnten.
Beginnen wir nun, nachdem wir uns diese allgemeineren Entwicklungstendenzen in Erinnerung gerufen haben, mit der Fokussierung auf unser Untersuchungsgebiet und der Annäherung zu Lösungsansätzen für unsere Fragestellung nach der konkreten Auswirkung der Zugehörigkeit zur katholischen Kirche auf das Leben, Denken und Handeln der Katholiken.
3. Das Bistum Limburg in nassauischer Zeit
Um die Wende, die unter dem dritten Limburger Bischof Peter Joseph Blum eintrat, besser verstehen zu können, muss zunächst ein kurzer Blick auf die Gründung des Bistums 1827 und die folgende Entwicklung geworfen werden. Entstanden ist es als typisches Landesbistum, d.h. dass sich sein Wirkungsraum fast vollständig mit den Grenzen des nassauischen Herzogtums deckte.
3.1 Bistumsgründung
Die französische Expansion unter Napoleon, die eine große Existenzkrise für viele kleinere und mittlere Herrschaften rechts des Rheins mit sich brachte, veranlasste die Grafen von Nassau-Weilburg und Nassau-Usingen sich 1806 dem Rheinbund anzuschließen. Schon mit dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 hatten sie neben anderen kleineren Herrschaften auch rechtsrheinische Territorien von Kurtrier und Kurmainz übernommen. Am 30. August 1806 schlossen sich die beiden nassauischen Fürstentümer - die dritte Linie, Nassau-Oranien, büßte seine Parteinahme für Preußen mit dem Verschwinden von der Landkarte ein - zum Herzogtum Nassau zusammen. Auf dem Wiener Kongreß kamen zu diesem Staatsterritorium noch Gebiete des Großherzogtums Berg und die Niedergrafschaft Katzenelnbogen hinzu.
Die Übernahme der katholischen Gebiete machte aus den vormals rein protestantischen (alt)nassauischen Landen einen paritätischen Staat, freilich unter Leitung eines protestantischen Herzogs und einer mehrheitlich protestantischen Regierung (als erster katholischer Minister wurde Graf Carl Wilderich von Walderdorff 1834 berufen). Das Herzogtum blieb für die Dauer seiner Existenz aber insgesamt in einem ausgewogenen Konfessionsverhältnis mit leichter Bevölkerungsmehrheit der Protestanten (s. Tab. 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[25]
Tab.1: Konfessionsverteilung in Nassau
Bei Gründung des Herzogtums lebten die damals rund 130.000 Katholiken Nassaus vor allem in den ehemaligen kurtrierischen und kurmainzischen Gebieten im Nordwesten (Westerwald) und dem anschließenden Gebiet von Hadamar über Limburg über den Goldenen Grund bis nach Camberg und Würges, sowie im Südwesten (Rheingau, Maingau und Taunus). Innerhalb der Gesamtdiözese lag der Anteil der Katholiken an der Bevölkerung im 19. Jahrhundert bei durchgehend um die 40 Prozent.[26] Bis zu Beginn des 20. Jahrhundert war das Bistumsgebiet industriearm und agrarisch strukturiert, nur Frankfurt und das zur nassauischen Residenzstadt ausgebaute Wiesbaden bildeten eine Ausnahme.[27] Die Industrialisierung setzte erst nach 1866 zuerst in Frankfurt und danach im übrigen Rhein-Main-Gebiet ein.
Wie Winfried Schüler formuliert, folgte der territorialen Festigung des Herzogtums eine innenpolitisch-administrative: die Regierung folgte dabei einem Kurs der inneren Reformen und der Reorganisation der Staatsverwaltung, wozu auch eine landständische Verfassung gehörte, die erste ihrer Art in Deutschland[28]. Das Ergebnis dieses Kurses war aber „ein streng zentralistischer Einheitsstaat, der mit seinem bürokratischen Reglementierungsbedürfnis und absolutistischen Herrschaftsanspruch auch vor den Kirchen nicht haltmachte.“[29] In der Union von 1817, im Jubiläumsjahr der Reformation, wurden in Nassau Lutheraner und Reformierte zur „evangelisch-christlichen Kirche“ vereinigt.[30]
Die Regelung der katholischen Kirchenangelegenheiten sollte dagegen länger dauern. Am 24. März 1818 traten Unterhändler der oberrheinischen Staaten Baden, Württemberg, Hessen-Darmstadt, Kurhessen, Nassau und Frankfurt in Frankfurt am Main zusammen, um über eine neue Ordnung der katholischen Verhältnisse zu beraten. Denn zu diesem Zeitpunkt war noch nicht geklärt, welcher bischöflichen Gewalt die Katholiken des Herzogtums Nassau unterstanden. Der nassauische Vertreter Johann Ludwig Koch suchte auf der Konferenz nach einem Partner für eine gemeinsame Bistumsgründung, um die Belastung für den nassauischen Etat gering zu halten. Er fand ihn in der Freien Stadt Frankfurt, in der rund 6000 Katholiken lebten.[31] Mit dem Vertrag zwischen Nassau und Frankfurt war schon der territoriale Umfang und die finanzielle Dotation des Bistums Limburg in Unterhandlungen der staatlichen Vertreter gefallen. Es folgten mehrere Jahre der Verhandlungen mit Rom, bis das Bistum 1827 durch die Bulle „Ad dominici gregis custodiam” als Suffraganbistum der Erzdiözese Freiburg innerhalb der neuen Oberrheinischen Kirchenprovinz (zusammen mit Rottenburg, Mainz und Fulda) errichtet wurde. Dem Selbstverständnis des Staatskirchentums nach datiert die Gründung des Bistums mit dem Erlass der Herzoglichen Dotationsurkunde am 8. Dezember 1827. Die Verhandlungen mit Rom zogen sich vor allem deshalb in die Länge, weil der Modus der Bischofswahl geklärt werden musste. In der Bulle von 1827 war geregelt, dass diese Wahl durch ein Domkapitel erfolgen musste, dem Landesherrn wurde aber das Recht eingeräumt, „personae minus gratae“ bis auf drei verbleibende Kandidaten von der Nominationsliste zu streichen.[32]
Es sind vor allem zwei Faktoren, die die Entwicklung des Bistums im 19. Jahrhundert bestimmen: sowohl die finanzielle Ausstattung als auch die Personalsituation speisten sich aus sehr begrenzten Ressourcen. Dazu kam, dass der nassauische Staat für beide Faktoren ein starkes Aufsichtsrecht für sich in Anspruch nahm.
Nach 1827 waren die Bistümer der Oberrheinischen Kirchenprovinz in vergleichbarer, weil einigermaßen gleicher Ausgangslage. Dem Bistum Limburg kam dabei an sich keine Schlüsselstellung zu. Seine Geschichte verlief auch nicht entfernt so bewegt und stürmisch wie in den Parallelgründungen Freiburg und Rottenburg, was vor allem daran lag, dass hier die Ideen der kirchlichen Aufklärung nur in gemildeter Form vertreten waren. In Nassau existierte zudem keine Landesuniversität, an der sich theologische Oppositionsbewegungen und Gegenmeinungen hätten verfestigen können. Der Großteil der Limburger Theologen studierte an den Universitäten Gießen, Würzburg und Mainz, für das „praktische Jahr“ vor der Priesterweihe wurde 1829 das Limburger Priesterseminar errichtet, dessen Ausbau zu einer Vollfakultät jedoch nicht gelang.[34]
Aber auch die Landesherrn der Oberrheinischen Staaten koordinierten ihr Vorgehen in Fragen der katholischen Kirche. Zuerst war dies 1830 der Fall, als in allen Staaten gleichlautende Verordnungen ergingen über die oberhoheitlichen Rechte des Staates über die katholische Kirche. Durch dieses Vorgehen war das Ende der Zeit der Konkordate eingeläutet: Die restaurierten Staaten waren nicht mehr bereit, ihr landesherrliches Regiment durch bindende Verträge mit Rom einzuschränken. Somit war den neuen Diözesen der Oberrheinischen Kirchenprovinz aber auch die „Rechtsunsicherheit in die Wiege gelegt. [...] Kirchliches Recht galt nur unter staatlichem Vorbehalt“[35].
3.2 Bischof Peter Joseph Blum - „DieMorgenröthe eines schöneren Tages“
In diesem vormärzlichen Spannungsfeld des Staatskirchentums war die Bischofswahl von 1842 eine Richtungsentscheidung für die Katholiken des Herzogtums. Die ersten zwei Limburger Bischöfe Jakob Brand (1827-1833) und Johann Wilhelm Bausch (1835-1840) gehörten noch einer Generation an, die in vorsichtiger Weise die Reformlinie einer gemäßigten kirchlichen Aufklärung fortzusetzen versuchte.[36] Die Bennennung eines Nachfolgers von Bausch markierte dagegen das Streben der katholischen Kirche und des Heiligen Stuhls an ihrer Spitze, sich von staatlichen Vorgaben zu befreien.[37] Die Bischofswahl 1840 wurde von Rom kassiert, denn sie war unkanonisch: Im nach Rom gesandten Wahlinstrument war vermerkt, dass Herzog Adolph von neun auf der Wahlliste stehenden Namen sieben gestrichen hatte; eine kanonische Wahl forderte aber mindestens drei Kandidaten. Zudem wurde im Wahlinstrument vermerkt, dass vor der Wahl die zwei verbliebenen Kandidaten Jakob Mohr, Dekan von Oberlahnstein, und Peter Joseph Blum, Pfarrer von Oberbrechen, befragt wurden, ob sie die Wahl annehmen würden. Auch das war nach kirchlichem Recht nicht erlaubt. Weil Blum die Befragung verneinte, wählte das Domkapitel am 9. Juli 1840 Mohr zum Bischof.[38] Noch vor der Entscheidung aus Rom war das Domkapitel durch einen Bericht des „Fränkischen Couriers“ schwerstens kompromittiert worden. Denn das Schlimmste an diesem „abgekarteten Spiel der nassauischen Regierung“ sei gewesen, so der „Courier“, dass kein einziges Mitglied es gewagt habe, sich durch förmlichen Protest zu distanzieren.[39] Die Protestbewegung gegen den staatskirchlichen Eingriff rührte also nicht von innerhalb des Gremiums der Bischofswähler her, sondern wurde von außen - zum einen von der kirchlich gesinnten „ultramontanen“ Presse, zum anderen von Rom - artikuliert und unterstützt.
Das Anbrechen einer neuen Zeit, eines neuen katholischen Geistes mit dem Amtsantritt Blums wird in allen historischen Darstellungen betont. Schon Heinrich Brück schrieb 1868: „Erst mit der Inthronisation des Bischofes Peter Joseph brach die Morgenröthe eines schöneren Tages für die Diöcese Limburg ein.“[40] Katholische Autoren lobten Blums starke persönliche Frömmigkeit wie seine kompromisslose Haltung gegenüber den
Ambitionen des nassauischen Staates. Doch woher kam diese Einstellung, die Blum so klar von seinen Amtsvorgängern unterschied?
Blum stammte aus Geisenheim, einer kleinen Stadt im Rheingau unweit von Rüdesheim. Dort wurde er am 18. April 1808 als drittes von acht Kindern des Schuhmachers Franz Anton Blum und seiner Gattin, der „schlichten Bürgerfrau“[41] Elisabeth geboren. Näher als dem Vater stand der Junge der Mutter, die ihre Kinder streng erzog; Höhler weiß dazu: „Die Ordnung im Hause und in Bezug auf den Besuch von Kirche und Schule wurde unerbittlich gehandhabt.[42] “ Peter Joseph begleitete seine Mutter „gar manchesmal“ in die Wallfahrtskirchen nach Nothgottes und Marienthal. Auch die vom Biographen Höhler oft erwähnte Wissbegierigkeit und der Studienfleiß schienen sich schon in jungen Jahren abzuzeichnen: „Ebenso beschäftigten ihn ihre Erklärungen beim Religionsunterrichte und er plagte sie oft mit seinem kindlichen Fragen so sehr, daß sie ihn kaum zu beschwichtigen wußte.“[43] Persönliche Förderung außerhalb des Familienverbandes fand Blum durch Heinrich Blum, einen Autodidakten in Diensten der gräflich Ingelheimschen Familie in Geisenheim, sowie durch Jakob Stassen, einen ehemaligen Kanonikus und Gymnasialprofessor aus Worms. Letzterer unterhielt in Geisenheim eine Privatschule, an der auch Peter Joseph Blum unentgeltlich eine Gymnasialausbildung erhielt. Der Junge bekam durch Blum und Stassen, diesen „Männern des Gebetes“ eine „tiefe, tätige und durchaus schlichte Gottesliebe“[44] vermittelt, was auch mit der religiösen Erziehung durch die Mutter korrespondierte. Eingebettet in diese einfache, aber dichte mystisch-religiöse Glaubenswelt verwundert es auch nicht, dass Höhler von Wachträumen oder Visionen des Jungen berichtet: Im Alter von sieben Jahren soll er sich selbst als „ehrwürdige Priestergestalt mit schneeweißen Haaren und gar liebem, zufrieden lächelndem Angesichte“ gesehen haben.[45] Solche Vorkommnisse hätten dazu beigetragen, so der Biograph weiter, seinem ganzen Denken von Kindheit an eine Richtung auf das Übersinnliche zu geben, die er bis zu seinem Tod bewahrt hätte. Diesen „träumerische[n] Zug in seinem Wesen“[46] bewahrte sich Blum auch in seiner Studienzeit zuerst in Würzburg, wo er ab 1826 Philosophie studierte, und dann in Bonn, wo er im Herbst 1827 das Studium der Theologie begann. Das Studium betrieb er eifrig und selbstzerstörerisch: In Nachtarbeiten, aufgeputscht durch starken Kaffee, versuchte er seine empfundene ungenügende Vorbildung durch Stassens Privatschule wettzumachen, wodurch seine Gesundheit schwer und teilweise dauerhaft (mit einem lebenslangen Augenleiden) geschädigt wurde.
Am 18. Mai 1832 empfing Blum von Bischof Brand die Priesterweihe. Schon Ende des Jahres begann er seine Lehrtätigkeit am im Aufbau befindlichen Limburger Priesterseminar. Er blieb acht Jahre in Limburg, wo er auch als Stadtkaplan und Domvikar wirkte und einen Sitz im Domkapitel besaß. Hier gehörte er zu den Kräften, die energisch auf Überwindung des staatskirchlichen Systems hinarbeiteten, was aber der nassauischen Regierung nicht bekannt wurde. Besonders engagiert war Blum aber in der Seelsorge, für die er prädestiniert schien, wie Höhler schreibt:
„Blum hatte eine eigene Gabe, zu den Herzen zu reden, sie aufzurütteln und zu begeistern; bei allem Ernste blieb er jedoch stets freundlich und mild. Kurz, das ganze Wesen und Wirken des jungen Priesters war so eigenartig, eindringend und gewinnend, daß er sich bald die Sympathie und das Vertrauen von Hoch und Nieder erworben hatte. [...] Wer mit ihm in Berührung kam, der fühlte sofort, daß der Geist Gottes ihn erfüllte.“[47] [48] Sein „innerster Herzenswunsch“ war es auch, Pfarrer in einer kleinen Dorfgemeinde zu werden.[49] Erschien ihm die vakante Pfarrei Hochheim am Main noch zu städtisch, so bewarb er sich für die Stelle im Dorf Oberbrechen in der Nähe von Limburg. Dort ließ man den qualifizierten jungen Mann nur ungern ziehen, empfahl ihn aber mit Rücksicht auf seine oft gestörte Gesundheit und seinen Vater, der bei ihm seinen Lebensabend verbringen wollte, der Regierung.[50] Das Leben als Gemeindepfarrer, das er am 1. April 1840 antrat, stellte ihn vor sehr verschiedene Herausforderungen: Er bemühte sich nicht nur, durch wohl ausgearbeitete Predigten „Leben und Bewegung in die religiös etwas erschlafften Gemüter seiner Pfarrangehörigen“ zu bringen, sondern musste sich auch mit rebellischen Kirchenvorständen auseinandersetzen und den Küster auf einen späteren Feierabend vertrösten, wenn er Samstags länger in der Kirche blieb, um Beichte zu hören; er nahm Beziehungen zu seinem evangelischen Kollegen in Kirdorf auf und an seinem Religionsunterricht in Oberbrechen nahm auch ein Junge jüdischen Bekenntnisses teil[51] ;
zuletzt war da auch noch seine wunderliche Haushälterin, die nach eigenem Bekunden in Kontakt mit übernatürlichen Mächten stand.[52]
In den zwei Jahren Tätigkeit in Oberbrechen trat Blum auch in Bekanntschaft mit Moritz Lieber[53], Advokat, Publizist und Legationsrat aus Camberg. Er gehörte neben dem Grafen Wilderich von Walderdorff und Max von Gagern wohl zu den politisch einflussreichsten Laienkatholiken des Herzogtums. Der Sohn eines vermögenden Teehändlers und Berater der Herzöge Wilhelm und Adolph übersetzte katholische Autoren ins Deutsche, so vor allem Joseph de Maistre und Thomas Moore. Überregionale Bekanntheit erlangte er durch seine Stellungnahme zum Kölner Ereignis. Schon 1831 hatte er sich in einer Streitschrift für Beibehaltung des Zölibats ausgesprochen und war dafür von Papst Gregor XVI. ausgezeichnet worden. In seinen Glaubensvorstellungen war er also konservativ und kirchentreu. Als nassauischer Legationsrat und Mitglied (später Präsident) der Ersten nassauischen Kammer (1858-1860) war er aber ebenso fest in das politische Leben des Herzogtums eingebunden.
Lieber war es auch, der Blum eindringlich dazu riet, die erneute Bischofswahl am 20. Januar 1842[54], wenn sie auf ihn fallen sollte, anzunehmen. Die widerstrebende Haltung Blums gibt Höhler wie folgt wieder:
„Es waren bittere Tage für den gequälten Mann. Man wies ihn auf die Folgen hin, welche eine neue Ablehnung seinerseits haben müsse, stellte ihm die Not der Zeit, das Vertrauen des Kapitels und des ganzen Klerus und die Wichtigkeit der Wal vor, alles Verhältnisse, welche klar den Willen Gottes erkennen ließen, daß er die Leitung der Diözese übernehmen sollte.“[55]
Die tatsächliche Wahl des Pfarrers von Oberbrechen zum nächsten Bischof von Limburg trat dann auch erwartungsgemäß ein und wurde von ihm angenommen. Bei seiner Inthronisation im Oktober 1842 war der neue Bischof erst 34 Jahre alt, seine Priesterweihe lag zehn Jahre zurück - ohne Zweifel kann man hier von einer „Blitzkarriere“ sprechen[56], die sicherlich durch die überschaubare Anzahl von geeigneten Amtkandidaten in dem kleinen Bistum begünstigt war. Mit Blums Wahl war aber auch der Generationswechsel auf der Leitungsebene der Diözese vollzogen: Die Zeit der späten kirchlichen Aufklärung war nun endgültig vorbei. Der Limburger Seminarist Mardner dichtete aus Anlass der Inthronisation Blums:
„Der Kirche wirst Du Deine Tage weihen,
Mit Macht den Feind, der ihr sich naht, bekämpfen;
Verlaßnen und Bedrängten Hülfe leihen,
Den Priester durch des Glaubens Flamme heben;
Verjüngt wird Deine Diözese blüh’n,
Und hoch des Christen Herz in Liebe glüh’n.
Durch Dich steh’n wir, wie Brüder im Verein,
Wir werden stark durch Einheit sein.“[57]
In diesen Zeilen scheint schon angekündigt, dass auch die bisherige Subordination der Kirche unter den Staat ihrem Ende entgegenging. Schon seinen Gehorsamseid gegenüber den Gesetzen Nassaus und der Freien Stadt Frankfurt legte Blum nur „salvo iure canonico“ ab, d.h. nur unter dem Vorbehalt, dass „aus demselben auf keinerlei Weise irgendetwas abgeleitet oder begründet werden könne, was mit denjenigen heiligen Verpflichtungen nicht vereinbarlich wäre, die ich als katholischer Bischof gegen meine Kirche habe.“[58] Das war eine programmatische Erklärung, die aber noch keine konsequente Strategie verfolgte. Der neue Bischof war zunächst ganz darauf bestrebt, das religiöse Leben, das von der „Kälte der rationalistischen Theologie“[59] bestimmt worden war, zu erneuern und „in jugendlichem Schwunge die Kirche von jenen staatlichen Anordnungen zu befreien, die eine Entfaltung der religiösen Kräfte erschwerten.“[60] Brück meint dazu: „Er glich einem Feldherrn, der sich jeden Fuß breit Landes erobern musste. So oft er irgend etwas unternahm, was zur Beförderung der Frömmigkeit und Religiosität gereichte, legte die nassauische Regierung ein Veto ein.“[61]
Der Hauptstreitpunkt zwischen Bischof und Regierung blieb bis zur Revolution 1848 das nassauische Schulsystem, die sogenannte „Simultanschule“[62]. Die konfessionelle Trennung des Schulunterrichts sollte nach Blums Ansicht aber zumindest überall dort eingeführt werden, wo mehrere Lehrer angestellt waren. Mit der Abschaffung des gemischt-konfessionellen „allgemeinen Religionsunterrichts“ 1844 konnte der Bischof zumindest einen Teilerfolg verbuchen.
3.3 Revolution und nassauischer Kirchenstreit
Die Revolutionsereignisse im Herzogtum 1848[63], Bischof Blums Haltung zu den Ereignissen[64], sowie der in die Reaktionszeit fallende nassauische Kirchenstreit[65] sind an anderer Stelle schon hinlänglich dargestellt worden, daher genügt es hier, für diese Arbeit relevante Aspekte zu akzentuieren.
Das Jahr 1848 war in der Diözese die eigentliche Geburtsstunde einer organisierten katholischen Laienbewegung mit politischem Engagement.[66] Die Vereinsgründungen nach Mainzer Vorbild (der „Centralverein für religiöse Freiheit“ sowie der „Piusverein für religiöse Freiheiten“) hatten zum Ziel, „die geistlichen Oberen in Wahrung und Beförderung der Interessen unserer heil. Kirch nach Möglichkeit zu unterstützen“[67]. Sie wurden sowohl vom Klerus als auch von einflussreichen Laien organisiert und unterstützt, so wurde Moritz Lieber durch seine enge Verbindung zum Mainzer Kreis zur Schlüsselfigur der nassauischen katholischen Vereinsbewegung.[68] Seit 1848 setzte Bischof Blum, der mit Lieber befreundet war, auf die Mobilisierung der katholischen Massen durch Petitionen.[69] Sein starker Rückhalt bei den Katholiken seiner Diözese half ihm bis zu seinem Tod immer wieder, seine Forderungen selbstbewusst zu artikulieren.
Die enge Zusammenarbeit von Blum und Lieber um das Jahr 1848 drückt sich auch darin aus, dass Lieber die Denkschrift der Würzburger Bischofskonferenz, der ersten synodalen Zusammenkunft nach dem Ende der Reichskirche, entworfen hat. Sie blieb für ein halbes Jahrhundert das kirchenpolitische Aktionsprogramm der Katholiken Deutschlands.[70] Auf die Würzburger Beschlüsse des deutschen Episkopats wird noch punktuell unter 5.3 eingegangen.
Im Zuge der Gewährung von neun Volksforderungen durch Herzog Adolph am 5. März 1848 erließ die nassauische Regierung am 7. März auch ein vorläufiges Pressegesetz, das die Zensur aufhob und die unbeschränkte Pressefreiheit einführte.[71] Dies führte zu zahlreichen Zeitungsneugründungen. In Limburg erkannte man darin eine Gefahr für Kirche und Staat und erließ am 24. Juni 1854 eine Anweisung an die Dekane[72], um dem Konsum der Blätter mit „anerkannt kirchenfeindlicher Tendenz“ entgegenzusteuern:
„Wir erinnern die Herren Pfarrer daran, Dem durch geeignete pastorelle Einwirkung öffentlich und privat mit allem Nachdrucke entgegenzuarbeiten, da es offenbar schwer sündhaft ist, die schlechte Presse durch Abonnement zu unterstützen und sich der Gefahr auszusetzen, durch tägliche Lektüre der giftigsten Verläumdungen und Herabwürdigungen der Lehren, Institute und Diener der Kirche unvermerkt irre gemacht zu werden.“
Die Lancierung der ersten katholischen Tageszeitung, des „Nassauischen Zuschauers“, am 1. Juli 1848 in Hadamar gegründet, schlug aber fehl.[73] Erst 1870 gelang die Etablierung einer solchen katholischen Zeitung für das Bistum Limburg mit Gründung des „Nassauer Boten“.
Dem liberalen Frühling folgte sukzessive ein staatlicher rollback von gegebenen Versicherungen der Freiheit. Bei dieser Durchsetzung seines monarchischen Herrschaftsanspruchs in möglichst reiner und unverfälschter Weise standen dem Herzog als Leitbild klar die vormärzlichen Verhältnisse vor Augen.[74] Doch dass die Erfahrungen von 1848 nicht rückgängig zu machen waren, zeigt nicht nur die Entfremdung der liberalen politischen Führungsschicht vom Herzog, sondern auch der in die Reaktionszeit fallende Nassauische Kirchenstreit (1853-1861). Er entzündete sich an der Praxis der Pfarrbesetzungen und der fehlenden Kompetenzabgrenzung zwischen Staat und Kirche; stand also im Kontext des Oberrheinischen Kirchenstreits[75]. Die katholischen Bischöfe der Provinz stellten sich gegen die langjährige Rechtspraxis, die aber nie von Rom offiziell anerkannt worden war, und wurden für dieses Vorgehen von den Regierungen als „revolutionär“ angeprangert. Anders als in Kurhessen, Hessen-Darmstadt und Württemberg, wo es bald zur Verständigung auf einen Modus vivendi kam, blieben die Fronten zwischen Staat und Kirche in Nassau und Baden verhärtet. Für die nassauische Regierung blieb Bischof Blum, der nach ihrer Ansicht „in vollständiger Auflehnung gegen die Regierung begriffen“[76] war, ein schwieriger Verhandlungspartner. Eine Einigung konnte 1861 nur in einer Kompromisslösung und in Berücksichtigung des auch in Nassau erstarkenden Liberalismus - ein Gegner sowohl der katholischen Kirche als auch des reaktionären Staates - gefunden werden. Trotz der Bescheidenheit des Erreichten, so bilanziert Schatz, wurde die Kirche jetzt nicht mehr als zu beaufsichtigender Untertan, sondern als Partner anerkannt. Die Unmöglichkeit, sich in Prinzipienfragen einig zuwerden, wurde anerkannt und dennoch wurde ein praktischer Modus des Miteinanderlebens gefunden.[77]
4. Der Anschluss an Preußen aus kirchenpolitischer Sicht
4.1 Nassaus Rolle im Krieg von 1866
Nassau hatte sich seit dem Wiener Kongreß außenpolitisch an Österreich orientiert. 1836 war das Herzogtum zwar dem deutschen Zollverein beigetreten, aber nach der Revolution von 1848 schwenkte Herzog Adolph ganz auf den österreichischen Kurs ein. Er war vom Trauma der Revolution geprägt, denn er konnte es nicht verwinden, dass ihn die Volksmassen zu einem liberalen Reformkurs gezwungen hatten.[78] Konsequenterweise stimmte Nassau 1866 im Bundestag für die Mobilmachung gegen Preußen.
Die Parteinahme zeigt deutlich die tiefe Diskrepanz zwischen den herzoglichen Vorstellungen und den Wünschen der Nassauer Bürger. Von Seiten der Wirtschaft war schon zuvor befürchtet worden, dass der Kurs des Herzogs zum Ausschluss Nassaus aus dem Zollverein führen könnte.[79] Das wäre fatal gewesen, denn die Hauptabnehmer nassauischer Exportgüter wie Eisenerz, Wein, Mastvieh, Marmor und Tonwaren (v.a. Krüge) waren die Zollvereinstaaten.[80]
Der Bruch trat offen hervor, als die Abgeordneten des Landtags mehrheitlich für eine Neutralitätserklärung und gegen eine Bewilligung von Kriegsmitteln stimmten. Doch Herzog Adolph ließ sich von dieser Entscheidung nicht beeinflussen (hier zeigt sich seine autoritäre Herrschaftsauffassung), musste allerdings zur Ausrüstung seiner Truppen eine Anleihe von 500.000 Gulden beim Frankfurter Bankhaus Rothschild aufnehmen.
Der Verlauf des kurzen Krieges im Sommer 1866 und die Übernahme der Regierungsgeschäfte in Wiesbaden durch den preußischen Zivilkommissar von Diest sind bekannt.[81] Am 3. Oktober 1866 erließ der preußische König Wilhelm das Patent, mit dem er Nassau und Frankfurt offiziell in Besitz nahm.
Die Einstellung der nassauischen Bevölkerung zur Annexion bleibt schwierig zu beurteilen. Hier müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden: 1.) Die politische Grundeinstellung (ob liberal oder konservativ); 2.) Wirtschaftlich-soziale Stellung (wohlhabende Unternehmer begrüßten die Wirtschaftsmacht Preußen eher freundlicher als andere Bevölkerungsteile [82] ); 3.) Bindung an und Sympathie für die nassauische Dynastie; 4.) Konfessionszugehörigkeit. Der letzte Faktor, der für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit besonders interessant ist, hatte aber wohl die geringste Auswirkung. Die traditionell-konservative Verankerung des politischen Denkens im großdeutschen Patriotismus war in katholischen Kreisen sicher stärker ausgeprägt als in protestantischen. Herzog Adolphs Österreichfreundlicher Kurs sowie der gefundene Kompromiss mit dem Limburger Bischof hatten zudem in den letzten Jahren den nassauischen Patriotismus vor allem im katholischen Bevölkerungsteil wachsen lassen. Im Gegensatz dazu lastete das Menetekel des Kölner Ereignisses noch auf dem preußischen Staat und war als antipreußisches Ressentiment bei Katholiken präsent. Aber letztlich einte eine Tatsache alle Bevölkerungskreise, nämlich die Art und Weise der Annexion. Sie wurde auf einer obrigkeitlichen Ebene durchgeführt, ohne die geringste Mitwirkung der Bürger (denkbar etwa in einer Volksabstimmung). So ist es nicht verwunderlich, dass diese sich nicht nur den kriegerischen Ereignissen, sondern auch der Annexion gegenüber größtenteils gleichgültig zeigten.[83]
Über die Stimmung in Frankfurt berichtet der katholische Stadtpfarrer Eugen Theodor Thissen in einem Brief an Karl Friedrich von Savigny[84]:
„Die Frankfurter Bürger können sich in der Einverleibung ihrer freien Stadt mit Preußen gar nicht zurechtfinden. Der Widerwille ist am größten bei denjenigen Leuten, die kein
politisches Urteil haben und sich nicht einmal klar machen können, was sie denn bei dem Verlust ihrer Selbständigkeit eigentlich verlieren. [...] Leider hat das Auftreten der Militärbehörde bei der Invasion und das Benehmen der Offiziere diesen „Patriotismus“ hervorgerufen [...]. Ich habe in der Privatseelsorge große Mühe, die Forderungen der Religion in dieser Beziehung einzuschärfen.“[85]
Thissen berichtet weiter, dass dieser Unmut auch von den Protestanten geteilt wurde. Ihre liturgischen Verhältnisse, d.h. explizit die Formel der Kirchengebete, wurden auf preußische Verhältnisse angeglichen. Daraufhin kam es in den protestantischen Kirchen zu „Exzessen, denen [...] gewiß noch größere folgen werden“.[86] Den „republikanischen Gemütern“ der Frankfurter passte dabei „die einem monarchischem Staat entsprechende Formel des Gebetes für die Landesobrigkeit“ nicht.[87] Die Konsequenz drückte ein protestantischer Bürger gegenüber dem katholischen Stadtpfarrer aus: „Bei uns wird es die Folge haben, daß man nicht mehr in die Kirche geht.“[88] Solche unmittelbar obrigkeitlichen Eingriffe in die Dinge der Kirche mit drastischen Konsequenzen waren katholischerseits nicht zu befürchten, denn der preußische Staat hatte nach dem Kölner Ereignis mit den Bischöfen schon längst einen modus vivendi gefunden. Demgemäss teilte die Staatsobrigkeit den Bischöfen ihre Wünsche mit, die dann ihrerseits die Verordnungen erließen.
An diesem Beispiel kann man also sehen, wie die vorhandene und so oft polemisierte hierarchische Organisationsform der katholischen Kirche auch stabilisierend einwirken konnte, indem sie neue politische Verhältnisse „von oben“ sanktionierte. Auf bestehende lokale protestantische Organisationsformen wurde hingegen direkt zugegriffen und eingewirkt, was bei den Gläubigen und Kirchgängern zu Missstimmung führen konnte. Welche Rolle speziell der Bischof von Limburg bei der Integration der katholischen Nassauer in den preußischen Staat spielte, soll im nächsten Kapitel ausführlich behandelt werden. Die folgenden Ausführungen geben Einblick in die Erwartungen des Bischofs an die preußische Staatsführung und sind wichtig für die Fragestellung nach der Einstellung des Klerus zu Staatsautoritäten.
4.2 Bischof Blums Hirtenbrief vom 15. Oktober 1866
Nur 12 Tage nach dem Annexionspatent verfasste der Limburger Bischof einen Hirtenbrief an seine Diözesanen und seinen Klerus, der auf allen Seiten für Überraschung sorgte. Der Inhalt entsprach so gar nicht der gemeinsamen Ansicht, der sententia communis der deutschen Katholiken, die auf dem Katholikentag von 1862 formuliert hatten, dass die kleindeutsche Zerstückelung des Vaterlandes durch Ausschluss des katholischen Kaiserhauses ein verdammungswürdiger Frevel sei.[89]
In seinem Hirtenbrief[90] ruft Blum seine Diözesanen dazu auf, sich nicht an dem „nicht selten mit verletzender Leidenschaftlichkeit geführten Meinungskampfe über den Grad der Berechtigung für die eine oder die andere Auffassung zu betheiligen“, sondern vielmehr die bereits vollzogene und von den übrigen deutschen und europäischen Fürsten anerkannte Annexion zu akzeptieren. Durch diese ,translaté sei dem neuen Landesherrn Wilhelm diejenige Ehrfurcht, Liebe, Treue und derjenige Gehorsam zu schenken, die vorher dem nassauischen Haus entgegengebracht wurden. Die nassauischen Katholiken könnten dies guten Gewissen tun, denn dem König sei „durch seine überwiegende Machtstellung vorzugsweise die große Aufgabe der nothwendig gewordenen politischen Regeneration Deutschlands zugefallen“. Außerdem sei es dem König anzurechnen, dass er „bei der vorherrschend ungläubigen Richtung unserer Zeit es laut und öffentlich bekennt, daß er seine Krone nicht der wechselnden Volksgunst, sondern der Gnade Gottes [...] verdanke“. Dieses „Bekenntnis der tief christlichen Weltanschauung“ (auf die konfessionellen Unterschiede ging Blum hier nicht weiter ein) korrespondiere mit der Stellung der katholischen Kirche in Preußen: sie habe „verfassungsgemäß und [...] factisch eine ihrer göttlichen Stellung und Sendung würdige Stellung“. Blums preußenfreundliche Ansichten kulminieren in folgender Passage:
„Es lassen sich diese Hoffnungen in der Einen zusammenfassen, daß durch eine weise und gerechte Kraftentwicklung Preußens Deutschland sich wieder zur ersten Macht Europa’s emporschwinge, und zwar nicht nur in Förderung der zeitlichen Wohlfahrt der menschlichen Gesellschaft [...], sondern auch in Förderung ihres ewigen Wohles durch Beschützung, Liebe und Verehrung des von Christus [...] gegründeten ewigen Reiches der Wahrheit und Gnade.“
Nach diesen Darlegungen blieb Blum nur noch der rückblickende „Ausdruck des aufrichtigen Dankes und der bleibenden Liebe und Verehrung“ für den nassauischen Herzog und den Frankfurter Senat.
Der entmachtete Herzog Adolph wiederum war über Blums Hirtenbrief sehr erzürnt und schrieb dem Bischof einen rügenden Brief[91], in dem er ihm Eidbruch und Opportunismus vorwarf. Blum habe bei seiner Amtseinführung 1842 dem Herzog und seinen Nachfolgern einen Treueid geleistet, aus dem ihn nur der Herzog hätte entlassen können. Die unkritische Aufnahme der neuen Obrigkeit, auch in die Gebetsformeln, bezeichnete Adolph als „eine offenbare Verletzung der angelobten Treue, die ich gerade von Ihnen, Herr Bischof, ich gestehe es offen, am wenigsten erwartet hätte.“ Seine verletzten landesherrlichen Gefühle und Erwartungen scheinen deutlich in folgender Passage durch: „Ich habe nie verlangt, daß Jemand sich mir und meinen Interessen zum Opfer bringt, - aber hätten Sie, Herr Bischof, auch nur versucht, dem Sieger gegenüber sich für die Heiligkeit des Eides zum Märtyrer machen zu lassen, hätten Sie dem Beispiel der heiligen Männer nachgestrebt, die Sie ja täglich in der Kirche preisen, welches schöne erhabene Beispiel hätten Sie Ihren Diözesanen gegeben, wie würden Sie geachtet vor der ganzen Welt dastehen!“[92]
Adolph bezweifelte, dass Blums Opportunismus weder dem preußischen König noch den Diözesanen gefallen könnte:
„Wissen Sie, was Ihre Diözesanen sagen? Gerade der bessere Theil der Geistlichkeit sowohl als auch der Laien, gerade der Theil, der es gleich ehrlich meint mit Kirche und Staat [...] ist in Verzweiflung. Glauben Sie denn, [...] daß derjenige, der sich durch seine größere Macht nun zu ihrem Landesherrn gemacht hat, ein großes Vertrauen zu einer Geistlichkeit haben kann, der einfach die Gewalt der Waffen und eine Aufforderung dazu genügt, die Treue zu verletzen?“
Als einzige mögliche Entschuldigung für Blums Verhalten führte Adolph an, dass sich der Bischof „in einem Augenblick der Schwäche“ wohl „durch Sophismen Anderer verleiten“ ließ. Seinen tadelnden Brief schließt der entmachtete Landesherr mit folgenden Worten, die verdeutlichen, welchen Grad von Respekt und Achtung er noch dem Bischof als religiöse Kapazität entgegenbringt:
„Nun ich wünsche Ihnen, [...] daß wenn dereinst das Stündlein kommen wird, in dem wir Alle die Hülfe Gottes am meisten gebrauchen, ebenso wie ich auf Seine Göttliche Gnade hoffe, diese auch Ihnen nicht fehlen werde, und daß Er Ihnen diesen Treubruch vergeben möge, sowie auch ich ihnen vergebe.“
Und wie reagierte die neue Landesherrschaft? Wilhelm hatte bei der Annexion Skrupel gehabt, denn er stieß schließlich einen legitimen Fürsten von seinem Thron. Doch Blums Hirtenbrief lieferte dem preußischen König, der immerhin, was nicht zu vergessen ist, das Oberhaupt (Summus episcopus) seiner protestantischen Landeskirche war, eine wichtige theologische Rechtfertigung[93], sowie eine vorzeigbare und gewichtige Stimme der Akzeptanz aus den neuen Territorien. Kultusminister von Mühler sandte Blum eine Antwort, dem auch ein kurzes Dankschreiben des Königs beigefügt war. Beide Schreiben zeigen, dass man in Berlin erfreut war, „wie richtig Eur. Bischöfliche Hochwürden die Aufgabe der kirchlichen Organe in den neuerworbenen Landestheilen erkannt haben, von ihrem Standpunkt dazu mitzuwirken, daß in den Gemüthern ein aufrichtiger Anschluß an die nach Gottes Fügung eingetretene neue Ordnung der Dinge angebahnt [...] werde“[94]. Wilhelms Brief wurde im „Königlich preußischen Staats-Anzeiger“ vom 5. Dezember 1866 abgedruckt.[95] Auch Königin Augusta, die im Oktober (während Blums Abwesenheit) durch Limburg reiste, ließ es sich nicht nehmen, dem Bischof schriftlich ihren Dank auszusprechen und ihn wissen zu lassen, dass sie sich freuen werde, seine persönliche Bekanntschaft zu machen.[96] Die Anerkennung des Königs drückt sich auch in der Verleihung des Kronenordens zweiter Klasse mit Stern an Blum zu dessen 25jährigem Konsekrationsjubiläum 1867 aus.
Wie Schatz herausgestellt hat, war die eigentliche Seele des preußenfreundlichen Kurses Generalvikar Karl Klein.[97] Der gebürtige Frankfurter und spätere Bischof von Limburg (1886-98) meinte im Oktober 1866 behaupten zu können, dass sich „die überwiegende Mehrheit [...] darüber freut, daß für uns die Kleinstaaterei mit ihrer Misere so Gott will für immer beseitigt erscheint“[98].
Dass nicht alle Geistliche der Diözese so kompromisslos wie Klein dachten, zeigt nicht nur der Fall des Pfarrers Mathias aus Niedertiefenbach, der sich geweigert hatte, den Eid auf König Wilhelm abzulegen.[99] Auch im Domkapitel gab es kontroverse Diskussionen. Klein hatte eine Huldigungsadresse an König Wilhelm im Namen von Bischof Blum verfasst.[100] Dieser sollte dem König den Ausdruck aufrichtiger Untertänigkeit und Treue (hier war „Liebe“ im Konzept schon gestrichen) „zu Füßen legen“ und versichern, daß nicht nur er diese Gefühle „unverbrüchlich bewahren und nach Kräften bethätigen“, sondern auch seine Diözesanen anhalten werde, sich als gute und treue Untertanen Preußens zu erweisen. Der weitere Text der Huldigungsadresse an den „allerdurchlauchtigsten, großmächtigsten König und Herrn“ war ebenso ehrfürchtig gehalten. Für die Mehrheit des Domkapitels war das zuviel, die Adresse wurde in der Sitzung vom 19. Oktober abgelehnt. In einer Erklärung[101] legt Domkapitular Johannes Zaun, Stadtpfarrer von Limburg, seine Gründe dar. Es liege „kein Anlaß vor, dem König von Preußen jetzt eine solche Huldigungsadresse zu senden. Dies dennoch thun, trotz der entgegenstehenden Sympathien und Äußerungen fast sämmtlicher Katholiken der Diözese, könnte leicht als Schmeichelei gedeutet werden und uns mit den AdvokatenDeputationen aus Dillenburg, Diez und Wiesbaden auf gleiche Linie stellen.“[102] Aus seinen aufrichtigen Gefühlen macht er keinen Hehl: Er hege keine Liebe und Anhänglichkeit für Wilhelm, der einen ungerechten Krieg geführt und das nassauische Vaterland an sich gerissen habe; seine Sympathien gehörten Herzog Adolph „in guten wie in bösen Tagen“. Besonders übel stieß ihm Kleins Sprachduktus auf: „Zudem liebe ich die Freiheit über alles und mag mich keinem Menschen weder bildlich noch wirklich zu Füßen legen und ähnliche Ausdrücke gebrauchen; im geistlichen Munde erscheinen mir solche Redensarten mindestens nicht angemessen.“
Zauns Befürchtungen, sich mit den preußenfreundlichen Verlautbarungen in ungewollte Gesellschaft zu manövrieren, mussten in der Reaktion der „Mittelrheinischen Zeitung“[103] ihre Bestätigung finden. Unter dem Titel „Der Hirtenbrief des Bischofs von Limburg über die Hohe Mission Preußens“ zog das Blatt in seiner Ausgabe vom 1. November 1866[104] seine ganz eigenen Schlussfolgerungen. Mit Polemik wurde dabei freilich nicht gespart; gleich zu Beginn des Artikel liest man: „Der Hirtenbrief des Herrn Bischofs von Limburg wegen Anschluß Nassaus an Preußen hat die gläubigen Schafe nicht sehr erbaut; man glaubte, die Sprache der Fortschrittler, nicht des apostolischen Hirten zu hören“. Im folgenden legt der Autor Blums Hirtenbrief ganz nach seinen kleindeutschen Aussagen aus:
„Da der Herr Bischof jetzt eine Wiedergeburt Deutschlands erwartet, und nach dem Ausspruche des Herrn Bischof Gott mit Preußen gewesen, so war das conservative Oesterreich das einzige Hinderniß der Neugestaltung Deutschlands und Gott hat also Oesterreich verworfen und Preußen erwählt.“
Mit kaum verhohlener Ironie drückt der Artikel die Begeisterung der Fortschrittler aus, dass der Bischof die „conservativ-clericalen Männer und treuen Anhänger der Kirche“ jetzt mit eigenen Mitteln schachmatt gesetzt hat:
„Jetzt, da der Herr Bischof selbst geredet hat, jetzt müssen alle Zweifel schwinden; denn der Bischof gehört zum unfehlbaren Lehramte der Kirche, ist also Bruchtheil der Unfehlbarkeit, und seiner Stimme muß die Herde folgen. [...] Wir wissen, daß der Laie nicht grübeln und fragen darf: warum? Sondern daß er glauben und vertrauen muß seinem Bischofe.“
Nach Erwähnung all dieser Widrigkeiten, die Bischof Blum entgegenschlugen, muss nun der eigentliche Sinn und Zweck eruiert werden, die er mit seinem Hirtenbrief verfolgte. In der Tat konnte es Blum nicht schnell genug gehen mit der Adaption der preußischen Verfassung. Berlin hatte ein Übergangsjahr vorgeschrieben, in dem die nassauische Verfassung wie in den anderen annektierten Staaten in Kraft bleiben sollte. Doch der Bischof wollte „mit allen Kräften dahin wirken, daß die Verfassungsbestimmungen über die Stellung der Kirche zum Staate schon in der allernächsten Zeit ins Leben träten“[105]. Er beauftragte Klein mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Denkschrift. Vor allem sollten die primären Streitpunkte zwischen dem Bischof und der nassauischen Regierung geändert werden, nämlich das simultane Schulwesen und die staatliche Verwaltung des Kirchenvermögens. Dem Hirtenbrief folgte diese Denkschrift, in der Blums Maximalforderungen niedergelegt waren, als Immediateingabe an den König in kürzester Zeit nach. Als Resultat wurde dem Bischof am 20. April 1868 das freie Besetzungsrecht für alle kirchlichen Stellen zugesprochen, und der Zentralkirchenfonds ging am 1. Januar 1869 in die Verfügung des Ordinariats über. Doch die Zugeständnisse der neuen Regierung blieben begrenzt. Preußen konnte nicht Ende noch Bruch wollen, sondern nur Abwicklung und Überführung, denn der Staatsgewalt muss altes Recht solange gelten, bis neues vereinbart ist.[106]
Aus den spezifischen Problemverhältnissen seines Landesbistums herkommend, verknüpfte Blum also mit der Annexion seine ganzen Hoffnungen auf bessere Verhältnisse für die katholische Kirche. Er stellte sich mit seinem Hirtenbrief realistisch auf den Boden der neuen Tatsachen, so wie es auch der geistige Wortführer des deutschen Episkopats, der Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler, später tat.[107]
Durch seine schnelle Entscheidung zugunsten Preußens kann man es Blum auch als Verdienst anrechnen, dass der „deutsche Bruderkrieg“ nicht im Nachhinein als Krieg der Konfessionen ausgelegt werden konnte. Er nahm den antikatholisch eingestellten Nassauern, die in der Kriegsentscheidung ein Gottesgericht zugunsten eines neuen protestantisch dominierten Staates erkennen wollten, den Wind aus den Segeln.
Der hoffnungsvolle Ausblick auf die zu erwartenden preußischen Kirchenverhältnisse war es wohl auch, die den Diözesanklerus mit Blums preußenfreundlichem Kurs versöhnten. Zu allererst wurde er freilich bei denjenigen unterstützt, die sich an der nassauischen „Kleinstaaterei“ gerieben hatten. Dazu gehörte neben Klein auch der Frankfurter Stadtpfarrer Thissen.[108]
In Frankfurt wurde der Brand des Kaiserdoms in der Nacht zum 15. August 1867 als Zeichen der neuen Zeit gedeutet. Ein Großbrand zerstörte dieses alte Symbol des Reiches wie des Frankfurter Bürgerstolzes - pikanterweise genau in der Nacht vor König Wilhelms erstem Besuch in der annektierten Stadt. Den zehn Tage später gegründeten Frankfurter Dombauverein, der sich dem Wiederaufbau verschrieb, sieht Ralf Roth als richtungsweisende Initiative von konfessionsübergreifender Kooperation.[109] Doch weitere solcher negativ auszulegender Vorzeichen blieben aus. Tatsächlich ist kein anderes Land, das im Jahr 1866 annektiert wurde, so reibungslos in Preußen aufgegangen wie Nassau.[110] Der Hirtenbrief von Bischof Blum trug dazu bei, mindestens im Diözesanklerus das Aufkommen einer starken preußenfeindlichen Partei zu verhindern. Dort sehnte man sich nicht, selbst nicht während des Kulturkampfes, nach dem früheren Staat zurück, wie das die „Welfenpartei“ im ehemaligen Königreich Hannover tat.[111]
Bevor in der Chronologie der Ereignisse fortgeschritten werden kann und wir uns den Ereignissen des preußischen Kulturkampfes im Bistum zuwenden, muss zuerst ein umfassender Blick geworfen werden auf das Glaubensleben der Diözesanen.
5. Das Glaubensleben der Diözesanen vor dem Kulturkampf
Ich bevorzuge bei Beschreibung der individuellen Religionsausübung den Begriff „Glaubensleben“ vor dem der „Religion“. Nach meiner Auffassung handelt es sich bei letzterer in erster Linie um die Ausarbeitung und die Lehre einer Theologie, während ich das „Glaubensleben“ als gelebten Glauben, als Anwendung der kirchlich-theologischen Lehre auf das individuelle Leben definieren will.
5.1 Probleme der Forschung
Es stellt sich in der Tat ein großes Forschungsproblem, wenn die Stellung des Klerus im Phänomen der katholischen Erneuerung beurteilt werden soll. Hier halten sich Ressentiments aus der Kulturkampfzeit erstaunlich lange, indem vereinzelt die katholische Erneuerung als eine zentral vom Klerus gelenkte Bewegung dargestellt wird. So z.B. bei Michael N. Ebertz, der Max Webers Herrschaftstheorie relativ unkritisch auf die Organisierung der Massenreligiosität überträgt. So kommt er zu dem Ergebnis, dass „die katholisch-religiösen Verhaltens- und Handlungsweisen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts [...] auf das enorme Interesse katholischer Autoritäten an der Erhaltung ihrer Anhängerschaft mittels der Anpassungsstrategie schließen [lassen]“[112]. Ebertz hat damit auch gleich ein Erklärungsmuster für die von ihm konstatierte fehlende Integration der Katholiken in den modernen Nationalstaat und die bürgerliche Gesellschaft gefunden. Sie sei nämlich ebenfalls Resultat dieser „bewussten ,Verzauberung der Welt’“, die „zur Stabilisierung des Bewusstseins von der Legitimität der katholisch-geistlichen Herrschaft“ beitrug.[113] Noch radikaler näherte sich 1973 Gottfried Korff dieser Frage. Nach seiner Darstellung des im ausgehenden 19. Jahrhundert populären Josefskults als Disziplinierungsmaßnahme der katholischen Arbeiterschaft stellt er die Frage, „ob in Anbetracht des nur noch ,manipulativ ausgedachten Einsatzes’ der Heiligenverehrung überhaupt noch von einer populären Frömmigkeitsform die Rede sein kann, ob sie nicht durch die kirchliche Verwaltung die Form eines bloßen Herrschaftsinstruments angenommen hat“.[114]
Für beide Positionen gilt, dass sie, ohne dies zu hinterfragen, die These eines „ultramontanisierten“ Klerus voraussetzen. Die Organisation und Lenkung der Volksfrömmigkeit konnte nach diesem Erklärungsmuster nämlich nur deshalb so erfolgreich sein, weil sich die Geistlichkeit in eine hierarchische Kette von Befehlsempfängern aus Rom gewandelt hätte.[115] Eine angemessene Beurteilung des Pastoralklerus, dem von vielen Seiten viel Bedeutung für die Entwicklung eines katholischen Milieus beigemessen wurde und wird, steht aber noch aus. Sicherlich kommen hier auch regionale Unterschiede stark zum Tragen. Deshalb möchte mich zuerst mit diesem Problem auseinandersetzen, indem ich allgemeine Forschungsergebnisse und empirisches Material aus der Limburger Diözese miteinander kombiniere.
Danach muss die von Bischof Blum erstrebte religiöse Erneuerung näher in den Blick genommen werden. Unablässlicher Bestandteil dieser war die Integration bzw. Kanalisierung der Glaubensbewegungen „von unten“ in die „offizielle“ Kirche. Dass sich diese Integration nicht nur auf das Wallfahrtswesen beschränkte, sondern auch andere wichtige Bestandteile des Glaubenslebens erfasste, wie z. B. durch Gründung von neuen, caritativen Glaubensgemeinschaften oder stärkere Ausrichtung der Kirche als „Dienstleister“ auch für untere Gesellschaftsschichten wie in Frankfurt, soll im folgenden ausgeführt werden. Leider hat sich die historische Religionsforschung bisher zu stark in spezialisierten oder mehr theoretisch geprägten Diskussionen verfangen, und einige Aspekte des Glaubens, die dem historischen Wandel unterlagen, der Kirchengeschichte überlassen, so dass nur wenige wirklich synoptische Darstellungen existieren.[116]
5.2 Die „Priester als Milieumanager“
Die kritische Wissenschaft hat, wie gesagt, bislang der Erforschung von Positionierungen der Geistlichkeit, d.h. ihre Verankerung in der Lebenswelt der Gläubigen und ihren Einfluss auf jene, zu wenig Beachtung geschenkt. 1996 hat Olaf Blaschke mit seinem Aufsatz über den Priester als „Milieumanager“[117] einen Anstoß zur Erschließung dieses wissenschaftlichen Desiderats gegeben. Erkennend, dass die massive Präsenz des Klerus in der katholischen Substruktur nicht in sozialstatistischen Daten aufgeht, versucht er durch Analyse der Substruktur, der religiösen Mentalität und des religiösen Amtscharismas die Möglichkeiten des Klerus an Fürsorge, Agitation und Manipulation innerhalb des Milieus zu bemessen.[118]
Zum Amtscharisma des Priesters ist der Umstand zu zählen, dass nach katholischer Lehre nur ein geweihter Priester dem Gläubigen die Sakramente spenden kann, er ist somit eine Art Mittler zwischen göttlicher Gnade und menschlichem Dasein. Blaschke nennt dies das „Korrespondenzparadigma“: „Im Priester realisierten und objektivierten sich die göttlichen Kräfte, mit denen er besonders im Ritual eine Identität herstellte, die den Laien verschlossen blieb.“[119] Diese sakrale Aura, die gleichzeitig Distanz und Vertrauen schuf, umgebe den Priester und habe die Laien beeindruckt.[120] Ansehen und damit Macht des Klerus über die Laienwelt seien im 19. Jahrhundert stark gestiegen und hätten dazu geführt, dass der Kleriker nicht nur als Kultvorsteher galt, sondern auch als Berater in allen Lebenslagen aufgesucht werden konnte.[121] Unterstützt von seiner Sakralisierung und entrückenden Charismatisierung wurden dem Klerus die Potenz und Kompetenz zugeschrieben, die wichtigsten Positionen der katholischen Laienwelt in Zentrumspartei, Vereinen, Literatur und Presse erfolgreich zu besetzen und bis ins 20. Jahrhundert mit einem Selbst- und Sendungsbewusstsein zu verteidigen, das sich von dem der Laien, wie qualifiziert auch immer, deutlich unterschied.[122]
Im 19. Jahrhundert entstand das Idealbild des volksnahen Pfarrers, worauf Margaret Lavinia Anderson hingewiesen hat. Sie bemerkte oftmals wiederkehrende Topoi wie Leutseligkeit, Frohsinn und Geselligkeit in den Lebensbeschreibungen von Klemens Maria Hofbauer und des Missionsvikars Eduard Müller.[123] Auch der Limburger Bischof Blum wird häufig als Mann des Volkes charakterisiert, ebenso wie der Frankfurter Stadtpfarrer Beda Weber. Diese Attribute, die den betreffenden Seelsorgern Popularität und Sympathie sicherten, minderten in den Augen der Gläubigen nicht ihr religiöses Charisma bzw. ihre religiöse Kompetenz, eher im Gegenteil.
Das im 19. Jahrhundert gewachsene Ansehen der Kleriker ist nämlich nicht nur Ergebnis der erstarkten, ultramontan ausgerichteten Kirchenhierarchie, sondern auch einer „Demokratisierung“[124] des Klerus: Im 19. Jahrhundert glich sich der soziale Hintergrund der Mehrheit der Geistlichen dem einer breiten Bevölkerungsschicht an - eine Folge der Säkularisation und der damit einhergehenden Auflösung der alten Reichskirche. Im 19. Jahrhundert treten uns damit übrigens auch völlig neue Bischofstypen entgegen. Eine adlige Herkunft war nun nicht mehr zwingende Voraussetzung für dieses Amt.
Tatsächlich entwickelte sich die Priesterrekrutierung im 19. Jahrhundert reziprok zur Bevölkerungsstatistik, sowohl in Nassau wie auch im Rest Deutschlands. Während zu Beginn des Jahrhunderts mehr Priester aus der Stadt kamen, sollte am Ende des Jahrhunderts die Mehrheit vom Land oder aus der Kleinstadt stammen. Demgegenüber war die deutsche Bevölkerung seit Beginn der Industrialisierung in einer Urbanisierung begriffen. Ebenfalls unproportional verhielt sich die wachsende katholische Einwohnerzahl zur Anzahl der Priester in der Diözese, wie Tab. 2 zeigt.
Tab. 2: Quantitatives Verhältnis von Laien und Priestern im Bistum Limburg 18371881[125]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Bistum war aufgrund dieser Entwicklung schon seit seiner Gründung auf den Zustrom von auswärtigen Priestern angewiesen. Nach der Säkularisation der Klöster war die Regierung zunächst bestrebt gewesen, die Angehörigen der Männerorden zum Priester „umzuschulen“ bzw. dafür zu sorgen, dass sie von den Gemeindepfarrern als Kapläne angestellt wurden. Diese Maßnahme, die hauptsächlich eine Kostenersparnis für den Staat bedeutete (denn das Kaplansgehalt war niedriger bemessen als eine Rentenfortzahlung[126] ), wirkte sich aber aufgrund des durchschnittlich hohen Alters der Mönche nicht dauerhaft positiv auf das quantitative Verhältnis aus.
Ein wichtiges Ziel von Bischof Blums Programm der religiösen Erneuerung war daher die Quantifizierung und Qualifizierung der Ausbildung. Zur Rekrutierung von Priesternachwuchs bestand seit 1852 ein bischöfliches Knabenkonvikt beim Gymnasium in Hadamar. Eine „Diözesan-Rettungsanstalt für gefährdete Knaben“ war ein besonderes Anliegen von Blum, sie wurde 1858 zunächst in Dernbach eingerichtet, dann über Montabaur nach Marienstatt verlegt.[127]
Aber auch die etablierte Geistlichkeit will der Bischof wieder stärker auf den Geist des Christentums verpflichten. Auf der Bischofskonferenz in Würzburg 1848 äußerte er sich bei der Diskussion um Wiedereinführung von Synoden dahingehend, „dass die Hauptaufgabe der synodalen Thätigkeit in unserer Zeit die reformatio cleri sein müsse.“ Denn: „Nur wenn sie [= die Geistlichen], die das Leben Jesu an sich darstellen sollten, vom Geist des Christenthums durchdrungen seien, werde dieses wieder zu grösserer Geltung kommen.“[128] Um diesen Geist in seinem Bistum zu stärken, setzte Bischof Blum auf „Fortbildung“. Auch nach ihrer Ausbildung und Weihe sollten die Limburger Kleriker die Möglichkeit haben, geistliche Übungen (Exerzitien) durchzuführen. Nach Wiederbelebung des Wallfahrtsortes Bornhofen durch Redemptoristen (s. 5.5), leiteten diese „wiederholt gemeinsame Priester- und Lehrerexerzitien für die Diözese zu grösster Erbauung der Teilnehmer“.[129] In 20 Jahren (1850-70) hielten sie laut Hauschronik „71 Kurse Exerzitien ausser dem Hause mit durchschnittlich 20 Vorträgen, 18 Kurse im Hause mit je 18 Vorträgen, 400 Exerzitien an einzelne (im Hause) mit 16 Vorträgen und ca. 45 sogenannte stille Exerzitien (ohne Vorträge)“.[130] Auch für Schatz bildeten die Priesterexerzitien einen Hauptpunkt in Blums geistlicher Erneuerung des Klerus.[131]
Zusammenfassend gesagt wollte Blum eine größere Spiritualisierung des Klerus erreichen, sein Biograph Höhler schrieb dazu:
„Allein dieser [= der Weltklerus] zählte neben einer kleinen Zahl von vortrefflichem Geiste erfüllte Männer nur zu viele andere in seinen Reihen, die wohl das, was sie als ihre Pflicht erkannten, vollbrachten, aber von dem inneren, verzehrenden Feuer, welches den Bischof erfüllte und rastlos vorwärts trieb, nur wenig besaßen.“[132]
Einfache Pflichterfüllung, wie gewissenhaft, korrekt und engagiert auch immer ausgeführt, war also nicht mehr oberstes Bewertungskriterium für einen „guten“ Pfarrer, er sollte sich vielmehr durch „inneres, verzehrendes Feuer“ des Glaubens auszeichnen. In diesem Umstand ruht übrigens auch die Hochschätzung des Mönchtums durch Bischof Blum.
All diese beschriebenen Entwicklungen und Maßnahmen deuten auf einen Prozess hin, den man, in Referenz zur stärkeren Aufsicht über die Geistlichen durch den Episkopat, häufig als „Ultramontanisierung“ umschrieben hat.[133] Man kann in der Tat nicht bestreiten, dass die Ausübung klerikaler Kontrolle, wie Blackbourn feststellt, das hervorstechendste Merkmal der in den 1850er und 1860er Jahren immer rascher voranschreitenden Wiederbelebung der katholischen Frömmigkeit war.[134] In der Limburger Diözese war es vor allem die „honestas clericalis“, die von Bischof Blum streng beachtet wurde. Wie Höhler schreibt, war er in diesem Punkt unerbittlich: „Unzeitige Milde kannte er nicht, wenn es sich um die Ehre Gottes und der Kirche handelte.“[135] Doch trotz dieser Haltung neige ich dazu, mit Anderson überein zu stimmen, dass sich statt „Ultramontanisierung“ ein wertneutralerer Begriff wie „Professionalisierung“ eher anbieten würde. Berücksichtigend, dass es im 19. Jahrhundert sehr wenige Berufe gab, die nicht strenge Unterordnung verlangten und keiner Aufsicht unterstanden, schreibt Anderson: „In Angaben zu Überwachungen und Prozessen konnte man [] den Versuch erkennen, eine Qualitätskontrolle einzurichten, wie es in jedem sich professionalisierenden Beruf geschieht.“[136] Zu einer heiklen Angelegenheit wird diese Qualitätskontrolle freilich dort, wo in elementare persönliche Grundrechte eingegriffen wurde, wozu z.B. auch die Gewissensfreiheit gehört. Doch für solche Fragen, das muss man auch betonen, war die katholische Kirche des 19. Jahrhunderts noch nicht in dem Maße sensibilisiert, wie wir es heute sind.
Eine wichtige Wende, die den steigenden Einfluss der Priester als Milieumanager erkennen lässt, trat im Frankfurter Katholizismus mit der Tätigkeit von Beda Weber[137] als Stadtpfarrer (von 1849 bis 1858) ein. In der ehemaligen Hauptstadt des Deutschen Bundes war seit der Reformation der lutherische Bevölkerungsteil in der Überzahl und in Senat und Rat fast ausnahmslos tonangebend. Mitte des 17. Jahrhunderts erlebte die Handelsmetropole eine Einwanderungswelle von italienischen Kaufmannsfamilien. Einige dieser katholischen Familien brachten es zu einem ansehnlichen Reichtum und sollten auch noch in der Folgezeit, nachdem Kontroversen über ihren rechtlichen Status geklärt waren, eine bedeutende Rolle spielen.[138] Zu dieser Gruppe sind die Familien Guaita, Brentano, Bellini und Bolongaro zu zählen. Wenn sich aus diesem „Kaufmannskatholizismus“ im 19. Jahrhundert auch die meisten katholischen Bürger der Stadt rekrutierten, so waren 1858 von den insgesamt 14.000 Katholiken in der Stadt der größere Teil (nämlich 9750) Fremde im Sinne des damaligen Bürgerrechts, d.h. Einwohner ohne Bürgerpatent.[139] Diese katholischen Fremden waren mehrheitlich Dienstboten, die aus 50 bis 150 km entfernten Regionen stammten, so dass sich die Gemeinde (wie keine andere in Frankfurt) in ihrem Innern durch eine hohe soziale Spannung auszeichnete.[140] Dem Tiroler Benediktiner Beda Weber, 1848 als Abgeordneter des Wahlkreises Meran nach Frankfurt gekommen und 1849 von Bischof Blum zum Stadtpfarrer ernannt, gelang die Synthese durch Herausbildung eines eigenen katholischen Selbstbewusstseins in der Stadt. Weber betrachtete seine Aufgabe als „Dienst an der Gemeinde“, er versuchte „als erstes, eine Atmosphäre des Vertrauens zwischen dem Seelsorger und der ausgedehnten Gemeinde zu schaffen, den religiösen Sinn zu wecken, das durch die gegebene Situation verursachte Minderwertigkeitsgefühl zu beseitigen und die Gleichgültigen aufzurütteln“[141]. Dadurch wurde Weber zur zentralen Figur der katholischen Erneuerung in der Frankfurter Gemeinde. Er ergriff einige scheinbar einfache Maßnahmen, die aber ein hohes persönliches Engagement voraussetzten: zum einen die Intensivierung der Seelsorge durch Einführung von Frühgottesdiensten für Dienstboten, von sonntäglichen „Christenlehren“, wöchentlichen Schulmessen und regelmäßigen Krankengottesdiensten im Hospital zum Heiligen Geist, zudem regte er die sozialcaritative Vereinsarbeit an; zum anderen engagierte er sich im Pressewesen.[142] Uber Webers Bemühungen, in Frankfurt eine jesuitische Volksmission abzuhalten, soll in 5.3 noch näher eingegangen werden.
5.3 Volksmissionen
Im Herbst 1848 versammelten sich die deutschen Bischöfe in Würzburg, um über die aktuellen Geschehnisse, nämlich der im März ausgebrochenen Revolution, und die Herausforderungen, die diese der katholischen Kirche stellten, zu beraten. Denn die katholische Kirche war trotz aller Zwistigkeiten, die sie mit einigen Landesfürsten austrug, dennoch eine zutiefst konservative Kraft. Das Bündnis zwischen Thron und Altar war zu keiner Zeit gefährdet. Staat und katholische Kirche verfolgten ein gemeinsames prinzipielles Ziel, dass sie in einer gemeinsamen Sprache ausdrückten, nämlich in der Formel „Ruhe und Ordnung“. Wie Schieder anhand der Trierer Rockwallfahrt herausstellt, ist dies die Standardformel der restaurativen Herrschaftsideologie.[143]
Auch für Kardinalstaatssekretär Giovanni Soglia-Ceroni sollte auf einer Konferenz des deutschen Episkopats weniger über eine geistige Auseinandersetzung mit den neuen Ideen oder eine Anpassung der Kirche an die Erfordernisse der Gegenwart beraten werden, sondern hauptsächlich das Bemühen um die Abwehr des gefürchteten Zeitgeistes im Zentrum stehen.[144] Auf ihren Beratungen trugen die deutschen Erzbischöfe und Bischöfe gemeinsam die Erkenntnis, dass eine außerordentliche Kampagne von Volksmissionen das Vertrauen, die Folgsamkeit und die Ordnung unter den Katholiken in ganz Deutschland wieder herstellen würde. In Nummer 44 der Würzburger Beschlüsse erklärten sie, „daß die Volksmissionen nützlich und in gegenwärtiger Zeit höchst wünschenswerth sind, um das erschlaffte kirchliche Leben wieder zu erwecken“.[145] In einer solchen „systematischen] und dramatisch[en]“ und „anti-aufklärerischen Kampagne gegen Materialismus, Rationalismus und Liberalismus“[146] sahen sie den besten Weg zu einer Uberwindung der herrschenden Missstände, die nach ihrer Ansicht aus einem fehlgeleiteten Zeitgeist resultierten. Die Kirche operierte hier also nach einer ZweckMittel-Rationalität: Je größer und außerordentlicher die Herausforderungen der Zeit an sie waren, desto größer und außerordentlicher mussten auch die Maßnahmen sein, diesen Herausforderungen der Zeit zu begegnen. Auch Bischof Peter Joseph Blum trug diese Auffassung, „dass die gewöhnliche ordentliche Seelsorge, wie immer gewissenhaft und eifrig ausgeübt, in unsern Tagen nicht mehr ausreiche, um dem immer wachsenden Unglauben und Sittenverderbniß mit Erfolg zu steuern, dass es vielmehr hierzu der Anwendung außerordentlicher Mittel bedürfe“.[147]
Wenn also die Ereignisse von 1848 der unmittelbare Auslöser für die Wiedereinführung der Volksmissionen waren, so blieben sie allerdings nicht auf den engen zeitlichen Rahmen der Reaktionszeit begrenzt. Vielmehr wurden sie seitdem immer wieder durchgeführt. Im folgenden sollen aber nur die ersten Volksmissionen in Limburg und Frankfurt, die eine aufgrund ihrer Neuartigkeit eine besondere Stellung einnahmen, besprochen werden.
Im Bistum Limburg starteten die Volksmissionen 1850 in der Residenzstadt. Eine detaillierte Darstellung von Gisbert Lieber[148], Bischof Blums Sekretär und ein Augenzeuge, wurde noch im selben Jahr publiziert. Sein „Andenken an die ersten Missionen in der Diöcese Limburg“ will „die innere Bedeutung der Missionen, nämlich die außerordentliche Kraft der Wiedererweckung des Glaubens und des religiösen Lebens [...] überzeugend darstellen“.[149] Er schreibt dazu:
„Während man nichts eifriger erstrebte, als die Kirche der tiefsten Erniedrigung entgegenzuführen, sahen wir die Glieder derselben offen vor den Augen des erstaunten Vaterlandes in großartigen Versammlungen auftreten und hörten sie das Bekenntniß treuer Anhänglichkeit an die Kirche, an deren Glauben und Leben mit der wärmsten Begeisterung aussprechen.“
Am Nachmittag des 4. Februar, dem Fest Mariä Reinigung, läuteten die Glocken des Limburger Domes zum Beginn der Volksmission. Sechs Redemptoristenmissionäre zogen „in ihrem einfachen schwarzen Ordenskleide, ein Kreuz im Gürtel, bescheiden und anspruchslos“[150] in den Dom ein. Nach Intonation von „Komm heiliger Geist“ übertrug ihnen der Stadtpfarrer von Limburg für die Dauer der Mission seine Vollmachten über die Gemeinde. Die erste Predigt des Pater Superior erklärte „in schlichter und einfacher Weise, was eine Mission sei, und was sie bezwecke“: Die Gläubigen sollten in dichter Folge über die Glaubenswahrheiten belehrt werden, damit sie „im Hinblicke auf diese [...] einmal recht ernst Einkehr nähmen in unser Herz und uns wieder bewusst würden, was wir als Christen sollen und wollen“.[151] Dreimal am Tag (7, 13 und 16 Uhr[152] ) wurde eine Predigt gehalten, die „meist eine Stunde, oft noch länger“ dauerte. Nach Liebers Angabe waren in den letzten Tagen der Mission 8000-10.000 Menschen im Dom versammelt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Limburger Mission schon die umliegende Gegend erfasst: „Aus mehr als zwanzig Ortschaften bis auf 4-5 Stunden im Umkreise kamen die Landleute herbei.“[153]
Die Mission war ein solcher Erfolg, dass selbst der in die Zeit fallende Fasching nur wenige Menschen zum Feiern animieren konnte. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, welchen Stellenwert diese traditionelle „Fünfte Jahreszeit“ im katholischen Kalender einnahm. Aber den wenigen maskierten Limburgern, die sich auf der Straße zeigten, wollte „nicht einmal die Schuljugend“ nachziehen.[154]
Während die Redemptoristen 1850 nach Limburg in den traditionell katholischen Landgemeinden des Westerwalds missionierten, oblag den Jesuiten die Durchführung der Mission in den Städten.[155] In der Region hatten die Jesuiten schon in Mainz, Heidelberg und Worms missioniert, im April 1852 waren sie in Wiesbaden zu Gast.
In Frankfurt führten drei Jesuiten (Roh, Haßlacher und Pottgeißer) die Volksmission im November 1852 durch. Man kann sich leicht die Aufregung vorstellen, die dadurch in der mehrheitlich protestantischen und republikanisch-liberalen Stadt entstand, war doch der Jesuitenorden für liberale Zeitgenossen der Inbegriff für alles Obskur-Dunkle im Katholizismus und der katholischen Kirche gleichermaßen. Mit spöttischer Ironie beschreibt Stadtpfarrer Beda Weber das Erstaunen der Deutschen, die ab 1848 feststellen mussten, dass die Jesuiten „verwundersamer Weise Leute ohne Pferdefuß“ waren und überdies „Feinde alles finsteren Wesens, aller nutzlosen Religionsgrübelei, duldsam im Umgange mit Andersdenkenden“[156]. Dennoch wollten die Katholiken Frankfurts mit der Durchführung einer Volksmission auf einen günstigen Zeitpunkt, d.h. den Zustand eines konfessionellen Friedens in der Stadt, warten. Als man aber sah, dass dieser Beschluss den ausgemachten Gegnern, namentlich den liberalen Zeitungen und Politikern, in die Hände spielte, gab man diesen Beschluss auf: „Die Jesuitenmissionäre wurden berufen, um von unserer Seite ihren erbitterten Gegnern wenigstens Gelegenheit zu geben, die Wirklichkeit mit ihrem Conterfei im Frankfurter Journal zu vergleichen.“[157] Dass die Volksmission nicht nur ein Mittel zur religiösen Erneuerung war, sondern auch ein öffentliches Zeichen setzen sollte, scheint bei Webers Beschreibung des Zustandekommens der Frankfurter Mission durch: „Unzählige Katholiken“ hätten sie gewünscht, um „einerseits die große Erbauung solcher Geistesübungen für’s eigene Herz zu benützen, andererseits dadurch ein öffentliches Bekenntniß ihrer Anhänglichkeit an die römisch-katholische Kirche abzulegen.“[158]
Die Volksmission in Frankfurt dauerte 14 Tage. Weber zufolge empfingen ca. 6000 Menschen die Sakramente der Buße und Kommunion. An jedem Tag der Mission wurde von den Jesuiten drei Predigten gehalten, die „vom ersten Augenblick an eben so stark von Katholiken als Protestanten besucht“ waren[159]. Im Dom versammelten sich 60008000 (bei ca. 12.000 katholischen Einwohnern) Menschen aus der Stadt und dem umliegenden Land, er war „fast immer dergestalt überfüllt [...], daß erst nach dem Gottesdienste bei allmähliger Entleerung an’s Herauskommen zu denken war“. All das vollzog sich laut Weber in störungsfreier Ruhe, so dass auch kein Polizeieinsatz zur Wahrung der äußeren Ordnung nötig war. Er will sogar öfter gesehen haben, wie sich Katholiken und Protestanten nach der Predigt umarmten und in tiefer Ergriffenheit ausriefen: „Ja, das ist wahr; davon bin ich jetzt vollkommen überzeugt!“. Letztere sollen außerdem über die „Innigkeit des katholischen Kirchenlebens“, die „Macht der katholischen Lehre“ und den „Geist der Missionäre“ gestaunt haben.[160] Welche Wirkung die Volksmission in Franfurt hatte, bleibt schwer einzuschätzen. Die Veranstaltung scheint nahe am Grad eines Spektakels balanciert zu haben. Weber überliefert den Ausspruch eines Teilnehmers: „Ein Anderer meinte, eine solche Mission sei doch eine köstliche Sache, und als Abendunterhaltung ohne Geldverlust einzig in ihrer Art.“[161] Andere kamen, um sich lebende Jesuiten anzusehen und vielleicht schließen sich danach einige der Meinung eines Teilnehmers an: „Ganz adäquate Leute, das muß ich sagen!“[162] Sicher half die Volksmission aber den Frankfurter Katholiken, ein positiv besetztes Selbstbewusstsein auszubilden, was von Stadtpfarrer Weber schon vorher unterstützt worden war (s. 5.2). Er selbst drückt dies so aus:
„Die Katholiken konnten den Jubel ihres Herzens nicht verheimlichen, dass die Wahrheiten ihrer heiligen Kirche so siegreich dargelegt und verfochten wurden. Ihr Lied nach der Predigt erwuchs daher zu einem Sturm der Freude, des Einklanges, der Seligkeit, daß selbst die fühllosesten Herzen gerührt und erschüttert wurden.“[163] Zur Schau getragener Stolz auf die eigene Konfession und mit Stolz ausgelebte Konfessionalität - besonders in der Stadt, wo der Einfluss der Pfarrer allgemein im Sinken begriffen war[164], kam der Volksmission sicher eine herausragende Stellung innerhalb der Rechristianisierungs- und Rekonfessionalisierungsbestrebungen der Kirche zu.
Es wäre dabei durchaus lohnend, eine genauere Untersuchung en détail über die Auswirkung der Frankfurter Volksmission auf die protestantischen Stadtbewohner anzustellen, die ja nach Webers Zeugnis auch am Geschehen im Dom teilnahmen. Es wäre kurzsichtig anzunehmen, dass sie unbeeindruckt und passiv dem Geschehen folgten oder dass sich die protestantische Geistlichkeit gegenüber der jesuitischen Konkurrenz geduldig abwartend verhielt. Michael Gross nennt neben anderen Gründen für die Teilnahme von Protestanten an den Volksmissionen (Neugierde, Unterhaltung, Auseinandersetzung mit katholischen Lehren zu „Studienzwecken“) auch das religiöse Bedürfnis: „In the absence of an organized campaign for Protestant revival, Protestants all over Germany continued to be drawn to the Catholic missions for Christian instruction.“[165] Auf der anderen Seite reagierten, wie Gross weiter anführt, protestantische Pastoren und Kirchenführer auf das katholische „Revival“ und die Konkurrenz der Missionen mit „einer Flut von antikatholischen, antiklerikalen und antijesuitischen Predigten und Pamphleten“.[166]
Gross legt bei seiner Darstellung und Analyse der Volksmissionen viel Gewicht auf die eindrucksvollen Predigten der Jesuiten, die vor allem von den grundlegenden Glaubenslehren des Katholizismus handelten.[167] Leider wägt er bei seiner Darstellung des
„theatralischen Stils“ der Predigten nicht scharf genug ab zwischen zeitgenössischer Polemik und vorurteilsfreien Augenzeugenberichten. Vor allem die jesuitischen Predigten über die Höllenqualen hätten, wie Gross formuliert, Männer und Frauen zusammen brechen lassen: „Sie waren panisch, keuchten, jammerten und erhoben ihre Arme über ihre Köpfe, auf ihre Knie niedergefallen und weinten wie Kinder.“[168] Schon Beda Weber hingegen versuchte, solcher Kritik entgegenzuwirken:
„Die Jesuiten wenden sich nicht an’s Gefühl der Erregbaren im Sturm einer kecken Phantasie ohne Grund und Beweis. Ihr Vortrag ist ein Muster von ruhiger Darstellung, wo zuerst der Verstand, sodann das Herz für das Christenthum gewonnen wird. Kein Mensch bekommt bei ihren Predigten Anfälle von Ohnmacht, Niemand wird aus Höllenfurcht wahnsinnig, Keiner untauglich für’s irdische Geschäft.“[169]
Wie theatralisch oder vernünftig die Predigten wirklich waren, lässt sich aus heutiger Sicht nur schwer beurteilen. Selbst wenn uns Texte überliefert sind, können wir doch nicht mehr nachvollziehen, in welcher Weise sie vorgetragen worden sind, ganz zu schweigen vom flankierenden sinnlichen Gesamteindruck einer Volksmission. Sicher ist aber, dass diese Predigten keinen Raum ließen für theologische Problemstellungen akademischer Prägung. Dafür spricht zum einen die Art der Veranstaltung als katholische Rechristianiserungsmaßnahme und andererseits die Ausrichtung der Predigergruppe. Die Jesuiten waren die stärkste Trägergruppe des Ultramontanismus und Repräsentanten der katholischen Tradition. Von ihnen erwartete man „den Weltton der allgemeinen katholischen Kirche aus allen Völkern und Zeiten, den Gesamtausdruck katholischer Ueberzeugungen“[170] zu hören. Hier stellten die Jesuiten und auch die Redemptoristen auch eine innerkirchliche Konkurrenz zum Pfarrklerus dar, der von der unmittelbaren Volksmission weitgehend ausgeschlossen blieb. Der Jesuitenorden stellte die institutionalisierte intellektuelle Elite der katholischen Kirche dar, ihre Ausbildung war nicht vergleichbar mit derjenigen der einfachen Pfarrer. Dazu kommt, dass das Predigen in der Kirche nur ein Teilsaspekt der seelsorgerlichen Arbeit eines Gemeindepfarrers war. Er verbrachte viel mehr Zeit mit anderen Aspekten des Berufes, darunter vor allem mit denjenigen, die mit den zu spendenden Sakramenten zu tun hatten: Taufe, Kommunion, Firmung, Hochzeit, Krankheits- und Sterbefällen. Auch die organisierten Laienaktivitäten im Gemeindeleben wurden in zunehmendem Maße oft vom Gemeindepfarrer betreut.
Anders als Gross sieht Anderson vor allem die Möglichkeit zum Ablegen der Beichte als ausschlaggebenden Faktor für den Erfolg der Volksmissionen. Das Bewusstsein für sündhaftes Verhalten (nach Gewissenserforschung) und danach das Eingestehen desselben gegenüber anderen sei eine wichtige Voraussetzung für eine religiöse Erneuerung. Dieses Muster sei nicht nur bei den Katholiken zu beobachten, sondern auch im amerikanischen, besonders methodistischen Revivalismus.[171] Tatsächlich wurde die Möglichkeit zum Beichtablegen ebenso stark in Anspruch genommen wie das Hören der Predigt. Der Augenzeuge Gisbert Lieber beschreibt das Szenario in Limburg, das sich auch in anderen Missionsorten einstellte:
„Der Zudrang zu den Beichtstühlen war unbeschreiblich groß; um 3 Uhr Morgens schon weckten die guten Leute den Küster aus dem Schlafe auf, damit er ihnen die Kirche öffne; Viele standen von Morgen bis Abend mehrere Tage hindurch am Beichtstuhle, und sie brachen in lautes Weinen aus, wenn es ihnen nicht gelang, bei einem Beichtvater anzukommen.“[172]
Lieber vergisst dabei nicht zu erwähnen, dass es die Missionspredigten waren, die die Menschen in die Beichtstühle trieb, um dort eine Generalbeichte abzulegen:
„Wie aber, wenn diese Mission gerade die letzte Gnade wäre, welche Gott dir zu geben beschlossen?! - Dies die Wahrheit, die uns in einem nicht minder erschütternden Vortrag, als der vorhergehende gewesen, ebenso dogmatisch scharf als populär entwickelt und in sehr treffenden Beispielen veranschaulicht wurde.“[173]
Dieser erzeugte „Geist der Reue und Buße“ scheint eine regelrechte Obsession nach dem Abnehmen der Beichte durch einen Priester hervorgerufen zu haben, so wie er auch nach Liebers Zeugnis dazu führte, dass sich die Gläubigen dem Priester verstärkt auch außerhalb des Sakraments anvertrauten:
„Und wenn es ihnen, bei der übergroßen Menge der Beichtenden nicht gelang, zur Beichte zu kommen, so zogen sie den Priestern nach in alle Winkel des Hauses; mit Thränen in den Augen, mit aufgehobenen Händen baten und flehten sie, nur der Last sie zu entledigen, welche sie auf dem Herzen trugen, und die sie jetzt nicht selten ohne allen Rückhalt auch selbst außer der Beicht dem Priester entdeckten.“[175]
Aufgrund dieser Beschreibungen fällt es schwer, zwischen einer größeren Bedeutung der Predigten oder der Beichte abzuwägen. Erstere ist als Sensibilisierungsmaßnahme für sündhaftes Verhalten durch die Geistlichkeit zu sehen, letztere als individuell vollzogene religiöse Erneuerung unter „Zuhilfenahme“ eines Geistlichen, die freilich nicht losgelöst von einem kollektiven Rahmen zu verstehen ist.
5.4 Bruderschaften und religiöse Vereine
Schon unter 3.3 wurden verschiedene Initiativen zu katholischen Vereinsbildungen im Jahr 1848 erwähnt. Mit ihrer Verquickung von politischen Forderungen nach bürgerlichen und kirchlichen Freiheiten sind sie Frühformen des organisierten politischen Katholizismus, der sich später in der Zentrumspartei sammelte. Doch neben diesen klar politisch ambitionierten Vereinen bildeten sich nach 1848 auch sozialcaritative Vereine, sowie spezielle Vereine für bestimmte Bevölkerungsgruppen (Gesellenvereine, Müttervereine, Jungfrauenkongregationen, Katholischer Kaufmännischer Verein, Dienstbotenverein, Arbeiterverein, Männerverein)[176].
Einen weiteren Aufschwung, der anders als 1848 gänzlich unpolitisch geprägt war und blieb, gaben den Laienbündnissen die Volksmissionen. Nach deren Ende wurden sogenannte Tugendbündnisse gegründet, um das neue religiöse Bewusstsein auch in die Folgezeit zu retten. Sie sollten, wie Gisbert Lieber es formuliert, „gewissermaßen der Heerd [sein, L.W.], auf welchem das hl. Feuer der Mission in steter Gluth bewahrt wird, und von welchem aus immer neue Wärme, immer neue religiöse Innigkeit und Begeisterung in die ganze Gemeinde ausströmt“[177]. Dazu findet sich in den Akten des Limburger Ordinariats eine Anweisung an die Dekane vom 27. Februar 1856, „Die Errichtung von Jugendbündnissen betreffend.[178] “ Darin wird das „lebhafte Verlangen“ des Bischofs ausgedrückt, „diese heilsamen Vereinigungen überall [...] entstehen und unter sorgsamer pastoreller Pflege zu rechter Blüte gedeihen zu sehen“. Folgende ausführliche Begründung soll wiedergegeben werden, weil sie gut Blums Intention und seine pädagogisch-seelsorgerliche Perspektive erklärt:
„Seine Bischöfliche Gnaden hegen [...] die tiefbegründete [...] Ueberzeugung, daß die fraglichen Tugendbündnisse ein unter den Verhältnissen der Gegenwart vorzüglich geeignetes, ganz im Geiste der Kirche gelegenes Mittel sind, um die Segnungen der Missionen in den Pfarrgemeinden zu erhalten und fortzupflanzen, namentlich aber die heranreifende Jugend, auf welcher die Hoffnung einer glücklichen Zukunft der Kirche ruht und die eben darum zu jeder Zeit der Gegenstand der zärtlichen Liebe, der aufopfernden Fürsorge aller seeleneifrigen Priester und wahrhaft von dem Geiste Christi erfüllten Hirten gewesen ist, gegen die zahllosen Gefahren, welche sie dermalen leider noch fast allerwärts in erhöhtem Maße umgeben und ihr irdisches Lebensglück wie das ewige Heil ihrer unsterblichen Seelen zu untergraben drohen, möglichst zu schützen und auf die gesegnete Bahn ächter christlicher Tugend und Frömmigkeit zu leiten. “
Um die gewünschte Verbreitung der Bündnisse zu begünstigen, hatte man sich in Limburg entschlossen, die Mitgliedschaft für die Jugend etwas leichter zu gestalten. Die Teilnahme an Tanzvergnügungen sollte prinzipiell nicht verboten werden, da man beobachtet hatte, dass die Mitglieder der Tugendbündnisse trotzdem an solchen Veranstaltungen teilgenommen hatten. Ein solcher Interessenskonflikt führte eher zum Ausstieg der Jugendlichen aus den Bündnissen als zur Aufgabe der Vergnügungen. Hier lagen die Grenzen der sittlich-religiösen Erneuerung, die die Volksmissionen herbeiführen wollten, wie auch Gross bei seiner Analyse des Einflusses der Volksmission feststellt: „Das Tanzen blieb unauflösbar verwoben in die Struktur des sexuellen und religiösen Lebens von bäuerlichen Gemeinden in ganz Zentraleuropa, und Versuche, solche grundlegenden Komponenten volkstümlicher Kultur zu reformieren, waren bestenfalls begrenzt.“[179]
5.5 Wallfahrten und Prozessionen
Hier muss an erster Stelle die Begriffsunterscheidung zwischen Wallfahrt und Prozession erläutert werden, die so nicht im zeitgenössischen Sprachgebrauch vorgenommen wurde. Beide Begriffe wurden meist synonym gebraucht. Für spätere Ausführungen möchte ich daher folgende groben Definitionen machen: Eine Wallfahrt ist eine oftmals mehrtägige Reise einer Pilgergruppe, die von ihrem Heimatort zu einem Zielort mit überregionaler Bedeutung zieht, um dort um göttliche Gnade, meist für ein persönliches Anliegen, zu bitten. Als eine Prozession möchte ich dagegen rituelle Umzüge einer Pfarrgemeinde bezeichnen, die sich zu besonderen Feiertagen innerhalb der Gemeindegrenzen oder zu einem nahegelegenen Ort (meist eine Kapelle o.ä.) bewegten.[180]
Anhand der in der zweiten Hälfte des 19. Jh. wieder verstärkt durchgeführten Wallfahrten und Prozessionen zeigt sich am deutlichsten die Wandlung der katholischen Kirche, auch im Bistum Limburg. Der Trierer Erzbischof Clemens Wenzeslaus (1768-1812) hatte noch versucht, die Wallfahrten einzudämmen. 1784 sah er sich gemüßigt, „diesem Unfuge mittels einer allgemeinen Verordnung zu steuern“[181]. Neben der ökonomischen und ordnungspolitischen Kritik (die Pilger würden ihre Haushaltungen für acht oder mehr Tage ohne Vorstand verlassen) ist es auch die Kritik am religiösen Nutzen solcher langen Fahrten, die Clemens Wenzeslaus bewegt: mehrere Wallfahrer würden „statt der wahren Andacht und des heiligen Gottesdienstes in der Pfarrkirche ohne Erbauung und jemals zu erwartenden Seelennutzen müsig und schwermend herum“ wandern. Diese Haltung gegenüber dem Wallfahrtswesen blieb auch im Generalvikariat und in der Anfangszeit des Bistums Limburg bestimmend.[182] Sie wurde auch von der Mehrheit der Pfarrgeistlichen geteilt, denn die Wallfahrten stellten eine Konkurrenz zum Pfarrgottesdienst dar; „das Misstrauen gegenüber spontaner, schwärmerischer, ungeregelter, kirchlich nicht beaufsichtigter Frömmigkeit ist typisch für den Pfarrklerus, eine besondere Form des alten Konflikts zwischen Priester und Prophet“[183].
Nach der Säkularisation, als wichtige Wallfahrtskirchen und -klöster vom Herzogtum Nassau übernommen und geschlossen worden waren, erließ die Regierung 1815 ein Verbot aller Prozessionen über die Pfarrgrenzen hinaus. Sie ging hierbei konform mit dem ersten Limburger Bischof Jakob Brand. Die Notwendigkeit von Wallfahrten für das katholische Glaubensleben wurde erst später von Bischof Blum wieder akzentuiert. Während sich die Einstellung des Staates zum Wallfahrtswesen nicht geändert hatte, war also von Seiten der Kirche sehr wohl eine andere Position bezogen worden. Das führte zu Konflikten, die sich erstmals durch die Ereignisse der Trierer Rockwallfahrt akzentuierten. Bischof Blum hatte die Wallfahrt 1844 enthusiastisch begrüßt, selbst an ihr teilgenommen und die Teilnahme von Gläubigen aus seinem Bistum gefördert.[184] Die Erwähnung der Wallfahrt in Blums Fastenhirtenbrief 1845 stellte die Regierung dagegen vor ein Problem. Regierungspräsident Möller betonte gegenüber dem Staatsministerium die Illegalität der Wallfahrt, die unter die Verordnungsbestimmungen von 1815 falle. Sie dürfe darum in einem bischöflichen Hirtenschreiben nicht billigend erwähnt werden.[185] Möllers Ansicht setzte sich in dieser Angelegenheit im Staatsministerium nicht durch, doch schon wenige Monate später wurde das Domkapitel erneut über einen Verstoß gegen das nämliche Edikt befragt. Im September 1845 war eine Prozession von Limburg aus zur Kapelle im benachbarten Beselich gezogen, an der auch Geistliche durch Abhaltung von Gottesdiensten beteiligt waren.[186] Bischof Blum stellte sich dabei klar auf Seiten der Wallfahrer. An Möller gerichtet bemerkte er, „daß einerseits die katholische Kirche bei allem ihrem Eifer gegen jegliche Art von Mißbräuchen das Wallfahrten an sich nicht nur erlaube, sondern billige, ja selbst empfehle, und andrerseits bei dem katholischen Volke allenthalben in Deutschland [...] das Bedürfniß, auch in dieser speziellen Weise seinem religiösen Drange zu genügen, mächtig wieder erwacht sei.“[187]
Die beiden Fälle zeigen ein sowohl inkonsequentes als auch paradoxes Verhalten der Staatsregierung: Während die große, „massenwirksame“ Trierer Wallfahrt ungestört organisiert und befördert werden konnte, schritt man gegen eine kleine, lokal verankerte Prozession mit aller Strenge des Gesetzes ein. Walter Lutz erklärt dieses Verhalten mit der differierenden Organisationsform beider Fahrten: Die Rockwallfahrt war eine „Wallfahrt von oben“ gewesen. Vielleicht hatte sich die nassauische Regierung in dieser Frage an der Haltung der preußischen orientiert, die der Veranstaltung zumindest mit wohlwollender Neutralität gegenüber stand.[188] Doch erwiesen ist es, dass die nassauische Regierung die Wallfahrtsbewegung „von unten“ ablehnte.[189] Bei der Untersuchung der Limburger Prozession wurden ihre Teilnehmer als Mitglieder der unteren Volksklasse identifiziert, sowie als ungebildet und abergläubisch charakterisiert. Wie Lutz weiter betont, seien das genau Sprache und Perspektive der aus den Reihen des Besitz- und Bildungsbürgertums kommenden zeitgenössischen Wallfahrtskritik: „Dieses Bürgertum verschloß weitgehend die Augen vor der sich infolge der Industrialisierung verschärfenden sozialen Frage und verachtete aus seiner spätaufklärerischen Perspektive die religiösen Gewohnheiten und Bedürfnisse des einfachen Volkes.“[190] Das inkonsequente Vorgehen der Regierung zeigt aber auch die Ohnmacht des vormärzlichen Staates, den neu erstarkten organisierten Katholizismus in Schranken zu weisen, so dass man sich lieber auf Nebenschauplätze und Nebengefechte einließ. Das Verhalten des nassauischen Staates liegt also auch in der Wallfahrtsfrage ganz auf der Linie der deeskalierenden Politik: Man war nicht bereit, es zum offenen Bruch mit der katholischen Kirche kommen zu lassen. Bezeichnend dagegen die Stellung von Bischof Blum: „Er verteidigte [...] den Zug zur Beselicher Kapelle als unschuldigen Bittgang und nahm das zum Anlaß, die Aufhebung des Wallfahrtsverbots von der Regierung zum wiederholten Male zu fordern.“[191]
Wie eng Wallfahrten und Prozessionen neben ihrer Bedeutung für individuelle Bedürfnisse nach göttlicher Gnade und Hilfe auch schon seit Jahrhunderten mit Bedürfnissen der ländlichen Ökonomie verbunden waren, betont Vadim Oswalt: „Sie beruhten auf einer volksreligiösen Einheit von Magie und Religion, auf der Hoffnung auf eine unmittelbare Wirksamkeit des Heiligen zum Schutz vor Hagelschlag und Viehseuchen und zur Beförderung des Wachstums der Feldfrüchte.[192] “ Der versuchte Umbau der religiösen Mentalität durch die katholische Aufklärung misslang in diesem Punkt: „Ländliche Volkskultur zeigte sich ausgesprochen resistent gegen kirchliche Disziplinierungsinitiativen.“[193]
Der wichtigste überlokale Wallfahrtsort der Diözese Limburg war Bornhofen am Rhein. Auf dieser Wallfahrt konnte der Pilger seit 1704 den vollkommenen Ablaß erwerben. Schon seit dem 13. Jahrhundert hatte sich um das „wundertätige Bild“ der Maria eine Wallfahrtstradition entwickelt. Bis zur Säkularisation übernahmen Kapuziner, die neben der Wallfahrtskirche in einem Kloster lebten, die religiöse Betreuung der Pilger. Nach der Auflösung des Klosters ging die Wallfahrt stark zurück, hat aber niemals gänzlich aufgehört zu existieren, selbst in den Jahren von 1813 bis 1821, als die Kirche geschlossen war. Der „Bornhofenpilger“ aus dem Jahr 1935 weiß dazu: „Man brach damals in die Kirchenmauer gegenüber dem Gnadenbild ein kleines Fenster; an ihm zogen die Pilger vorüber, und jeder durfte ein paar Augenblicke hindurchschauen und die Gnadenmutter begrüßen.“ Schatz schreibt, dass bereits im Vormärz, als der Limburger Klerus noch diesem Phänomen gegenüber reserviert eingestellt war, eine Massenbewegung in der Bornhofener Wallfahrt entstanden war.[194] Dazu muss man wissen, dass Bornhofen auch stark von Gläubigen vom anderen Ufer des Rheins, also aus der Diözese Trier, zu welcher der Ort vor der Säkularisation gehörte, frequentiert wurde. Dort war spätestes 1844, wie wir gesehen haben, das Wallfahrtswesen von Bischof und Klerus bereits vollkommen akzeptiert und befördert worden.
Auf Einladung von Bischof Blum, der im Frühjahr einen Teil des Klosters erworben hatte, wurde am 8. September 1850 in Bornhofen eine Niederlassung der Redemptoristen gegründet, mit zunächst zwei Patres und einem Laienbruder. Die nassauische Regierung leistete zuerst Widerstand, konnte sich aber gegen den entschlossenen Bischof nicht durchsetzen, der am Gründungstag selbst in Bornhofen zugegen war und mit Tausenden Gläubigen feierte und zu ihnen predigte.[195] In der Folgezeit blühte die Wallfahrt nach Bornhofen wieder auf und erreicht bald eine Durchschnittszahl von jährlich 20.000 Pilgern (s. auch Tab. 3).[196]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab.3: Wallfahrten nach Bornhofen (aus allen Diözesen) 1852-1873[197]
Wie Schieder anhand der Wallfahrten zum Heiligen Rock nach Trier herausgestellt hat, wurde die Organisation dieser speziellen Prozessionen „nicht etwa religiösen Bruderschaften oder gar dem Zufall überlassen, sondern strikt in die Hände der Pfarrgeistlichen gelegt“ und dem Klerus damit eine autoritäre Führungsrolle gesichert.[198] Bleibt Schieders These fest an die Trierer Wallfahrt gekoppelt, so lässt sich doch auch allgemein in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Tendenz ausmachen, dass man dazu überging, Bruderschaftsvorsteher als Anführer der Wallfahrten durch Priester zu ersetzen. Das geschah unter Umständen durchaus auf Wunsch der Wallfahrer und ist nicht bloß als restriktive Maßnahme zur klerikalen Organisation der Massenreligiosität im Sinne Ebertz’ (s. 5.1) zu verstehen.
Das zeigt deutlich ein Beschwerdebrief an Bischof Blum aus dem Jahr 1863[199] ; er soll hier stellvertretend für viele kritische Stimmen zur Walldürner Wallfahrt[200] referiert werden.
Der Absender war Anton Bender aus Großsollbach (Dekanat Meudt), dem Brief nach zu urteilen ein Mensch, der nicht viel Erfahrung hatte mit dem schriftlichen Verkehr[201], und darum wahrscheinlich dem bäuerlich-kleinbürgerlichen Milieu zuzurechnen ist. Er hatte sich der Wallfahrt nach Walldürn als Pilger angeschlossen und machte seinem Ärger wie folgt Luft:
„Ein Brudermeister von Holler [Dekanat Montabaur, L.W.] war ofter betrunken, dieser betete wann es im einfiehl, die Leute wolten in gar nicht mer haben zum vorbeten. Wenn er so durch die Prozesion ging, so kam ofter ein Bursch aus seinem Ort zu im, und so schwäzten beite und lachten mit einander ganze halbe Stundenlang mit einander das gab wieder vieles Aegerniß. Wenn dieser Mann dann auch mal diese Pilger in Reih eins hinder das andere haben wollte, die Pilger hatten aber keine Achtung for ihm. Es ist doch Traurig und groß zubedauern daß eine so große und schöne Prozesion merstertheils doch ordentliche Pilger, von solchen Führer geführt wurde. Wo doch keine Ordnung ist da ist auch kein Glück noch Segen Gottes.“
Die Führung durch den Brudermeister war also nicht nur aus religiöser Perspektive ohne Nutzen, sondern vielmehr insgesamt schädlich. Bender warf dem Brudermeister auch Betrug vor, denn dieser würde für die Rückreise per Schiff viel mehr Geld als angemessen von den Pilgern nehmen. Zudem war der Mangel von jeglicher Moral und Sittlichkeit ein Ärgernis für ernsthafte Pilger. Wenn Bender sich weigert niederzuschreiben, welche Art von Gesprächen auf den Schiffen geführt wurde, wo männliche und weibliche Wallfahrer zusammen waren, so schreibt er stattdessen:
„Es waren viele junge Leute, diese haben gefrien und ließen sich freien, a Schande für Pilger auf einer Reise nach Walldürn zu dem h. Bult [muss heißen: Blut, L.W.] unseres Herrn Jesu Christe. Es waren viele junge Leute Männlichen Geschlechts die ließen währent dem Gebet ihre Kappe oder Hühte, störten sich wenig da das doch auch nicht schicklich ist wen es auch wol einer nicht haben wolte.“
Seinen Beschwerdebrief schließt Bender mit folgenden Worten:
„Der Himmel möge sich erbarmen über unsrer Prozesion das solche doch auf einen Weeg komt - auf den Weeg der Ordnung das nämlich die Vorbeter bei Kreuz u. Fahne bleiben und nicht in Wirzhäusern sitzen bleiben.“
Das Ordinariat suchte daraufhin nach einem Pfarrer, der die Wallfahrt nach Walldürn leiten sollte. Sie fand ihn in Pfarrer Fluck aus Weidenhahn, der sie erstmals 1869 anführte 200 und einen aufschlussreichen Bericht für das Ordinariat verfasste.[202] Dieser schloss mit den Worten:
„Im Allgemeinen muß ich bemerken, daß das Verhalten der Wallfahrer sowohl auf der Reise als auch an dem Gnadenorte selbst mich recht erbaut hat. Die Führung der Prozession durch einen Geistlichen ist unumgänglich nothwendig.“
Nur zwei Kritikpunkte führte Fluck an: Der erste betraf die körperliche Verfassung der Pilger. Unter den etwa 700 Pilgern befand sich eine kranke Frau aus Lindenholzhausen, die in Heusenstamm bei Frankfurt zurückgelassen werden musste und dort auch später verstarb. „Ganz ungehörig ist es,“, urteilt Fluck, „dass zuweilen Frauen, deren Umstände es nicht mehr erlauben, [...] diesen weiten Weg unternehmen.“ Die Wallfahrtsführer befanden sich hier freilich in einer prekären Situation, denn eine Wallfahrt zog primär jene Menschen an, die sich von ihr eine besondere göttliche Gnade zur Linderung physischer Leiden erhofften. Die Sorge um das gesundheitliche Wohlergehen der Pilger betrifft auch Flucks zweiten Kritikpunkt. Die Heimreise wurde auf dem Main „auf 3 uebereinander gebundene[n] Schiffen“ angetreten. Die Schiffleute waren aber, wie in vorherigen Jahren, „in betrunkenem Zustande“, was beim Passieren von Brücken und beim Navigieren bei „widrigem Wasserstande“ eine erhebliche Gefahr für die Pilger darstellte. Darüber hinaus waren die Pilger fast einen ganzen Tag (19 Stunden) lang auf den Schiffen eng zusammengepfercht, so dass sie weder ihren Platz verlassen, noch in angemessener Weise ihren natürlichen Bedürfnissen nachkommen konnten.
Aus den obigen Ausführungen ist erkenntlich, dass sich in der Wallfahrtsfrage die Positionen der kirchlichen Entscheidungsträger der Aufklärung und der religiösen Erneuerung nur prinzipiell, aber nicht in praktischen Fragen unterschied. Zu beiden Zeiten versuchte man, die sittliche Ordnung sicherzustellen; die Frage nach dem religiösen Nutzen stand dabei im Vordergrund. Doch während man gegen Ende des 18. Jahrhunderts versuchte, das Wallfahren durch obrigkeitliche Direktive abzustellen, konzentrierte man sich Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Einbindung des weiterhin bestehenden Bedürfnisses in die kirchliche Organisation.
5.6 Orden und Kongregationen
Die religiösen Orden stellten ein wichtiges Element der populären Frömmigkeit dar. Im Gegensatz zum Weltklerus brauchte der Ordensklerus, bis auf wenige Ausnahme, keine höhere Schulbildung (d.h. Besuch eines Gymnasiums und weiterführendes theologisches Studium) nachzuweisen, um Aufnahme in den geistlichen Stand zu finden. Somit stand das Leben im Orden prinzipiell viel breiteren Bevölkerungsschichten offen.
Die Säkularisation der Klöster hatte auf dem Gebiet des späteren Bistums Limburg gravierende Auswirkungen: bis April 1817 wurden alle bestehenden 26 Klöster aufgelöst. Das Bestreben der nassauischen Regierung traf sich dabei mit den von der kirchlichen Aufklärung geprägten Vorstellungen des Trierer Generalvikariats, die sich in der Überzeugung von der Nutzlosigkeit des Ordenslebens und der ausschließlichen Wertschätzung der Pfarrarbeit zeigten.[203]
Nach der Säkularisation war Limburg bis 1850 (33 Jahre lang) eine Diözese ohne Ordensleute. Erst mit Bischof Blum trat eine Trendwende ein. Zu seinem Programm der Förderung der allgemeinen Frömmigkeit gehörte die Wiedereinbindung von religiösen Orden in das Glaubensleben der Diözesanen.
5.6.1 Etablierte Orden in der Diözese
Blum war aufgrund der angespannten Personalsituation „vor allem aus seelsorgerischen Gründen an der Niederlassung von Ordenspriestern innerhalb der Diözese interessiert“.[204] Lange bemühte er sich, Redemptoristen, deren Arbeit er schon anhand der Volksmissionen schätzen gelernt hatte, in sein Bistum zu holen. Entsprechend erfreut war er, als 3 Ordensmitglieder[205] im September 1850 in Bornhofen den Wallfahrtsdienst übernehmen konnten.
Die Anzahl der Ordens- und Kongregationsansiedlungen blieb bis zum Kulturkampf recht überschaubar. Bei einer Überprüfung der Ordensniederlassungen anlässlich des Erlasses des Jesuitengesetzes im Juli 1872 zählte die Regierung auf: Neun Patres, vier Laienbrüder und ein Rektor des Redemptoristenkollegiums in Bornhofen; eine Niederlassung der Jesuiten in Marienthal (seit 1870) mit drei Priestern; drei Patres und mehrere Laienbrüder der Väter vom Heiligen Geist und unbefleckten Herzens Mariens (Spiritaner) im Kloster Marienstatt bei Hadamar; eine Niederlassung der Englischen Fräulein in Frankfurt, die mit 12 Personen dort eine Mädchenschule unterhielt; zuletzt noch sieben Vinzentinerinnen, die in Limburg in Krankenpflege und Schuldienst tätig waren.[206]
Nur zwei Ausnahmen sind von dieser überschaubaren Verteilung zu machen: Das Bistum brachte selbst zwei religiöse Kongregationen[207] hervor, die Armen Dienstmägde Jesu Christi und die Barmherzigen Brüder, die 1851 bzw. 1856 offiziell vom Bischof anerkannt wurden.
5.6.2 Die Armen Dienstmägde Jesu Christi
Die noch heute bestehende und international tätige Kongregation geht auf die Stiftung der Tagelöhnerin Katharina Kasper (1820-1898) aus Dernbach, einem Dorf im unteren Westerwald, zurück. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt zählte das Dorf etwa 700 Einwohner und besaß keine eigene Pfarrkirche, so dass die Gläubigen zum Gottesdienst nach Montabaur oder Wirges gehen mussten. Kasper, die von sich selbst sagte, „daß Gott etwas Besonderes von mir verlangte, und daß ich die Armen und Kranken pflegen sollte“[208], will ihr Leben auf diese Weise in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Sie sammelte einige gleichdenkende junge Frauen um sich und gründete 1842 einen „frommen Verein“.[209] Die Kontaktaufnahmen zu Dekan Heimann in Montabaur und Bischof Blum verliefen zu Anfang unter keinen guten Vorzeichen: Es wurde Verdacht geschöpft, es entweder mit einer Herumtreiberin oder einer geistig nicht gesunden Person zu tun zu haben.[210] Aber Kasper blieb hartnäckig und machte sich noch mehrmals zu Fuß auf den Weg nach Limburg, bis der Bischof sie wieder empfing, denn für sie stellte er „die Autorität dar, ohne die ihr Weg nicht zum Ziele führte“[211]. Für Blum kristallisierte sich damit die Ernsthaftigkeit von Kaspers Unternehmen heraus, und er begann, ihre Initiative zu unterstützen: durch Bestätigung der ersten Vereinsstatuten 1850 und durch offizielle Konstituierung als „Genossenschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi“ (im folgenden: ADJC) mit Einkleidung und Gelübdeablegung der ersten fünf Schwestern am 5. August 1851 in Wirges. Schon 1847 hatten sich die fünf jungen Frauen zu einer Wohngemeinschaft in einem kleinen, selbstgebauten Haus in Dernbach zusammengeschlossen, weshalb die Genossenschaft häufig auch als „Dernbacher Schwestern“ bezeichnet wurde. Damit waren erste Entwicklungslinien vorstrukturiert. Bischof Blum ernannte den Geistlichen Johann Jakob Wittayer zum Superior der Genossenschaft, während er selbst oberster Leiter der Genossenschaft und Kasper (bzw. Mutter Maria, wie sie ab 1851 zu nennen ist) Generaloberin bleibt.
Die ADJC erlebten ein relativ schnelles Wachstum.[212] Der wachsenden Mitgliederzahl entsprach aber auch eine große Nachfrage von Seiten des Pfarrklerus nach Entsendung von Ordensschwestern, die eine größeres Netz von Filialhäusern nach sich zog. Während neben der ursprünglichen Intention Kaspers, die Kranken zu versorgen, die ADJC auch schon die Fürsorge für verwahrloste oder ganz verwaiste Kinder übernommen hatten, war es Superior Wittayer, der den Wirkungskreis auf die Übernahme von höheren Töchterschulen und damit auch auf die Sorge für Mädchen aus höheren Ständen ausdehnte. Kasper war damit zuerst nicht einverstanden, fügte sich aber in Wittayers Anweisungen. Im Kulturkampf sollten die Erziehungs- und Bildungsinitiativen der Kongregation unterbunden und jene wieder ganz auf die Krankenpflege beschränkt werden.
Am 16. April 1978 wurde Katharina Kasper durch Papst Paul VI. seliggesprochen. Sie ist damit den großen religiösen Persönlichkeiten des Bistums hinzu zu rechnen.
In wieweit die ADJC in Verbindung gebracht werden können mit der sich langsam akzentuierenden Frauenbewegung, wie Fuchs das tut[213], ist fraglich. Auf jeden Fall scheint die Kongregation der bürgerlichen Frauenbewegung, die politische und gesellschaftliche Partizipation forderte, fern zu stehen. Sie war vielmehr geprägt von agrarisch-kleinbürgerlichen Schichten, in denen es selbstverständlich und auch existenziell notwendig war, dass auch weibliche Familienmitglieder ihren Teil zur harten Arbeit beisteuerten. Es ist also zu bedenken, dass sich der Wirkungskreis von Frauen in der stark männlich dominierten Gesellschaft hauptsächlich auf Tätigkeiten für die Familie beschränkte (diese konnten freilich je nach sozialem Grad sehr unterschiedlich sein).
Auch wenn Frauen des weiteren von der Institution Kirche, der Kirchenhierarchie, ausgeschlossen waren, so lassen sich von Fall zu Fall auch von ihnen ausgehende religiöse Inspirationen nachweisen. An erster Stelle ist dazu die Familienmutter zu zählen, der traditionell die Erziehung der Söhne und Töchter zufiel. Unter 3.2 wurde schon Bischof Blums sehr fromme Mutter Elisabeth erwähnt, die nach Höhlers Zeugnis „noch im Alter den kleinen Katechismus des sl. Petrus Canisius auswendig wusste“. Sie gab ihren Kindern den ersten Religionsunterricht und „pflanzte ihnen [...] eine große, ehrfürchtige Liebe zur allerseligsten Jungfrau ins Herz“.[214]
In antikatholischen Ressentiments der Zeit wurde dieser weibliche Einfluss als eine Feminisierung der Religion ausgedrückt. Frauen wurde Bildungsinferiorität und mangelnder Verstand (als Resultat der „leicht erregbaren Frauengemüter“[215] ) unterstellt. So seien sie zum beliebten Angriffsziel der „Pfaffen“ geworden und leichter empfänglich für die katholischen Lehren und Forderungen als Männer. Wie Blackbourn analysiert, war die liberale Version der Unabhängigkeit sowohl als Funktion der Geschlechts- wie der Klassenzugehörigkeit bestimmt. Die liberale Kritik entzündete sich nicht nur an Ordensfrauen, die für die Liberalen ein perfektes Symbol der Rückständigkeit waren, auch „die zahlreiche Anwesenheit von Frauen und Kindern bei verschiedenen Anlässen öffentlichen katholischen Protestes stach ins Auge und wurde häufig von Liberalen als Argument ins Feld geführt, um ihren geistlichen Gegner zu diskreditieren“[216]. Tatsächlich lässt sich eine größere Beteiligung von Frauen am religiösen Leben feststellen; erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts glich sich der Geschlechterunterschied wieder aus.[217]
Eingehend mit dieser Problemstellung hat sich Relinde Meiwes beschäftigt, die nach einem Erklärungsmuster für die Entstehung und rasche Ausbreitung der neuen Frauenkongregationen ab Mitte des 19. Jahrhunderts suchte.[218] Frauenkongregationen erlebten einen regelrechten „Boom“; wichtig im Blick zu haben ist dabei, dass dieser „Ordensfrühling“ des 19. Jahrhunderts geschlechtsspezifisch ausgeprägt war: so waren 1872 in Preußen von den 9048 Mitgliedern in Orden und Kongregationen nur 1037 Männer, aber 8011 Frauen.[219] Für Meiwes war die wechselseitige Beeinflussung von drei gravierenden gesellschaftlichen Wandlungsprozessen im 19. Jahrhundert grundlegend für die Ausbreitung der Frauenkongregationen: die Renaissance des religiösen Lebens, die soziale Frage und die sogenannte Frauenfrage.[220] Die Kongregationen boten den Frauen die einmaligen Voraussetzungen, religiöse, soziale und berufliche Interessen zu verbinden und waren so in begrenztem Rahmen auch eine Chance zur Teilhabe an Berufs- und Bildungsmöglichkeiten. Die hierarchische Organisationsstruktur im „Mutterhaussystem“ hatte dabei entscheidenden Einfluss auf Wirksamkeit und Effizienz der Kongregationen. Meiwes’ Forschungsergebnisse lassen sich auch auf die ADJC anwenden: Das Leben der Schwestern war geprägt von hoher Motivation bei niedriger materieller Gratifikation, religiöser Sinnstiftung als Kompensation für die harte Arbeit und der gemeinschaftlichen Lebensform als Garant für Effizienz und persönliche Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit.[221] Durch ihre Expansion - sowohl geographisch als auch der Mitgliederzahl nach - prägten die Schwestern dabei das Bild der katholischen Kirche: sie traten als religiöse Vermittler auf - sowohl in der Lehre, als auch in christlicher Alltagsarbeit - und fungierten als Teil der kirchlichen Struktur. Durch ihre ganz eigene, neuartige Symbiose von Kontemplation und Arbeit, die sich sowohl im kirchlichen wie im öffentlichen Raum vollzog, hätten sie, so Meiwes, auch eine neue Legitimation für die Kirche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschaffen.[222] Aus diesen Überlegungen heraus ist es für das historische Verständnis nicht sinnvoll, bestimmte Aspekte des weiblichen Kongregationslebens anders zu gewichten als andere, dieses bleibt eine Verquickung von religiös inspirierter weiblicher Arbeit zur Linderung sozialer Not.
5.6.3 Die Barmherzigen Brüder von Montabaur
Dass die Initiative zur neuen Symbiose von Kontemplation und Arbeit nicht in einer geschlechtsspezifischen Religiosität begründet war, zeigt die Kongregation der Barmherzigen Brüder von Montabaur. Sie sollte aber bei weitem nicht die gleiche Expansion erleben wie die ADJC, obwohl sie ebenfalls sozialcaritative Dienste übernahm und eine ähnliche Organisationsstruktur aufwies.
Die Kongregation geht auf die Stiftung des Kaufmanns Peter Lötschert (1820-1886) zurück. Er stammte, ebenso wie Katharina Kasper, aus dem Westerwald, nämlich aus der Gemeinde Höhr. Lötschert trat nach seiner Volksschulzeit 1837 eine Kaufmannslehre bei J.C. Siebert in Hadamar an, in dessen Diensten er zehn Jahre blieb. Die Kleinstadt war katholisch geprägt. Zwei Andeutungen von Georg Hilpisch, der eine kurze Geschichte der Kongregation schrieb, deuten an, dass sich Lötschert in ein katholisches Mikromilieu begab. Zum einen erwähnt er, dass zwei Töchter von Siebert den ADJC beitraten. Zum anderen behauptet er von Lötschert, dass ihm „Gottesdienst [...] allzeit vor Herrendienst“ ging[223], was seinen „tatkräftige[n] und tüchtige[n]“ Prinzipal wohl nicht störte.
Hilpisch weiß, dass Lötschert, der als Messdiener schon unmittelbare Erfahrungen im Altardienst sammeln konnte, Priester werden wollte und sich diesbezüglich an Bischof Blum wandte. Aber weil er schon zu alt war, um die mangelnde Gymnasialbildung nachzuholen, musste Blum ihn abweisen, „ermunterte ihn aber, seiner frommen Richtung treu zu bleiben“.[224] Wahrscheinlich war es der Bischof, der ihm daraufhin 1847 eine Anstellung im Kaufmannsgeschäft des Bruders von Moritz Lieber, Franz Gisbert Lieber, in Camberg vermittelte. Auch hier fand Lötschert, wie in Hadamar, ein Umfeld, mit dem er identische Vorstellungen und Interessen teilte und das ihn unterstützte. So ist es z.B. erklärbar, dass Lieber nichts von einer Ersatzleistung wissen wollte, als sich ein Dieb in den Laden schlich, um zwei Ballen Tuch zu stehlen, während Lötschert in seinem „ziemlich entlegenen Zimmer dem Gebete oblag“[225].
Der junge Mann, der seine Freizeit mit Andachtsübungen und Gebeten verbrachte, war auch Mitglied in den Camberger Pius- und Vinzenzvereinen. Hier konnte er seine rhetorischen Fähigkeiten schulen. In seiner Heimat Höhr, die er regelmäßig besuchte, gründete Lötschert 1848 einen Piusverein. Seine Vorträge dort seien, so berichtet Hilpisch, „begeisterte Ansprachen“ gewesen, „die ungeheuchelten Beifall fanden und den Sinn der Zuhörer erst auf die Interessen der Kirche und das Seelenheil hinlenkten“.[226] Der Kaufmann, der mit keinerlei geistlichen Weihen bedacht, sondern nur besonders fromm war, wurde also zum Kommunikator und Propagator der Interessen der katholischen Kirche.
Seit 1851 führte Lötschert erst in Hillscheid und dann in Hadamar ein gemeinsames Leben mit einigen Gleichdenkenden. Ähnlich wie die ADJC wollten sie durch tätige Hilfe an Armen und Kranken zum christlichen Leben finden. Vom Bischof als Genossenschaft anerkannt und eingekleidet wurden die ersten fünf Brüder 1856. Die Barmherzigen Brüder wuchsen nicht so schnell wie die ADJC; 1905 zählten sie 297 Mitglieder, von denen 100 Brüder und 25 Novizen innerhalb der Diözese Limburg tätig waren.[227]
Konfrontiert mit den beiden Kongregationen der Barmherzigen Brüder und der ADJC drängt sich die Frage auf, warum sich die jungen, tatkräftigen und sich nach einem christlichen Leben sehnenden Katholikinnen und Katholiken nicht einfach einem bestehenden Orden anschlossen, statt sich der Arbeit, Mühe und Unsicherheit einer eigenen Gemeinschaftsgründung auszusetzen. Die Erklärung muss in der gemeinnützigen Arbeit vor Ort zu suchen sein. Denn im Bistum gab es, wie beschrieben, keine größeren Niederlassungen etablierter Orden. Auf den Zusammenhang zwischen Kaspers Motivation und der exorbitanten sozialen Not im Westerwald wies schon Konrad Fuchs hin.[228] Diese Mittelgebirgsregion war das Armenhaus Nassaus, Wilhelm Heinrich Riehl bezeichnete den Westerwald als „nassauisches Sibirien“. Auch spärliche herzogliche und private Initiativen konnten Hungerkrisen, Massenarmut und Auswanderung nicht beseitigen.[229] Motiviert durch die christliche Bereitschaft, selbst das letzte Stück Brot noch zu teilen., wollte sich Katharina Kasper von der herrschenden lähmenden Lethargie befreien und durch Eigeninitiative eine Selbsthilfe organisieren.[230] Die jungen Leute wollten also in ihrer angestammten Heimat, ihrem Herkunftsort und -land, aktiv karitative Arbeit leisten, um so nicht nur die soziale Not zu lindern, sondern auch das religiöse Leben zu fördern. Beide Ziele gingen dabei Hand in Hand und waren in der Vorstellung der Kongregationsmitglieder nicht voneinander zu trennen. An diesem Punkt setzt auch die Kritik an; sie lässt sich in der Frage zusammenfassen, ob die katholischen Initiativen zur Lösung der sozialen Frage beitrugen und tauglich waren. Armut war und ist ein zentrales christliches Thema, und von den mittelalterlichen Bettelmönchen bis zur Ordensmutter Theresa gab es viele verschiedene christlich-katholische Ansätze zum Umgang mit diesem Problem. Doch im 19. Jahrhundert sah sich die klassische caritative Lehre der Kirche mit anderen säkularen Lösungsstrategien konfrontiert: Die dunkle Seite der Industrialisierung, die Pauperismus und die Herausbildung einer proletarischen Klasse nach sich zog, rief radikalere Bewegungen auf den Plan, die sich eine Änderung des politischen und sozialen Systems zum Ziel gesetzt hatten. Die sozialistische Kritik am katholischen Caritaswesen ging dahin, dass die Kirche die armen Bevölkerungsschichten nicht aus ihrer politischen Unmündigkeit befreie, sondern diese vielmehr durch kontraproduktive und unzeitgemäße Ideale noch aktiv unterstütze.[131]
Sicher kann man behaupten, dass keine der geistlichen Kommunitäten im Bistum Limburg im untersuchten Zeitraum die Eigenschaften zeigte, die man gemeinhin dem klösterlichen Leben zuschrieb, nämlich Isolation und Weltfremdheit hinter dicken Klostermauern. Auch die klassische Kritik der kirchlichen Aufklärung am Klosterwesen findet nur wenig Anwendung auf die neuen caritativen Kongregationsbewegungen. Sie sind auch deshalb aufgrund ihrer Neuartigkeit, aber vor allem aufgrund der sozialen Herkunft ihrer Mitglieder und ihrer erfolgreichen Integration in die offizielle Kirche, als ein wichtiger Teilaspekt der katholischen Erneuerung hinzuzurechnen.
Nachdem wir nun die herausragendsten Aspekte des Phänomens der religiösen Erneuerung beleuchtet haben, wollen wir den chronologischen Verlauf wieder aufgreifen, um zu sehen, wie sich das diesem erneuerten Katholizismus entgegenstehende geistige Klima im Deutschen Reich und im Bistumsgebiet entwickelte und verschärfte, so dass es zum offenen Streit zwischen Rechristianisierung und Säkularisierung im Kulturkampf kam.
6. Der Kulturkampf
6.1 Historische Hinführung und Begriffsdefinition
Schon vor der Bildung des Deutschen Reiches 1871 waren Konflikte über die Stellung der katholischen Kirche im öffentlichen Leben in Deutschland und auch in anderen europäischen Staaten ausgebrochen. Doch erst die nationale Einigung ermöglichte in Deutschland eine neue Konzentration der antikatholischen Kräfte, um die liberalen Forderungen nach Säkularisierung, Modernisierung und Emanzipierung des Staates von der Kirche, die sich katholischerseits nach dem Vatikanischen Konzil endgültig und dogmatisch vom Liberalismus und der modernen Welt abgewandt hatte, zur Erfüllung zu bringen.
Begünstigt wurden diese liberalen Forderungen durch taktische Erwägungen von Reichskanzler Bismarck. Nach der Reichsgründung vollzog er einen Wechsel in der Politik der katholischen Kirche gegenüber.[233] Seit 1866 hatte er versucht, für Berlin eine Nuntiatur zu erhalten und nach dem Untergang des Kirchenstaates bot er dem Papst sogar ein Asyl in Preußen an. Er erkannte 1869, dass eine Erschütterung des Vertrauens der acht Millionen preußischen Katholiken ein Nachteil für die Dynastie wäre. Seine Hoffnung, es „noch zum Vertrauensmann der katholischen Kirche zu bringen“[234], entsprach seiner Hoffnung, dadurch politische Probleme in Polen, Belgien, Bayern und im Innern lösen zu können. Doch nach 1871 waren es die starken Vorbehalte gegen die katholische Zentrumspartei, die Bismarck in Annäherung zu den Liberalen brachte. Aufgrund der Geschlossenheit seiner Wählerschaft stellte das Zentrum schon nach der ersten Reichstagswahl 1871 die zweitstärkste Fraktion im Parlament. Es versuchte dort nicht nur eine Intervention des Reiches zugunsten einer Sicherung der weltlichen Macht des Papstes, die nach dem Anschluss Roms an das vereinte Königreich Italien gebrochen war, durchzusetzen, sondern stellte auch im März 1871 den Antrag, in die neue Reichsverfassung die kirchenfreiheitlichen Grundrechtsartikel der Preußischen Verfassung von 1850 aufzunehmen.[235] Besonders letzteren Vorstoß nahm Bismarck zum Anlass, sein Misstrauen gegen die politische Organisation des Katholizismus dahingehend auszudrücken, dass er das Zentrum als fremdgesteuerte Partei bezeichnete, die seine Macht- und Souveränitätssphäre einschränke.[236] Zudem befürchtete er, dass sich im Zentrum die Speerspitze einer „schwarzen Internationalen“ bilden könnte, die nicht nur süddeutsche, polnische und elsässische Partikularisten, sondern auch als politisches Sammelbecken antipreußisch Gesinnte und sonstige Unzufriedene umfassen könnte; zudem könnte es auch mit der befürchteten (katholischen) „Revanche-Koalition“ zwischen Frankreich und Österreich zusammenarbeiten.[237]
Der Kulturkampf in Preußen, auf den hier vor allem eingegangen werden soll, begann am 8. Juli 1871 mit der Aufhebung der katholischen Abteilung im preußischen Kultusministerium. Damit hatte Bismarck die einzige institutionalisierte Interessensvertretung für katholische Belange im Staat beseitigt. In einer darauffolgenden ersten Phase des Kulturkampfes wurden verabschiedet: der in das Strafegsetzbuch des Deutschen Reichs aufgenommene „Kanzelparagraph“ (10. Dezember 1871), der den Geistlichen verbot, staatliche Angelegenheiten in „einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise“ zu behandeln; das preußische „Schulaufsichtsgesetz“ (11. März 1872), das dem Staat die Aufsicht auch über den Religionsunterricht erteilte; sowie das reichsweite „Jesuitengesetz“ (4. Juli 1872), das zuerst alle Mitglieder der Societas Jesu, anschließend auch „verwandte“ Orden wie Redemptoristen und Lazaristen aus dem Reich auswies. Flankiert wurden diese Gesetze von umstrittenen Personalentscheidungen: Bismarck entließ den konservativen Kultusminister Heinrich von Mühler und übertrug das Ressort im Januar 1872 dem Liberalen Adalbert Falk. Zudem ernannte er den mit Rom zerstrittenen Kardinal Prinz Gustav von Hohenlohe-Schillingsfürst zum ersten Gesandten der Reichsvertretung beim Heiligen Stuhl. Dieser Affront führte zum Streit mit Rom, und die Stelle blieb erst unbesetzt und wurde später aufgelöst.[238]
In einer zweiten Phase wurde die Kirche in den „Maigesetzen“ von 1873 in Preußen einem geschlossenen System staatlicher Aufsicht unterworfen.[239] Sie griffen ein in die Ausbildung der Geistlichen[240], die Finanzierung der Kirchen[241] und die innerkirchliche Personalpolitik[242]. Zudem wurde der Austritt aus der Kirche erleichtert und die Altkatholiken (s. 6.3) wurden staatlich anerkannt. Zur Untersuchung von Rechtsvergehen gegen diese neuen Gesetze wurde der Königliche Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten geschaffen und mit weitgehenden Vollmachten ausgestattet.
Die schnelle Folge von immer neuen restriktiven Gesetzen sollte bis 1876 andauern. In diese Zeit fällt auch die Einführung der obligatorische Zivilehe zuerst in Preußen, dann im gesamten Reich; zudem verhinderte das reichsweite „Expatriierungsgesetz“ die unbefugte Ausübung von kirchlichen Ämtern; die Verwaltung erledigter (vakanter) Bistümer wurde im entsprechenden preußischen Gesetz vom 20. Mai 1874 einem staatlichen Kommissar übertragen; das preußische „Brotkorbgesetz“ vom 22. April 1875 sperrte die Staatsmittel (Temporalien) für „renitente“ Geistliche.
Wie schnell der von Rudolf Virchow geprägte Begriff „Kulturkampf“ von allen Seiten aufgegriffen wurde (katholischerseits stellte man ihn noch in Apostrophe), zeigt, wie treffend er für die Zeitgenossen das ausdrückte, was dem Streit zugrunde lag. Für die Liberalen beschrieb er „das Aufeinanderprallen ihrer eigenen, im liberalen Nationalismus verkörperten ,modernen’ Perspektive mit der den deutschen Katholiken zur Last gelegten Rückständigkeit und halsstarrigen Kirchturmpolitik“[243].
In dieser Arbeit soll und kann der Kulturkampf nicht als Juristikum behandelt werden, auch wenn er sich nach Aktenlage hauptsächlich als ein solches niederschlägt.[244] Mit Auswertung der vielen Gerichtsurteile, deren verhängte Strafgelder sich wegen Nichtbezahlens kontinuierlich steigerten, ist allein für unsere Fragestellung noch nicht viel gewonnen. Ich werde daher nur kurz auf die quantifizierbaren Auswirkungen des Kulturkampfes in der Diözese Limburg eingehen, um anschließend danach zu fragen, wie sich katholische Laien, Klerus und Staatsautoritäten in den so einschneidend veränderten Rahmenbedingungen untereinander positionierten.
6.2 Die Reaktion der Katholiken auf die „Klimawende“
Im Sommer 1872 begann sich der katholische Protest gegen Kanzelparagraph und Schulaufsichtsgesetz zu formieren. Nach Verabschiedung des Jesuitengesetzes rief Papst Pius IX. die deutschen Katholiken auf, sich der Verfolgung der Kirche zu widersetzen. Der deutsche Episkopat versammelte sich im September 1872 in Fulda. Diese Versammlung war nach 1848 die am zahlreichsten besuchte deutsche Bischofskonferenz im 19. Jahrhundert.[245] Sie erließ eine Denkschrift „über die Lage der katholischen Kirche im Deutschen Reiche“[246], die die Vorwürfe, dass die Kirche reichsfeindlich und staatsgefährlich sei, zurückwies und die jüngsten Maßnahmen Preußens und des Reichs als bezeichnete.[247]
Als unmittelbare Reaktion auf die Denkschrift ist in den Limburger Ordinariatsakten ein Brief der katholischen Gesellschaft „Concordia“ aus Camberg vom 21. Oktober 1872 überliefert.[248] Die Unterzeichner sprechen nach eigener Auskunft im Namen und Auftrag von 500 Mitgliedern. „Mit gespannter Aufmerksamkeit“ seien sie auf ihren beiden letzten Sitzungen der Verlesung der Denkschrift „Wort für Wort gefolgt, und sie hat nicht verfehlt, auf uns einen tiefen nicht mehr zu verlöschenden Eindruck zu machen.“ Der Brief fährt fort:
„Wie alle wahren Katholiken, haben auch wir uns erbaut und gestärkt, getröstet und ermuthight an dieser von ächt apostolischem Freimuthe getragenen Erklärung; [...] Wir sind durchdrungen von dem Gedanken und seufzen unter der Luft des Bewußtseins, daß unsere Tage voll schweren Kampfes gegen die Mächte der Finsterniß, gegen die Verirrungen der Vernunft und gegen die Ausschweifungen des menschlichen Herzens sind. [...] Je mehr wir aber diese unheilvollen Zustände beklagen, und je seltener Jemand den Muth hat, entschieden und unerschrocken den durch alle Attribute der weltlichen Macht geschützten Götzenbildern unsers Jahrhunderts entgegenzutreten: desto mehr sind wir, und wohl Tausende und aber Tausende mit uns, darüber erfreut, dass unsere hochwürdigsten Oberhirten trotz der ihnen drohenden Gefahren und Verfolgungen mit solcher Rückhaltlosigkeit und Offenheit für die Wahrheit, für die Freiheit und das Recht der Kirche und des katholischen Volkes in die Schranken getreten sind. [...] Deßhalb fühlen wir uns auch gedrängt, in aller Ehrerbietung unsern hochwürdigsten Oberhirten die Gefühle des innigsten Dankes, aber auch unsere volle und freudige Zustimmung zu den Inhalten der Denkschrift auszusprechen und damit die Zusicherung zu verbinden, dass wir das erhabene Beispiel, das Sie, hochwürdigste und gnädigste Herren, dem katholischen Volke gegeben haben, mit Gottes Hilfe treu befolgen und für unsern heiligen Glauben jedes Opfer zu bringen bereit sein werden.“
Es waren Aussagen wie diese, die Bischof Blum in seinem Kurs bestärken und sein Bewusstsein, dabei verantwortlich für seine Diözesanen und in ihrem Auftrag zu handeln, bestätigen mussten.
6.3 Auswirkungen des Kulturkampfes im Bistum Limburg 6.3.1 Gemeindeleben
Das preußische Gesetz über Anstellung und Vorbildung der Geistlichen vom 11. Mai 1873 schrieb den geistlichen Oberen verpflichtend vor, denjenigen Kandidaten, dem ein geistliches Amt übertragen werden sollte, dem Oberpräsidenten unter Bezeichnung des Amtes zu benennen (§15) und spricht jenem das Recht des Einspruchs zu (§16). Mit dieser Anzeigepflicht war den staatlichen Stellen also eine Einflussnahme auf die Besetzung von geistlichen Stellen eingeräumt. Damit waren alle Freiheiten der Pfarrbesetzungen, die Bischof Blum über Jahre mit dem nassauischen Staatskirchentum in Konflikt gebracht hatten, und die er nach der Annexion durch Preußen so freudig begrüßt hatte, zunichte gemacht. Schatz bemerkt dazu, dass das Gesetz prinzipiell weit weniger verletzend für die Kirchenfreiheit war als die nassauischen Bestimmungen, aber es war „etwas anderes, der Kirche eine bereits errungene Freiheit wieder wegzunehmen, als ihr eine bloß ersehnte vorzuenthalten“.[249]
Zunächst blieb es im Bistum ruhig, Blum hatte noch rechtzeitig vor Inkrafttreten des Gesetzes die meisten der vakanten Pfarreien besetzt, um einem offenen Konflikt aus dem Weg zu gehen.[250] Doch der Tod des Pfarrers von Balduinstein führte Ende Oktober 1873 zum offenen Kulturkampf. Selbstverständlich, so muss man sagen, folgte Blum der Haltung des übrigen preußischen Episkopats und besetzte die Stelle von sich aus und ohne dem Wiesbadener Oberpräsidenten davon Anzeige zu machen. Dem neu ernannten Pfarrer Houben untersagte Oberpräsident Bodelschwingh jede Amtshandlung und als sich Houben daran nicht hielt, kam es zu Verurteilung, Flucht, erneuter Verurteilung und Beschlagnahme des Pfarrvermögens. Die betroffene Kirchengemeinde lehnte eine Pfarrerwahl ab, so dass die Pfarrei offiziell vakant blieb. Dieses Muster sollte sich bei allen Pfarreibesetzungen wiederholen, so dass bis Dezember 1882 insgesamt 45 von den 148 Gemeinden der Diözese (30%) ohne Pfarrer gemeldet waren.[251]
Ein weiteres Kulturkampfgesetz, das unmittelbar auf das Gemeindeleben vor Ort eingriff, war das Gesetz über die Vermögensverwaltung in den katholischen Kirchengemeinden vom 20. Juni 1875[252], das dieselbe einem Kirchenvorstand und einer Gemeindevertretung übertrug. Der Kirchenvorstand sollte nach § 5 aus dem Pfarrer und mehreren von der Gemeinde gewählten Kirchenvorstehern bestehen. Durch dieses Gesetz fiel die sachliche Aufsicht über die örtliche Kirchenvermögensverwaltung nun wieder dem Staat zu; Bischof Blum musste dem Gesetz - zwar unter Protest - zustimmen, wenn er nicht auf die letzten ihm noch zugesprochenen Rechte der Vermögensverwaltung in den Gemeinden verzichten wollte.[253] Die Wahlergebnisse der Kirchenvorstände sind höchst aufschlussreich für das Verhalten der katholischen Bevölkerung im Kulturkampf. Anderhub zufolge schloss die Wiesbadener Regierung aus den Wahlergebnissen in Frankfurt und Wiesbaden auf eine Zunahme ultramontaner Kräfte, und auf dem Land bestimmte der Einfluss der Geistlichen den Ausgang der Wahlen.[254] Dass der Versuch, von Staats wegen ein vom Klerus unabhängiges Gremium für die Kirchengemeinden zu schaffen, gescheitert ist, soll noch einmal bei der Frage nach einer Koalition zwischen Klerus und Laien (6.4) aufgegriffen werden.
Mit den neu zu wählenden Kirchenvorstände und den rechtlichen Beschränkungen der Amtsausführung der Pfarrer sind schon die wichtigsten Auswirkungen des Kulturkampfes auf das Gemeindeleben im Bistum Limburg genannt. Die Bistumsleitung und die Dekane ergriffen dabei mehrere Maßnahmen, um die religiöse Versorgung auch in den vakanten Pfarreien aufrechtzuerhalten. Gelingen konnte dies nur durch einen geschlossenen kollegialen Kraftakt von noch nicht gesperrten Geistlichen in der ohnehin angespannten Personalsituation (vgl. 5.2). Begünstigend wirkte sich aber neben der Geschlossenheit des Klerus[255] auch die Tatsache aus, dass die Staatsbeamten vom Landrat an abwärts die Kulturkampfgesetze mäßigend und zurückhaltend anwendeten.[256]
6.3.2 Bischof
Die gravierendste Auswirkung des Kulturkampfes im Bistum Limburg war sicherlich die vom preußischen Staat verfügte Amtsenthebung von Bischof Blum. Aufgrund des systematischen Widerstands des Bischofs, der sich nicht nur in Verweigerung des schuldigen Gehorsam gegenüber den Landesgesetzen, sondern „auch in direkt und indirekt beförderter Aufreizung“ der ihm untergebenen Geistlichen und Diözesanen „zu gleich gesetzwidrigem Verhalten“ geäußert hatte, forderte der Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau, Freiherr August von Ende, Blum mit Schreiben vom 17. Oktober 1876[257] zur Niederlegung seines bischöflichen Amtes auf. Der Bischof war von seiner Praxis, geistliche Stellen ohne vorherige Anzeige selbständig zu besetzen, nicht abgerückt und ist konsequenterweise auch nicht der staatlichen Aufforderung nachgekommen, die vakanten Pfarreien nach vorgeschriebenem Modus zu besetzen. Die daraufhin verhängten Exekutivstrafen steigerten sich wegen Nichtbezahlens ständig höher und konnten auch durch Zwangseintreibung nicht vollzogen werden, denn Blum hatte seinen gesamten Besitz auf andere kirchliche Institutionen umgeschrieben. Das wenige, was der Gerichtsvollzieher 1874 im ohnehin nicht reich ausgestatteten bischöflichen Haushalt[258] pfänden konnte, war Blums Reisekutsche, Porträts des Kaisers und der Kaiserin, drei Kruzifixe, einige Ölgemälde und Blums goldenes Brustkreuz (Pectoral) mit Kette, das ihm zu seinem 25jährigen Konsekrationsjubiläum vom Klerus geschenkt worden war.[259] Doch diese Pfändungen riefen einen so großen Protest innerhalb der katholischen Bevölkerung hervor, dass bei den Versteigerungen in Limburg die Gegenstände von katholischen Bürgern ohne Gegengebote ersteigert wurden. Sie wurden in teilweise triumphalen Demonstrationszügen dem Bischof zurückgebracht und ihm als unpfändbare Leihgaben zurückübertragen.
Um einer drohenden Verhaftung zu entgehen, zog sich der mittlerweile 68jährige und gesundheitlich instabile[260] Blum in ein ihm von Fürst Karl zu Löwenstein angebotenes Exil auf Schloss Haid in Böhmen zurück. Einen Tag vor der Abreise regelte er die Übertragung seiner geistlichen Befugnisse an Domdekan Klein.[261] Außerdem verfasste er ein Antwortschreiben an von Ende[262], in dem er mittelte, dass die von Gott ihm auferlegten Pflichten gegen seine Diözesanen es ihm nicht erlauben würden, der Aufforderung zur Niederlegung seines Oberhirtenamtes zu entsprechen. Blum führte weiter aus:
„Eine staatsbehördliche Entlassung aus dem bischöflichen Amte gibt es rechtlich nicht; und eine factische Hemmung meiner geistlichen Wirksamkeit würde nur eine wol auch der Staatswohlfahrt nicht zuträgliche Steigerung des für mein Bisthum preußischen Antheils bereits vorhandenen kirchlichen Nothstandes herbeiführen [...]. Was [...] systematischer Widerstand gegen die Staatsgewalt genannt wird, ist in Wahrheit pflicht- und rechtmäßiges Festhalten an der vom Sohne Gottes seiner Kirche behufs Erfüllung ihrer überirdischen Mission verliehenen unentbehrlichen Freiheit und Selbständigkeit [...].“
Auf die Schwierigkeiten der Bischöflichen Verwaltung aus dem Exil heraus soll unter 6.4 noch eingegangen werden. Insgesamt sieben Jahre dauerte Blums Exil, bis er am 8. Dezember 1883 die offizielle Nachricht seiner Begnadigung erhielt. Seinem Sekretär Höhler war angesichts der Heimreise des Bischofs gar nicht wohl zu Mute, denn die Aufregung habe Blum magenleidend und appetitlos gemacht. Er fürchtete, die Aufregung bei einem feierlichen Empfang könnte dem Heimkehrer schwer schaden: „Er ist nervös arg herunter. Mir bangt so schon.“[263] Doch der triumphale Empfang des so lange vermissten Bischofs ließ sich nicht verhindern. Am 19. Dezember traf Blum in einem
Sonderzug von Frankfurt im mit Fahnen, Kränzen und Ehrenpforten festlich geschmückten Limburg ein. Ein ausführlicher Bericht des „Nassauer Boten“ vom 20. Dezember[264] schrieb dazu unter anderem:
„Überrascht war jeder Begleiter des Hochwürdigsten Herrn von der Begeisterung die sich auf der ganzen Route in Böllerschießen, Glockengeläute, Musikbegrüßung und Hochrufen kundgab; auch die weitgehendsten Hoffnungen des Festkomites in Limburg wurden durch die Betheiligung der Bürgerschaft wie der Bewohner der näheren und ferneren Umgebung übertroffen. Besonders befriedigt äußerte sich der Hochwürdigste Herr Bischof über den Empfang, den ihm seine Bischofsstadt bereitet hat; wohl habe er gedacht, daß die Stadt ihn mit einer entsprechenden Feier empfangen würde, aber das Gebotene habe alle Vermuthungen weit übertroffen.“
Auch der liberalen „Neuen Würzburger Zeitung“ blieben die Ereignisse in Limburg nicht verborgen, sie sah die Rückkehr des Bischofs aber keineswegs so enthusiastisch wie der katholische „Nassauer Bote“. In der Ausgabe vom 21. Dezember[265] schrieb sie:
„Ohne die Unterstützung der konservativen Partei hätten die Klerikalen es niemals dahin bringen können, dass soeben ein wegen andauernder, absichtlicher Verletzung der Staatsgesetze, wegen prinzipieller Leugnung des Gesetzgebungsrechts des Staates aus dem Amte entlassener Bischof zur Wiederaufnahme seines Amtes als Triumphator in „seiner Residenzstadt“ eingezogen ist, beharrend in der Renitenz gegen die Gesetze, seiner Diözese und allen Ultramontanen ein lebendiges Beispiel, daß man bei einiger Hartnäckigkeit klerikalerseits mit der preußischen Regierung fertig werden kann.“
Nur noch etwas länger als ein Jahr nach seiner Rückkehr blieb Bischof Blum am Leben, nach Verschlechterung seines Gesundheitszustandes im Herbst 1884 starb er am 30. Dezember 1884.
6.3.3 Orden und Kongregationen
Die ersten Ordensgeistlichen, die der Kulturkampf im Bistum erfasste, waren die Jesuiten in Marienthal und kurz darauf die Redemptoristen in Bornhofen und die Väter vom Heiligen Geist in Marienstatt. Zuvor waren Bischof Blum die antijesuitischen Aussagen des Darmstädter Protestantentags im Oktober 1871 nicht entgangen, der sich für ein staatliches Verbot des Ordens eingesetzt hatte. In einer öffentlichen Erklärung vom 17. Oktober 1871, die im „Nassauer Boten“ abgedruckt wurde[266], wollte der Bischof „den nichtswürdigen Verläumdungen entgegen [...] treten“, die indirekt auch den deutschen
Episkopat trafen, der sich der Mitwirkung der Jesuiten in seinen Diözesen bediente. Er wies darauf hin, dass sich die Jesuiten nichts hätten zuschulden kommen lassen, was den Vorstoß des Protestantentags rechtfertigen würde und bemerkte, dass ein solches Verlangen mit der gesetzlich garantierten Religionsfreiheit und Autonomie der Kirche unvereinbar sei.
Zu Blums Erklärung findet sich in den Akten des Ordinariats ein zustimmender Brief[267] aus der katholischen Hochburg Camberg. Dort hatte im Januar 1870 der Jesuitenpater Zurstraaßen eine „Marianische Congregation für die Arbeiter“ gegründet und ein Jahr später wurde von zwei Patres eine Mission abgehalten. Die im Brief angeführten Argumente zur Verteidigung der Jesuiten waren die gleichen wie in der Bischofserklärung.
„Was Ew. Bischöfliche Gnaden erklärt, ist unser Aller tiefinnerste unerschütterliche Ueberzeugung. Auch uns erfüllt es mit Abscheu und Entrüstung, Männer, deren einzige Lebensaufgabe die Arbeit für das wahre Wohl ihres Mitmenschen ist, Priester, die leuchtende Vorbilder der Sittenreinheit und heiligen Eifers sind, Gelehrte endlich, die wir im Kampfe für religiöse Wahrheit und göttliches Recht immer an der Spitze erblicken, durch grundlose Anschuldigungen aller Art einem künstlich eregten Haß der Menge geopfert zu haben. [...] Der confessionelle Friede ist durch ihr Wirken eher befestigt, als getrübt worden, auch unsere patriotischen Gesinnungen sind dieselben geblieben. [...] Uebrigens verhehlen wir uns nicht, dass es ein bedeutsames Zeichen einer ernsten und schweren Zeit ist, wenn wir einen planmäßigen Kampf eröffnet sehen gegen jenen Orden, der seit seinem Bestehen immer die Wahrheit des Katholicismus war, und wir wissen nur zu gut, daß ein Kampf gegen die Jesuiten so viel bedeutet, als ein Vorgehen gegen die katholische Kirche.“
Die letzten Zeilen lassen erkennen, wie offensichtlich das neun Monate später verabschiedete Jesuitengesetz von den Katholiken als Angriff auf ihre Kirche wahrgenommen wurde. Verfasst wurde der Brief wohl von den drei Erstunterzeichnern, alle Geistliche aus Camberg[268], aber beigefügt war eine Unterschriftenliste mit 692 Unterschriften aus der katholischen Gemeinde. Zudem berichtet Höhler von sechs großen Volksversammlungen zugunsten der Jesuiten, die nach Blums Erklärung binnen zwei Monaten in der Diözese abgehalten worden waren.[269]
Nachdem dessen Initiative zur Abfassung einer gemeinsamen Erklärung aller Bischöfe an der Ablehnung des Kölner Erzbischofs Melchers gescheitert war[270], griff er auf die Proteststrategie zurück, die er schon in nassauischer Zeit angewendet hatte: Er verfasste am 25. Juni 1872 eine Immediateingabe an Kaiser Wilhelm.[271] Darin appellierte er an die von Wilhelm 1866 gegebene Zusicherung der Segnungen der kirchlichen Verhältnisse Preußens. Zu einer ungekränkten katholischen Religionsausübung gehörte nach Blum aber unabdingbar die Freiheit des katholischen Volkes, sich nach den kirchenobrigkeitlich approbierten Ordensregeln üben zu können, so wie auch dem Weltklerus die unterstützende und ergänzende Hilfe des Regularklerus und dem Diözesanbischof das Recht, den Diözesanen die Segnungen der Ordenstätigkeiten zuzuwenden, gesichert bleiben müsse. Blum sucht also um das Vertrauen des Kaisers und führt an, dass es der Majorität des Reichstags, die den Jesuiten staatsgefährliche Tätigkeit unterstelle, niemals gelingen werde, für diese Behauptung einen irgendwie haltbaren Beweis zu erbringen. Er möchte, dass Preußen im Bundesrat gegen die Genehmigung der Reichstagsbeschlüsse gegen die Jesuiten stimme oder der Kaiser zumindest einem Bundesratsbeschluss seine Sanktion verweigere. Als dritte Forderung formuliert Blum, dass zumindest in seiner Diözese die Tätigkeit der als Wallfahrtspriester in Marienthal und Bornhofen und als Direktoren der Knabenrettungsanstalt in Hadamar angestellten Regularkleriker weiterhin gestattet werden solle. Er könne dafür, wenn dies staatlicherseits gefordert würde, von den Regularklerikern ein Treue- und Gehorsamsgelöbnis gegen den Kaiser und König und die bürgerlichen Gesetze verlangen, welches 1866 von jedem seiner Weltkleriker geleistet worden war. Überdies versichert er Wilhelm, dass er der Bezirksregierung jederzeit alle verlangt werdende Auskunft über den Personalstand in Bornhofen, Marienthal und Marienstatt geben und niemals gestatten würde, dass ein von der Staatsbehörde als illegal bezeichneter Ordensgeistlicher in seiner Diözese eine kirchliche Tätigkeit ausübe.
Eine Antwort sollte der Bischof erst 14 Tage nach Verabschiedung des Jesuitengesetzes am 18. Juli 1872 erhalten. Das Reichskanzleramt teilte ihm mit, dass seine ersten beiden Anträge nun ihre Erledigung gefunden hätten und der dritte in das Ressort des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten und des Inneren falle, an welchen die Immediateingabe weitergeleitet worden sei. Die Initiative Blums blieb also ohne jeglichen Erfolg, denn auf eine Antwort des Ministers wartete er noch am 14. März 1873[273]. Am 11. November 1872 verließen die Jesuiten Marienthal. Die von der Regierung der Societas Jesu als verwandt befundenen Orden der Redemptoristen und Väter vom Heiligen Geist mussten ebenfalls ihre Niederlassungen in Bornhofen und Marienstatt am 14. bzw. 12. Juli 1873 verlassen. Für den Bischof waren das schwere und tiefgreifende Beeinträchtigungen der katholischen Religionsausübungen, die sich mit dem Recht der katholischen Reichsbürger auf jene nicht vertrugen. Es war aber auch der staatliche Befund einer Verwandtschaft zwischen den drei Orden, den Blum in einer ausführlichen Eingabe an den Bundesrat widerlegen wollte; nicht nur, dass dieser Befund die jahrhundertealte Tradition und die gewachsene Vielfalt des Mönchtums einfach wegwischte, Blum sah die Gefahr, dass bald jeder Orden mit jedem in Verwandtschaft gebracht werden könnte und dann der Staat konsequenterweise alle religiösen Orden und Kongregationen verbieten würde. Tatsächlich wurden im preußischen „Klostergesetz“ vom 31. Mai 1875 alle Orden aus dem Staatsgebiet ausgewiesen; nur diejenigen, die der Krankenpflege verpflichtet waren, durften bestehen bleiben.[274]
Das schloss die ADJC und die Barmherzigen Brüder mit ein. Sie konnten als krankenpflegende Orden weiterbestehen, mussten aber ihre Erziehungstätigkeiten in ihren eigenen Schulen, Kindergärten und Waisenhäusern aufgeben[275] und wurden unter staatliche Aufsicht gestellt. Sie waren die einzigen religiösen Kongregationen, die im Bistum auch während des Kulturkampfes existierten, waren aber „praktisch reduziert auf den reinen Krankenpflegebereich und abgeschnitten von allen Möglichkeiten gesellschaftlich relevanter Einflussnahme“[276]. Durch Gründung von Niederlassungen in Holland hielten sie sich eine Rückzugsmöglichkeit offen, falls auch sie ausgewiesen werden sollten. Außerdem hatten sie ihren Besitz weitestgehend an ihre Niederlassungen außerhalb Preußens übertragen. Regierungsassessor Rabe, der 1877 zum staatlichen Kommissar für die bischöfliche Vermögensverwaltung in der Diözese ernannt wurde, stand mit seinen Kollegen, die in anderen preußischen Diözesen eingesetzt waren, und seinen Vorgesetzten in regem Informationsaustausch auch über das Bemühen der Regierung, gegen Scheinverträge über Klosterbesitz vorzugehen.[277]
6.3.4 Priesterausbildung
Die Ausbildung des Priesternachwuchses war mit dem preußischen Gesetz über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen 1873 unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Das Gesetz schrieb in § 4 ein dreijähriges theologisches Studium an einer deutschen Staatsuniversität und die Ablegung einer wissenschaftlichen Staatsprüfung (sogenanntes „Kulturexamen“[278] ) als Voraussetzung zur Bekleidung eines geistlichen Amtes vor. Das theologische Studium an einem bischöflichen Seminar war nur mit Erlaubnis des Ministers der geistlichen Angelegenheiten gleichwertig (§ 6). § 9 stellte unmissverständlich klar: „Alle kirchlichen Anstalten, welche der Vorbildung der Geistlichen dienen (Knabenseminare, Klerikalseminare, Prediger- und Priesterseminare, Konvikte etc.), stehen unter Aufsicht des Staates.“[279]
Oberpräsident Bodelschwingh forderte Bischof Blum daraufhin am 26. Mai 1873 auf, ihm mitzuteilen, ob Blum für das Limburger Seminar die staatliche Anerkennung nach § 6 wünsche. Zudem ersuchte er den Bischof, ihm Statuten, Lehrpläne und Personalverzeichnis zu übersenden.[280] In seinem Antwortschreiben vom 27. Juni[281] wies Blum darauf hin, dass § 6 keine Anwendung finde, weil das Priesterseminar keine philosophisch-theologische Lehranstalt sei (seit 1834 absolvierten die Studenten hier nur den einjährigen Seminarkurs[282] ). Auch erwiderte er Bodelschwingh, dass er außer Stande sei, zur Durchführung des Gesetzes seinerseits mitzuwirken und verwies auf einen gemeinsamen Protest der preußischen Bischöfe gegen dasselbe. Unter dem gleichen Datum ging aber ein Schreiben des Bischöflichen Ordinariats[283] an den Seminarregens Heinrich Lala. Darin wurde diesem mitgeteilt, dass die Bischöfe beschlossen hatten, dass die Hausordnung, das Disziplinar-Reglement und der Lehrplan von den Vorstehern der Seminare unter Mitteilung der vom Bischof eingelegten Verwahrung dem Oberpräsidenten auf sein Verlangen mitgeteilt werden könnten. Ebenso sei eine staatliche Inspektion der bau-, feuer- und sanitätspolizeilichen Verhältnisse, jedoch nicht der inneren Angelegenheiten, zu gestatten. Seminarregens Lala führte diese Anweisung präzise aus, wie seine Berichte[284] über die bis 1876 immer wieder neu angeordneten Inspektionen an das Ordinariat beweisen. Wegen Verhinderung der Revision wurden schon am 22. Dezember 1873 die dem Seminar und seinem Personal gewidmeten Staatsmittel gesperrt, und seine Schließung vom neuen Oberpräsidenten August von Ende am 10. April 1876 verfügt. Bis 1887 wurden die Theologiestudenten der Diözese in Bayern ausgebildet und dort auch provisorisch angestellt.[285]
6.4 Die Koalition zwischen Klerus und Laien
Nach Darstellung der Hauptelemente des Kulturkampfes im Bistums soll nun gefragt werden, was er für die Beziehung zwischen Klerus und Gläubigen bedeutete. Man geht davon aus, dass der Kulturkampf, entgegen seiner Intention als Säkularisierungsmaßnahme, als Katalysator die ohnehin schon starke gewachsene Koalition von Klerus und Gläubigen noch weiter zusammenschweißte.[286] Lässt sich aber tatsächlich eine bedingungslose Loyalität der Katholiken zu den Geistlichen feststellen? Oder gab es auch entgegen der oft zu findenden Aussage über die „Geschlossenheit“ der Katholiken negative Beispiele? Einige exemplarische Episoden sollen hierfür herangezogen werden.
Für diese Fragestellung sind m. E. auch die deutschen katholischen Bewegungen relevant, die sich aus ihrer liberalen Grundhaltung heraus von der Amtskirche abgespalten haben. Diese freireligiösen Bewegungen sind als Protestbewegungen zur religiösen Erneuerung zu verstehen, ihnen entsprachen auf protestantischer Seite die „Lichtfreunde“; zudem dynamisierten demokratische Kräfte des Vormärz diese Initiativen. Eine erste solche katholische Bewegung formierte sich in Reaktion auf die Trierer Rockwallfahrt, ihre Anhänger bezeichneten sich später als „Deutschkatholiken“[287]. Der zeitgenössischen Kritik gegen dieses inszenierte „Götzenfest“[288] schloss sich auch eine Stimme aus Nassau an. Einer der führenden Liberalen des Herzogtums, der Katholik Karl Braun, verfasste 1844 anonym eine entsprechende Streitschrift.[289] Darin prangerte er die Wallfahrt als Inszenierung von Adel und Klerus an und kritisiert, dass die Pilger fast durchweg den „armen Volksklassen“, deren Elend täglich wachse, zugerechnet werden müssten. Auch wenn Braun später von seiner Streitschrift abrückte und weiterhin in der katholischen Kirche verblieb[290], fühlten sich viele andere Gleichdenkende von den Ereignissen in Trier so stark abgestoßen, dass sie mit dieser katholischen Kirche nichts mehr zu tun haben wollten. Bischof Blums Reaktion folgte in einer Predigt am 23. April 1845[291] im Limburger Dom. Darin ließ er an seinem strengen Kirchenbewusstsein keinen Zweifel und bezeichnete die Deutschkatholiken als „eben so wenig wahrhaft deutsch, als wahrhaft katholisch gesinnt“.
1848 erhielten die Deutschkatholiken im Herzogtum Nassau Korporationsrechte, konnten sich aber nicht zu einer größeren Bewegung ausweiten. 1859 schlossen sich die Deutschkatholiken mit den protestantischen „Lichtfreunden“ zum Bund freireligiöser Gemeinden Deutschlands zusammen.
Die zweite Protestbewegung, die später als „Altkatholiken“ bezeichnet wurde, entzündete sich an den Beschlüssen des Vatikanischen Konzils, namentlich am Unfehlbarkeitsdogma. Zentrum der Bewegung war wieder der gemischtkonfessionelle Regierungssitz Wiesbaden, wo eine starke Schicht liberaler Katholiken existierte.[292] Der dort erscheinende „Rheinische Kurier“ schrieb in seiner Ausgabe Nr. 59 vom 10. März 187 1[293]:
„Schon im Juli v. Js. war in katholischen Kreisen der Diöcese Limburg eine Kundgebung gegen die Decrete über die absolute Gewalt des Papstes und dessen persönliche Unfehlbarkeit als Entscheidungen eines ökumenischen Concils und gegen die dadurch herbeigeführte, mit dem überlieferten Glauben der Kirche in Widerspruch stehende Neuerung in der Vorbereitung begriffen, deren Ausführung nur in Folge des ausgebrochenen Krieges unterblieben ist. Jetzt, wo der Friede hergestellt und der unterbrochene Kampf gegen den Ultramontanismus wieder mit voller Hingebung aufgenommen werden kann, ist diese Bewegung von Neuem in Fluß gekommen. [...] Da die deutschen katholischen Kirchenfürsten, obgleich sie vorzugsweise diesen Beschlüssen des Concils in Rom den hartnäckigsten Widerstand entgegengesetzt hatten, jetzt jede Opposition aufgegeben und sich unterworfen haben und auch der übrige Clerus mit winzigen Ausnahmen eine andere Haltung nicht genommen hat, so ist selbstverständlich der katholische Laienstand auf sich selbst angewiesen. An überzeugungstreuen Führern, die in der katholischen Wissenschaft die erste Stelle einnehmen, wie Schulte, Döllinger etc. fehlt es nicht; es wird nur darauf ankommen, daß der katholische Laie, welcher an das neue Dogma nicht glaubt - und wie viele glauben wol daran? - auch den Muth hat, seine Ueberzeugung öffentlich zu bekennen.“
In der Ausgabe Nr. 97 der gleichen Zeitung vom 25. April 1871[294] findet sich folgende Annonce des „Comités für die Bewegung gegen die päpstliche Unfehlbarkeit in der Diöcese Limburg“:
„In Erwägung, daß die im Vatikan gehaltene Versammlung nicht mit voller Freiheit berathen und wichtige Beschlüsse nicht mit der erforderlichen Uebereinstimmung gefasst hat, erklären die unterzeichneten Katholiken, dass sie die Decrete über die absolute Gewalt des Papstes und dessen persönliche Unfehlbarkeit als Entscheidungen eines ökumenischen Concils nicht anerkennen, vielmehr dieselben als eine mit dem überlieferten Glauben der Kirche im Widerspruch stehende Neuerung verwerfen.“
Insgesamt 39 Unterzeichner werden mit Namen und Beruf genannt, sie stammen alle aus Wiesbaden. Weitere solche Annoncen mit neuen Namen folgten in den Ausgaben vom 21. und 24. Mai, sowie vom 16. Juli 1871.
Tatsächlich unternahm die bischöfliche Leitung nun stärkere Anstrengungen, die aufkeimende Protestbewegung an einem Ausweiten zu hindern, als bei den Deutschkatholiken. In erster Linie geschah das durch eine umfassende Informationspolitik, in Hirtenbriefen und Verbreitung von Broschüren. Aber auch die Pfarrer werden von Bischof Blum ermahnt, die Situation genau im Auge zu behalten. Im Amtsblatt vom 14. März 1871 ermahnte er „sämmtliche Herren Pfarrgeistlichen auf das Dringendste, alle Mittel aufzubieten, welche Seeleneifer und Pastoralklugheit ihnen an die Hand geben, um zu verhüten, dass nicht noch Andere zum Ungehorsam gegen die Beschlüsse der allgemeinen vaticanischen Kirchenversammlung und damit zum Abfall von der Wahrheit verführt werden.“[295] Besonders die Katholiken, die noch „von Herzen an der katholischen Glaubens- und Sittenlehre festhielten“, sollten vor den „Verführern“ beschützt werden. Konkret wurden die Pfarrer wie folgt angewiesen:
„ [...] wird es sich empfehlen, wenn diejenigen Herren Seelsorger, in deren Gemeinden Anstrengungen zur Erlangung von Unterschriften zu der gedachten Erklärung entweder bereits gemacht worden, oder doch mit Grund zu besorgen sind, ihre Parochianen alsbald von der Kanzel vor diesen äußerst gefährlichen Schlingen liebevoll und ernstlich warnen und dabei hauptsächlich betonen, dass der Beitritt zu dieser Erklärung gleichbedeutend ist mit einer vollständigen Auflehnung gegen die Auctorität der Kirche [...]; und daß sowohl diejenigen, welche sich zur Unterschrift haben verleiten lassen, weder im Leben der hl. Sacramente, noch nach dem Tode des kirchlichen Begräbnisses theilhaftig werden können, wenn sie sich nicht vorher wieder aufrichtig bekehrt, und das gegebene Ärgerniß durch einen öffentlichen Widerruf gut gemacht haben.“
Denn nur im Schoße der heiligen katholischen Kirche, so schließt Blum, ist allein das Heil und der wahre Seelenfrieden für die vom Glauben Abgefallenen zu finden. Die altkatholische Gemeinde wurde mit der Anerkennungsurkunde des altkatholischen Bischofs Reinkens[296] vom preußischen Staat offiziell anerkannt. Aber auch ihr fehlte eine Massenbasis, die Altkatholiken blieben, wie Nipperdey schreibt, „eine Gelehrtenhäresie, eine kleine Protestkirche bürgerlicher Bildung. [...] Der Traditionalismus des Kirchenvolkes und die ultramontane Vorprägung war stärker, das neue Dogma war nicht von so elementarer Bedeutung und vitaler Bewegkraft, um eine Spaltung zu begründen.“[297]
Für die Fragestellung nach der Koalition zwischen Klerus und Gläubigen in der Kulturkampfzeit kann man thesenhaft festhalten, dass sich hier in den innerkatholischen Protestbewegungen nach der Trierer Rockwallfahrt und dem Ersten Vatikanum bereits schon abgespalten hatte, was sich aus einer liberalen Prägung heraus abspalten wollte und nicht bereit war, der katholischen Kirche in den Kulturkampf zu folgen. Dieser Umstand würde also im Gegenzug für eine starke Koalition zwischen Klerus und den nunmehr „verbliebenen“ katholischen Laien zeugen.
Doch wie kann diese angenommene Koalition aus heutiger Sicht nachvollzogen werden? Blicken wir dafür zunächst auf Bischof Blum, der in seinem böhmischen Exil von den Ereignissen vor Ort abgeschnitten war. Er machte sich Sorgen um die Vorgänge in den Gemeinden und wollte den Informationsfluss an ihn regeln, so dass er nicht mehr auf Einzelstimmen und Gerüchte angewiesen sein sollte. Seinem Stellvertreter Klein schrieb er 1881[298]:
„Die noch immer andauernde kirchliche Nothlage und Behinderung der regelmäßigen Diözesan-Verwaltung, sowie verschiedene mir zu Ohren gekommne höchst unerfreuliche Berichte über Vorgänge in einzelnen Pfarreien meines Sprengels haben mich zu dem Entschlusse geführt, die Dekane zur regelmäßigen Einsendung der von ihnen amtlich zu erstattenden Berichte an mich aufzufordern, damit ich künftig mehr als bisher die mir von Gott anvertraute Diözese überwachen und gegebenen Falles die nöthig und möglich erscheinenden Maßregeln treffen könne.“
Durch regelmäßige Berichte der Dekane also wollte Blum seinem „schweren Herzen“, hervorgerufen durch die Ungewissheit über die Zustände in der Diözese, wenigstens teilweise gerecht werden. Darüber hinaus richtete er an die Domherren die Anfrage, ob diese nicht über Ostern für einige Wochen in verwaisten Pfarreien ihren Wohnsitz nehmen könnten, „um den Leuten den Empfang der hl. Sacramente zu erleichtern und die Wohlthaten einer regelmäßigen Seelsorge zu spenden“.
„Ein solches Opfer würde gewiß in der ganzen Diözese einen überaus günstigen Eindruck hervorbringen und den Herrn zugleich Gelegenheit geben, die kirchlichen Zustände des Sprengels wie sie sich während des Stillstandes der Ordinariatsthätigkeit entwickelt haben, näher kennen zu lernen sowie etwaigen Übelständen durch Wort und Beispiel abzuhelfen.“ Aus diesen Zeilen spricht der volksnahe, väterliche Bischof, der sich im Exil isoliert fühlte von seiner Gemeinde, die stets, und besonders in dieser „schlimmen“ Zeit, seiner seelsorgerlichen Obhut bedarf. Entsprechend hatte er auch in der Zeit vor seinem Exil sehr viel Wert darauf gelegt, die verwaisten Pfarreien persönlich zu besuchen, dort Gottesdienst zu halten und „sie zum Ausharren in der Treue gegen die Kirche zu ermutigen“[299].
Klein versuchte daraufhin, den Bischof zu beruhigen. Die Punkte, über die Blum Auskünfte verlange, seien bereits nach Tunlichkeit geregelt. Klein zeigte sich als Herr der Lage und gab an, fast alles beantworten zu können, was für den Bischof von Interesse sei. Der Wunsch Blums, die Domkapitulare sollten Wohnung in verwaisten Pfarreien nehmen, stieß bei den vielbeschäftigten Betroffenen auf keine große Gegenliebe und schien ihnen aufgrund der angespannten Finanzlage auch nicht ratsam. Klein schreibt dazu[300]:
„Es ist die Frage, ob sich an diesen Landorten, wie überhaupt in den verwaisten Pfarreien eine leidliche Unterkunft finden lasse. In der Regel wird es der Fall nicht sein, da die Wirtshäuser meistens nur für ganz geringe Leute berechnet sind.“
Blum nahm den Domherren diese Entscheidung nicht übel. Er dankte Klein für dessen Eifer in der Verwaltung der Diözese. Deshalb trage er auch keine Bedenken, wenn dieser nach eigener Maßgabe die Dekane zur regelmäßigen Einsendung von Berichten veranlasse und sie in Form von Referaten an Blum weiterleite [301]:
„Auf diese Weise werde ich einerseits besser als bisher von dem Stande der Dinge in der Diözese unterrichtet und in die Lage gesetzt werden, die Pflichten meines Oberhirten-Amtes, so weit dies gegenwärtig thunlich, zu erfüllen; andererseits aber wird unter meiner Geistlichkeit das Bewusstsein wieder lebendiger werden, dass die Bischöfliche CentralVerwaltung der Diözese, wenn auch nicht in dem früheren Umfange, so doch in der Ausdehnung weitergeführt wird, welche zur Aufrechterhaltung der Ordnung nothwendig ist.“
Die daraufhin gesammelten Visitationsberichte der Dekane[302], die aus der Hochphase des Kulturkampfes (1877-1881) datieren, sind höchst aufschlussreich für unsere Fragestellung nach dem Verhältnis der Laien zu ihren Geistlichen und sollen im folgenden referiert werden.
Die Visitationsberichte aus dem Dekanat Eltville fallen positiv aus, die Priester hier würden die Katechese in den Schulen gut verrichten und in befriedigendem Maße Anschaffungen für ihre Kirchen tun.
Der Dekan von Höchst, Dr. Kratz, meldete am 29. Juni 1879, dass in den drei verwaisten Pfarreien Höchst, Hattersheim und Hofheim jeweils noch ein Priester Dienst tue.
„In den übrigen Pfarrein geht alles in gewohnter Ordnung, die Geistlichen helfen sich wechselseitig treu aus. Die Wahl der Kirchenvorstände ist im Ganzen genommen gut ausgefallen, so dass die Pfarrer nach wie vor die Leiter derselben sind. Ausnahme macht Hofheim.“
Der Dekan von Rennerod berichtete am 26.1.1879 aus der verwaisten Pfarrei HöhrSchönberg:
„Gegenüber dem Versuche, der Gemeinde durch maigesetzliche „Wahl“ einen Seelsorger zu geben, haben die Gläubigen ihre kirchliche Treue bewärt, indem der Kirchenvorstand einen von „Wahlberechtigten“ zahlreich unterschriebenen Protest dem mit der Leitung der Wahl beauftragten Landrath aushändigte, worauf weitere derartige Versuche unterblieben.“
Auch Dekan Herzmann von Limburg konnte positives berichten: Am 28. Dezember 1877 teilte er mit, die Bewohner der verwaisten Gemeinden Niederbrechen und Werschau gingen „fleißig“ zum Gottesdienst in die benachbarten Gemeinden nach Lindenholzhausen, Oberbrechen und Villmar. „Eine Civilehe ohne kirchliche Trauung ist hier nicht zu fürchten.“ Auch zwei Jahre später war die Kirchentreue der Niederbrechener und Werschauer ungebrochen, wie Herzmanns Bericht vom 29. Dezember 1879 zeigt: „Besser sieht es in den beiden anderen verwaisten Pfarreien Niederbrechen u. Werschau aus. Seit Spätsommer functionirt in beiden Orten der Neopresbyter Eberz von Hadamar bis jetzt ohne die geringste Störung. Ich habe ihm Unterkunft besorg bei [...] einer braven Familie in Niederbrechen; unter dem Titel „Hauslehrer“ ist er bei der Polizei angemeldet, hat nobles Logis und gute Kost ganz umsonst, wofür er dessen Kinder in den Elementargegenständen etwas nachhilft. Er hält jeden Tag seine hl. Messe und binirt an Sonn- u. Feiertagen nach Werschau, wofür ihn beide Gemeinden durch den Klingelbeutel honoriren.“
Dieses vergleichsweise ungestörte Treiben musste früher oder später den staatlichen Behörden zur Kenntnis gelangen. Und in der Tat berichtete Dekan Herzmann zwei Jahre später, am 27. Dezember 1881:
„[...] Aehnlich handelte der Landrat auch in Niederbrechen. In einem Schreiben an den dortigen Bürgermeister, einige Tage vor der Wahl, fordert er diesen zum Bericht auf über einen Geistlichen, welcher sich daselbst niedergelassen u. alle amtlichen Functionen vornehme. Der H. Bürgermeister hat ihm berichtet, dass er von einem solchen Geistlichen in Niederbrechen nichts wisse. Der daselbst wohnende Geistliche sei Hauslehrer, wie H. Landrat ja selbst schon 2 Jahre wisse []; die von ihm verlangte Anzeige über jede unbewiesene Amtsfunction weise er zurück; denn dazu gebe er sich nicht her, weil er nicht von seiner Gemeinde u. jedem guten Katholiken verflucht werden wolle. Die Folge war 6 M. Strafe [...].“[303]
Besonders der letzte Satz lässt aufhorchen, in ihm wird der Interessenskonflikt der lokalen Beamten zwischen dem geschuldeten Gehorsam gegenüber dem Staat und gegenüber der Kirche formuliert: Der Bürgermeister von Niederbrechen (wahrscheinlich wie die überwiegende Mehrheit seiner Gemeinde auch Katholik) hatte hierbei klare Prioritäten zugunsten der geistlichen Autorität gesetzt. Ihm war aber auch ein friedliches Leben vor Ort wichtiger als sich in gehorsamer Befolgung der Staatsgesetze zum Außenseiter in seinem Dorf und Märtyrer des Staates zu machen. Anders dagegen gestaltete sich die Situation in Obertiefenbach, wie Dekan Herzmann im Bericht von 1879 schreibt:
„Am schlimmsten sieht es seit der Sperre des H. Pfarrer Schraeder in Obertiefenbach aus. Weil er den schlimmen Gendarm auf dem Nacken sitzen hat, ist daselbst nichts zu machen. Mit der größten Vorsicht kann er kaum die Kranken ansehen. Alles andere ist ohne Anzeige ganz unmöglich. Einige schlechte Elemente hängen sogar mit dem Gendarm heimlich zusammen (Bürgermeisterwahl!).“
Aber auch die Verhältnisse in Obertiefenbach veränderten sich. Hatte der Dekan am 26. Juni 1880 noch berichtet, dass gegen ihn selbst wegen Abhaltung von Gottesdienst in Obertiefenbach Anklage erhoben worden war[304], so meldete er ein halbes Jahr später (am 28. Dezember) ohne genauere Angabe von Gründen, dass der Pfarrer dort seit Juli wieder ungestört seine pfarramtlichen Funktionen erfüllen könne.
Aus Obertiefenbach stammt auch ein eigentümliches Dokument aus der beginnenden Kulturkampfzeit. Es fand sich 1986 bei Bauarbeiten in der dortigen Grundschule und ist von Marie-Louise Crone in seinen historischen Zusammenhang gebracht worden.[305] Es handelt sich dabei um eine selbstbetitelte „Urkunde“ aus dem Jahr 1874, verfasst von „sieben Knaben der Knabenschule zu Obertiefenbach, welche alle im Jahre 1874/75 in der hintersten Bank saßen“, alle aus dem Jahrgang 1861.[306] Der eigentümlichen ,Arenga’ folgt die Auflistung von 7 Namen und danach folgender Text:
„Wir sind treue Anhänger der katholischen Kirche und unsers hochwürdigsten Herrn Bischofs Joseph Blum. Wir gehen zum H. Lehrer Geis in die Schule. Unser Pfarrer heißt J. Schrädter. [...] Am 28ten Jahrestag der Erwählung unseres hl. Vaters Papst Pius IX.“
Gerade dieser Text ist es, was dieses Zeugnis für die Nachwelt, vielleicht verfasst während einer langweiligen Schulstunde, für unsere Fragstellung interessant macht. Wie Crone nachweist, hatten die 13jährigen Schüler drei Wochen vor der Abfassung ihrer Urkunde von Bischof Blum in der Stadtkirche von Limburg die Firmung erhalten. Diese persönliche Begegnung kann einen so nachhaltigen Einfluss auf sie gemacht haben, dass sie ein begeistertes Zeugnis für ihre Kirche und ihren Bischof abgeben wollten.[307] Die Datierung der Urkunde auf das genaue Datum der Erwählung von Papst Pius IX (16. Juni) erklärt sich aus dem Bestreben von Bischof Blum, aus dem Jahrestag der Krönung des Papstes (21. Juni) im Jahr 1874 eine große Manifestation für die bedrängte Kirche zu organisieren.[308] Er selbst nahm an diesem Tag an einer Prozession zum Heilborn, einem Wiesenhügel nahe bei Dernbach, teil, wo sich 8000-10.000 Menschen versammelten.[309]
Zuletzt muss noch daraufhin gewiesen werden, dass staatliche Kulturkampfgesetze durch das Verhalten der Gläubigen ad absurdum geführt wurden. Höhler schreibt über die Verhältnisse in den verwaisten Pfarreien:
„Die Gendarmerie bekam einen schweren Stand; die Glocken blieben stumm, die Zeit der hl. Messe wurde von Haus zu Haus in aller Stile angesagt. Zur bestimmten Stunde fand sich die Gemeinde in der Kirche ein; ringsum auf den Höhen standen Wachtposten [...]. Selbst der Schuljugend hatte sich eine solche Begeisterung bemächtigt, dass sie dabei mitwirkte [...].“[310] Auch Bismarck bilanzierte in seinen „Gedanken und Erinnerungen“ kritisch:
„Erst durch die Praxis überzeugte ich mich, daß die juristischen Einzelheiten psychologisch nicht richtig gegriffen waren. Der Mißgriff wurde mir klar an dem Bilde ehrlicher, aber ungeschickter preußischer Gendarmen, die mit Sporen und Schleppsäbel hinter gewandten und leichtfüßigen Priestern durch Hintertüren und Schlafzimmer nachsetzten.“[311]
Zwischenergebnis: Der Kulturkampf förderte innerhalb des Limburger Klerus die Uniformierung eines eigenen Standesbewusstseins. Durch Vereinheitlichung der Interessen, Intensivierung des Gruppenzusammenhalts, der sich praktisch in kollegialen Aushilfstätigkeiten ausdrückte, und die stärkere Aufsicht durch das Bischöfliche Ordinariat, das besonders in dieser Zeit sensibilisiert war für jedwedes abweichende Verhalten, wurde ein kollektives Selbstbild der Geistlichen stärker als in früheren Zeiten erzeugt.
Im Verhältnis zwischen Klerus und Gläubigen ist die Erfahrung der Laien von entscheidender Bedeutung, dass die Geistlichen vor Ort, und besonders die so genannten „Sperrlinge“ häufig auf ihre Hilfe angewiesen waren, sowohl existenziell (durch Vorgaben des Brotkorbgesetzes), aber auch in einer gemeinsamen „konspirativen Verschwörung“ gegen den Staat und seine als unrecht empfundenen Gesetze. Laien mussten bestimmte Sachverhalte verschweigen, positionierten sich den Staatsgesetzen entgegen und verstießen zum Teil auch aktiv gegen sie. Diese Erfahrung führte sicherlich nicht nur zu einem verzerrten Gerechtigkeitsgefühl in der Wahrnehmung des Staates, sondern auch zu einem größeren Zusammenwachsen der Katholiken. Ob aber dadurch eine unterstellte Führungsposition der Geistlichen für ihre Parochianen realiter gefestigt werden konnte, ist fraglich. Wahrscheinlich erwuchs aus der Koalition eher ein partnerschaftliches Verhältnis, resultierend aus dem Aufeinander-Angewiesensein. Dem entspricht auch ein Befund aus den Visitationsberichten der Dekane aus den Jahren 1879 bis 1881: An mehreren Stellen wird dort erwähnt, dass die Gehälter der Pfarrer durch die Gemeinden verringert wurden. Diese erkannten also die Möglichkeit der Einflussnahme, die sie durch die neuen Kirchenvorstände ausüben konnten.
Auf jeden Fall wäre die Durchsetzung einer Forschungsthese, die die katholischen Laien im Nachhinein für unmündig erklärt, indem sie den Geistlichen zuviel Einfluss auf sie einräumt, falsch und verheerend. Anderhub erwähnt ein exemplarisches Beispiel, in dem katholische Laien klar ihre Wünsche darüber äußerten, wie sich ihre Pfarrer zu verhalten hätten.[312] In der Zeit des Kulturkampfes wollten die Gemeinden nicht, dass sich ihre Pfarrer unter diesen spezifischen Umständen per eindeutiger Erklärung zu treuen Staatsdienern machten. Man zeigte sich stattdessen lieber solidarisch. Der Versuch des preußischen Staates, die katholische Kirche zu „entklerikalisieren“ war völlig absurd und sein Scheitern vorprogrammiert. Besonders Bischof Blum war spätestens seit seiner Exilszeit zum katholischen Volkshelden geworden.
6.5 Das Verhältnis der katholischen Laien zum Staat am Beispiel der Sedanfeier
Offene Unmutsbekundungen der katholischen Bürger, denkbar z.B. in tätlichen Angriffe auf Amtsträger oder öffentlich ausgesprochenen Schmähungen, sind nicht bekannt. Der Protest war passiv, aber nicht weniger ausgeprägt.
Umgekehrt muss aber der Blick der Forschung erst noch geschärft werden für Ereignisse, die für positiv besetzte Einstellungen von katholischen Bürgern zum Staat zeugen. Die Gründung des Deutschen Reiches 1871 wurde sicherlich nicht nur von liberalen Zeitgenossen freudig begrüßt. Deutlich zeigen sich divergierende Meinungen von Laien und Klerus im Bistum Limburg bei der Etablierung eines nationalen Gedenk- bzw. Feiertages am Jahrestag der Kapitulation der französischen Armee bei Sedan (1./2. September 1870). Der deutsche Episkopat vertrat eine eindeutige, ablehnende Stellung, wenn es um die Beteiligung der katholischen Kirche an diesen Feiern ging. Formuliert wurde sie u.a. vom Mainzer Bischof Ketteler, der in einem Ausschreiben 1874[313] den Ursprung der Sedanfeier nachzeichnete: Sie gehe nämlich „nicht vom gesammten deutschen Volke aus, sondern hauptsächlich von einer Partei“. Diese Partei sei „dieselbe, welche in der Gegenwart an der Spitze des Kampfes gegen das Christenthum und die katholische Kirche steht“. Sie wolle nicht so sehr den deutschen Sieg feiern, sondern ihren eigenen Sieg über die katholische Kirche und diese mit der vorgeschobenen Forderung nach patriotischer Gesinnung auch noch vor ihren Triumphwagen spannen. Dazu wolle sich die Kirche aber nicht hergeben: „Mag man immerhin uns den Patriotismus absprechen: Wir wollen lieber diesen Schimpf tragen, als unter Hohngelächter unsere Religion für solche Zwecke entwürdigen.“ Da die Katholiken Deutschlands „nicht zu gleicher Zeit blutige Thränen weinen und Freudenfeste feiern“ könnten, solle jedes feierliche Geläute und jede Art von Gottesdienst mit Charakter eines Freudenfestes unterbleiben. Erlaubt werden solle aber ein Gebet oder Bittamt für „unser deutsches Vaterland“ und die „innere Einheit“, da dies „immer unsere Pflicht ist“. Aber nicht nur in der katholischen Geistlichkeit, sondern auch in der lutherischen regte sich Protest gegen die gewünschte kirchliche Partizipation zur Sedanfeier: Oberpfarrer Kümmel aus Marburg teilte dem dortigen Bürgermeister im Namen des lutherischen Ministeriums am 27. August 1874 mit, dass man gegen ein aus der Stadtkasse finanziertes Glockengeläut nichts einzuwenden habe, fährt aber fort:
„Wir können aber unser Befremden darüber nicht zurückhalten, dass man der Kirche, bezw. der Geistlichkeit die Abhaltung eines Gottesdienstes zumuthet, der erfahrungsmäßig von den Gliedern der Gemeinde fast gar nicht, vielmehr nur von den wenigen eigentlichen Festtheilnehmern besucht zu werden pflegt. Auffallend ist es dabei, dass ein großer Theil der Festgenossen die Gottesdienste, welche die Kirche zur Ehre Gottes und zur Verherrlichung Seiner großen Erlösungs- und Friedensthaten feiert, spärlich oder fast nicht besucht, dagegen verlangt, dass die Kirche, welche den Frieden predigt, zur Verherrlichung von Kriegsthaten herbeigezogen werden soll auf welche neues Blutvergießen und nicht der Friede erfolgt ist. Mögen solche Ereignisse zu Volksfesten geeignet erscheinen, im Interesse der Kirche liegt eine solche Feier jedenfalls nicht und kann auch schwerlich der allgemeine Wunsch der Kirchengemeinde sein, wie die geringe Betheiligung an der kirchlichen Feier bisher deutlich genug bewiesen.“[314]
Kümmels Hauptargumente gegen einen speziellen Festgottesdienst waren also im Unterschied zu Kettelers, dass nach einem solchen weder besonders große Nachfrage innerhalb der Gemeinde bestehe, sondern vielmehr von Leuten gewünscht werde, die ansonsten eher unkirchlich waren, und dass der Anlass (die „Verherrlichung von Kriegstaten“) der christliche Lehre widerspreche.
Doch zurück zu den Katholiken im Bistum Limburg: Am 4. September 1874 traf im Ordinariat ein Telegramm aus Höchst ein, adressiert an Bischof Blum. Der Inhalt lautete: „Trotzt des Verbots seitens der Katholiken Geistlichkeit ertheilte uns Königlicher Regierungspräsident [...] Erlaubniß zum Läuten der Kirchglocken welche dann auch gestern und heute zur Verherlichung der Sedanfeier geläutet wurden, dies erlaubt sich mitzutheilen Comité für Sedanfeier.“[315]
Sofort wurde eine kirchliche Untersuchung eingeleitet. Sie sollte erstens herausfinden, ob die Kirchenglocken wirklich geläutet wurden, zweitens wenn ja, von wem und drittens wer sich hinter dem „Comité für Sedanfeier“ verbirgt. Dazu berichte Pfarrer Schmidt aus Höchst am 21. September 1874[316]:
„Ein Comitémitglied, Dachdecker Sonntag, erschien am Tage vor genannter Feier bei mir mit dem Ansuchen, daß bei der Sedanfeier das Glockengeläute gestattet werden möge. Demselben erwiderte ich, daß das fragliche Geläute von mir nicht gestattet werden könne, da diese Feier
eine außerkirchliche sei und zu diesem Zwecke [...] eine Autorisation von Seiten des Bischöflichen Ordniariates erfolgen müsse, worauf der Genannte sich wieder entfernte. Ich bemerkte ihm noch, daß, wenn in der fraglichen Angelegenheit eine Weisung mir zukommen sollte, ich ihm Mittheilung machen wolle.
Am folgenden Tage, am Vorabend der Feier kam der Präsident des hiesigen Kriegervereines Kälber und zeigte mir ein inzwischen eingeholtes Telegramm des Königl. Regierungspräsidiums zu Wiesbaden vor, worin angezeigt war, dass das Geläute am Vorabend u. am andern Morgen stattzufinden habe; worauf ich mein früheres Verbot nicht zurüknehmen zu können erklärte.“
Dennoch wurden die Kirchenglocken, zu denen der Zugang nicht verschlossen war, geläutet. Die Ereignisse von Höchst scheinen nach Aktenlage singulär für das Bistum gewesen zu sein. Diese Singularität entspricht auch Untersuchungsbefunden aus anderen Regionen, so dass man sich an dieser Stelle dem Urteil von Eleonore Föhles anschließen kann: „Der Tag des militärischen Sieges bei Sedan entwickelte sich nach 1871 relativ schnell zum eigentlichen Reichsfeiertag. Im Kulturkampf wurde er ,protestantisch- antikatholisch überformt’ (Nipperdey), weshalb die Katholiken darauf mit Boykotten reagierten. [...] Ein Festgeläute zum Sedantag wurde erst in den 80er Jahren nach und nach eingeführt.“[317]
In Zusammenhang mit der Sedanfeier ist auch die Errichtung des Nationaldenkmals im Niederwald über Rüdesheim im Rheingau zu nennen. Das 37,6 Meter hohe NiederwaldDenkmal wurde nach sechsjähriger Bauzeit am 28. September 1883 eingeweiht. Der „Nassauer Bote“ kontrastierte in seiner Ausgabe vom 4. September 1883[318] dieses neue gewaltige Nationalsymbol mit den katholischen Kirchenverhältnissen in der Region:
„[...] eine verwaiste Pfarrei [Rüdesheim], ein aufgehobenes Kloster [Marienthal] und eines verbannten Bischofs Vaterstadt [Geisenheim] die nächste Umgebung des stolzen Siegesdenkmals auf dem Niederwald; rheinauf, rheinab aber und weit ins Land hinein versammelt sich um verwaiste Kirchen und Altäre das gläubige Nassauervolk voll schmerzlichen Sehnens nach seinem fernen hochbetagten Oberhirten, dem jedes katholische Herz im Lande mit hingebendster Treue und Liebe zugethan ist. Und über solchem geistlichen Elende, solch friedloser Trauer soll sich groß und glänzend nun in schneidenstem Kontraste ein Denkmal deutscher Einheit, deutscher Kraft und gottvertrauendem Opfersinnes erheben!“ Das neue in Stein und Bronze gefasste deutsche Nationalgefühl stehe also in eklatantem Missverhältnis zur Spaltung des deutschen Volkes, hervorgerufen durch die
Beeinträchtigung der freien Religionsausübung des katholischen Bevölkerungsteils. Der „Bote“ machte Reichskanzler Bismarck anschließend einen Lösungsvorschlag für die innenpolitische Spaltung:
„Man rühmt unserem Kanzler mit Recht nach, daß Gefühlspolitik ihm fremd sei. Wäre es wohl bloße Gefühlspolitik, wenn er durch seinen Rath es erwirkte, dass um das stolze Niederwalddenkmal bei seiner Enthüllung auch ein kirchlich durch die Rückkehr seines Bischofs hocherfreutes Volk sich jubelnd drängte?!“
Zwischenergebnis: Wir haben gesehen, dass der neue nationale Kult um die Bezwingung Frankreichs und die anschließende Reichsgründung von nationalen und liberalen Kräften sehr intensiv vorangetrieben wurde. Dieser Kult war in seiner Betonung der nationalen Einheit an sich überkonfessionell angelegt, wurde aber bis in die 1880er Jahre von Katholiken sehr viel stärker abgelehnt als von Protestanten. Stärker als dieses neue nationale Identifikationsangebot hielt sich das alte, das den Katholiken durch die Zugehörigkeit zu ihrer Kirche angeboten wurde. Sie schlossen sich mehrheitlich der ablehnenden Haltung gegenüber den neuen Nationalfeierlichkeiten, wie sie von ihren Oberhirten artikuliert wurde, an.
Doch spätestens seit diese ein harmonischeres Ideal im Verhältnis von Kirche und Staat ausgaben, war der Weg auch für die katholische Bevölkerung geebnet, sich dem „HurraPatriotismus“ des Wilhelminischen Deutschlands anzuschließen. So ist die Geschichte des Katholizismus in Deutschland zwischen 1871 und 1914, wie Nipperdey schreibt, auch eine Geschichte seiner Nationalisierung: „Das großdeutsche Reichsbewußtsein verschwindet. Kaiser und Reich gewinnen an Gewicht. Flotten-, Kolonial- und Weltpolitik werden auch von Teilen des Katholizismus aufgenommen.“[319]
6.6 „Nach Canossa gehen wir nicht“ - Die Beziehungen zwischen Klerus und Staat
In der Fragestellung zu den Auswirkungen des Kulturkampfes muss noch eine abschließende Antwort gefunden werden, in welcher Weise er das Bündnis zwischen Thron und Altar beeinflusste. Die schon oben angeführte angespannte Personalsituation in der Diözese während des Kulturkampfes schränkte anderweitiges, d.h. auch politisches, Engagement der Pfarrer drastisch ein und verwies sie ganz auf die Seelsorge. So wurde Pfarrer Johannes Ibach aus Villmar 1879 von Blum angewiesen, sein Landtagsmandat für das Zentrum niederzulegen.[320] Solche Vorgänge mussten einen inneren Prozess der Geistlichen, die die staatliche Verfolgung und Kriminalisierung ihrer Amtsausübung durch stärkere Loyalität gegenüber der Kirchenhierarchie kompensierten, nur unterstützen. So wenig, wie Bismarck nach Canossa gehen wollte, war der Klerus bereit, sich dem Omnikompetenzanspruch des Staates[321] zu beugen.
Bischof Blums Programm der inneren Erneuerung des Glaubens war in nassauischer Zeit zwar punktuell durch die nassauische Regierung eingeschränkt worden, aber größtenteils setzte jene auf eine deeskalierende Kirchenpolitik. Die Regierung ließ sich auf keine prinzipielle Diskussion ein und ließ offene Streitfragen lieber im Sande verlaufen, als mit der Härte des Gesetztes einzugreifen und es zum offenen Bruch kommen zu lassen. So verfuhr man in Angelegenheit der Trierer Rockwallfahrt und im Nassauischen Kirchenstreit. Der Bischof dagegen signalisierte eine kompromisslosere Haltung. Das lag nicht daran, dass er ein besonders streitlustiger Aufrührer war, sondern seine Pflichten als Oberhirte der Diözese dahingehend interpretierte, den Gläubigen und dem Klerus dazu zu verhelfen, ihren Katholizismus frei und ungehemmt auszuleben. Unterstützt wurde er dabei auch von seinem Berater Karl Klein.[322] Blum war kein Diplomat, er bevorzugte geklärte Fronten und nahm lieber den offenen Kampf in Rechnung als einen aus seiner Sicht untragbaren Zustand weiter zu (er)tragen. Dieser Charakterzug hilft nicht nur zu erklären, warum er kurz nach Annexion des Herzogtums 1866 die preußische Herrschaft mit offenen Armen empfing, er sagt uns auch viel über das Verhältnis des Bischofs zu staatlichen Autoritäten. Wie die meisten seiner bischöflichen Kollegen war Blum auch schon vor dem Kulturkampf konflikterprobt; so war das weitverbreitete Kirchenverständnis das einer „ecclesia militans“, einer streitenden Kirche. Nipperdey meint dazu: „Die Kirche selbst wird zum Gegenstand der Frömmigkeit; und da der Laie eigentlich als selbständige Figur nicht vorkommt, ist Kirche nicht das Gottesvolk, sondern die Institution und ihre Hierarchie. Und es ist die ecclesia militans, die ecclesia triumphans, von der hier die Rede ist.“[323]
Kurie und Papst in Rom unterstützen die deutschen Bischöfe, waren aber auch, besonders unter dem neuen Pontifikat von Leo XIII. kompromissbereiter. Dazu muss man berücksichtigen, dass das Papsttum inzwischen zu einer souveränen Repräsentanz der katholischen Kirche gewachsen war und als solche auch vom deutschen Episkopat akzeptiert wurde. Als sich Leo XIII. mit der deutschen Regierung in einer „Übereinkunft der Souveräne“[324] auf eine Beilegung des Kulturkampfes einigte, veränderte sich das Verhältnis von deutschem Episkopat und Klerus zum Staat gravierend. Nicht mehr Opposition, sondern Kooperation war nun die vorgegebene Marschroute. Im Bistum Limburg wurde diese Kehrtwende von Bischof Karl Klein vollzogen, der immer wieder die „Concordia inter Imperium et Sacerdotium“ als Leitmotiv seines Pontifikates verkündete. In der Auffassung einer engen Verschwisterung und zwingenden Interdependenz von Staat und Kirche durch ihre Grundlagen, ihre Organisation und ihre Aufgabe sah Klein den Kulturkampf als eine vorübergehende und nun wie eine Ehekrise glücklich überwundene Episode.[325] Wie Schatz ausführt, entsprach Kleins Ideal der Rückkehr zu einer ungebrochenen Concordia zwischen Kirche und Staat gewiss einem im deutschen Katholizismus weit verbreiteten Integrationsbedürfnis in den Kaiserstaat, widersprach aber der Logik der Geschichte: die einschneidenden Erfahrungen des Kölner Ereignisses und des Kulturkampfes waren nicht rückgängig zu machen.[326]
Zu diesen Erfahrungen gehört aber eben auch die Beilegung des Kulturkampfes durch direkte diplomatische Verhandlungen zwischen der Reichsregierung und der Kurie, die nicht nur den Episkopat, sondern auch das Zentrum umgingen. Die Diplomatie des Vatikans, erfahren im Umgang mit monarchischen Systemen, konnte sich nur schwer daran gewöhnen, die Entscheidungsfreiheit katholischer Laien in Sachfragen zu akzeptieren und deren gewählte Volksvertreter in ihr Kalkül einzubeziehen.[327] Erst ab 1887 setzte ein langsamer Akzentwandel der päpstlichen Politik unter Kardinalstaatssekretär Rampolla ein, nämlich eine stärkere Öffnung gegenüber den „Völkern“ und den demokratischen Kräften.[328] Zuvor war diese schon in radikalerer Art von den sozial engagierten „roten Kaplänen“ vollzogen worden, die im Gegensatz zum politisch und sozial konservativen Episkopat gegen das staatlich-großbürgerliche Establishment waren und aus Opposition bei Stichwahlen zur Not auch die Sozialdemokraten unterstützen.[329] Hier zeigte sich, dass die im Kulturkampf ausgeprägte kirchliche Oppositionshaltung sowie die katholische Mobilisierung von Massen noch partiell weiterbestand.
Schlussbetrachtung:
Einige Forschungsthesen mussten in dieser Arbeit relativiert werden. Zwar gilt „Keine Regel ohne Ausnahme“, aber meines Erachtens ist der allgemeine Forschungsstand in Sachen der katholischen Erneuerung noch nicht soweit fortgeschritten, dass sich allgemein verbindliche Thesen ohne weiteres aufrechterhalten lassen. Besonders virulent sind dabei: Stellung und Einfluss, Selbst- und Fremdbild des Klerus - vom Kaplan bis zum Bischof - in der individuellen und kollektiven Lebenswelt, sowie die Koalition zwischen Klerus und Gläubigen vor, während und nach dem Kulturkampf.
Bischof Blum, der über 40 Jahre die Diözese Limburg leitete, sah seine Tätigkeit nicht als Beruf, sondern als Aufgabe. In Hebung der Frömmigkeit unter Klerikern wie Laien sah er ein unabdingbare Voraussetzung für eine kollektiv-sittliche wie eine individuell-religiöse Erneuerung. So nahm er in seinen schriftlich hinterlassenen Dokumenten oft eine Verbindung zwischen den Interessen der Kirche und dem Seelenheil der Katholiken vor. Nur in einer starken, vitalen und von staatlicher Bevormundung befreiten Kirche sah er die Voraussetzungen dafür gegeben, dass die katholischen Gläubigen sittlich-religiös geleitet werden konnten. Eine schädliche, den Staat gefährdende Wirkung bestritt er lebhaft.
Als Minderheitskonfession im untersuchten Gebiet (zuerst im nassauischen, später stärker ausgeprägt im preußischen Staatsverbund) lässt sich häufig die Formulierung finden, dass die katholische Kirche nur die gleichen Rechte wie die protestantische zugesprochen haben wollte. Die liberale Gegenposition hingegen besagte, der Einfluss der „Pfaffen“ sei schon groß genug, zuerst auf ihre Gemeinden, und dann auch noch in der Politik (durch das Zentrum). Die Unabhängigkeit der katholischen Kirche vom Staat sei nicht zu befördern, sondern im Gegenteil einzuschränken.
Doch trotz all der Wandlungen und Konflikte im Verhältnis zwischen katholischer Kirche und Staat, blieb erstere eine konservative Kraft; zu keiner Zeit führte sie einen direkten
Angriff auf die Monarchie. So wie seine Amtskollegen wollte aber auch Bischof Blum ein Wort bei der Gestaltung der Gesellschaft und der Politik mitreden. Die Kirche mischte sich ein; und sie versuchte ihren gesellschaftlichen und politischen Einfluss auszuweiten, um (um in der Logik ihrer Argumentation zu bleiben), die Staatsuntertanen vor den „verderblichen Einflüssen“ (Liberalismus, später Sozialismus) zu schützen.
Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Ungedruckte Quellen Diözesanarchiv Limburg (DAL)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Gedruckte Quellen
- Acta et decreta sacrorum conciliiorum recentiorum. Collectio Lacensis, (Bd. 5: Acta et decreta s. conciliorum, quae ab Episcopis Germaniae, Hungariae et Hollandiae ab a. 1789. usque ad a. 1869. celebrata sunt), Freiburg 1897.
- Bismarck, Otto von: Gedanken und Erinnerungen, Stuttgart/Berlin 1928.
- Huber, Ernst Rudolf/Huber, Wolfgang: Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert. Dokumente zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts, Bd. II: Staat und Kirche im Zeitalter des Hochkonstitutionalismus und des Kulturkampfs, Berlin 1976.
- Kasper, Katharina: Schriften, Bd. 1: Erste Regeln und eigenhändige Briefe, Kevelaer 2001.
- Dies.: Schriften, Bd. 2: In ihrem Auftrag verfasste Schreiben, Kevelaer 2004.
- Lill, Rudolf (Hg.): Der Kulturkampf (Beiträge zur Katholizismusforschung, Reihe A: Quellentexte zur Geschichte des Katholizismus Bd. 10), Paderborn u.a. 1997.
- Real, Willy (Hg.): Katholizismus und Reichsgründung. Neue Quellen aus dem Nachlaß Karl Friedrich von Savignys (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte N.F. Heft 11), Paderborn u.a. 1998.
- Siegfried, Nikolaus: Aktenstücke betreffend den preußischen Culturkampf, nebst einer geschichtlichen Einleitung, Freiburg 1882.
- Vatikanische Akten zur Geschichte des deutschen Kulturkampfes. Leo XIII, Teil I, 1878-1880, im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearb. v. Rudolf Lill, Tübingen 1970.
- Weber, Beda: Cartons aus dem deutschen Kirchenleben, Mainz 1858.
3. Literatur Abkürzungen
AmrhKg Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte NA Nassauische Annalen
- Altermatt, Urs: Volksreligion - neuer Mythos oder neues Konzept? Anmerkungen zu einer Sozialgeschichte des modernen Katholizismus, in: Jakob Baumgartner (Hg.): Wiederentdeckung der Volksreligiosität, Regensburg 1979, S. 105-124.
- Anderhub, Andreas: Verwaltung im Regierungsbezirk Wiesbaden 1866-1885 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau XXII), Wiesbaden 1977.
- Anderson, Margaret Lavinia: Die Grenzen der Säkularisierung. Zur Frage des katholischen Aufschwungs im Deutschland des 19. Jahrhunderts, in: Hartmut Lehmann (Hg.): Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 130), Göttingen 1997, S. 194-228.
- Angerer, Martin: Beda Weber. Eine typische Seelsorgergestalt des neunzehnten Jahrhunderts, mit besonderer Berücksichtigung der Liturgie (Schlern-Schriften 256), Innsbruck 1970.
- Bastgen, Beda: Die Limburger Bischofswahlen von 1834-1842, in: Theologische Quartalschrift 122 (1941), S. 91-106.
- Becker, Hans: Generalvikar Dr. Höhler, in: Jahrbuch des Bistums Limburg 1970, S. 2-7.
- Bertsche, August: Moritz Lieber 1770-1860, in: Nassauische Lebensbilder Bd. 4, Wiesbaden 1950, S. 185-192.
- Besier, Gerhard: Kirche, Politik und Gesellschaft im 19. Jahrhundert (Enzyklopädie deutscher Geschichte Bd. 48), München 1998.
- Blackbourn, David: Volksfrömmigkeit und Fortschrittsglaube im Kulturkampf (Institut für europäische Geschichte Mainz, Vorträge Nr. 81), Stuttgart 1988.
- Blaschke, Olaf: Die Kolonialisierung der Laienwelt. Priester als
Milieumanager und die Kanäle klerikaler Kuratel, in: Ders./Frank-Michael Kuhlemann (Hg.): Religion im Kaiserreich, Gütersloh 1996, S. 93-135.
- Bornkamm, Heinrich: Die Staatsidee im Kulturkampf. Mit einem Nachwort zum Neudruck, Darmstadt 1969.
- Brück, Heinrich: Die oberrheinische Kirchenprovinz von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, mit besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses der Kirche zur Staatsgewalt, Mainz 1868.
- Burkhard, Dominik/Leuninger, Ernst/Schatz, Klaus: Limburg, in: Erwin Gatz (Hg.): Die Bistümer der deutschsprachigen Länder von der Säkularisation bis zur Gegenwart, Freiburg/Basel/Wien 2005, S. 423-443.
- Burleigh, Michael: Earthly Powers. Religion and Politics in Europe from the Enlightment to the Great War, London 2005.
- Clark, Christopher: Der neue Katholizismus und der europäische Kulturkampf, in: Comparativ 12 (2002), Heft 5/6, S. 14-37.
- Ders./Kaiser, Wolfram (Hg.): Culture Wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteenth-Century Europe, Cambridge 2003.
- Dies.: Kulturkampf in Europa im 19. Jahrhundert, in: Comparativ 12 (2002), Heft 5/6, S. 7-13.
- Crone, Marie-Louise, Obertiefenbach im Jahre 1874. Ein Stimmungsbild zur Kulturkampfzeit, in: AmrhKg 40 (1988), S. 221-236.
- Dies./ Kloft, Matthias Th./ Hefele, Gabriel : Limburg. Geschichte des Bistums, Bd. IV: Aufbruch in eine neue Zeit, Strasbourg 1997.
- Ebert, Ferdinand: Peter Joseph Blum, in: Nassauische Lebensbilder Bd. 5, Wiesbaden 1955, S. 186-199.
- Ebertz, Michael N.: Die Organisierung von Massenreligiosität im 19. Jahrhundert. Soziologische Aspekte zur Frömmigkeitsforschung, in: Jahrbuch für Volkskunde N.F. 2 (1979), S. 38-72.
- Ders.: „Ein Haus voll Glorie schauet...“. Modernisierungsprozesse der römisch-katholischen Kirche im 19. Jahrhundert, in: Wolfgang Schieder (Hg.): Religion und Gesellschaft im 19. Jahrhundert (Industrielle Welt, Bd. 54), Stuttgart 1994, S. 62-85.
- Föhles, Eleonore: Kulturkampf und katholisches Milieu 1866-1890 in den niederrheinischen Kreisen Kempen und Geldern und der Stadt Viersen (Schriftenreihe des Kreises Viersen 40), Viersen 1995.
- Freytag, Nils: Aberglauben im 19. Jahrhundert. Preußen und seine Rheinprovinz zwischen Tradition und Moderne (1815-1918) (Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte Bd. 22), Berlin 2003.
- Fuchs, Konrad: Katharina Kasper (1820-1898), Gründerin der
Klostergenossenschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi. Ein Beitrag zur sozialen Frage im 19. Jahrhundert, in: NA 88 (1977), S. 149-166.
- Ders.: Peter Josef Blum 1808-1884, in: Limburg-Weilburg. Beiträge zur Geschichte des Kreises, Limburg 1986, S. 552-554.
- Fuchs, P. Damasus: Bornhofen am Rhein. Geschichte des Ortes, der Kirche, des Klosters und der Wallfahrt, Fulda/Wiesbaden 1937.
- Gall, Lothar: Bismarck. Der weiße Revolutionär, Frankfurt am Main/Berlin/ Wien4 1980.
- Gatz, Erwin: Der Weltklerus in den Kulturkämpfen, in: Ders. (Hg.): Der Diözesanklerus (Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts Bd. IV), Freiburg/Basel/Wien 1995, S. 105-124.
- Ders.: Zur Neubesetzung der Bistümer Limburg und Fulda 1885-87, in: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 71 (1976), S. 78-112.
- Ders./Heribert Schmitz: Tendenzen der Pfarreientwicklung von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, in: Ders. (Hg.): Die Bistümer und ihre Pfarreien (Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts Bd.1), Freiburg/Basel/Wien 1991, S. 89-104.
- Götz von Olenhusen, Irmtraud: Die Ultramontanisierung des Klerus. Das Beispiel der Erzdiözese Freiburg, in: Wilfried Loth (Hg.): Deutscher Katholizismus im Umbruch zur Moderne (Konfession und Gesellschaft Bd. 3), Stuttgart/Berlin/Köln 1991, S. 46-75.
- Grane, Leif: Die Kirche im 19. Jahrhundert. Europäische Perspektiven, Göttingen 1987.
- Gross, Michael B.: The War against Catholicism. Liberalism and the AntiCatholic Imagination in Nineteenth-Century Germany (Social History, Popular Culture, and Politics in Germany), Michigan 2004.
- Hilpisch, Georg: Die Genossenschaft der Barmherzigen Brüder von Montabaur. Eine kurze Geschichte ihrer Entstehung und Entwicklung bis zur Gegenwart, Wiesbaden 1926.
- Höhler, Matthias: Geschichte des Bistums Limburg mit besonderer
Rücksichtnahme auf das Leben und Wirken des dritten Bischofs Peter Joseph Blum, Limburg 1908.
- Hürten, Heinz: Kurze Geschichte des deutschen Katholizismus 1800-1960, Mainz 1986.
- Jedin, Hubert (Hg.): Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. VI/1: Die Kirche zwischen Revolution und Restauration, Freiburg 1985.
- Kampe, Walther: Bistum Limburg (Reihe Deutschland deine Diözesen), Augsburg 1988.
- Ders.: Unser gemeinsamer Weg. 150 Jahre Bistum Limburg, Frankfurt 1977.
- Königstein, Ulrich: Kulturkampf im Bistum Speyer. Eine
regionalgeschichtliche Untersuchung (Saarbrücker theologische Forschungen Bd. 7), Frankfurt u.a. 1999.
- Korff, Gottfried: Heiligenverehrung und soziale Frage. Zur Ideologisierung der populären Frömmigkeit im späten 19. Jahrhundert, in: Gunter Wiegelmann (Hg.): Kultureller Wandel im 19. Jahrhundert (Studien zum Wandel von Gesellschaft und Bildung im Neunzehnten Jahrhundert Bd. 5), Göttingen 1973, S. 102-111.
- Ders.: Kulturkampf und Volksfrömmigkeit, in: Wolfgang Schieder (Hg.): Volksreligiosität in der modernen Sozialgeschichte (Geschichte und Gesellschaft Sonderheft 11), Göttingen 1986, S. 137-151.
- Kropat, Wolf-Arno: Das Ende des Herzogtums (1850-1866), in: Herzogtum Nassau 1806-1866. Politik, Wirtschaft, Kultur (Veröffentlichungen der historischen Kommission für Nassau 32), Wiesbaden 1981, S. 37-52.
- Ders.: Das Herzogtum Nassau zwischen Rheinbund und Revolution 18061866, in: Uwe Schultz (Hg.): Die Geschichte Hessens, Stuttgart 1983, S. 171181.
- Ders.: Die nassauischen Liberalen und Bismarcks Politik in den Jahren 18661867. Die Reaktion der Fortschrittspartei und der Bevölkerung Nassaus auf die preußische Annexion, besonders im Spiegel der Reichtagswahlen vom 12. Februar und 31. August 1867, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 16 (1966), S. 215-296.
- Lamp, Ida, Die Kongregation der Armen Dienstmägde Jesu Christi (Mutterhaus Dernbach/Westerwald). Ein Abriß ihrer Geschichte von der
Gründungszeit bis zum Tod ihrer Stifterin Katharina Kasper (gest. 1898), in: AmrhKg 41 (1989), S. 319-346.
- Lehmann, Hartmut: Von der Erforschung der Säkularisierung zur Erforschung von Prozessen der Dechristianisierung und der Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa, in: Ders. (Hg.): Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa (Veröffentlichungen des MaxPlanck-Instituts für Geschichte 130), Göttingen 1997, S. 9-16.
- Lerner, Franz: Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Nassauer Raumes 18161964 (FS Nassauische Sparkasse), Wiesbaden 1965.
- Lill, Rudolf: Der Ultramontanismus. Die Ausrichtung der gesamten Kirche auf den Papst, in: Manfred Weitlauff (Hg.): Kirche im 19. Jahrhundert, Regensburg 1998, S. 76-94.
- Ders.: Die ersten deutschen Bischofskonferenzen, Freiburg 1964.
- Loth, Wilfried: Integration und Erosion: Wandlungen des katholischen Milieus, in: Ders. (Hg.): Deutscher Katholizismus im Umbruch zur Moderne (Konfession und Gesellschaft Bd. 3), Stuttgart/Berlin/Köln 1991, S. 266-281.
- Lutz, Walter: Aus der Geschichte der Pfarrei Limburg, in: 750 Jahre St. Georgsdom zu Limburg. Festschrift der Dompfarrei zur Kirchweihe am 11. August 1985, Limburg 1985, S. 92-148.
- Ders.: Die staatliche und kirchliche Untersuchung einer gesetzwidrigen Wallfahrt von Limburg zur Beselicher Kapelle am 14. September 1845, in: AmrhKg 46 (1996), S. 141-162.
- Maibach, Heinz: Limburgs Bischof Peter Joseph Blum und die Wahlen von 1848, in: AmrhKg 47, 1995, S. 269-276.
- Martin, Matthias: Der katholische Weg ins Reich. Der Weg des deutschen Katholizismus vom Kulturkampf hin zur staatstragenden Kraft (Europäische Hochschulschriften, Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 799), Frankfurt u.a. 1998.
- Meiwes, Relinde: „Arbeiterinnen des Herrn“. Katholische
Frauenkongregationen im 19. Jahrhundert (Geschichte und Geschlechter Bd. 30), Frankfurt/New York 2000.
- Dies.: Weibliche Berufsarbeit in Gesellschaft und Kirche. Katholische Frauenkongregationen im 19. Jahrhundert, in: Sigrid Schmitt (Hg.): Frauen und Kirche (Mainzer Vorträge 6), Stuttgart 2002, S. 115-133.
- Mooser, Josef: Katholische Volksreligion, Klerus und Bürgertum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Thesen, in: Wolfgang Schieder (Hg.): Religion und Gesellschaft im 19. Jahrhundert (Industrielle Welt, Bd. 54), Stuttgart 1994, S. 144-156.
- Morsey, Rudolf: Der Kulturkampf. Bismarcks Präventivkrieg gegen das Zentrum und die katholische Kirche, in: Manfred Weitlauff (Hg.): Kirche im 19. Jahrhundert, Regensburg 1998, S. 163-185.
- Neugebauer-Wölk, Monika: Zur Konstituierung historischer
Religionsforschung 1974 bis 2004 , in: zeitenblicke 5 (2006), Nr. 1, URL: http://www.zeitenblicke.de/2006/1/Einleitung/index_html (zuletzt aufgerufen am 26.5.2006).
- Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd. 1: Arbeitswelt und
3
Bürgergeist, München 1993.
- Ders.: Religion im Umbruch. Deutschland 1870-1918, München 1988.
- Oswalt, Vadim: Ach! Wäre es doch möglich, den Menschen begreiflich zu machen... Katholische Aufklärung und ländliche Lebenswelt in Oberschwaben im 19. Jahrhundert, in: Norbert Haag/Sabine Holtz/Wolfgang Zimmermann (Hg.): Ländliche Frömmigkeit. Konfessionskulturen und Lebenswelten 15001850, Stuttgart 2002, S. 325-342.
- Paletschek, Sylvia: Frauen und Säkularisierung Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Beispiel der religiösen Oppositionsbewegung des Deutschkatholizismus und der freien Gemeinden, in: Wolfgang Schieder (Hg.): Religion und Gesellschaft im 19. Jahrhundert (Industrielle Welt, Bd. 54), Stuttgart 1994, S. 300-317.
- Paulus, Adolf: Limburger Seminarkurs 1866/71 in: AmrhKg 30 (1978), S. 215-256.
- Raab, Heribert: Zur Geschichte und Bedeutung des Schlagwortes
„ultramontan“ im 17. und frühen 18. Jahrhundert, in: Historisches Jahrbuch 81 (1962), S. 159-173.
- Renkhoff, Otto: Nassauische Biographie. Kurzbiographien aus 13
Jahrhunderten (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau 39), Wiesbaden2 1992.
- Roth, Ralf: Katholisches Bürgertum in Frankfurt am Main 1800-1914. Zwischen Emanzipation und Kulturkampf, in: AmrhKg 46 (1994) S. 207-246.
- Salamon, Iris: Die Meinungs- und Pressefreiheit im Herzogtum Nassau (18061866) (Diss.), Frankfurt 1994.
- Schatz, Klaus: Das Erste Vaticanum, in: Manfred Weitlauff (Hg.): Kirche im 19. Jahrhundert, Regensburg 1998, S. 140-162.
- Ders.: Drei Limburger Bischofswahlen im 19. Jahrhundert (1827 - 1842 - 1886) als Spiegel kirchengeschichtlicher Auseinandersetzungen, in: AmrhKg 30 (1978), S. 191-213.
- Ders.: Geschichte des Bistums Limburg (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, Bd. 48), Mainz 1983.
- Ders.: Limburg, in: Erwin Gatz (Hg.): Die Bistümer und ihre Pfarreien (Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts Bd.1), Freiburg/Basel/Wien 1991, S. 421-430.
- Schieder, Wolfgang: Kirche und Revolution. Sozialgeschichtliche Aspekte der Trierer Wallfahrt von 1844, in: Archiv für Sozialgeschichte 14 (1974), S. 419454.
- Ders.: Religion und Revolution. Die Trierer Wallfahrt von 1844, Vierow 1996.
- Sperber, Jonathan: Popular Catholicism in Nineteenth-Century Germany, Princeton 1984.
- Schüler, Winfried: Die Katholische Partei im Herzogtum Nassau während der Revolution von 1848, in: AmrhKg 43 (1982), S. 121-142.
- Ders. : Die Herzöge von Nassau. Macht und Ohnmacht eines Regentenhauses im Zeitalter der nationalen und liberalen Bewegung, in: NA 95 (1984), S. 155172.
- Ders.: Die Revolution von 1848/49, in: Herzogtum Nassau 1806-1866. Politik, Wirtschaft, Kultur (Veröffentlichungen der historischen Kommission für Nassau 32), Wiesbaden 1981, S. 19-36.
- Schwedt, Hermann H.: Die katholische Kirche nach der Säkularisation, in: Herzogtum Nassau 1806-1866. Politik, Wirtschaft, Kultur (Veröffentlichungen der historischen Kommission für Nassau 32), Wiesbaden 1981, S. 275-282.
- Silberhorn, Lothar: Der Deutschkatholizismus in Nassau. Religiöser
Liberalismus am Mittelrhein und seine Gegenkräfte (Manuskript Magisterarbeit), 1999.
- Stürmer, Michael: Liberalismus und Kirche 1848-1933. Die Anatomie eines Un-Verhältnisses, in: Tutzinger Materialien 9 (1984), (ohne Seitenangabe).
- Traut, Michael: Moritz Lieber 1790-1860, in: Limburg-Weilburg. Beiträge zur Geschichte des Kreises, Limburg 1986, S. 546-547.
- Weber, Christoph: Ultramontanismus als katholischer Fundamentalismus, in: Wilfried Loth (Hg.): Deutscher Katholizismus im Umbruch zur Moderne (Konfession und Gesellschaft Bd. 3), Stuttgart/Berlin/Köln 1991, S. 20-45.
- Weimer, Erhard: Die Verarmung in Mittelnassau im 19. Jahrhundert, in: Limburg-Weilburg. Beiträge zur Geschichte des Kreises, Limburg 1986, S. 206-215.
- Wolf, Hubert: Der „Syllabus errorum“ (1864). Oder: Sind katholische Kirche und Moderne unvereinbar?, in: Manfred Weitlauff (Hg.): Kirche im 19. Jahrhundert, Regensburg 1998, S. 115-139.
[1] So wird die Verhaftung des Kölner Erzbischofs Clemens August von Droste-Vischering am 20. November 1837 durch die preußische Polizei bezeichnet. Droste provozierte eine Kraftprobe mit dem preußischen Staat durch kompromissloses, selbstständiges Vorgehen in Fragen der Bonner theologischen Fakultät (wo der Dogmatiker Georg Hermes gelehrt hatte) und der Mischehenfrage. Nach Verstreichen eines Ultimatums wurde er auf der Festung Minden gefangen gesetzt. Der Vorfall löste in ganz Deutschland Proteste der katholischen Bevölkerung aus, was auch auf die Streitschrift „Athanasius“ von Joseph Görres zurückzuführen ist. (Vgl. Jedin (Hg.): Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. 6,1 , S. 396f.)
[2] Wilhelm Heinrich Riehl: Land und Leute, Stuttgart 1861, S. 412. Das Kapitel „Die Macht der Kirche“ wurde 1850 verfasst.
[3] Anderson: Die Grenzen der Säkularisierung, S. 212.
[4] Lill: Der Ultramontanismus, S. 79.
[5] Blaschke: Die Kolonialisierung der Laienwelt, S. 101.
[6] Vgl. Lehmann: Von der Erforschung der Säkularisierung zur Erforschung von Prozessen der Dechristianisierung und der Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa, S. 13.
[7] Clark/Kaiser: Kulturkampf in Europa im 19. Jahrhundert, S. 11.
[8] Liberale Argumente referiert bei Blackbourn: Volksfrömmigkeit und Fortschrittsglaube im Kulturkampf, S. 17f.
[9] Bis auf die Bistumsgeschichte von Höhler, der viele Dokumente in seine Darstellung eingebunden hat, existiert keine edierte Quellensammlung für die Geschichte des Bistums. Daher müssen in dieser Arbeit an gegebener Stelle längere Zitate aus den Primärquellen eingefügt werden. Um den Umfang der Arbeit nicht zu groß werden zu lassen, beschränke ich mich mit der ausführlicheren Zitierung vor allem auf solche Dokumente, die bis jetzt noch nicht der Forschungsgemeinschaft erschlossen worden sind.
[10] Vgl. Becker: Der Kulturkampf als europäisches und deutsches Phänomen (1981); sowie die Aufsatzsammlungen: Christopher Clark/Wolfgang Kaiser (Hg.): Culture Wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteenth-Century Europe, Cambridge 2003; Dies. (Hg.): Kulturkampf in Europa im 19. Jahrhundert (Comparativ 12, Heft 5/6); Hartmut Lehmann (Hg.): Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa. Bilanz und Perspektiven der Forschung (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 130), Göttingen 1997. Der schweren Aufgabe einer Monographie über Religion und Politik im Europa des 19. Jahrhunderts hat sich jüngst Michael Burleigh gestellt (Ders.: Earthly Powers).
[11] Angeregt wurde sie vorwiegend durch Wolfgang Schieders 1974 publiziertem Artikel „Kirche und Revolution. Sozialgeschichtliche Aspekte der Trierer Wallfahrt von 1844“. Den aktuellen Forschungsstand gibt wieder: Neugebauer-Wölk: Zur Konstituierung historischer Religionsforschung 1974 bis 2004.
[12] Höhler: Geschichte des Bistums Limburg. Biographische Angaben zu Höhler bei Becker: Generalvikar Dr. Höhler.
[13] Ebert: Peter Joseph Blum.
[14] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg.
[15] Fuchs: Peter Josef Blum 1808-1884, S. 553.
[16] Ebd.
[17] Raab: Zur Geschichte und Bedeutung des Schlagwortes ultramontan, S. XX. Kritisch zum Forschungswert von Raabs Erkenntnissen: Weber: Ultramontanismus als katholischer Fundamentalismus, S. 20.
[18] So in Deutschland bei Johann Nikolaus von Hontheim in seiner unter dem Synonym Justinus Febronius publizierten Schrift „De statu ecclesiae“ (1765).
[19] Lill: Der Ultramontanismus, S. 80.
[20] Ebd.
[21] Schwedt: Die katholische Kirche nach der Säkularisation, S. 277.
[22] Lill: Der Ultramontanismus, S. 82.
[23] Ebd., S. 79.
[24] Nipperdey: Religion im Umbruch, S. 19.
[25] Die Zahlen sind entnommen aus Schüler: Die katholische Partei im Herzogtum Nassau während der Revolution von 1848, S. 121.
[26] Schatz: Limburg, S. 424.
[27] Ebd., S. 423.
[28] Zur Verfassung vom 1./2. September 1814 vgl. Struck: Die Gründung des Herzogtums Nassau, S. 12-15;
[29] Schüler: Die Herzöge von Nassau, S. 159-161.
[30] Schüler: Die katholische Partei im Herzogtum Nassau während der Revolution von 1848, S. 121.
[31] Weiterführend: Chrisiane Heinemann: Die Evangelische Union von 1817 als Beginn des modernen Landeskirchentums, in: Herzogtum Nassau 1806-1866. Politik, Wirtschaft, Kultur (Veröffentlichungen der historischen Kommission für Nassau 32), Wiesbaden 1981,S. 267-274.
[32] Zahl bei Schwedt: Die katholische Kirche nach der Säkularisation, S. 277.
[33] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 56.
[34] Schatz: Drei Limburger Bischofswahlen im 19. Jahrhundert (1827 - 1842 - 1886) als Spiegel kirchengeschichtlicher Auseinandersetzungen, S. 191.
[35] Schatz: Limburg, S. 427.
[36] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 57.
[37] Zu dieser Generation gehörten auch die (Erz)Bischöfe Boll in Freiburg, Keller in Rottenburg, Hommer in Trier und Graf Spiegel in Köln. (Ebd., S. 102.)
[38] Schatz führt diese Einstellung auf den seit 1836 amtierenden Kardinalstaatssekretär Raffaele Lambruschini zurück (Ebd., S. 112).
[39] Vgl. ausführlich zur Wahl und den anschließenden Ereignissen: Bastgen: Die Limburger Bischofswahlen 1834-1842; Schatz: Drei Limburger Bischofswahlen im 19. Jahrhundert (1827 - 1842 - 1886) als Spiegel kirchengeschichtlicher Auseinandersetzungen.
[40] Schatz: Drei Limburger Bischofswahlen im 19. Jahrhundert, S. 203.
[41] Brück: Die oberrheinische Kirchenprovinz, S. 291.
[42] Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 142.
[43] Ebd., S. 143.
[44] Ebd., S. 144.
[45] Ebd., S. 148.
[46] Ebd., S. 145.
[47] Ebd., S. 151.
[48] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 117.
[49] Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 158.
[50] Ebd., S. 156f.
[51] Vgl. Schreiben von Domdekan Fölix an Regierungspräsident Möller vom 17. März 1840, in: Höhler, S. 160.
[52] Vermutlich handelte es sich dabei um Abraham Stern (1831-1867), einem Sohn des Handelsmanns Seligmann Stern, der mit seiner Frau und vier Kindern in Oberbrechen lebte. (Vgl. Eugen Caspary: Jüdische Mitbürger in Oberbrechen 1711-1941. Eine Bestandsaufnahme, in: Hellmuth Gensicke, Egon Eichhorn (Hg.): Geschichte von Oberbrechen, Brechen-Oberbrechen 1975, S. 157-231.)
[53] Alle Fälle sind erwähnt bei Höhler, S. 162-166.
[54] Biographische Angaben bei Bertsche: Moritz Lieber 1790-1860; Renkhoff: Nassauische Biographie, S. 464f.;
[55] Traut: Moritz Lieber 1790-1860; Manfred Berger: Lieber, Moritz, in: Biographisch-Bibliographisches
[56] Kirchenlexikon, Bd. XXI (2003), Spalten 824-830.
[57] Ausführliche Darstellung bei Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 166-173.
[58] Ebd., S. 172f.
[59] Begriff bei Fuchs: Peter Josef Blum 1808-1884, S. 552. Vgl. aber auch die dort formulierten Einschränkungen einer solchen Formulierung.
[60] Festgedichte, Seiner Gnaden des Hochwürdigsten Herrn Dr. Peter Joseph Blum, Bischofs zu Limburg, zu Hochdessen am 2. October 1842 stattfindender Consecration und Inthronisation in tiefster Verehrung gewidmet von dem Bischöflichen-Clerical-Seminarium zu Limburg a. L., Frankfurt am Main 1842, S. 26.
[61] Mitteilung Blums an den Senat der Stadt Frankfurt vom 3. September 1842, bei Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 176.
[62] Ebert: Peter Joseph Blum 1808-1884, S. 186.
[63] Ebd., S. 187.
[64] Brück: Die oberrheinische Kirchenprovinz, S. 291.
[65] Weiterführend: Wolf-Heino Struck: Die nassauische Simultanschule, in: Herzogtum Nassau 1806-1866. Politik, Wirtschaft, Kultur (Veröffentlichungen der historischen Kommission für Nassau 32), Wiesbaden 1981, S. 253-266.
[66] Schüler: Die Revolution von 1848/49; Ders.: Die katholische Partei im Herzogtum Nassau während der Revolution von 1848; Werner Wolf/Rainer Koch (Hg.): Hessen in der Revolution von 1848/1849, Kelkheim 1989.
[67] Maibach: Limburgs Bischof Peter Joseph Blum und die Wahlen von 1848.
[68] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 359-406.
[69] Ebd., S. 129.
[70] Zitat aus dem Flugblatt „Katholiken Nassau’s!“ des Centralvereins für religiöse Freiheit vom 23. März 1848 (in: DAL 1 H 2).
[71] Vgl. Bertsche: Moritz Lieber 1790-1860, S. 191. Liebers Sohn Ernst war Mitbegründer des Zentrums und nach dem Tod von Ludwig Windthorst Führer desselben von 1891 bis 1902. (Weiterführend: Hermann Cardauns: Ernst Lieber. Der Werdegang eines Politikers bis zu seinem Eintritt in das Parlament (1838-1871), Wiesbaden 1927; Michael Traut: Der Reichsregent. Ernst Liebers Weg vom Männer-Casino Camberg an das Ruder kaiserlicher Großmachtpolitik (Schriftenfolge Goldener Grund 23), Bad Camberg 1984.)
[72] Burkhard/Leuninger/Schatz: Limburg, S. 440.
[73] Huber/Huber: Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, S. 15. Die Denkschrift ist ebd., S. 21-28 abgedruckt.
[74] Salamon: Die Meinungs- und Pressefreiheit im Herzogtum Nassau (1806-1866), S. 147.
[75] In: DAL 1 H 2.
[76] Schwedt: Die katholische Kirche nach der Säkularisation, S. 281.
[77] Schüler: Die Herzöge von Nassau, S. 172f.
[78] In einer Denkschrift vom 5. Februar 1851 forderten Erzbischof von Vicari (Freiburg) und seine Suffraganen Blum, Lipp (Rottenburg), von Ketteler (Mainz) und Kött (Fulda) die Aufhebung der staatskirchlichen Beengungen der Landesherrlichen Verordnungen von 1830. (Abgedruckt in Huber/Huber: Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, S. 158-166.) Für Schatz war der Oberrheinische Kirchenstreit einer der wenigen Versuche, offensiv voranzugehen und den Status quo einseitig in Frage zu stellen (Ders.: Geschichte des Bistums Limburg, S. 150.)
[79] Zitat von August Ludwig von Sayn-Wittgenstein-Berleburg, bei Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 377.
[80] Ebd., S. 156.
[81] Kropat: Das Ende des Herzogtums, S. 38.
[82] Adolph war den österreichischen Plänen einer großdeutschen Zollunion, die Bruck 1849 entwickelt hatte, nicht abgeneigt gewesen. Vgl. Lerner: Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Nassauer Raumes 1816-1964, S. 121f.
[83] Kropat: Das Ende des Herzogtums, S. 38.
[84] Vgl. Anderhub: Verwaltung im Regierungsbezirk Wiesbaden 1866-1885; Kropat: Die nassauischen Liberalen und Bismarcks Politik in den Jahren 1866-57.
[85] Das beweist eine Petition an den preußischen König, die dem Zivilkommissar von Diest am 1. August 1866 von einer Deputation von nassauischen Industriellen und angesehenen Kaufleuten aus dem Raum von Diez, Bad Ems, Dillenburg und Wiesbaden überreicht wurde. (Kropat: Die nassauischen Liberalen und Bismarcks Politik in den Jahren 1866-57, S. 235.)
[86] Ebd., S. 244.
[87] Brief vom 15./16. Oktober 1866, in: Real: Katholizismus und Reichsgründung, S. 50-54. Zum preußischen Diplomaten Savigny vgl. Willy Real: Karl Friedrich von Savigny 1814-1875. Ein preußisches Diplomatenleben im Jahrhundert der Reichsgründung (Historische Forschungen Bd. 43), Berlin 1990.
[88] Real: Katholizismus und Reichsgründung, S. 52.
[89] Ebd.
[90] Ebd., S. 53.
[91] Ebd.
[92] Paulus: Limburger Seminarkurs 1866/71, S. 215.
[93] In: DAL 1 H 18.
[94] Datiert mit Rumpenheim, 12. November 1866, in: DAL 1 H 18.
[95] Unterstreichungen wie im Original.
[96] Vgl. Paulus: Limburger Seminarkurs 1866/71, S. 218f.
[97] Zitat aus von Mühlers Brief an Blum, 30. November 1866, in: DAL 1 H 21.
[98] Auch bei Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S.322f. und Real: Katholizismus und Reichsgründung, S. 56.
[99] Brief von Königin Augusta an Bischof Blum, 25. Oktober 1866, in: DAL 1 H 21.
[100] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 163. Biographische Angaben bei Renkhoff: Nassauische Biographie, S. 398.
[101] Zitat aus einem Brief Kleins an den Bischof von Fulda, 24. Oktober 1866, in: DAL 1 H 25.
[102] Virulent wurde der Fall, weil die Weigerung von Mathias lange nach der Anweisung des Bischofs zur Genehmigung der Eidesleistung und Entlassung der Geistlichen aus dem Eid durch Herzog Adolph (19. April 1867) noch fortbestand. (DAL 1 H 26.)
[103] Konzept in: DAL 1 H 21.
[104] In: DAL 1 H 21. Vgl. auch Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 163f.
[105] Zu den erwähnten Deputationen vgl. Anm. 82.
[106] Das liberale, in Wiesbaden erscheinende Blatt war im Dezember 1866 zum offiziellen Organ der zwar preußenfreundlichen, aber auch nicht unkritischen „Nassauischen Fortschrittspartei“ geworden. Vgl. Salamon:
[107] Die Meinungs- und Pressefreiheit im Herzogtum Nassau (1806-1866), S. 214f.
[108] In: DAL 1 H 24.
[109] Zitat aus einem Brief Kleins an den Bischof von Köln, 8. Oktober 1866, in: DAL 1 H 25.
[110] Paulus: Limburger Seminarkurs 1866/71, S. 244.
[111] Kettelers Schrift „Deutschland nach dem Kriege von 1866“ (1867) ging dabei schonender mit den großdeutschen Gefühlen der Katholiken um. Vgl. Birke: Bischof Ketteler und der deutsche Liberalismus, S. 74.
[112] Im bereits erwähnten Brief an Savigny schreibt Thissen am 15./16. Oktober 1866:„Aber auch die neue Gestaltung der Dinge ist der katholischen Kirche günstig. Sie erhält auch in den hiesigen Gegenden die freie Stellung und würdevolle Behandlung, deren sie sich in dem preußischen Staate vor allen anderen Ländern erfreut, und die Schranken fallen, welche die Kleinstaaterei ihrer Wirksamkeit gestellt hatte.“ (Real: Katholizismus und Reichsgründung, S. 51f.)
[113] Roth: Katholisches Bürgertum in Frankfurt am Main 1800-1914, S. 239.
[114] Kropat: Das Herzogtum Nassau, S. 181.
[115] Vgl. Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 179.
[116] Ebertz: Die Organisierung von Massenreligiosität im 19. Jahrhundert, S. 56f.
[117] Ebd., S. 72.
[118] Korff: Heiligenverehrung und soziale Frage, S. 107.
[119] Auf dieses Forschungsproblem wies hin: Anderson: Die Grenzen der Säkularisierung, S. 205.
[120] Als methodischer Vorreiter ist hier Nipperdeys „Religion im Umbruch“ zu nennen, weil er erstmals Religion als ein Stück Deutungskultur analysiert, die „die ganze Wirklichkeit der Lebenswelt konstituiert, das Verhalten der Menschen und ihren Lebenshorizont, ihre Lebensinterpretation prägt, gesellschaftliche Strukturen und Prozesse, ja auch die Politik“. (Ebd., S. 7.)
[121] Blaschke: Die Kolonialisierung der Laienwelt.
[122] Ebd., S. 95.
[123] Ebd., S. 96.
[124] Ebd., S. 132f.
[125] Ebd., S. 98f.
[126] Ebd., S. 104.
[127] Anderson: Die Grenzen der Säkularisierung, S. 210f.
[128] Begriff bei ebd., S. 213. Anderson entwickelt diesen Begriff im Kontrast zum Begriff der „Entbürgerlichung“. Vgl. dazu Irmtraud Götz von Olenhusen: Klerus und Ultramontanismus in der Erzdiözese Freiburg. Entbürgerlichung und Klerikalisierung des Katholizismus nach der Revolution von 1848/49, in: Wolfgang Schieder (Hg.): Religion und Gesellschaft im 19. Jahrhundert (Industrielle Welt Bd. 54), Stuttgart 1994, S. 113-143.
[129] Die Zahlen sind entnommen aus: Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 144 und Anderson: Die Grenzen der Säkularisierung, S. 201.
[130] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 32
[131] Ebd., S. 221.
[132] Zit. nach dem Protokoll der XXIII. Sitzung vom 6. November 1848, in: Acta et decreta sacrorum conciliiorum recentiorum, Sp. 1077f. Blum begründete seine Ansicht mit folgenden Argumenten: „[...] viele Kleriker ständen nicht mehr auf kirchlichem Boden und seien nicht erleuchtet vom Lichte des Glaubens. Der Materialismus, der in der Welt herrsche, müsse bekämpft werden durch das Walten der heiligen Liebe; aber viele Priester seien selbst der Sinnlichkeit und Unreinigkeit verfallen. [...] die Priester seien zum Theile der Habsucht und dem Geize verfallen und schalteten nach Willkür über ihr kirchliches Einkommen, indem sie dasselbe gegen die Absicht der Kirche nur zur Bereicherung ihrer Verwandten und zur Erzielung eines möglichst annehmlichen Lebens verwendeten.“ (Ebd.)
[133] Zitat aus dem Rechenschaftsbericht des Ordinariats über den Redemptoristen-Dotationsfonds vom 29. Juli 1857 bei Fuchs: Bornhofen, S. 215.
[134] Ebd.
[135] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 121.
[136] Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 182.
[137] Für Irmtraud Götz von Olenhusen sind es v.a. vier Faktoren, die einen ultramontanen Klerus in der Erzdiözese Freiburg entstehen ließen: Wandel der sozialen Herkunft, Klerikalisierung und Sakralisierung des Priesterbildes, Veränderung der Ausbildung, Überwachen und Strafen durch die Kirchenbehörde. (Dies.: Die Ultramontanisierung des Klerus, S. 68.)
[138] Blackbourn: Volksfrömmigkeit und Fortschrittsglaube im Kulturkampf, S. 13.
[139] Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 191.
[140] Anderson: Die Grenzen der Säkularisierung, S. 205, Anm. 32.
[141] Die bis heute umfassendste Studie verfasste 1970 der Benediktiner Martin Angerer (Beda Weber. Eine typische Seelsorgergestalt des neunzehnten Jahrhunderts, mit besonderer Berücksichtigung der Liturgie). Die wichtigste biographische Darstellung liefert Heinrich Scharp: Beda Weber (1798-1858), in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 12 (1960), S. 214-234.
[142] Zur italienischen Einwanderung vgl. Johannes Augel: Italienische Einwanderung und Wirtschaftstätigkeit in rheinischen Städten des 17. und 18. Jahrhunderts (Rheinisches Archiv 78), Bonn 1971; Reves, Christiane: „Ich erzählte ihm von den sämtlichen italienischen Familien...“ Die Präsenz von Händlern am Comer See in Frankfurt im 17. und 18. Jahrhundert, in: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst 68 (2002), S. 309-326; Silke Wustmann: Die Einbürgerung der italienischen Kaufmannsfamilie Bolongaro in Frankfurt am Main. Studie zur wirtschaftlichen Rivalität zwischen der Reichsstadt Frankfurt und dem Kurfürstentum Mainz im 18. Jahrhundert, in: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst 68 (2002), S. 327-374.
[143] Zahlen bei Roth: Katholisches Bürgertum in Frankfurt am Main 1800-1914, S. 213.
[144] Ebd.
[145] Angerer: Beda Weber, S. 34. Die Formulierung, Weber habe die Frankfurter Katholiken „aus dem Ghetto geführt“, die dort ebenfalls referiert wird, ist m. E. unangemessen.
[146] Zu Webers Initiativen ausführlicher: Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 146f.; Angerer: Beda Weber, S. 35-46.
[147] Schieder: Kirche und Revolution, S. 443.
[148] Lill: Die ersten deutschen Bischofskonferenzen, S. 20.
[149] Gedruckt in: Huber/Huber: Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, S. 20.
[150] “The missionary campaign[...] was systematic and dramatic [...] and rallied the Catholic popuation in an anti-Enlightment campain against materialism, liberalism, and rationalism.” (Gross: The War against Cahtolicism, S. 32.)
[151] Lieber: Andenken an die ersten Missionen in der Diöcese Limburg, S.8f. (in: DAL 203 F 1).
[152] Gisbert Lieber (1824-1857), Sohn von Moritz Lieber, 1847 zum Priester geweiht, ab 1849 Sekretär von Bischof Blum; 1856 Professor und Subregens am Priesterseminar Limburg. (Renkhoff: Nassauische Biographie, S. 464.)
[153] Lieber: Andenken an die ersten Missionen, S. 8.
[154] Ebd., S. 10.
[155] Ebd., S. 11.
[156] Um 15 Uhr jeden Tages war ein Rosenkranz angesetzt.
[157] Ebd., S. 20.
[158] Ebd.
[159] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 137.
[160] Weber: Die Jesuitenmission in Frankfurt am Main, in: Ders.: Cartons aus dem deutschen Kirchenleben, S. 453.
[161] Ebd., S. 457.
[162] Ebd., S. 456.
[163] Ebd., S. 464.
[164] Ebd., S. 465.
[165] Ebd.
[166] Ebd., S. 466.
[167] Ebd., S. 465.
[168] „Die große Stadt löst die bergenden Riten der Geburtswelt auf und lockert die religiös-soziale Kontrolle, pluralisiert die Lebenswelt und setzt auch den Katholiken der ständigen Konfrontation mit säkularen und antikatholischen Verhaltensweisen und Überzeugungen aus, anderen, nicht mehr kirchlich symbolischen, scheinbar rationaleren Orientierungsangeboten.“ (Nipperdey: Religion im Umbruch, S. 22.)
[169] Gross: The War against Catholicism, S. 80.
[170] Ebd., S. 75.
[171] Gross wertet eine Sammlung von Missionsvorträgen des Paderborner Weltpriesters Joseph Hillebrand aus. Danach waren die Hauptthemen der Predigten: die Entstehung des Menschen, die Sakramente, die Zehn Gebote, Sünde und Buße, das Gericht nach dem Tod, die Bedrohung der Verdammung, der Notwendigkeit der Beichte, die Menschwerdung Christi und die unanfechtbare Autorität der Kirche (Ebd., S. 41f.).
[172] Ebd., S. 44.
[173] Weber: Die Jesuitenmission in Frankfurt am Main, S. 454. Ebd., S. 455.
[174] Anderson: Die Grenzen der Säkularisation, S. 209.
[175] Lieber: Andenken an die ersten Missionen in der Diöcese Limburg, S. 22. Ebd., S. 13
[176] Ebd., S. 32.
[177] Ebd.
[178] Burkhard/Leuninger/Schatz: Limburg, S. 440.
[179] Lieber: Andenken an die ersten Missionen in der Diöcese Limburg, S. 35.
[180] DAL 351 C 1
[181] Gross: The War against Catholicism, S. 61.
[182] Vgl. auch die Artikel „Prozession“ und „Wallfahrt“ im Lexikon für Theologie und Kirche, hg. v. Walter Kasper, Bd. 8, Freiburg3 1999, Sp. 678-681 bzw. Bd. 10, Freiburg3 2001, Sp. 961-966.
[183] DAL 259 V1
[184] Vgl. Lutz: Die staatliche und kirchliche Untersuchung einer gesetzeswidrigen Wallfahrt von Limburg zur Beselicher Kapelle am 14. September 1845, S. 143-149.
[185] Ebd., S. 149.
[186] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 120.
[187] Ebd., S. 121.
[188] Vgl. dazu ausführlich Lutz: Die staatliche und kirchliche Untersuchung einer gesetzeswidrigen Wallfahrt von Limburg zur Beselicher Kapelle am 14. September 1845.
[189] Brief Blums an Möller, 15.12.1845, in: DAL 280 B 1.
[190] Diese Haltung resultierte aus der restaurativen, staatserhaltenden Intention der Rockwallfahrt. Schieder: Kirche und Revolution, S. 442.
[191] Lutz: Die staatliche und kirchliche Untersuchung einer gesetzwidrigen Wallfahrt von Limburg zur Beselicher Kapelle am 14. September 1845, S. 159.
[192] Ebd., S. 162.
[193] Ebd., S. 158.
[194] Oswalt: Ach! wäre es doch möglich, den Menschen begreiflich zu machen..., S. 327.
[195] Ebd.
[196] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 135.
[197] Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 211.
[198] Ebd., S. 214. Fuchs gibt um das Jahr 1857 eine Durchschnittszahl von 30.000 Pilger an. (Ders.: Bornhofen, S. 215.)
[199] Die Zahlen sind entnommen aus Fuchs: Bornhofen, S. 215f. Fuchs hatte Einsicht in die Hauchronik des Klosters.
[200] Und weiter: „Hier stand nicht die Frage zur Diskussion, ob die diffuse Pilgererei der sozialen Unterschicht eine revolutionäre Gefährdung des restaurativen Staatssystems bewirken könne, vielmehr kann die Trierer Wallfahrt als gelungener Versuch des rheinischen Klerus angesehen werden, von oben her einen im kirchlichen Sinne staatserhaltenden Einfluß auf breite Massen sicherzustellen.“ (Schieder: Kirche und Revolution, S. 445.)
[201] In: DAL 280 C 4.
[202] Lutz bemerkt zu ihr: „Die Montabaurer oder Trierische Wallfahrt nach Walldürn hatte [...] keinen guten Ruf und wurde am Zielort nicht, wie das üblich ist, von Geistlichen begrüßt und abgeholt; Zeitgenossen nannten sie die Knüppel- oder Ranzengarde.“ (Ders.: Die staatliche und kirchliche Untersuchung einer gesetzeswidrigen Wallfahrt on Limburg zur Beselicher Kapelle am 14. September 1845, S. 148.)
[203] Orthographie und Grammatik wurden im Zitat nicht korrigiert.
[204] In: DAL 280 C 4.
[205] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 14f.
[206] Ebd., S. 143f.
[207] Patres Eichelsbacher und Rossmaier und Bruder Brindl. (Fuchs: Bornhofen, S. 190.)
[208] Aufzählung mit Quellennachweis bei Anderhub: Verwaltung im Regierungsbezirk Wiesbaden 1866-1885, S. 161f.
[209] Zur kanonischen Unterscheidung zwischen Orden und Kongregation vgl. Meiwes: Arbeiterinnen des Herrn, S. 54-63.
[210] Zit. nach Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 139.
[211] Die 1845 von ihr selbst verfassten Statuten sind abgedruckt bei Lamp: Die Kongregation der Armen Dienstmägde Jesu Christi (Mutterhaus Dernbach/Westerwald), S. 320f. Darin waren für die Mitglieder des Vereins Demut, Armut, Keuschheit, Gehorsam, Gewissenserforschung, Empfang der Sakramente, Gebet und „gänzliche Entsagung der Welt und ihrer Lust“ vorgeschrieben.
[212] Vgl. Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 139. Wie dort ausgeführt, beging Kasper „die Unklugheit, ihm [= Blum] eidetisch-visionäre Erlebnisse aus ihrer Kindheit zu erzählen.“ Obwohl Blum ja nach Höhlers Auskunft auch selbst kindliche Visionen gehabt hatte, war er vielleicht durch seine Oberbrechener Haushälterin (s. 3.2) für abergläubische Vorstellungen schon in einer entsprechenden Weise sensibilisiert worden, um Kasper abzuweisen.
[213] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 139.
[214] Im Todesjahr von Katharina Kasper (1898) waren 1725 Schwestern in 193 Filialen tätig. Genaue Angaben bei Lamp: Die Kongregation der Armen Dienstmägde Jesu Christi (Mutterhaus Dernbach/Westerwald).
[215] „Es nötigt außerordentlichen Respekt ab, daß Katharina Kasper die Notwendigkeit einer gediegenen Ausbildung im Industriezeitalter bereits in dessen Anfängen erkannt hat, und zwar, was von besonderer Bedeutung ist, für den weiblichen Bevölkerungsteil. Hierin dokumentiert sich zweifellos die Einsicht, dass es zu den grundlegenden Anliegen der Zeit gehörte, die Frau zu emanzipieren.“ (Fuchs: Katharina Kasper (18201898), Gründerin der Klostergenossenschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi, S. 158.) In seinem Fazit resümiert Fuchs: „[...]; gleichfalls hat sie [= Kasper] in keineswegs unerheblichem Maße Anteil an den Bestrebungen zur Emanzipation der Frau.“ (Ebd., S. 165.)
[216] Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 143.
[217] Zitat von Ludwig Ficker bei Blackbourn: Volksfrömmigkeit und Fortschrittsglaube im Kulturkampf, S. 21.
[218] Blackbourn: Volksfrömmigkeit und Fortschrittsglaube im Kulturkampf, S. 20.
[219] Vgl. Paletschek: Frauen und Säkularisierung Mitte des 19. Jahrhunderts, S. 300ff. (mit Zusammenfassung des Forschungsstandes).
[220] Meiwes: „Arbeiterinnen des Herrn“. Ihre Thesen fasst Meiwes im Aufsatz „Weibliche Berufsarbeit in Gesellschaft und Kirche“ zusammen.
[221] Ebd., S. 118.
[222] Ebd., S. 120.
[223] Ebd., S. 126.
[224] Ebd., S. 131f.
[225] Hilpisch: Die Genossenschaft der Barmherzigen Brüder von Montabaur, S. 6f. Ebd., S. 7.
[226] Ebd., S. 10.
[227] Ebd.
[228] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 143.
[229] Fuchs zieht in seinem Aufsatz „Katharina Kasper (1820-1898), Gründerin der Klostergenossenschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi“ hauptsächlich Wilhelm Heinrich Riehls „Land und Leute“ heran, um das Elend der Westerwälder zu beschreiben.
[230] Vgl. dazu Lerner: Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Nassauer Raumes 1816-1964, S. 29f., Weimer: Die Verarmung in Mittelnassau im 19. Jahrhundert.
[231] Fuchs: Katharina Kasper (1820-1898), Gründerin der Klostergenossenschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi, S.154.
[232] Argumente von Friedrich Engels referiert bei Korff: Heiligenverehrung und soziale Frage, S. 106f.
[233] Die antikatholischen Sichtweisen des Klosters werden ausführlich referiert bei Gross: The War against Catholicism, S. 128-184.
[234] Zum folgenden: Paulus: Limburger Seminarkurs 1866/71, S. 219f.
[235] Zitat von Bismarck 1871 bei Paulus: Limburger Seminarkurs 1866/71, S. 220.
[236] Zu den Vorstößen des Zentrums vgl. Bornkamm: Die Staatsidee im Kulturkampf, S. 9f.
[237] Vgl. ebd., S. 10 und S. 53ff., sowie Morsey: Der Kulturkampf, S. 166.
[238] Ebd., S. 165f.
[239] Vgl. Huber/Huber: Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, S. 536-542.
[240] Morsey: Der Kulturkampf, S. 169.
[241] Gesetz über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen (11. Mai 1873), in: Huber/Huber: Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert S. 594-599.
[242] Gesetz, betreffend die Abänderung der Artikel 15 und 18 der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 (5. April 1873), in: Ebd., S. 593.
[243] Ebd. und Gesetz über die Grenzen des Rechts zum Gebrauche kirchlicher Straf- und Zuchtmittel (13. Mai 1873), in: Ebd., S. 608.
[244] Blackbourn: Volksfrömmigkeit und Fortschrittsglaube im Kulturkampf, S. 17.
[245] Vgl. dazu auch Manfred Scholle: Die preußische Strafjustiz im Kulturkampf 1873-1880 (Diss.), Marburg 1974.
[246] Lill: Die ersten deutschen Bischofskonferenzen, S. 120.
[247] Abgedruckt bei Huber/Huber: Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, S. 563-579.
[248] Lill: Die ersten deutschen Bischofskonferenzen, S. 120.
[249] In: DAL 1 H 3.
[250] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 177.
[251] Anderhub: Verwaltung im Regierungsbezirk Wiesbaden 1866-1885, S. 165.
[252] Zahl bei Ebd., S. 168. Limburg liegt damit leicht über dem preußenweiten Prozentsatz von 24% vakanten Pfarreien im Jahr 1881. (Zahl bei Morsey: Der Kulturkampf, S. 172.)
[253] Huber/Huber: Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, S. 662ff; Lill: Der Kulturkampf, S. 105-108.
[254] Anderhub: Verwaltung im Regierungsbezirk Wiesbaden 1866-1885, S. 170.
[255] Ebd., S. 171.
[256] Schatz schreibt dazu: „Es ist für die Limburger Diözese kein einziger Fall eines mit dem Staat kollaborierenden Priesters bekannt. Die Tatsache, dass die Bischöfliche Behörde gegen einen solchen unnachsichtig eingeschritten wäre, dürfte vielleicht den einen oder anderen abgeschreckt haben.“ (Ders.: Geschichte des Bistums Limburg, S. 179f.)
[257] Ebd., S. 179; Anderhub: Verwaltung im Regierungsbezirk Wiesbaden 1866-1885, S. 173.
[258] In: DAL 2 3 L. Abgedruckt bei Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 338f.
[259] „Die Bischöfe von Limburg haben nie in einem „Palais“ gewohnt, sondern immer in relativ armen und beengten Verhältnissen.“ (Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 88.) Paulus meint dazu: „Hier lebt keine Tradition aus reicher, mächtiger, kirchenfürstlich-selbständiger Vergangenheit. [...] Hier ist alles klein. [...] Schmalhans war Kirchenmeister.“ (Ders.: Limburger Seminarkurs 1866/71, S. 217.)
[260] Vgl. Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S.334f.
[261] Schon seit 1861 hatte er sich wegen seines Gesundheitszustandes mit ernsthaften Rücktrittsabsichten getragen und bei Pius IX. zuerst um Resignation vom Amt und später um Ernennung eines Koadjutors mit dem Recht der Nachfolge ersucht. (Vgl. Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 170f.; Real: Katholizismus und Reichsgründung , S. 259f.)
[262] Schreiben Blums an Klein, 25. Oktober 1876, in: DAL 2 3 L.
[263] Schreiben Blums an von Ende, 25. Oktober 1876, in: Ebd. und Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 340ff.
[264] Schreiben Höhlers an Klein, 12. Dezember 1883, in: DAL 2 3 M.
[265] In: DAL 2 3 Q.
[266] In: DAL 2 3 N.
[267] In: DAL 106 G 2.
[268] Datiert mit 30. Oktober 1871, in: DAL 106 G 2.
[269] Pfarrer Mayer, Benefiziat Müllers und Kaplan Sehrbrock.
[270] Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 325.
[271] Melchers glaubte mehr an Demarchen an höchster Stelle als an plebiszitäre Mittel. (Schatz: Geschichte des
[272] Bistums Limburg, S. 175.)
[273] In: DAL 106 G 2.
[274] Das teilt Blum in einer Eingabe an den Bundsrat mit. (In: DAL 106 G 2)
[275] Preußisches Gesetz, betreffend die geistlichen Orden und ordensähnlichen Kongregationen der katholischen Kirche, in: Huber/Huber: Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, S. 659.
[276] In: DAL 106 G 2.
[277] In: DAL 106 G 2.
[278] Hilpisch führt diese Ausnahme auf Kriegsminister von Kameke zurück, der in einer Sitzung des Staatsministeriums erklärte, dass er ohne Barmherzige Schwestern keinen Krieg führen könne. (Ders.: Die Genossenschaft der Barmherzigen Brüder, S. 48.)
[279] Einzige Ausnahme war der von den ADJC betriebene Hort in Höchst, der wegen der vielen dort lebenden Fabrikarbeiter als „höchst wünschenswert“ eingestuft wurde und auf privater Basis weitergeführt wurde. (Anderhub: Verwaltung im Regierungsbezirk Wiesbaden 1866-1885, S, 163.)
[280] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 177.
[281] Vgl. DAL 101 AA 1. Hilpisch gibt an, dass die Barmherzigen Brüder ihren Grundbesitz in und bei Montabaur an den Grafen Wilderich von Walderdorff, den Besitz in Höchst an Backsteinfabrikant Wiegand und den Grundbesitz in Frankfurt an den Kaufmann Heinrich Kaufmann überschreiben hatten. (Ders: Die Genossenschaft der Barmherzigen Brüder, S. 49.)
[282] Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 180.
[283] So Morsey: Der Kulturkampf, S. 172f.
[284] Weiterführend: Friedrich Wilhelm Graf: Die Politisierung des religiösen Bewußtseins: die bürgerlichen Religionsparteien im deutschen Vormärz. Das Beispiel des Deutschkatholizismus, Stuttgart 1978; Alexander Stollenwerk: Der Deutschkatholizismus in den Preußischen Rheinlanden (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 15), Mainz 1971.
[285] So der katholische Priester Johannes Ronge, der die Kritik anführte, vgl. Schieder: Religion und Revolution, S. 70ff.
[286] „Die Wallfahrt nach Trier. Eine Stimme aus Nassau“ (1844).
[287] Silberhorn: Der Deutschkatholizismus in Nassau.
[288] In: DAL 2 3 U 11.
[289] Eine umfassende Untersuchung über die Altkatholiken in Hessen-Nassau steht noch aus. Einige Angaben
finden sich bei Schatz: Geschichte des Bistum Limburg, S. 172f., und Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 326.
[290] In: DAL 214 B 4.
[291] In: Ebd.
[292] Konzept in: ebd., abgedruckt bei Real: Katholizismus und Reichsgründung, S. 138f.
[293] Abgedruckt bei: Huber/Huber: Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, S. 627.
[294] Nipperdey: Religion im Umbruch, S. 13.
[295] Schreiben Blums an Klein, 26. Februar 1881, in: DAL 501 L 3.
[296] Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 335.
[297] Schreiben Kleins an Blum, 16. März 1881, in: DAL 501 L 3.
[298] Zur Ausarbeitung der Referate sollten außer Klein auch die Domherren Gerlach, Walter und Weimer herangezogen werden. (Schreiben Blums an Klein, 21. März 1881, in: DAL 501 L 3.)
[299] Alle in: DAL 501 L 3.
[300] Unterstreichung wie im Original.
[301] Herzmanns Verteidigung war, dass er als Dekan zur Abhaltung von Gottesdiensten in seinem Dekanat berechtigt sei.
[302] Crone: Obertiefenbach im Jahre 1874. Das Fundstück war zusammen mit anderen Papierresten bei Abriss der Wandtäfelung eines Klassenzimmers entdeckt worden.
[303] Die Urkunde ist wiedergegeben ebd., S. 221f.
[304] Ebd., S. 228.
[305] Ebd., S. 235.
[306] Höhler: Geschichte des Bistums Limburg, S. 331.
[307] Ebd., S. 330.
[308] Bismarck: Gedanken und Erinnerungen, S. 437.
[309] Es handelt sich dabei um Pfarrer Junk aus Ems, der im Dezember 1875 eine uneingeschränkte Gehorsamserklärung gegenüber den Gesetzen des Staates abgab, um seine Wohnung zu behalten. Im Februar 1876 widerrief er diese Erklärung von der Kanzel herab, auf Druck seiner Oberen und seiner Gemeinde, wie die Regierung vermutete. (Anderhub: Verwaltung im Regierungsbezirk Wiesbaden 1866-1885, S. 169.)
[310] Abgedruckt in „Katholisches Volksblatt für alle Stände“ No. 35 vom 30. August 1874 (in: DAL 559 BD 2).
[311] In: DAL 559 BD 2.
[312] Datiert mit 2. September 1874, in: Ebd.
[313] Ebd.
[314] Föhles: Kulturkampf und katholisches Milieu 1866-1890, S. 297/298. Die Autorin führt dort aber auch ein abweichendes Beispiel aus der Stadt Viersen an.
[315] In: DAL 2 3 M
[316] Nipperdey: Religion im Umbruch, S. 49. Zum Weg des politischen Katholizismus hin zur staatstragenden Kraft vgl. Martin: Der katholische Weg ins Reich.
[317] Schreiben von Blum an Dekan Herzmann, 5. Januar 1880, in: DAL 501 L 3.
[318] Becker: Der Kulturkampf als europäisches und als deutsches Phänomen, S. 432.
[319] Schatz: Drei Limburger Bischofswahlen im 19. Jahrhundert (1827 – 1842 – 1886) als Spiegel kirchengeschichtlicher Auseinandersetzungen, S. 211f.
[320] Ebd., S. 211f.
[321] Ebd., S. 212.
[322] Morsey: Der Kulturkampf, S. 179.
[323] Nipperdey: Religion im Umbruch, S. 19.
[324] Schatz: Drei Limburger Bischofswahlen im 19. Jahrhundert (1827 – 1842 – 1886) als Spiegel kirchengeschichtlicher Auseinandersetzungen, S. 212.
[325] Schatz schreibt dazu im Zusammenhang mit dem nassauischen Kirchenstreit: „Beachtlich ist, in welchem Maße Klein z.B. bei den Pfarrbesetzungen, beim Religionsunterricht und der kirchlichen Vermögensverwaltung radikale Konfrontationen vorschlägt oder wenigstens in Betracht zieht [...] Und tatsächlich war diese Konfliktstrategie des Generalvikars in der Frage der Pfarreibesetzungen die Marschroute, nach der der Bischof sich richtete.“ (Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 369.)
[326] Schreiben von Blum an Dekan Herzmann, 5. Januar 1880, in: DAL 501 L 3.
[327] Becker: Der Kulturkampf als europäisches und als deutsches Phänomen, S. 432.
[328] Schatz schreibt dazu im Zusammenhang mit dem nassauischen Kirchenstreit: „Beachtlich ist, in welchem Maße Klein z.B. bei den Pfarrbesetzungen, beim Religionsunterricht und der kirchlichen Vermögensverwaltung radikale Konfrontationen vorschlägt oder wenigstens in Betracht zieht [...] Und tatsächlich war diese Konfliktstrategie des Generalvikars in der Frage der Pfarreibesetzungen die Marschroute, nach der der Bischof sich richtete.“ (Schatz: Geschichte des Bistums Limburg, S. 369.)
[329] Nipperdey: Religion im Umbruch, S. 19.
- Arbeit zitieren
- M.A. Lisa Wünschmann (Autor:in), 2006, Katholische Erneuerung und Kulturkampf, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384965
Kostenlos Autor werden












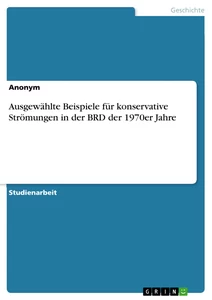









Kommentare