Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1) Einleitung
2) Der Leibniz-Clarke-Briefwechsel
2.1) Die ersten drei Schreiben
2.2) Darstellung des Prinzips in Leibniz' vierten und fünften Schreiben
2.3) Clarkes Kritik in seiner letzten Erwiderung
3) Principium identitatis indiscernibilium
3.1) Das Leibniz-Gesetz
3.2) Peter Forrest: The Identity of Indiscernibles
4) Das Prinzip der Identität von Ununterscheidbarem in Primary Truth
5) Fazit
Quellenverzeichnis
1) Einleitung
Im Seminar „Einführung in die Philosophie von Raum und Zeit: Newton gegen Leibniz“ wurde eine Vielzahl von Theorien bezüglich der Eigenschaften von Raum und Zeit vorgestellt, mit der sich Forscher, Denker und Theologen seit jeher beschäftigen. Die Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz und Isaac Newton sind dabei die wohl bekanntesten Teilnehmer der Debatte über Raum und Zeit und der Rolle, die die Materie bei dieser Fragestellung spielt. Diese Diskussion spiegelt sich in einem Briefwechsel zwischen Leibniz und Samuel Clarke, stellvertretend für Newtons Arbeiten und Ansichten, wieder, der sich ausführlich mit den Fragen rund um Raum und Zeit beschäftigt und durch den Tod Leibniz' sein verfrühtes Ende nahm.
Die folgende Hausarbeit mit dem Titel „Das Prinzip der Identität von Ununterscheidbarem“ wird sich mit eben diesem Briefwechsel beschäftigen, insbesondere mit einem speziellen Zitat aus Leibniz' viertem Schreiben. „Zwei Dinge als ununterscheidbar anzunehmen, heißt unter zwei Namen ein und dasselbe Ding anzunehmen“[1]. Worauf Leibniz mit dieser Aussage hinaus möchte, worum es sich bei dem Prinzip der Identität ununterscheidbarer Dinge handelt und ob er mit diesem Prinzip recht hat, gilt es im Laufe dieser Arbeit zu klären.
Zu diesem Zweck wird zunächst der zentrale Inhalt der Leibniz-Clarke-Korrespondenz vorgestellt, wobei gerade Leibniz' Ansichten über Raum, Zeit, Materie, Gott und sein Satz vom hinreichenden Grund im Mittelpunkt stehen werden. Diese Zusammenfassung beschränkt sich auf seine ersten drei Schreiben, wobei im vierten und fünften Schreiben, die gesondert untersucht werden, letztlich das Prinzip der Identität ununterscheidbarer Dinge im Mittelpunkt stehen wird. Dann werden das Prinzip und sein Vertreter an sich durchleuchtet, wobei geklärt werden soll, worum es sich bei Leibniz' Arbeit genau handelt und welche Meinungen und Interpretation dadurch entstanden sind. Dazu wird ein Artikel von Peter Forrest, „The Identity of Indiscernibles“, vorgestellt. Als direkter Vergleich seines Prinzips im Briefwechsel mit Clarke, wird ein weiterer Text von Gonzalo Rodriguez-Pereyra hinzugezogen, der das Prinzip ebenfalls untersucht, allerdings auf der Grundlage von Leibniz' Werk „Primary Truth“, wobei die Meinung des Autors ebenfalls eine Rolle spielen wird, sodass es am Ende möglich sein wird, die hier aufgeworfenen Fragen zu beantworten.
2) Der Leibniz-Clarke-Briefwechsel
2.1) Die ersten drei Schreiben
Der populäre Briefwechsel zwischen Leibniz und Clarke, übermittelt durch die damalige Prinzessin von Wales, Caroline von Ansbach, findet seinen Ursprung in einem von Leibniz verfassten kritischen Schreiben an dessen Rivalen Isaac Newton, in welchem er behauptet, Newtons Philosophie würde der natürlichen Theologie immensen Schaden zufügen. Doch anstatt einer rechtfertigenden Erwiderung von Newton erhielt Leibniz eine Antwort von Clarke, der sich schützend für Newton ausspricht und den Briefwechsel damit in Gang setzte.
Mit genanntem Vorwurf befasst sich Leibniz in seinem ersten Schreiben und übt damit offen Kritik an Newton, Locke und einigen weiteren aus, da sie, seinem Verständnis nach, Gott als materiell betrachten und ihm somit Vergänglichkeit zuschreiben würden. Dies wird gestützt durch Newtons Aussage, Gott nehme die Dinge durch den Raum wahr, wonach sie selbst nicht in Abhängigkeit zu ihm stehen würden. Außerdem würde Newton Gott einen gewissen Grad an Fehlerhaftigkeit vorwerfen. So behauptete er, dass die natürliche Bewegung, wie sie in der Welt und im All stattfindet, immer wieder von Gott selbst in Schwung gebracht werden müsse, um so weiterzulaufen, dass sie auch richtig funktioniert. Leibniz beendet seinen ersten Brief damit, dass er sagt, dass „wenn Gott Wunder vollbringt, er dies nicht tut, um Erfordernisse der Natur zu erfüllen, sondern der Gnade“2 wegen.
In seinem zweiten Schreiben reagiert Leibniz auf Clarkes Antwort, der seinesgleichen und deren „Mathematische Prinzipien der Physik“ 3 als Hauptfeinde eben jener Materialisten ausspricht, die die eigene, richtige Philosophie falsch interpretierten und an welche Leibniz' Kritik eigentlich gerichtet sein sollte. Diese Prinzipien würden die Materie als geringsten Teil des Universums einstufen und Gott, der keineswegs ein Hilfsmittel zur Wahrnehmung bedürfe, Allgegenwärtigkeit zusprechen, wodurch er, überall im Raum selbst vorhanden, mit allen Dingen verbunden sei. Leibniz sieht diese Materialisten ebenfalls als Feinde, sogar als Gottes Feinde selbst, an. Im darauffolgenden[2] [3]
Satz erklärt Leibniz, dass allein sein „Satz vom Widerspruch bzw. von der Identität“4 die Grundlage für die Mathematik liefert, wie er ihn in seiner „Theodizee“ nannte, der besagt, dass eine Aussage wahr oder falsch sein muss und niemals beides zur gleichen Zeit. Für die Grundlage der Physik müsste diesem Satz der „Satz vom hinreichenden Grunde“5 hinzugefügt werden, der wiederum besagt, dass sich nichts ereignet, „ohne dass es einen Grund gibt, warum es so ist und nicht anders“6. Dies begründe nicht nur die Physik, sondern auch die Metaphysik, die natürliche Theologie und bewiese die Existenz Gottes. Nach diesem Lob über die eigenen Errungenschaften, äußert Leibniz einen weiteren Kritikpunkt an Newton, der zwar die Materie als unbedeutend ansieht, aber nur in dem Sinne, dass sie einen so geringen Anteil des daneben existierenden leeren Raumes einnehme. Eben diese Existenz der Leere bestreitet Leibniz vehement, da Gott in der Materie seine Macht ausübt und dass Leere der Definition nach gerade dort ist, wo sich keine Materie befindet, was wiederum bedeuten würde, dass Gottes Macht sich nur in einem Bruchteil des Universums wiederfinden ließe. Im weiteren Verlauf des Briefes beschäftigt sich Leibniz dann wieder mit der Frage, inwieweit Gottes Eingreifen bzw. Antreiben des geregelten Laufs des Universums verstanden werden muss. Dazu zeigt er auf, was Gottes Macht überhaupt ausmacht. Denn wie eine Maschine von Künstlern oder Handwerkern gebaut werden kann, baut auch Gott die Körper, mit dem Unterschied, dass er zum Erbauen keiner Materie bedarf. Von Menschen erbaute Maschinen wurden zunächst aus bereits bestehender Materie geformt, Gottes Maschinen blicken auf keinen derartigen Ursprung zurück. Dadurch, dass Gott allein diese Macht besitzt, macht ihn das zum besten aller Schöpfer, weshalb Gottes Maschinen auch die besten Schöpfungen sind. An dieser Stelle wirft Leibniz seinem Gegenüber vor, dass sie die Ansicht vertreten, Gott müsse seine eigenen Fehler durch die Eingriffe in der Natur vornehmen, um die Maschine am Laufen zu halten. Dies würde aber seine Allmacht in Frage stellen, weshalb Leibniz zwar bestätigt, dass ein Eingreifen Gottes dann und wann vonstatten gehen müsse, es sich dabei aber nicht um eine Reparatur handle.7 Viel eher würde Gott in seiner vollkommenen Voraussicht bereits im Vorfeld Mittel und Wege einrichten, die einen Fehlschlag seiner Schöpfung vorbeugen. Auf diese Weise würde Gott nicht nur seiner Macht Ausdruck verleihen, da ohne ihn als „König“ 8 die Welt nicht existieren würde bzw. bereits untergegangen wäre, sondern durch die Voraussicht auch seiner Weisheit, wobei er in seinem Wirken in nichts eingeschränkt ist.
In seinem dritten Schreiben reagiert Leibniz auf eine Ausführung Clarkes, in welcher dieser behauptet, „der Raum sei ein absolutes wirkliches Seiendes“[4] und würde sogar ein Attribut Gottes bzw. Gott selbst sein. Dies hält Leibniz aber für unmöglich, da seiner Meinung nach der Raum und die Zeit aus Teilen bestehen[5], also eine bloße Folge von Abschnitten bilden und demnach als relativ zu klassifizieren sind. Folgend formuliert der Autor jeweils Definitionen für Raum und Zeit. Dabei stellt der Raum eine „Ordnung des Nebeneinanderbestehens“[6] und die Zeit eine „Ordnung der Aufeinanderfolge“[7] dar. Da der Raum zum einen etwas vollkommen Homogenes ist und sich deshalb keine zwei Raumteile oder Raumpunkte voneinander unterscheiden lassen, ist er selbst als nichtseiend zu bezeichnen. Erst, wenn sich Körper in diesen Raumpunkten befinden, sind diese unterscheidbar und umgekehrt ununterscheidbar, wenn sich keine Körper in ihm befinden. Warum dabei etwas so und nicht so nebeneinander besteht, ist allein Gottes Werk. Dies gilt genauso für die Zeit. In Clarkes zweiter Erwiderung bestätigte er die Überzeugungskraft von Leibniz' Satz vom hinreichenden Grund, fügt aber hinzu, dass es sich bei diesem Grund um den bloßen „Wille Gottes“[8] handeln würde. Dies würde aber für Leibniz bedeuten, dass Gott auch dann etwas wolle, ohne dabei einen bestimmten Grund zu verfolgen, was wiederum im Widerspruch zu seiner Weisheit steht. Demnach verfolgt sein Wille immer einem bestimmten Grund und keiner „sinnlosen Notwendigkeit“[9]. Auch Clarkes Aussage über die Leere, deren Existenz Leibniz ja bestreitet, dass dort wo keine Materie ist „andere Dinge“[10] existieren und auch sie, neben der Materie, von Gott gelenkt werden, wird an dieser Stelle angezweifelt. Als letzten wichtigen Punkt in seinem dritten Schreiben gibt Leibniz Antwort auf Clarkes Behauptungen bezüglich des Eingreifens Gottes in den Lauf der Welt und des Universums. So setzt Clarke voraus, dass die von Gott erschaffene Wirklichkeit die bestmöglichste Welt all seiner Entwürfe ist, was er durch seine Weisheit erkannt hat und diese Welt keinerlei Korrektur bedarf. Viel mehr hat Gott sie so perfekt eingerichtet, dass sie genau so lange hält, wie er es für richtig hält16. Ist dann dieses Verfallsdatum erreicht, stellt Gott die Welt wieder richtig ein, um seine Herrschaft zu demonstrieren. Leibniz fügt hinzu, dass Gott, der ja „alles in allem“ ist, durch diese Störungen, die das Verfallsdatum mit sich brächte auch Störungen bei sich selbst verursachen würde. Deshalb ist es laut ihm sinnvoller zu sagen, Gott verhindere die Störungen schon im Vornherein durch bestimmte Vorkehrungen, noch lange bevor sie überhaupt eingetreten sind.
2.2) Darstellung des Prinzips in Leibniz' vierten und fünften Schreiben
In Clarkes dritter Erwiderung nimmt dieser erneut Bezug auf Leibniz' Satz des hinreichenden Grundes und stellt fest, dass bei „Dingen (...), die ihrer eigenen Natur nach ohne Unterschied sind, ist der bloße Wille, und zwar ohne daß irgend etwas Äußeres auf ihn einwirkt, allein dieser hinreichende Grund, wie zum Beispiel in dem Falle, wo Gott irgendein Materieteilchen in dem einen und nicht dem anderen Orte erschaffen und angeordnet hat, obwohl ursprünglich alle Orte gleich sind“17. Dabei wäre es völlig egal, ob der Raum nun wirklich oder bloße Ordnung wäre, da aufgrund seiner Unterschiedslosigkeit allein der bloße Wille Gottes Grund dafür gewesen sein kann, dass die Reihenfolge von gleichen Teilchen a, b, c und nicht c, b, a gesetzt ist. Für ihn wäre es sogar absurd zu sagen, der Raum sei eine bloße Ordnung. Als Beispiel nennt er die Positionen einiger Himmelskörper zueinander, die, auch wenn sie irgendwo anders im Universum gesetzt worden wären, trotzdem am gleichen Ort blieben, solange sie ihre Abfolge beibehielten.
Leibniz beginnt sein viertes Schreiben direkt mit dem Statement, dass bei vollkommen unterschiedslosen Dingen „keine Möglichkeit zum Auswählen“18 bestünde und demnach ebenso weder Wahl noch Wille. Leibniz merkt an, dass es den bloßen Willen gar nicht geben kann, da sich ein Wille ohne Intention bereits in seiner Definition widerspricht. „Zwei voneinander ununterscheidbare Einzeldinge gibt es nicht“19. Laut Autor gibt es keine vollkommen gleichen Dinge in der Natur, so wie es Clarke behauptet. Gott wäre durch seine Weisheit niemals dazu verleitet solche Dinge zu erschaffen, geschweige denn sie in einer bestimmten Reihenfolge anzuordnen, da sich kein Sinn dahinter verbergen würde. Leibniz erklärt, dass man nach solchen Dingen in der Natur suchen kann, nennt als Beispiele Blätter oder Wassertropfen20, doch niemals, auch wenn es auf den ersten Blick so erscheinen möge, Dinge findet, die nicht einen sich abgrenzenden Unterschied aufweisen. Aus diesem Grund ist er davon überzeugt bewiesen zu haben, dass Atome nicht existieren. Auch behauptet er, dass durch seine „grundlegenden Sätze vom hinreichenden Grund und von der Identität ununterscheidbarer Dinge“21 die Metaphysik, die zuvor nur aus leeren Worten bestand, nun endlich beweiskräftige Ergebnisse liefern könne. Als Definition dieses hier neu aufgeworfenen Satzes der Identität ununterscheidbarer Dinge schreibt Leibniz: „Zwei Dinge als ununterscheidbar anzunehmen, heißt unter zwei Namen ein und dasselbe Ding anzunehmen“22. Mithilfe des Prinzips will er zeigen, dass Clarkes Behauptung, man könne Dinge im Universum versetzten und ihren Ort trotzdem beibehalten, solange die Körper bloß in ihrer Reihenfolge blieben, bloß Fiktion sei. Er wendet es ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auf den Zustand der Welt im Universum an, indem er schreibt, dass es unmöglich sein kann, dass Gott das Universum auf einer geraden Linie bewegt, „ohne sonst irgend etwas an ihm zu verändern (...). Denn zwei voneinander ununterscheidbare Zustände sind ein und derselbe Zustand“23. Da sich am Zustand der Welt, würde sie sich immer starr geradeaus im zwar vorstellbaren aber nicht wahrnehmbaren Raum bewegen, nie ein Unterschied zeigen würde, es also ein gleichbleibender Zustand wäre, hätte Gott keinen Grund sie derartig zu bewegen, weshalb er es auch seiner Weisheit wegen nicht tut. Die Homogenität des Raumes und die damit verbundene absolute Gleichheit seiner Teile würde dabei ein Problem darstellen, sollten auch noch ununterscheidbare Dinge in ihm platziert werden. Denn wie will die Wahl zwischen einzelnen Raumteilen, die ununterscheidbar sind, getroffen werden, wenn zwar der Wille aber kein Grund bestünde? Gott jedenfalls würde keine Wahl treffen, da er sich nicht von äußeren Dingen bestimmen ließe, sondern alles aus seiner inneren Weisheit hervorgeht.
In Leibniz' fünften Schreiben greift der Autor noch einmal die Tatsache auf, dass anhand seines Satzes des hinreichenden Grundes bereits abgeleitet werden konnte, dass es „in der Natur keine zwei absolute wirkliche Dinge gibt, die voneinander ununterscheidbar sind“24.
In diesem Falle würden Gott und die Natur nämlich ohne Grund handeln, sobald sie diese ununterscheidbaren Dinge unterschiedlich behandeln, so wie etwa die unterschiedliche Wahl des Raum- bzw. Zeitpunktes für genannte Dinge[11]. Leibniz führt auf, dass dadurch behauptet werden kann, dass Gott in diesem Fall überhaupt keine Materie erschaffen könne, da die kleinsten Teile der Materie, die Atome, deren Existenz er ja vehement bestreitet, vollkommen gleich sind. Auf derlei Vorwürfe würde er damit reagieren, dass die viel zu simpel gedachte Theorie der Atomisten unvereinbar mit der Ordnung der Dinge und Gottes Weisheit ist, durch die nichts ohne Grund geschieht. Ebenso findet er die Vorstellung dieser kleinsten, massiven Teilchen ohne jegliche Verschiedenheit bzw. Bewegung in ihren Teilen unmöglich, obgleich er behauptet, dass Materie in viele verschiedene bewegte Teile zerlegt werden kann, wobei allerdings keiner dem anderen gleicht. Er greift noch einmal seine Beispiele des Blattes und des Wassertropfens aus seinem vorherigen Schreiben auf und konkretisiert seine Behauptung. Dazu sagt er, dass sein Prinzip in jedem Falle für alle sinnlich wahrnehmbaren Dinge gilt, da ihm bislang kein Gegenbeispiel zum Beweis ununterscheidbarer Einzeldinge vorgelegt werden konnte. Für alle sinnlich nicht wahrnehmbaren Dinge gilt dabei weitestgehend dasselbe. Woraus sich die Materie tatsächlich zusammensetzen würde, wenn nicht aus unteilbaren Atomen, wären die Monaden, die weder Ausdehnung noch Teile besitzen und jede in ihrer Eigenschaft einzigartig ist[12]. Diese Monaden sind im Vergleich zu den Atomen nicht teilbar und sind weder auf natürliche Weise entstanden, noch vergänglich. Sie sind von Gott erschaffen worden und können auch nur von ihm allein wieder vernichtet werden. Monaden sind einfach und ausnahmslos individuell, wobei sie keinem Einfluss von außen ausgesetzt sein können und jede Veränderung an ihnen sich nach einem inneren Prinzip vollzieht. Es herrscht dabei eine strikte Hierarchie zwischen den individuellen Monaden, die wiederum in Gruppen klassifiziert werden können. Ganz oben steht Gott über jenen Monaden, die Leibniz als Geister bezeichnet, welche wiederum über das Merkmal der Fähigkeit zur Selbstreflexion verfügen, bis zu den schlafenden Monaden, die ohne eigene Wahrnehmung existieren. Für Raum und Zeit gilt das Prinzip vom Ununterscheidbarem nicht, da sie die „Ordnung für die Existenz der Dinge“[13] und keine Einzeldinge an sich sind. Für Leibniz sind die raumzeitlichen Teile ununterscheidbar, obgleich niemals zwei dieser Teile als ein und derselbe bezeichnet werden dürfen, da dies nicht zutreffen würde.
Alle möglichen Raum- und Zeitpunkte sind dementsprechend gleich gut, wonach Gott keinen Grund hätte zwei gleiche Dinge an unterschiedlichen Orten bzw. Zeitpunkten zu platzieren. „Seine Weisheit erlaubt es Gott aber nicht, zwei vollkommen gleichen und ähnlichen Würfeln gleichzeitig Plätze zuzuweisen, weil es unmöglich ist, einen Grund dafür zu finden, ihnen verschiedene Plätze zu geben, es sei denn, es gäbe einen Willen ohne Beweggrund“28. Was die Unterscheidbarkeit von Raum- und Zeitpunkten angeht, kann diese erst erfolgen, wenn Dinge in Raum und Zeit platziert wurden, was bedeutet, dass ihre Individualität von den Dingen abhängig sind.
[...]
[1] Leibniz, Gottfried Wilhelm: Der Leibniz-Clarke Briefwechsel / übers. und hrsg. von Volkmar Schüller. AkademieVerlag GmbH, Berlin (1991); S. 52, Z. 9ff
[2] Leibniz, Gottfried Wilhelm: Der Leibniz-Clarke Briefwechsel / übers. und hrsg. von Volkmar Schüller. AkademieVerlag GmbH, Berlin (1991); S. 20, Z. 11ff
[3] Ebd., S. 21, Z. 6ff
[4] Ebd., S. 37, Z. 19ff
[5] Vgl. Ebd., S. 37, Z. 24ff
[6] Ebd., S. 38, Z. 1ff
[7] Ebd., S. 38, Z. 2ff
[8] Ebd., S. 39, Z. 32ff
[9] Ebd., S. 40, Z. 20
[10] Ebd., S. 32, Z. 18
[11] Vgl. Ebd., S. 103, Z. 13ff
[12] Vgl. Ebd., S. 84, Z. 8
[13] Ebd., S. 85, Z. 27
- Arbeit zitieren
- Laura Wirths (Autor:in), 2015, Das Prinzip der Identität von Ununterscheidbarem. Die Philosophie von Raum und Zeit bei Newton und Leibniz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383801
Kostenlos Autor werden
















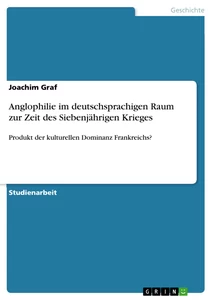





Kommentare