Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
II ABBILDUNGSVERZEICHNIS
III TABELLENVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
2 THEORETISCHE GRUNDLAGE
2.1 Das Geschlecht - Definition und Einführung in das Thema
2.1.1 Geschlecht - Definition
2.1.2 Sozialisation und Geschlechtsstereotype
2.1.3 Gender und Gender-Bias
2.1.4 Gender Mainstreaming
2.2 Biologische Konstitution von Männern und Frauen
2.3 Frauen und Männer - Unterschiede in der Gesundheit
2.3.1 Mortalität und Morbidität
2.3.2 Biologische Faktoren als Begründung für die gesundheitliche Ungleichheit von Männern und Frauen
2.4 Prävention und Gesundheitsförderung
2.5 Gesundheits-/Krankheitsverhalten und Inanspruchnahme medizinischer Versorgungs- und Präventionsmaßnahmen
2.5.1 Geschlechtsspezifisches Gesundheitsverständnis
2.5.2 Geschlechtsspezifisches Gesundheitsverhalten
2.5.3 Krankheitsverhalten und Inanspruchnahme medizinischer Versorgungs- und Präventionsmaßnahmen
2.6 Geschlechtsspezifische Unterschiede bei sportlicher Aktivität
3 FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESE
4 METHODIK
4.1 Probanden
4.2 Datenerhebung
4.2.1 Aufbau des Hauptfragebogens
4.2.2 Gütekriterien quantitativer Forschung
4.2.3 Statistische Verfahren zur Auswertung des Fragebogens
4.3 Vorgehensweise
5 UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
5.1 Gesundheitszustand
5.1.1 Anthropometrische Daten
5.1.2 Subjektive Befindlichkeit
5.1.3 Rückenschmerzen
5.1.4 Häufige Krankheitsbilder, Beschwerden oder Symptome
5.1.5 Psychische Gesundheit
5.1.6 Soziale Befindlichkeit
5.2 Gesundheitsverhalten
5.2.1 Bewegungsverhalten
5.2.2 Ernährungsverhalten
5.2.3 Tabakkonsum
5.2.4 Alkoholkonsum
5.2.5 Drogenkonsum
5.2.6 Schlafverhalten und Leistungsfähigkeit
5.2.7 Freizeitverhalten
5.3 Belastungen in Schule und Betrieb
5.3.1 Belastungen im Betrieb
5.3.2 Belastungen in der Schule
6 DISKUSSION
6.1 Gesundheitszustand
6.1.1 Physischer Gesundheitszustand
6.1.2 Psychischer und sozialer Gesundheitsstatus
6.2 Gesundheitsverhalten
6.2.1 Bewegungsverhalten
6.2.2 Ernährungsverhalten
6.2.3 Schlafverhalten und Leistungsfähigkeit
6.2.4 Freizeitverhalten
6.2.5 Tabak-, Alkohol-, und illegaler Drogenkonsum
6.3 Belastungen in Schule und Betrieb
6.3.1 Belastungen in der Schule
6.3.2 Belastungen im Betrieb
6.3.3 Zufriedenheit am Arbeitsplatz
7 BEANTWORTUNG DER EINGANGS FORMULIERTEN
7.1 Hypothese 1:
7.2 Hypothese
7.3 Hypothese
7.4 Hypothese
8 ZUSATZFRAGEBOGEN (WHO-FÜNF)
9 EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ZUKÜNFTIGE GESUNDHEITSFÖ
9.1 Gesundheitsverhalten
9.2 Psychische Gesundheit
9.3 Belastungen im Betrieb
9.4 Tabak-, Alkohol- und Drogenkonsum
9.5 Gesundheitsförderung im Rahmen der beruflichen Ausbildung, am Beispiel des Gesundheitsprojekts „Azubi fit im Kfz-Handwerk“
9.6 Zusammenfassung
10 FAZIT
11 LITERATURVERZEICHNIS
12 ANHANG
I Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
II Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Altersverteilung der Untersuchungsgruppe
Abbildung 2: Gewichtsverteilung nach Schulabschluss in Prozent
Abbildung 3: Arbeitsunfähigkeit allgemein und aufgrund von Rückenschmerzen
Abbildung 4: Prävalenz von Rückenschmerzen innerhalb verschiedener Zeitspannen
Abbildung 5: Spezifische Rückenschmerzen bei jungen Erwachsenen
Abbildung 6: Einschätzung des subjektiven Gesundheitszustandes im zeitlichen Kontext
Abbildung 7: Einschätzung des Gesundheitszustandes unter akuten Rückenschmerzen
Abbildung 8: Schmerzempfinden bei Rückenschmerzen nach Geschlecht
Abbildung 9: Prävalenz und Behandlung häufiger Krankheitsbilder bei jungen Männern
Abbildung 10: Prävalenz und Behandlung häufiger Krankheitsbilder bei jungen Frauen
Abbildung 11: Psychische Gesundheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Abbildung 12: Gefühl der Überlastung bei jungen Frauen und Männern in Prozent
Abbildung 13: Stressempfinden junger Frauen und Männer in Prozent
Abbildung 14: Zufriedenheit mit der Situation im Betrieb
Abbildung 15: Zufriedenheit mit der Situation in der Schule
Abbildung 16: Zufriedenheit mit der Situation im privaten Leben
Abbildung 17: Bewegungsverhalten junger Frauen und Männer in Prozent
Abbildung 18: Sportliche Aktivität junger Frauen und Männer in Prozent
Abbildung 19: Beliebteste Sportarten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Abbildung 20: Obst- und Gemüseverzehr junger Frauen und Männer in Prozent
Abbildung 21: Regelmäßigkeit bei der Einnahme der Hauptmahlzeiten in Prozent
Abbildung 22: Fast-Food-Konsum bei jungen Männern und Frauen in Prozent
Abbildung 23: Rauchverhalten im Kontext von Alter und Geschlecht
Abbildung 24: Absicht junger Erwachsener, ihr Rauchverhalten zu ändern
Abbildung 25: Shishakonsum junger Frauen und Männer in Prozent
Abbildung 26: Alkoholkonsum junger Frauen und Männer in Prozent
Abbildung 27: Vorlieben beim Alkoholkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener
Abbildung 28: Folgen des Alkoholkonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Abbildung 29: Drogenerfahrungen Jugendlicher und junger Erwachsener in Prozent
Abbildung 30: Cannabiskonsum junger Frauen und Männer in Prozent
Abbildung 31: Schlafpensum junger Frauen und Männer in Prozent
Abbildung 32: Wunsch junger Männer und Frauen nach mehr Schlaf
Abbildung 33: Gefühl junger Männer und Frauen ausgeruht und leistungsfähig zu sein
Abbildung 34: Medienkonsum junger Männer und Frauen in Prozent
Abbildung 35: Belastungsempfinden junger Männer und Frauen am Arbeitsplatz
Abbildung 36: Ungünstige Arbeitssituation junger Frauen am Arbeitsplatz
Abbildung 37: Ungünstige Arbeitssituation junger Männer am Arbeitsplatz
Abbildung 38: Zufriedenheit mit dem Betriebsklima in Prozent
Abbildung 39: Zufriedenheit mit dem Vorgesetzten in Prozent
Abbildung 40: Zufriedenheit mit den Kollegen in Prozent
Abbildung 41: Zufriedenheit mit dem Inhalt der Tätigkeit in Prozent
Abbildung 42: Zufriedenheit mit der Arbeitsbelastung in Prozent
Abbildung 43: Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung in Prozent
Abbildung 44: Belastungsempfinden junger Männer und Frauen in der Schule
Abbildung 45: Bewertung des subjektiven Gesundheitszustands im Vergleich
Abbildung 46: WHO-Fünf-Ergebnisdarstellung nach Geschlecht und in Prozent
Abbildung 47: Wohlbefinden in den letzten zwei Wochen
Abbildung 48: Frage eins des WHO (Fünf) - Fragebogens
Abbildung 49: Frage zwei des WHO (Fünf) - Fragebogens
Abbildung 50: Frage drei des WHO (Fünf) - Fragebogens
Abbildung 51: Frage vier des WHO (Fünf) - Fragebogens
Abbildung 52: Frage fünf des WHO (Fünf) - Fragebogens
III Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Signifikanzschranken nach Bühl & Zöfel, 2005
Tabelle 2: Korrelationskoeffizienten nach Diaz-Bone, 2006
Tabelle 3: Anthropometrische Daten der Untersuchungsgruppe
Tabelle 4: Gewichtsklassen nach Geschlecht
Tabelle 5: Altersspezifische Gewichtsverteilung nach Geschlecht
Tabelle 6: Subjektiver Gesundheitszustand der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Tabelle 7: Gegenwärtiger Gesundheitszustand nach Alter und Geschlecht
Tabelle 8: Gesundheitszustand im Kontext von Schmerzstärke und Geschlecht
Tabelle 9: Sportliche Aktivität im Kontext von Alter und Geschlecht
Tabelle 10: Darstellung des Obst- und Gemüseverzehrs bei zunehmendem Alter
Tabelle 11: Alkoholkonsum im Kontext von Alter und Geschlecht
Tabelle 12: Katererlebnis bei jungen Frauen und Männern in Prozent
Tabelle 13: Blackouterlebnis bei jungen Frauen und Männern in Prozent
Tabelle 14: Gesundheitszustand in Zusammenhang mit dem Rauchverhalten
Tabelle 15: Zusammenhang von Gewicht & Schulabschluss in Prozent
Tabelle 16: Zusammenhang von Gewicht & Mittag- bzw. Abendessen in Prozent
Tabelle 17: Zusammenhang von sportlicher Aktivität und Gewicht in Prozent
Tabelle 18: Gesundheitszustand und Gewicht nach Geschlecht
Tabelle 19: Zusammenhang zwischen Rückenschmerzen und der psychische Gesundheit
Tabelle 20: Zusammenhang zwischen Rückenschmerzen und dem Gefühl der Überlastung .
Tabelle 21: Auswirkungen von Schlaf auf Gesundheitszustand und Belastungsempfinden ...
Tabelle 22: Anteil rauchender Männer und Frauen nach Altersgruppen
Tabelle 23: Anteil rauchender Männer und Frauen nach Schulabschluss
Tabelle 24: Zusammenhang von Rauchverhalten und Cannabiskonsum
Tabelle 25: Einflussfaktoren auf die Belastung am Arbeitsplatz
Tabelle 26: Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse zu Hypothese 1
Tabelle 27: Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests zu Hypothese 1
Tabelle 28: Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse zu Hypothese 2
Tabelle 29: Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests zu Hypothese 2
Tabelle 30: Korrelationsanalyse bezüglich Gesundheit und dem Gefühl der Überlastung
Tabelle 31: Logistische Regression bezüglich psychosomatischer Beschwerden (weiblich) . 92
Tabelle 32: Logistische Regression bezüglich psychosomatischer Beschwerden (männlich)
Tabelle 33: Regressionsanalyse zu Hypothese 3
Tabelle 34: Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse zu Hypothese 4
Tabelle 35: Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests zu Hypothese 4
Tabelle 36: Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse zur Auswirkung von Schlaf
Tabelle 37: Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests zur Auswirkung von Schlaf
Tabelle 38: Ungünstige Ergebnisse bei der Beantwortung des WHO-Fünf-Fragebogens
1 Einleitung
In den vergangen Jahren haben Prävention und Gesundheitsförderung einen neuen Aufschwung erlebt.
Im Zentrum dieser Bewegung hat die Geschlechterperspektive eine völlig neue Bedeutung erlangt. Geschlecht soll demnach als zentrale Variable für mehr Zielgruppengenauigkeit in der Gesundheitsförderungs- und Präventionstheorie verankert werden (vgl. Altgeld & Kolip, 2009).
Als Schlüsselkonzept zur Umsetzung dieses Anspruchs dient die Strategie des Gender Mainstreamings. In diesem Sinne gilt es, den geschlechtsspezifischen Präventionsbedarf herauszuarbeiten, geschlechtsspezifische Unterschiede in den angebotenen Maßnahmen zu berücksichtigen sowie geschlechtergerechte Zugänge und Methoden zu wählen. Deutlich wird die Notwendigkeit geschlechtsorientierter Präventionsansätze vor allem daran, dass die durchschnittliche Lebenserwartung eines männlichen Neugeborenen im Vergleich zu einem weiblichen Säugling um etwa 6 Jahre geringer ist. Zusätzlich versterben doppelt so viele Männer wie Frauen vor dem 65. Lebensjahr an Todesursachen, die durch eine deutliche Verhaltenskomponente mitbedingt sind (vgl. RKI, 2006).
Zahlreiche Untersuchungen haben sich in den vergangen Jahren mit dem Thema der Gleich- stellung von Frauen und Männern auseinandergesetzt, jedoch wurden dabei hauptsächlich Geschlechterdifferenzen im mittleren Lebensalter erfasst. Erste aussagekräftige Datengrund- lagen für das Kindes- und Jugendalter wurden mit der HBSC-Studie sowie der deutschland- weiten KIGGS-Studie gelegt. Die vorliegende Arbeit versucht nun, die vorhandene Lücke zwischen dem Jugendalter und dem mittleren Erwachsenenalter zu schließen. Ziel ist es, unter Berücksichtigung des sozialen und biologischen Geschlechts Aussagen über den Gesund- heitszustand sowie das Gesundheitsverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 24 Jahren zu treffen und anschließend Vorschläge für eine geschlechterge- rechte Gesundheitsförderung anzubieten.
2 Theoretische Grundlage
2.1 Das Geschlecht - Definition und Einführung in das Thema
2.1.1 Geschlecht - Definition
Um im Zuge dieser Arbeit geschlechtsspezifische Aspekte der Gesundheitsförderung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorstellen zu können, bedarf es zunächst einer genauen und eindeutigen Definition der Kategorie „Geschlecht“.
Das Wort „Geschlecht" bedeutet ursprünglich nicht mehr als „Art", d.h. es besagt nur, dass es zwei Arten von Geschlechtern gibt - weibliche und männliche. Das lateinische „Sexus" (von secare: schneiden, trennen) hat dieselbe Bedeutung. Es verweist auf die Trennung der Menschheit in zwei Arten oder Gruppen - eine weibliche und eine männliche. Jeder Mensch gehört also entweder der einen oder der anderen Gruppe an, d.h. er ist entweder weiblichen oder männlichen Geschlechts (vgl. Lexikon-Institut, 1986).
2.1.2 Sozialisation und Geschlechtsstereotype
Um im weiteren Verlauf dieser Arbeit verstärkt auf den geschlechtsspezifischen Unterschied bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen bezüglich ihres Gesundheitszustandes, ihres Ge- sundheitsverhaltens sowie den Belastungen in Betrieb und Schule eingehen zu können, bedarf es zunächst einer kurzen Untersuchung „typisch weiblicher“ beziehungsweise „typisch männ- licher“ Verhaltensmuster.
Männliche und weibliche Sozialisation Im heute allgemein vorherrschenden Verständnis wird unter Sozialisation der Prozess der Entstehung und Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit, in wechselseitiger Abhängig- keit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt, verstanden. Gleichzeitig bezeichnet Sozialisation den Prozess, in dessen Verlauf sich der mit einer biolo- gischen Ausstattung versehene menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit bildet. Gesellschaftliche Erwartungen, die mit der jeweiligen Geschlechterrolle eines Mannes bzw. einer Frau verknüpft sind, werden während der Sozialisation erlernt (vgl. Geulen & Hurrelmann, 1982).
Somit werden Kinder in eine bestehende Gesellschaft hineingeboren und sozialisiert, die verschiedene Bewertungen über Männlichkeit und Weiblichkeit beinhaltet. Aufgrund unterschiedlicher Sozialisierungsrahmen geht jeder Mensch auf individuelle Art und Weise auf geschlechtsbezogene Erwartungen ein (vgl. Hurrelmann & Bründel, 1999).
Im Zuge der Industrialisierung zog zusätzlich eine moderne geschlechtstypische Arbeitsteilung in der Gesellschaft ein. Während die Männer tagsüber überwiegend dem Gelderwerb abseits der Familie nachgingen, wurde den Frauen überwiegend ein Platz innerhalb des häuslichen Umfeldes zugeschrieben. Auf diese Weise entstanden stereotype Rollenbilder, welche von Familie, Medien und Schule weitergetragen wurden (vgl. Geulen & Hurrelmann, 1982). Um dieses Phänomen der Rollenaufteilung zu verdeutlichen scheint es sinnvoll, auf männliche und weibliche Geschlechtsstereotype näher einzugehen und somit gleichzeitig die Grundlage für den weiteren Verlauf dieser Arbeit näher zu beschreiben.
Geschlechtsstereotype
„Geschlechtsstereotype sind allgemeine Annahmen über Frauen und Männer. Sie kennzeichnen das in einer Kultur und einer Region für typisch männlich und typisch weiblich gehaltene Verhalten“ (vgl. Hurrelmann & Bründel, 1999).
Dies hat zur Folge, dass gleiches Verhalten unterschiedlich bewertet wird, je nachdem, ob es von einer Frau oder einem Mann gezeigt wird.
Um die Ausbildung der Geschlechtsrolle besser nachvollziehen zu können, erscheint es an dieser Stelle sinnvoll, einen Blick auf die vorindustrielle Gesellschaft zu werfen. In dieser Phase der gesellschaftlichen Entwicklung wurden Mädchen auf die häusliche Arbeit und Kindererziehung vorbereitet, während die Jungen ein Handwerk erlernten oder auf die Landwirtschaft vorbereitet wurden. Infolge dessen entsprechen bis heute Abenteuerlust, Ag- gressivität, und Stärke typisch männlichen Rollenerwartungen. Frauen werden hingegen eher als gefühlvoll und schwach bezeichnet (vgl. Hurrelmann & Bründel, 1999). Bereits mit acht Jahren wissen Jungen, dass sie nicht passiv und schwach sein dürfen, sondern dass sie kämpfen und sich anstrengen müssen, um wahre Männer zu werden. Durch entspre- chende Äußerungen von Eltern, wie z.B. „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“, verinnerlichen Jungen schon in frühester Kindheit, keinen Schmerz zu zeigen, weil es als unmännlich gilt und für die spätere Rolle als Mann nicht förderlich ist. Diese und andere typisierenden Rol- lenmerkmale können dazu beitragen, dass Jungen im erwachsenen Alter Krankheitssymptome ignorieren oder sie sich nicht eingestehen (vgl. Hollstein, 2002).
2.1.3 Gender und Gender-Bias
Das deutsche Wort „Geschlecht“ wird sowohl im sozialen und psychologischen als auch im biologischen Zusammenhang verwendet.
Um zwischen diesen beiden Aspekten des Geschlechts besser unterscheiden zu können, wur- de der Begriff „Sex“ als biologische Bezeichnung und „Gender“ als Bezeichnung der sozialen und psychologischen Aspekte eingeführt. Gender kann weiterführend „als sozialer Ausdruck des biologischen Geschlechts aufgefasst werden, der von den Vorstellungen, von den Aufga- ben, Funktionen und Rollen bestimmt wird, die Frauen und Männer in der Gesellschaft sowie im öffentlichen und privaten Leben zugeschrieben werden“ (Eichler, 2000; zit. nach Jahn, 2002).
Mit dem Begriff „Gender“ bezeichnet sind somit alle geschlechtsbezogenen Unterschiede, die nicht biologisch erklärbar, sondern durch die Lebenswirklichkeiten bedingt bzw. geprägt sind. Aufgrund dieser Differenzierung nach biologischem und sozialem Geschlecht sollte auch für die Gesundheitsförderung klar sein, dass eine rein biologische Betrachtung nicht ausreichend ist. Auch im Rahmen dieser Arbeit werden lebensweltliche Bezüge als Grundlage zur Bewer- tung geschlechtsspezifischer Unterschiede von Jugendlichen und jungen Erwachsenen heran- gezogen.
Der Terminus „Gender-Bias“ beschreibt das Problem, dass durch zu geringe Berücksichti- gung der sozialen und biologischen Unterschiede der Geschlechter die Forschung zu teilweise falschen und nicht aussagekräftigen Ergebnissen kommt. Wichtig wird dieser Aspekt des Gender-Bias immer genau dann, wenn es um die Behandlung von Frauen geht, da in weiten Teilen der Medizin der Mann immer noch Maßstab ist (vgl. Jahn, 2002). Nur durch eine geschlechtsspezifische Betrachtung, sowohl im sozialen, als auch im biologi- schen Sinn wird es möglich, den Bedürfnissen von Frauen und Männern in gleicher Weise gerecht zu werden.
2.1.4 Gender Mainstreaming
„Gender Mainstreaming“ bezeichnet eine neue Strategie zur Herstellung von Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, welche als EU-Richtlinie 1997 verbindlich für alle Mitgliedstaaten im Amsterdamer Vertrag verankert und ebenso von der Bundesregierung 1999 als strukturierendes Leitprinzip anerkannt wurde:
“Gender mainstreaming is the (re)organisation, improvement, development and evaluation of policy processes, so that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all stages, by the actors normally involved in policy-making.” (Council of Europe, 1999)
Somit ist „Gender Mainstreaming“ die (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung grundsatzpolitischer Prozesse, mit dem Ziel, eine geschlechterbezogene Sicht- weise in alle politischen Konzepte auf allen Ebenen und in allen Phasen durch alle normaler- weise an politischen Entscheidungen beteiligten Akteure einzubringen. Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist demnach nicht nur eine Frage der formalen Gleichheit vor dem Gesetz, sondern auch eine auf den Alltag zielende Frage gleicher Lebens- chancen, von der Bildung über den Arbeitsmarkt bis hin zur Gesundheit. „Mainstreaming bedeutet bildlich gefasst: Die Genderbrille aufsetzen bei allem, was man tut, und zu prüfen: Spielt das Geschlecht eine Rolle, und wenn ja, wie kann es angemessen be- rücksichtigt werden?“ (BZgA, 2009).
Ziel dieser Arbeit ist es daher, unter Berücksichtigung des sozialen und biologischen Geschlechts Aussagen über den Gesundheitszustand und das Gesundheitsverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu treffen und davon ausgehend Vorschläge und Ansätze für eine geschlechtergerechte Gesundheitsförderung zu entwickeln.
2.2 Biologische Konstitution von Männern und Frauen
Von Geburt an unterscheiden sich Männer und Frauen bezüglich ihrer Anthropometrie. Jungen sind demnach schon zu Beginn ihres Lebens ca. 1,4% größer und etwa 3,8% schwerer als Mädchen. Im weiteren Verlauf ihres Lebens schließen Mädchen etwa zwei Jahre früher die Pubertät ab, was zu einer ca. 13cm geringere Körperlänge und einem ca. 20-25kg geringeren Körpergewicht gegenüber den Jungen führt. Die kürzere Entwicklungszeit der Mädchen hat zur Folge, dass der weibliche Knochenbau um bis zu einem Viertel leichter ist als der des Mannes (vgl. Marèes, 2003; DSHS-Köln, 2009).
Weitere ausgeprägte geschlechtsspezifische Unterschiede liegen bei der Verteilung von Fett und Muskulatur vor. Demnach verfügt der weibliche Körper über etwa 1,7mal mehr Fettgewebe als der männliche Körper. Bei Männern besteht der Körper zu etwa 40% aus Muskelmasse, Fett macht nur rund 15-18% aus. Bei Frauen hingegen macht das Muskelgewebe etwa 26% und das Fettgewebe etwa 25% aus (Marèes, 2003).
Aufgrund der höheren Konzentration an Testosteron im männlichen Blut kommt es zu einer ausgeprägteren Muskulatur des Mannes. Die absolute Kraft ist demnach messbar höher als die der Frau. Dem gegenüber steht der größere Bewegungsumfang der weiblichen Gelenke, sowie die größere Dehnbarkeit der weiblichen Muskulatur und des Sehnen- und Bandapparates. Hinsichtlich des Stoffwechsels lassen sich zwischen Männern und Frauen nur relativ geringe Unterschiede feststellen. Der Gesamtenergieumsatz von Frauen liegt bei etwa 5% bis 10% unter dem der Männer. Dies wird vorrangig auf den unterschiedlichen Anteil an Muskelgewe- be zwischen Männer und Frauen zurückgeführt und gilt sowohl in Ruhephasen als auch bei gleicher körperlicher Aktivität (vgl. Marèes, 2003; DSHS-Köln, 2009). Unterschiede innerhalb des kardiovaskulären Systems (Herzfrequenz, Herzvolumen, Schlag- volumen, Herzminutenvolumen und Herzgewicht) lassen sich sowohl bei Männern als auch bei Frauen sehr individuell und abhängig vom Ausprägungsgrad der Anpassung an die Trai- ningsbelastungen feststellen. Die Werte bei den Männern sind im Mittel jedoch höher als die der Frauen (vgl. Marèes, 2003).
2.3 Frauen und Männer - Unterschiede in der Gesundheit
2.3.1 Mortalität und Morbidität
Allgemein bekannt ist, dass Männer sowohl in Deutschland als auch in fast allen anderen Staaten der Welt eine höhere Mortalität aufweisen als Frauen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte für das Jahr 2006 als mittlere Lebenserwartung bei Geburten von Frauen 81,6 Jahre, bei Männern dagegen nur 76 Jahre (vgl. RKI, 2006).
Einem weiteren Gesundheitsbericht des RKI ist zu entnehmen, dass sich die geschlechtsspezi- fische Mortalität zusätzlich in verschiedenen Altersabschnitten unterscheidet. Hier gilt es be- sonders hervorzuheben, dass die „höhere Mortalität“ (Übersterblichkeit) von Männern ab dem 17. Lebensjahr steil ansteigt und im Alter von 30 Jahren ihren Gipfel erreicht, wo sie dreimal so hoch ist wie bei Frauen (vgl. RKI, 2005).
Suizid wurde laut Angaben des statistischen Bundesamtes im Jahr 2000 in der Altersklasse bis 25 Jahren deutlich häufiger von Jungen begangen: Durchschnittlich 18,6 Suizidfällen in einer Vergleichsgruppe von 100.000 Jungen stehen nur durchschnittlich 5,6 Suizidfälle in einer gleich großen Mädchengruppe gegenüber (vgl. BMFG, 2005).
Seit 1850 waren bei der durchschnittlich steigenden allgemeinen Lebenserwartung und bei generell höherer Lebenserwartung der Frau teils größere, teils kleinere Differenzen zwischen den Geschlechtern festzustellen. Die wechselnde Größe der Differenzspanne hat vielerlei Ur- sachen, welche jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht ausführlicher vertieft werden sollen. Im selben Zeitraum konnte eine Verlagerung der Todesursachen festgestellt werden. Zählten um 1850 noch Infektionskrankheiten zu den Haupttodesursachen, wovon vorrangig jüngere Frau- en betroffen waren, dominieren heute Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die unterschiedliche Anfälligkeit für diese Haupttodesursache ist ein wesentlicher Grund für die starken Mortalitätsdifferenzen zwischen Männern und Frauen (vgl. Dinges, 2007).
Insgesamt sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen in allen Altersgruppen mehr Männer.
Die zweithäufigste Todesursache in Deutschland nach den kardiovaskulären Erkrankungen stellen Krebserkrankungen dar. Hierbei zeigt sich, dass bei Männern vorrangig Lungenkrebs, bei Frauen vorrangig Brustkrebs zum Tode führt. Männer sind dreimal häufiger von Lungen- krebs betroffen als Frauen. Der Hauptrisikofaktor scheint hierbei das Rauchen zu sein. Wäh- rend jedoch die Inzidenz bei Männern innerhalb der letzten zwanzig Jahre sinkt, ist zu be- obachten, dass diese aufgrund veränderten Rauchverhaltens bei Frauen langsam steigt (vgl. RKI, 2006).
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werde ich auf geschlechtsspezifische Gesundheitsrisiken und Erkrankungen sowie auf geschlechtsspezifisches Gesundheitsverhalten in Bezug auf Jugendliche und junge Erwachsene näher eingehen.
2.3.2 Biologische Faktoren als Begründung für die gesundheitliche Ungleichheit von Männern und Frauen
Grundsätzlich ergeben sich Unterschiede, wenn Krankheiten an einem biologischen Geschlechtsmerkmal auftreten. Aus naturwissenschaftlicher Sicht lassen sich jedoch weitere Erklärungen für die unterschiedliche Morbidität und Mortalität von Frauen und Männern darstellen. Es gibt so genannte X-chromosomale Erbkrankheiten, welche auf dem X-Chromosom angelegt sind. Das kürzere Y-Chromosom macht Männer anfälliger für die auf dem X- Chromosom vererbten Krankheiten. Zusätzlich wird vermutet, dass auf dem X-Chromosom befindliche Genabschnitte die Produktion des Immunglobulin IgM steuern und Männer daher ein anfälligeres Immunsystem haben (vgl. Kolip & Stein-Hilbers, 2000).
Im vorherigen Kapitel wurden Herz-Kreislauf-Erkrankungen anhand eines Berichts des RKI (2006) als die häufigste Todesursache skizziert. Derzeit wird in der Literatur darüber disku- tiert, ob die weiblichen Östrogene einen Schutz vor Herz-Kreislauferkrankungen darstellen, wobei dieser Zusammenhang bisher noch nicht empirisch bestätigt werden konnte (vgl. Kolip & Stein-Hilbers, 2000).
Betrachtet man jedoch die Ausführungen des Gender Datenreports (2005), so zeigt sich, dass Frauen in Deutschland eine deutlich höhere gesunde Lebenserwartung haben als Männer. Im Jahre 1996 erwarteten Frauen in Deutschland 69 gesunde Lebensjahre, Männer hingegen nur 63. In Dänemark (62 Jahre) und den Niederlanden (63 Jahre) erwarten Frauen und Männer dagegen jeweils die gleiche Zahl gesunder Lebensjahre (vgl. Stürzer & Cornelißen, 2005).
Anhand dieser Beispiele zeigt sich, dass neben biologischen Faktoren verstärkt lebensweltliche Einflüsse für geschlechtsspezifische Mortalitäts- und Morbiditätsdifferenzen herangezogen werden müssen.
2.4 Prävention und Gesundheitsförderung
Im Folgenden soll unterschieden werden zwischen Prävention und Gesundheitsförderung. Präventionsmaßnahmen zielen auf die Vermeidung bzw. Verminderung von risikobehafteten Faktoren ab. Hierzu zählen Einflüsse wie Bewegungsmangel, Fehlernährung, Tabak- und Al- koholkonsum oder Bluthochdruck. Präventiven Maßnahmen ist es zum Ziel gesetzt, diese Faktoren auszuschalten oder zumindest zu reduzieren. Hier muss jedoch eine weitere Unter- scheidung getroffen werden, wie sie 1967 nach Caplan und Grunebaum eingeführt wurde. Je nachdem zu welchem Zeitpunkt und in welcher Art eine Intervention stattfindet, lässt sich zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention unterscheiden (vgl. Caplan & Grune- baum, 1967; zit. nach Hurrelmann, 2006):
„Primäre Prävention“ setzt sich zum Ziel, bereits vor Entstehung einer Erkrankung alle möglichen und bekannten Risikofaktoren auszuschalten. Somit wird versucht, der Erkrankung vorzubeugen oder zumindest eine starke Ausweitung zu verhindern. Prävention kann in diesem Fall generalisiert sein und somit die gesamte Bevölkerung ansprechen (z.B. Aufklärung über Fehlernährung) oder sich spezifisch an bestimmte Risikogruppen wenden (z.B. Bluthochdruckpatienten) (vgl. Hurrelmann, 2006).
„Sekundäre Prävention“ versucht gezielt, existierende Risiken in einem frühen Stadium der Krankheit zu meiden bzw. zu eliminieren. Zur Erkennung von frühen Krankheitsstadien eignen sich hier besonders Screening-Verfahren, um schnellstmöglich Therapiemaßnahmen ergreifen zu können, damit eine weitere Ausbreitung der Erkrankung verhindert werden kann. Die wichtigste Devise der sekundären Prävention ist die Früherkennung von Krankheiten und die darauf folgende Eindämmung (vgl. Hurrelmann 2006).
Sobald akute Symptome vorhanden sind, spricht man von „Tertiärprävention“ oder Rehabilitation. Das Ziel liegt hier darin, weitere Verschlimmerung zu verhindern, bzw. die Wiederherstellung verlorener Funktionen zu fördern (vgl. Hurrelmann, 2006).
Eine Einteilung erfolgt also unter dem Gesichtspunkt, wann Präventionsmaßnahmen ergriffen werden - vor, während oder nachdem eine Krankheit eingetreten ist.
Anders als mit der Prävention verhält es sich mit der Gesundheitsförderung, welche sowohl präventive Maßnahmen als auch Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit umfasst. Hierbei ist zu bedenken, dass sich der Mensch nie in einem Zustand vollkommener Gesund- heit befindet und daher die Gesundheitsförderung versucht, möglichst gute Rahmenbedingun- gen für ein Leben mit größtmöglicher Gesundheit zu schaffen. Bei der Gesundheitsförderung steht nach Hurrelmann die Stärkung von Schutzfaktoren im Zentrum (vgl. Hurrelmann, 2006).
In der Ottawa-Charta hat die WHO hierzu eine Agenda verfasst mit genauen Vorschlägen zur Umsetzung der Gesundheitsförderung. Die WHO definiert Gesundheitsförderung folgendermaßen (WHO, 1986):
„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.“
Die Charta verfolgt das Ziel, dass die Gesundheitsförderung nicht nur im medizinischen Kon- text, sondern auf alle Lebensbereiche ausgeweitet erfolgt, also präsent ist in allen sozialen Systemen (z.B. am Arbeitsplatz, in der Schule, in Jugendclubs, etc.), genannt Settings. In die- sen Systemen sollen Möglichkeiten der Gesundheitsförderung erkannt und dann für das Indi- viduum passende Strategien entwickelt werden, ein gesünderes Leben zu führen (vgl. Altgeld, 2009).
Einen Schwerpunkt möchte ich hier auf die betriebliche Gesundheitsförderung legen, da der Betrieb ein besonders wichtiges Setting darstellt. Dies ist darin begründet, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Großteil ihrer Zeit am Arbeitsplatz verbringen und das Umfeld und die Bedingungen dort großen Einfluss auf Wohlbefinden, Gesundheit und Motivation nehmen (vgl. Wenninger, Gröben, & Bös, 2007).
Hier greift neben dem individuellen Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an gesundheitsfördernden Bedingungen daher auch das Interesse der Betriebe, da gesunde Mitar- beiter produktiver und motivierter sind, wodurch effizienteres Arbeiten ermöglicht wird. Ein weiterer positiver Umstand liegt darin begründet, dass mit Hilfe innerbetrieblicher Ge- sundheitsförderprogramme eine Gruppe von Menschen durch diese Maßnahmen erreicht wer- den kann, die sonst seltener an gesundheitsfördernden Schritten teilnimmt; hier sind v.a. junge „gesunde“, erwerbstätige Männer zu erwähnen (vgl. Wenninger et al., 2007).
2.5 Gesundheits-/Krankheitsverhalten und Inanspruchnahme medizinischer Versorgungs- und Präventionsmaßnahmen
Frauen und Männer leiden unterschiedlich häufig und auf unterschiedliche Art und Weise an Krankheiten und Gesundheitsstörungen. Ihr Versorgungsbedarf unterscheidet sich ebenso wie ihre Inanspruchnahme von Präventionsmaßnahmen. Zusätzlich wird ihr Gesundheitszustand und ihr Gesundheitsverhalten von geschlechtsspezifischen Arbeits- und Lebensbedingungen beeinflusst. Dies soll nun näher erläutert werden
2.5.1 Geschlechtsspezifisches Gesundheitsverständnis
Um im weiteren Verlauf dieser Arbeit Angaben zu Gesundheitszustand und Befindlichkeitsstörungen von Frauen und Männern besser einschätzen zu können, werde ich zunächst erörtern, was jeder der beiden Gruppen unter dem Begriff „Gesundheit“ versteht. Auch soll durch die Analyse eines unterschiedlichen Gesundheitsverständnisses von Männern und Frauen eine Erklärung für mögliche Unterschiede bei der Inanspruchnahme von medizinischen Versorgungs- und Präventionsmaßnahmen aufgezeigt werden.
Die Bedeutung von Gesundheit findet in Redewendungen wie „Mir geht es gut“ oder „Ich bin gesund“ häufig Verwendung. Aus diesem Grunde erscheint es als sinnvoll, zunächst einige Definitionsversuche über den Begriff „Gesundheit“ anzuführen. Die bekannteste Definition von Gesundheit stammt von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 1963 (vgl. BMFG, 2005):
„Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen“
Eine weitere Definition stammt von Hurrelmann. Er hat aus verschiedenen Definitionen und Theorien, welche den Begriff Gesundheit erklären, vier Leitvorstellungen herausgearbeitet (vgl. Hurrelmann & Franzkowiak, 2004):
Die Leitvorstellung von…
… Gesundheit als gelungener und Krankheit als nicht gelungener Bewältigung von inne- ren und äußeren Anforderungen.
… Gesundheit als Gleichgewicht und Krankheit als Ungleichgewicht von Risiko- und Schutzfaktoren auf der körperlichen, psychischen und sozialen Ebene.
… „relativer“ Gesundheit und „relativer“ Krankheit nach objektiven und subjektiven Kri- terien.
… Gesundheit und Krankheit als Reaktion auf gesellschaftliche Gegebenheiten.
Gesundheit wird meistens als selbstverständlich vorausgesetzt und rückt häufig erst beim Auf- treten von Krankheiten, d.h. wenn Beschwerden und Schmerzen auftreten, in den Blickwin- kel. Dennoch sollte nicht übersehen werden, dass männliche Jugendliche wie auch erwachse- ne Männer ein eigenes Gesundheitsverständnis haben, das in erster Linie zum traditionellen Bild von Männlichkeit passt. Ihr Gesundheitsverständnis basiert auf: „Ich bin gesund, wenn ich voll da bin“ oder „Ich bin gesund, wenn ich keine Schmerzen habe“. Gesund zu sein ist für sie etwas Selbstverständliches und wird verkürzt auf die Formel „fit, fun, lifestyle“ ge- bracht (vgl. Weikert, 2005)
Auch dem Ergebnis einer Teilnehmerwirkungsanalyse der deutschen Herz-Kreislauf- Präventionsstudie ist zu entnehmen, dass Männer und Frauen ein unterschiedliches Verständnis von Gesundheit aufweisen. Die Analyse macht deutlich, dass Männer Gesundheit viel häufiger in Verbindung mit Krankheit und Meiden von Risiken für eben diese sehen. Für Frauen sind hingegen „glücklich sein“ und „Zufriedenheit“ grundlegende Voraussetzungen für Gesundheit (vgl. Maschewsky-Schneider, Klesse, & Sonntag, 1991).
Brandes beschreibt als zentralen Unterschied zwischen der männliche und weiblichen Bevöl- kerung, „dass Frauen dazu neigen, eine Innenperspektive auf ihren Körper einzunehmen und Männer eine Außenperspektive. Solange der Körper aus dieser Außensicht funktioniert, ver- schwenden Männer keinen Gedanken an das, was in ihm vorgeht“ (Brandes, 2003; zit. nach Altgeld, 2009).
Unterschiede im Gesundheitsverständnis lassen sich auch in der Verteilung der Todesursachen bei Frauen und Männern ablesen. Männer sterben demnach beispielsweise häufiger an Herz-Kreislauf-Krankheiten, weil sie weniger Präventionsangebote wahrnehmen und sich weniger aktiv mit Fragen einer gesunden Lebensführung auseinander setzen (vgl. RKI, 2006). Im nächsten Kapitel soll nun das auf dem Gesundheitsverständnis begründete Krankheitsverhalten von Männern und Frauen umfassend behandelt werden.
2.5.2 Geschlechtsspezifisches Gesundheitsverhalten
Unter Gesundheitsverhalten bezeichnet man „alle Reaktionen und Verhaltensweisen, die einen Zusammenhang mit Gesundheit bzw. Krankheit aufweisen. Gesundheitsverhalten steht danach als übergeordneter Begriff für alle Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung des gegenwärtigen Gesundheitszustandes“ (Bengel, 1992).
Durch vielerlei Faktoren kann das Gesundheitsverhalten eines Menschen sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden. Beispielsweise ist das Gesundheitsverhalten einer Person davon abhängig, als wie bedrohlich eine Krankheit subjektiv wahrgenommen wird oder ob therapeutische Maßnahmen mit größerem finanziellen Aufwand verbunden sind. Jeder Mensch nimmt die Gefährdung durch eine Krankheit auf unterschiedliche Art und Weise wahr. Je größer diese jedoch empfunden wird, desto eher wird ein Mensch Vorsorgemaßnahmen in Anspruch nehmen (vgl. Bengel, 1992).
Begründet auf dem unterschiedlichen Gesundheitsverständnis von Frauen und Männern kann ein geschlechtsspezifisches Gesundheitsverhalten abgeleitet werden.
Frauen sind laut Kuhlmann und Kolip sensibler in der Wahrnehmung ihres Körpers. Sie ha- ben ein Gefühl dafür, ihn gesund zu halten und sich um ihn zu kümmern. Zudem stellen beide fest, dass Frauen mehr über Gesundheit und Krankheit wissen als die männliche Bevölkerung. Die in Kapitel 2.3.1 bereits erwähnte höhere Lebenserwartung der Frauen lässt sich unter an- derem auf das nachlässige Gesundheitsverhalten der Männer zurückführen (vgl. Kuhlmann & Kolip, 2005).
2.5.3 Krankheitsverhalten und Inanspruchnahme medizinischer Versorgungs- und Präventionsmaßnahmen
Jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, wird im Laufe seines Lebens erkranken. Es stellt sich jedoch die Frage, warum Männer in Deutschland im Vergleich zu Frauen eine um 6,5 Jahre niedrigere Lebenserwartung haben. Neben dem geschlechtsspezifischen Verständnis von Gesundheit lassen sich auch Unterschiede bei der Inanspruchnahme medizinischer und gesundheitlicher Angebote als mögliche Gründe ausmachen.
Selbst wenn man Arztbesuche der weiblichen Bevölkerung aufgrund von Verhütung, Schwangerschaft und Geburt nicht berücksichtigt, nehmen Männer deutlich seltener ärztliche Dienstleistungen in Anspruch als Frauen (vgl. Sieverding, 2000).
Einem Auszug des Arzneiverordnungsreport 2009 ist beispielsweise zu entnehmen, dass im Jahre 2008 etwa 73% aller Arztbesucher Frauen waren (vgl. Schwabe & Paffrath, 2009). Der benannte Unterschied bei der Inanspruchnahme von ärztlichen Versorgungsleistungen ist jedoch vor allem bei leichten Erkrankungen oder bei Unklarheit, ob eine Krankheit vorliegt, festzustellen. Nach einer begonnenen Versorgungsleistung lassen sich keine signifikanten Unterscheide bezüglich der Behandlungshäufigkeit feststellen (vgl. Sieverding, 2000). Gründe hierfür könnten, wie bereits oben angedeutet, in einer optimistischeren Sichtweise von Gesundheit bei Männern liegen.
Parallel zur geringeren Wahrnehmung von Versorgungsleistungen im Krankheitsfall nehmen Männer auch deutlich seltener Präventionsmaßnahmen in Anspruch. Einem Bericht des Ro- bert-Koch-Instituts ist zu entnehmen, dass Männer seltener als Frauen an Präventionsmaß- nahmen teilnehmen. Demnach gaben unter anderem in den Bereichen Ernährung, Gewichts- reduktion, Stressbewältigung und Rücken- oder Wirbelsäulengymnastik signifikant mehr Frauen an, schon einmal ein Kurs belegt zu haben. Dem Bericht des Robert-Koch-Instituts ist weiter zu entnehmen, dass diese Tendenz nicht allein auf das höhere Gesundheitsbewusstsein der Frauen, sondern auch auf nur sehr bedingt ansprechende Kursangebote für Männer zu- rückzuführen ist (vgl. RKI, 2005).
Lieselotte Hinze und Andrea Samland stellen aufgrund einer geschlechtsspezifischen Analyse zur Inanspruchnahme von Präventions- und Gesundheitsförderkursen die Vermutung auf, dass Männer Sport- und Freizeitangebote in der Regel Kursen zur Förderung der Gesundheit vorziehen (vgl. Hinze & Samland, 2004).
Im Folgenden sollen daher Unterschiede bei der Ausübung sportlicher Aktivitäten zwischen Männern und Frauen aufgezeigt werden.
2.6 Geschlechtsspezifische Unterschiede bei sportlicher Aktivität
Bewegungsmangel ist ein zentraler Risikofaktor für zahlreiche Erkrankungen, wie Herzin- farkt, Schlaganfall und Übergewicht. Körperliche Aktivität kann solchen Risiken vorbeugen und somit einen positiven Einfluss auf die Gesundheit haben. Trotz dieser weit verbreiteten Erkenntnis ist ein großer Teil der Bevölkerung weiterhin eher sportlich inaktiv. Studien der Universität Leipzig zeigen, dass sich Frauen im Alltag mehr bewegen als Männer, was zum Teil auf die zahlreichen häuslichen Verpflichtungen der Frauen zurückzuführen ist. Umge- kehrt treiben Männer jedoch deutlich häufiger Sport als Frauen (vgl. Pfeffer & Alfermann, 2009).
Weitere geschlechtsspezifische Unterschiede lassen sich feststellen, wenn man die Wahl der jeweiligen Sportarten betrachtet. Hierbei zeigt sich, dass junge Männer vorrangig risikoträch- tige und wettkampforientierte Sportarten bevorzugen, während Frauen hingegen Individual- sportarten und ästhetische Sportarten wie Gymnastik vorziehen (vgl. Pfeffer & Alfermann, 2009).
Die weit verbreitete Vereinsmüdigkeit von Frauen lässt sich oftmals auf das Angebot der Ver- eine zurückführen, denn je kleiner ein Verein ist, desto häufiger hat er männlich orientierte Angebote, wie „Fußball“. Frauen zieht es dagegen häufiger in Fitness-Studios, weil diese ihre Angebotspalette eher auf Frauen ausrichten. Laut Pfeffer und Alfermann existieren zwei Hauptursachen für die geschlechtsspezifischen Ausrichtungen beim Sporttreiben (vgl. Pfeffer & Alfermann, 2009):
- Biologische Ursachen
Einen Grund für die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Präferenz einzelner Sportarten stellen möglicherweise die unterschiedlichen biologischen Voraussetzun- gen dar. Wie bereits erläutert sind Männer im Durchschnitt größer und schwerer, ha- ben mehr Muskelmasse und weniger Körperfett als Frauen. Daraus folgt, dass Männer im Vergleich größere Kraft und Schnelligkeit entwickeln können. Diese unterschiedli- chen körperlichen Voraussetzungen könnten ein Grund dafür sein, warum Männer vor- rangig Sportarten mit Leistungs- und Wettkampfcharakter bevorzugen. Soziologische Geschlechterrolle Ein weiterer Grund, warum Männer vorrangig wettkampf-, leistungs- oder risikoorientierte Sportarten favorisieren, könnte darin bestehen, dass sie dort verstärkt ihre Männlichkeit demonstrieren können. Frauen verhalten sich hingegen gesundheitsbewusster und wenden sich vermehrt präventiven Angeboten zu.
3 Fragestellung und Hypothese
Ziel dieser Arbeit ist es, Aufschluss über den Gesundheitszustand und das Gesundheitsverhalten von männlichen und weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 24 Jahren zu erhalten. Über dies hinaus soll eine datengebundene Grundlage geschaffen werden, die es erlaubt, Empfehlungen für eben diese Personengruppe zu formulieren. Um eine Basis zur Auswertung des vorhandenen Datenmaterials zu schaffen, wurden die im Folgenden aufgeführten Hypothesen formuliert:
Hypothese 1:
Die männlichen und weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterscheiden sich in ihrem Gesundheitsverhalten. Die jungen Frauen verfolgen einen gesünderen Lebensstil.
Hypothese 2:
Die weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben einen besseren Gesundheitszu- stand.
Hypothese 3:
Männliche Jugendliche und junge Erwachsene sind häufiger ungünstigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt als junge Frauen.
Hypothese 4:
Sportliche Aktivität steht in engem Zusammenhang mit dem allgemeinen Gesundheitszustand der Jugendlichen und jungen Erwachsenen und bietet somit die optimale Voraussetzung für eine umfängliche Gesundheitsförderung.
Kapitel 4 Methodik
4 Methodik
4.1 Probanden
Im Zuge dieser empirischen Arbeit wurden insgesamt 3827 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 24 Jahren hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes, ihres Gesundheitsverhaltens und ihren Belastungen in Schule und Betrieb befragt. 2000 (52,3%) der befragten Probanden sind männlich und 1827 (47,4%) sind weiblich. Abb. 1 zeigt die Altersverteilung der befragten Probanden. Die Altersgruppe von 17 bis 21 Jahren ist hierbei am Häufigsten vertreten. Das durchschnittliche Alter der Probanden liegt bei Berechnung des Mittelwerts bei 18,75 Jahren und bei Berechnung des Median bei 18 Jahren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Altersverteilung der Untersuchungsgruppe
4.2 Datenerhebung
Mit Hilfe eines Fragebogens, welcher sich aus einem Haupt- und einem Zusatzfragebogen zusammensetzt, wurde die Basis für diese Untersuchung geschaffen (s. Anhang). Die schriftliche Befragung mit Fragebogen ist die klassische Methode der quantitativen Be- fragung. Hierbei ist die voll standardisierte geschlossene Frage, bei der der Befragte aus einer Zahl von Antwortmöglichkeiten auswählt, die übliche Frageform. Zusätzlich finden sich auch einige offene Fragestellungen, die aber in dieser Untersuchung die weitaus kleinere Fraktion stellen. Die schriftliche Befragung eignet sich mit ihrer standardisierten Befragungsform vor allem bei Untersuchungen großer Stichproben und bietet zugleich die Möglichkeit einer direk- ten Vergleichbarkeit der befragten Personen bzw. Personengruppen. Zusätzlich wird ein Interviewereffekt, wie er bei mündlichen Befragungen eine Rolle spielt, mit Hilfe dieses Messverfahrens ausgeschaltet (vgl. Homburg & Krohmer, 2006).
4.2.1 Aufbau des Hauptfragebogens
Ein Fragebogen sollte als ein Gesamtkonzept betrachtet werden, in dem die Reihenfolge und die Struktur der Fragen wichtige Einflussfaktoren zur Erlangung korrekter Daten sind (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010).
In diesem Sinne beinhalten Kopf- bzw. Fußzeilen Informationen darüber, wer die Befragung durchführt, sowie die Anschrift, Telefonnummer und E-mailadresse des Befragers. Die Überschrift des Fragebogens „Gesundheitszustand, Gesundheitsverhalten und Belastungen bei Auszubildenden“ soll den Befragten Aufschluss über den Zweck der Untersuchung geben. Ziel ist es, auf diese Weise den Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmern die wissenschaftliche Relevanz des Fragebogens vor Augen zu führen, da so die Akzeptanz signifikant positiv beeinflusst wird (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010).
Insgesamt besteht der Fragebogen aus 48 Items, welche zum überwiegenden Teil durch An- kreuzen vorgegebener Möglichkeiten beantwortet werden. Bei einigen wenigen Fragestellun- gen ist es möglich, die Antwort durch freie Vervollständigungen genauer zu beschreiben. Um dem Fragebogen eine Struktur zu verleihen, ist der Hauptteil in vier zusammenhängende Abschnitte untergliedert. Im ersten Abschnitt werden unter anderem zunächst Alter, Ge- schlecht sowie die anthropometrischen Daten Größe und Gewicht der Probanden ermittelt. Der zweite Abschnitt beinhaltet 12 Items, welche den derzeitigen Gesundheitszustand sowohl allgemein, als auch in Bezug auf Rückenschmerzen und sonstige Erkrankungen erfragen. Zu- sätzlich werden hier Fragen über die Zufriedenheit im Betrieb, in der Schule und im privaten Leben gestellt. Der dritte Teil besteht aus 22 Items, welche das Gesundheitsverhalten der Pro- banden erfragen. In diesem Teil des Fragebogens geht es um eine Einschätzung zum Bewe- gungs-, Ernährungs-, Freizeit- und Schlafverhalten, sowie um die Erfahrungen von Überlas- tung und den Konsum von Genussmitteln und Drogen. Der vierte und letzte Teil beinhaltet sechs Items, welche sich konkret mit belastenden Situationen in der Schule und im Betrieb befassen.
4.2.2 Gütekriterien quantitativer Forschung
Bei dieser Arbeit, die valide, reliable und objektive Ergebnisse liefern soll, war es im Vorfeld wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass die Qualität der Untersuchung so hoch ist, dass die Un- tersuchungsergebnisse keine Fehlschlüsse oder Fehlinterpretationen zulassen. Es wurde daher versucht, die entscheidenden Gütekriterien Valididät, Reliabilität, und Objektivität möglichst weitestgehend zu realisieren.
Die Validität beschreibt die Richtigkeit eines Messverfahrens. Sie ist definiert als die Fähigkeit eines Instrumentes, das zu messen, was gemessen werden soll (vgl. Homburg & Krohmer, 2006; Raab-Steiner & Benesch, 2010).
Gerade bei schriftlichen Datenerhebungen in Form von Fragebögen, wie sie auch Grundlage dieser Arbeit ist, sollte daher grundsätzlich auf kurze und präzise Fragestellungen geachtet werden. Der zusätzliche Einsatz von Kontrollfragen war aufgrund des insgesamt recht großen Themenspektrums allerdings nicht möglich. Eine ergänzende Prüfung der Umfrageergebnisse auf ihre Validität wäre daher wünschenswert.
Die Reliabilität ist die Zuverlässigkeit einer Messung, d.h. die Angabe, ob ein Messergebnis bei einer erneuten Befragung unter den gleichen Umständen stabil ist. Die Überprüfung dieses Parameters wurde mit Hilfe einer Kontrolleingabe durchgeführt (vgl. Homburg & Krohmer, 2006).
Die Objektivität von Fragen oder Messverfahren ist gegeben, wenn die Antworten bzw. Messwerte unabhängig vom Interviewer bzw. Prüfer sind (vgl. Homburg & Krohmer, 2006). Durch die mittels Fragebögen durchgeführte Datenerfassung ist in der hier vorliegenden Studie eine hohe Objektivität sichergestellt.
4.2.3 Statistische Verfahren zur Auswertung des Fragebogens
Um erste Angaben und Schwerpunkte innerhalb der befragten Untersuchungsgruppe zu erhalten, wurden die vorhanden Datensätze zunächst mit Hilfe einfacher statistischer Verfahren, wie Häufigkeits-, Mittelwertberechnungen, Standardabweichungen und Kreuztabellen, ausgewertet. Zur Unterstützung der Ergebnisse wurden graphische Darstellungen hinzugezogen. Um im Weiteren, basierend auf diesen Voruntersuchungen, Aussagen über mögliche Verknüpfungen bzw. über die Stärke möglicher Zusammenhänge treffen zu können, war es notwendig, weitere statistische Verfahren hinzuzuziehen.
Allgemein basiert diese statistische Auswertung auf der Statistiksoftware PASW Statistics 18 für Windows/Mac und Microsoft Exel: Mac 2008.
Mittelwertvergleiche und Chi-Quadrat-Test
Mit Hilfe von Mittelwertvergleichen soll überprüft werden, ob auftretende Mittelwertunter- schiede aufgrund zufälliger oder überzufälliger Schwankungen zu erklären sind (vgl. Bühl & Zöfel, 2005).
Als überzufällig wird in der Statistik ein Zusammenhang beschrieben, dessen nachgewiesene Signifikanz hoch genug ist, um nicht mehr als Zufall zu gelten, aber dennoch nicht so eindeutig scheint wie eine direkte Kausalität (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010). Überzufälligkeiten können mit Hilfe statistischer Testverfahren wie z.B. dem Chi-Quadrat- Test ermittelt werden. Kann eine solche Überzufälligkeit festgestellt werden, so spricht man von einem signifikanten Unterschied.
Tab. 1 zeigt eine international anerkannte Einteilung zur Bewertung statistischer Signifikanz. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die Signifikanzen, innerhalb der Tabellen und Abbildungen, in Form von Sternchen gekennzeichnet.
Tabelle 1: Signifikanzschranken nach Bühl & Zöfel, 2005
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Korrelationskoeffizient
Die Korrelationsanalyse ermittelt das Maß für den Grad eines statistischen, linearen Zusam- menhangs zwischen zwei Variablen. Die Stärke des Zusammenhangs wird mit r (Korrelati- onskoeffizient) gekennzeichnet. Der Wertebereich des Korrelationskoeffizienten liegt zwi- schen -1 und +1, wobei r = 0 darauf hinweist, dass kein linearer Zusammenhang zwischen den beiden Variablen existiert. r = -1 weist hierbei auf einen perfekten negativen und r = +1 auf einen perfekten positiven linearen Zusammenhang hin. Im internationalen Gebrauch wird der Betrag des Korrelationskoeffizienten als Maß für die Stärke des Zusammenhangs verwendet (vgl. Diaz-Bone, 2006).
Es existieren mehrere Korrelationskoeffizienten, deren Definition von dem Skalen- bzw. Messniveau der gemessenen Variablen abhängt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Schätzung der Korrelation mit dem Korrelationskoeffizient nach Pearson setzt voraus, dass beide Variablen intervallskaliert und normalverteilt sind. Der Korrelationskoeffizient nach Spearman wird hingegen vorrangig bei ordinal skalierten oder nicht-normalverteilten Variablen angewendet (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010).
Tabelle 2: Korrelationskoeffizienten nach Diaz-Bone, 2006
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Regressionsanalyse
Die Regressionsanalyse ist eines der am häufigsten angewendeten statistischen Analysever- fahren. Sie gibt einen Zusammenhang zwischen zwei oder mehreren Variablen an. Bei der Regressionsanalyse wird vorausgesetzt, dass ein gerichteter Zusammenhang existiert. Dies bedeutet, dass es eine abhängige Variable und mindestens eine unabhängige Variable gibt. Mit der Regressionsanalyse wird somit untersucht, ob die verschiedenen unabhängigen Vari- ablen einen Einfluss auf die abhängige Variable haben und wie stark dieser Einfluss ist. Entsprechend der Skalierung und der Annahme eines linearen Zusammenhangs muss zwi- schen der linearen und der logistischen Regression gewählt werden (vgl. Raab-Steiner & Be- nesch, 2010).
4.3 Vorgehensweise
Zunächst werden in Kapitel 5 die Ergebnisse, geordnet nach den drei Themenbereichen Ge- sundheitszustand, Gesundheitsverhalten und Belastungen in Schule und Betrieb vorgestellt. Hierbei geht es darum, die einzelnen Fragen nach ihrer Häufigkeit darzustellen und erste Un- terschiede zwischen männlichen und weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf- zuzeigen.
In Kapitel 6 werden anschließend die hier gewonnen Ergebnisse mit den in der Literatur ver- ankerten Daten verglichen und diskutiert. Die wichtigste Vergleichsliteratur stellen hierbei die KIGGS- sowie die HBSC-Studie (Health Behaviour in School-aged Children) und ein Ge- sundheitsbericht des Robert Koch-Instituts zum Thema „Gesundheit in Deutschland“ dar.
Im Weiteren werden basierend auf den in Kapitel 5 und 6 gewonnen Erkenntnissen die in Kapitel 3 formulierten Hypothesen überprüft.
Zum Schluss werden die gewonnen Erkenntnisse dazu genutzt, Vorschläge für eine geschlechtergerechte Gesundheitsförderung zu entwickeln.
5 Untersuchungsergebnisse
5.1 Gesundheitszustand
Hinweise auf den Gesundheitszustand der befragten Probanden liefern unter anderem die Fragen „Wie würden Sie ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben?“, „Hatten bzw. haben Sie Rückenschmerzen und waren Sie deshalb in Behandlung?“, „Haben Sie sich in den letzten Monaten müde, lustlos, ausgebrannt oder depressiv gefühlt?“ und „Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Situation im Betrieb, in der Schule und im privaten Leben?“.
5.1.1 Anthropometrische Daten
Bei den in dieser Untersuchung erhobenen anthropometrischen Daten handelt es sich um Alter, Größe, Gewicht und dem Body-Mass-Index (BMI). Eine strukturierte Übersicht nach Geschlecht bietet Tabelle 3.
Tabelle 3: Anthropometrische Daten der Untersuchungsgruppe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der BMI ist ein häufig verwendeter Indikator dafür, ob eine Person unter-, normal- oder übergewichtig ist. Definiert ist er als Verhältnis von Körpergewicht in Kilogramm zum Quadrat der Körpergröße in Metern (vgl. Marèes, 2003):
Es zeigt sich, dass die männlichen Probanden im Durchschnitt 1,80m groß und 77,83kg schwer sind. Die weiblichen Befragten sind im Durchschnitt 1,68m groß und wiegen durchschnittlich 58,84kg.
Bezüglich des Gewichts ist ein höchst signifikanter Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen festzustellen (s. Tab. 4). Während der An- teil präadipöser Frauen 12,1% beträgt, liegt der Anteil präadipöser Männer mit 24,3% mehr als doppelt so hoch. Weiter ist festzustellen, dass der Anteil adipöser Männer um 40% höher ist als der Anteil adipöser Frauen. Im Gegenzug liegt der Anteil untergewichtiger Frauen um etwa ein Drittel höher als bei den Männern
Tabelle 4: Gewichtsklassen nach Geschlecht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ebenfalls kann sowohl für die männlichen als auch für die weiblichen Befragten ein höchst signifikanter Zusammenhang zwischen Alter und BMI beobachtet werden (s. Tab. 5). Demzu- folge nimmt die Wahrscheinlichkeit, untergewichtig zu sein bei beiden Geschlechtern mit steigendem Alter ab.
Ein ganz anderes Bild zeigt sich jedoch bei der Betrachtung von Übergewicht und Alter in Bezug auf das Geschlecht. Während mit zunehmendem Alter der Anteil übergewichtiger Frauen nur geringfügig steigt, nimmt der Anteil der männlichen Übergewichtigen um 52% zu. Im Alter von 21 bis 24 Jahre sind somit 45,1% der männlichen Untersuchungsgruppe übergewichtig (Frauen: 23,6%).
Tabelle 5: Altersspezifische Gewichtsverteilung nach Geschlecht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Betrachtet man die Verknüpfung von Gewicht und absolviertem Schulabschluss, so wird zusätzlich deutlich, dass auch hier ein höchst signifikanter Zusammenhang besteht (s. Abb. 2). Es zeigt sich, dass 32,9% der Testpersonen mit einem Hauptschulabschluss, 26,1% der Testpersonen mit einem Realschulabschluss und 14,3% der Testpersonen mit Abitur übergewichtig bis stark übergewichtig sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Gewichtsverteilung nach Schulabschluss in Prozent
5.1.2 Subjektive Befindlichkeit
Die Auswertung in Tab. 6 zeigt, dass der Großteil der Befragten ihren Gesundheitszustand mit sehr gut bis gut bezeichnet. Gerade einmal 6,5% definieren ihren Gesundheitszustand mit schlecht bis sehr schlecht. Betrachtet man den Unterschied zwischen der männlichen und weiblichen Untersuchungsgruppe so fällt auf, dass Männer (64,7%) ihren Gesundheitszustand signifikant häufiger mit sehr gut bis gut beschreiben als Frauen (57,5%).
Tabelle 6: Subjektiver Gesundheitszustand der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zusätzlich besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen Alter und der persönlichen Einschätzung des eigenen Gesundheitszustandes (s. Tab. 7). Die Daten zeigen, dass 65% der 16- 18-jährigen, 58,3% der 19-21-jährigen und 53,8% der 22-24-jährigen Befragten ihren Gesundheitszustand mit sehr gut bis gut bezeichnen.
Tabelle 7: Gegenwärtiger Gesundheitszustand nach Alter und Geschlecht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.1.3 Rückenschmerzen
Im Mittel waren sowohl die männlichen als auch die weiblichen Probanden in den letzten zwölf Monaten 9,47 Tage arbeitsunfähig. Abb. 3 zeigt, dass 85,9% der Frauen im vergangenen Jahr mindestens einen Tag nicht arbeitsfähig waren (Männer: 76,9%). Aufgrund von Rückenschmerzen gaben 14,2% der männlichen Befragten und 23,8% der weiblichen Befragten an, mindestens einen Tag arbeitsunfähig gewesen zu sein. Anders formuliert bedeutet dies, dass 60,5% der Probanden, welche in den letzten 12 Monaten wegen Rückenschmerzen arbeitsunfähig waren, Frauen sind. Die Männer waren aufgrund von Rückenschmerzen im Durchschnitt 0, 86 Tage, die Frauen 2,02 Tage arbeitsunfähig.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Arbeitsunfähigkeit allgemein und aufgrund von Rückenschmerzen
Besonders auffällig bei der Betrachtung der Prävalenz von Rückenschmerzen ist der große Anteil an Personen (66,9%), welche innerhalb der letzten 5 Jahre mindestens einmal von Rü- ckenschmerzen betroffen waren. Gerade einmal 19,3% der Befragten gaben jedoch an, inner- halb der letzten 5 Jahre aufgrund von Rückenschmerzen in Behandlung gewesen zu sein. Le- diglich bezüglich der Prävalenz von Rückenschmerzen innerhalb der letzten sieben Tage kann ein signifikanter Unterschied (***) zwischen Männern und Frauen festgestellt werden. Frauen sind demnach mit 16% häufiger betroffen als Männer (11,7%). Auch lassen sich in diesem Zeitraum mehr als doppelt so viele Frauen (15,8%) wie Männer (7,7%) aufgrund von Rücken- schmerzen behandeln (***).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Prävalenz von Rückenschmerzen innerhalb verschiedener Zeitspannen
Insgesamt klagen 49% der Befragten über Schmerzen im Lendenbereich, 36% über Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich und nur 9% über Schmerzen im Brustwirbelbereich. Zusätzlich sind signifikante Unterschiede zwischen den männlichen und weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen festzustellen (s. Abb. 5)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Spezifische Rückenschmerzen bei jungen Erwachsenen
Betrachtet man den in Abb. 6 dargestellten höchst signifikanten Zusammenhang zwischen der Beurteilung des subjektiven Gesundheitszustandes und dem zeitlichen Auftreten von Rücken- schmerzen, so wird deutlich, dass je weiter die Rückenschmerzen zeitlich zurück liegen, desto häufiger wird die Einschätzung des subjektiven Gesundheitszustandes mit sehr gut bis gut bewertet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Einschätzung des subjektiven Gesundheitszustandes im zeitlichen Kontext
Betrachtet man den gerade festgestellten Zusammenhang zwischen der Beurteilung des sub- jektiven Gesundheitszustandes und dem Auftreten von Rückenschmerzen innerhalb der letz- ten sieben Tage unter geschlechtsspezifischem Hintergrund, so lässt sich ein signifikanter Unterschied zwischen den männlichen und weiblichen Probanden feststellen. Abb. 7 zeigt, dass Männer (52%), welche unter akuten Rückenschmerzen leiden, ihren Ge- sundheitszustand häufiger mit sehr gut bis gut bewerten als Frauen (47%), die unter akuten Rückenschmerzen leiden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Einschätzung des Gesundheitszustandes unter akuten Rückenschmerzen
Während die meisten Befragten die Stärke ihrer Rückenschmerzen mit mittel (42%) beschrei- ben, bezeichnen 10,5% der Befragten ihre Schmerzen als stark und 20,5% der Befragten als leicht (s. Abb. 8). Die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Befragten sind höchst signifikant.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Schmerzempfinden bei Rückenschmerzen nach Geschlecht
Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen kann ein höchst signifikanter Zusammenhang zwischen dem persönlichen Gesundheitszustand und dem subjektiv wahrgenommen Schmerzempfinden bei Rückenschmerzen festgestellt werden. Tab. 9 zeigt, dass bei zunehmendem Schmerzempfinden sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die subjektive Beschreibung des eigenen Gesundheitszustandes weniger mit sehr gut bis gut, dafür aber häufiger mit schlecht bis sehr schlecht bewertet wird.
Tabelle 8: Gesundheitszustand im Kontext von Schmerzstärke und Geschlecht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.1.4 Häufige Krankheitsbilder, Beschwerden oder Symptome
Unter dieser Rubrik wurden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach Krankheiten, Beschwerden oder Symptomen wie Magen-Darm-Erkrankung, grippalen Infekten, Herz- Kreislauf-Beschwerden, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Allergien und anderen Beschwer- den befragt. Die Probanden sollten angeben, welche dieser gesundheitlichen Einschränkungen innerhalb der vergangenen 12 Monaten bei ihnen in Erscheinung getreten sind und ob sie deswegen einen Arzt aufgesucht haben. Insgesamt hatten in den vergangenen 12 Monaten mit 73,2% zwar die meisten der Befragten eine Erkältung oder einen grippalen Infekt, jedoch wa- ren nur 31,5 % der Befragten deswegen in medizinischer Behandlung. Zusätzlich litten viele der Befragten unter Kopfschmerzen (52,1%) und Magen-Darm-Beschwerden (41,9%). Die Abb. 9 und 10 stellen die Beantwortung dieser Frage nach Männern und Frauen getrennt dar. Hier wird ein großer Unterschied zwischen den Geschlechtern deutlich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 10: Prävalenz und Behandlung häufiger Krankheitsbilder bei jungen Frauen
5.1.5 Psychische Gesundheit
Um eine Aussage über die psychische Verfassung der Probanden treffen zu können, wurden diese gefragt, ob sie sich in den vergangenen 12 Monaten müde, lustlos, ausgebrannt oder depressiv gefühlt haben. Um zusätzlich einen Einblick zu bekommen, wie stark die Jugendli- chen und jungen Erwachsenen unter Stress leiden, wurden diese im Weiteren zu ihrem per- sönlichen Gefühl der Überlastung und des Zeitdrucks befragt.
[...]
- Arbeit zitieren
- Studienrat Steffen Weber (Autor:in), 2010, Geschlechtsspezifische Aspekte der Gesundheitsförderung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/382929
Kostenlos Autor werden













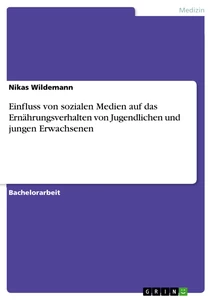






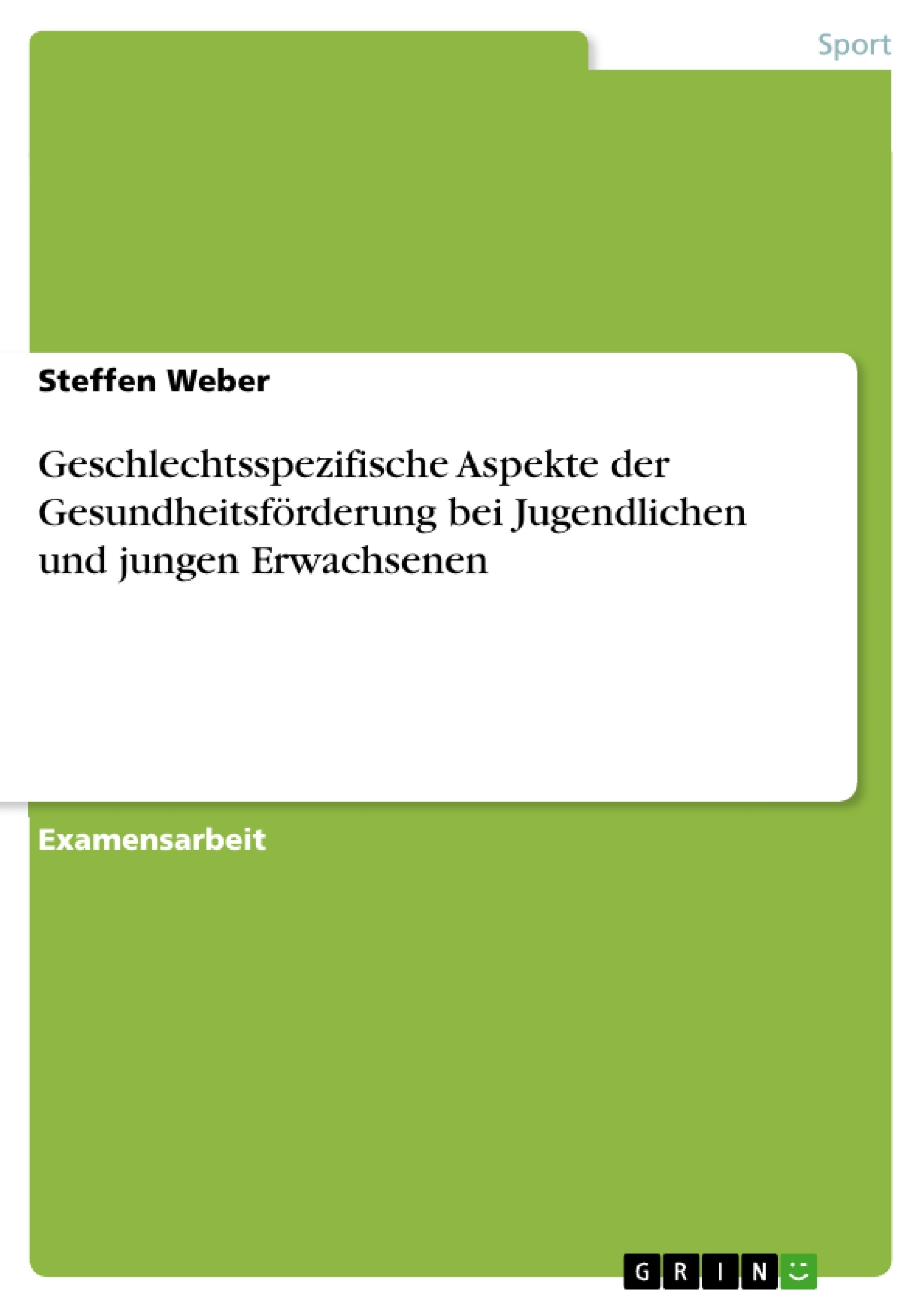

Kommentare