Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
I. Theoretischer Teil
2. Zur Konstruktion von Geschlecht
2.1 Evolutionäre Perspektive
2.2 Geschichtliche Perspektive
2.2.1 Das 18. Jahrhundert
2.2.2 Das 19. Jahrhundert
2.2.3 Das 20. Jahrhundert
2.2.4 Ansichten von Simone de Beauvoir im Jahre 1949
2.3 Entwicklungspsychologische Perspektive
2.3.1 Geschlechtsidentität in der Kindheit
2.3.2 Geschlechtsidentität in der Adoleszenz
2.3.3 Geschlechtsidentität im Erwachsenenalter
3. Geschlechtsspezifische Unterschiede: Faktum oder Vorurteil?
4. Androgynie
4.1 Sichtweise von C. G. Jung
4.2 Sichtweise von D. Alfermann
5. Wandel der Geschlechtsrollen
5.1 Veränderung der weiblichen Rolle
5.2 Veränderung der männlichen Rolle
6. Beziehungsstile
7. Hypothesen
II. Methode
III. Ergebnisse
1. Geschlechtstypen: Reales und ideales Selbstbild
2. Zufriedenheit
3. Aussehen und Mode
4. Liebe und Beziehung
5. Zusammenfassung
IV. Diskussion
V. Anhang
(1) Fragebogen
(2) Abbildungsverzeichnis
(3) Tabellenverzeichnis
(4) Stichwortverzeichnis
(5) Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Wie werden „Frauen“ und „Männer“ gedacht und wahrgenommen und wie präsentieren sich die weiblichen oder männlichen Individuen? Welche Eigenschaften werden ihnen zu- oder abgesprochen und in welchen Prozessen vollzieht sich diese Typisierung?[1]
Wissenschaft beginnt damit, dass wir unsere Aufmerksamkeit beschränken indem wir die Grenzen des Bereichs abstecken, innerhalb dessen wir die Wirkungen der wesentlichen Elemente aufzuklären suchen.[2] Ziel dieser Arbeit ist es, sowohl einen Überblick über die Entstehung von Geschlecht aus verschiedenen Perspektiven zu geben, als auch auf momentane Veränderungen, die unsere Gesellschaft durchläuft, einzugehen. Die facettenreichen theoretischen Bemühungen, Anteile von Weiblichkeit und Männlichkeit zu beschreiben und in Erklärungshypothesen neu zu erfassen, ermöglichen es, Geschlecht als etwas Veränderbares zu begreifen.
In den ersten Kapiteln werde ich mich mit der Konstruktion des Geschlechtsbegriffes beschäftigen. Die zu untersuchende Variable Geschlecht wird sowohl von der evolutionären, der geschichtlichen als auch von der entwicklungspsychologischen Sichtweise beleuchtet. Weiters wird der feministische Klassiker „Das andere Geschlecht“ von Simone de Beauvoir aufgegriffen. Zur Erklärung der männlich – weiblichen Differenz wird in diesem Kapitel primär auf Theorien der Psychoanalyse zurückgegriffen. Beauvoirs Argumentationen geben allerdings auch kulturtheoretische Einblicke – es bieten sich also sowohl Erklärungen für das kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit als auch Modelle zur Analyse von Sozialisationsprozessen von Mädchen und Jungen an.
Welchem Geschlecht wir angehören ist ein integraler Bestandteil dessen, wer wir sind, wie wir uns selbst erleben, und wie andere mit uns umgehen. Gesellschaften haben schon immer sorgfältig ausgearbeitete Systeme von Glaubensvorstellungen entwickelt, die unter anderem die Aufgabenverteilung kontrollieren.
Für alle Gesellschaften ist das Geschlecht eines der zentralen Ordnungs- bzw. Orientierungskriterien: Gesellschaften, die Verhaltensweisen im Hinblick auf männliche und weibliche Aufgaben koordinieren, zeichnen sich gewöhnlich durch eine Reihe von tief verwurzelten Anschauungen über Eigenschaften von Männern und Frauen aus.[3] Es wird als gegeben hingenommen, dass Männer und Frauen unterschiedliches Verhalten zeigen, verschiedene Verantwortlichkeiten und Privilegien haben, und dass Männer Frauen anders behandeln als Männer bzw. vice versa.[4] Stereotype sind vor allem für die Alltagsbewältigung notwendig, da sie dazu dienen, die Komplexität der Welt in überschaubare Einheiten zu reduzieren.[5] Sie tragen also demzufolge zu mehr Ordnung und Übersichtlichkeit bei. Allerdings sollten Stereotype immer „mit Vorsicht genossen“ werden, da sie sich oft als ungenau bzw. unrichtig erweisen können.
Wie auch immer diese Prozesse im Einzelnen funktionieren mögen, es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Geschlechtszugehörigkeit einen Unterschied macht. Zahllose wissenschaftliche Befunde haben inzwischen belegt, dass es nicht das gleiche ist, wenn Männer oder Frauen agieren. Das Kapitel „Geschlechtsspezifische Unterschiede: Faktum oder Vorurteil“ versucht darzustellen, in welchen Prozessen sich die vorherrschenden Glaubensvorstellungen in Bezug auf das Geschlecht vollziehen bzw. herauszufinden, inwieweit geschlechtsspezifische Unterschiede der Realität entsprechen.
Menschen unterscheiden sich in ihrer Bereitschaft, Informationen aus der Umgebung und über sich selbst nach ihrem geschlechtstypischen Gehalt zu ordnen. Menschen, die stark dazu neigen, geschlechterschematisch zu denken und Informationen zu ordnen, teilen somit die Welt in männlich und weiblich ein. Menschen hingegen, die wenig dazu neigen, geschlechterschematisch zu denken, ordnen ankommende Informationen weniger nach ihrem geschlechtstypischen Gehalt, sondern mehr nach anderen Kriterien. Solche Menschen lassen sich auch in ihren Bewertungen weniger von geschlechtstypischen, und damit häufig sachfremden Kriterien, leiten.[6] Im Kapitel „Androgynie“ wird sowohl aus der Sichtweise von Carl Gustav Jung als auch von Dorothee Alfermann darzustellen versucht, durch welche Merkmale sich androgyne Persönlichkeiten auszeichnen und warum sie Vorteile gegenüber geschlechtstypischen Personen aufweisen müssten.
Sowohl das Modell der Arbeitsteilung, wie auch zugleich das der „Persönlichkeitsteilung“ zwischen den Geschlechtern wurde als gelungene Entwicklung angesehen. Indem sich Mann und Frau „ergänzten“ erschien das System vollständig.[7] Die Annahme, die Frau sei von Natur aus ein leidendes, passives, erduldendes Wesen, das nur vom Gefühl her lebe und keinen Verstand besitze, beruht – zumindest in unserer westlichen Welt – auf einer veralteten Sichtweise. Allerdings legitimierten Gesetze noch weit bis ins 20. Jahrhundert, dass der Ehemann über den Einsatz der weiblichen Arbeitskraft zu entscheiden habe. Normalerweise waren Männer also allein geschäftsfähig und befugt Privatbelange nach außen zu vertreten.[8] Doch auch heute existieren noch eine Reihe von Erwartungen in Bezug auf das bei Männern und Frauen angemessene Verhalten. Diese Geschlechtsrollenerwartungen betreffen die meisten Lebensdomänen.[9] Allerdings sind Glaubensvorstellungen in Bezug auf das Geschlecht heute einem raschen Wandel unterworfen: sie sind in sich widersprüchlicher geworden und rufen darum eher Zweifel hervor.[10]
Soziale Veränderungen, wie beispielsweise die steigende Anzahl berufstätiger Frauen, haben dazu geführt, dass Männer und Frauen in ein anderes Licht gerückt sind. Eine nachweisbare Veränderung der Frauenrolle lässt sich auch in der Bildungsbeteiligung der Mädchen und Frauen erkennen. Die heutige Generation von Jungen und jungen Männern genießt somit keine bessere Schulausbildung mehr als die Mädchen.[11] Außerdem wird heutzutage später geheiratet, Kinder werden später geboren und Beziehungen resultieren immer öfter in einer Scheidung. Bereits 1986 waren Familien mit doppeltem Einkommen bzw. Single – Mütter am steigenden Ast begriffen.[12]
Gesellschaftlicher Wandel lässt sich auch immer sehr klar in den Medien und im Bereich des Konsumgütermarktes erkennen. Während die traditionelle Auffassung des Mannes als rauer, aggressiver, muskulöser Mann, der männliche Sportarten und Aktivitäten schätzt, nicht verschwunden ist, beurteilt die Gesellschaft die Rolle des Mannes langsam anders. Ende der 90er-Jahre gestand man Männern zu, mitfühlend und eng mit anderen Männern befreundet zu sein. Im Gegensatz zum Macho, der keine Gefühle zeigen darf, heben Marketingexperten jetzt die ‚gefühlsbetonte’ Seite von Männern hervor.[13] Das Kapitel „Wandel der Geschlechtsrollen“ versucht soziale und gesellschaftliche Veränderungen sowohl aus der Sicht der weiblichen als auch der männlichen Rolle herauszuarbeiten.
Unter dem Aspekt des allmählichen Wandels der Geschlechtsrollen werden im Kapitel „Beziehungsstile“ romantische Beziehungen zwischen Männern und Frauen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Seit dem Rückgang des kirchlichen Einflusses wird nicht mehr der „Herr im Himmel“ bei Tod und Krankheit „angebetet“, sondern der Lebensgefährte. Die Auflösung einer geschlossenen christlichen Moral übertrug der Lebensgemeinschaft die schwere Bürde, für die Suche nach Zukunft und Perspektiven, für Identität und Orientierung allein verantwortlich zu sein. Diese Mehrbelastung zehrt schon seit langem am Konstrukt der bürgerlichen Ehe und all ihren Nachfolgerinnen. Unzählige Ratgeber, Kummerspalten und wissenschaftliche Analysen sprechen für sich.[14] Welche Merkmale stabile und zufriedene Beziehungen ausmachen und welche Inhalte in Partnerschaften entscheidend sind, werden zu analysieren versucht.
Ziel der Untersuchung, die im Anschluss an den theoretischen Teil vorgestellt wird, war vorwiegend, herauszufinden, ob androgyne Persönlichkeiten, also Personen, die sich sowohl mit positiven männlichen als auch mit positiven weiblichen Variablen beschreiben, Sozialisationsvorteile aufweisen: ob sie beispielsweise glücklicher mit ihrem Leben sind und erfülltere Beziehungen führen. Im Kapitel „Ergebnisse“ wird dargestellt, ob die aufgestellten Hypothesen verworfen oder beibehalten werden konnten.
I. Theoretischer Teil
2. Zur Konstruktion von Geschlecht
Geschlechterforschung rückt die Kategorie Geschlecht als Prozess, Struktur und Verhältnis in das Zentrum ihrer Analysen. Sie beschäftigt sich systematisch mit der Frage nach der Entstehung und Struktur der Geschlechterverhältnisse und den damit verbundenen sozialen, kulturellen, politischen, ökonomischen und symbolischen Folgen. Dabei wird Geschlecht nicht als etwas Naturgegebenes verstanden, sondern etwas, dass sozialen und kulturellen Konstruktionsmechanismen unterliegt. Das bedeutet, dass die Geschlechterforschung danach fragt, wie aus Menschen "Männer" und "Frauen" werden und welche Implikationen mit diesen Prozessen verbunden sind. Das Menschenbild entspricht also keiner „ewigen archetypischen Idee im Sinne Platons“, sondern einer „wandelbaren geschichtlichen Funktion“.[15]
Dieses Kapitel befasst sich aus interdisziplinärer Perspektive mit der sozialen Kategorie Geschlecht, die Denk- und Wissenssysteme ebenso bestimmt wie gesellschaftliche und kulturelle Organisationsformen. Aus der Sichtweise unterschiedlicher Fachgebiete – der evolutionären, geschichtlichen und psychologischen Perspektive werden grundlegende Kenntnisse zur Konstruktion von Geschlecht vermittelt. Gegenstand dieses Kapitels ist es aufzudecken, wie Unterschiede zwischen den Geschlechtern sozial und kulturell konstruiert werden bzw. welche Denkweisen den Prozess des Geschlechterverhältnisses bestimmen.
2.1 Evolutionäre Perspektive
Mit der Theorie der natürlichen Auslese (über den Ursprung der Arten, 1859) löste Charles Darwin eine wissenschaftliche Revolution in der Biologie aus. Er wollte ergründen, wie neue Arten entstehen bzw. auch wieder verschwinden konnten.[16] Die Evolutionstheorie geht davon aus, dass menschliches Verhalten sowohl durch die Gene als auch durch Umweltinputs beeinflusst wird.[17] Evolution hingegen bezeichnet die sich im Laufe der Zeit vollziehenden Veränderungen organischer (lebender) Strukturen.[18]
Betrachtet man Geschlechtsunterschiede aus evolutionspsychologischer Sicht fällt auf, dass sich Männer und Frauen in der Phylogenese unterschiedlichen Anpassungsforderungen gegenüber sahen. Heute sind diese Anpassungen als Geschlechtsunterschiede beobachtbar. Die Frau hat klassischerweise einen grazileren Körperbau, zierlichere Knochen als der Mann, eine geringere Muskulatur, ein kleineres Gehirngewicht, eine spärlichere Körperbehaarung, dagegen aber etwas stärker ausgeprägte Fettpolster. Das männliche Idealbild entspricht weitgehend dem „athletischen“ Körperbau. Dies lässt darauf schließen, dass Menschen spezifische Anpassungen bzw. Adaptionsmechanismen entwickeln mussten um verschiedenste Überlebensprobleme zu überwinden.[19]
Ärzte und Anthropologen stellen heute fest, dass sich im Körperbau der Menschen unserer Kultur immer mehr Abweichungen von den klassischen Leitbildern zeigen: Frauen von großem Wuchs, voluminöser Muskulatur, starkem Knochenbau und stärkerer Körperbehaarung werden immer häufiger. Umgekehrt findet sich, dass Männer mit stärkeren Fettpolstern, geringerer Ausprägung der Muskeln sowie mit grazileren Knochen ebenfalls immer zahlreicher werden. Hierzu kann man feststellen, dass eine wachsende Zahl von Frauen keineswegs mehr wie früher auf den häuslichen Bereich beschränkt ist, sondern arbeitet „wie ein Mann“. Umgekehrt sind die meisten Männer nicht mehr damit beschäftigt, unter Einsatz ihrer Kräfte zu jagen, zu fischen, Ackerbau zu betreiben und „Stammesfehden“ auszutragen. Die Mehrzahl der Männer ist vielmehr in geschlossenen Räumlichkeiten beschäftigt und arbeitet im Sitzen. Das fördert offenbar „Beschaulichkeit an Leib und Seele“ und führt letztlich zu einer Ausprägung, die man früher als weiblich bezeichnet hätte.[20]
Befunde zur Nahrungsbeschaffung weisen darauf hin, dass eine gewisse Form der Arbeitsteilung existierte: Männer gingen auf die Jagd – Frauen sammelten Beeren. Die Unterschiede im räumlichen Vorstellungsvermögen der Geschlechter reflektieren deren Adaption für das Jagen und Sammeln. Durchschnittlich sind Frauen bei der Standortbestimmung von Objekten besser als Männer (= Sammeln). Männer hingegen übertreffen Frauen bei räumlichem Denken. (= Jagen).[21]
Abgesehen von dem Prozess der Nahrungsbeschaffung sind die Asymmetrien zwischen Mann und Frau in Bezug auf die Fortpflanzung bzw. auf die Höhe der Minimalinvestition um Nachwuchs zu bekommen auffällig. Während Frauen mindestens neun Monate Schwangerschaft und die Stillzeit investieren müssen, reicht bei Männern ein einmaliger Sexualkontakt zur Fortpflanzung aus. Weiters sind Frauen nur bis zu einem bestimmten Lebensalter fortpflanzungsfähig, während Männer dies unter Umständen bis ins hohe Alter sind. Je mehr Sexualkontakte der Mann unter günstigen ökologischen Bedingungen hatte, desto höher war „seine“ Fortpflanzungsrate. Zu erwarten ist, dass Frauen eine durchschnittlich geringere Anzahl von Sexualpartnern haben als Männer, und dass Frauen eine negativere und ablehnendere Haltung gegenüber wechselnden Partnern und Gelegenheitssex an den Tag legen. Befragt man Frauen und Männer, für wie wahrscheinlich sie einen sexuellen Kontakt mit einem Menschen halten, den sie erst kurz kennen, findet man einen deutlichen Geschlechtsunterschied: Während Frauen nach einer Woche Bekanntschaft eine gewisse Bereitschaft angeben, ist dies bei Männern schon nach einer Stunde der Fall.[22] Der reproduktive Vorteil aufgrund kurzfristiger Beziehungen für Männer ist klar ersichtlich.[23]
Im Gegensatz zu soziobiologischen Annahmen gehen aber sozialisations- ebenso wie rollentheoretische Modelle davon aus, dass Einstellungen und Verhalten sich aufgrund geänderter Erwartungen und Normen ändern.[24] So wäre zu erwarten, dass sich sexuelle Einstellungen und Verhaltensweisen der Geschlechter im Zeitvergleich immer mehr annähern. Dies umso mehr, als Empfängnisverhütungsmethoden es erlauben, Sexualität von der Fortpflanzung abzukoppeln.
Da die Fortpflanzungsfähigkeit von Frauen mit der Menopause endet, ist zu erwarten, dass die Bevorzugung jüngerer Frauen für Männer einen Selektionsvorteil darstellt. Die soziale Norm für „angemessene“ Altersdifferenzen bei Paaren geht tatsächlich in diese Richtung. Als Normalfall gelten Paare, bei denen die Männer etwas älter sind als die Frauen. Altersdifferenzen von wenigen Jahren in beiden Richtungen werden toleriert, sehr große Altersdifferenzen hingegen negativ bewertet. Dabei gibt es aber anscheinend eine Asymmetrie: Beziehungen zwischen Frauen und wesentlich jüngeren Männern werden schärfer sanktioniert als solche zwischen Männern und wesentlich jüngeren Frauen.[25]
Für Männer sind zwei Präferenzen bei der Entscheidung für einen langfristigen Partner ausschlaggebend: Das erste ist, Frauen von hoher Fruchtbarkeit bzw. reproduktivem Wert zu identifizieren. Männer haben Attraktivitätsmerkmale entwickelt, die Hinweise auf die reproduktive Kapazität einer Frau enthalten. Hinweise auf Jugend und Gesundheit sind hier zentral[26]:
- Glatte Haut
- Volle Lippen
- Schmale Kieferknochen
- Symmetrische Gesichtszüge
- Weiße Zähne
- Abwesenheit von Wunden / Verletzungen
- Taille-Hüfte-Verhältnis[27]
Im Lauf der menschlichen Evolutionsgeschichte waren Männer mit einem weiteren großen adaptiven Problem konfrontiert: die Ungewissheit der Vaterschaft. Männer, die diesem Problem gleichgültig gegenüberstanden, riskierten, die Kinder eines anderen Mannes aufzuziehen, was für ihren Reproduktionserfolg äußerst nachteilig gewesen wäre. Männer legen daher nicht nur Wert auf physische Attraktivität, sondern auch auf Treue bzw. sexuelle Loyalität.[28] Männliche Eifersucht konzentriert sich daher meist auf eventuelle sexuelle Untreue der Partnerin, da eben die Gewissheit der Vaterschaft gefährdet ist. Frauen reagieren eher eifersüchtig auf emotionale Untreue – verbunden mit dem Wunsch langfristiger Beziehungen. Eifersucht führt zu einem Verhalten, dass den Partner davon abhalten soll, den anderen zu verlassen oder untreu zu werden.[29]
Sexuelle Eifersucht ist auch ein wichtiger Kontext, der männliche Aggressionen gegen die eigene Partnerin auslöst. Aus Sicht der evolutionären Psychologie ist Aggressivität kein einzelnes oder isoliertes Phänomen. Sie stellt eine Vielzahl von Strategien dar, die sich unter ganz besonderen kontextspezifischen Bedingungen auswirkt.
Aggressivität bietet zeitweilig Lösungen für ganz unterschiedliche adaptive Probleme:[30]
- Vereinnahmung Ressourcen anderer
- Verteidigung der Familie gegen Angriffe
- Erhöhte sexuelle Fortpflanzungsrate
- Hierarchie, Macht und Status
- Abschreckung von Rivalen
- Abschreckung langfristiger Partner vor Untreue oder Verlassen
Aggressivität und Dominanz werden durch verschiedene Faktoren bestimmt und angezeigt, darunter eine aufrechte Haltung, eine gleichmäßige Stimme, direkter Blickkontakt, ein schneller Gang, ein ausgeprägtes Kiefer und körperliche Größe. Auch das Hormon Testosteron und der Neurotransmitter Serotonin konnten beide in Zusammenhang mit Dominanz in Verbindung gebracht werden.[31] In verschiedenen Metaanalysen[32] konnte nachgewiesen werden, dass Männer auch heute noch aggressiver als Frauen sind, allerdings gleichen sich Männer und Frauen im Erwachsenenalter stärker an. Dies kann darauf beruhen, dass die Sozialisation in unserer Kultur darauf hinläuft, aggressives Verhalten zu unterbinden, was somit im Kindes- und Jugendalter noch zu beobachtende stärkere Aggressivität mindert. Von Männern ausgeübte Dominanz und Aggression werden allerdings nicht so negativ bewertet, wie dasselbe Verhalten von Frauen, da Frauen gemäß ihrem Stereotyp als sanft, freundlich und herzlich beschrieben werden.[33]
Zur Zeit unserer Vorfahren liefen Frauen, die sich wahllos auf Männerpartnerschaften einließen eher Gefahr, geringere Reproduktionserfolge zu erzielen als diejenigen, die klug auswählten.[34] Frauen können ihre Nachkommen nicht mit einer erhöhten Rate an Sexualkontakten steigern, sehr wohl aber durch die sorgfältige Auswahl des Partners. Wichtig dabei ist, dass der Partner über ausreichende Ressourcen verfügt, die in den Nachwuchs investiert werden können.[35] Frauen scheinen Männer mit vielen Ressourcen und hohem Status heute noch attraktiver zu finden, eben weil diese Attraktivitätskriterien zu einer erfolgreicheren Reproduktion geführt haben.
Frauen richten ihre Partnerpräferenzen also auf Eigenschaften, die den Besitz oder den zukünftigen Erwerb von Ressourcen versprechen:[36]
- Ehrgeiz
- Intelligenz
- höheres Alter
- Status
Es spricht viel dafür, dass die sexuelle Selektion beim Mann das Entstehen einer Motivation für Statusbestrebungen stärker gefördert hat als bei der Frau. Frauen sind eher egalitär, Männer eher hierarchisch eingestellt. Ein höherer Status bedeutet für Männer im Allgemeinen mehr Sexualpartner.[37]
Potential bezüglich Ressourcen allein reicht jedoch nicht aus. Frauen sehen sich zeitweilig mit dem Problem des Bindungswillens seitens der Männer konfrontiert. Die Suche nach Liebe ist die Lösung des Problems. Handelt ein Mann aus Liebe, so zeigt er seinen Bindungswillen mit der betreffenden Frau. Allerdings täuschen Männer Frauen manchmal über emotionales Engagement und über langfristige Absichten um kurzfristigen sexuellen Zugang zu erlangen.[38] Handelt es sich um eine langfristige Beziehung, so bevorzugen Frauen Eigenschaften, die darauf hindeuten, dass der Mann ein guter Versorger und Vater sein wird. Für die Frauen unserer Vorfahren war es allerdings auch wichtig, dass es Männern nicht an Mut und Kraft fehlte, die gemeinsamen Ressourcen zu verteidigen. Auch moderne Frauen wählen Männer zum Teil nach Stärke, Körperbau und Gesundheit aus.[39]
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass suizidale Vorstellungen am häufigsten bei Menschen mit schlechten reproduktiven Aussichten vorkommen[40]:
- das Scheitern heterosexueller Partnerschaften
- ein schlechter Gesundheitszustand
- schlechte finanzielle Aussichten
Höchstwahrscheinlich haben Menschen „kontextsensitive psychische Mechanismen“ entwickelt, um ihr künftiges Reproduktionspotential und ihren Nettoaufwand für die genetische Verwandtschaft einzuschätzen.[41]
2.2 Geschichtliche Perspektive
Um den kulturellen Wandel, den Fluss politischer Ereignisse und die sozialen Probleme zu verstehen ist es notwendig auch die geschichtliche Perspektive der Geschlechterforschung zu erläutern.
Die Geschichte der Geschlechterforschung hat, historisch gesehen, nicht voraussetzungslos begonnen. Sozial wirksame Überlegungen wurden lange Zeit einseitig von Männern vertreten – von Philosophen, Staatstheoretikern, Natur- und Humanwissenschaftlern sowie Politikern – da Frauen in nennenswerter Zahl erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Institutionen der Wissenschaft vertreten waren. Ehe sich also feministische Diskurse entfalten konnten, waren Vorstellungen von „Geschlecht“ und „Geschlechtlichkeit“ bereits aus männlicher Perspektive vorgedacht.[42]
2.2.1 Das 18. Jahrhundert
Vor dem 18. Jahrhundert hat man die Frau für sexuell wesentlich anfälliger und genussfähiger gehalten als den Mann. Im viktorianischen Zeitalter (1840 – 1901) hingegen wurde das Klischee-Bild von einer fast asexuellen Frau geschaffen. Diese Differenzierung ist historisch neu: die vor-viktorianische Haltung hatte gerade den Frauen angelastet, dass sie die Verführerinnen waren. Eine neue Typisierung der Geschlechterrollen entsteht: den Männern mutet man eine sündige Natur zu – das Höchste, dass man von ihnen erwarten kann, ist, dass sie ihre „ununterdrückbaren Impulse“ lediglich in der Ehe ausleben. Die Natur der Frau wird hingegen als so rein angesehen, dass man ihnen zutraut gegenüber sexuellen Gefühlen völlig immun zu sein.[43] Dieser neue Stereotyp wird im ganzen bürgerlichen Zeitalter bis ins 20 Jahrhundert vorherrschen.
Im 18. Jahrhundert wird nicht mehr aufgrund von Familienpolitik geheiratet sondern aufgrund Liebe.[44] Frauen und Kindern wird eine solche Feinfühligkeit zugeschrieben, dass sie vor allem Groben und Anzüglichen geschützt werden. Auch werden Kinder jetzt nicht mehr als kleine Erwachsene sondern als Kinder gesehen und so behandelt. (In dieser Zeit entsteht auch die erste Kinderliteratur). Mütter beginnen jetzt auch, ihre Kinder selbst zu stillen.[45]
Ein harter Vater und eine sanfte Mutter werden zu den beiden einander ergänzenden Figuren der bürgerlichen Familie. Das Frauenbild wird dem der Mutter angenähert – es führt zur Spaltung des Frauenbildes in „die Heilige“ und „die Hure“.[46] Mitsprache, noch irgendwelche anderen Rechte in der Gesellschaft hatten Frauen zu dieser Zeit nicht.
Die Anfänge der Frauenrechtsbewegung lagen im späten 18ten Jahrhundert. Die Voraussetzungen dieser Bewegung waren die vorherigen historischen Ereignisse wie zum Beispiel das Zeitalter der Aufklärung und die industrielle Revolution, die eine enorme wirtschaftliche und soziale Umwälzung mit sich brachten. Der Prolog der Frauenbewegung wurde in Frankreich – in der Französischen Revolution (1789) – gesprochen. Es wurde das aktive und passive Wahlrecht und die Zulassung zu allen Ämtern gefordert. Die römisch-katholische Kirche bekämpfte die Frauenbewegung von Anfang an, mit der Begründung, sie zerstöre die Stellung des Mannes in der Familie. Nach der Französischen Revolution wurden alle Errungenschaften wie Scheidungsrecht, Eigentumsrecht und Zugang zu Bildungswegen für Frauen wieder aufgehoben. Schließlich wurden auch alle Zusammenschlüsse von Frauen verboten. Dieses Verbot war für die Geschichte der Frauen sehr entscheidend. Mit dem Sieg des bürgerlichen Lagers über die Volksbewegung hatte die Theorie der Egalität der Geschlechter für lange Zeit keine Chance mehr.[47]
1792 erinnerte die Engländerin Mary Wollstonecraft die Revolutionäre daran, dass sie in der Erklärung der Menschenrechte die Frauenrechte vergessen hätten und verfasste: „A Vindication of the Rights of Women“ (Eine Verteidigung der Frauenrechte). Neben einer Interessensvertretung im Parlament forderte sie das Recht auf Ausbildung und das Recht auf sexuelle Befriedigung für Frauen.[48] (Was zu dieser Zeit natürlich äußerst schockierend war). Mary Wollstonecraft kann als eine der Gründungsheroinen der Frauenbewegung gesehen werden.
2.2.2 Das 19. Jahrhundert
Die industrielle Revolution des 19ten Jahrhunderts führte zu einer sozialen Not unter den Arbeiterinnen und Dienstmädchen. Berufsmöglichkeiten für unverheiratete Frauen des Mittelstandes existierten kaum. Generell wurde politisches Engagement für Frauen zu einem hohen Risiko. Bis ins 19. Jahrhundert besaßen sie weder Versammlungs- noch Vereinsrechte. Aufklärungskampagnen, welche die weibliche Bevölkerung erreichen sollten, riefen Verbote und Terror hervor. Schimpfworte wie „Suffragetten“ [frz. Suffrage = die Wahl], „Emanzen“ und „Blaustrümpfe“ diskriminierten Frauenrechtlerinnen, die Freiheit, Gleichheit und Achtung für das eigene Geschlecht reklamierten. Heutzutage lässt es sich schwer nachvollziehen, wie riskant damals „weiblicher Eigensinn“ war.[49] Gefängnisstrafen und gesellschaftliche Ächtung mussten sie in Kauf nehmen. Weil gesetzliche Verbote nur für politische Vereine galten, wurden sehr bald Vereine mit kulturellen oder karitativen Bezeichnungen gegründet.[50]
Gemäßigte Frauenführerinnen forderten die Reform der Mädchenschule und der Lehrerinnenausbildung und strebten verbesserte Bedingungen für das Studium von Frauen an Hochschulen an. 1893 wurde das erste Mädchengymnasium in Deutschland gegründet. Seit 1908 waren Frauen an deutschen Universitäten vertreten. Kennzeichnend für die größere Bewegungsfreiheit war auch eine Änderung der Mode. Im Jugendstil (1900 bis 1920) wurden weite und fließende Gewänder populär. Auch Schwimmbäder wurden für beide Geschlechter frei zugänglich.[51]
Die Frauen, die in den USA lebten, zeigten schon früh ihre Eigenständigkeit. Viele Frauen verloren ihre Männer auf dem Weg in den Westen und mussten sich so eine eigene Existenz aufbauen. In den Vereinigten Staaten von Amerika war der Feminismus erfolgreicher als in anderen Ländern. Seine Anführerinnen waren meist gebildete, auf Reformen drängende Frauen der Mittelschicht. 1848 beteiligten sich mehr als 100 Personen an der ersten Frauenrechtsversammlung im Bundesstaat New York. Unter der Leitung von Lucretia Mott und der Frauenrechtlerin Elizabeth Cady Stanton forderten die Feministinnen gleiche Rechte, einschließlich des Wahlrechts. Es entstanden Colleges für Frauen, wie das Mount Holyoke College. Das Zugangsrecht der von Männern dominierten Universitäten wurde allerdings erst etwas später erstritten.[52]
In den 1880er Jahren gab es Allianzen zwischen der Frauenbewegung und den Ideen des Sozialismus. Auch in der Praxis sozialistischer Staaten (bis 1989) hatte sich erwiesen, dass die Gleichberechtigung von Frauen stärker als in westlichen Industriegesellschaften verwirklicht werden konnte.[53] Bildungsmöglichkeiten und berufliche Karrieren wurden staatlich sanktioniert, die Infrastruktur für Kinderpflege und Entlastung der Mutter schienen weitaus ausgebauter zu sein als in vergleichbaren kapitalistischen Staaten.
2.2.3 Das 20. Jahrhundert
Nach der Jahrhundertwende wurden die Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht militant: Suffragetten verfolgten eine Politik bewusster Regel- und Rechtsverletzungen, traten in Hungerstreik und lieferten diverse Gewaltaktionen. (Zertrümmerung von Schaufensterscheiben, Zerstörung von Bildern der Nationalgalerie etc.)[54]
Der Erste Weltkrieg (1914-18), in dem viele Frauen die Arbeitsplätze der zur Armee eingezogenen Soldaten einnahmen, trug dann mehr als alles andere dazu bei, den Widerstand gegen die politische Gleichberechtigung allgemein und auch der der Frauen zu brechen. So erhielten Frauen nach dem Krieg (1918/19) das aktive und passive Wahlrecht in fast allen westlichen Ländern. Die einzige Ausnahme war die Schweiz, wo das Frauenstimmrecht auf Bundesebene erst 1971 eingeführt wurde.[55] [Am längsten sträubten sich die Männer des Kantons Appenzell-Innerrhoden. Ende 1990 (!) haben sie ihren Widerstand schließlich aufgegeben.]
In der Zeit des Nationalsozialismus, die das Ideal von traditioneller Mütterlichkeit und die Herrschaft des Mannes über seine Gattin propagierte, lösten sich fast alle Frauenverbände, die für die Gleichberechtigung plädiert hatten, auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939 – 1945) halfen hauptsächlich Frauen die Städte wieder aufzubauen da viele Männer im Krieg gefallen waren. In die Geschichte gingen sie als „Trümmerfrauen“ ein. Die Situation der Frauen nach Kriegsende kann zweideutig ausgelegt werden. Einerseits standen viele Frauen mit ihren Kindern vor dem Nichts – andererseits stand der Weg der Emanzipation frei.
In den 60er Jahren organisierten aktive Feministinnen Frauenrechtsgruppen, die auf die allgemeine Benachteiligung der Frauen aufmerksam machten. Anfang der 70er Jahre protestierten Frauen gegen die Strafmäßigkeit der Abtreibung. Mit Unterschriftenaktionen wie „Ich habe abgetrieben“ und Parolen wie „Mein Bauch gehört mir“ forderten sie das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Mitte der 70er Jahre differenzierten sich die Aktivitäten der Gruppen: es wurde jetzt vermehrt gegen die alltägliche Diskriminierung von Frauen in Beruf und Gesellschaft gekämpft. Mit der Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit gingen Frauen auf die Straße. Es entstanden Frauenverlage und Frauenhäuser für misshandelte Frauen. Betty Friedan gründete im Zuge der Bürgerrechtsbewegung 1966 die feministische Frauenorganisation „NOW“ (National Organisation of Women) in den USA. Neben politischer und sozialer Gleichberechtigung ging es um die Revision der kulturellen Symbolsysteme (z.B.: Normalisierung der weiblichen grammatikalischen Formen)[56] Noch heute hat die Sprache Probleme damit, die Gleichrangigkeit der Geschlechter auszudrücken. In einigen Sprachen benützt man dasselbe Wort für Mensch und Mann. (z.B. England, Frankreich) Teilweise sieht das so aus, als ob der Mann das Grundmodell der Menschheit darstellt und die Frau lediglich eine Variation wäre.
Mit den Entwicklungen der Frauenbewegung in den 70er Jahren gab es in den USA parallel dazu eine kleinere Männerbewegung. Diese kleine Gruppe von Männern war der Meinung, dass die männliche Geschlechtsrolle die Männer unterdrücke und deshalb abgeschafft bzw. verändert werden müsste. Damit war der Startschuss für eine Männerforschung parallel zur feministischen Frauenforschung gegeben.[57] Das Thema Männlichkeiten und Mannsein existiert in Europa allerdings erst seit Anfang der 90er Jahre.[58] Ab diesem Zeitpunkt schien es nicht länger eindeutig zu sein, was ein „richtiger“ Mann ist oder zu sein hat oder was Männer überhaupt auszeichnet. Auf diesen Sachverhalt wird in Kap 5.2 („Veränderung der männlichen Rolle) genauer eingegangen.
Heutzutage sind die Geschlechter in den meisten hoch industrialisierten Staaten formal gleich gestellt. Machtungleichheiten sind von den Verfassungen verboten. Allerdings ist die Gleichstellung im Beruf oder eine gerechte Verteilung der Hausarbeit, noch keineswegs zur Selbstverständlichkeit geworden. Durch staatliche Maßnahmen der „Frauenförderung“ bzw. Antidiskriminierungsgesetze gibt es allerdings doch Bewegungen in den traditionellen geschlechtlichen Rollenmustern.[59]
2.2.4 Ansichten von Simone de Beauvoir im Jahre 1949
Simone de Beauvoir versucht in ihrem im Jahre 1949 erschienenen Werk „Das andere Geschlecht, Sitte und Sexus der Frau“ dem Leser eine selbständige Seins- und Wertbestimmung der Frau zu vermitteln, indem sie demütigende Traditionen und Benachteiligungen analysiert und zu beschreiben versucht, wie es zu solch einer Abwertung eines Teiles der Menschheit kommen konnte. Simone de Beauvoirs Werk bietet auf eine interessante und nachvollziehbare Art einen Einblick in die weibliche Wirklichkeit. Zu Beginn stellt sie die teils noch vorhandenen Fakten und Mythen vor, mit denen die Frau im Laufe ihrer historischen Vergangenheit zu kämpfen hatte. Weiters versucht sie über einige historische Fakten einen neuen Mosaikstein zur Beantwortung der Frage, wie die weibliche Wirklichkeit dargestellt und konstituiert worden ist, hinzuzufügen. Sie versucht unter anderem über die Existenzphilosophie, die vorgeschichtlichen und ethnologischen Gegebenheiten, zu begreifen, wie dieses Hierarchiegebilde zustande kommen konnte.
Die biologischen Voraussetzungen sind Tatsachen, denen keine Frau entrinnen kann. Simone de Beauvoir versucht zu Beginn diese biologischen Gegebenheiten zu ergründen, um herauszufinden, wie sich die weibliche Wirklichkeit konstituierte und warum die Frau als das „Andere“ definiert worden ist.
„Kein biologisches, psychisches, wirtschaftliches Schicksal bestimmt die Gestalt, die das weibliche Menschenwesen im Schoß der Gesellschaft annimmt. Bei Mädchen und Knaben ist der Körper zunächst die Ausstrahlung einer Ichheit, das Werkzeug, das die Erfassung der Welt vollzieht. Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es “.[60]
Mit dieser wohl bekanntesten Aussage beginnt der zweite Teil ihres Buches. Dieser Teil, der sich auf erlebte Erfahrungen von Frauen bezieht, vermittelt dem Leser mit welchen Schwierigkeiten eine Frau von Kindheit an zu kämpfen hat.
Die der Geburt und der Entwöhnung verläuft bei beiden Geschlechtern gleich, doch schon nach einem halben Jahr, also in dem Augenblick, wo das Kind sich im Spiegel erkennt, beginnt es sich seiner Identität bewusst zu werden. Indem es der Mutterbrust weggenommen wird, wird der Säugling entwöhnt, wodurch laut Simone de Beauvoir die Angst entsteht, verlassen zu werden.
„…hier [bei der Entwöhnung, Anm.] nun erscheinen die kleinen Mädchen zunächst bevorzugt. Eine zweite, langsamere Entwöhnung als die erste entzieht den Körper der Mutter den Umarmungen des Kindes. Dem Jungen werden nach und nach Küsse und Liebkosungen verweigert, das kleine Mädchen aber streichelt man weiter, es darf weiterhin am Schürzenzipfel der Mutter hängen, man sieht ihm seine Tränen und Launen nach, amüsiert sich über sein Mienenspiel und seine Koketterien.“[61]
Je älter das Kind wird, desto mehr erfährt es die männliche Überlegenheit. Zuerst wird es diese Rangordnung innerhalb der Familie erfahren.
„So ist die Passivität, die im Wesentlichen ein Charakteristikum der Frau sein wird, ein Zug, der sich in ihr von den ersten Jahren an entwickelt. Es ist jedoch falsch, wenn behauptet wird, sie sei biologisch bedingt[62]. In Wirklichkeit wird ihr ein Schicksal von ihren Erziehern und der Gesellschaft auferlegt.“[63] „Je mehr das Kind heranreift, je mehr sich seine Welt weitet, um so mehr bestätigt sich auch die männliche Überlegenheit.“[64] „Die Rangordnung der Geschlechter wird zunächst bei ersten Erfahrungen in der Familie klar. Das Leben des Vaters ist von einem geheimnisvollen Prestige umwoben. Er ernährt die Familie, er ist für sie verantwortlich, er ist ihr Haupt.“[65]
Alles was ein kleines Mädchen erfährt (sei es durch Märchen, Lieder oder literarische Werke) beinhaltet eine Verherrlichung des Mannes. In jedem Märchen sitzen die Frauen immer irgendwo gefangen und warten auf ihren Prinz, der sie als großer Abenteurer befreien wird.
„Mit zehn oder zwölf Jahren sind die meisten Mädchen eigentlich verfehlte Jungen. Die überströmende Lebensfreude wird in ihnen abgebremst, verkehrt sich so in Nervosität. Sie langweilen sich, und aus Langeweile überlassen sie sich romantischen Träumereien. Sie verlieren den Sinn für die Wirklichkeit. Da sie nicht handeln können, reden sie und untermischen dabei gern Vernünftiges mit Reden, die nicht Hand und Fuß haben.“[66]
Durch das Einsetzen der Periode verschlimmert sich laut Simone de Beauvoir der „Zustand“ und das junge Mädchen erfährt eine weitere „Demütigung“. Während der Pubertät wird dem weiblichen Geschlecht bewusst, dass ihre Zukunft ihr einen gänzlich anderen Weg vorgibt, als dem des männlichen Geschlechts. Der Junge kämpft zwar zu Beginn der Pubertät auch mit gewissen Schwierigkeiten, doch allmählich freut er sich über die Manneswürde und die Freiheit. Das Mädchen dagegen erfährt Grenzen.
„Ganz selbstverständlich werden sie dadurch [durch die Pubertät, Anm.] kokett und fangen an zu schauspielern. Ihr Unbehagen verrät sich in ihrer Ungeduld, in Zornesausbrüchen, in Weinkrämpfen. Sie neigen häufig zu Tränen. Es liegt darin ein Protest gegen die Härte des Schicksals und gleichzeitig eine Art, sich selbst als bemitleidenswert hinzustellen. Ihre meisten Konflikte beziehen sich auf ihr Verhältnis zur Familie. Man darf die Ursache solcher Phantasiegebilde bzw. kindlicher Tragödien nicht in der „geheimnisvollen“ weiblichen Seele, sondern in der Situation des Kindes suchen. Weil es eine Frau ist, weiß das Mädchen, […] dass tausend Abenteuer, tausend Freuden ihm versagt sind. Die Wonnen der Passivität sind es, die Eltern und Erzieher, Bücher und Mythen, Frauen und Männer dem kleinen Mädchen vorgaukeln.“[67]
In der Jugendzeit erlernt das Mädchen die weitere Zurückhaltung und wird regelrecht zur Selbstbeherrschung „genötigt“. Damit verliert sie ihre ursprüngliche Lebensfreude und dies führt in gewisser Weise zur Selbstaufgabe.
Simone de Beauvoir erörtert die biologischen Voraussetzungen und Tatsachen, mit denen Frauen sich identifizieren müssen. Aber nicht um der Frau die lebenslange Unterdrückung verständlich zu machen sondern um der Frau zu einer gewissen Akzeptanz ihrer Weiblichkeit zu verhelfen. Denn nur durch die Akzeptanz des „Unveränderbaren“ kann eine Frau zur inneren Freiheit gelangen. Die erdrückende Lage der Frauen wird erst richtig ersichtlich, wenn man wie Simone de Beauvoir in die Vergangenheit zurückblickt. Auf subtile Art und Weise bringt Simone de Beauvoir dem Leser, anhand ihrer geschilderten Erfahrungswerte, die teilweise ohnmächtige Lage der Frauen zum Ausdruck. Allerdings wird eine Befreiung der Frau nicht aufgrund eines Kampfes oder das „Aufleben“ der natürlichen Differenzierungen zwischen den Geschlechtern stattfinden, sondern nur aufgrund einer „gleichberechtigten, geschwisterlichen Freundschaft“ auf dem Niveau der Akzeptanz.
2.3 Entwicklungspsychologische Perspektive
Sollte man aus der Kenntnis eines einzigen Merkmals den Lebensweg eines Menschen voraussagen, dürfte die Geschlechtszugehörigkeit das beste Kriterium sein. Nicht nur das Individuum selbst ist mit seiner Geburt lebenslang männlich oder weiblich (von den seltenen Fällen einer Geschlechtsumwandlung einmal abgesehen), sondern es wird auch in eine Welt hineingeboren, in der nach männlich und weiblich unterschieden wird. Während die Natur bestimmt, ob wir männlich oder weiblich sind, legt die Kultur fest, was es bedeutet, weiblich oder männlich zu sein.[68] Jede Gesellschaft besitzt bestimmte Vorstellungen bezüglich geschlechtstypischer Verhaltensweisen. Diese Normen werden dem heranwachsenden Kind vorgeschrieben – das die Geschlechterrolle vorerst spielt und dabei unbewusst verinnerlicht.[69]
Die wissenschaftliche Entwicklungspsychologie nahm ihren Ursprung in erster Linie mit der von Charles R. Darwin (1809 – 1882) begründeten Evolutionstheorie, die auch das Interesse für die psychische Entwicklung des Menschen anregte. Die Entwicklungspsychologie beschäftigt sich mit den Veränderungen des Erlebens und Verhaltens im Laufe der Zeit.[70] Die Hauptfragestellung im Zusammenhang mit der Geschlechtsrollenentwicklung besteht darin zu untersuchen, auf welchem Wege Individuen Geschlechterstereotype und –Rollenerwartungen als kognitive Wissensbestände erwerben und Präferenzen bzw. Einstellungen entwickeln. (Z.B. ihre Geschlechterrolle positiv oder negativ bewerten) Wesentlich ist weiters, ob diese Einstellungen auch in das Verhaltensrepertoire aufgenommen werden. (Dieser Prozess wird auch als Geschlechtstypisierung bezeichnet.)
Der Aufbau und die Veränderungen der Geschlechtsidentität im individuellen Lebenslauf sind das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels biologischer, sozialer und individueller Entwicklungsbedingungen. Am Anfang steht die Festlegung des genetischen Geschlechts. An den äußeren sichtbaren Geschlechtsmerkmalen wird bei der Geburt das „Erziehungsgeschlecht“ bestimmt.[71] Endogene (Anlage-), exogene (Umwelt-) und autogene (Selbststeuerungs-) Faktoren bedingen und beeinflussen sich wechselseitig: alle drei Faktorengruppen sind voneinander abhängig und lassen gleichwertig die Entwicklung des Menschen voranschreiten.[72]
Es ist zwischen Geschlechtsidentität und Geschlechtsrollenidentität zu unterscheiden. Ersteres meint die Entwicklung einer stabilen Geschlechtsidentität als Mann bzw. Frau, die einen notwendigen Bestandteil in der Entwicklung eines Menschen darstellt. Im Allgemeinen fällt die Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt identifizierten und zugeschriebenen biologischen Geschlecht zusammen.[73] Die mit dem Geschlecht assoziierten Eigenschaften, Verhaltensweisen, Berufe usw. werden nicht nur als kognitive Konzepte erworben, sondern liefern die Grundlage für die Entwicklung der eigenen Geschlechtsrollenidentität.[74] Von unseren Eltern lernen wir also nicht nur die Stereotype (unser Wissen um die typischen Eigenheiten der Geschlechter), sondern auch, was angemessen ist bzw. von ihnen erwartet wird: die Geschlechtsrollenerwartungen.[75] Kinder erwerben also neben ihrer biologisch fundierten Geschlechtsidentität eine psychologisch und sozial determinierte Geschlechtsrollenidentität.
Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Eltern in der Erziehung nicht geschlechtsneutral verhalten, sie leben geschlechtstypisches Verhalten vor und verstärken typisch weibliches und typisch männliches Verhalten ihrer Kinder. Bei vielen Eltern und Erziehern zeigen sich Vorlieben für typisch männliches oder weibliches Spielzeug, typisch männliche oder weibliche Kleidung und eine Einteilung der Umwelt in männlich oder weiblich.
Alfermann[76] zeigt durch ein einfaches Schema, wie sich geschlechtsspezifische Verhaltensweisen entwickeln bzw. festigen können:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Entwicklung geschlechtsspezifischer Verhaltensweisen[77]
Buben und Mädchen, die sich selbst schon als männlich bzw. weiblich einschätzen können, lernen auf diesem Weg welches Verhalten angemessen ist. Sind diese Verhaltensweisen erst einmal verinnerlicht, sind sie meist irreversibel.[78]
Interessant in diesem Zusammenhang sind Unterschiede zwischen Mutter-Kind- und Vater-Kind-Beziehungen:[79]
- Mütter sind häufiger und länger mit ihren Kindern zusammen als Väter
- Väter übernehmen weniger Betreuungsfunktionen
- Der relative Anteil spielerischer Aktivitäten ist in der Vater-Kind-Interaktion größer als in der Mutter-Kind-Interaktion
- Väter interagieren mit ihren Kindern häufiger in der Eltern-Kind-Triade, Mütter häufiger in der Mutter-Kind-Dyade
- Der Erziehungsstil der Väter ist weniger restriktiv als der der Mütter
- Väter beschäftigen sich mehr mit ihren Söhnen als mit ihren Töchtern
- Mütter dagegen beschäftigen sich mit Söhnen und Töchtern etwa gleich viel Klarerweise gibt es auch Gemeinsamkeiten von Mutter-Kind- und Vater-Kind-Beziehungen:[80]
- Das Kind ist Mutter und Vater genetisch gleich ähnlich (bis auf das Geschlecht)
- In traditionellen Familien hat das Kind den längsten und bis etwa zum Jugendalter auch den intensivsten Kontakt mit Mutter und Vater unter allen erwachsenen Bezugspersonen
- Mutter und Vater unterstützen typischerweise das Kind mehr als alle anderen Erwachsenen, wozu sie genetisch prädisponiert sowie moralisch und juristisch verpflichtet sind
- Väter können Unterstützungsfunktionen genauso gut ausüben wie Mütter
- Das Kind entwickelt typischerweise eine Bindung an Mutter und Vater, die enger ist als an alle anderen Erwachsenen
Dass Väter anders mit ihren Kindern umgehen als Mütter, ist empirisch gut belegt. Einige Unterschiede lassen sich direkt auf generelle Geschlechtsunterschiede in Einstellungen und Verhalten zurückführen. Interessant ist, dass Väter sich umso mehr mit ihren Kindern beschäftigen, je angenehmer die Tätigkeit für sie ist, während die notwendigen aber weniger attraktiven Tätigkeiten eher von den Müttern erledigt werden.
Die psychologische Forschung zur Geschlechterdifferenzierung kann man im Wesentlichen in drei Gruppen unterteilen:
- Geschlecht als individuelles Merkmal
- Geschlecht als soziale Kategorie und
- Geschlecht als Dimension der Selbstwahrnehmung und Informationsverarbeitung
Individuelles Merkmal:[81] Die große Mehrzahl der Untersuchungen setzt die Geschlechtsvariable mit dem biologischen Geschlecht gleich. In einer Variante dieses Forschungsansatzes werden Personengruppen mit einem unterschiedlichen psychologischen Geschlecht, d.h. mit einem maskulinen, femininen oder androgynen Selbstkonzept gegenübergestellt.
Soziale Kategorie:[82] Unter dieser Perspektive wird das Geschlecht als eine bedeutsame soziale Kategorie betrachtet, mit der bestimmte Rollenerwartungen und Rollendifferenzierungen verknüpft sind. Es stellt sich die Frage, welchen Unterschied es – in einem konkreten sozialen Kontext – macht, männlich oder weiblich zu sein.
Dimension der Selbstwahrnehmung und Informationsverarbeitung:[83] Im Vordergrund steht hier die Selbstwahrnehmung als männlich oder weiblich. Die Selbstwahrnehmung beruht auf folgenden Informationsquellen:
- Wahrnehmung und Beobachtung von Attributen der eigenen Person
- Vergleich von Attributen der eigenen Person mit denen anderer Personen
- Soziale Reaktionen auf eigenes Verhalten
Im Folgenden wird auf die Entwicklung der Geschlechtsidentität in der Kindheit, in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter eingegangen:
2.3.1 Geschlechtsidentität in der Kindheit
Säuglinge halten ab dem dritten Lebensmonat, spätestens jedoch mit sechs Monaten die Stimmen männlicher und weiblicher Erwachsener auseinander und können ab dem neunten Monat männliche und weibliche Gesichter unterscheiden. Allerdings wären Kinder in diesem Alter noch nicht in der Lage, die Frage „Bist Du ein Junge (Mädchen)?“ korrekt zu beantworten. Dies gelingt erst mit zweieinhalb bis drei Jahren. Ab dem dritten Lebensjahr orientiert sich die Wahl bzw. Ablehnung von Spielsachen oder Spielaktivitäten zunehmend am Kriterium der Geschlechtsangemessenheit. Die Geschlechterrollen werden eher wie absolut gültige Naturgesetze eingeordnet, statt als kulturell vereinbarte soziale Konventionen verstanden. In diesem Alter gewinnen auch geschlechtshomogene Gruppen als Kontext, in dem Kinder soziale Erfahrungen sammeln, größere Bedeutung. Im Kindergarten lässt sich schon erkennen, dass kleine Buben vermehrt mit Buben, kleine Mädchen vermehrt mit Mädchen, spielen. Eine Befragung von Kindern im Kindergartenalter hat ergeben, dass Jungen ihre Geschlechtsgenossen „schlauer“ und „attraktiver“ finden als Mädchen, die ihnen „langweilig“ und „ängstlich“ vorkommen. Demgegenüber schätzen Mädchen an ihren Geschlechtsgenossinnen, dass sie „friedlicher“ und „angenehmer“ im Umgang sind als Jungen, die ihnen „böse“ und „wild“ erscheinen.[84] Ein Hauptunterschied zwischen den Geschlechtern besteht hier, dass Jungen intensiver als Mädchen Dominanzhierarchien aufbauen und darauf aus sind, ihren Status zu sichern. Das Kind erwirbt sein geschlechtstypisches Verhalten als Mann oder Frau durch Nachahmung (Lernen am Modell) und durch Verstärkung seitens anderer Personen.[85]
[...]
[1] Vgl. Knapp, G. A. (2001): S. 73
[2] Vgl. Tiger, L. (1972): S. 69
[3] Vgl. Tiger, L. (1972): S. 109
[4] Vgl. Tiger, L. (1972): S. 15
[5] Vgl. Alfermann, D. (1996): S. 10
[6] Vgl. Alfermann, D. (1996): S. 29f.
[7] Vgl. Alfermann, D. (1996): S. 59
[8] Vgl. Becker-Schmidt, R. (2001): S. 42
[9] Vgl. Staines, G. L. / Libby, P. L. (1986): S. 211
[10] Vgl. Becker-Schmidt, R. (2001): S. 21
[11] Vgl. Alfermann, D. (1996): S. 35
[12] Vgl. Katz, P. A. (1986): S. 48
[13] Vgl. Solomon, M. et al (2001): S. 229
[14] Vgl. Goebel, J. (1999): S. 101
[15] Vgl. Kilian, H. (1959): S. 116
[16] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 26
[17] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 43
[18] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 24
[19] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 26f.
[20] Vgl. Kilian, H. (1959): S. 17
[21] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 145
[22] Vgl. Oliver, M. B. (1993): S. 29ff.
[23] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 251
[24] Vgl. Alfermann, D. (1996): S. 157f.
[25] Vgl. Asendorpf, J. / Banse, R. (2000): S. 174
[26] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 220
[27] Ideal ist ein Taille-Hüfte-Verhältnis von 3:4, beispielsweise sollte die Taille bei einer Hüfte von 80 cm circa 60 cm betragen. Frauen mit derartigen Rundungen weisen meist einen höheren Östrogenspiegel auf und bekommen mehr Kinder.
[28] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 221
[29] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 443f.
[30] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 403
[31] Vgl. Nolen-Hoeksema, S. / Rusting, C. L. (1999): S. 336
[32] Vgl. Bettencourt, B. A. (1996): S. 422ff.
[33] Vgl. Alfermann, D. (1996): S. 135
[34] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 187
[35] Vgl. Asendorpf, J. / Banse, R. (2000): S. 168f.
[36] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 188
[37] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 477
[38] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 364f.
[39] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 188
[40] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 146
[41] Vgl. Buss, D. M. (2004): S. 147
[42] Vgl. Becker-Schmidt, R. (2001): S. 14
[43] Vgl. Schwanitz, D. (1999): S. 526ff.
[44] Vgl. Schwanitz, D. (1999): S. 531
[45] Vgl. Schwanitz, D. (1999): S. 532
[46] Vgl. Schwanitz, D. (1999): S. 533
[47] Vgl. Schwanitz, D. (1999): S. 534
[48] Vgl. Schwanitz, D. (1999): S. 535
[49] Vgl. Becker-Schmidt, R. (2001): S. 17
[50] Vgl. Schwanitz, D. (1999): S. 538
[51] Vgl. Schwanitz, D. (1999): S. 539
[52] Vgl. Schwanitz, D. (1999): S. 536
[53] Vgl. Treinen, H. / Brothun, M. (1973): S. 277f.
[54] Vgl. Schwanitz, D. (1999): S. 538
[55] Vgl. Schwanitz, D. (1999): S. 540
[56] Vgl. Schwanitz, D. (1999): S. 540
[57] Vgl. Connell, R. (1999): S. 43
[58] Vgl. Möller, K. (1997): S. 23
[59] Vgl. Becker-Schmidt, R. (2001): S. 27f.
[60] Beauvoir, S. de (1949): S. 334
[61] Beauvoir, S. de (1949): S. 337
[62] Es handelt sich hier um eine Sichtweise, nicht um einen empirisch nachweisbaren Sachverhalt.
[63] Beauvoir, S. de (1949): S. 339
[64] Beauvoir, S. de (1949): S. 401
[65] Beauvoir, S. de (1949): S. 402
[66] Beauvoir, S. de (1949): S. 404
[67] Beauvoir, S. de (1949): S. 406
[68] Vgl. Trautner, H. M. (2002): S. 648
[69] Vgl. Klöhn, E. (1979): S. 14
[70] Vgl. Hobmair et al (1997): S. 196
[71] Vgl. Trautner, H. M. (2002): S. 656
[72] Vgl. Hobmair et al (1997): S. 201
[73] Vgl. Alfermann, D. (1996): S. 57
[74] Vgl. Solomon, M. et al (2001): S. 223
[75] Vgl. Alfermann, D. (1996): S. 25
[76] Vgl. Alfermann, D. (1996): S. 67
[77] Vgl. Alfermann, D. (1996): S. 67
[78] Vgl. Mischel, W. (1966): S. 141
[79] Vgl. Asendorpf, J. / Banse, R. (2000): S. 70
[80] Vgl. Asendorpf, J. / Banse, R. (2000): S. 71
[81] Vgl. Trautner, H. M. (2002): S. 650
[82] Vgl. Trautner, H. M. (2002): S. 650f.
[83] Vgl. Trautner, H. M. (2002): S. 651
[84] Vgl. Trautner, H. M. (2002): S. 657
[85] Vgl. Trautner, H. M. (2002): S. 658f.
- Arbeit zitieren
- Mag. Viktoria Schmidt (Autor:in), 2005, Sozialisationsvorteile androgyner Menschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38153
Kostenlos Autor werden


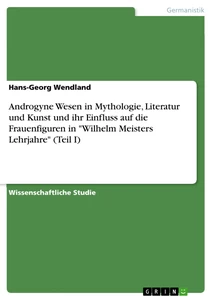
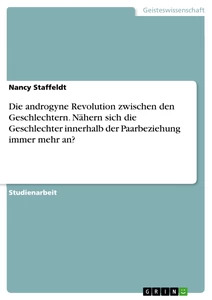
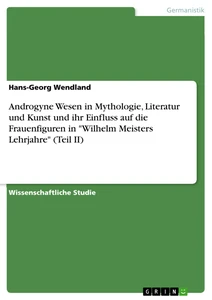















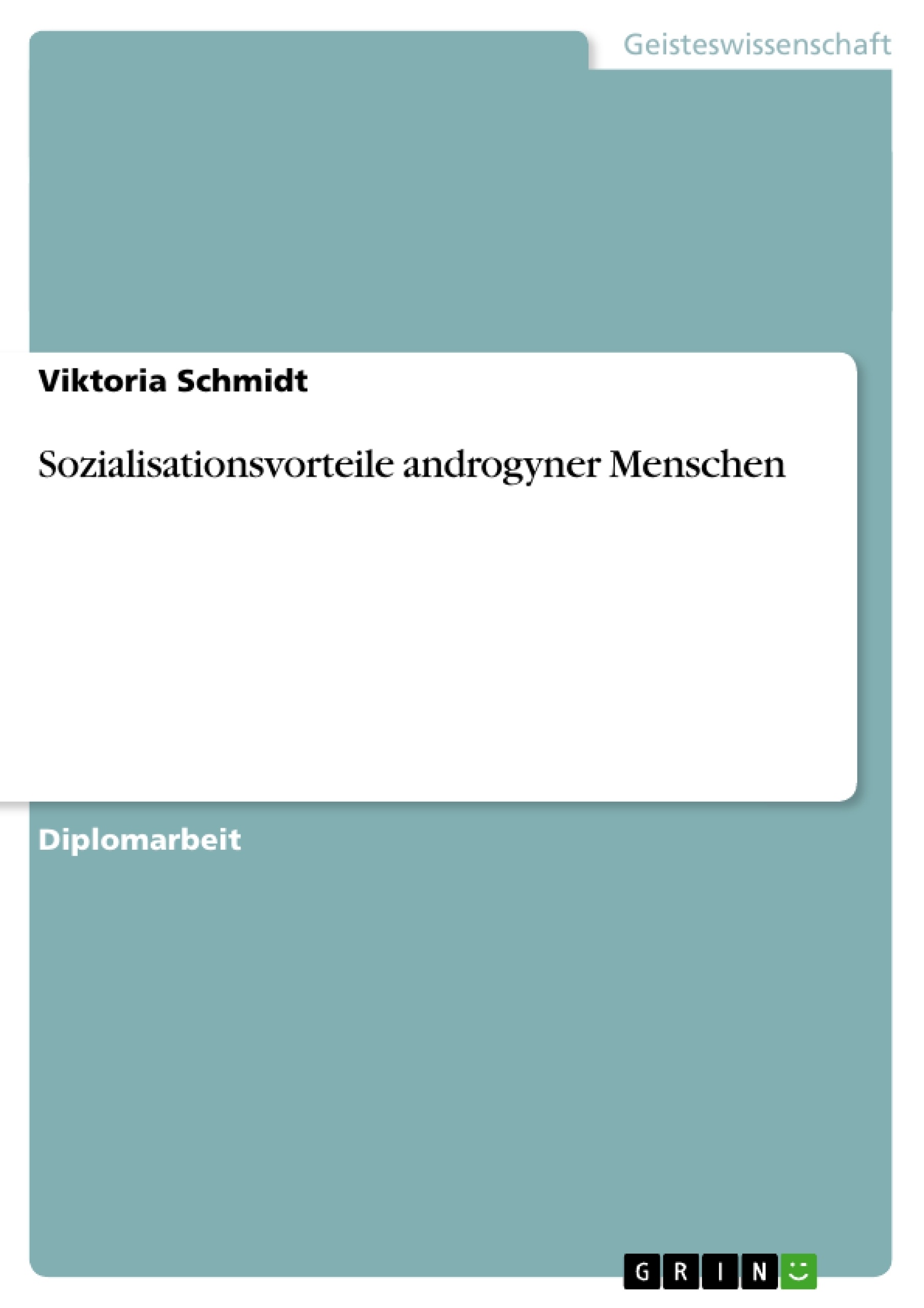

Kommentare