Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Legitimation der Thematik
1.2 Wege der Bearbeitung und Darstellung
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Alkoholismus
2.2 Menschen mit geistiger Behinderung und Suchtmittel
2.3 Prävention
3 Problemstellung
4 Modell
4.1 Multiprofessionelle Herangehensweise
4.2 Zielgruppe
4.3 Didaktische Rahmenbedingungen
4.4 Methodische Handlungsansätze
4.5 Ziele
5 Schluss
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis in Tabellenform
Handbuch zur Alkoholprävention Für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Vorwort
-> Hinter jeder Sucht, steckt eine „SehnSucht“ –
ein Sehnen nach Liebe und Geborgenheit, die Suche nach
Herausforderungen, an denen man wachsen kann, nach
Anerkennung und dem Gefühl etwas wert zu sein. <<
(Suchtpräventionsstelle der Diakonie Würzburg)
1 Einleitung
Im Im Zuge der aktuellen Gender-Diskussion soll in dieser Arbeit davon abgesehen werden, aus Gründen der Leserfreundlichkeit das männliche Geschlecht stellvertretend zu benutzen. Da die Sprache eines der bedeutendsten Ausdrucksmittel unserer Gesellschaft ist und durch diese aktiv Werte vermittelt werden, wird bei der Ausarbeitung dieser Arbeit auf gendergerechte Sprache geachtet. Daher werden gendergerechte Formulierungen, wenn möglich genutzt. Sollte dies im Satz nicht möglich sein, werden geschlechtsspezifische Paarformen (zum Beispiel Schülerinnen und Schüler) oder geschlechtsneutrale Bezeichnungen (zum Beispiel Lehrkräfte) verwendet. Bei der expliziten Nennung von Autorinnen oder Autoren im Text werden Vor- und Nachname genannt, um das Geschlecht kenntlich zu machen.
1.1 Legitimation der Thematik
Das Bewusstsein darüber, dass auch Menschen mit einer geistigen Behinderung süchtig werden können und die Auseinandersetzung mit diesem Problem haben sich erst in den letzten Jahren entwickelt. Gerade durch die Paradigmenwechsel in der Heil- und Sonderpädagogik, von der Institutionalisierung hin zur Normalisierung und Inklusion, entsteht ein Bild des Teilhabegedankens, welches sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens mit einschließt (vgl. Kvas 2009, 17). Mehr Teilhabe bedeutet auch gleichzeitig mehr Verantwortung und fordert den reflektierten Umgang mit der Umwelt und ihren vielfältigen Angeboten. In diesen Kontext lässt sich die ausgewählte Thematik dieser Arbeit einordnen und die Notwendigkeit ihrer Thematisierung legitimieren, denn Alkohol und andere Suchtmittel sind als Teil des gesellschaftlichen Lebens in unseren Kulturkreisen zu betrachten.
Peter Schinner bezeichnete das Themengebiet als Neuland in wissenschaftlicher und berufspraktischer Hinsicht, denn es handelt sich bei der „Alkohol- und Suchtproblematik“ um ein sehr junges Thema im Bereich der Heil- und Sonderpädagogik, welches bislang weitgehend unbeachtet oder sogar vernachlässigt worden ist. Diese Tatsache hat zur Folge, dass noch nicht auf normierte Daten zurückgegriffen werden kann und man sich lediglich mit einem Maß an Bescheidenheit und Respekt dem Problem nähern und Lösungsansätze entwickeln kann (vgl. Schinner 2000, 3). Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie wenige Studien zeigen, dass das Thema „Suchtmittelgebrauch von Menschen mit geistiger Behinderung“ besonders im Rahmen von zunehmender Selbstbestimmung und Inklusion zu behandeln ist (vgl. Beer 2003, 77ff). Seit den 80er Jahren werden von Forscherinnen und Forschern aus dem amerikanischen Raum Studien betrieben, welche deutlich machen, dass der durchaus positive Gewinn von Autonomie die Gefahr des uneingeschränkten Zugangs zu alkoholischen Getränken mit sich bringt. Dies wird durch die Ausbreitung ambulant betreuter Wohnformen begünstigt und erhöht das Risiko, ein problematisches Trinkverhalten zu entwickeln (vgl. Beer 2003, 102ff). Es ist schwer festzustellen, ob es sich um ein Phänomen handelt, welches erst durch Integration und stetige Deinstitutionalisierung signifikant wird oder ob das Thema bisher sogar bewusst tabuisiert wurde, weil zwei große Problembereiche unserer Gesellschaft hier aufeinandertreffen. Behinderung und Alkoholismus bilden zwei Diskussionspunkte schon für sich allein, zusammen scheinen sie eine Welle neuer Probleme und vor allem die Forderung nach neuen Maßnahmen zu stellen. Die Entwicklung spezifischer Konzepte und Therapiemöglichkeiten für diese besondere Zielgruppe erfordert die Aufmerksamkeit und Zuwendung verschiedenster Professionen. So stellt sich ein neues Aufgabenfeld dar, welches auf interdisziplinäre Weise erschlossen werden sollte und es ist anzunehmen, dass die Problematik in Zukunft stärker thematisiert werden wird (vgl. Beer 2003, 77ff).
1.2 Wege der Bearbeitung und Darstellung
Den zuvor benannten, problematischen Entwicklungen widmet sich diese Arbeit in theoretischer sowie praktischer Weise, wodurch sie sich in zwei grobe Abschnitte strukturieren lässt: Ziel des theoretischen Teils ist es, die Problemlage der Alkoholabhängigkeit von Menschen mit einer geistigen Behinderung zu erfassen.
Dazu beschäftigt sich Kapitel 2 in wissenschaftlicher Weise und auf Grundlage von Literaturrecherchen mit den Fragestellungen:
Gibt es die Problematik der alkoholkranken Menschen mit geistiger Behinderung?
Wie wird der Thematik aktuell begegnet?
Wo finden sich Zusammenhänge zwischen Alkoholprävention und Sonderpädagogik?
Kapitel 3 ist als Überleitung von der Theorie zur Praxis zu sehen. Hier werden die ersten Fragestellungen zusammenfassend beantwortet und gleichzeitig eine neue aufgeworfen: Wie kann Prävention im schulischen Setting der Problematik begegnen?
Das praktische Ziel ist die Erstellung eines Modells zur Suchtprävention. Die Zielgruppe stellt dabei die Berufsschulstufe von Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung dar. In Kapitel 4 finden sich dazu Überlegungen, Strukturierungen und die theoretische Ausarbeitung der Konzeption, wobei sich die praktischen Ideen, Arbeitsblätter und Methoden in dem separaten Praxisheft befinden. Das Modell versteht sich als Sammlung von Präventionsmöglichkeiten, welche an Förderschulen für geistige Entwicklung eingesetzt werden können, um dem Problem des Alkoholmissbrauchs in der Zielgruppe frühestmöglich zu begegnen und Menschen vor einer Flucht in den unreflektierten Alkoholkonsum oder gar in die Alkoholabhängigkeit zu bewahren.
Zur besseren Orientierung wird der Aufbau der vorliegenden Arbeit näher beschrieben und die Ziele der einzelnen Kapitel formuliert.
Kapitel 2 widmet sich den theoretischen Grundlagen, wobei die Themen stets im Kontext mit dem Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung bearbeitet werden. An dieser Stelle ist anzumerken, dass Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen in diesem Themenkomplex weniger Beachtung finden werden, da sie durch fehlenden Zugang zu stofflichen Suchtmitteln nicht primär gefährdet sind, eine Alkoholabhängigkeit zu entwickeln (vgl. Klauß 2008, 7).
Angeregt durch Gespräche mit der Suchtpräventionsfachstelle der Diakonie Würzburg sowie der Aktualität und Brisanz des Themas, werden in der theoretischen Auseinandersetzung drei Säulen errichtet, um sich dem Themenkomplex strukturiert und sinnhaft nähern zu können:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Theoretische Säulen der Arbeit (eigene Darstellung)
Abgeleitet vom Titel sollen sie das theoretische Fundament bilden und Erkenntnisse stützen, welche zur Erstellung des Praxisheftes notwendig sind.
Kapitel 2.1 trägt den übergeordneten Titel „Alkoholismus“ und präsentiert in 2.1.1 einleitend die Droge Alkohol selbst. Dabei werden die Geschichte des Alkoholkonsums, die Stellung der Droge in der Bundesrepublik Deutschland, die rechtlichen Grundlagen des Alkoholkonsums sowie die Wirkung der Substanz im menschlichen Körper beschrieben. Kapitel 2.1.2 widmet sich dem Entstehungsprozess von Alkoholabhängigkeit. Dazu wird gezielt ein multifunktioneller Erklärungsansatz herangezogen und beleuchtet. 2.1.3 definiert die Begriffe Sucht und Abhängigkeit und grenzt diese voneinander ab. Dies ist für ein besseres Verständnis der Problematik wichtig. 2.1.4 beschäftigt sich mit den physischen und psychischen Folgen von Alkoholismus und schließt dadurch die sachliche Bearbeitung der ersten Säule ab. In 2.2 wird der Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung in Zusammenhang mit dem Thema Suchtmittel betrachtet. Da es sich dabei um den Personenkreis handelt, welcher in dieser Arbeit primär behandelt wird, soll der Versuch einer Definition des Begriffs „geistige Behinderung“ präsentiert werden. Weiterhin wird das Problembewusstsein in Deutschland ermittelt. Es wird dazu darauf eingegangen, wie das Problem des Suchtmittel- beziehungsweise Alkoholkonsums von Menschen mit geistiger Behinderung wahrgenommen und wie mit dem Phänomen umgegangen wird. In den beiden Unterkapiteln 2.2.3 und 2.2.4 geht es weiterführend um die Vulnerabilität, also die Anfälligkeit für Alkoholabhängigkeit und um die Prävalenz, also die Häufigkeit der Erkrankung von Menschen mit geistiger Behinderung an alkoholbedingter Abhängigkeit.
In Kapitel 2.3 wird anschließend die Säule „Prävention“ behandelt. Dazu werden unterschiedliche Formen von Prävention erklärt und ihre Eignung für das schulische Setting analysiert. In 2.3.1 wird ein Vergleich von Leitlinien der Suchtprävention mit den didaktischen Prinzipien der Sonderpädagogik beschrieben, um Schwerpunkte für eine wirkungsvolle Alkoholprävention im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung herauszufiltern. Dazu werden Ansätze der Prävention betrachtet, welche Anknüpfungspunkte für die praktische Arbeit bieten und eine Vernetzung von Suchtprävention und Sonderpädagogik ermöglichen. Um sich der schulischen Suchtprävention weiter anzunähern, wird in 2.3.2 der Lehrplan des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung für Berufsschulstufen betrachtet und Bezüge zur Alkoholprävention vorgestellt. Das in Kapitel 2 erschlossene Wissen bildet insgesamt das sachspezifische Fundament für folgende praktische Überlegungen.
Dazu wird in Kapitel 3 die Problematik erneut aufgeworfen und anhand der Erkenntnisse aus der theoretischen Arbeit zusammenfassend diskutiert. Aufgeworfene Fragen und Vermutungen werden an dieser Stelle beantwortet. Dadurch wird zu dem praktischen Teil der Arbeit übergeleitet.
Kapitel 4 stellt sich als praktischer Teil der Arbeit dar und beschreibt ein selbst entwickeltes Praxismodell, welches der bearbeiteten Problemstellung präventiv begegnen soll. Der Fokus liegt dabei auf der schülerorientierten Alkoholprävention im schulischen Setting.
Durch die Strukturierung des vierten Kapitels wird versucht, das Konzept von der breiten Erkenntnislage aus Kapitel 2 langsam zu verdichten, um am Ende die Ziele des Modells treffend formulieren zu können. Dazu werden Überlegungen zu den Themen „Multiprofessionelle Herangehensweise“, „Zielgruppe“, „didaktische Rahmenbedingungen“ und „methodische Handlungsansätze“ angestellt. In 4.6 werden sich Nachforschungen und Gedanken schließlich zu den Zielen des Modells zuspitzen. Das entwickelte Modell, welches als eine Art Bausteinkasten für die Alkoholprävention in Klassen der Berufsschulstufe von Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung aufgebaut ist, wird als eigenständiges Werk bereitgestellt. Es finden sich darin praktische Ideen, Methoden, Materialien, Arbeitsblätter und Vorlagen für eine abwechslungsreiche Suchtprävention. Damit stellt dieses Werk eine Art Pilotmodell dar, da es bisher nur sucht- bzw. alkoholpräventive Programme für Regelschulen oder Betriebe gibt. Durch die Sammlung von Präventionsprogrammen für Regelschulen, Besprechungen mit der Suchtpräventionsfachstelle der Diakonie Würzburg und Internetrecherchen wurden aus vielen Methoden und eigenen Überlegungen geeignete Lernbereiche und Materialien herausgefiltert, modifiziert, erarbeitet und auf die Zielgruppe ausgelegt.
Kapitel 5 stellt abschließend die Erkenntnisse und Erfahrungen dar, welche während der theoretischen und praktischen Arbeit gewonnen werden konnten. Es beinhaltet außerdem aktuelle Entwicklungen im Hinblick auf das erstellte Praxismodell und gibt einen Ausblick auf mögliche Perspektiven.
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Alkoholismus
Alkoholismus bezeichnet die Alkoholkrankheit als Abhängigkeit von der Substanz Ethanol, welche als Alkohol bekannt ist. Bei der Entwicklungsdiagnose einer Alkoholabhängigkeit müssen unterschiedliche Aspekte beachtet werden. Diese Bedingungsfaktoren sind als komplexes Gefüge zu sehen, welche sich dynamisch und wechselwirkend beeinflussen (vgl. Soyka und Küfner 2007, 20f).
2.1.1 Die Droge Alkohol
Alkohol ist die am häufigsten und stärksten konsumierte Substanz in Deutschland. Unter dem umgangssprachlichen Begriff Alkohol versteht man den Wirkstoff Ethylalkohol oder Ethanol, welcher oral konsumiert und legal vertrieben wird (vgl. Kuntz 2005, 110). Die Substanz kann aus verschiedenen Rohstoffen wie Zuckerrohr, Getreide oder Früchten durch die Vergärung von Zucker gewonnen werden. Der Begriff ist auf das arabische Wort „al-kuhl“ zurückzuführen, welches ursprünglich „feines Pulver“ bedeutete (vgl. Schill et al. 2004, 15).
Geschichte des Alkoholkonsums Seitdem sich Menschen in Schrift und Bild ausdrücken, berichten sie von der Herstellung und der Verwendung von Alkohol. Babylonische Keilschriften führten Alkohol in Lohnlisten auf, die Technik des Bierbrauens wurde in Ägypten auf einem alten Königsgrab hinterlassen. Viele Schriften erzählen davon, wie sich auch Römer und Griechen an alkoholischen Getränken erfreuten (vgl. Noack 1980, 279). Alkohol ist in das Leben der Menschen fast jeder Kultur eingebunden. Diese Tatsache hat nicht nur mit der Wirkung zu tun, welche der Alkohol auf den menschlichen Körper und seine Sinne hat. Die alkoholische Gärung war in vorgeschichtlicher Zeit die wichtigste Methode, um Lebensmittel über längere Zeit haltbar zu machen (vgl. Noack 1986, 30). Durch die neu entdeckte Möglichkeit der Destillation konnte im Mittelalter aus Wein, Getreide und Kartoffeln hochprozentiger Alkohol hergestellt und langfristig gelagert werden (vgl. Schill et al. 2004, 15). Arbeiter und Tagelöhner wurden zu diesen Zeiten häufig mit alkoholischen Getränken bezahlt. Diese Handhabung führte mit der frühkapitalistischen Industrialisierung zu den ersten Formen von Alkoholismus. Sämtliche Versuche, die Herstellung und den Konsum von Alkohol wieder einzudämmen, wie zum Beispiel die Prohibitionsmaßnahmen in Amerika, scheiterten (vgl. Kuntz 2005, 110). Heute sind alkoholische Getränke in sämtlichen nicht-islamischen Ländern nahezu unbegrenzt verfügbar, käuflich zu erwerben und haben sich im Laufe der Zeit so weit entwickelt, dass sie in unserer Gesellschaft und Kultur einen festen Platz eingenommen haben und nur schwer wegzudenken sind.
Alkohol in Deutschland
In den 1950er - Jahren betrug der jährliche pro Kopf Verbrauch reinen Alkohols in Deutschland 3,2 Liter. In den darauf folgenden Jahren war ein ständiger Anstieg des Konsums zu notieren. Für das Jahr 1980 wurde ein Verbrauch von 12,9 Litern ermittelt, welcher bis heute -laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung- nur leichten Schwankungen unterliegt und nahezu stagniert (vgl. Schill et al. 2004, 30). Alkohol kann als Volksdroge unserer Gesellschaft bezeichnet werden, welche gesellschaftlich anerkannt und integriert ist. Die Substanz wird nicht als problematisches Suchtmittel gesehen, sondern ganz bewusst zu einer Vielzahl von verschiedenen Anlässen konsumiert. Wir nutzen Alkohol als Lebensmittel um unseren Durst zu stillen, als Genussmittel zu gutem Essen oder als Gesellschaftsmittel bei Festen und feierlichen Anlässen. Doch auch bei Angst, Stress, Sorgen, Problemen oder Langeweile wird Alkohol konsumiert (vgl. Jahn 2001, 81). Besonders in Gesellschaft, also beim sozialen Trinken, gibt es viele Bräuche und sprachliche Wendungen, die den Alkohol zu einem Teil von Geselligkeit machen. Trinkrituale, wie sich zuprosten, Brüderschaft trinken, auf etwas Trinken und etliche weitere, tragen zur Heiterkeit während des sozialen Trinkens bei (vgl. Noack 1986, 32). Bei jungen Leuten sind Trinkspiele besonders beliebt und können sogar den Grund für ein Treffen darstellen. Deutschland kann aufgrund dieser Entwicklung und der verbreiteten Einstellung gegenüber der Substanz zu den „Permissivkulturen“ gezählt werden, in denen Alkoholkonsum zu Mahlzeiten oder Festen als selbstverständlich angesehen wird, Trunkenheit und Konsum in unangebrachten Situationen oder Mengen jedoch als negativ bewertet werden (vgl. Noack 1986, 34).
Diese Toleranz und Selbstverständlichkeit gegenüber dem Konsum von Alkohol werden dann unverständlich, wenn Zahlen zu Folgeschäden wie Unfällen oder kriminellen Delikten betrachtet werden. Denn Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit stellen in Deutschland das größte sozialmedizinische Problem dar (vgl. Schill et al. 2004, 31).
„Bestimmungsgemäß ist Alkohol zwar ein Genussmittel. Es gibt jedoch kein zweites Suchtmittel, das derart regelmäßig missbraucht wird. Alkohol führt zu mehr menschlichen und familiären Dramen sowie zu höheren gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Gesamtschäden, als alle illegalen Drogen zusammengenommen“ (Kuntz 2005, 112).
Der Konsum von Alkohol ruft einige Effekte hervor, welche als positiv angesehen werden. Dazu zählen Emotionen wie Sich- frei- fühlen von Stress und Angst, bessere Stimmung, Euphorie, Befreiung von Unsicherheiten und das Gefühl, Dinge schaffen zu können. Allerdings beeinflusst übermäßiger oder regelmäßiger Konsum der Substanz das Gegenteil. Wenn eine Gewöhnung oder Abhängigkeit entsteht, zeigen sich eher destruktive als konstruktive Verhaltensmuster (vgl. Haveman und Stöppler 2014, 150). Die Flucht in die Alkoholsucht kann als ein Weg aus belastenden Situationen erlebt werden. Bis heute gibt es eine ambivalente Einstellung gegenüber Alkoholproblemen in Deutschland: Einerseits sind sie seit 1968 gesetzlich als Krankheit festgeschrieben, andererseits wird Alkoholismus als schuldhaftes Fehlverhalten angesehen (vgl. Lindenmeyer 1999, 1f).
Rechtliche Grundlage
Da es das praktische Ziel dieser Arbeit ist, ein Präventionsmodell zu entwickeln, welches im Jugendalter ansetzt, wird an dieser Stelle auf die rechtlichen Grundlagen des Konsums von Alkohol eingegangen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Menschen mit oder ohne geistige Behinderung handelt, da diese Gesetze für alle Menschen gleichermaßen gelten. §9 des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) widmet sich im Rahmen des „Jugendschutzes in der Öffentlichkeit“ alkoholischen Getränken, deren Verzehr und Verkauf. Demnach ist es in Gaststätten, Verkaufsstellen oder in der Öffentlichkeit verboten, Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein enthalten, an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren abzugeben oder ihnen den Verzehr zu gestatten. Als branntweinhaltige Getränke gelten alle hochprozentigen Getränke wie Schnaps, Liköre oder Mischungen wie Wodka mit Orangensaft.
Andere alkoholische Getränke, wie zum Beispiel Wein und Bier, dürfen nicht für Kinder und Jugendliche unter sechzehn Jahren zugänglich gemacht werden. Allerdings dürfen diese Getränke an Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren ausgeschenkt werden, wenn diese von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.
Alkohol im menschlichen Körper
Alkohol wird zumeist oral aufgenommen und fast vollständig im Magen-Darm-Trakt des menschlichen Körpers resorbiert. Dabei werden 20% im Magen und der überwiegende Rest im oberen Dünndarm verarbeitet. Ein geringer Teil gelangt über die Mundschleimhaut und die Speiseröhre in das Blut, wodurch bereits wenige Minuten nach dem Konsum Alkohol im Blut feststellbar ist. Durch Blutstrom und Diffusion verteilt sich der Alkohol im Körper. Wie schnell sich dieser Ablauf vollzieht, wird durch einige Umstände bedingt: der Alkoholkonzentration des Getränkes, dem Füllzustand des Magens, der Durchblutung der Schleimhäute, dem Ausmaß der Bewegungsvorgänge im Magen-Darm-Trakt, der Wasserverteilung im Organismus, dem Zuckergehalt des Getränkes. So können rasches Trinken, gesüßte oder warme Getränke, ein leerer Magen oder Aufregung die Resorption und damit die Wirkung des Alkohols beschleunigen (vgl. Schill et al. 2004, 18). Weiterhin hängt die Resorptions- und Diffusionsgeschwindigkeit von der allgemeinen physischen und psychischen Verfassung des Konsumenten und der Gewöhnung des Körpers an Alkohol ab. Die Wirkung von Alkohol kann aufgrund dieser Variablen nicht genau vorhergesagt werden. Ungefähr 30 – 60 Minuten nach der Einnahme wird die höchste Alkoholkonzentration im Blut erreicht, die Informationsübertragung der Nervenzellen wird dann durch die Freisetzung des Transmitters Dopamin beeinflusst (vgl. Schott 2011, 33). Dieser Transmitter hat je nach Dosierung der Droge erregende oder hemmende Effekte auf die Synapsen im Gehirn des Menschen (vgl. Schill et al. 2004, 18). Alkohol kann somit weder den stimulierenden, noch den sedierenden Substanzen zugeordnet werden. Geringe Dosierungen wirken sich meistens enthemmend und stimmungshebend aus. Sie verursachen ein gesteigertes Kontakt- und Kommunikationsbedürfnis. Höhere Konsummengen können jedoch zu dämpfenden Effekten wie Ermüdung oder Benommenheit führen (vgl. Schott 2011, 33). Obwohl Alkohol das am stärksten tolerierte Suchtmittel ist, birgt er ein enorm hohes gesundheitliches Gefährdungspotenzial, welches durch die ständige Verfügbarkeit und Präsenz in unserer Gesellschaft noch bedenklicher wird.
„In unserer Gesellschaft stoßen wir mit Alkohol auf die Gesundheit an. […] Dabei ignorieren wir, dass Alkohol Zellgift ist, das abhängig von der konsumierten Menge massiv schädigend auf Organe und Organsysteme einwirkt, wobei es bei längerfristiger Einnahme zu irreversiblen Schädigungen kommt“ (Schill et al. 2004, 21).
Die toxische Wirkung der Substanz greift sogar bei einmaligem übermäßigen Konsum das vegetative Nervensystem, die Blutzuckerwerte, die Gehirnzellen, die Koordination, den Stoffwechsel der Leber und weitere wichtige Körperfunktionen und Organe an (vgl. Noack 1980, 278). „Aus medizinischer Sicht gibt es keinen risikofreien Alkoholkonsum“ (Schill et al. 2004, 18). Die Schäden der Gesundheit steigen mit dem sinkenden Lebensalter, wodurch eine Prävention in der Kindheit oder Jugend notwendig wird, um frühzeitig vor Krankheiten zu schützen (vgl. Noack 1980, 273).
2.1.2 Entstehung
Die Abhängigkeit zur Droge Alkohol hat im Gegensatz zu einigen anderen Drogen eine relativ lange Entstehungsdauer, da sie sich über Konsum, Genuss, Gewöhnung zu Missbrauch und Sucht entwickelt. Die Grenzen zwischen normalem, von der Gesellschaft akzeptiertem und genussvollem Konsum hin zu dem Missbrauch der Substanz sind fließend und treffen in verstärkter Form auf Norm- und Wertvorstellungen der Umwelt (vgl. Niebaum 2001, 98).
Seit etwa den 1970er Jahren werden Erklärungsmodelle für die Entstehung von Sucht bzw. Abhängigkeit entwickelt (vgl. Schott 2011, 36). Dabei entstanden (und entstehen) Modelle aus den Perspektiven verschiedenster Wissenschaftsbereiche, sodass mittlerweile auf biologische, lerntheoretische, sozialpsychologische, soziologische, psychoanalytische, persönlichkeitsbezogene oder existentielle Theorien zurückgegriffen werden kann. Es ist zu beachten, dass keine dieser Theorien allein den ganzen Umfang einer Suchtentstehung erfassen kann und es viele Überschneidungen zwischen den unterschiedlich ausgerichteten Ansätzen gibt (vgl. Waibel 1993, 15). Eine monokausale Betrachtungsweise kann die Ursache eines solch komplexen Problems nicht erklären (vgl. Metzinger 2012, 5).
„Vielmehr ist die Entwicklung einer Abhängigkeit multifaktoriell bedingt, denn Sucht ist niemals nur ein individuelles Problem, sie wird immer auch durch soziale und gesellschaftliche Einflüsse mit ausgelöst“ (Metzinger 2012, 5).
Zugunsten der Übersicht und eines besseren Verständnisses soll hier deswegen ein multifaktorielles Suchtmodell kurz erläutert werden, welches in Deutschland weithin als akzeptiertes Modell für die Analyse, Erklärung und Beschreibung von Sucht gilt: Das Trias-Modell. Das Modell wurde schon im Jahr 1973 entwickelt und fungiert bis heute in einigen Theorien und präventiven Ansätzen als theoretisches Fundament (vgl. Laging 2005, 129).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Trias der Entstehungsursachen von Sucht (vgl. Laging 2005, 129)
Das Modell verfolgt eine bio-psycho-soziale Herangehensweise und betrachtet Sucht als ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren aus den Bereichen Person/Persönlichkeit, Umwelt/gesellschaftliche Bedingungen und Droge (vgl. Kammerer 2000, 13). Dabei wird davon ausgegangen, dass alle suchtbegünstigenden oder auch suchtverhindernden Faktoren einer dieser drei Haupteinflussquellen zugeordnet werden können. Mehrfaktorenmodelle dieser Art beruhen auf einer Vielzahl von korrelativen Zusammenhängen, bei denen es keine Begrenzung der Variablen gibt (vgl. Laging 2005, 129). Einzelne Faktoren können die Entstehung von Sucht dabei nicht separat erklären und müssen immer in ihrer Wechselwirkung mit anderen Variablen betrachtet werden (vgl. Kammerer 2000, 14). Das Trias-Modell lässt allgemein keine klaren Diagnosen über die Suchtentwicklung bei einer individuellen Person zu. Da die relevanten Faktoren sich von Person zu Person unterscheiden und es nicht möglich ist, die tatsächlichen Ursachenzusammenhänge in ihrer Gänze zu erfassen, handelt es sich bei dem Modell vielmehr um eine Art Gefäß, in dem Forschungsergebnisse zu einzelnen Faktoren gebündelt werden (vgl. Laging 2005, 130). Das Modell bietet einen Überblick und leitet dazu an, den Mensch in seiner Umwelt zu betrachten und Wechselwirkungen zu beachten.
Bernd Kammerer (2000, 14f) schlüsselt die drei Hauptquellen der Suchtentstehung des Trias-Modells auf und bezieht dabei ebenfalls aktuelle und zeitgemäße Gedanken mit ein. Diese sind für die hier behandelte Thematik besonders interessant, da sie Anknüpfungspunkte für die Faktoren der Suchtentstehung bei Menschen mit einer geistigen Behinderung liefern, welche in Punkt 2.2.3 eingehender betrachtet werden. Bei suchtkranken Menschen mit geistiger Behinderung sind häufig spezifische Besonderheiten und dadurch Verschärfungen dieser Bedingungen vorzufinden. Diese resultieren aus verschiedenen psychosozialen Belastungsfaktoren wie Störungen der Identitätswahrnehmung und des Selbstwertgefühls aufgrund fehlender Zuwendung, mangelnden Kompensationsmöglichkeiten basierend auf intellektuellen und emotionalen Einschränkungen, mangelnde oder fehlende Entwicklung von Möglichkeiten der Selbstbestimmung sowie mangelnder oder fehlender sozialer Integration (vgl. Schinner 2000, 5).
Die folgende Aufzählung möglicher Variablen nach Bernd Kammerer (2000, 14f) zeigt, in welchen Bereichen Probleme entstehen können. Sie erlaubt außerdem eine Reflexion über die Lebensumstände von Menschen mit geistiger Behinderung in unserer Gesellschaft, welche sich von denen der Menschen ohne Behinderung in Teilen signifikant unterscheiden.
Variablen des Faktors Person:
- Körperliche Faktoren
- Psychische Disposition
- Frühkindliche Erfahrungen
- Mangel an Selbstverantwortlichkeit, Selbstvertrauen
- Psychosoziale Kompetenz
- Emotionale Erlebnisfähigkeit
- Biomedizinische Faktoren
- Existentielle Frustration, Unerfülltsein, Sinnverlust
Variablen des Faktors Umwelt:
- Soziale Schichtzugehörigkeit
- Allgemeine Lebensbedingungen
- Alter und Geschlecht
- Familiensozialisation, Familienstruktur, Elternhaus, Erziehungsstil, Familienklima
- Einfluss sozialer Gruppen
- Konsumgewohnheiten
- Einstellungen zu Suchtmitteln
- Möglichkeiten der Alltagsbewältigung und Alltagssituation
- Werbung
- Normen, Werte, Bedingungen
- Unerfüllte elementare Bedürfnisse des Individuums
- Überfordernde Konflikte
- Mangel an Perspektiven
- Zunahme von Trennungen und Scheidungen
- Entwicklungsmöglichkeiten
- Stressoren und Belastungen jeglicher Art in den Bereichen:
- Schule, Partnerschaft, Arbeitssituation, Gesellschaft/erwartetes Verhalten
Variablen des Faktors Droge:
- Wirkungsweise
- Einnahmeart
- Dauer der Einnahme
- Geschmack
- Dosis
- Suchtpotential
- Verfügbarkeit und Griffnähe
- Image des Suchtmittels
- Preis
- Angebot, Marktlage
- Gesellschaftliche Akzeptanz
- Kulturspezifische Befindlichkeit
- Symbolische Bedeutung
- Reiz des Verbotenen
Eine weitere Bearbeitung des Trias- Modells nahm Klaus Hurrelmann (1997, 18ff) vor. Er setzte das Modell zur Abhängigkeitsentwicklung in Beziehung zu dem von ihm entwickelten Gesundheitskonzept. In diesem beschreibt er Gesundheit als Balanceakt, durch den das Individuum seine innere und äußere Umwelt ständig in Einklang bringen muss, um seine Selbstbestimmung zu erhalten. Der Konsum von Drogen wird in diesen dynamischen Prozess eingebunden und dazu genutzt, die persönlichen Ressourcen zu stärken. Dabei wird deutlich, dass sich Drogen nicht instrumentalisieren lassen, da ihre Wirkung nicht vorhersagbar ist und sie dadurch physische und psychische Risikofaktoren darstellen (vgl. Laging 2005, 130).
„Der unkontrollierte Drogengebrauch ist […] Ausdruck einer zumindest problematischen Form der Lebensbewältigung, insofern zwar auch ein Versuch der Bewältigung von Belastungen, aber auch ein inadäquater Versuch: Die Droge wird zu dem Problem, als dessen Lösung sie sich ausgibt“ (Hurrelmann und Bründel 1997, 9).
So wird die Droge als Mittel der Problembewältigung und Sucht als Ausdruck einer gestörten Gesundheitsbalance gesehen, welche das Ziel hat, die Person mit der Umwelt in Einklang zu bringen (vgl. Hurrelmann und Bründel 1997, 19f).
Zusammenfassend und im Hinblick auf den Personenkreis ist festzuhalten, dass Menschen mit Behinderung den gleichen Faktoren der Suchtentstehung ausgesetzt sind wie Menschen ohne Behinderung, sie jedoch häufig mit weiteren oder stärkeren Stressoren umgehen müssen. Zudem können durch kognitive Beeinträchtigungen Fähigkeiten zur Bewältigung solcher Belastungen eingeschränkt sein und problematische Lösungsstrategien entstehen. Eine Sucht entwickelt sich dabei in direkter Wechselwirkung von Person, Umwelt und Droge und ist mit den Versuchen der Problembewältigung während der Phase der Integration in die spezifische Umgebung in direkten Zusammenhang zu bringen.
2.1.3 Sucht und Abhängigkeit
Die Begriffe Sucht und Abhängigkeit werden in der Praxis synonym verwendet. Allerdings spricht der Begriff „Sucht“ auch Anteile des Verhaltens und Erlebens an und geht dadurch über das allgemeine Verständnis von „Abhängigkeit“ hinaus (vgl. Kammerer 2000, 12). Aus diesem Grund werden die beiden Begriffe im Folgenden definiert und voneinander abgegrenzt.
Das Wort „Sucht“ stammt etymologisch von dem gotischen „siukan“ ab, welches „kranksein“ bedeutete (vgl. Kammerer 2000, 12). Im Germanischen wurde es zu „siech“, wobei sich eine Ähnlichkeiten mit dem entsprechenden englischen Wort „sick“ (= krank, übel, unwohl) zeigt (vgl. Waibel 1993, 12). Der heute verwendete Begriff „Sucht“ ist mehrdeutig und lässt sich zum einen als Krankheit und zum anderen als Laster verstehen (vgl. Jahn 2001, 19). Sucht wird dabei häufig auch als eine Form des Sehnens und Suchens gesehen. „Wären wir nicht Suchende unser Leben lang, wir wären keine Menschen mehr oder schon am Ziel“ (Koob 1992, 34). Obwohl es sich beim Sehnen um ein existentielles Gefühl des menschlichen Wesens handelt, lässt es sich nur schwer im Worte fassen (vgl. Koob 1992, 21).
„Die Frage nach der Sinngebung des Lebens, die Suche nach Inhalten, nach Glück und nach innerer Zufriedenheit, vielleicht auch nach Erfolg als positiver Verstärker, die Flucht vor Unzufriedenheit und die Angst vor Frustration als negative Verstärker geben dem Suchenden Richtlinien vor“ (Jahn 2001, 21).
Die Sehnsucht lässt sich also als eine übermächtige Kraft beschreiben, welche zu Verlangen und einer Suche nach Ersatzbefriedigungen führen und sich dabei zu einer Sucht im Sinne einer zerstörerischen Krankheit ausdehnen kann (vgl. Koob 1992, 21). Im alltäglichen Sprachgebrauch verwenden wir das Wort für Verhaltensweisen, welche unnormal oder störend wirken wie Arbeitssucht oder Geltungssucht (vgl. Kammerer 2000, 12). Weiterhin werden auch übersteigerte Gefühlsformen wie Habsucht, Tobsucht oder Eifersucht mit dem Begriff verknüpft. Durch diesen Zusammenhang wird deutlich, dass „Sucht“ auch tiefste emotionale Vorgänge des Menschen aufgreift. „Eine suchtartige Entwicklung kann in vielen Verhaltensbereichen vorkommen, denn kein Bedürfnis des Menschen ist instinktartig begrenzt“ (Kammerer 2000, 12). Von einer Sucht spricht man im Zusammenhang mit Emotionen aber erst dann, wenn durch die Aufgabe von Kontrolle ein Verlust entsteht, man sich und Mitmenschen durch das Verhalten stört, aber dennoch keine alternativen Handlungsmöglichkeiten finden kann. Aufgrund des Verlustes der persönlichen Freiheit kann auch eine emotionale Sucht die Persönlichkeit des Menschen beeinträchtigen (vgl. Kammerer 2000, 12).
„Sucht ist also als Krankheit im psychosozialen Kontext zu verstehen, die eben nicht unbedingt an bestimmte chemische Substanzen gebunden ist, sondern an die abhängige Persönlichkeit“ (Jahn 2001, 25).
Unterschieden wird auch aus diesem Grunde zwischen nicht-stoffgebundenen und stoffgebundenen Suchtformen (vgl. Jahn 2001, 25). Da die Doppeldeutigkeit und das weite Verständnis des Begriffs problematisch sind, um Krankheitssymptome und Verhaltensweisen unmissverständlich und trennscharf zu beschreiben, diagnostizieren und beurteilen, hat die WHO (Weltgesundheitsorganisation) das Wort „Sucht“ durch „Abhängigkeit“ ersetzt (vgl. Kammerer 2000, 12). In einer gekürzten Definition der WHO ist Drogenabhängigkeit ein psychischer und zum Teil auch physischer Zustand, der aus der Wechselwirkung zwischen einem lebenden Organismus und einer Droge hervorgeht und einen unwiderstehlichen Zwang hervorruft, die Droge ständig oder periodisch zu konsumieren, um ihre Wirkung zu erleben oder um unerträgliche Abstinenzsymptome zu beseitigen (vgl. Petermann und Roth 2006, 15f). Mit dieser Definition wird in der Literatur häufig gearbeitet, da sie das allgemeine Verständnis von Sucht bzw. Abhängigkeit eindeutig und verständlich wiedergibt.
Medizinische Klassifikationssysteme wie DSM (Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen) oder ICD-10 (internationale Klassifikation der Krankheiten; engl. International Classification of Diseases) orientieren sich an dem Begriff der „Substanzabhängigkeit“. Sie benennen Kriterien, anhand derer eine Drogenabhängigkeit festgestellt werden kann. Da in der Praxis mit beiden Systemen gleichermaßen gearbeitet wird, sollen sie an dieser Stelle Erwähnung finden. Sie sind im Kontext dieser Arbeit nicht nur für das grundlegende theoretische Verständnis wichtig, sondern auch für die schulpraktische Arbeit im Hinblick auf das entwickelte Präventionsmodells relevant. Helmut Kuntz hält die Kriterien für Abhängigkeit der beiden Klassifikationssysteme in eigenen Worten verständlich fest (vgl. Kuntz 2005, 42ff):
DSM-IV:
Mindestens drei der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein, um die Diagnose der „Substanzabhängigkeit“ zu stellen.
1. Toleranzentwicklung, die gekennzeichnet ist durch:
a. Verlangen nach einer Dosissteigerung, um die gewünschten Wirkungen herbeizuführen,
b. deutlich verminderte Wirkung bei fortgesetzter Einnahme der gleichen Dosis des Mittels.
2. Entzugssymptome, die sich äußern durch:
a. charakteristische Entzugserscheinungen für die Substanz
b. dieselbe oder eine ähnlich wirkende Substanz wird eingenommen, um Entzugssymptome zu lindern oder zu vermeiden.
3. Die Substanz wird häufiger in größeren Mengen oder länger als beabsichtigt genommen.
4. Anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Substanzgebrauch zu verringern oder zu kontrollieren.
5. Viel Zeit für Aktivitäten, die Substanz zu beschaffen, sie zu sich zu nehmen oder sich von ihren Wirkungen zu erholen.
6. Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden auf Grund des Substanzmissbrauchs aufgegeben oder eingeschränkt.
7. Fortgesetzter Substanzmissbrauch trotz Kenntnis eines anhaltenden oder wiederkehrenden körperlichen oder psychischen Problems, das durch den Substanzgebrauch verursacht wurde.
ICD-10:
Drei der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein, um die Diagnose stellen zu können:
1. Starker Wunsch oder unabwendbarer innerer Zwang, psychoaktive Substanzen zu konsumieren,
2. verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich Beginns, Beendigung und Menge des Substanzkonsums,
3. Substanzgebrauch mit dem Ziel, auftretende seelische Entzugssymptome zu vermeiden oder umgehend zu mildern,
4. merkliche körperliche Entzugserscheinungen bei Beendigung oder Einschränkung des Konsums,
5. spürbare Toleranzentwicklung, Gewöhnung an höhere Dosen der Droge, um die gleiche Wirkung zu erzielen,
6. fortschreitende Vernachlässigung anderer Aktivitäten und Interessen sowie ein erhöhter Zeitaufwand, um sich von den Folgen des Konsums zu erholen,
7. anhaltender Suchtmittelkonsum trotz nachweislich schädigender Folgen,
8. eingeengtes Verhaltensmuster im Umgang mit der Substanz.
Die Klassifikationssysteme lassen durch ihre Vielschichtigkeit erahnen wie unscharf sich eine Drogenabhängigkeit abbilden lässt. Etwa ebenso schwer wie die Diagnose fällt auch die Benennung der Erkrankung. Denn ähnlich verschwommen wie der Begriff Sucht ist der Begriff Alkoholismus, welcher jedoch wegen seiner Handlichkeit und Verständlichkeit dennoch häufig genutzt wird (vgl. Soyka und Küfner 2007, 7).
In der ICD-10 findet sich aufgrund der Vielschichtigkeit von Alkoholabhängigkeitserkrankungen ein Katalog von Störungsbildern, die durch den Konsum von Alkohol verursacht werden können. Diese Systematik hat das Ziel, die Schwammigkeit des Begriffes Alkoholismus aufzulösen und einen eindeutigeren Sprachgebrauch sowie differenziertere Diagnosemöglichkeiten zu fördern.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (ICD-10-GM-2014 2014)
In dieser Arbeit werden die Begriffe Alkoholismus, Alkoholabhängigkeit und Alkoholsucht synonym und in Abgrenzung zu Alkoholmissbrauch und Alkoholkonsum verwendet, um das Thema möglichst verständlich, dennoch differenziert und fachlich korrekt zu betrachten. Obwohl der Begriff Sucht viele Definitionen verkörpert, ist es in dieser Arbeit legitim, ihn zu benutzen. Denn auch das Bedingungsgefüge einer Abhängigkeitsentstehung ist als komplex und vielschichtig anzusehen und die emotionale Ebene sollte besonders bei der präventiven Arbeit nicht außer Acht gelassen werden.
2.1.4 Folgen
Der missbräuchliche Genuss von Alkohol kann mit Folgen und Schäden verbunden sein, welche physischer, psychischer oder auch sozialer Art sein können. Dies gilt für Menschen mit geistiger Behinderung genauso wie für Konsumenten ohne Behinderung (vgl. Beine 2003, 18). Nahezu alle Organe können durch regelmäßigen Alkoholkonsum geschädigt werden, wobei es nicht relevant ist, ob schädlicher Gebrauch oder Alkoholabhängigkeit vorliegt (vgl. Haase 2009, 13).
„Durch süchtiges Verhalten möchte der Mensch Lustgefühle erlangen und Unlustgefühle und Spannungen abbauen – das Bedürfnis nach kleinen und großen Fluchten aus den Realitäten des Alltags wächst“ (Füssel 1998, 7).
Da Folgen solcher Fluchten häufig gleichzeitig Anlass und Grund für Alkoholkonsum sind, lassen sich Überschneidungen bei der Beschreibung dieser nicht vermeiden (vgl. Soyka und Küfner 2007, 233). Weil es nicht zielführend ist, im Rahmen dieser Arbeit auf sämtliche Folgen von Alkoholismus einzugehen, wird der Versuch angestellt, diese unter den Oberbegriffen „physisch“ und „psychosozial“ weitestgehend zusammenzufassen und dabei besonders spezifische Auswirkungen zu fokussieren, welche für Menschen mit geistiger Behinderung bedeutsam sein können. Da der Suchtmittelgebrauch von Menschen mit Behinderung in Deutschland bisher kaum thematisiert wurde, gibt es nur wenige Informationen oder Fakten zu spezifischen Folgeproblemen des Personenkreises. Trotzdem wird an dieser Stelle der Versuch angestellt, Folgeprobleme im Hinblick auf die speziellen Lebensumstände und Besonderheiten der Zielgruppe darzustellen.
Physische Folgen
Folgeerkrankungen von chronischem Alkoholkonsum erstrecken sich über sämtliche Bereiche der Medizin. Sie zeigen sich in der inneren Medizin, Neurologie, Dermatologie, Chirurgie, Orthopädie und Psychiatrie (vgl. Soyka und Küfner 2007, 175–232).
Die häufigsten Störungen durch Alkohol im Bereich der inneren Medizin sind Leberschäden. Die Leber ist in Bezug auf den Alkoholabbau das wichtigste Organ im Körper des Menschen, daher hat chronischer Alkoholkonsum in relevanten Mengen hier eine direkte toxische Wirkung (vgl. Soyka und Küfner 2007, 175). Alkohol wirkt sich außerdem schädigend auf Blutzuckerwerte, Atmung, Herzfrequenz und Kreislauf aus (vgl. Noack 1980, 279). Neurologische Schädigungen betreffen in erster Linie das Gehirn, können aber durch morphologische und funktionelle Veränderungen direkte Auswirkungen auf die Psyche des Menschen haben (vgl. Soyka und Küfner 2007, 205). Unter solche Störungen lassen sich das Wernicke-Korsakow-Syndrom, die alkoholische Kleinhirnatrophie, die alkoholische Polyneuropathie und der alkoholische Tremor einordnen. Insbesondere die Ganglienzellen des Gehirns reagieren empfindlich auf Alkohol. Bei jedem Rausch können bis zu zehn Millionen dieser nicht regenerierbaren Zellen absterben (vgl. Noack 1980, 278). Ebenfalls möglich sind Schlaganfälle oder epileptische Anfälle (vgl. Soyka und Küfner 2007, 205–219). Es ist bisher nicht bekannt, ob sich chronischer Alkoholkonsum bei Menschen mit einer geistigen Behinderung anders auswirkt. Allerdings wurde durch verschiedene Verfahren herausgefunden, dass verlangsamte Grundtätigkeit des Gehirns, Frequenzsenkungen, Schrumpfungen von Nervenzellen, Zerfall, Wucherungen sowie eine signifikante Reduktion der Durchblutung des zentralen Nervensystems von Alkohol verursacht werden (vgl. Soyka und Küfner 2007, 205f). Alkohol setzt dadurch nachweislich die intellektuelle Leistungsfähigkeit herab, wobei zunächst das logische Denken beeinträchtigt wird. Je nach Dosis ist zudem die Gedächtnisleistung betroffen, wobei am stärksten das unmittelbare Behalten beeinträchtigt und bei hohen Dosen ebenfalls das Langzeitgedächtnis geschädigt wird (vgl. Noack 1980, 279). Folgeerscheinungen und -störungen sind für Menschen mit geistiger Behinderung besonders relevant, da ihre hirnorganischen Schädigungen häufig schon mit Wahrnehmungsstörungen einhergehen (vgl. Kvas 2009, 18). Denkbar ist also, dass Schädigungen durch Alkoholkonsum in einem bereits beeinträchtigten System gravierende Auswirkungen haben und frühzeitig zu Folgeerkrankungen und Leistungsabbau führen können. Ein weiterer zu beachtender Punkt ist, dass viele Menschen mit geistiger Behinderung auf Medikamente angewiesen sind und diese in ihrer Wirkung durch Alkohol erheblich verändert werden können. Durch den Konsum von Alkohol können dadurch bedrohliche und lebensgefährliche Situationen entstehen (vgl. Haveman und Stöppler 2014, 291; Kvas 2009, 18).
Psychosoziale Folgen
Psychosoziale Auswirkungen von Alkoholismus sind bei Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen relevant. Häufig tritt dabei das Phänomen auf, dass es sich nicht nur um Folgen, sondern auch um Ursachen des Konsums handelt. Alkoholkonsum beeinflusst zunächst kurzfristig das aktuelle Verhalten und erst in langer Sicht Persönlichkeit und Umwelt des Konsumenten. Das problematische Verhalten ruft dabei Reaktionen des sozialen Umfeldes hervor (vgl. Soyka und Küfner 2007, 233). Charakteristisch ist die veränderte Persönlichkeitsstruktur während der Alkoholabhängigkeit. Diese wird als „perimorbid“ bezeichnet und ist gekennzeichnet durch eine erhöhte Depressivität, geringes Selbstwertgefühl, geringe Frustrationstoleranz und erhöhte Psychopathiewerte im Sinne stärkerer sozialer Devianz in den Einstellungen und Verhaltensweisen des Menschen (vgl. Soyka und Küfner 2007, 235). Diese typische Persönlichkeitsform zeigt interessanterweise viele Merkmale und Eigenschaften, welche der Mensch mit dem Alkohol zu bekämpfen versucht. Eine weitere Steigerung dieses Verhaltens findet man in der alkoholischen Hirnschädigung und Wesensänderung. Diese ist charakterisiert durch eine verlangsamte Psychomotorik, verlangsamtes Denkvermögen, Mangel an Konzentrationsfähigkeit, Abschwächen der motorischen und sensorischen Fähigkeiten sowie einer Reihe von Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderungen wie Reduktion von Initiative und Motivation, Unzuverlässigkeit, Gleichgültigkeit, depressive Grundstimmung und teilweise aggressivem Verhalten (vgl. Soyka und Küfner 2007, 235f). Diese Veränderungen übertragen sich auf die soziale Ebene und beeinflussen freundschaftliche oder partnerschaftliche Beziehungen, das Familienleben, das Sexualleben und das Berufsleben.
„Wenn man Untersuchungsergebnisse über Alkoholmenge und die verschiedenen sozialen Konsequenzen zusammenfasst, dann zeigt sich, wie zu erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit negativer sozialer Folgen mit ansteigendem Alkoholkonsum zunimmt“ (Soyka und Küfner 2007, 244).
Solche negativen, sozialen Folgen können Arbeitsplatzverlust, Unfälle oder Kriminalität sein, sich darüber hinaus auf den privaten Bereich übertragen und Trennungen, emotionale Schmerzen oder Einsamkeit hervorrufen. Spezifische soziale Folgeprobleme ergeben sich insbesondere aus der besonderen Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung, welche zumeist an ein hohes Maß von Fremdbestimmung oder Kontrolle geknüpft ist. Durch das Leben in pädagogisierten Institutionen oder betreuten Wohnformen, in denen der Alkoholkonsum zumeist nicht gestattet ist, kommt es häufiger zu Grenzüberschreitungen und regelwidrigem Verhalten. Dies kann zu Sanktionen durch das Betreuungspersonal und Ablehnung durch Mitbewohner führen und in der Folge Schuldgefühle hervorrufen, das Selbstwertgefühl des Menschen schwächen und im schlechtesten Falle den Wunsch nach erneuter Kompensation durch die Droge erzeugen (vgl. Schinner 2000, 4).
2.2 Menschen mit geistiger Behinderung und Suchtmittel
2.2.1 Geistige Behinderung – Versuch einer Definition
Es ist nicht möglich, den Begriff „geistige Behinderung“ mit einem Satz zu definieren, da er sich nicht auf charakteristische oder allgemeingültige Merkmale festlegen lässt (vgl. Fornefeld 2009, 59). Da es sich jedoch um den Personenkreis handelt, welcher in dieser Arbeit im Mittelpunkt steht, wird an dieser Stelle der Versuch angestellt, ihn zu beschreiben und in seiner Komplexität verständlich zu machen. Es kann sich dabei in diesem Rahmen nicht um eine vollständige Erfassung sämtlicher Perspektiven auf den Begriff „geistige Behinderung“ handeln und beinhaltet insofern präferierte Erklärungsansätze der Autorin.
Geistige Behinderung hat man nicht, man ist es nicht, sie ist keine gesundheitliche Störung oder psychische Krankheit. Sie ist zu sehen als ein Zustand, welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten in verschiedenen Lebensbereichen beeinträchtigen kann. Man kann sie sich vorstellen als Raum, in dem sich der Mensch entfaltet und in dem er mit seiner Umwelt im Rahmen seiner Möglichkeiten agiert (vgl. AAMR 2002). „Definieren bedeutet immer festlegen und zwar endgültig (,definitiv`)“ (Speck 1999, 40). Einer solchen Festlegung strebt man in der Sonderpädagogik entgegen, da die Einzigartigkeit jedes Menschen und somit auch jeder einzelnen Behinderung nicht greifbar ist. Durch den reflektierten und in gewissem Maße auch flexiblen Umgang mit der Begrifflichkeit werden mehr Möglichkeiten der Entwicklung eröffnet sowie Eingrenzung und Stigmatisierung entgegengewirkt. Die versteckte Offenheit des Begriffs wird durch seine semantische Zusammensetzung deutlich. Der Begriff „Geist“ eignet sich eigentlich nicht für eine wissenschaftliche Operationalisierung, da er selbst unzählige Definitionen und Deutungen mit sich bringt. Wenn man allerdings im Zusammenhang mit „Behinderung“ das „Geistige“ als intellektuelle Funktion bestimmt, wird der Begriff verständlicher. Der Begriff „Behinderung“ stellt ein komplexes System aus verschiedenen Teilbegriffen dar, welche sich gegenseitig bedingen: organische Schädigungen (des zentralen Nervensystems), individuelle Persönlichkeitsfaktoren sowie soziale Bedingungen und Einwirkungen. Aus dem Zusammenwirken dieser Faktoren entsteht erst die Auffassung von „Behinderung“, welche zumindest in Deutschland gängig ist (vgl. Speck 1999, 39). Der Begriff stellt ein großes Thema und anthropologisches Problem in vielen Diskussionen dar. Besprochen wird die Zuschreibung von Defiziten, Stigmatisierung und Möglichkeiten der Verwendung anderer Begrifflichkeiten. Trotz dieser Probleme blieb der Terminus im alltäglichen, wissenschaftlichen und juristischen Bereich bisher bestehen. Allerdings wurde dazu übergegangen, die defizitäre Sichtweise ein Stück weit aufzubrechen, indem man die kategoriale Festschreibung vermeidet und eine allgemeine Bezeichnung voranstellt, um die Behinderung als sekundäres und nicht alleiniges Merkmal festzulegen (zum Beispiel Jugendliche mit geistiger Behinderung) (vgl. Fornefeld 2009, 61).
„Geistige Behinderung“ als wissenschaftlicher Begriff bedarf aufgrund seiner Verwendung einer Klassifikation, auf welche an diesem Punkt eingegangen werden muss, um den fokussierten Personenkreis zu definieren. Es existieren verschiedene anerkannte Kategorien, welche die Kommunikation zwischen Disziplinen ermöglichen und den (internationalen) wissenschaftlichen Austausch erleichtern sollen. In dieser Arbeit wird zunächst auf das Klassifikationssystem der ICD-10 eingegangen, da dies durch die suchtpräventive Ausrichtung des Themas und die dadurch entstehende Verknüpfung mit dem Fachbereich der Sozialen Arbeit sinnvoll erscheint. Die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD, engl.: International Classification of Diseases) ist ein weltweit anerkanntes Diagnoseklassifikationssystem, welches im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Es wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) regelmäßig aktualisiert und den Fortschritten der Medizin angepasst. Momentan liegt die zehnte Version des Systems vor. Die seit 2004 existierende, deutsche Fassung nennt sich ICD-10-GM (vgl. Fornefeld 2009, 66f). Geistige Behinderung wird hier wie folgt beschrieben:
„Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzstörung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten. Der Schweregrad einer Intelligenzstörung wird übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. Diese können durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung in der jeweiligen Umgebung erweitert werden. Diese Messmethoden erlauben eine ziemlich genaue Beurteilung der Intelligenzstörung. Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit durch einen erfahrenen Diagnostiker ab. Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern. Sie können sich, wenn auch nur in geringem Maße, durch Übung und Rehabilitation verbessern. Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen“ (ICD-10-GM-2014 2014).
[...]
- Arbeit zitieren
- Liesa Gärtner-Vander (Autor:in), 2018, Wie kann man effektiv Alkoholsucht bei Schülern und Schülerinnen mit geistiger Behinderung vorbeugen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379723
Kostenlos Autor werden















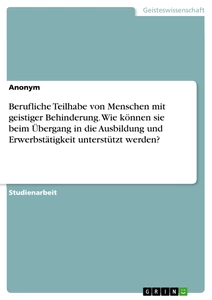






Kommentare