Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Phänomenologie
2 Diagnostik ICD-10/DSM-5
3 Ätiologie
4 Therapie
4.1 Von der Behandlung zur Bewältigung
4.2 Von der Bewältigung zur Rückfallprävention
4.3 Wirksamkeitsanalysen
5 Prävention
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Glossar
Anhang A
Bestätigung
Zusammenfassung
Die Pädophilie ist nach den aktuellen psychiatrischen Klassifikationssystemen als eine anhaltende oder dominierende sexuelle Präferenz für präpubertäre Kinder definiert (Fromberger, Jordan & Müller, 2013). Beachtenswert ist, dass weniger als 50% aller Kindesmissbrauchstäter die diagnosti- schen Kriterien der Pädophilie erfüllen (Blanchard, Klassen, Dickey, Kuban & Blak, 2001). Ätiolo- gisch wird gegenwärtig von multikausalen Wirkmechanismen ausgegangen; dabei wären genetische, lerntheoretische und neurobiologische Faktoren zu diskutieren (Seto, Michael C., 2009; Seto, M.C. & Association, 2008).
Gemäß der Behandlungsleitlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) ist Psychotherapie bei der Behandlung von Pädophilie das probate Mittel. Bestätigten frühere Metaanalysen noch positive Behandlungseffekte, gemessen an Rückfallraten (Hanson, Bourgon, Helmus & Hodgson, 2009), ist die aktuelle Studienlage nicht mehr so eindeutig (Grønnerød, Grønnerød & Grøndahl, 2014; Schmucker & Lösel, 2015).
Nach aktuellem Kenntnisstand stellen dennoch kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze kombiniert mit modernen Modellen wie RNR oder/und GLM die Methode der Wahl dar (Fromberger et al., 2013; Hill, 2007). Metaanalysen zeigen positive Effekte dieser Behandlungsansätze, wobei nicht eine Veränderung der devianten sexuellen Orientierung, sondern die Verhinderung weiterer sexueller Übergriffe das Behandlungsziel darstellt.
Schlüsselwörter:
Pädophilie, Sexualverhalten, Paraphilien, Sexuelle Abweichungen, Therapie, Prävention, kognitivverhaltenstherapeutische Ansätze, Metaanalysen
Einleitung
Nur selten wird ein Bereich der Medizin derart ideologisch und häufig auch polemisch diskutiert wie Störungen der sexuellen Präferenz und hier insbesondere die Pädophilie. Eine verwirrende Vielzahl an Begriffen - wie sexueller Missbrauch, sexuelle Misshandlung, sexualisierte Gewalt, sexueller Übergriff, Inzest, Pädophilie - sowie deren unscharfe Trennung und oftmals synonyme Verwendung, verschärfen zusätzlich die Diskussion.
Es ist daher von großer Wichtigkeit die Begriffe der Pädophilie bzw. Hebephilie sorgsam und klar von dem Begriff und Inhalt der Pädosexualität abzugrenzen. Pädosexualität bezieht sich eben nicht auf die sexuelle Ausrichtung, sondern auf das Verhalten, also die Missbrauchshandlung eines Erwachsenen an einem Kind. Sexuelle Missbrauchshandlungen können eine pädophile Präferenz zum Hintergrund haben, oft sind jedoch andere Motive Grund für Missbrauch.
Umgangssprachlich wird der Begriff leider oft synonym zum Begriff der Pädophilie verwendet. Doch nicht jeder, der ein Kind missbraucht hat, ist pädophil und nicht jeder mit einer pädophilen Ausrichtung missbraucht Kinder (Berner, Briken, Hill, Kraus & Lietz, 2007; Blanchard et al., 2001; Fromberger et al., 2013).
Der Begriff Pädophilie leitet sich aus den griechischen Wörtern „pais“ für Kind oder Knabe und „philia“ für die freundschaftliche Liebe ab. Erstmals wurde die Bezeichnung von dem deutschösterreichischen Psychiater Krafft-Ebing in seinem 1886 erschienenen Standardwerk „Psychopathia Sexualis“ (Krafft-Ebing, R., 1886; Krafft-Ebing, R. v., 1984) verwendet.
Grundsätzlich sollte auch zwischen Pädophilie und Hebephilie unterschieden werden (Beier, K. et al., 2013). Pädophilie meint die sexuelle Ausrichtung auf Kinder in der Vorpubertät. Hebephilie hingegen meint die sexuelle Ausrichtung auf frühpubertierende Kinder. Die Bezeichnung Pädophilie beschreibt demnach ein sexuelles Interesse. Pädophile Personen werden durch den Anblick kindlicher Körper sexuell erregt, ihre Wünsche nach Liebe und Sexualität richten sich ausschließlich oder zu einem gewissen Teil auf Kinder.
Man differenziert daher auch zwischen einem ausschließlichen - primären Typus, einer sogenannten Kernpädophilie, bei der sich das sexuelle Interesse ausschließlich auf Kinder richtet, und einem nicht-ausschließlichen - sekundären Typus, bei dem sexuelle Gefühle auch durch erwachsene Personen ausgelöst werden können (Hall & Hall, 2007; Schwarze & Hahn, 2016).
Ob jemand eine pädophile bzw. hebephile Ausrichtung oder beides hat, lässt sich nicht am Alter des Kindes festmachen, denn die körperliche Entwicklung von Kindern verläuft individuell unterschiedlich und dementsprechend setzt auch deren Pubertät zu keinem bestimmten Zeitpunkt ein. Vielmehr ist hierfür entscheidend, welche Körpermerkmale der Jungen oder Mädchen als sexuell erregend empfunden werden (Schwarze & Hahn, 2016).
Die Pädophilie ist jedoch nur eine von vielen möglichen Störungen (sofern die Merkmale einer Störung vorliegen; vergl. Punkt 2) der sexuellen Präferenz oder Paraphilien. Eine Störung ist gekenn- zeichnet durch Leidensdruck. Der Leidensdruck besteht bei der von der Störung betroffenen Person oder ihrem Umfeld. Infolgedessen dient der Störungsbegriff des ICD-10/DSM-5 nicht der Konstituie- rung einer „Normalität“ (und damit potenziell der Ausgrenzung des „Abnormen“) oder dem „Täter- schutz“, sondern ist Voraussetzung für die möglichst genaue Beschreibung eines mit Leiden verbun- denen Verhaltens und dessen möglichst spezifischer Therapie (Dybus, Siepelmeyer & Ventzke, 2016; Kasper & Volz, 2008).
Gemäß der Behandlungsleitlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) ist Psychotherapie bei der Behandlung von Pädophilie die Methode der Wahl (Berner et al., 2007; Fromberger et al., 2013).
1 Phänomenologie
Mit Blick auf die Phänomenologie der Pädophilie stellt die fehlende sexuelle Attraktion für erwach- sene Personen das zentrale Charakteristikum dieser Sexualdevianz dar. Außerdem wurde über Störungen der Impulskontrolle und eine ausgeprägte emotionale Unreife von Pädophilen sowohl im klinischen Alltag als auch in Studien berichtet. Darüber hinaus wurden Soziopathie und interpersonelle Defizite wie Mangel an Durchsetzungsfähigkeit oder Störungen des Selbstkonzeptes geschildert (Wiebking, Witzel, Walter, Gubka & Northoff, 2006).
Im ICD 10 und DSM-5 ist Pädophilie unter Störung der Sexualpräferenz bzw. Paraphilie klassifiziert, was letztlich Synonyme sind. Die Begriffe Störungen der Sexualpräferenz (ICD), Paraphilie (DSM), sexuelle Deviation und Perversion werden in der Literatur fast synonym benutzt.
Beier und Loewit stellen bei Ihrer Definition genau auf die vorgenannte Störung der Impulskontrolle ab: „Unter Störungen der sexuellen Präferenz (Paraphilien) werden Störungsbilder verstanden, bei denen die betroffenen Personen unter normabweichenden sexuellen Impulsen leiden oder andere zu Opfern dieser Impulse machen“ (Beier, K. M. & Loewit, 2012, S. 54).
Das DSM-5 fordert u.a., dass wiederkehrende, intensive sexuell erregende Fantasien, bzw. sexuell dranghafte Bedürfnisse oder Verhaltensweisen mindestens über einen Zeitraum von 6 Monaten aufgetreten sind (Kasper & Volz, 2008).
2 Diagnostik ICD-10/DSM-5
Das Störungsbild der Pädophilie zählt heute gemäß ICD-10 zu den Störungen der Sexualpräferenz und ist als eine anhaltende oder dominierende sexuelle Präferenz für eines oder mehrere Kinder vor deren Pubertät definiert. Die diagnostischen Kriterien im Überblick zeigt Tabelle 1 im Anhang A.
Grenzen zwischen „Normalität“ und „Abweichung“ sind oft schwer zu ziehen. Dieser Problematik wird erstmals im DSM-5 Rechnung getragen, in dem zwischen Paraphilien einerseits und paraphilen Störungen andererseits unterschieden wird.
Dem DSM-5 zufolge wird ein Patient nur dann mit einer Störung der Sexualpräferenz (Para- philic Disorder) diagnostiziert, wenn er sowohl die einschlägigen Fantasien, Bedürfnisse oder Verhaltensweisen aufweist (A-Kriterium) als auch darunter leidet oder infolgedessen Beeinträchti- gungen hinnehmen muss oder deswegen andere schädigt (B-Kriterium). Weist hingegen jemand nur die entsprechenden Fantasien, Bedürfnisse oder Verhaltensweisen auf, wird dies zwar als paraphil beschrieben, aber nicht mehr als psychisch erkrankt diagnostiziert. Das heißt aus sexualmedizinischer Sicht werden nur jene Störungsbilder als sexuelle Präferenzstörungen bzw. Paraphilien verstanden, bei denen die Betroffenen unter normabweichenden sexuellen Impulsen leiden. Demzufolge werden Personen, welche abweichende sexuelle Neigungen aufweisen, aber nicht unter diesen leiden, auch nicht als gestört, krank oder behandlungsbedürftig angesehen. Dies gilt solange sie weder andere noch sich selbst durch ihre abweichenden sexuellen Bedürfnisse beeinträchtigen oder gefährden (Beier, K. M. & Loewit, 2012).
3 Ätiologie
Bis heute ist die Ätiologie der Pädophilie weitgehend ungeklärt. Konditionierungsprozesse während der Pubertät, eigene Missbrauchserfahrungen in der Kindheit, genetische Prädispositionen und neurobiologische Auffälligkeiten werden diskutiert (Seto, 2008; zitiert nach Fromberger et al., 2013). Soweit dem Autor bekannt ist, konnte keiner dieser Erklärungsansätze bis jetzt wirklich empirisch ausreichend belegt werden, um ein evidenzbasiertes Ätiologiemodell zu konstituieren.
4 Therapie
Für die Fragestellung dieser Ausarbeitung ist problematisch, dass es keine Studien zu geben scheint, die sich allein auf die Wirksamkeitsanalyse von Therapien bei Pädophilie konzentrieren ohne dies gleichzeitig in Verbindung mit Sexualstraftaten zu bringen. Aber auch für pädophile Sexualstraftäter allein, scheint es keine Wirksamkeitsstudien zu geben. Alle vom Verfasser gefundenen Metaanalysen beziehen sich auf Sexualstraftaten insgesamt bzw. im Idealfall noch auf Sexualstraftaten an Kindern (Grønnerød et al., 2014; Walton & Chou, 2014) jedoch ohne Differenzierung nach pädophilem Hintergrund.
In den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts war die Mehrheit der Forschen- den vorrangig an der Frage interessiert, wie sich bestimmte Paraphilien wie Voyeurismus, Exhibitio- nismus, Pädophilie erfolgreich (weg)behandeln lassen. Dann, zu Beginn der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts war die Datenlage Behandelter groß genug um - unter der im ersten Absatz erwähnten Einschränkung - unterschiedliche Studienvergleiche anzustellen. Aus ihnen ließ sich schließen, dass die Symptombehandlungen dieser Paraphilien - hinsichtlich der Absenkung des Rückfallrisikos - als nicht erfolgreich einzustufen waren. Gegen-Konditionierungsversuche auf Grundlage von verhaltens- therapeutischen Ansätzen wie z.B. elektrische und olfaktorische Aversionstherapien, Rekonditionie- rungsversuche mit und ohne phallometrischem Biofeedback, sowie masturbatorische Sättigung zeigten deutlich, dass keinerlei langfristige Erfolge erreicht werden konnten (Fiedler, 2004).
In der Wissenschaft wird seit langem in einem laufenden Prozess über das Verständnis der Pa- raphilien (DSM-5) bzw. der Störungen der sexuellen Präferenz (ICD-10) diskutiert. Während ein behavioristischer Ansatz die Paraphilien als erlerntes Verhalten konzeptualisiert, sieht ein anderer Ansatz die Paraphilien als eine von vielen möglichen Manifestationen menschlicher Sexualität. Dieser Ansatz bildet die Grundlage für eine auf Akzeptanz basierte therapeutische Arbeit mit Paraphilien (Präventionsnetzwerk-Kein-Täter-werden, 2017). Auf der Basis des zweiten Ansatzes ist die endgül- tige Konstituierung der Sexualstruktur im Jugendalter erfolgt und bleibt in ihren grundsätzlichen Merkmalen lebensüberdauernd bestehen. Dies gilt ebenso für die Unveränderbarkeit spezieller sexueller Neigungen, die sich ebenfalls im Jugendalter manifestieren und die sexuelle Präferenzstruk- tur teilweise oder sogar vollkommen kennzeichnen können (Allroggen, 2011; Beier, K. M., Konrad, Amelung, Scherner & Neutze, 2010; Beier, K. M. & Loewit, 2012; Nieschlag, 2009; Seto, Michael C., 2012). Demzufolge sollte das vorrangige Ziel einer Therapie die Verhinderung von sexuellen Übergriffen auf Kinder bzw. die Verhinderung von Wiederholungstaten sein.
4.1 Von der Behandlung zur Bewältigung
Wie unter Punkt 4 ausgeführt, stellte sich heraus, dass der eigentliche Wirkmechanismus erfolgreicher Behandlung nicht im Wegtherapieren von Symptomen bestand, sondern in der Vermittlung, von Bewältigungsstrategien für rückfallkritische Situationen. Für eine erfolgreiche Rückfallbehandlung ist es sehr wichtig, Patienten aktiv zu unterstützen und konkret darin zu unterweisen, wie sie selbstver- antwortlich und kompetent in Risikosituationen bestehen oder wie sie diese aktiv vermeiden können (Fiedler, 2004).
4.2 Von der Bewältigung zur Rückfallprävention
Eine therapeutisch klug vorbereitete Vermeidung zukünftiger Rückfälle wurde alsbald zum zentralen Angelpunkt der weiteren Ausarbeitung und Evaluation von Behandlungskonzepten. Die Rückfallprä- vention (s.a. Punkt 5) steht heute in jedem neu entwickelten Behandlungsprogramm im Mittelpunkt.
4.3 Wirksamkeitsanalysen
Fiedler (2004) führt an, dass im vorgenannten Kontext bereits zu Beginn der 1990’er Jahre erste Wirksamkeitsanalysen vorgelegen haben. In einer dieser Studien äußerten sich Marshall und Eccles (1991) kritisch, mittels psychodynamischer und einsichtsorientierter Therapie die Rückfallzahlen begrenzen zu können. Sie fanden wenig Anhaltspunkte für eine Effektivität dieser Behandlungskon- zepte im Unterschied zu nicht behandelten Sexualstraftätern. Fromberger et al. (2013) verweisen in ihrer Abhandlung besonders auf eine Metaanalyse von Hanson et al. (2009) der zufolge 19,2% der unbehandelten - aber nur 10,9% der psychotherapeutisch behandelten Sexualstraftäter (in einem durchschnittlichen Beobachtungszeitraum von 4,7 Jahren) nach ihrer Entlassung wieder einschlägig rückfällig geworden seien. Allerdings betrachtete diese Analyse schwerpunktmäßig, ob die für allgemeine Straftäter wirksamen Behandlungen mit Modellen wie z.B. risk-need-responsivity; RNR (Bonta & Andrews, 2007) auch für die Behandlung von Sexualstraftätern wirksam sind.
Metaanalysen aus den Jahren 2014 und 2015 (Grønnerød et al., 2014; Schmucker & Lösel, 2015; Walton & Chou, 2014) sind hinsichtlich der Wirksamkeitsaussagen nicht mehr so eindeutig. Mit einer Effektgröße von r=0.3 berichten die Autoren einer von zwei Metaanalysen dieser Arbeit, die sich explizit auf Sexualstraftäter gegen Kinder beziehen (SOAC), einen mittleren Wirksamkeitseffekt, gehen aber selbst in ihrem Fazit davon aus, dass aufgrund der zugrundeliegenden Studienlage (9 Studien die als gut oder schwach bewertet wurden) und einem Nachbeobachtungszeitraum von nur 3 Jahren keine (deutliche) Wirkung auf SOAC nachgewiesen werden konnte (Grønnerød et al., 2014). Trotz eines qualitativ besseren Untersuchungsansatzes kamen Walton und Chou (2014) - in ih-rer ebenfalls auf SOAC ausgerichteten Analyse - zu keiner signifikanten Verringerung der Rückfallra-ten von behandelten gegenüber unbehandelten SOAC.
Schmucker und Lösel (2015) berichten in der Fortsetzung Ihrer Studie von 2005 (Lösel & Schmucker, 2005) zwar von geringeren (als in der Studie von 2005) aber dennoch signifikanten Wirksamkeitseffekten von behandelten gegenüber unbehandelten Sexualstraftätern. Alle Autoren sind der Meinung, dass es an qualitativ hochwertigen Studien unter Berücksichtigung der Kriterien des Collaborative Outcome Data Committee (CODC) fehlt, damit eindeutigere Aussagen zur Wirksamkeit von Interventionen getroffen werden können.
5 Prävention
Das vom Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Charité Berlin initiierte Präventions- projekt Dunkelfeld (PPD) befasst sich seit 2004 ebenfalls mit der Frage, ob präventivtherapeutische Maßnahmen bei Männern mit pädophiler oder hebephiler Sexualpräferenz, die allerdings nicht unter Aufsicht der Justizbehörden stehen, sexuelle Übergriffe auf Kinder verhüten können (Faistbauer, 2011).
Die bis dahin genutzten Ansätze näherten sich der Problematik des sexuellen Kindesmissbrauchs in erster Linie sekundärpräventiv. Anlass für die Therapie war demnach immer ein stattgefundener sexueller Übergriff. Dadurch blieb eine Gruppe weitestgehend unversorgt, die aufgrund einer vorliegenden pädophilen oder hebephilen Präferenz ein hohes Übergriffsrisiko aufwies, aber noch keinen sexuellen Übergriff begangen hatte. Das PPD hat es sich zum Ziel gesetzt, besonders der unterversorgten Gruppe potentieller und realer Dunkelfeld-Täter mit pädophiler und/oder hebephiler Präferenz eine Therapie anzubieten, um das Risiko eines erstmaligen oder fortgesetzten sexuellen Kindesmissbrauchs zu verringern (Beier, K. M. et al., 2010).
Eines der Ziele des Projektes besteht darin, die Wahrnehmung für die Thematik in der Gesellschaft zu sensibilisieren und aufzuzeigen, dass es Betroffene gibt, die über ein Problembewusstsein verfügen und ihrerseits sexuelle Übergriffe verhindern wollen. Aber auch im PPD hat man noch keine wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse darüber, ob das Risiko sexueller Übergriffe bei fundiert durchgeführter Diagnostik und Therapie gesenkt werden kann und somit primärpräventive Maßnahmen direkten Opferschutz darstellen (Beier, K. M. et al., 2010).
6 Fazit
Die Fragestellung dieser Arbeit lässt sich aufgrund neuerer Metaanalysen nicht mehr eindeutig bejahen. Zwar zeigen die Behandlungsansätze noch positiven Effekte, die aber, wenn überhaupt, keine große Signifikanz zeigen. Um eindeutigere Aussagen treffen zu können fehlt es noch immer an qualitativ guten Studien; die insbesondere auch in Übereinstimmung mit den Kriterien des Collabora- tive Outcome Data Committee (CODC) stehen (Beech et al., 2007). Aufgrund der Studienlage aber auch aufgrund existierender neuer Modelle, scheint es angeraten, die Behandlungsleitlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) zu überarbei- ten. Die dort uneingeschränkte Befürwortung von Psychotherapie als Mittel der Wahl bei der Behandlung von Pädophilie (Berner et al., 2007; Fromberger et al., 2013) ist in dieser Form nicht mehr „state of the art“.
Die Verknüpfung neuerer Interventionsmodelle mit kognitiv- verhaltenstherapeutischen Mit- teln, wäre ein Ansatzpunkt für neue Studien. Davon ausgehend, dass Pädophilie über die Lebensspan- ne hinweg als sexuelle Präferenz bestehen bleibt, scheint es auch ratsam, die Beobachtungszeiträume im Hinblick auf eventuelle Rückfälle bzw. Ersttaten deutlich zu verlängern. Dem Verfasser ist dabei bewusst, dass sowohl ethische als auch reale Hindernisse das Finden geeigneter (randomisierter) Kontrollgruppen erschweren.
Nach wie vor sind Forschungen über betroffene Frauen völlig unterrepräsentiert.
[...]
1 Fachbegriffe und Abkürzung werden im Glossar erläutert
- Arbeit zitieren
- Matthias Dybus (Autor:in), 2017, Inwieweit ist Psychotherapie eine wirksame Methode zur Risikoverringerung eines Kindesmissbrauchs?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378655
Kostenlos Autor werden



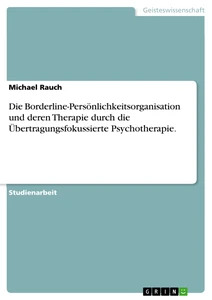







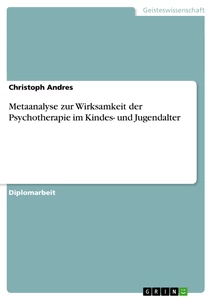




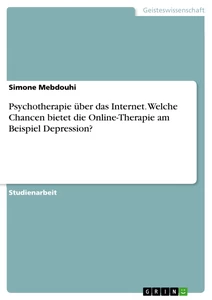
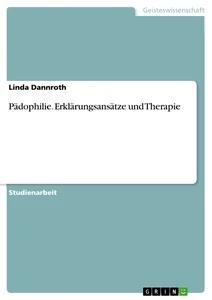




Kommentare