Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Benachteiligung
2.1.1 Soziale Herkunft
2.1.2 Soziale Konstruktion
2.2 Jugendliche
2.2.1 Jugendliche und ihre Aufgaben
2.2.2 Die Generation Z
2.3 Teilhabe
2.3.1 Soziale Teilhabe
2.3.2 Berufliche Teilhabe
2.3.3 Inklusion
3. Handlungsleitende Methoden
3.1 Soziale Einzelfallhilfe
3.2 Soziale Gruppenarbeit
3.3 Erlebnispädagogik
3.4 Aufsuchende Jugendarbeit
4. Handlungsleitende Theorien
4.1 Lebensweltorientierung
4.2 Systemtheorie
5. Das Projekt Jugendscout
6. Bezug der Methoden und Theorien auf die Arbeit des Jugendscouts
6.1 Soziale Einzelfallhilfe
6.2 Soziale Gruppenarbeit
6.3 Erlebnispädagogik
6.4 Aufsuchende Jugendarbeit
6.5 Lebensweltorientierung
6.6 Systemtheorie
7. Anforderungen an Sozialarbeitende
8. Herausforderungen für die Arbeit des Jugendscouts
9. Reflexion und Ausblick
10. Quellenverzeichnis
1. Einleitung
„Insbesondere die Lebenssituation von sozial benachteiligten Jugendlichen ist durch Be-lastungs- und Ausgrenzungsrisiken gekennzeichnet, z.B. durch Migration, Geschlecht, so-ziale Herkunft usw. Die Ausgrenzungsrisiken zeigen sich z.B. durch Einkommensarmut und durch gering ausgeprägte Netzwerkstrukturen, welche die Gesellschaft den Jugend-lichen zur Verfügung stellt, oder sie lassen sich an Bildungsarmut festmachen, die Er-werbschancen deutlich verringert“ (KNAPP 2014, S. 258f.).
In der heutigen Zeit, welche von Individualisierung und Pluralisierung geprägt ist, die mit einer Endstandardisierung von herkömmlichen Lebensverläufen einhergeht, sind vor allem benachteiligte Jugendliche von Orientierungslosigkeit und Hilflosigkeit betroffen. Die Gesellschaft entwickelt sich zunehmend zu einer Leistungs- und Erfolgsgesellschaft, in der die Menschen weitestgehend auf sich allein gestellt sind, wodurch diesen Jugend-lichen das notwendige Gefühl von Sicherheit genommen wird. Dadurch steigen die Risiken, von der Gesellschaft exkludiert zu werden (vgl. HUFT 2014, S. 28ff.).
„Benachteiligte Jugendliche [leiden, d. Verf.] besonders unter den schwierigen ökono-mischen Veränderungen der Gesellschaft. Sie suchen, genauso wie ihre nicht benach-teiligten Altersgenossen, (…) nach Teilhabe und einem Mindestmaß an Anerkennung. (…) Aber sie besitzen im Gegensatz zu den besser gestellten Jugendlichen (…) ein schlechteres ökonomisches Niveau und haben daher nicht viel an gesellschaftlichem Status zu verlieren“ (HUFT 2014, S. 30).
Mit ökonomischem Niveau meint Andreas Huft den Besitz von Gütern und finanziellen Ressourcen. Diese Differenzierung zwischen besser und schlechter gestellten Jugend-lichen führt dazu, dass Benachteiligte in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft zunehmend eingeschränkt werden (vgl. HUFT 2014, S. 30).
An dieser Stelle setzt das Projekt Jugendscout an, dem ich während meiner Praxisphasen im Rahmen des dualen Studiums zugeordnet bin. Der Jugendscout ist ein arbeitsmarkt-politisches Instrument, welches für die Integration benachteiligter Jugendlicher in den Ar-beitsmarkt und folglich in die Gesellschaft eingesetzt wird. Der Jugendscout steht dafür, jedem jungen Menschen eine Chance zu geben. Aus diesem Leitsatz heraus entstand die Motivation zur Bearbeitung der leitenden Fragestellung. Das Ziel dabei ist, die Sinnhaftig-keit dieses Beratungsdienstes herauszuarbeiten. Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird der Frage nachgegangen, inwiefern der Jugendscout zur Teilhabe benachteiligter Jugend-licher beitragen kann.
Zunächst wird der Begriff Benachteiligung mit Blick auf die soziale Herkunft und die soziale Konstruktion als Hintergründe dessen definiert. Anschließend wird der Begriff Jugendliche beleuchtet. Dabei werden Entwicklungsaufgaben in dieser Phase sowie die „Generation Z“ (SCHOLZ 2014) thematisiert. Es folgt eine theoretische Fundierung zum Thema Teilhabe. Diese wird in sozialer und beruflicher Dimension differenziert, wonach der Begriff Inklusion näher betrachtet wird. Dies ist zum Verständnis der folgenden Ana-lyse grundlegend: Nach der Vorstellung des Projekts Jugendscout werden die handlungs-leitenden Methoden und Theorien, auf denen die Arbeit des Jugendscouts basiert, vor-gestellt. Infolgedessen werden die theoretischen Grundlagen konkret auf die Arbeit des Jugendscouts transferiert, um schlussendlich die Leitfrage beantworten zu können. Dabei ist es notwendig, zudem die essentiellen Kompetenzen Sozialarbeitender in diesem Handlungsfeld herauszuarbeiten und etwaige Grenzen, die vielmehr als Herausforderun-gen betrachtet werden, nicht zu übersehen. Abschließend erfolgt eine kritische Reflexion dieser Thematik.
2. Theoretische Grundlagen
Zu Beginn dieser Arbeit werden die Begriffe Benachteiligung, Jugendliche, die „Gene-ration Z“, Teilhabe sowie Inklusion näher betrachtet und definiert. In diesem Zusammen-hang werden rechtliche Grundlagen sowie mögliche Hintergründe zur Entstehung von Benachteiligung beleuchtet. Der Begriff Teilhabe wird im Rahmen dieser Literaturarbeit in den Dimensionen der sozialen und beruflichen Teilhabe ausdifferenziert.
2.1 Benachteiligung
Jeder Mensch kann grundsätzlich von Benachteiligungen unterschiedlicher Art betroffen sein. Generell beschreibt Benachteiligung den Gegensatz von Bevorzugung. Meist sind in einer Gesellschaft die mehr oder minder zufällig Wohlhabenden bevorzugt, wohingegen Menschen, die einen Mangel leiden, benachteiligt sind. Stephan Ellinger führt an, dass „Besitz, Lebensstil und Milieuzugehörigkeit (..) in unserem Staat zu großen Teilen unver-dient vererbt [werden, d. Verf.]“ (ELLINGER 2013, S. 26). Er macht demnach zum einen die soziale Herkunft und damit verbunden die Sozialisation verantwortlich für die eigene soziale Stellung; zum anderen wird ihm zufolge Benachteiligung aber ebenso sozial konstruiert (vgl. ELLINGER 2013, S. 9ff.). Diese beiden Hintergründe von Benachteili-gungen werden in den folgenden Teilkapiteln dargestellt.
Der Begriff Benachteiligung kann unterschiedlich definiert werden. Als grundlegend für die Beurteilung, wer benachteiligt ist, ist ein Verständnis von Normalität. Benachteiligungen sind dementsprechend Abweichungen von dieser Normalitätsvorstellung. „Das Normale“ wird meist von der Mehrheit einer Gesellschaft definiert. Näheres dazu folgt unter dem Abschnitt 2.1.2 Soziale Konstruktion (vgl. SCHIERHOLZ 2001, S. 12ff.) .
Johannes Münder präzisiert Benachteiligungen als Defizite der Sozialisation in Familie, Schule, Ausbildung, Berufsleben und sonstiger Umwelt: „Soziale Benachteiligungen wer-den immer dann vorliegen, wenn die altersgemäße gesellschaftliche Integration nicht wenigstens durchschnittlich gelungen ist, insbesondere bei Haupt- und Sonderschülern ohne Schulabschluss, Absolventen des Berufsvorbereitungsjahrs, Abbrechern von Maß-nahmen der Arbeitsverwaltung, Ausbildungsabbrechern, Langzeitarbeitslosen, jungen Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen“ (Münder 1997, S. 170, zit. nach: SCHIERHOLZ 2001, S. 12).
Lernbeeinträchtigungen werden mit Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung gebracht. In der Regel beeinflussen Verhaltensstörungen im Laufe der Jahre auch das Lern- und Leis-tungsverhalten negativ. Verhaltensauffälligkeiten sind häufig auf schwierige Sozialisa-tionsbedingungen zurückzuführen (vgl. SCHIERHOLZ 2001, S. 14ff.). Dies wird im Teil-kapitel 2.1.1 Soziale Herkunft weiter ausgeführt.
Christine Buchholz und Angela Haubner definieren benachteiligte Jugendliche als junge Menschen, denen aufgrund verschiedener Ursachen die volle Teilhabe an den gesell-schaftlichen Vorzügen verwehrt ist. Benachteiligungen sind häufig auf die soziale Herkunft verbunden mit Armut, auf eine schlechte schulische Bildung, mangelnde Sprachkennt-nisse, nichtdeutsche Herkunft beziehungsweise (bzw.) Nationalität oder das Geschlecht zurückzuführen (vgl. BUCHHOLZ/HAUBNER 2005, S. 280).
Der Begriff Benachteiligung birgt viele Facetten: Häufig ist von Bildungsbenachteiligung, sozialer Benachteiligung, beruflicher Benachteiligung und Marktbenachteiligung die Rede.
Bildungsbenachteiligung führt meist auch zu beruflicher Benachteiligung. Eine berufliche Benachteiligung ist allerdings nicht immer nur Folge einer Bildungsbenachteiligung. Sozia-le Benachteiligung meint eine defizitäre Sozialisation in den verschiedenen Instanzen, die beispielsweise zu einer fehlenden Ausbildungsreife führen kann. Marktbenachteiligung geht von einer schlechten Arbeitsmarktlage aus, sodass beispielsweise ausbildungsreife Jugendliche aufgrund mangelnder Ausbildungsplätze keine Berufsausbildung aufnehmen können (vgl. BRÜNING/KUWAN 2002, S. 12f.).
Gerhild Brüning und Helmut Kuwan differenzieren Benachteiligung zudem aus soziolo-gischer und subjektbezogener Perspektive. Soziologisch betrachtet liegt eine Benachteili-gung vor, wenn Personen oder Personengruppen gesellschaftlichen Anforderungen und der gesellschaftlichen Entwicklung nicht gerecht werden können. Unter diesem Blickwin-kel gilt es zu beachten, dass die Faktoren, die zu Benachteiligung führen, von der Zeit und der Gesellschaft abhängig sind. Gesellschaftliche Zielsetzungen, politische Wertorientie-rungen und berufliche Anforderungen sind dabei entscheidend. Benachteiligt sind diejeni-gen, die aufgrund von kaum oder nicht beeinflussbaren Faktoren verminderte Chancen besitzen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Aus Sicht der Individuen liegt eine Benachteili-gung vor, wenn die Teilhabe an der Gesellschaft in ökonomischer, kultureller und politi-scher Hinsicht eingeschränkt ist. Oft werden Menschen, die von anderen als benachteiligt wahrgenommen werden, stigmatisiert und stereotypisiert. Diese vermeintlich objektive Zu-schreibung einer Benachteiligung kann von dem subjektiven Empfinden der betroffenen Personen abweichen. Allgemein kann Benachteiligung die Vorstufe zu sozialer Ausgren-zung sein (vgl. ebd., S. 14ff.).
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) hebt zudem Benachteiligungen aufgrund physischer und psychischer Behinderungen hervor. Diese werden durch die Segregation, d.h. die räumliche Trennung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung oder Verhaltens-auffälligkeiten scheinbar reproduziert. Für sie gibt es eine gesonderte Schulform. Durch die Inklusionsbewegung wird versucht, dem entgegenzuwirken und Benachteiligungen aufgrund der gesundheitlichen und kognitiven Voraussetzung aufzubrechen (vgl. www.dji.de/index.php?id=43406, 2016).
Wichtig in der Förderung von benachteiligten Menschen ist es, sich auf die Ressourcen und Kompetenzen der Betroffenen zu stützen und dabei passgenaue Hilfen, abgestimmt auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Individuen, einzuleiten. Benachteiligte Jugend-liche, die beispielsweise an einer berufsvorbereitenden Maßnahme teilnehmen oder sich in keinem Beschäftigungsverhältnis befinden, werden oft als berufsunreife Jugendliche bezeichnet, die in Bezug auf diesen Aspekt unterstützt werden müssen (vgl. BRAUN 2003, 120f.).
Gemäß Art. 3 Grundgesetz (GG) darf niemand wegen seines Geschlechts, seiner Ab-stammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen sowie aufgrund einer Behinderung be-nachteiligt oder bevorzugt werden. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich (vgl. Art. 3 GG). Zudem ist es nach § 7 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) in Verbindung mit (i.V.m.) § 1 AGG verboten, Individuen wegen ihrer Rasse bzw. ethni-schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu benachteiligen. Sich dennoch entwickelnde oder bestehende Benachteiligungen sollen verhindert oder beseitigt werden (vgl. § 7 AGG i.V.m. § 1 AGG). Diese Rechtsgrundlagen stellen die Daseinsberechtigung für jegliche Soziale Dienste bzw. im Allgemeinen für jegliche professionelle Hilfe dar, um individuelle Benachteiligungen zu bewältigen.
Das Achte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) ist die rechtliche Grundlage für die Arbeit des Jugendscouts. § 1 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII verankert die Förderung der indivi-duellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen und die Vermeidung bzw. den Abbau von Benachteiligungen. Gemäß § 13 Abs. 1 SGB VIII werden sozialpädagogische Hilfen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und zur Überwindung individueller Beein-trächtigung dann angeboten, wenn junge Menschen in erhöhtem Maße Unterstützung bedürfen. Diese Hilfen fördern die schulische und berufliche Ausbildung, die Einglie-derung in die Arbeitswelt und die soziale Integration (vgl. § 13 SGB VIII i.V.m. § 1 SGB VIII).
2.1.1 Soziale Herkunft
Das finanzielle, soziale und kulturelle Kapital der Eltern entscheidet zu großen Teilen über die Chancen ihrer Kinder. Vor allem die Bildung der Eltern ist dabei von essentieller Bedeutung. Ebenso werden deren Zugänge zum Arbeitsmarkt mit verantwortlich für die Chancen der Kinder gemacht. Aufgrund des unterschiedlichen Aufwachsens entwickeln Kinder verschiedene Zukunftsperspektiven. Die Kindheit ist die Basis für die gesamte sprachliche, kognitive und sozio-emotionale Entwicklung. Bedeutsam ist dabei das Um-feld, in dem Kinder aufwachsen. Dieses Umfeld soll Kinder dazu anregen, in diesen Berei-chen zu wachsen. Vor allem in den frühen Jahren besteht dieses Umfeld größtenteils aus der Familie. Benachteiligten Jugendlichen „mangelt es an personalen und sozialen Res-sourcen. In der Familie – das bedeutungsvollste soziale Netzwerk – finden viele keinen Rückhalt und keine Unterstützung“ (KNAPP 2014, S. 261). Dies führt zu Demotivation, einem unsicheren Bindungsverhalten und einem negativen Selbstbild, wodurch diese Jugendlichen schlechteren Chancen ausgesetzt sind. Die Familie ist somit verantwortlich für die Bildung von Kindern, die wiederum über die Möglichkeiten in der Zukunft von Kin-dern und Jugendlichen entscheidet. Der 14. Kinder- und Jugendbericht zeigt auf, dass „fast jeder dritte junge Mensch aus einem Elternhaus, das entweder von Armut bedroht ist, in dem die Eltern keiner Erwerbstätigkeit nachgehen oder aber selbst keine ausrei-chenden Schulabschlüsse vorweisen können“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2013, S. 40), kommt. Dadurch entsteht eine zu-nehmend größer werdende ökonomische Ungleichheit. Jugendliche gaben bei der Befra-gung an, dass die familiäre Unterstützung für die eigene Entfaltung bedeutsam ist. Dem-nach lässt sich festhalten, dass das Heranwachsen innerhalb der Familie und des sozia-len Umfelds sowohl im Kindes- als auch im Jugendalter über den weiteren Verlauf des Lebens entscheidet (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2013, S. 40ff.).
Die 17. Shell Jugendstudie macht die große Bedeutung der sozialen Herkunft für die schulische Laufbahn und die Zuversicht der Jugendlichen deutlich. Lediglich 45% der befragten Jugendlichen aus der unteren sozialen Schicht blicken zuversichtlich auf die Realisierbarkeit der beruflichen Wünsche – im Vergleich dazu sind es 81% aus der oberen sozialen Schicht. Menschen aus der unteren sozialen Schicht sind im Vergleich zu Menschen aus der mittleren und oberen sozialen Schicht mit weniger finanziellem, kultu-rellem und sozialem Kapital ausgestattet (vgl. http://www.shell.de/aboutshell/our-commit ment/ shell-youth-study-2015/family-education-employment-future.html, 2016).
Die Familie vermittelt Normen und Werte, die Kinder und Jugendliche internalisieren und in ihre eigene Lebensführung implementieren. Erfahrungen im Hinblick auf Mit- und Selbstbestimmung prägen ihr Verständnis von Teilhabe. Wie dem 14. Kinder- und Jugendbericht zu entnehmen ist machen Kinder und Jugendliche aus der unteren sozia-len Schicht häufiger die Erfahrung, darüber mitzuentscheiden, wie viele Kinder sie mit nach Hause nehmen dürfen. Werte wie Freundschaft und Gemeinschaft sind scheinbar in dieser Schicht bedeutend. Kinder aus der oberen Schicht hingegen dürfen über Themen wie Taschengeld und Kleidung mitentscheiden. Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass in dieser Schicht Werte wie sozialer Status und Ansehen sowie Erfolg gemessen an Geld wichtig sind (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2013, S. 110f.).
Das soziale Problem der Jugendarbeitslosigkeit geht vor allem auf die Familien zurück, die Problemlagen ausgesetzt sind. In den meisten Fällen stammen Jugendliche ohne Schulabschluss, Ausbildungsplatz oder Beschäftigung aus Familien mit einer hohen Pro-blemdichte: Beispielsweise familiäre Konflikte, Gewalt- und Kriminalitätserfahrungen, Ar-beitslosigkeit der Eltern, finanzielle Armut, existenzielle materielle Probleme wie Hunger oder (drohende) Obdachlosigkeit bestimmen in diesen Familien oft den Alltag. Dies sind ungünstige Entwicklungsbedingungen für Heranwachsende. „Das Familiengeschehen, die Erfahrungen, Auseinandersetzungen und Unterstützungen mit und durch die Eltern sind für die Jugendliche elementar für die Identitätsbildung“ (ECARIUS/EULENBACH/FUCHS/ WALGENBACH 2011, S. 73). Die erlernten Handlungsstrategien, Verhaltens- und Aus-drucksweisen sowie Normen und Werte wirken sich entscheidend auf die Zukunft von Kindern und Jugendlichen aus (vgl. SCHIERHOLZ 2001, S. 27f.).
Nicht nur die soziale Herkunft entscheidet über die Qualifikation von Menschen, sondern Benachteiligungen werden durch gesellschaftliche Entwicklungen reproduziert und ver-stärkt, was im Folgenden detaillierter dargestellt wird.
2.1.2 Soziale Konstruktion
Ellinger deutet in seiner Publikation „Förderung bei sozialer Benachteiligung“ (ELLINGER 2013) eine soziale Konstruktion von sozialen Problemen an, d.h. durch den Wohlstand der Gesellschaft werden sozial schwächere Personengruppen im Vergleich zur Mehrheit einer Gesellschaft marginalisiert. Vor diesem Hintergrund werden Benachteiligte häufig selbst verantwortlich für ihre Situation gemacht. Ellinger spricht von einem Versäumnis der Eigenverantwortung, welches benachteiligten Menschen von Nicht-Betroffenen zu-geschrieben wird. Das Prioritätensystem einer Gesellschaft legt „normale“ Verhältnisse fest, welche aus den Ansprüchen der Mehrheit der Gesellschaft hervorgehen. Die zu-nehmende Ökonomisierung ist entscheidend für die Benachteiligung sozial Schwacher: Konsumorientiertes Denken und Agieren sowie ein Bildungssystem, welches sich zu-nehmend an der Elite orientiert, gewinnen in der Gesellschaft fortwährend an Bedeutung. Vor allem die Gewinnmaximierung und Leistungserbringung bestimmen heute die Ent-wicklung kapitalistisch orientierter Gesellschaften. Benachteiligte Menschen werden dabei als Opfer der Ökonomisierung gesehen. Leistung und Erfolg gewinnen an Priorität, wo-durch Mitmenschlichkeit und Gleichheit an Bedeutung verlieren. Schwache Mitglieder ei-ner Gesellschaft werden häufig zurückgelassen, sogar das Bildungssystem richtet sich immer mehr an Besserqualifizierte, um diese weiter zu fördern. Soziale Probleme werden Ellinger zufolge sozial konstruiert (vgl. ELLINGER 2013, S. 9ff.).
Theo Klauß schreibt in der Fachzeitschrift der Lebenshilfe „Teilhabe“: „Zwar wird niemand offiziell wegen erheblicher kognitiver, motorischer, sozialer oder psychischer Einschrän-kungen ausgegrenzt, doch ist ihnen in sehr vielen Lebensbereichen die gleichberechtigte, aktive Teilhabe verwehrt. Es sind Menschen, die schwer behindert werden, das macht ihre schwere Behinderung aus“ (KLAUSS 2016, S. 2).
Vor allem junge Erwachsene werden zur Beschleunigung aufgefordert. Dies zeigen die Schulreform der G8-Gymnasien sowie der Wegfall des verpflichtenden Wehrdienstes bzw. des Zivildienstes. Schülerinnen und Schüler müssen in kürzerer Zeit denselben Unterrichtsstoff bearbeiten und nach der Schulzeit direkt in eine berufliche Ausbildung wechseln. Jugendliche reagieren unterschiedlich auf diese Anforderungen. Manchen fällt es leicht, diesen schnellen Bildungsweg zu verfolgen – auch weil sie über die notwendi-gen Ressourcen verfügen. Andere hingegen haben Schwierigkeiten, diesen komprimier-ten Anforderungen adäquat nachzukommen. Die Folge dessen sind Wiederholungen von Klassenstufen oder Qualifizierungsmaßnahmen im Übergang von der Schule in einen Beruf, die zu geringerem Selbstvertrauen und damit verbunden schwindender Motivation führen (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2013, S. 44).
Hans-Günter Rolff analysierte die Korrelation der Sozialisation und der Auslese in der Schule und kam zu dem Ergebnis, dass sich das Schulsystem nach den Werten, Norma-litätsvorstellungen und Verhaltensweisen der Mittelschicht ausrichtet, weil sie die breite Masse einer Gesellschaft ausmacht. Demnach werden aufgrund des auf die Mittelschicht angepassten Bildungssystems soziale Unterschiede, die den schichtbezogenen Soziali-sationsprozessen entspringen, aufrechterhalten oder gar vergrößert. Rolff zufolge wird die soziale Schichtung durch die Bildungsinstitutionen reproduziert und stabilisiert, benach-teiligte Menschen werden somit auch in diesem gesellschaftlichen System vernachlässigt. „Bereits aus einer früheren ‚Benachteiligung‘ heraus stigmatisiert, sind die Jugendlichen damit einer weiteren Form der Benachteiligung ausgesetzt“ (BUCHHOLZ/HAUBNER 2005, S. 281). Soziale Ungleichheit wächst infolgedessen aufgrund der zunehmenden Förderung der Mittelschicht, wodurch sozial schwache Personengruppen marginalisiert werden (vgl. ROLFF 1997, S. 229ff.).
Zudem trägt der demografische Wandel zu veränderten Bedingungen des Aufwachsens bei. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen geht weiter zurück, wohingegen die Zahl der Seniorinnen und Senioren[1] steigt. Demnach werden insgesamt betrachtet mehr Angebote für die alternde Gesellschaft eingerichtet, was das Aufwachsen der jungen Generation direkt oder indirekt beeinflusst (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2013, S. 59).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur
(http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61541/altersstruktur, 2016).
Durch einen generellen Anstieg des Einkommens, mehr Bildung, soziale Sicherheit, Freizeitmöglichkeiten und Mobilität in einer Gesellschaft ist eine zunehmende Indivi-dualisierung der Handlungsmöglichkeiten zu verzeichnen. Aufgrund dessen verfügen Menschen über die Freiheit, ihr Leben relativ autonom zu gestalten. Allerdings ist dies nicht nur die Freiheit, es wird sogar von den Menschen verlangt, weitestgehend eigen-ständig zu leben. Die Bevölkerung besitzt erweiterte Wahl- und Entscheidungsmöglich-keiten. Somit erhöht sich das Risiko des Scheiterns ebenso, wie die Freiheit der auto-nomen Lebensführung wächst (vgl. MÜLLER 2012):
„So schafft die Individualisierung zwar einerseits gesellschaftliche Freiräume, bringt aber für eine große Zahl von Jugendlichen – gerade für jene aus Familien mit einem relativ niedrigen ökonomischen, kulturellen und sozialen Status, der häufig mit Bildungsarmut einhergeht – auch Nachteile; sie gehören zu den ‚Individualisierungsverlierern‘“ (KNAPP 2014, S. 265).
Diese Individualisierung kann zu Gruppenbildungen Gleichgesinnter führen, die Halt in einer Gesellschaft vieler Möglichkeiten geben. Dadurch können Traditionen verloren ge-hen, neue Lebensformen etablieren sich. Infolgedessen ist es möglich, dass die Gruppe der sozial Schwachen wächst, die Schwierigkeiten in der Umsetzung der Eigenverant-wortlichkeit aufweist. Ihnen fehlen oft die notwendigen Ressourcen, vor allem die finan-ziellen Mittel, um diesem Gesellschaftswandel Stand zu halten. Menschen möchten ihren Lebensentwurf in der Regel in Gruppen ausleben. Daher grenzen sich Gruppen Gleich-gesinnter, welche als soziale Milieus bezeichnet werden, auch räumlich von der Masse ab. Aufgrund dessen kann die soziale Segregation zunehmen, wodurch soziale Ungleich-heiten und damit verbundene Benachteiligungen wachsen (vgl. MÜLLER 2012).
Mit dieser Individualisierung geht eine zunehmende Pluralisierung der Lebensstile einher: Die Gesellschaft entwickelt sich von einer Arbeitergesellschaft, bei welcher der Fokus auf der Sicherung der Grundbedürfnisse liegt, hin zu einer Erlebnisgesellschaft, die von unter-schiedlichen Lebensstilen geprägt ist, welche vom Alter, der Bildung und den individuellen Möglichkeiten abhängen. Diese Unterschiedlichkeit wird zunehmend von der Gesellschaft toleriert. Es kommt zu einem „Nebeneinander-Leben“ der verschiedenen „Lebensstil-Szenen“ und „-Milieus“, was gleichzeitig bedeutet, dass sich Bessergestellte wenig für die Belange sozial Schwacher interessieren. Daher haben Benachteiligte keine Lobby bzw. eine zu kleine Lobby, die sich für ihre Interessen einsetzt, und angesichts des geringen eigenen Bildungsstandes gelingt auch keine eigene politische Partizipation, um die beste-henden Verhältnisse zu den eigenen Gunsten zu verbessern. Infolgedessen werden Benachteiligungen verstärkt (vgl. SCHIMANK 2012). Vor allem die heutige Jugend wird durch diese gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt, was für ihre Identitätsbildung mit-verantwortlich ist. Zum besseren Verständnis wird nachfolgend die Altersklasse der Jugendlichen vorgestellt.
2.2 Jugendliche
Der Begriff Jugendliche wird im Hinblick auf zu bewältigende Aufgaben in dieser Phase sowie auf die „Generation Z“, die aktuell die jugendliche Generation personifiziert, im Fol-genden näher betrachtet.
2.2.1 Jugendliche und ihre Aufgaben
Der § 7 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII definiert als Jugendliche Personen zwischen 14 Jahren und 17 Jahren. Als junge Volljährige werden diejenigen bezeichnet, die 18 Jahre alt sind, das 26. Lebensjahr aber noch nicht vollendet haben (vgl. § 7 SGB VIII).
Der 14. Kinder- und Jugendbericht bezeichnet die Lebensphase zwischen der Kindheit und dem Erwachsenenalter als Jugend. Die Begriffe Jugend und Jugendliche meinen nicht dasselbe. Jugend wird weitestgehend als homogene Gruppe verstanden, während die Bezeichnung Jugendliche die Vielfalt jugendlicher Lebensformen einschließt. Schon 1975 betitelte der Soziologe Erwin Scheuch einen Aufsatz mit den Worten: „Die Jugend gibt es nicht“ (SCHEUCH 1975, S. 54). Die Jugend steht immer in Abhängigkeit zu der jeweiligen Gesellschaft (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAU-EN UND JUGEND 2013, S. 136).
Der Soziologe Helmut Schelsky, der sich der Jugendforschung widmete, definiert Jugend nicht als Generation, sondern als Rolle, die es einzunehmen gilt. Dadurch erhalten ihm zufolge Jugendliche die Möglichkeit, frühzeitig am Erwachsenenleben zu partizipieren. Er sieht die Jugend als Übergangsphase, um vollends in das Erwachsenenalter einzutreten. Von Jugendlichen wird laut Schelsky fast dasselbe gefordert wie von Erwachsenen: An dieser Stelle ist die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit und die damit einhergehende ökonomische Selbstständigkeit aufzuführen (vgl. SCHELSKY 1960, S. 108, zit. nach: ECARIUS/ EULENBACH/FUCHS/WALGENBACH 2011, S. 34).
Soziologisch betrachtet dient die Jugendzeit noch heute, in Analogie zu Schelsky, der Vorbereitung auf das Leben eines Erwachsenen. Diese Altersphase wird, wie jede andere auch, durch gesellschaftliche Rollenzuschreibungen normiert. Die Gesellschaft und deren Entwicklung, vor allem die Individualisierung der Lebenslagen und die Pluralisierung der Formen der Lebensführung, beeinflussen das Jugendalter. Es gibt keine einheitliche Erklärung dessen, was Jugendliche und diese Phase kennzeichnet (vgl. VEITH 2008, S. 76f.).
Eine Übereinstimmung aller Definitionen von Jugend gibt es Hans Thiersch zufolge in dem Sinne, dass die Jugend die Zeit „der wachen Erfahrung von gesellschaftlichen und eigenen Lebensmöglichkeiten [ist, d. Verf.], die Zeit, in der sich die eigenen Optionen und Erwartungen ausbilden in der Auseinandersetzung mit Vorgaben, Erwartungen und vor allem auch im Widerspruch zu ihnen. Jugend ist eine Zeit des Fragens, Suchens, und Experimentieren mit den eigenen Möglichkeiten, eine Zeit des Kampfes um die eigene Identität“ (THIERSCH 2014, S. 62).
Benno Hafeneger schreibt in einem Artikel über die junge Generation, die Jugend sei kei-ne Generation, kein soziales Problem und keine soziale Gruppe. Vielmehr wird das Auf-wachsen Jugendlicher vergesellschaftet. Demnach ist die Jugendphase eine Konstruk-tion und eine „gesellschaftlich institutionalisierte Lebensphase mit Mustern, die das Auf-wachsen strukturieren“ (HAFENEGER 2015, S. 15). Häufig ist das Jugendbild negativ besetzt, sodass Jugendliche scheinbar Probleme in einer Gesellschaft auslösen. Er plä-diert für die fachliche und politische Einmischung von Fachkräften, um ein positives Ju-gendbild hinsichtlich ihrer Ressourcen, Kompetenzen und Potenzialen zu bewirken (vgl. HAFENEGER 2015, S. 15ff.).
Vor allem ist diese Lebensphase von Übergangsprozessen in vielen Dimensionen ge-prägt: Zum einen ist der Eintritt in die Volljährigkeit und die damit verbundene Übernahme von Rechten und Pflichten kennzeichnend, zum anderen der Übergang von der Schule in einen Beruf (vgl. REISSIG 2015, S. 187).
Lothar Böhnisch zufolge kann es vorkommen, dass dieser Prozess aufgrund des sozialen Wandels mehrmals durchlaufen werden muss: „Der Beruf, den man mit 16 oder 20 Jahren erlernt hat, kann vielleicht in 10 oder 15 Jahren nicht mehr als Existenz- und Lebens-mittelpunkt tragen, der andauernde Zwang zum Mithalten steht am Horizont der Jugend-biografien“ (BÖHNISCH 2008, S. 26).
Jugendliche sind einem ständigen Veränderungsdruck ausgesetzt. Des Weiteren ist der Identitätsbildungsprozess zu nennen, der von unterschiedlichen Indikatoren, wie bei-spielsweise der Familie, den Peers, der Umwelt und den vorhandenen Möglichkeiten, ab-hängt und daher individuell verläuft. Ein gelingender Übergang von der Schule in einen Beruf setzt eine gute Schulbildung voraus, jedoch steigen die Anforderungen an Bildung und Ausbildung zunehmend, weshalb Unsicherheiten seitens der Jugendlichen wachsen. Der Druck der Gesellschaft, die entsprechende Eignung für den Arbeitsmarkt zu erlangen, wird größer (vgl. REISSIG 2015, S. 187f.).
Als klassische Aufgaben im Lebensabschnitt der Jugend sind die Ablösung vom Eltern-haus, die Peerorientierung, die Bewältigung der Pubertät und die zunehmende Selbst-ständigkeit zu nennen. Diese dienen der Identitätsbildung in personaler, kultureller und sozialer Hinsicht sowie der Erweiterung eigener Kompetenzen. Die Ausgestaltung der Aufgaben und damit verbunden die sich entwickelnde Identität sind individuell und hängen von den bestehenden Ressourcen ab. Westliche Industriegesellschaften erwarten von Jugendlichen, sich am Ende der Phase von der Herkunftsfamilie abgelöst zu haben und ökonomisch eigenständig zu sein bzw. die erforderlichen Schritte dazu eingeleitet zu ha-ben. Ergänzend sollen Jugendliche eine moralisch orientierte Identität entwickeln, die Achtsamkeit und Verantwortung anderen gegenüber einschließt. Von ihnen wird gefor-dert, eine gesellschaftskonforme Geschlechterrolle einzunehmen. Zugleich wird erwartet, dass Jugendliche ein Bewusstsein ihrer Selbstwirksamkeit ausbilden, d.h., dass sie sich ihrer Mitgestaltungs- und Teilhabemöglichkeiten bewusst werden und diese durch lebens-langes Lernen umsetzen. Diesen Anforderungen nach zu urteilen handelt es sich nicht in erster Linie um entwicklungspsychologische Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, sondern vielmehr um gesellschaftliche Erwartungen, die zu erfüllen sind. Vor allem Jugendliche sind durch ihre zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben in der sich wandelnden Gesell-schaft von Benachteiligungen betroffen: „Grundsätzlich hat ein Drittel der jungen Genera-tion Probleme, den Anforderungen von Entwicklungsaufgaben gerecht zu werden“ (KNECHT 2014, S. 261). Industriegesellschaften erwarten eine zunehmende Verantwor-tungsübernahme und Verselbstständigung der Mitglieder der Gesellschaft. Häufig beste-hen dafür nur unzureichende gesellschaftliche und institutionelle Bedingungen, die für die Umsetzung dessen erforderlich wären (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2013, S. 136ff.; vgl. MOSER 2010, S. 25ff.).
Da sich der Jugendscout, welcher im weiteren Verlauf gesondert vorgestellt wird, an junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren richtet, ist im Rahmen dieser Arbeit mit dem Begriff Jugendliche diese Altersgruppe gemeint. Aktuell wird häufig von der „Generation Z“ gesprochen. Diese Betitelung ist kennzeichnend für die „heutige“ Jugend.
2.2.2 Die Generation Z
Die „Generation Z“ folgt den „Generationen X und Y“. Sie beginnt in etwa mit dem Geburtsjahr 1995. Vorab ist es wichtig zu betonen, dass das Wort Generation nicht ein-deutig mit dem Geburtsjahr gleichzusetzen ist. Vielmehr ist das Wertemuster entschei-dend, welche Personen zu einer Generation gehören. Dabei verfolgen Menschen ähn-lichen Alters häufig gleiche Werte, wodurch die Annahme entstehen kann, dass eine gewisse Altersspanne eine Generation ausmacht. Die „Generation Z“ wird als luxus-liebend und freiheitsstrebend beschrieben. Tendenziell ist sie eher risikofreudig, weshalb häufige Wechsel der Zukunftsperspektiven denkbar sind. Zudem ist die „Generation Z“ durch das Aufwachsen mit neuen Medien und Technologien geprägt. Demnach ist es verständlich, dass diese Generation Kontakte in sozialen Netzwerken und Chaträumen[2] intensiv pflegt und meist die neuesten Smartphones[3] und andere technische Geräte besitzt. Die „Generation Z“ trennt Berufs- und Privatleben heute nur bedingt: Aufgrund der permanenten Erreichbarkeit via E-Mail und Telefon versteht sie Arbeit meist als Arbeit von zu Hause aus. Daher wird diese Generation als fordernd empfunden, die hohe Ansprüche an Arbeitsverhältnisse stellt. Arbeit stellt in der Regel für diese Generation lediglich ein Mittel zum Zweck dar. Wichtig für die Mitglieder der Generation ist ein angenehmes Arbeitsklima, sie wollen sich in einem Betrieb wohlfühlen. Generell weist die „Generation Z“ keine hohen Qualifikationen auf. Das kann auf den komprimierten Unterrichtsstoffs auf-grund der verkürzten Schullaufbahn zurückzuführen sein. Ferner wird sie als materialis-tisch angesehen und als eine Generation, die sich über den Besitz profiliert und dadurch versucht, das Selbstwertgefühl anzuheben. Die Darstellung im Internet führt neben dem Besitz ebenso zu einem erhöhten Selbstwertgefühl. Angesichts dieser Wertelage lässt sich nachvollziehen, warum die meisten Jugendlichen der heutigen Zeit ihr Leben in sozialen Netzwerken veröffentlichen und andere daran teilhaben lassen wollen. Aufgrund der Individualisierung und der Pluralisierung ist ein Individualismus als Rollenverständnis dieser Generation zu verzeichnen. Das Gruppengefühl entsteht nicht aus der Gesell-schaft, sondern aus der Gemeinschaft heraus. Eindrücklich ist die schwindende intrin-sische, altruistische und soziale Motivation. Die „Generation Z“ ist in allen drei Ebenen mit einer niedrigen Motivation anzusiedeln. Freizeit und extrinsische Anreize, wie beispiels-weise Geld, sind für sie handlungsleitend. 2012 wurde „Yolo“[4] zum Jugendwort des Jahres gewählt. Hier spiegeln sich die Freiheitsbestrebungen der Jugend von heute und ihr Drang, mit Spaß verbundene Aktivitäten auszuüben, wider. Verpflichtungen gehen Jugendliche auf der Basis dieser Grundhaltung nur ungern ein (vgl. SCHOLZ 2014, S. 7ff.). Die Beschreibung der „Generation Z“ ist wichtig, um zu prüfen und abzuwägen, wie der Jugendscout auf die Zielgruppe zugehen muss, um zu ihrer Teilhabe beitragen zu können. Der Begriff Teilhabe mit Blick auf die soziale und berufliche Dimension wird nach-folgend beleuchtet.
2.3 Teilhabe
Ein menschenwürdiges Leben bedarf mehr als der reinen Erfüllung der physischen Grundbedürfnisse. Zwischenmenschliche Beziehungen und ein Mindestanteil am gesell-schaftlichen, kulturellen und politischen Leben sichern das Existenzminimum einer Per-son. Die Existenz eines Menschen basiert auf sozialen Bezügen, weshalb die Partizipa-tion an diesen Dimensionen ebenso wichtig ist, wie die Sicherung der physischen Grund-bedürfnisse. Gesellschaftliche Teilhabe wird durch den Zugang zu öffentlichen Gütern sichergestellt, wie zum Beispiel (z.B.) zum Gesundheitssystem und Mobilität. Kulturelle Teilhabe schließt beispielsweise die Nutzung des Bildungssystems und von Freizeit-angeboten ein. Politische Teilhabe bedeutet die Gleichstellung aller und die Partizipation an politischen Entscheidungen. Teilhabe wird unterschiedlich gedeutet: Neben diesen Di-mensionen der Teilhabe sind in der Literatur noch die der wirtschaftlichen und sozialen Teilhabe zu finden. Die wirtschaftliche Teilhabe meint die Zugehörigkeit zum Arbeitsmarkt und die soziale Teilhabe definiert die Mitgliedschaft in sozialen Netzwerken und den Zu-gang zu persönlichen Beziehungen (vgl. INSTITUT FÜR SOZIALARBEIT UND SOZIAL-PÄDAGOGIK E.V. 2012, S. 16).
Der Begriff Teilhabe wird synonym zum Begriff Partizipation verwendet. Die Weltgesund-heitsorganisation definiert den Begriff als „Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR REHABILITATION 2012, S. 1). Lebenssituationen sind individuell zu betrachten: Hiermit können unterschiedliche Lebensfelder und Altersstruk-turen gemeint sein. Daraus lässt sich schließen, dass jede Bevölkerungsgruppe mit dem Thema Teilhabe in Verbindung steht. Das Lebensgefühl eines Menschen wird stark von den eigenen Gestaltungsmöglichkeiten beeinflusst. Wenn eine Person die Möglichkeiten besitzt, die ihr wichtigen und der Lebenssituation angemessenen sozialen Rollen zufrie-denstellend einzunehmen, dann ist eine Person sozial eingebunden – dann ist Teilhabe gegeben. Dementsprechend ist die Teilhabe eines Menschen einerseits von den indivi-duumsbezogenen Voraussetzungen, andererseits von den gesellschaftlichen Gegeben-heiten abhängig (vgl. DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR REHABILITATION 2012, S. 1ff.).
Der Begriff ist allerdings unscharf definiert, denn was Partizipation konkret bedeutet, geht aus der Bezeichnung des Einbezogenseins in Lebenssituationen nicht hervor. Um katego-risieren zu können, was als Partizipation gilt und was nicht, wurden verschiedene Stufen-modelle entwickelt. Sherry Arnstein unterteilte 1969 in der „ladder of citizen participation“ den Begriff Partizipation in drei Kategorien: Er differenziert zwischen Nicht-Partizipation, Schein-Partizipation und Partizipation. Diese sind wiederum in insgesamt acht Stufen ge-gliedert. Allgemein beschreibt er Partizipation als Teilhabe an Entscheidungsmacht, die das Verhältnis von Mitgliedern einer Gesellschaft steuert. Ihm zufolge genügt es nicht, Menschen Informationen zukommen zu lassen und sie zu beraten, dies versteht er als Schein-Partizipation. Erst ab der sechsten Stufe der Partnerschaft, d.h. der Beteiligung an Aushandlungsprozessen, spricht Arnstein von Partizipation. Dieser Stufe folgen die teil-weise und die vollkommene Entscheidungskompetenz in der Kategorie der Partizipation. „Partizipation ist auf Strukturen angewiesen, die Partizipation zulassen“ (URBAN 2005, S. 3). Strukturen, die zwar Beteiligung zulassen, aber nicht genutzt werden, führen nicht direkt zu Teilhabe. Individuen und Strukturen stehen somit in einer Wechselbeziehung zu-einander. Dies verdeutlicht, dass eine gewisse Mitwirkung von Individuen erforderlich ist, um Partizipation zu verwirklichen. Zudem ist Partizipation ein Erfahrungsprozess: Indivi-duen lernen durch Teilhabeerfahrungen, sich zu beteiligen und beteiligt zu werden. Dazu ist es notwendig, dass jedes Mitglied einer Gesellschaft zu eigenständigen Entscheidun-gen fähig ist. Der Auftrag der Sozialen Arbeit liegt demnach darin, Unterlegenen die Ent-scheidungsmacht zu übertragen und sie darin zu fördern, über sich selbst zu bestimmen (vgl. URBAN 2005, S. 2f.; vgl. PLUTO 2007, S. 53ff.).
Richard Schröder fügte 1995 darüber hinaus die Stufe der Selbstverwaltung hinzu, die über der Selbstbestimmung, d.h. der vollkommenen Entscheidungskompetenz, steht. In der Kinder- und Jugendhilfe beschreibt dies Prozesse, die Kinder und Jugendliche ohne jegliche Hilfe von Erwachsenen bewältigen. Schröder zufolge liegt der Erfolg einer Bera-tung bereits darin, eine angenehme Gesprächssituation zu gestalten. An dieser Stelle ist besonders auf die aufsuchende Arbeit hinzuweisen. Besucht man die AdressatInnen der Kinder- und Jugendhilfe in ihrer Lebenswelt, dann fühlen sie sich ernst genommen und gestalten den Prozess der Entscheidungsfindung aktiver mit (vgl. MOSER 2010, S. 102f.).
Partizipation ist ein Querschnittsthema aller Lebenslagen: In jedem Alter ist es notwendig, eigene Entscheidungen zu treffen. Die Fokussierung des achten Kinder- und Jugend-berichts auf die Lebensweltorientierung, welche die Partizipation als Handlungsmaxime festschreibt, hat diesen gesellschaftlichen Prozess der zunehmenden Beteiligung von BürgerInnen vorangetrieben. Vor allem der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen wird eine besondere Bedeutung im Partizipationsdiskurs zugeschrieben. Das SGB VIII schreibt dies gesetzlich fest: Gemäß § 1 Abs. 1 SGB VIII hat jeder junge Mensch das „Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§1 Abs. 1 SGB VIII). Nach § 8 SGB VIII wird der Grundsatz verfolgt, Kinder und Jugendliche in alle sie betreffenden Entscheidungen zu involvieren (vgl. § 8 SGB VIII). Durch Erfahrungen in diesem Bereich lernen Kinder und Jugendliche, Kompromisse auszuhandeln und Mehrheitsentscheidungen mitzutragen. Ebenso erleben sich Kinder und Jugendliche durch Teilhabe an unterschiedlichen Ebenen als für die Gesellschaft wichtige Mitglieder. Auf diese Weise gestalten sie ihre Lebenswelt selbst – Kinder und Jugendliche, die entweder nur geringe oder noch keine Partizipations-erfahrungen gemacht haben, entziehen sich meist der Gesellschaft (vgl. MOSER 2010, S. 73ff.).
Teilhabe setzt Wissen und Können voraus, ebenso wie Werte und Regeln, die es sich anzueignen gilt. Folglich geht Partizipation mit Lernen einher. Lernen ist in diesem Kon-text nicht mit der reinen Wissensaneignung gleichzusetzen, sondern meint darüber hinaus vielmehr den Erwerb von Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenzen. Sozialkompetenz schließt beispielsweise Empathie, Verständnis anderen gegenüber, Konflikt- und Lösungskompetenz ein. Das Realisieren eigener Interessen sowie die Empfindung des Selbstwerts und der Selbstwirksamkeit und des damit einhergehenden Selbstvertrauens zählen zur Selbstkompetenz. Die Methodenkompetenz beinhaltet z.B. die Kompetenz, das eigene Lernen zu reflektieren und gegebenenfalls zu optimieren. Als wichtige Voraus-setzung für die Auseinandersetzung mit den eigenen Problemen ist die Empfindung von Selbstwirksamkeit an dieser Stelle hervorzuheben, „denn je stärker die Überzeugung von den eigenen Kompetenzen ist, desto höhere Barrieren können überwunden werden“ (BANDURA 1977, 1997, zit. nach: MOSER 2010, S. 92).
Nicht jeder Mensch hat dieselben Möglichkeiten, sich gesellschaftlich zu engagieren. Die soziale Herkunft, vor allem die damit verbundenen finanziellen und bildungsbedingten Ressourcen, entscheiden darüber, wie sich jemand beteiligen kann. So führen beispiels-weise Armut, Existenzängste und Stigmatisierung zu sozialer Isolation und hindern die Betroffenen, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können (vgl. MOSER 2010, S. 156ff.).
In dieser Ausarbeitung werden die Dimensionen der sozialen und beruflichen Teilhabe be-trachtet, da der Jugendscout vor allem das Ziel der sozialen und beruflichen Integration, wenn nicht sogar Inklusion, verfolgt. Eine Inklusion ist jedoch nicht nur von der Arbeit des Jugendscouts, sondern auch von einer gesellschaftlichen Entwicklung abhängig, was der Jugendscout nicht alleine steuern kann. Zunächst werden in einigen Sätzen die soziale und die berufliche Teilhabe definiert, bevor die theoretische Fundierung der Methoden des Jugendscouts dargestellt wird.
2.3.1 Soziale Teilhabe
Wie bereits oben angeführt bedeutet soziale Teilhabe die Mitgliedschaft in sozialen Netz-werken und den Zugang zu persönlichen Beziehungen. Diese Analyse weitet den Begriff „soziale Teilhabe“ insoweit aus, dass die kulturelle Teilhabe, d.h. der Zugang zu Bildung und Freizeitangeboten, und die gesellschaftliche Teilhabe, also die Gleichstellung aller, mit dieser Bezeichnung eingeschlossen werden.
Mit sozialer Teilhabe ist „die Teilhabe (…) an Errungenschaften eines ‚sozialen Gemein-wesen‘ – angefangen von guten Lebens- und Wohnverhältnissen, Sozial- und Gesund-heitsschutz, ausreichenden und allgemein zugänglichen Bildungschancen und der Inte-gration in den Arbeitsmarkt bis hin zu vielfältigen Freizeit- und Selbstverwirklichungsmög-lichkeiten“ (BEIRAT INTEGRATION 2013, S. 1) gemeint.
Soziale Teilhabe ist darauf angewiesen, dass eine Gesellschaft ihren Mitgliedern Chan-cen eröffnet, sodass Teilhabemöglichkeiten durch BürgerInnen mitgestaltet werden kön-nen. Die gleichberechtigte Einbeziehung von Individuen in Gesellschaftsprozesse ist kein einmal erreichter Zustand, sondern ein dynamischer und verzahnter Ablauf, welcher von der Gesellschaft gefördert werden muss (vgl. BEIRAT INTEGRATION 2013, S. 1f.).
Laut ICF, der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-sundheit, ist soziale Teilhabe gelungen, wenn Individuen an den Bereichen „Elementares Lernen“, „Allgemeine Aufgaben und Anforderungen“, „Kommunikation“, „Mobilität“, „Selbstversorgung“, „Häusliches Leben“, „Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen“, „Bedeutende Lebensbereiche“ sowie „Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben“ partizipieren. Die volle Teilhabe in diesen genannten Bereichen ist für ein selbst-ständiges, gelingendes Leben elementar (vgl. WORLD HEALTH ORGANIZATION 2005, S. 33).
Zum Führen eines menschenwürdigen Lebens können die Sozialhilfe und deren Leistungen beitragen, sofern Personen hilfebedürftig und zu diesen Leistungen berechtigt sind. In § 34 SGB XII sind Leistungen für Bildung und Teilhabe festgelegt, die Schüle-rInnen, deren Familien auf Sozialhilfe angewiesen sind, eine angemessene Teilnahme am Schulgeschehen ermöglichen. Dieses trägt zur schulischen Bildung und zur Bildung sozialer und Selbstkompetenzen bei, etwa durch die Ermöglichung der Teilnahme an Klassenfahrten und Schulausflügen (vgl. §§ 1 und 34 SGB XII).
Speziell die Teilhabe von Menschen mit Behinderung oder von Menschen, die von Behin-derung bedroht sind, ist im SGB IX, dem Rehabilitations- und Teilhabegesetz behinderter Menschen, gesetzlich verankert (vgl. SGB IX).
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder see-lische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Ge-sellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist“ (§ 2 Abs. 1 SGB IX).
Nach dem SGB IX erhalten diese Menschen Leistungen zur Förderung ihrer Selbstbe-stimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Diese Leistun-gen zur Teilhabe sind unterteilt in Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teil-habe am Arbeitsleben, unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen und Leis-tungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (vgl. §§ 1 und 5 SGB IX).
„Zentraler Integrations- und Teilhabemodus in modernen Gesellschaften ist Erwerbs-arbeit“ (VON SCHWANENFLÜGEL 2015, S. 56). Das bedeutet, dass sich die soziale Teil-habe und die berufliche Teilhabe gegenseitig bedingen: Ohne Einkommen sind Aktivitäten des gesellschaftlichen Lebens nicht möglich. Eine den Normen der Gesellschaft unzu-reichende soziale Teilhabe, d.h. schlechte Bildungsvoraussetzungen, schlechte Wohn-verhältnisse sowie eingeschränkte Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, erschweren eine berufliche Teilhabe eminent. Eine Exklusion aus dem Arbeitsmarkt führt allerdings zu Ein-kommensarmut, die wiederum schlechte Wohn- und Lebensverhältnisse sowie einge-schränkte Selbstverwirklichungsmöglichkeiten bedingt. Das Normalitätsverständnis west-licher Industriegesellschaften, demnach auch von Deutschland, verknüpft die Beendigung der Jugendphase mit der ökonomischen Eigenständigkeit. Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen stehen, bleiben dem Soziologen Stefan Hradil zufolge meist in sozia-len Randlagen hängen (vgl. HRADIL 2001, S. 180ff.).
Daher wird der beruflichen Teilhabe eine gesonderte Stellung beigemessen, wenn es um die soziale Teilhabe und die Inklusion in eine Gesellschaft geht.
2.3.2 Berufliche Teilhabe
Unter dem Kapitel 2.3 Teilhabe wurde die wirtschaftliche Teilhabe als Teilhabe am Ar-beitsmarkt aufgeführt. Diese Ausarbeitung bezeichnet diese Art von Teilhabe als beruf-liche Teilhabe, um das Ziel des Jugendscouts der beruflichen Integration mit dieser Be-zeichnung einzuschließen. Die Gesellschaft Deutschlands ist durch eine Erwerbs- und Leistungsorientierung gekennzeichnet, weshalb es ersichtlich ist, dass sich die Teilhabe an der Gesellschaft im Wesentlichen über die Teilhabe am Erwerbsleben definiert (vgl. BRÜNING/ KUWAN 2002, S. 11).
Als gelingende berufliche Teilhabe wird der Übergang in das Arbeitsleben gesehen. Dieser Übergang hängt allerdings von unterschiedlichen Faktoren ab: Neben der sozialen Herkunft und damit verbundenen Bildungskompetenzen, Werten und Normen ist auch die soziale Integration in eine Gesellschaft verantwortlich dafür, wie der Übergang in das Arbeitsleben verläuft. Jugendliche ohne oder mit Hauptschulabschluss gehören zu der Gruppe, deren berufliche Integration gefährdet und deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, d.h. deren soziale Teilhabe, damit ebenso bedroht ist (vgl. PUHR 2009, S. 55ff.).
[...]
[1] Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend präzisiert, dass keine offizielle Definition zu Seniorinnen und Senioren existiert. Das Altern ist ein individueller Prozess. Die Begriffe „Seniorinnen und Senioren“ orientieren sich an spezifischen Altersgrenzen, zum einen am gesetzlichen Renteneintrittsalter, zum anderen an der Gruppe älterer Arbeitnehmenden im Alter zwischen 55 und 64 Jahren (vgl. BUNDESMINIS-TERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2008, S. 5).
[2] Ein Chat ist laut Duden ein „im Internet angebotenes Medium, mit dem online Kontakte hergestellt und Infor-mationen ausgetauscht werden können“ (http://www.duden.de/rechtschreibung/Chat, 2016).
[3] „Die Smartphone-Definition (…) bezeichnet im Wesentlichen Geräte, die für die intensive mobile Internet-nutzung entworfen wurden und dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Zusatzsoftware (sogenannte ‚Applica-tions‘ – kurz: ‚Apps‘) zu installieren“ (AMBERG/LANG 2011, S. 308). So kann eine kontinuierliche Erreich-barkeit über E-Mail oder soziale Netzwerke gewährleistet werden. Ein Smartphone ist nicht nur für das Telefo-nieren ausgelegt, sondern vielmehr für die Nutzung zusätzlich installierbarer Anwendungen. Solche Anwen-dungen sind beispielsweise Chaträume, soziale Netzwerke, E-Mail-Portale oder Spiele (vgl. AMBERG/LANG 2011, S. 25ff.).
[4] Abkürzung für “You only live once”, zu Deutsch: Man lebt nur einmal (vgl. http://www.spiegel.de/ schulspiegel/jugendwort-des-jahres-2012-jury-kuert-yolo-a-869201.html, 2016).
- Arbeit zitieren
- Lara Bungartz (Autor:in), 2016, Inwiefern kann der Jugendscout das Leben benachteiligter Jugendlicher positiv beeinflussen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377577
Kostenlos Autor werden











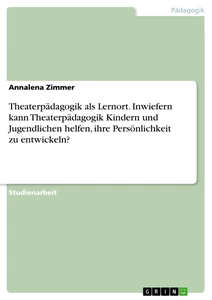










Kommentare