Leseprobe
Gliederung
Einleitung
1. Depressionen
1.1 Definitionen
1.2 Symptomatik
1.3 Verlaufsformen
1.4 Ätiologie
2. Alkoholkonsum und Alkoholproblematik
2.1 Klassifikation der Konsumformen
2.2 Die Entwicklung pathologischer Trinkmotive
2.3 Formen des Trinkverhaltens nach Jellinek
3. Komorbidität psychischer Störungen und Störungen durch Substanzkonsum
3.1 Klassifikation nach ICD-10 und DSM-5
3.2 Ätiologiemodelle bei Doppeldiagnosen und komorbiden Störungen
3.3 Epidemiologie
4. Grundlagen und Konzept der Motivierenden Gesprächsführung
4.1 Ziele der Motivierenden Gesprächsführung
4.2 Theoretische Grundlagen der Motivierenden Gesprächsführung
4.3 Prinzipien der Motivierenden Gesprächsführung
4.4 Strategien der Motivierenden Gesprächsführung
5. Modifikation der Motivierenden Gesprächsführung
5.1 Bei Klienten/Patienten mit Depressionen
5.2 Bei Klienten/Patienten mit Depressionen und komorbider Alkoholproblematik
5.3 Grenzen und ethische Aspekte der Motivierenden Gesprächsführung
6. Motivierende Gesprächsführung in der Psychosozialen Arbeit
6.1 Rahmenbedingungen Sozialpsychiatrischer Zentren
6.2 Die Anwendung der Motivierenden Gesprächsführung in SPZ
7. Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die Soziale Arbeit und mit ihr die eigenständige Teildisziplin der klinischen Sozialarbeit richtet sich in Form spezifischer Methoden an die Menschen, die von sozio-psycho-somatischen Störungen, Erkrankungen und Behinderungen betroffen sind. Sie verfolgt dabei das Ziel, die Beschwerden psychisch kranker Menschen sowie deren Angehörigen durch den diagnostisch fundierten Einsatz sozialer Interventionen zu verringern oder zu beseitigen, deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und den Betroffenen zu mehr Lebensqualität zu verhelfen (vgl. Bischkopf et al. 2017: 11). Im Rahmen meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit im Sozialpsychiatrischen Zentrum Porz und in der Theorie im Zuge meines Studiums der Sozialen Arbeit an der katholischen Hochschule Köln, konnte ich in Bezug auf psychische Störungen und ihren Erscheinungsformen sowohl praktische Erfahrungen sammeln als auch bereits bestehende theoretische Kenntnisse vertiefen. Vor diesem Hintergrund habe ich die Beratung von und den Umgang mit den Klienten als besonders schwierig als auch interessant erlebt, bei denen gleichzeitig sowohl eine psychische Störung (im folgenden PS abgekürzt) als auch eine Störung durch Substanzkonsum (folgend SSK abgekürzt) vorlagen. Dieses zeitgleiche Zusammenwirken zweier Störungen, im Fachterminus auch als Komorbidität oder häufig als Doppeldiagnose (folgend DD abgekürzt) begrifflich erfasst, ist nicht nur eine erhebliche Belastung für die Betroffenen selbst, sondern es stellt auch die in der Regelversorgung tätigen professionellen Helfer vor dem Hintergrund komplexer Kausalbeziehungen zwischen den Störungen vor verschiedene Anforderungen, um Veränderungsprozesse zu bewirken. Gespräche mit Klienten, Angehörigen sowie kooperierenden Fachkräften nehmen hier eine besondere und unverzichtbare Funktion ein. Sie ermöglichen einerseits die Erhebung und Klärung des Hilfebedarfs unter Berücksichtigung der individuellen Problemlagen und Biografien der Klienten und stellen andererseits bei der Durchführung der entsprechenden psychosozialen Unterstützung die Grundlage dar, auf der sich die gesamte Hilfestellung vollzieht und dienen darüber hinaus auch dem Beziehungsaufbau zwischen Klient und Sozialarbeiter. Viele Konzepte und Vorgehensweisen der klinischen Sozialarbeit beruhen auf einem partnerschaftlichen und personenzentrierten Ansatz. Diese Ansätze beinhalten eine bestimmte Vorgehensweise, die durch einen konstruktiven und zieloffenen Dialog und eine motivierende Grundhaltung geprägt sind (vgl. Kremer und Schulz 2012: 7). Ihr zentraler Ausgangs- und Bezugspunkt ist die subjektive Sicht der Erkrankten. Die Interventionen der Sozialen Arbeit in Form struktureller, personeller, sozialer und monetärer Hilfen richten sich nach ihrem basalen Anliegen, Klienten ein möglichst selbstbestimmtes und autonomes Leben zu ermöglichen. Dieser auf Ressourcenaktivierung orientierte dialogische Prozess wird auch unter schwierigen Bedingungen, wie beispielsweise Unfreiwilligkeit oder Widerstand auf Kooperation hin zur Problemlösung ausgerichtet. Genau an diesen Schnittstellen setzt das Konzept der Motivierenden Gesprächsführung an (vgl. Kap. 4). Die Motivierende Gesprächsführung (folgend MG abgekürzt) hat sich hier zwar als sehr empfehlenswerte Komponente eines umfassenden Behandlungsansatzes für Patienten mit DD erwiesen (vgl. Arkowitz et al. 2010: 291), es bleibt jedoch unter Berücksichtigung eventuell bestehender störungsspezifischer Beeinträchtigungen der Klienten die zentrale Frage dieser Arbeit zu klären, ob die MG bei Klienten mit Doppeldiagnosen unverändert angewendet werden kann, oder ob diese in der Praxis modifiziert werden muss, um den klinischen Herausforderungen, die diese Patientengruppe mit sich bringt, gerecht zu werden? Die von mir in der vorliegenden Arbeit beschriebene Komorbiditätsform von Depressionen und SSK in Form eines problematischen Alkoholkonsums wird beispielhaft und mit dem Wissen um die diversen weiteren Formen und Ausprägungen von Menschen mit Mehrfachdiagnosen gewählt, um die Anwendung der MG im Kontext Sozialpsychiatrischer Zentren und der Beratung komorbider Klienten darzustellen. Zum besseren Verständnis werden zunächst die wesentlichen Merkmale depressiver Störungen (folgend DS abgekürzt) sowie möglicher Ursachen dargestellt (vgl. Kap. 1). Darauf aufbauend werden die zentralen Aspekte und Formen eines problematischen Alkoholkonsums diskutiert (vgl. Kap. 2). Die möglichen Kausalbeziehungen zwischen Depressionen und eines problematischen Alkoholkonsums werden im dritten Kapitel unter dem Themenkomplex Komorbidität beschrieben und auf verschiedene Störungsmodelle übertragen. Es wird weiterführend herauszuarbeiten sein, welche Grundhaltung, theoretischen Modelle, Prinzipien und Strategien der MG zu Grunde liegen (vgl. Kap. 4). Ausgehend von der zentralen Fragestellung werden in einem weiteren Schritt zunächst mögliche und empfohlene Modifikationen der MG in Bezug auf deren Anwendung bei Depressionen erläutert (vgl. Kap. 5.1) und nachfolgend um den Aspekt der Alkoholproblematik (vgl. Kap. 5.2) sowohl erweitert als auch reflektiert. Die Grenzen des Konzeptes werden weiterführend aus verschiedenen Perspektiven (Klient/Sozialarbeiter, Hilfesysteme) betrachtet, als auch in Bezug auf die persönliche, fachliche und ethische Dimension diskutiert (vgl. Kap. 5.3). Im 6. Kapitel wird das Konzept der MG hinsichtlich der hier erörterten Komorbiditätsform vor dem Hintergrund der konzeptionellen Besonderheiten Sozialpsychiatrischer Zentren (folgend SPZ abgekürzt) auf dessen Anwendbarkeit überprüft, sowie mögliche Schwerpunkte der Beratung herausgearbeitet. In der Schlussbetrachtung (vgl. Kap. 7) wird das Potential des Konzeptes als auch dessen Grenzen in der Sozialen Arbeit zusammengefasst.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit für Personen stets die männliche Sprachform verwendet; die weibliche Form ist selbstverständlich eingeschlossen.
1. Depressionen
Die Depression (lat. deprimere „niederdrücken“) gehört zu den häufigsten Formen psychischer Störungen. Aktuelle und internationale Bevölkerungsstudien sowie Arbeitsunfähigkeitsstatistiken bestätigen, dass Depressionen in westlichen Industrienationen seit Beginn der 1990-Jahre noch vor Volkserkrankungen wie Diabetes mellitus und koronaren Herzerkrankungen als die gesellschaftlich belastensde Krankheitsgruppe einzuordnen ist. Die Lebenszeitprävalenz liegt in Deutschland in Bezug auf Depressionen bei 19% (vgl. Wittchen et al. 2010: 7).
Der Begriff der Depression oder die Formulierung des Deprimiert-Seins werden in unserem täglichen Sprachgebrauch im Kontext eines negativ konnotierten Stimmungszustandes recht häufig und synonym verwendet. Daher gilt es zunächst eine Abgrenzung zwischen Trauer und Depression vorzunehmen. Sprechen verschiedene Menschen über Depressionen, meinen sie häufig nicht das Gleiche und kommen schnell zu einer aus dem Alltagswissen entspringenden Deutungszuweisung. So führt beispielsweise der Inhalt eines Buches, ein Konflikt mit dem Partner oder einfach nur das triste Wetter dazu, dass wir uns deprimiert oder niedergeschlagen fühlen. In den meisten Fällen handelt es sich hier um normale seelische Zustände in Form von Stimmungstiefs oder Stimmungsschwankungen, die nach kurzer Zeit wieder abklingen (vgl. Meyendorf und Kabza 2009: 18). Auch die Trauer, die meistens mit Verlusterlebnissen einhergeht, wie z.B. das Ende einer Beziehung oder der Tod eines nahestehenden Menschen, ist zunächst nichts anderes als eine natürliche seelische Reaktion auf eben dieses Ereignis. Durchlaufen werden für gewöhnlich verschiedene Stadien der Trauerarbeit, deren Abfolge meistens ähnlich ist, sich jedoch nach Dauer und Intensität individuell unterscheidet. Auch körperliche Auswirkungen wie Schlafstörungen, innere Unruhe oder Appetitstörungen können somatische Folgen der Trauer sein. Am Ende eines bewältigten Trauerprozesses, der neben der Trauer auch andere vielfältige Gefühle wie Angst, Scham, Schuld oder Wut beinhalten kann, gelingt es den Betroffenen in der Regel den Verlust zu verarbeiten (vgl. Wolfersdorf 2008: 25). Gerät das Verhältnis zwischen auslösendem Ereignis, Intensität und Dauer der Trauerreaktion aus dem Gleichgewicht und kann sich die betroffene Person nicht mehr aus dem Kreislauf aus negativen Gedankenschleifen und einem chronischen Gefühl der Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und der inneren Leere lösen, so können dies schon konkrete Hinweise auf eine mögliche depressive Episode sein. Als wesentlichen Unterschied zwischen Trauer und Depression beschreiben Meyendorf und Kabza (vgl. 2009: 24), dass Depressive die Fähigkeit verloren haben Gefühle zu empfinden. Während es sich also bei der Trauerarbeit um ein „aktives Geschehen“ (ebd.) handelt, welches das Wahrnehmen und die Verarbeitung von negativen Gefühlen beinhaltet, ist das depressive Erleben durch seine Passivität und Unfähigkeit gekennzeichnet diese Gefühle überhaupt zu empfinden. Wie in den folgenden Kapiteln eingehender beschrieben, sind bei der Entstehung von Depressionen immer mehrere Faktoren beteiligt (vgl. Kap. 1.4). In Bezug auf die vorliegende Thematik dieser Arbeit sowie die zentrale Fragestellung, bleibt es weiterhin wichtig zu erwähnen, dass sich die verschiedenen depressiven Symptome auf den gesamten Menschen auswirken (vgl. Kap. 1.2 und 1.3). Die folgenden Definitionen ermöglichen hier einen ersten Einblick, auf welchen verschiedenen Ebenen diese spezifischen Symptome wirksam sind und mit welchen Beeinträchtigungen dies für die Betroffenen verbunden ist.
1.1 Definitionen
1. Wolfersdorf (2007: 19) beschreibt die Depression als „schwere psychische Erkrankung, die den gesamten Menschen beeinträchtigt, ihn in seinem körperlichen Befinden, in seinem Denken, in seiner Gestimmtheit, in seinen Gefühlen, in seinen Bezügen zur Umwelt, aber auch in Bezug zur eigenen Person und zur Zukunft bedroht“.
2. „Eine Depression ist eine weit verbreitetet psychische Störung, die durch Traurigkeit, Interessenlosigkeit und den Verlust an Genussfähigkeit, Schuldgefühle und geringes Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Konzentrationsschwächen gekennzeichnet sein kann. Sie kann über längere Zeit oder wiederkehrend auftreten und die Fähigkeit einer Person zu arbeiten, zu lernen oder einfach zu leben beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann eine Depression zum Suizid führen“(WHO, o.J.).
3. Meyendorf und Kabza (2009: 27) bezeichnen die Depression „als ernst zu nehmende Krankheit, die mit einer tiefgreifenden Veränderung der Gemütslage, nicht aber des Verstandes einhergeht. Das Denken und die Wahrnehmung werden jedoch durch das kranke Gefühl oder Gemüt beeinflusst“.
Diese Definitionen verdeutlichen, dass die depressive Symptomatik auf allen Ebenen des menschlichen Daseins wirksam ist. Betroffen sind sowohl die Selbstbewertung und Selbsteinschätzung, die körperliche Befindlichkeit, als auch das gesamte Erleben, Handeln und Denken.
1.2 Symptomatik
Im Rahmen der Erfassung depressiver Störungen haben sich die beiden weltweit etablierten Klassifikationssysteme ICD-10 (Internationales Klassifikationssystem psychischer Störungen; in der zehnten Überarbeitung) und DSM-5 (Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen; fünfte Auflage der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung) weitestgehend angeglichen (vgl. Wittchen et. al. 2010: 7). Sowohl im ICD-10 als auch im DSM-5 wird zwischen bipolarer, bzw. manisch-depressiver und unipolarer Symptomatik unterschieden und je nach Schwere, Ausprägungsgrad und Verlaufsform kodiert (vgl. Rahn und Mahnkopf 2005: 311). Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Relevanz wird daher bei der Beschreibung der wesentlichen Kriterien DS folgend der ICD-10 verwendet. Diese Kriterien basieren primär auf den Symptomen der Erkrankung, ihres Fortbestehens und der Schwere, den daraus resultierenden Einschränkungen und Behinderungen sowie ihrem Verlauf (vgl. Wittchen et. al. 2010: 7).
Die Zuordnung der depressiven Symptomatik erfolgt im ICD-10 in den Kategorien Hauptsymptome (A)und Nebensymptome (B).
Die Einschlusskriterien einer depressiven Episode sind nach dem ICD-10 erfüllt, wenn während mindestens ca. 2 Wochen:
A mindestens 2 (bzw. für eine schwere Episode 3) der folgenden Symptome vorliegen:
- depressive Stimmung, in einem für den Betroffenen deutlich ungewöhnlichen Ausmaß, die meiste Zeit des Tages, fast jeden Tag und im Wesentlichen unbeeinflusst von den Umständen
- Interessen oder Freudverlust an Aktivitäten, die normalerweise angenehm waren
- verminderter Antrieb oder gesteigerte Ermüdbarkeit
B und zusätzlich mindestens eines der folgenden Symptome vorliegt, wobei die Gesamtzahl der Symptome je nach Schweregrad mindestens 4-8 beträgt:
- Verlust des Selbstvertrauens oder des Selbstwertgefühls
- Unbegründete Selbstvorwürfe oder ausgeprägte, unangemessene Schuldgefühle
- wiederkehrende Gedanken an Tod oder an Suizid; suizidales Verhalten
- Klagen über oder Nachweis eines verminderten Denk- oder Konzentrationsvermögens, Unschlüssigkeit oder Unentschlossenheit
- psychomotorische Agitiertheit oder Hemmung (subjektiv oder objektiv)
- Schlafstörungen jeder Art
- Appetitverlust oder gesteigerter Appetit mit entsprechender Gewichtsveränderung
Depressive Störungen werden im ICD-10 den sogenannten affektiven Störungen zugeordnet und je nach Ausprägung der Symptomatik in drei Schweregrade eingeteilt (leicht, mittel und schwer). Eine leichte depressive Episode liegt vor, wenn 2 der ersten 3 Hauptsymptome und zwei Nebensymptomen auftreten. Bei einer mittelgradigen depressiven Episode liegen zwei Hauptsymptome und mindestens drei, höchstens aber vier Zusatzsymptomen vor. Schwere depressive Episoden werden diagnostiziert wenn alle drei Hauptsymptome und mindestens vier der Nebensymptome vorliegen (vgl. Dilling et al. 2005: 139).
Die verschiedenen Krankheitsverläufe, die Intensität sowie die hohe Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten depressiver Symptome, haben dazu geführt, dass die Depression auch als die Krankheit der „vielen Gesichter“ bezeichnet wird (Meyendorf und Kabza 2009: 88). In der klinischen Psychologie werden heute daher auch die Termini depressive Störung oder depressives Syndrom verwendet, da hierunter verschiedene Symptomkonstellationen und Erscheinungsformen subsumiert werden können. Die depressive Symptomatik zeichnet sich nach Wolfersdorf (2008: 31/35) in erster Linie durch einen „großen Leidensdruck“ sowie ein „reduziertes Lebensgefühl“ aus. Die Beschwerden, die in Verbindung mit Depressionen genannt werden, bzw. auftreten, lassen sich in vier Kategorien aufteilen.
1. Auf der vegetativen Ebene treten Symptome wie Schlafstörungen, innere sowie äußere Unruhe, Appetit-/Libido-/ und Leibgefühlstörungen sowie Vitalitätsverlust auf (vgl. Mahnkopf 2009: 11).
2. Die affektive Ebene ist geprägt durch eine depressive Herabgestimmtheit, die auch als „erlebte Leblosigkeit“ oder „vitale Traurigkeit“ bezeichnet wird (Wolfersdorf 2008: 41). Dieser schwer zu fassende Zustand kann auch als „emotionaler Heimatverlust“ im Sinne eines Abgetrennt-Seins von sich selbst verstanden werden (ebd.: 41).
3. Im Bereich des Verhaltens und Handelns tritt das depressive Syndrom vor allem in Verbindung mit Antriebsstörungen und sozialem Rückzug auf. Der Verlust an Interesse sowohl im Bezug zu sich selbst als auch in der Folge zum sozialen Umfeld äußert sich mit zunehmendem Schweregrad in der Unfähigkeit aktiv zu werden. Auf der psychomotorischen Ebene zeigen sich Beeinträchtigungen des Aktivitätsniveaus in Richtung einer psychomotorischen Agitiertheit (körperlich erlebte Unruhe, Getriebenheit) oder einer psychomotorischen Hemmung, die z.B. durch eine Reduktion der Mimik und Gestik als auch der Bewegungsabläufe zu erkennen ist (vgl. ebd.: 71).
4. Das depressive Denken lässt sich zunächst nach formalen Abläufen sowie der inhaltlichen Thematik differenzieren. Konkret sind sowohl die Struktur, bzw. der Vorgang des Denkens (Wie wird gedacht?) als auch der Inhalt (Was wird gedacht?) beeinträchtigt. Auf der formalen Ebene sind Konzentrationsstörungen, Gedankenabreißen, Denkhemmungen, umständliches und eingeengtes Denken als auch das Verhaften in bestimmten negativ geprägten Gedankenschleifen typisch. Depressive grübeln oft nur bruchstückhaft immer wieder um das gleiche Thema herum, ohne sich davon lösen zu können. Darüber hinaus kann bei einigen Depressiven auch eine Verlangsamung des Denkens beobachtet werden, dass sich durch eine monotone Sprache, langsamen Formulierungen sowie einer inhaltlichen Verarmung zeigt (vgl. ebd.: 51). Diese Hemmungsphänomene, erschweren neben eines Mangels an Antrieb, Interesse und Freude, zusätzlich den Zugang zu neuen Sichtweisen oder Perspektiven. In Bezug auf die inhaltlichen Denkstörungen lässt sich sagen, dass Depressive zunächst nichts anderes denken als „gesunde“ Menschen auch. Der zentrale Unterschied ist nach Wolfersdorf (2008: 52) jedoch, „das sie anders denken“. Der Gedanke des Nichtkönnens, sowie an die eigene Unzulänglichkeit, führen zu Schuldgefühlen und Gedanken der Minderwertigkeit. Die Folge sind Selbstabwertung und Versagensgefühle. Typische depressive Gedanken und Aussagen sind: „Ich bin schuld, dass…“, „ich kann nichts“, „ich bin eine Last für andere…“.
1.3 Verlaufsformen
Typisch sind meist episodische Krankheitsphasen, die durch längere symptomfreie Zeiten unterbrochen sind. Tritt die depressive Störung nur einmalig auf, handelt es sich um eine depressive Episode (vgl. Dilling et al. 2005: 139 ff.). Bei ca. 50 % der Patienten, die bereits an einer depressiven Episode erkrankt sind, folgt auch eine zweite. Bei dieser Patientengruppe besteht eine 80-90% Wahrscheinlichkeit auch an einer dritten Episode zu erkranken. Mit zunehmender Phasenzahl steigt auch das Risiko einer erneuten depressiven Episode. Diese Verlaufsform wird als rezidivierende, also wiederkehrende depressive Störung bezeichnet (vgl. Mahnkopf 2009: 18).
Neben diesen episodischen Verläufen wird im ICD-10 in vier weitere Verlaufsformen unterteilt.
Bei den bipolaren affektiven Störungen stehen sich zwei Stimmungspole gegenüber. Typisch für dieses Krankheitsbild ist ein Wechsel zwischen manischen oder hypomanischen und depressiven Episoden sowie Phasen ohne Krankheitssymptome. Die Dauer der depressiven Episoden überwiegt zumeist die der (hypo-)manischen Episoden. Zeichen einer manischen Episode sind eine gehobene und/oder gereizte Stimmung, übersteigerte Aktivität, Ideen- und Gedankenflut, Rededrang, vermindertes Schlafbedürfnis und Selbstüberschätzung (vgl. Wittchen et al. 2010: 12). Darüber hinaus können bipolare Störungen auch mit psychotischen Symptomen wie z.B. Wahngedanken und Halluzinationen auftreten (vgl. Dilling et al. 2005: 137).
Die zyklothyme Störung ist eine leichte Form der bipolaren Störung, deren wesentliche Kennzeichen in einer anhaltenden Stimmungsinstabilität mit zahlreichen Perioden leichter Depression und leicht gehobener Stimmung besteht (vgl. ebd.: 149).
Bei anhaltenden affektiven Störungen mit eher leichtem dafür chronischem Krankheitsverlauf von mindestens 2 Jahren, kommt die Diagnose einer Dysthymie (früher auch als neurotische Depression bezeichnet) in Betracht. Bei diesem Krankheitsbild ist es möglich, dass sich neben dem Fortbestehen der Grunderkrankung zusätzlich eine depressive Episode entwickelt. In diesem Fall handelt es sich um eine „double depression“ (vgl. Mahnkopf 2009: 19).
1.4 Ätiologie
Die Klassifikation depressiver Erkrankungen hat in den letzten Jahrzehnten einen Wandel erfahren. So wurden depressive Störungen vor diesem Wandel nach ihren angenommenen Ursachen in drei Hauptgruppen mit verschiedenen Untergruppen eingeteilt und je nach Relevanz in psychogene (psychisch bedingt), somatogene (körperlich bedingt) und endogene (von innen heraus) Depressionen unterteilt (vgl. Meyendorf und Kabza 2009: 62). Aufgrund der Vielzahl an möglichen Wirkfaktoren und der Komplexität des Systems Mensch erscheint es nachvollziehbar, dass es bis heute kein einheitliches, empirisch gestütztes Modell gibt, welches die Entstehung von Depressionen zusammenfasst. Dies liegt u.a. daran, dass die unterschiedlichen Forschungsdisziplinen und deren Erklärungsmodelle der Depression ursächlich verschiedene Faktoren zugrunde legen. Zudem treten Depressionen häufig gemeinsam mit anderen psychischen Erkrankungen und somatischen Störungen auf. Diese spezifische Form von Komorbidität innerhalb einer diagnostischen Gruppierung, wird auch als homotypisch bezeichnet und trifft bei depressiven Episoden auf 60% und bei der Dysthymie auf 80% der Erkrankten zu. Zu den häufigsten Komorbiditätsformen gehören hier alle Arten von Angststörungen. Diese treten in den meisten Fällen vor der ersten DS auf (vgl. Wittchen et al. 2010: 21).
Je nach wissenschaftlicher Verortung (Biologie, Psychologie, Pharmakologie) haben sich verschiedene Ansätze entwickelt. Neurobiologische Modelle sehen bei Entstehung depressiver Störungen genetische Faktoren, sowie einen gestörten Hirnstoffwechsel als maßgeblich. Bei der Genese DS wirken also sowohl innere wie auch äußere Faktoren je nach Ursache unterschiedlich stark. Es gibt bei der Entstehung aller Depressionsformen jedoch eine gemeinsame Grundursache, eine Störung des Gehirnstoffwechsels (vgl. Meyendorf und Kabza 2009: 35).
Statt einer übergeordneten Theorie in Bezug auf die Genese depressiver Störungen, gibt es daher eine Reihe „modellhafter Konzepte“ (Wolfersdrorf 2009: 75), die auf den ersten Blick zwar widersprüchlich erscheinen mögen, bei genauerer Betrachtung jedoch einen Konsens darin finden, dass bei der Entstehung depressiver Erkrankungen sowohl die Veranlagung im Sinne einer Neigung depressiv zu werden, als auch die Lebensumstände eine Rolle spielen. Die Akzentuierung dieser Ursachenfaktoren ist individuell verschieden und bedarf daher im klinischen Kontext immer der Prüfung des Einzelfalls.
Meyendorf und Kabza (vgl. 2009: 64) betonen weiterführend, dass es im Hinblick auf die Verortung der Ursachen DS zwar Überschneidungen gebe und stützen somit die multifaktoriellen Entstehungsmodelle, es jedoch vor dem Hintergrund einer gelingenden, bzw. für den einzelnen Patienten geeigneten Behandlung/- Therapie weiterhin wichtig sei, nach einer eventuell bestehenden dominierenden Ursache zu forschen. Beispielhaft werden DS benannt, die z.B. mit einem Verlusterlebnis einhergehen oder als Folge einer seelischen oder körperlichen Überlastung auftreten. Diese lassen sich teilweise innerhalb kurzer Zeit mit einigen psychotherapeutischen Sitzungen beheben. Mittelschwere bis schwere depressive Episoden, als auch chronisch verlaufende Formen der Depression, erfordern hingegen eine Therapie mit Antidepressiva (vgl. ebd.: 38). Diese Behandlung mit Antidepressiva schafft bei diesen schwereren Verläufen meist erst die Voraussetzungen dafür, dass Erkrankte ansprechbar werden sowohl für eine ergänzende psychotherapeutische Behandlungen als auch für sozialarbeiterische Gespräche und folgende Interventionen.
Die folgenden Modelle/Theorien legen bei der Entstehung DS ihren Schwerpunkt auf jeweils verschiedene auslösende oder begünstigende Faktoren. Dabei betrachten sie die Genese aus unterschiedlichen Perspektiven und schreiben der Depression je nach Schwerpunkt vermehrt biologische, psychologische, soziale und/oder kognitive Faktoren zu.
1.4.1 Diathese- Stress-Modell
Nach dem Diathese-Stress-Modell oder auch Vulnerabilitäts-Stress-Modell entstehen depressive Störungen durch das Zusammenwirken aktueller und chronischer Belastungen (Stressoren, auslösende Faktoren) mit neurobiologischen bzw. psychischen Veränderungen, sowie anderen modifizierten Variablen auf der Basis einer Veranlagung (Vulnerabilität) einer Person (vgl. Wittchen et al. 2010: 14) . Dieses Modell betont die multifaktorielle Dynamik bei der Entstehung einer DS.
1.4.2 Psychodynamisches Modell
Das Psychodynamische Modell möglicher Depressionsentwicklungen geht von einer frühkindlichen Mangelerfahrung aus, auf deren Grundlage sich eine Störung des Selbstwertgefühls entwickelt. Diese Störung begünstigt die Entwicklung eines Gefühls des existentiellen Zuwenig. Aus dieser erlebten Minderwertigkeit heraus entsteht ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung von außen, was wiederum zu Bewältigungsversuchen wie symbiotischer Beziehungsgestaltung oder der Entwicklung extremer Leistungs- und Moralvorstellungen führen kann. Das Scheitern dieser Kompensationsstrategien ist dann der Auslöser für die depressive Symptomatik (vgl. Wolfersdorf 2009: 79).
1.4.3 Depressionsmodell nach Beck (1981)
Das von Beck entwickelte Modell der kognitiven Triade trifft Aussagen über spezifische Merkmale des depressiven Denkens. Die drei kognitiven Muster sich selbst, Erfahrungen und die Zukunft verzerrt zu bewerten, stellen in diesem Modell die wesentlichen Denkmuster dar. Die Selbstbewertung fällt in der Regel extrem negativ und allumfassend aus und eigene Neigungen und Erfahrungen werden stets als defizitär und unzureichend gedeutet. Depressive Symptome wie z.B. Antriebsarmut werden als eigenes Versagen interpretiert und die Krankheit häufig als unüberwindbares Hindernis betrachtet (1981, zit. n. Wolfersdorf 2009: 60).
1.4.4 Modell der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman (1979)
Das Modell der erlernten Hilflosigkeit geht von der Annahme aus, dass der depressiv Erkrankte meint, an einer gegebenen Situation nichts ändern zu können und zwar egal wie er sich verhält. Es kann hier auch von einer generalisierten erlernten Hilflosigkeit gesprochen werden, da situationsübergreifend selbst dann keine Einflussmöglichkeit gesehen wird, wenn diese real existiert (1979, zit. n. Wolfersdorf 2009: 60).
Weitere biochemische Erklärungsmodelle befassen sich mit dem Corticotrope Releasing Hormon (CRH), dem u.a. die Ausschüttung des Stresshormons Kortisol zugeschrieben wird. Das Modell besagt, dass bei Depressiven gleichbleibend zu viele Stresshormone produziert werden und die Betroffenen so einem andauernden Stresserleben ausgesetzt sind. Medikamente die hier ansetzten, sind jedoch noch nicht flächendeckend im Einsatz (vgl. Meyendrof und Kabza 2009: 46).
Die oben aufgeführten Theorien und Modelle tragen maßgeblich zum Verständnis der Komplexität bei der Genese DS bei. Sie schließen sich jedoch nicht gegenseitig aus, sondern sie haben meist gleichermaßen Bestand. Es gibt nicht die eine Ursache für DS. Es werden jedoch, wie bereits beschrieben, je nach wissenschaftlicher Verortung bei der Entstehung DS die verschiedenen als ursächlich betrachteten Faktoren unterschiedlich stark betont.
Im Kontext der klinischen Sozialarbeit und der Beratung depressiver Klienten ist die Erkundung dieser möglichen Ursachen u.a. deshalb von Bedeutung, da die Suche nach einem Therapieplatz ein häufig formuliertes Ziel ist und diese Ursachen wichtige Hinweise liefern können, die für eine bestimmte Therapieform sprechen. Ist beispielsweise ersichtlich, dass negative Denkmuster oder ungünstige Verhaltensweisen im Vordergrund der individuellen Problematik stehen, kommt eher die Anbindung an eine kognitive Verhaltenstherapie in Betracht. In Bezug auf die zuvor beschriebenen depressiven Symptome und deren mannigfaltigen Kombinationsmöglichkeiten zeigt sich, dass deren Kenntnis eine unverzichtbare Qualifikation hinsichtlich der Gestaltung eines bedarfsgerechten Beratungs-/Hilfeprozess ist. Dies betrifft insbesondere das Wissen um die verschiedenen Schweregrade sowie über die möglichen episodischen als auch chronischen Krankheitsverläufe und den damit verbundenen Beeinträchtigungen als auch Risiken. Professionelle Sozialarbeit hilft den Betroffenen als auch deren Angehörigen dabei herauszufinden, welche Optionen ihnen bei der Bewältigung lebenspraktischer Anforderungen zur Verfügung stehen als auch wo mögliche Überforderungen drohen.
DS treten häufig mit Störungen durch Substanzkonsum (SSK) auf. In den meisten Fällen in Kombination mit einem problematischen Alkoholkonsum (vgl. Barth 2011: 103). Um ein tieferes Verständnis hinsichtlich der vorliegenden Thematik zu ermöglichen sowie deren gesellschaftliche und gesundheitspolitische Relevanz zu verdeutlichen, wird im folgenden Kapitel zunächst auf die verschiedenen Aspekte des Alkoholkonsums eingegangen. Besonders beleuchtet werden hier die Wirkung und mögliche Funktionen sowie Abgrenzungen zwischen verschiedenen Trinkmotiven und Schweregraden des Alkoholkonsums.
2. Alkoholkonsum und Alkoholproblematik
In Deutschland konsumieren 9,5 Millionen Menschen Alkohol in einer gesundheitlich riskanten Form und 1,8 Millionen Menschen gelten als alkoholabhängig. Jährlich sterben mindestens 73.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholkonsums. Obwohl der Verbrauch seit Jahren leicht rückläufig ist, liegt er bei relativ hohen 9,7 Litern reinem Alkohol pro Kopf und Jahr. Das entspricht einem jährlichen Gesamtverbrauch an alkoholischen Getränken von 136,9 Litern pro Kopf. Deutschland liegt damit im internationalen Vergleich im oberen Zehntel (vgl. Seitz et al. 2013: 13).
Die soziokulturellen Faktoren prägen die Konsummuster einer jeden Kultur. In permissiven Gesellschaften wie Deutschland, in denen der Alkoholkonsum als Genussmittel aktiv beworben wird und als normal gilt, ist der Alkoholmissbrauch deutlich höher als in Kulturen, in denen der Konsum aus rechtlichen oder religiösen Gründen untersagt ist (vgl. ebd.: 44). Ungünstige soziale Bedingungen wie Armut, Arbeitslosigkeit sowie ein geringer Grad an sozialer Sicherheit begünstigen zudem missbräuchliche Konsummuster. Der Alkoholkonsum erfüllt dann die Funktion, diese ungünstigen sozialen Faktoren besser ertragen zu können (vgl. ebd.: 44). Darüber hinaus herrscht sowohl in der Allgemeinbevölkerung als auch in der Fachwelt bis heute eine ambivalente Einstellung gegenüber Alkoholproblemen. Einerseits findet sich Alkohol als stetiger Begleiter öffentlicher als auch privater Veranstaltungen wieder und die Abhängigkeit wird seit 1968 gesetzlich als Krankheit anerkannt, andererseits werden Alkoholprobleme nach wie vor als Zeichen persönlicher Schwäche ausgelegt (vgl. Lindenmeyer 2005: 2).
Die Begriffe Alkoholkonsum, Alkoholproblematik, Alkoholabhängigkeit treffen zunächst jedoch noch keine Aussagen über Ursachen, Motivation und Ausmaß des Trinkverhaltens. Es wird aus medizinisch-psychologischer Sicht daher unterteilt in verschiedene Konsumformen, die hinsichtlich der konsumierten Alkoholmenge in einem bestimmten Zeitraum differenzieren und eingrenzen ab wann die konsumierte Menge in Verbindung mit körperlichen, psychischen und sozialen Folgeschäden als pathologisch zu betrachten ist.
„Alkoholprobleme sind somit als mehrdimensionales Kontinuum zu verstehen mit unterschiedlichen Ausprägungsrichtungen und Schweregraden, aus denen letztendlich einzelne Syndrome mit expliziten Diagnosen belegt und damit zum offiziellen Gegenstand des Gesundheitssystems werden“ (ebd.: 2).
2.1 Klassifikation der Konsumformen
Um eine Einschätzung des individuellen Risikos zu ermöglichen wurden verschiedene Konsumklassen definiert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1. Konsumklassen (vgl. Seitz et al. 2013: 15)
Ein schädlicher Gebrauch liegt nach ICD-10 dann vor, wenn Schäden auf psychischer oder körperlicher Ebene nachweisbar sind, jedoch keine Hinweise für eine Abhängigkeit gefunden werden können. Unterschiedliche interkulturelle Bedeutungen führten dazu, dass soziale Schäden nicht im ICD-10 aufgenommen wurden. Der DSM-5 erweist sich hier im Hinblick auf den klinischen Alltag als geeigneter, da die Kriterien ausführlicher und präziser beschrieben sind (vgl. Lindenmeyer 2005: 12).
Die diagnostischen Kriterien für einen schädlichen Gebrauch sind nach DSM-5 erfüllt wenn:
1.Der Alkoholkonsum in klinisch bedeutsamer Weise zu Beeinträchtigungen oder Leiden führt und sich mindestens eines der folgenden Kriterien innerhalb desselben 12-Monats-Zeitraums manifestiert:
- wiederholter Alkoholkonsum, der zu einem Versagen bei der Erfüllung wichtiger Verpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule oder zu Hause führt (z.B. wiederholtes Fernbleiben von der Arbeit oder schlechte Arbeitsleistungen in Zusammenhang mit Alkoholkonsum; Vernachlässigung von Kindern und Haushalt).
- wiederholter Alkoholkonsum in Situationen, in denen es aufgrund des Konsums zu einer körperlichen Gefährdung kommen kann (z.B. Alkohol am Steuer oder das Bedienen von Maschinen unter Alkoholeinfluss).
- wiederkehrende Probleme mit dem Gesetz in Zusammenhang mit Alkoholkonsum (z.B. Verhaftung auf Grund ungebührlichen Betragens unter Alkohol).
- fortgesetzter Alkoholkonsum trotz ständiger oder wiederholter sozialer oder zwischenmenschlicher Probleme, die durch den Alkoholkonsum verursacht oder verstärkt werden (z.B. Streit mit dem Ehegatten über die Folgen der Intoxikation, körperliche Auseinandersetzungen).
2.Die Symptome niemals die Kriterien für eine Abhängigkeit erfüllt haben (ebd.: 2005: 13).
Für die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit müssen nach ICD-10 die folgenden Diagnosekriterien des Abhängigkeitssyndroms (F10.2) erfüllt sein:
Zumindest 3 der folgenden Kriterien waren innerhalb des letzten Jahres gleichzeitig vorhanden:
1.Starker Wunsch oder eine Art Zwang, Alkohol zu konsumieren
2.Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums
3.Körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums, nachgewiesen durch die alkoholspezifischen Entzugssymptome oder die durch die Einnahme von Alkohol oder einer nahe verwandten Substanz, um Entzugssymptome zu mildern oder zu vermeiden
4. Nachweis einer Toleranz: Um die ursprünglich durch geringere Alkoholmengen erreichten Wirkung hervorzurufen sind größere Alkoholmengen erforderlich (eindeutige Beispiele sind die Tagesdosen von Alkoholikern, die bei Konsumenten ohne Toleranzentwicklung zu einer schweren Beeinträchtigung oder sogar zum Tode führen würden)
5.Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zu Gunsten des Alkoholkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um Alkohol zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen
6.Anhaltender Alkoholkonsum trotz Nachweis eindeutiger schädlicher Folgen, wie z.B. Leberschäden oder Verschlechterung kognitiver Funktionen. (vgl. Dilling et al. 2005: 93)
Die fünfte Stelle des Diagnoseschlüssels dient der weiteren Unterteilung des Alkoholabhängigkeitssyndroms:
F.10.20 gegenwärtig abstinent/ F10.21 gegenwärtig abstinent, aber in geschützter Umgebung/ F10.23 gegenwärtig abstinent, aber in Behandlung mit aversiven oder hemmenden Medikamenten (z.B. Antabus oder Disulfirman)/ F10.24 gegenwärtiger Alkoholkonsum/ F10.25 ständiger Alkoholkonsum oder F10.26 episodischer Alkoholkonsum (vgl. ebd.: 94).
Ob zwischen riskantem, schädlichem Alkoholkonsum und Alkoholabhängigkeit ein qualitativer Unterschied besteht oder ob mit dieser Aufteilung lediglich verschiedene Schweregrade von Alkoholproblemen erfasset werden, bleibt nach Lindenmeyer umstritten. Er schreibt dieser Einteilung jedoch insofern ihre Berechtigung zu, da sie in Form einer entsprechenden Differentialdiagnose hilfreich und notwendig ist, geeignete Therapieziele zu entwickeln. So ist Abstinenz bei einem riskanten oder schädlichen Alkoholkonsum kein primäres, vor allem jedoch kein realistisches Therapieziel (vgl. Lindenmeyer 2005: 14).
2.2 Die Entwicklung pathologischer Trinkmotive
Die Motive, Alkohol zu konsumieren können individuell stark variieren und beinhalten viele Aspekte, die es hinsichtlich der Entwicklung einer SSK zu prüfen gilt. So fungiert der Konsum von Alkohol häufig als „Eisbrecher“ und erleichtert die Gestaltung sozialer Kontakte. Vielen Menschen gelingt es unter Alkoholeinfluss besser, ihre Gefühle auszudrücken. Das Selbstwertgefühl ist meist gesteigert während die Impulskontrolle mit fortschreitendem Konsum sinkt. Daher zeigt der Konsument unter Alkoholeinfluss Verhaltensweisen, die er sonst (nüchtern) eher vermieden hätte. Zum anderen kann Alkohol neben diesen stimulierenden Effekten auch beruhigend und/oder dämpfend wirken. Er kann so z.B. dazu dienen, den Übergang zwischen Arbeitstag und Freizeit zu gestalten. Er kann aber auch als Mittel eingesetzt werden, um Probleme und Ängste zu überwinden oder sie schlichtweg aus dem Bewusstsein zu verdrängen. So können z.B. berufliche Stresssituationen, seelische oder körperliche Probleme, Überlastung, Konflikte jeglicher Art, Einsamkeit oder Schlafstörungen mögliche Motive für den Konsum sein (vgl. ebd.: 24).
Mit der Entstehung der Alkoholabhängigkeit haben sich praktisch alle psychologischen Theorien befasst. Die Lerntheoretischen Ansätze nehmen hier eine wesentliche Rolle ein, da sie einen maßgeblichen Einfluss auf bedeutende therapeutische Strategien haben (vgl. Seitz et al. 2013: 46). Unter verhaltenstherapeutischen Aspekten ist die Alkoholabhängigkeit ein erlerntes (Fehl)Verhalten, das unter anderem der Reduzierung von Spannungszuständen dient. Die daraus resultierenden positiven Konsequenzen sowie die Vermeidung negativer Konsequenzen, verstärken wiederum den Konsum. Da Alkohol sofort wirkt, wird diese Wirkung zu einem Stimulus für die weitere Einnahme. Die Erwartung der Wirkung des Alkohols verstärkt in der Folge das Einnahmeverhalten. Die Erwartungen, die mit dem Konsum verbunden sind, können jedoch sehr unterschiedlich sein. Während Männer mit der Einnahme von Suchtmitteln versuchen eher positiv besetzte Zustände zu steigern, konsumieren Frauen diese häufiger, um eher negative Zustände zu verringern. Diese als wirksam erlebten kognitiven Vermittlungsprozesse unter Alkoholeinfluss können als Vorläuferbedingungen bei der Entwicklung pathologischer Trinkmotive betrachtet werden (vgl. ebd.: 46).
Tiefenpsychologische Modelle gehen in Bezug auf Alkoholprobleme von einer prämorbiden Persönlichkeitsentwicklung aus und schreiben dem Alkoholkonsum drei zentrale Funktionen zu:
-Abhängigkeit im Dienste der Befriedigung
-Abhängigkeit im Dienste der Abwehr, z.B. von Depressionen und Angst
-Abhängigkeit im Dienste der Kompensation, z.B. von Minderwertigkeitsgefühlen(ebd.)
Lindenmeyer (vgl. 2005: 24) stellt Bezüge zu der von Grawe (2004) formulierten Konsistenztheorie und den darin beschriebenen basalen Grundbedürfnissen des Menschen nach Bindung, Orientierung/Kontrolle, Lustgewinn bzw. Unlustvermeidung und Selbstwerterhöhung her. Diese Theorie geht davon aus, dass wenn deren Befriedigung nicht gelingt oder Konflikte zwischen den Bedürfnissen bestehen, dies zu einer Art Frustrationserleben führt. Dieser Zustand wird auch als „Inkonsistenzspannung“ beschrieben. Der Alkoholkonsum kann hier die Funktion eines mit der Zeit immer wichtigeren Werkzeugs einnehmen und so zu der Ausbildung von Annäherungs- sowie Vermeidungsschemata zur Befriedigung dieser Grundbedürfnisse führen (vgl. ebd.).
Auch die Häufung der Alkoholabhängigkeit in Familien ist ein wichtiger Aspekt für die Entwicklung pathologischer Trinkmotive. So liegt die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Familienangehörigen einer alkoholabhängigen Person, selbst eine Alkoholproblematik entsteht 3-4 Mal höher als bei einer unbelasteten Person, in deren Familie keine Alkoholprobleme vorkommen (vgl. Seitz et al. 2013: 47).
Eine beeinträchtigte Selbstwahrnehmung ist ein typisches Phänomen bei Alkoholabhängigen. Sie erleben daher sowohl angenehme wie auch unangenehme Folgen erst bei relativ hohen Alkoholmengen. Dem entgegen trägt der Alkoholkonsum bei vielen Alkoholikern zur Verringerung von unangenehmer Selbstaufmerksamkeit bei. Eine unrealistische, positiv verzerrte Wirkungserwartung kann dazu beitragen, dass sich ein schädliches Konsummuster entwickelt und festigt. Dementsprechend oft sind verzerrte und idealisierte Erwartungen hinsichtlich des Konsums bei Alkoholismus zu beobachten. Ein eingeschränktes Verhaltensrepertoire aufgrund des Mangels an alternativen Lösungsstrategien führt dazu, dass der Konsum als einziger Ausweg für bestimmte Situationen in Frage kommt (vgl. Lindenmeyer 2005: 25). Jellinek (1960) hat die Ursachen der Alkoholabhängigkeit genauer ausdifferenziert und die möglichen Motive teils verschiedenen Konsumformen zugeordnet.
2.3 Formen des Trinkverhaltens nach Jellinek
Die Alkoholikertypologie nach Jellinek (1960) unterscheidet vier Formen des Trinkverhaltens:
- Der Konflikttrinker (Alpha-Trinker) greift aus Mangel an alternativen Bewältigungsstrategien in ganz bestimmten Situationen zum Alkohol. Der Konsum stellt eine Art Lösungsversuch im Hinblick auf den Konflikt oder die Irritation dar.
- Dem Rauschtrinker (Gamma-Trinker) gelingt es trotz bester Vorsätze nicht, kleinere Mengen an Alkohol zu konsumieren. Rausch und Kontrollverlust sind typische Folgen dieses Trinkmusters.
- Der Spiegeltrinker (Delta-Trinker) trinkt über den Tag verteilt, um die Alkoholkonzentration (Spiegel) im Blut aufrecht zu erhalten. Sinkt dieser Spiegel treten unangenehme Entzugserscheinungen auf.
- Der periodische Trinker (Epsilon-Trinker) auch Quartalstrinker genannt konsumiert episodisch Alkohol. Auf abstinente Phasen, ohne oder unauffälligem Alkoholkonsum folgen unkontrollierte Phasen (1960, zit. n. Lindenmeyer 2005: 6)
Diese Einteilung hat sich im klinischen Alltag als geeignet erwiesen, da sie die spezifische Problematik eines Alkoholabhängigen im Einzelfall beschreibt und so zu einem besseren Verständnis führt.
Es kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass es sich sowohl bei DS als auch der Alkoholabhängigkeit um ein fließendes Kontinuum zwischen normal (kein Leiden hervorrufend) bis abnorm (Leiden hervorrufend) handelt. Bei beiden Störungen bestehen im Rahmen ihrer Klassifikation Abstufungen hinsichtlich ihrer Schweregrade und den damit verbundenen Ausprägung der störungsspezifischen Symptomatik.
Im nächsten Kapitel werden die möglichen Ursache-Wirkungs-Verhältnisse zwischen DS und einem problematischem Alkoholkonsum anhand der Klassifikationskriterien ICD-10 und DSM-5 sowie verschiedener Modelle der Komorbiditätsgenese exemplarisch dargestellt.
3. Komorbidität psychischer Störungen und Störungen durch Substanzkonsum
Der Begriff der Doppeldiagnose (DD), der das„gemeinsame Auftreten eines Missbrauchs oder einer Abhängigkeit von einer oder mehreren psychotropen Substanzen und mindestens einer anderen psychischen Störung bei einem Patienten in einem bestimmten Zeitraum“beschreibt, wurde in dieser Bedeutung erst Ende der 1980 Jahre mit der Einführung deskriptiver und multiaxialer Klassifikationssysteme wie dem ICD-10 und DSM-3 ermöglicht (Moggi und Donati 2004: 3). So konnten erstmals, bei Vorliegen zweier oder mehrerer Störungen mehrere Diagnosen gestellt werden und ebneten so den Weg für neue (integrative) Therapieverfahren. Als Doppeldiagnose wird von den Autoren weiterführend ein „Spezialfall von Komorbidität“verstanden. Komorbidität bezeichnet „das Auftreten von mehr als einer diagnostizierbaren Störung bei einer Person in einem definierten Zeitintervall“(ebd.). Barth (2011: 91ff.) gibt ergänzend zu bedenken, dass die Kennzeichnung der Komorbidität als „Begleiterkrankung“ missverständlich sei, da diese
[...]
- Arbeit zitieren
- Tino Altemester (Autor:in), 2017, Komorbidität von Depressionen und einer bestehenden Alkoholproblematik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377401
Kostenlos Autor werden

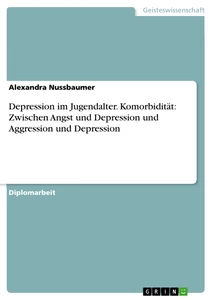
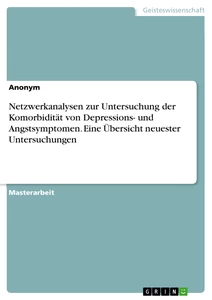
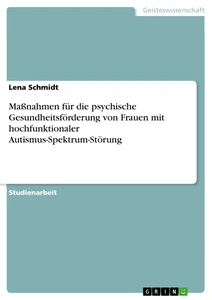


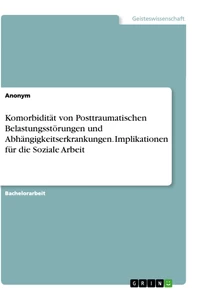

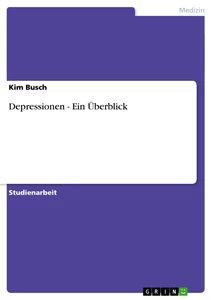









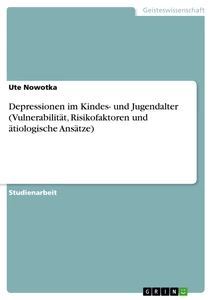



Kommentare