Leseprobe
1
1.
Einleitung
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Thematik der sexuellen Gewalt gegen
Frauen mit Behinderungen. Die Auseinandersetzung mit der Thematik erfolgt dabei
insbesondere vor dem Hintergrund struktureller Bedingungsfaktoren.
Seit einigen Jahren arbeite ich mit Menschen mit Behinderungen und habe dabei immer
wieder Frauen mit Behinderungen kennengelernt, die in unterschiedlicher Weise Erfah-
rungen mit Gewalt und insbesondere auch mit sexueller Gewalt gemacht haben. Gleich-
zeitig habe ich erlebt, wie Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag mit Vorurteilen
und diskriminierenden Verhaltensweise und Bedingungen konfrontiert werden und wie
dadurch ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigt werden kann. Während meines
Studiums habe ich zudem ein wachsendes Interesse an der Auseinandersetzung mit den
Geschlechterverhältnissen und damit zusammenhängenden Aspekten der Diskriminie-
rung von Frauen entwickelt.
Aufgrund der Kombination dieser Erfahrungsbereiche habe ich begonnen, mich intensi-
ver mit der Lebenssituation von Frauen mit Behinderungen auseinanderzusetzen. Dabei
bin ich auch immer wieder mit zwei widersprüchlichen Aspekten konfrontiert worden:
einerseits wird in der Literatur vielfach eine Negierung der Sexualität von Menschen
mit Behinderungen beschrieben. Andererseits wird insbesondere in der jüngeren Litera-
tur auf eine große Betroffenheit von sexueller Gewalt bei Mädchen und Frauen mit Be-
hinderungen aufmerksam gemacht. Auf diese Problematik, aber auch auf die allgemeine
Benachteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderungen sowie auf die Notwen-
digkeit von mehr Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen wird darüber hinaus auch in
der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ausdrücklich hingewiesen
(vgl. Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 2010, S.
11ff). Vor diesem Hintergrund entstand der Wunsch nach einer intensiveren
Auseinandersetzung mit der Thematik der Betroffenheit von sexueller Gewalt bei
Frauen mit Behinderungen.
Auf Basis der Annahme, dass Frauen mit Behinderungen häufiger von sexueller Gewalt
betroffen sind als Frauen ohne Behinderungen, soll die vorliegenden Arbeit den Fragen
nachgehen, wie hoch das tatsächliche Ausmaß der Betroffenheit von sexueller Gewalt
2
ist und welche Zusammenhänge und Bedingungen zu diesem erhöhten Risiko führen. In
diesem Zusammenhang soll außerdem analysiert werden, wie sich ihre Situation hin-
sichtlich der Verfügbarkeit von Hilfe und Unterstützung nach sexuellen Gewalterfah-
rungen darstellt und ob bzw. welche Veränderungen im Zusammenhang mit Präventi-
onsmaßnahmen sowie Intervention und Unterstützung notwendig sind. Ziel dieser Ar-
beit ist es damit, einen Beitrag zum besseren Verständnis der Thematik der sexuellen
Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen zu leisten und auf dieser Basis Schlussfolge-
rungen für einen verbesserten Umgang mit dieser Problematik darzustellen.
Wie der Titel der Arbeit zeigt, geht es in der vorliegenden Arbeit um Frauen mit
Behinderungen. Da aber ein Zusammenhang zwischen Gewalterfahrungen in
verschiedenen Lebensabschnitten besteht, wie im weiteren Verlauf gezeigt wird (vgl.
u.a. Abschn. 4.4.4) soll auch die Betroffenheit von sexueller Gewalt bei Mädchen mit
Behinderungen thematisiert werden. Eine inhaltliche Beschränkung auf spezifische
Behinderungsarten wird nicht vorgenommen. Zwar sind im Hinblick auf die konkrete
Konzeption von Präventions- sowie Interventions- und Unterstützungsmaßnahmen
verschiedene methodische wie auch inhaltliche Heransgehensweisen und Angebote
unabdingbar. Jedoch soll im Rahmen dieser Arbeit unter anderem auch analysiert
werden, inwiefern unterschiedliche Arten von Beeinträchtigungen mit einer erhöhten
Betroffenheit von sexueller Gewalt im Zusammenhang stehen und damit als
Einflussfaktoren für das Risiko für sexuelle Gewalt von Bedeutung sind. Zudem ist eine
exakte Abgrenzung bestimmter Beeinträchtigungs- bzw. Behinderungsarten ohnehin
schwierig (wie auch in Abschn. 2.2 ersichtlich wird) und betroffene Frauen weisen nicht
selten mehrere Arten von Beeinträchtigungen auf (vgl. u.a. Hague et al. 2007, S. 30;
Schröttle et al. 2012a, S. 8).
In der vorliegenden Arbeit werden zudem soziale Konstruktionen von Differenzkatego-
rien und deren Auswirkungen auf Individuen thematisiert. In den letzten Jahren hat sich
mit der Debatte um die soziale Inklusion von Menschen mit Behinderungen auch zu-
nehmend eine Forderung nach Dekategorisierung durchgesetzt, was bedeutet, dass
Menschen gar nicht erst in Kategorien wie ,,behindert" oder ,,nicht behindert" eingeteilt
werden sollen und auf Bezeichnungen wie ,,Menschen mit Behinderungen" verzichtet
werden sollte (vgl. Bergeest 2006, S. 55). Aus Gründen der Verständigung kann jedoch
auf diese Kategorisierungen nicht verzichtet werden (vgl. ebd.), was auch die vorliegen-
de Arbeit betrifft.
3
Im Folgenden soll zunächst ein Verständnis für die allgemeine Lebenssituation von
Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft geschaffen werden. In Abschnitt
2 wird deshalb ein historischer Überblick über den Wandel des gesellschaftlichen Um-
gangs mit bzw. der Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen gegeben,
um aufzuzeigen, wie sich die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen im
Laufe der Zeit entwickelt haben. Des Weiteren findet eine Auseinandersetzung mit dem
Behinderungsbegriff statt, um damit zusammenhängende definitorische Schwierigkeiten
aufzuzeigen. Gleichzeitig soll anhand dessen der Wandel der Sichtweisen im Kontext
von Behinderung verdeutlicht und das heutige Verständnis von Behinderung als soziale
Konstruktion skizziert werden. Darüber hinaus findet eine Auseinandersetzung mit den
aktuellen Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen in Deutschland statt, um Be-
nachteiligungen und Ausgrenzungen aufzuzeigen, die auch in der heutigen Zeit noch
mit einer Behinderung einhergehen. Im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem
Personenkreis der Frauen mit Behinderungen, sollen zudem bereits an dieser Stelle Un-
terschiede bezüglich der Lebenslagen von Frauen und Männern mit Behinderungen auf-
gezeigt werden.
In Abschnitt 3 werden anschließend theoretische Grundlagen der Geschlechterforschung
dargestellt und in einen Zusammenhang mit Behinderungs- und Sexualitätskonstruktio-
nen gebracht. Auf diese Weise sollen grundlegende, potentielle Diskriminierungen für
Frauen mit Behinderungen eruiert werden, die sich aus den verschiedenen Differenzka-
tegorien ergeben. Vor dem Hintergrund des Einflusses gesellschaftlicher Haltungen
bezüglich Behinderung, Geschlecht und Sexualität werden zudem Erkenntnisse bezüg-
lich der Sozialisationsbedingungen von Mädchen und Frauen mit Behinderungen sowie
potentiell negative Entwicklungstendenzen, die hieraus hervorgehen können, dargestellt.
Im vierten Abschnitt findet die Auseinandersetzung mit der Betroffenheit von Frauen
mit Behinderungen von sexueller Gewalt und deren Zusammenhängen statt. Nicht bzw.
kaum berücksichtigt werden die Darstellung spezifischer Ursachentheorien sowie indi-
viduelle täterbezogene Faktoren, da der Schwerpunkt dieses Abschnittes auf den
empirischen Ergebnissen zur sexuellen Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen liegt.
Den Ausgangspunkt für diese Auseinandersetzung stellt die Annahme dar, dass
Ursachen für Gewalt gegen Frauen in den gesellschaftlichen Macht- bzw.
Geschlechterverhältnissen liegen. Das bedeutet, dass es sich bei Gewalt gegen Frauen
im Allgemeinen um ein gesellschaftliches Phänomen handelt (vgl. Brockhaus &
4
Kolshorn 1993, S. 216), dessen Ursprung in den Machtstrukturen zwischen den
Geschlechtern sowie der gesellschaftlichen Heteronormativität zu sehen ist (vgl. Ott
2000, S. 183f) und damit ein wesentlicher Bestandteil patriarchaler Gesellschaften ist
(vgl. Brockhaus & Kolshorn 1993, S. 216f). Gewalt gegen Frauen dient demnach dem
Zweck der Aufrechterhaltung der maskulinen bzw. patriarchalen Macht und Kontrolle,
indem Frauen unterdrückt und hierarchisch unterhalb der Männer positioniert werden
(vgl. ebd. S. 217; Ott 2000, S. 183).
Nach einer Auseinandersetzung mit den Begriff der sexuellen Gewalt, die klären soll,
was genau hierunter zu verstehen ist, werden die Ergebnisse verschiedener, nationaler
und internationaler, repräsentativer sowie nicht-repräsentativer, quantitativer als auch
qualitativer Untersuchungen dargestellt. Es wird das Ausmaß bezüglich der Häufigkeit
und Formen sexueller Gewalt und sexueller Belästigung sowohl in der Kindheit und
Jugend wie auch im Erwachsenenleben dokumentiert. Einerseits soll so die These der
höheren Betroffenheit von Mädchen und Frauen mit Behinderungen überprüft werden
und gleichzeitig sollen damit Hinweise auf den Kontext der sexuellen Gewalt in allen
Lebensphasen erarbeitet werden. Im Anschluss werden die Täter/-innen sowie verschie-
dene Risikofaktoren, die aus den empirischen Ergebnissen hervorgehen, betrachtet, um
weitere Erkenntnisse über die Bedingungszusammenhänge der sexuellen Gewalt gegen
Frauen mit Behinderungen zu erlangen. Im Hinblick auf die Aufdeckung unerkannter
sexueller Gewalt werden zudem mögliche Folgen bei Betroffenen thematisiert.
Darauffolgend findet in Abschnitt 5 eine Darstellung potentieller Probleme und Barrie-
ren bezüglich der Inanspruchnahme von Unterstützung nach sexueller Gewalt statt, um
auf vorhandene Schwierigkeiten und Barrieren aufmerksam zu machen und Schlussfol-
gerungen für nötige Veränderungen abzuleiten. Auf Basis der Erkenntnisse und
Schlussfolgerungen der empirischen Untersuchungen werden anschließend notwendige
zukünftige Veränderungen sowohl für Interventions- und Unterstützungsangebote bei
sexueller Gewalt gegen Mädchen und Frauen mit Behinderungen wie auch für den Be-
reich der Prävention veranschaulicht. Die Darstellung der Entwicklungstendenzen er-
folgt zudem für verschiedene Ebenen der Intervention und Prävention.
Eine reflexive Auseinandersetzung mit den zentralen Erkenntnissen sowie ein Ausblick
auf mögliche Entwicklungen bilden den Abschluss der Arbeit.
5
2.
Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft
Da diese Arbeit sich mit dem Personenkreis der Frauen mit Behinderungen auseinan-
dersetzt, soll in diesem Kapitel ein grundlegendes Verständnis für die Lebenssituation
von Menschen mit Behinderungen und die gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber
diesem Personenkreis geschaffen werden. Zunächst soll deshalb skizziert werden, wie
sich die gesellschaftliche Stellung von Menschen mit Behinderungen historisch entwi-
ckelt hat. Vor dem Hintergrund dieses allgemeinen Wandels des Umgangs mit Men-
schen mit Behinderungen in der Gesellschaft soll im Anschluss erläutert werden, wie
sich im Zuge dieser Veränderungen auch das Verständnis von Behinderung entwickelt
hat. Abschließend wird in diesem Kapitel ein Blick auf die aktuelle Lebenssituation von
Menschen mit Behinderungen in Deutschland geworfen, um einen Eindruck davon zu
erlangen, welche Problemen und Benachteiligungen sich auch in der heutigen Zeit noch
aufgrund einer Behinderung ergeben und wie viele Menschen in unserer Gesellschaft
davon betroffen sind. Es werden deshalb auch statistische Unterschiede zwischen Frau-
en und Männern mit Behinderungen in Deutschland wie auch Aspekte der heutigen Be-
troffenheit von Diskriminierung sowie struktureller und interpersonaler Gewalt themati-
siert.
2.1
Die Entwicklung der gesellschaftlichen Situation von Menschen mit Be-
hinderungen
Ebenso lange, wie es die Menschheit gibt, hat es auch Behinderungen gegeben - sie
sind Ausdruck der menschlichen Vielfalt. Seit tausenden von Jahren lässt sich auch die
gesellschaftliche Grundhaltung gegenüber Menschen mit Behinderungen in verschiede-
nen Kulturen zurückverfolgen, wobei diese in erster Linie geprägt war von elitären
Menschheitsidealen, Ausgrenzung, menschenunwürdiger Behandlung und Tötung (vgl.
Bergeest 2006, S.11; Mattner 2000, S. 16ff; Kastl 2010, S. 24).
Antike und Mittelalter
Bereits für die Zeit der Antike lässt sich nachweisen, dass Menschen mit Behinderungen
als sozial ´unbrauchbar` galten und ihnen deshalb das Recht auf Leben abgesprochen
wurde. Sie wurden in der Regel ausgesetzt, öffentlich zur Schau gestellt, als Sklaven/-
6
innen verkauft oder getötet (vgl. Mattner 2000, S. 16ff). Auch zur Zeit des Mittelalters
war es üblich, Menschen mit Behinderungen einer inhumanen Behandlung auszusetzen;
Behinderungen galten als Symbol für das Böse bzw. wurden als teufliche Besessenheit
interpretiert. Die Menschen versuchten sich mit Folterungen, Exorzismen,
Aussetzungen oder Tötungen dieses Bösen zu entledigen. In einigen Städten wurden
Menschen mit Behinderungen in Gefängnisse oder auch sogenannte Toll- oder
Narrenhäuser gesperrt, in denen sie zur Schau gestellt wurden. Allerdings begann im
späten Mittelalter auch die Zeit der Armenfürsorge, sodass Menschen mit
Behinderungen erstmals auch Empfänger von Pflege und Fürsorge empfingen. Jedoch
erhielten die Menschen, die aufgrund einer Behinderung oder Krankheit aus der
Gesellschaft verstoßen worden waren, lediglich ein Mindestmaß an Versorgung.
Diejenigen, die hier keinen Platz fanden, mussten ihr Dasein als Bettler/-innen fristen
(vgl.Mattner 2000, S. 21ff; Rommelspacher 1999, S.23f).
Die Tötungen aufgrund von Behinderungen betrafen in allen bekannten Gesellschaften
in der Regel Kinder und insbesondere Neugeborene, nur in seltenen Fällen sind
Tötungen erwachsener Menschen mit Behinderungen bekannt (vgl. Kastl 2010, S. 24f;
Rommelspacher 1999, S. 24).
Die Zeit des Nationalsozialismus
Erst in der Moderne erreichte die systematische Tötung von Menschen mit
Behinderungen mit dem Nationalsozialismus ihren Höhepunkt. Insgesamt wurden etwa
100.000 Menschen aufgrund einer Behinderung ermordet (vgl. Arnade 2003, S.3). Mit
dem Argument der Optimierung der Menschheit und dem Erhalt der Volksgesundheit
durch ´Rassenhygiene` wurde durch die Nationalsozialisten die Euthanasie, also die
Ermordung von Menschen mit Behinderungen zur Vernichtung ´minderwertigen
Erbguts`, angeordnet (vgl. Rommelspacher 1999, S. 25f; Mattner 2000, S. 54). Zudem
wurde soziales Engagement für Menschen mit Behinderungen als Gefährdung für das
Gesamtwohl des Volkes und falsch verstandene Nächstenliebe betrachtet, die lediglich
einzelnen ´Ballastexistenzen` zu Gute käme (vgl. Mattner 2000, S. 54). Zu den
Maßnahmen, die im ´Kampf gegen das minderwertige Erbgut` eingeführt wurden,
zählten unter anderem das Sterilisationsgesetz zur ´Verhütung erbkranken
Nachwuchses`, das Ehegesundheitsgesetzt (Verbot der Eheschließung mit einer an einer
geistigen Störung oder Erbkrankheit leidenden Person), intensive Rassenpropaganda
(z.B. in Form von Zeitschriften, Filmen oder Radiosendungen) und die Umgestaltung
7
der vorhandenen Hilfsschulen zu Sammelbecken zur Erfassung und Aussortierung
sogenannter ´schwachsinniger` Schüler. Das oberste Ziel war aber die Auflösung der
Hilfsschule, durch die Verhinderung des erbkranken Nachwuchses. Diejenigen
Personen, die aufgrund der Schwere der Beeinträchtigung als bildungsunfähig galten
und deshalb keine Hilfsschule besuchten, wurden in Pflegeanstalten eingewiesen und
von dort aus späteren Euthanasiemaßnahmen unterzogen (vgl. ebd. S. 54ff). Die
Maßnahmen gipfelten schließlich in der Tötung von Menschen mit Behinderungen,
wobei mit der Ermordung von Kindern begonnen wurde. Später waren auch
Erwachsene betroffen (vgl. Rommelspacher 1999, S. 25; Mattner 2000, S. 69ff).
Entwicklungen nach 1945
Laut Mattner (2000) hat in den ersten 20 Jahren nach dem Ende des Krieges in
Deutschland zunächst keine thematische Aufarbeitung der nationalsozialistischen
Verbrechen an Menschen mit Behinderungen stattgefunden (vgl. S. 75). Dies betraf
insbesondere auch die Hilfsschulpädagogik, die sich bis in die 1970er Jahre hinein nicht
mit dem Umgang mit Menschen mit Behinderungen zur Zeit der Nazi-Diktatur
auseinandersetzte und weiterhin sogenannte ´bildungsunfähige` Kinder vom
Schulbesuch ausschloss (vgl. ebd. S. 75ff).
Obwohl nach 1945 das Lebensrecht von Menschen mit Behinderungen offiziell nicht
mehr angezweifelt wurde, war die allgemeine Lebenssituation von Menschen mit
Behinderungen, insbesondere derjenigen mit geistiger Behinderung, weiterhin schlecht
(vgl. Arnade 2003, S. 3). Das aus der Zeit des Nationalsozialismus stammende ´Gesetz
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses`, die rechtliche Grundlage für
Zwangssterilisationen, behielt weiterhin seine Geltung. Offiziell wurde es erst im Jahr
1973 abgeschafft, wobei es weiterhin möglich war, mit der Zustimmung eines
Vormundes, eines Vormundschaftsgerichtes oder einer Ärztin/eines Arztes Mädchen
und Frauen mit Behinderungen unter Vortäuschung einer medizinischen Notwendigkeit
und ohne ihr Wissen zu sterilisieren
1
1
Erst seit dem Jahr 1992 wurde eine gesetzliche Grundlage zum Schutz betroffener Mädchen und Frauen
geschaffen, indem eine Sterilisation gegen den Willen von Mädchen und Frauen mit Behinderungen
verboten worden ist (vgl. Mattner 2000, S. 76ff; Arnade 2003, S. 3).
(vgl. Mattner 2000, S. 76ff; Arnade 2003, S. 3).
Erst Ende der 1950er Jahre machte sich langsam eine Verbesserung der allgemeinen
Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen bemerkbar. Es entstanden
Elterninitiativen und Vereine, es wurden unter anderem Sonderkindergärten und
8
Beschützende Werkstätten gegründet und an den Hochschulen entstanden eigenständige
heil- und sonderpädagogische Fachdisziplinen. Zu Beginn der 1960er Jahre begannen
Initiativen wie beispielsweise die ´Lebenshilfe` sich für bessere Betreuungsbedingungen
oder eigenständige Schulen für Menschen mit Behinderungen einzusetzen (vgl. Mattner,
2000, S. 80; Möckel 2006, S. 90).
Im Zuge dieser Entwicklungen bildete sich auch eine vermehrte Kritik am traditionellen
Verständnis von Behinderung heraus. Neben den medizinischen bzw. biologischen
Aspekten von Behinderung wurde zunehmend auch eine soziale Perspektive in die
Auseinandersetzung mit dem Phänomen Behinderung miteinbezogen (vgl. Mattner
2000, S. 80ff; Kastl 2010, S. 242f; Abschn. 2.2). Dieser Perspektivenwechsel führte
auch zu einer Verbesserung der Betreuung und Förderung von Menschen mit
Behinderungen. So entstand in den 1970er Jahren die Integrationsbewegung, die sich
für die gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und ohne Behinderungen einsetzte.
Menschen mit Behinderungen begannen außerdem vermehrt selbst für ihre Interessen
einzutreten. Es entstanden beispielsweise ´Clubs Behinderter und ihrer Freunde` (CBF)
oder die sogenannten ´Krüppel-Gruppen`, die sich für mehr Beratungsangebote, die
Ermöglichung eines Lebens außerhalb von Heimen sowie mehr Selbstbestimmung und
Integration für Menschen mit Behinderungen einsetzten (vgl. Mattner 2000, S. 80ff;
Kastl 2010, S. 49).
Insgesamt hat sich die gesellschaftliche Stellung von Menschen mit Behinderungen in
den vergangen Jahrzehnten sehr positiv entwickelt (vgl. Möckel 2006, S. 91;
Theunissen 2006 S. 80f). Dies zeigt sich beispielsweise im Sprachgebrauch, aufgrund
einer stärkeren Sensibilität für die Wirkung sozialer Zuschreibungen. Wenn von einer/m
´Behinderten` gesprochen wird, wie es in der Vergangenheit üblich war, wird dadurch
ein einzelner Aspekt eines Menschen als dominierendes Merkmal der Persönlichkeit
betont und sie/er somit auf dieses reduziert. Deshalb wird vermehrt der Forderung von
Behindertenverbänden Rechnung getragen und die Bezeichnung ´Menschen mit
Behinderungen` verwendet (vgl.Theunissen 2006 S. 80f). Aber auch die Veränderungen
der gesetzlichen Rahmenbedingungen verdeutlichen diese positive Entwicklung. Im
Jahr 1992 wurde das Betreuungsgesetz verabschiedet, welches die Zwangssterilisation
von Mädchen und Frauen mit Behinderungen verbietet. Allerdings ist unter bestimmten
Voraussetzungen (wie z.B. einer dauerhaften Einwilligungsunfähigkeit, der
Ungeeignetheit anderer Verhütungsmethoden und der Genehmigung eines
9
Vormundschaftsgerichtes) dennoch eine Sterilisation betroffener Frauen möglich (vgl.
Mattner 2000, S. 76ff; Arnade 2003, S. 3).
Weitere rechtliche Fortschritte für Menschen mit Behinderungen sind zudem das
´Diskriminierungsverbot`, das im Jahr 1994 um den Satz ,,Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden" (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG) ergänzt wurde, das
Inkrafttreten des neunten Sozialgesetzbuches zur ´Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen` im Jahr 2001 und das ´Behindertengleichstellungsgesetz` aus
dem Jahr 2002 (vgl. Trenk-Hinterberger 2006, S. 331ff). Außerdem ist im Jahr 2008 die
´UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen` in Kraft getreten,
welche die Gültigkeit der allgemeinen Menschenrechte für Menschen mit
Behinderungen verdeutlichen soll. Darin wird unter anderem das Recht auf Bildung für
alle von Behinderung betroffenen Menschen an allgemeinen Schulen (´Inklusion`) oder
auch das Recht auf Arbeit, Barrierefreiheit, Ehe und Partnerschaft sowie Freiheit von
Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch erklärt (vgl. Beauftragter der Bundesregierung für
die Belange behinderter Menschen 2010).
2.2
Die Entwicklung des Behinderungsbegriffs vom medizinischen zum
sozialen Modell
Ähnlich wie die gesellschaftliche Situation von Menschen mit Behinderungen unterlag
auch das Verständnis von Behinderung einigen Veränderungen. Lange Zeit wurde Be-
hinderung ausschließlich als medizinisches Phänomen betrachtet, bei dem bei den be-
troffenen Personen ein körperlicher Defekt bzw. eine Abweichung von der Norm vor-
handen ist, der bzw. die beseitigt oder vermindert werden sollte. Dabei handelt es sich
um das ´medizinische` oder auch ´individuelle Modell von Behinderung`. ´Individuell`
bezieht sich darauf, dass es sich um ein Problem eines Individuums handelt und dass die
Verantwortung für eine Veränderung bzw. Verbesserung der Situation bei dem Indivi-
duum selbst gesehen wird; die Person soll sich an die gegebenen Bedingungen anpassen
(vgl. Mattner 2000, S. 9f; Kastl 2010, S.48; Köbsell 2010, S. 18f).
Nach diesem medizinischen Verständnis handelt es sich bei einer Behinderung um eine
objektiv feststellbare, irreversible Beeinträchtigung eines betroffenen Menschen als
Folge eines vorausgegangenen Krankheitsprozesses oder einer angeborenen Schädi-
gung, die eine Beeinträchtigung der individuellen Leistungsfähigkeit bedingt (vgl.
Mattner 2000, S. 9; Kastl 2010, S. 48). Diese individualdefizitäre Perspektive betrachtet
10
die negativen Auswirkungen der Beeinträchtigung (wie z.B. schlechtere Bildung,
schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder auch mangelnde Mobilität etc.) als na-
türliche Folge der Beeinträchtigung des Individuums, da die Behinderung mit Normab-
weichung, Unfähigkeit und Abhängigkeit gleichgesetzt und somit negativ bewertet wird
(vgl. Köbsell 2010, S. 18).
Bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel bezüglich des Umgangs mit Menschen
mit Behinderungen und die Entstehung der ´Independent Living-Bewegung` und der
´Krüppel-Gruppen`, wurden zunehmend auch eine soziale Perspektive in der Auseinan-
dersetzung mit Behinderung berücksichtigt hierbei handelt es sich um das sogenannte
´soziale Modell von Behinderung` (vgl. Mattner 2000, S. 90f; Kastl 2010, S. 43;
Köbsell 2010, S. 18). So definierte die ´Union of Physically Impaired Against Segrega-
tion` (UPIAS), eine in den 1970er Jahren in Großbritannien gegründete politische Or-
ganisation körperbehinderter Menschen, die sich für die Gleichberechtigung von Men-
schen mit Behinderungen einsetzte (vgl. Kastl 2010, S. 49), den Begriff wie folgt:
,,In our view, it is society which disables physically impaired people. Disability is some-
thing imposed on top of our impairments, by the way we are unnecessarily isolated and ex-
cluded from full participation in society. Disabled people are therefore an oppressed group
in society. To understand this it is necessary to grasp the distinction between the physical
impairment and the social situation, called ´disability`, of people with such impairment.
Thus we define impairment as lacking part of or all of a limb, or having a defective limb,
organ or mechanism of the body; and disability as the disadvantage or restriction of activity
caused by a contemporary social organization which takes no or little account of people
who have physical impairments and thus excludes them from participation in the main-
stream of social activities" (UPIAS 1997, S.20; UPIAS zit. n. Kastl 2010, S.49).
Hier wird ersichtlich, dass zwischen der körperlichen Schädigung (´impairment`)
einerseits und der Aktivitätseinschränkung (´disability`) durch die Gesellschaft und
einem damit verbundenen, nachteiligen gesellschaftlichen Status andererseits
unterschieden wird. Damit soll verdeutlicht werden, dass die Ursache für eine
Behinderung nicht eine Schädigung bzw. Beeinträchtigung, sondern die soziale
Unterdrückung ist. Zu Beginn der 1990er Jahre hat sich aus dieser Sichtweise auch der
Slogan ´Man ist nicht behindert, man wird behindert` etabliert (vgl. Kastl 2010, S. 49).
Diese Differenzierung zwischen Beeinträchtigung und Behinderung hat zunehmend
auch Eingang in offizielle Dokumente gefunden. So zum Beispiel in der ICF
(´International Classification of Functioning, Disability and Health`/ ´Internationale
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit`) der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) (vgl. WHO 2005, S. 9; Bergeest 2006, S. 56f). Ziel dieses
11
bio-psycho-sozialen Modells ist die Beschreibung von Gesundheit und die Klassifikati-
on von Funktionsfähigkeit und Behinderung in Verbindung mit Gesundheitsproblemen
(vgl. WHO 2005, S. 9). Dies erfolgt über folgende Kategorien:
-
Funktionsfähigkeit und Behinderung; mit den Komponenten
·
Körperfunktionen und -strukturen:
Mit Körperfunktionen sind physiologische und mentale Funktionen des Kör-
pers (wie z.B. sehen, hören etc.) gemeint. Der Begriff Körperstrukturen be-
zeichnet die Anatomie des Körpers (z.B. Gliedmaßen oder Organe). Eine Be-
einträchtigung der Funktionen oder der Struktur stellt eine Schädigung dar
(vgl. WHO 2005, S. 16ff).
·
Aktivitäten und Partizipation:
Der Begriff Aktivitäten meint die Durchführung von Handlungen (z.B. Lernen
oder Selbstversorgung). Partizipation meint das Einbezogensein in Lebenssitu-
ationen (z.B. soziales Leben). Schwierigkeiten der Aktivitäten oder Teilhabe
werden im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt festgestellt (vgl. ebd.).
-
Kontextfaktoren; mit den Komponenten
·
Umweltfaktoren:
Dies bezeichnet die gesellschaftlichen Strukturen (z.B. Kommunikation, Ver-
kehr, Gesetze, Einstellungen) (vgl. ebd. S. 21f).
·
Personenbezogene Faktoren:
Damit ist die unmittelbare Umwelt des Individuums gemeint (u.a. Sozialkon-
takte, häuslicher Bereich, Schule oder Arbeitsplatz) (vgl. ebd.).
Die Kontextfaktoren können einen positiven oder negativen Einfluss auf die Leistung
bzw. Leistungsfähigkeit eines Individuums in Bezug auf Aktivitäten und Partizipation
bzw. seine Körperfunktionen und -strukturen haben und stehen mit diesen Komponen-
ten in Wechselwirkung (vgl. ebd. S. 22). Eine Behinderung ist nach dieser Klassifika-
tion
,,das Ergebnis oder die Folge einer komplexen Beziehung zwischen dem Gesundheitsprob-
lem eines Menschen und seinen personenbezogenen Faktoren einerseits und den externen
Faktoren, welche die Umstände repräsentieren, unter denen des Individuum lebt, anderer-
seits" (ebd.).
12
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die unterschiedlichen Kon-
textfaktoren einen Menschen mit einem Gesundheitsproblem in unterschiedlicher Weise
beeinflussen können, sodass eine Behinderung, die sich gegebenenfalls aus der Wech-
selwirkung ergibt, unterschiedlich ausgeprägt sein kann und damit als kontextrelationa-
les Phänomen zu verstehen ist (vgl. ebd.). Innerhalb dieser Klassifikation wird Behinde-
rung somit nicht mehr verstanden als Merkmal einer Person, sondern als das Ergebnis
einer dynamischen Wechselwirkung zwischen einem Individuum mit einer körperlichen
Schädigung und den sozialen Kontextfaktoren. Dadurch wird zudem verdeutlicht, dass
eine Schädigung nicht nur zu Partizipationsproblemen oder Aktivitätsstörungen führen
kann, sondern, dass die Kontextfaktoren auch umgekehrt die körperliche Schädigung
verstärken oder abschwächen können (vgl. Bergeest 2006, S. 56f).
Das soziale Modell von Behinderung verdeutlicht auch, dass es sich dabei, im Gegen-
satz zur Sichtweise des medizinischen Modells, um ein Phänomen handelt, das von der
Gesellschaft gemacht ist. Ein Mensch ist nicht behindert, sondern wird durch die Be-
dingungen seiner Umwelt behindert, da er nicht den gesellschaftlichen Normalitätser-
wartungen darüber entspricht, was jemand können sollte bzw. wie jemand sein sollte.
Da aber die Umweltbedingungen so angelegt sind, dass sie den Bedürfnissen der Mehr-
heit der Gesellschaft bzw. insbesondere derjenigen entsprechen, die aufgrund der gesell-
schaftlichen Strukturen über Macht und Möglichkeiten der Einflussnahme verfügen,
werden diejenigen, die von der gesellschaftlich konstruierten Norm abweichen, benach-
teiligt bzw. ausgeschlossen (vgl. Rommelspacher 1999, S.7ff). Somit sind Behinderun-
gen laut Rommelspacher (1999)
,,eine gesellschaftliche Konstruktion, denn nicht die faktische Beeinträchtigung ist das ent-
scheidende Problem, sondern die Konstruktion einer Normalität, die nur für bestimmte
Menschen gilt und die die anderen als andere ausgrenzt"(S.10),
wobei der Zweck dieser Ausgrenzung die Reproduktion der Normalität ist (vgl. ebd. S.
33).
Nach einer Behinderungsdefinition von Kastl (2010) wird Behinderung verstanden als
eine dauerhafte, negativ bewertete, körpergebundene (z.B. in Bezug auf Kompetenzen,
Selbstbilder, psychische Funktionen oder auch körperliche Konstitutionen) Abweichung
von situativen, sachlichen und sozial generalisierten Wahrnehmungs- und Verhaltensan-
forderungen (damit sind sowohl konkretes Verhalten als auch bloße Verhaltensmög-
lichkeiten gemeint), die das Ergebnis eines schädigenden Prozesses und dessen Interak-
tion mit den Lebensbedingungen ist. Diese Definition berücksichtigt die Komponente
13
der Schädigung einerseits und den Konstruktionscharakter von Behinderung anderer-
seits sowie die Wechselwirkungen zwischen der Schädigung und den Umweltbedingun-
gen, welche letztendlich die Behinderung ergeben (vgl. S.108ff). Gleichzeitig wird mit
dieser Definition Behinderung nicht ausschließlich in eine äußerliche Benachteiligung
aufgelöst, sondern verweist trotz der (sozial)konstruktivistischen Komponente auf die
Körpergebundenheit einer Behinderung in Form einer Schädigung und der damit ver-
bundenen Normabweichung (vgl. ebd. S. 112f).
Hinsichtlich des Alltagsverständnisses von Behinderungen weist Kastl (2010) außerdem
auf den Zusammenhang zwischen der Konstruktion von Behinderung und dem Kriteri-
um der Wahrnehmbarkeit (z.B. aufgrund des Aussehens, der Kommunikation oder des
Verhaltens) hin, da dieses in der Regel mit der Annahme der Sichtbarkeit einer Behin-
derung einhergeht (vgl. vgl. S.40). Allerdings ergeben sich für beide Gruppen, für Men-
schen mit, wie auch ohne wahrnehmbare Behinderungen, spezifische Probleme. Des-
halb ist der Aspekt der Wahrnehmbarkeit einer Behinderung als ambivalent zu bewer-
ten. Auf der einen Seite werden sichtbare Behinderungen negativ empfunden, da sie
gesellschaftlichen ´Normalitäts`- bzw. Idealvorstellungen nicht gerecht werden. Da-
durch sind die Betroffenen allgemein negativen Reaktionen im sozialen Kontext ausge-
setzt, was sich nachteilig auf das Selbstwertgefühl auswirken kann. Auf der anderen
Seite wünschen sich Betroffene mit einer nicht sichtbaren Behinderung in spezifischen
Situationen, dass die Behinderung sichtbar wäre, um Anerkennung für ihre besonderen
Bedürfnisse zu erlangen. Oft wird die Erfahrung gemacht, dass die Umwelt mit wenig
Verständnis reagiert, wenn eine Person ohne sichtbare Beeinträchtigungen Rücksicht
und Schonung (z.B. einen Sitzplatz) in Anspruch nehmen möchte (vgl. Eiermann,
Häußler & Helfferich 2000 S. 196ff).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es sich bei einer Behinderung um ein sehr
vielschichtiges Phänomen handelt und das bei der Auseinandersetzung damit
verschiedene Komponenten betrachtet werden müssen, was auch die Formulierung einer
einheitlichen Definition schwierig macht (vgl. Kastl 2010, S. 39f). Aus der Perspektive
des sozialen Modells gibt es kein eindeutiges Merkmal, um zu entscheiden, was eine
Behinderung ist und diese besteht immer dann, wenn aufgrund der Schädigung situati-
onsspezifische, sozial generalisierte Anforderungen nicht erfüllt werden können (vgl.
ebd. S. 107ff).
14
So ist laut Kastl (2010) beispielsweise
,,ein gehörloser Mensch in einer Umwelt von anderen gehörlosen Menschen, mit denen er
sich über Gebärden verständigen kann, nicht oder jedenfalls sehr viel weniger behindert als
in einer durchschnittlichen Umgebung, die auf hörende Individuen abgestellt ist" (S. 112).
Insgesamt ist der Behinderungsbegriff außerdem ambivalent zu bewerten, da zum einen
der Status der Behinderung in Form einer amtlich anerkannten Schwerbehinderung im
sozialrechtlichen Sinn Schutz und Hilfe verleihen soll. Zum anderen droht in
Verbindung mit diesem Begriff auch immer Stigmatisierung und Exklusion (vgl.
Theunissen 2006, S. 81). Zur Feststellung dieses Status wird die sozialrechtliche
Definiton nach dem neuenten Sozialgesetzbuch angewendet, welche lautet:
,,Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seeli-
sche Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das
Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft beeinträchtigt ist" (SGB IX, §2 Abs. 1).
Das Ausmaß dieser Beeinträchtigung wird im Grad der Behinderung gemessen (GdB)
und durch medizinische Gutachter festgestellt. Kastl (2010) postuliert in diesem Zu-
sammenhang, dass in der Praxis der nach dieser Definition maßgebliche Aspekt der
gesellschaftlichen Teilhabe aber nicht das primäre Beurteilungskriterium für den
Schwerbehindertenstatus ist und das eine Behinderung weiterhin in erster Linie an me-
dizinischen Gesichtspunkten ´gemessen` wird und somit nach wie vor das
´medizinische Modell` maßgeblich ist (vgl. S. 39).
Als schwerbehindert gelten Personen, bei denen ein Grad der Behinderung (GdB) von
50 bis 100 festgestellt wird, Personen mit einem Grad der Behinderung unter 50 gelten
als leicht behindert. Der Grad der Behinderung wird in Zehnerschritten von 20 bis 100
abgestuft (vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland 2009, S. 4; Kastl 2010, S. 37).
2.3
Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen heute
Die Auseinandersetzung mit der Entwicklung der Sichtweisen von Behinderung und der
gesellschaftlichen Stellung von Menschen mit Behinderungen zeigt, dass diese in der
Vergangenheit immer von Gewalt und Diskriminierung betroffen waren. In diesem Ab-
schnitt soll betrachtet werden, wie sich die Lebenssituation von Menschen mit Behinde-
rungen und, vor dem Hintergrund der Fragestellungen der vorliegenden Arbeit, vor al-
lem auch von Frauen mit Behinderungen in der heutigen Zeit darstellt. Zunächst soll
15
dafür ein Überblick darüber gegeben werden, wie viele Menschen mit Behinderungen in
Deutschland leben und welche Unterschiede sich bezüglich der Lebenslagen von Frauen
und Männern mit Behinderungen vorfinden lassen. Im Anschluss werden aktuelle Dis-
kriminierungen und Benachteiligungen skizziert, denen Menschen mit Behinderungen
in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind. Im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit der
Betroffenheit von sexueller Gewalt bei Frauen mit Behinderungen (vgl. Abschn. 4) wird
abschließend ein Überblick über das allgemeine Ausmaß der Betroffenheit von interper-
sonaler Gewalt bei Frauen mit Behinderungen gegeben.
2.3.1
Frauen und Männer mit Behinderungen in Deutschland
Bezüglich der Frage, wie viele Menschen mit Behinderungen in Deutschland leben,
liegen nur Zahlen in Form der Schwerbehindertenstatistik vor. In dieser werden aller-
dings nur Menschen mit einer amtlich festgestellten Schwerbehinderung, d.h. ab einem
Grad der Behinderung von 50, aufgeführt, weshalb einige Personengruppen nicht einbe-
zogen sind (vgl. Kastl 2010, S. 38f). Somit ist davon auszugehen, dass die tatsächliche
Anzahl von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft größer ist, als die in
der amtlichen Statistik angegebene Zahl (vgl. Kastl 2010, S. 38f).
Laut Statistischem Bundesamt lebten zum Jahresende 2007 in der Bundesrepublik
Deutschland 6,9 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung, was einen Anteil
an der Gesamtbevölkerung von etwa acht Prozent ausmacht. Von diesen 6,9 Millionen
Menschen waren etwa 48 Prozent Frauen. Zudem waren etwa drei Viertel der Menschen
mit Behinderungen älter als 55 Jahre (74,7%) und die häufigste Behinderungsart waren
körperliche Behinderungen in Form von Schädigungen der inneren Organe bzw. der
Organsysteme (64,3%). Die häufigste Behinderungsursache war mit etwa 82 Prozent
eine Erkrankung und im Allgemeinen handelt es sich bei den meisten Behinderungen
um eine im Lebenslauf erworbene Schädigung. Nur bei etwa vier Prozent der Menschen
mit Behinderungen war die Behinderung angeboren (vgl. Statistisches Bundesamt
Deutschland 2009, S. 5). Dieser Aspekt ist im Rahmen dieser Arbeit insofern
interessant, dass der Zeitpunkt des Behinderungseintritts eine Rolle für die
Sozialisationsbedingungen und folglich für die Lebenssituation von Menschen mit
Behinderungen spielt (vgl. Schildmann 2000, S. 30), worauf im weiteren Verlauf
detailierter eingegangen wird (vgl. Abschn. 3.4).
16
Zu den Menschen, die in der Schwerbehindertenstatistik nicht berücksichtigt werden,
zählen, wie bereits erwähnt, einerseits diejenigen, bei denen ein Grad der Behinderung
von unter 50 vorliegt, sowie diejenigen Personen, die keine behinderungsspezifischen
Hilfen zur Eingliederung in die Gesellschaft in Anspruch nehmen möchten und deshalb
keine Anerkennung als schwerbehindert beantragt haben (vgl. Rath 2006, S. 249). Dies
betrifft insbesondere Frauen, die nicht erwerbstätig sind
,
wodurch diese in der Statistik
unterrepräsentiert sind (vgl. Cornelißen 2005, S. 533).
In der Schwerbehindertenstatistik lassen sich zudem einige Unterschiede zwischen
Männern und Frauen feststellen, welche insbesondere mit der traditionellen Verteilung
von Erwerbs- und Reproduktionsarbeit zwischen Männern und Frauen
zusammenhängen (vgl. ebd.). Denn das Sytem der sozialen Sicherung und damit auch
die berufliche Rehabilitation ist in erster Linie an männlichen Lebens- und
Arbeitsmustern orientiert (insbesondere an Erwerbsarbeit, aber auch an Kriegen), was
sich in Form eines Ungleichgewichts auf die Behindertenstatistik auswirkt. Dies
bedeutet, dass die Statistik stark durch Berufs- und Erwerbsunfähigkeit, sowie (vor
allem in der Vergangenheit) Kriegsbeschädigungen geprägt ist (vgl. Schildmann 2003,
S. 31f).
Des Weiteren lag die Beschäftigungsquote von Frauen mit Behinderungen mit 21
Prozent im Jahr 2003 deutlich unter der von Männern mit Behinderungen (30 Prozent)
und noch deutlicher unter den Quoten von Frauen (53 Prozent) und Männern (71
Prozent) ohne Behinderungen. Darüber hinaus zeigt sich in diesem Zusammenhang
auch, dass bezüglich der Ursachen für eine Schwerbehinderung der Anteil ostdeutscher
Frauen an den Schwerbehinderungen, die durch einen Arbeitsunfall verursacht wurden,
auf Grund ihrer stärkeren beruflichen Integration,
vier
Prozent über dem Anteil west-
deutscher Frauen liegt (vgl. Cornelißen 2005, S. 533ff). ,,Die schlechtere Beschäfti-
gungssituation behinderter Frauen wirkt sich erwartungsgemäß auf deren finanzielle
Situation aus" (ebd. S. 576). So leben beispielsweise 24 Prozent der Frauen mit Behin-
derungen von einem Einkommen unter 1.100 Euro, gegenüber 13 Prozent der Männer
mit Behinderungen. Auch im Vergleich zu Frauen (14%) und Männern (10%) ohne Be-
hinderungen ist dies ein hoher Anteil (vgl. ebd.). ,,Behinderte Frauen befinden sich also
besonders häufig in einer prekären wirtschaftlichen Situation" (ebd.).
Darüber hinaus zeigen sich bezüglich der Geschlechterverteilung auch alterspezifische
Unterschiede; so überwiegt der Anteil der schwerbehinderten Männer in den jüngeren
Altersgruppen, während bei den über 75-jährigen Menschen mit Behinderungen der
17
Anteil der Frauen, bedingt durch eine höhere Lebenserwartung und damit
zusammenhängenden häufiger auftretenden Erkrankungen sowie geschlechtsspezifische
Risiken für das Auftreten einer Behinderung (z.B. sind Arbeitsunfälle bei Männern eine
häufigere Ursache für Behinderungen als für Frauen), in der Statistik überwiegt (vgl.
Cornelißen 2005, S. 538).
Ebenso zeigen sich Unterschiede bezüglich des Familienstandes: Männer mit
Behinderungen sind deutlich häufiger verheiratet als Frauen mit Behinderungen (70%
vs. 44%) (vgl. ebd. S. 583f). Damit haben Männer mit Behinderungen bessere
Möglichkeiten, ,,im Rahmen einer Ehe Unterstützung zu finden als behinderte Frauen"
(ebd. S. 584). Die Gründe dafür sind einerseits die allgemein höhere Lebenserwartung
von Frauen und andererseits, dass Ehemänner häufig älter sind als Ehefrauen (vgl. ebd.).
So leben Männer oft noch mit ihrer Partnerin zusammen, wenn im Alter eine
Behinderung eintritt, während ,,Frauen [sind] in dieser Situation oft schon verwitwet"
sind (ebd.).
Die Zahl der Personen mit mehrfachen Behinderungen geht nicht aus der Statistik her-
vor, da der Grad der Behinderung ausschließlich auf der jeweils schwersten Behinde-
rung basiert. Das heißt, dass nicht erfasst wird, ob neben der schwersten Behinderungs-
form noch weitere Arten von Behinderungen bei einer Person vorliegen (vgl.
Statistisches Bundesamt Deutschland 2009, S.4)
Zusammenfassend wird bei sichtbar, dass es sich bei den Menschen mit Behinderungen
um einen großen Personenkreis handelt. Da sich aber keine exakten Angaben über die
tatsächliche Anzahl der Personen mit einer Behinderung in der Bundesrepublik
Deutschland machen lassen und insbesondere Frauen aus oben genannten Gründen häu-
fig keinen Schwerbehindertenausweis beantragen, ist davon auszugehen, dass insgesamt
noch mehr Menschen in unserer Gesellschaft von den Problemen und Benachteiligun-
gen, die mit einer Behinderung einhergehen, betroffen sind, als in der Statistik beziffert.
2.3.2
Diskriminierungen und strukturelle Gewalt
Trotz der großen Fortschritte bezüglich der Anerkennung der Rechte von Menschen mit
Behinderungen und deren Akzeptanz in allen Lebensbereichen (vgl. Abschn. 2.1), wird
diese positive Entwicklung in der heutigen Zeit zunehmend auch beeinträchtigt durch
ein bioethisches Paradigma, welches eine rigorose Vermeidung von Krankheit anstrebt
18
(vgl. Watzal 2003, S.2). Zwar wird das Recht auf Leben von Menschen mit
Behinderungen in der heutigen Zeit, im Gegensatz zur Zeit des NS-Regimes, von
niemandem mehr bestritten (vgl. Arnade 2003, S. 3), jedoch hat sich die grundlegende
Idee der ,,Erschaffung qualitativ hochwertiger, leidensfreier, im sozialen
Reproduktionsprozess verwertbarer Menschen" (Mattner 2000, S. 128) mit den
modernen Möglichkeiten der Humangenetik, den biothetischen Diskursen um die
pränatale und Präimplantationsdiagnostik, um sogenannte ´Designerbabies` und um
lebensunwertes Leben bis heute gehalten (vgl. Mattner 2000, S. 128; Schildmann 2000,
S. 27; Vernaldi 2001, S. 48f). Hinzu kommt, dass in der heutigen Gesellschaft der
körperlichen Attraktivität und dem Attribut sexuell begehrenswert zu sein ein sehr
hoher Stellenwert beigemessen wird. Es hat sich ein Menschenbild etabliert, in dem ein
Mensch weitgehend auf seinen Körper reduziert wird. In diesem Zusammenhang
werden die Menschen, die den gängigen Idealen beispielsweise aufgrund von
Behinderungen nicht entsprechen, in hohem Maße abgewertet (vgl. Vernaldi 2001, S.
48f). Die heutige gesellschaftliche Situation von Menschen mit Behinderungen befindet
sich in einem Spannungsfeld zwischen einer bedürfnisorientierten, individuellen
Förderung und Bemühungen um Integration bzw. Inklusion auf der einen Seite und
einer modernen Debatte über die Kosten- Nutzen- Aspekte und den Wert (ungeborenen)
menschlichen Lebens auf der anderen Seite (s. Pränatale und
Präimplantationsdiagnostik) (vgl. Mattner 2000, S. 7; Arnade 2003, S. 5; Bergeest
2006, S. 45).
Neben der Abwertung von Menschen mit Behinderungen durch die moderne
´Eugenikdebatte` und der damit zum Ausdruck kommenden gesellschaftlichen Einstel-
lungen sind Menschen mit Behinderungen in vielen Lebensbereichen Diskriminierun-
gen und Ausgrenzungen ausgesetzt (z.B. ungefragtes Duzen und Anfassen, angestarrt,
beschimpft oder ignoriert werden) (vgl. Eiermann et al. 2000, S.119; Schröttle et al.
2012a, S. 14f). Denn eine Behinderung wird nach wie vor als Abweichung von der
´Normalität` bewertet (vgl. Eiermann et al. 2000, S. 119). Unter anderem beklagen ins-
besondere Menschen mit sichtbaren körperlichen Behinderungen, dass in unserer Ge-
sellschaft ´behindert sein` vielfach mit ´geistig behindert` oder ´blöd sein` gleichgesetzt
wird (vgl. ebd., S. 247). Weiterhin kommt es häufig zu belästigenden, bevormundenden
oder benachteiligenden Verhaltensweisen der Umwelt und Betroffene fühlen sich oft
nicht ernstgenommen (vgl. Schröttle et al. 2012a, S. 16), Frauen mit Behinderungen
19
berichten zudem davon nicht als geschlechtliches Wesen wahrgenommen zu werden
(vgl. Eiermann et al. 2000, S. 247).
Im alltäglichen Leben belastet zudem
,,[d]as Fehlen barrierefreier Umwelten, sei es aufgrund der unzureichenden räumlichen und
infrastrukturellen Bedingungen, sei es aufgrund mangelnder Unterstützung durch Hilfsmit-
tel und Gebärdensprachdolmetscher/-innen zur Gewährleistung der Kommunikation mit
Hörenden, sei es aber auch aufgrund der strukturellen Rücksichtslosigkeit von Ämtern und
Behörden im Umgang mit und der Förderung von Menschen mit Behinderungen"
(Schröttle et al. 2012b, S. 159)
die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen. Darüber hinaus berichten diese
häufig über negative Erfahrungen mit Ärzten/innen oder medizinischem Personal, z.B.
in Form von groben Untersuchungsmethoden, mangelnder Empathie oder auch Be-
zeichnung als ´Simulant/-in` (vgl. Eiermann et al. 2000, S. 120f).
Ein weiterer Bereich in dem es zu Diskriminierungen für Menschen mit Behinderungen
kommt, ist die Sprache. Trotz der steigenden Sensibilität bezüglich des Sprachge-
brauchs insbesondere von offizieller Seite oder in wissenschaftlicher Literatur, sind im
Alltag immer noch überwiegend Bezeichnungen wie die/der ´Behinderte(n)` oder auch
unangemessene Floskeln wie ´an den Rollstuhl gefesselt` gebräuchlich. Diese entspre-
chen einerseits nicht dem eigenen Empfinden der Menschen mit Behinderungen und
andererseits vermitteln sie ein falsches, einseitig negatives Bild vom Leben von Men-
schen mit Behinderungen (vgl. Radtke 2003, S.8f).
Ebenso zeigen sich die Medien wenig sensibel für die Lebenssituation von Menschen
mit Behinderungen, welchen hier eine sehr begrenzte Präsenz gewährt wird (vgl. ebd. S.
9). Entweder wird über Menschen mit Behinderungen berichtet, wenn sie ,,ungewöhnli-
che Leistungen erbringen" (ebd.) (z.B. Sport, berufliche Herausforderungen), was zeigt,
dass ihnen diese Leistungen eigentlich von vornherein nicht zugetraut werden und dass
für sie andere Normen angewendet werden (vgl. ebd.). Das andere Extrem bezüglich der
Darstellung von Menschen mit Behinderungen in den Medien ist die Darstellung als
,,ausschließlich hilfsbedürftige Wesen" (ebd.), wodurch Mitleid hervorgerufen werden
soll. Insgesamt wird durch den Umgang der Medien mit Behinderungen ein ´normales`
Bild sowie die Integration von Menschen mit Behinderungen erschwert bzw. verhindert
(vgl. ebd.).
20
In besonderem Ausmaß erfahren Menschen mit Behinderungen die in Einrichtungen
leben zudem strukturelle Gewalt
2
Ebenfalls problematisch ist der Umgang mit Partnerschaft und Sexualität in den Ein-
richtungen. Innerhalb der Einrichtungen scheinen ,,feste[n] Paarbeziehungen und/oder
eine[r] Familiengründung" (Schröttle et al. 2012a, S.15) nicht möglich zu sein (vgl.
ebd.). Dies zeigt sich unter anderem darin, dass Schwangerschaften überwiegend abge-
brochen werden und, obwohl der Großteil der Frauen in den Einrichtungen nicht in ei-
ner Partnerschaft lebt (vgl. Zemp 1997, S. 98) bzw. sexuell nicht aktiv ist (vgl. Schröttle
et al. 2012a, S. 15), kommt es bei vielen Frauen zur Anwendung von Verhütungsmitteln
(vgl. Zemp 1997, S. 98; Schröttle et al. 2012a, S. 15). Während noch vor einigen Jahren
in Einrichtungen in erster Linie Verhütung durch Sterilisation erfolgte (vgl. Zemp 1997,
S. 99), hat sich in der heutigen Zeit die ,,Gabe von Verhütungsmitteln (oft der 3-
Monatsdepots)" (Schröttle et al. 2012a, S. 15) durchgesetzt. Zemp (1997) erwähnt in
diesem Zusammenhang, ,,daß [!] bei vielen Frauen, um die möglichen Folgen von sexu-
eller Gewalt zu verhindern, prophylaktisch verhütet wird" (S. 98).
. Das bedeutet, dass die strukturellen Gegebenheiten
der Einrichtungen die eigene Lebensgestaltung einschränken und Bewohner/-innen über
mangelnde Selbstbestimmung und Gestaltungsmöglichkeiten verfügen. Unter anderem
können Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen leben, über ihre Zeit nicht
gemäß ihrer Bedürfnisse verfügen (z.B. vorgeschriebene Essens- oder Zu-Bett-geh-
Zeiten) und verfügen oft über wenig Privat- und Intimsphäre (z.B. nicht abschließbare
Zimmer oder Waschräume) was zudem das Risiko für (sexuelle) Gewalt erhöht (vgl.
Zemp 1997, S. 90; Schröttle et al. 2012a, S. 11; Abschn. 4.4.5).
Weitere Probleme, die sich für Menschen, die in Einrichtungen leben, stellen, sind die
Integration in den ersten Arbeitsmarkt aufgrund ,,geringe[r] Bildungs- und Ausbildungs-
ressourcen" (Schröttle et al. 2012a, S. 15) sowie ,,ein transparenter und selbstbestimm-
ter Umgang mit den eigenen finanziellen Mitteln" (ebd.). Des Weiteren zeigt sich im
Zusammenhang mit struktureller Gewalt, dass Frauen mit Behinderungen in hohem
Ausmaß von finanzieller Not betroffen oder bedroht sind (vgl. ebd. S. 16) und die fi-
nanziellen Mittel nicht ausreichen, ,,um die Dinge des täglichen Lebens zu finanzieren"
(ebd.) bzw. notwendige, behinderungsbedingte Ausgaben zu decken (vgl. ebd.).
Schröttle et al. (2012a) machen außerdem darauf aufmerksam, dass Frauen mit Behin-
2
Zemp (1997) versteht hierunter ,,Einschränkungen der persönlichen Freiheit in räumlich-
organisatorischer Hinsicht, z.B. mangelnde Intimsphäre durch Teilen des Zimmers [...]; keine Möglich-
keit das Zimmer abzuschließen etc." (S. 90).
21
derungen in Deutschland, insbesondere diejenigen, die in Einrichtungen leben, eine
,,größere soziale Isolation" (S. 89) aufweisen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bezüglich des Umgangs mit und der
Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft,
insbesondere bei Betrachtung der historischen Entwicklung, zwar enorme
Verbesserungen zu verzeichnen sind und es bedeutende Fortschritte gegeben hat.
Allerdings zeigt sich auch, dass eine uneingeschränkete Akzeptanz der Verschiedenheit
und die Anerkennung der Würde allen menschlichen Lebens in allen möglichen
Erscheinungsformen auch in der heutigen Zeit immer noch nicht erreicht sind und dass
Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft weiterhin von Ausgrenzungen,
Diskriminierungen und Vorurteilen betroffen sind (vgl. Rommelspacher 1999, S. 7ff;
Mattner 2000, S. 160; Arnade 2003, S. 6; Bergeest 2006, S. 54).
2.3.3
Interpersonale Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen
Neben der Betroffenheit von struktureller Gewalt und Diskriminierungen, sind Frauen
mit Behinderungen auch in hohem Ausmaß körperlicher und psychischer Gewalt ausge-
setzt, wie die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen zeigen (vgl. u.a. Eiermann et
al. 2000; Martin et al. 2006; Brownridge 2006; Schröttle et al. 2012a).
Eine nicht-repräsentative Untersuchung, die sich unter anderem mit der Gewaltbetrof-
fenheit von Frauen mit Behinderungen auseinandersetzt, ist die Studie ´Live Leben
und Interessen vertreten Frauen mit Behinderung` (vgl. Eiermann et al. 2000; im
Folgenden mit LIVE-Studie abgekürzt), deren Ziel es war, ,,´...die spezifischen Prob-
leme behinderter Frauen in ihren verschiedenen Facetten, d.h. auch nach Behinderungs-
arten getrennt zu erfassen´" (ebd. S. 33). In dieser Studie wurden 987 Frauen mit
Körper- und Sinnesbehinderungen im Alter von 16- 60 Jahren, die einen
Schwerbehindertenausweis besitzen und nicht in Einrichtungen oder Heimen leben,
schriftlich befragt. Zudem wurden 60 Frauen mit Körper- und Sinnesbehinderungen
biografisch interviewt sowie Gespräche mit 40 Frauen geführt (vgl. ebd. S. 55f).
Allgemeine Gewalterfahrungen wurden im Rahmen der mündlichen biografischen
Interviews erfragt (vgl. ebd. S. 270). Die Ergebnisse zeigten, dass Frauen mit
Behinderungen im Erwachsenenalter in erster Linie massive körperliche Gewalt durch
alkoholabhängige Ehemänner erleben. Erlebte körperliche Gewalt in der Kindheit ging
vor allem vom Vater aus, wobei teilweise aber auch die Mütter als Täterinnen in
22
Erscheinung traten. Allerdings geht aus der Studie auch hervor, dass die
Gewalterfahrungen teilweise bereits vor Eintritt der Behinderung stattfanden, sodass
kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Behinderung und Gewalterfahrung
hergestellt werden kann (vgl. ebd. S. 253f). Allerdings ist ein Zusammenhang zwischen
Behinderung und Gewalt insofern feststellbar, dass Behinderungen und Erkrankungen
eine Folge von Gewalterfahrungen sein können, insbesondere, wenn diese in der
Kindheit stattgefunden haben. Dies kann sich beispielsweise in Form von
psychosomatischen oder direkten körperlichen Beschwerden äußern. Andererseits kann
eine vorliegende Behinderung die Folgen einer Traumatisierung verstärken (z.B. durch
eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten oder soziale Isolation) (vgl. ebd. S.
271).
Auch internationale Studien haben sich mit der Gewaltbetroffenheit von Frauen mit
Behinderungen auseinandergesetzt. In einer repräsentativen US-amerikanischen
Untersuchung von Martin et al. (2006) wurde der Frage nachgegangen, ob der Status
der Behinderung von Frauen, die nicht in Institutionen leben, während des Zeitraums
von einem Jahr vor dem Befragungszeitpunkt mit einem erhöhten Risiko Gewalt zu
erleben korreliert (vgl. S. 823). Dabei wurden die von den befragten Frauen mit und
ohne Behinderungen angegebenen Gewalterfahrungen in drei Kategorien eingestuft:
keine Gewalterfahrung, nur körperliche Gewalt (sexuelle Gewalt ausgeschlossen) und
sexuelle Gewalterfahrungen (sowohl mit als auch ohne körperliche Gewalt) (vgl. ebd.).
Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass für Frauen mit Behinderungen im
Vergleich zu den Frauen ohne Behinderungen kein erhöhtes Risiko bestand, innerhalb
eines Jahres vor dem Befragungszeitpunkt nur körperliche Gewalt zu erleben (2 % vs.
2,3 %) (vgl. ebd. S. 831).
Demgegenüber stehen die Ergebnisse einer repräsentativen kanadischen Untersuchung
von Brownridge (2006), die das Risiko für Gewalt (einschließlich sexueller Gewalt) in
Paarbeziehungen bei Frauen mit Behinderungen im Vergleich zu Frauen ohne
Behinderungen in den letzten fünf Jahren vor dem Befragungszeitpunkt thematisiert
(vgl. S. 805). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass für Frauen mit Behinderungen
im Allgemeinen eine 40 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit vorliegt, in den fünf Jahren
vor dem Befragungszeitpunkt Gewalt in Paarbeziehungen erfahren zu haben, wobei
zudem ein besonderes Risiko für das Erleben schwerer Gewalt besteht. Bezogen auf das
letzte Jahr vor der Befragung weisen Frauen mit Behinderungen eine Prävalenz von
zwei Prozent auf (vs. 1,7 % Frauen ohne Behinderungen), bei Betrachtung der
23
vorausgegangenen fünf Jahre liegt die Prävalenz der Gewaltbetroffenheit von Frauen
mit Behinderungen bei etwa fünf Prozent (vs. 3,5 % Frauen ohne Behinderungen).
Somit stützt diese Untersuchung das vermutete höhere Risiko von Frauen mit
Behinderungen von Gewalt in Paarbeziehungen betroffen zu sein, wobei in diesem
Zusammenhang auch darauf verwiesen wird, dass vor allem das Risiko für schwere
Gewaltformen (z.B. schlagen, treten, beißen oder Faustschläge) doppelt so hoch ist, wie
für Frauen ohne Behinderungen (vgl. ebd. S. 812ff).
In der ersten repräsentativen Studie zur ´Lebenssituation und Belastungen von Frauen
mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland` von Schröttle et al. (2012a)
,,wurden 1.561 Frauen im Alter von 16 bis 65 Jahren befragt" (S. 7). Es handelte sich
dabei um Frauen mit und ohne Behindertenausweis, die in Haushalten und Einrichtun-
gen mit verschiedensten Beeinträchtigungen und Behinderungen, (körperliche, psychi-
sche und geistige sowie Sinnes- und multiple Behinderungen) leben, welche u.a. zu ih-
ren Erfahrungen mit Gewalt befragt wurden (vgl. ebd. S. 7f). Zudem wurden die
Ergebnisse dieser Studie teilweise mit Ergebnissen ,,aus der repräsentativen Vorgänger-
studie ´Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland` von
2004 verglichen" (ebd. S. 27), um eine Vergleichsmöglichkeit zu den Erfahrungen von
Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt zu haben (vgl. ebd.).
Neben einer repräsentativen Befragung in allgemeiner Sprache, in der Frauen mit
Behinderungen in Haushalten und Einrichtungen befragt wurden, gab es einen
Fragebogen in vereinfachter Sprache, mit denen Frauen in Einrichtungen mit einer
sogenannten geistigen Behinderung befragt wurden (vgl. Schröttle et al. 2012a, S. 27).
Darüber hinaus wurden nicht-repräsentative ,,Zusatzbefragungen bei gehörlosen, blin-
den und schwerstkörper-/mehrfachbehinderten Frauen" (Schröttle et al. 2012b, S. 3)
durchgeführt, da diese Gruppen im Rahmen der Hauptbefragung nicht ausreichend re-
präsentiert worden wären und für die Befragung teilweise andere Methoden nötig waren
(vgl. ebd.). In diesem Rahmen wurden 341 Frauen im Alter von 16-65 Jahren befragt
(wobei der Anteil der 16-20-Jährigen sehr gering war) (vgl. ebd.) Außerdem wurde in
diesem Zusammenhang eine
qualitative Studie bezüglich der indiviuellen
Gewalterfahrungen mit 31 der von Gewalt betroffenen Frauen im Alter von 25 bis 62
Jahren durchgeführt (vgl. Kavemann & Helfferich 2012, S. 13). Ziel war es, ,,wesentli-
che Anhaltspunkte für praktische Unterstützung zu gewinnen" (ebd.).
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Frauen mit Behinderungen von allen
Gewaltformen (körperliche, psychische und sexuelle) im Erwachsenenleben wesentlich
24
häufiger betroffen sind, als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Von mindestens einer
Situation körperlicher Gewalt sind Frauen mit Behinderungen nahezu doppelt so häufig
betroffen, wie Frauen ohne Behinderungen (58-73% vs. 35%) (vgl. Schröttle et al.
2012a, S.12f).
Viele der betroffenen Frauen haben aber auch bereits in der Kindheit in höherem
Ausmaß als Frauen ohne Behinderungen Gewalt (z.B. durch Eltern) und dabei
insbesondere schwere körperliche sowie psychische Gewalt erlebt. Dies triffft auch auf
diejenigen Frauen zu, bei denen die Behinderung erst später im Lebensverlauf
eingetreten ist (vgl. ebd. S. 12). Ebenso erfolgte die Gewaltausübung bei vielen Frauen,
bei denen die Behinderung erst im Erwachsenenalter auftrat, sowohl vor als auch nach
Eintreten der Behinderung (vgl. ebd. S. 13). In diesem Zusammenhang wird auf die
wechselseitige Beziehung zwischen Gewalterfahrungen und Behinderungen verwiesen:
einerseits besteht für Frauen mit Behinderungen ein erhöhtes Risiko von Gewalt
betroffen zu sein, andererseits können Gewalterfahrungen den physischen und
psychischen Gesundheitszustand beeinflussen (vgl. ebd. S. 12).
Am häufigsten von körperlicher und psychischer Gewalt sind die Frauen betroffen, die
in Einrichtungen leben und mit dem allgemeinen Fragebogen befragt wurden (vor allem
Frauen mit psychischen Erkrankungen sowie einige Frauen mit Schwerstkörper- bzw.
Mehrfachbehinderung) (vgl. ebd. S. 13). Zudem zeigt die Untersuchung, dass Frauen
mit Behinderungen ,,nicht nur häufiger körperliche Übergriffe erlebt haben, sondern
dass es sich dabei auch um schwerere und vielfach auch bedrohlichere Übergriffe
gehandelt hat" (ebd.; Hervorheb. im Original). Frauen mit Sinnes- und
Körperbehinderungen weisen außerdem ein besonders hohes Ausmaß an
Gewaltbetroffenheit auf. Vor allem gehörlose Frauen haben in Kindheit und Jugend
demnach ,,doppelt so häufig wie die anderen Befragungsgruppen Tätlichkeiten
zwischen den Eltern miterlebt" (Schröttle et al. 2012b, S. 13). Des Weiteren haben diese
Frauen
,,signifikant häufiger psychische Gewalt durch Eltern erlebt. Darüber hinaus wurden von
etwa drei Viertel der Frauen [...] psychische und/oder körperliche Übergriffe in
Einrichtungen benannt, in denen sie in Kindheit und Jugend untergebracht waren" (ebd.).
Ebenfalls hoch ist das Ausmaß der Gewalterfahrungen der Frauen der Zusatzbefragung
im Erwachsenenleben. Mehr als drei Viertel (78-84%) der in diesem Rahmen befragten
Frauen waren psychischer und mehr als jede zweite Frau (60-75%) körperlicher Gewalt
ausgesetzt (vgl. ebd. S. 12). Auch hier sind die gehörlosen Frauen die am stärksten
25
betroffene Gruppe: ,,Jeweils drei Viertel der gehörlosen Frauen hatten körperliche bzw.
psychische Gewalt seit dem 16. Lebensjahr erlebt [...]" (ebd. S. 14). Zudem berichtete
etwa die Hälfte der Frauen der Zusatzbefragung (40-50%) ,,von psychisch verletzenden
Verhaltensweisen durch Personen in Ämtern und Behörden und etwa 30-40%
benannten dies im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung, insbesondere durch
Ärzte/-innen" (ebd. S. 14).
Bezüglich der Täter/-innen zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass diese, wie auch bei
Frauen ohne Behinderungen, in erster Linie aus dem sozialen Nahraum der betroffenen
Frauen stammen; d. h. es handelt sich dabei vor allem um Partner/innen oder
Familienmitglieder (vgl. Schröttle et al. 2012a, S. 14). Bei Frauen, die in Einrichtungen
leben und neben dem hohen Ausmaß an struktureller Gewalt körperliche, sexuelle und
psychische Gewalt erfahren, erfolgt dies in der Regel durch andere Bewohner/innen,
Arbeitskollegen/innen sowie durch das Einrichtungspersonal (vgl. ebd.).
3.
Frauen mit Behinderungen im Spannungsfeld zwischen Behinde-
rungs-, Geschlechts- und Sexualitätskonstruktionen
Bereits die Auseinandersetzung mit den aktuellen Lebenslagen von Menschen mit Be-
hinderungen lässt erahnen, dass für Frauen und Männer mit Behinderungen unterschied-
liche Lebensbedingungen existieren. Diese ergeben sich unter anderem aus der traditio-
nellen, geschlechtsspezifischen Aufgabenverteilung in unserer Gesellschaft (vgl.
Abschn. 2.3.1). Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass aufgrund der Behinderung auch
erhebliche Unterschiede bezüglich der Lebenssituation von Frauen mit und ohne Behin-
derungen bestehen. In diesem Kapitel sollen deshalb, vor dem Hintergrund der relatio-
nalen Sichtweise von Behinderung (vgl. Abschn. 2.2), die Lebens- und Sozialisations-
bedingungen von Frauen mit Behinderungen sowie die sich daraus ergebenden Benach-
teiligungen dargelegt werden. Dabei wird im Hinblick auf die Problematik der sexuellen
Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen insbesondere der Bereich der Sexualität the-
matisiert. Zunächst wird deshalb die ´doppelte Diskriminierung`, die sich für Frauen mit
Behinderungen in unserer Gesellschaft ergibt, aufgezeigt. Anschließend erfolgt eine
Auseinandersetzung mit dem Begriff der ´Sexualität`, um im darauffolgenden Abschnitt
aufzuzeigen, wodurch die gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber der Sexualität von
Ende der Leseprobe aus 127 Seiten
- Arbeit zitieren
- Heike Hiemstra (Autor:in), 2012, Sexuelle Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen. Hintergründe, Prävention und Hilfsangebote, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376258
Kostenlos Autor werden
✕
Leseprobe aus
127
Seiten




















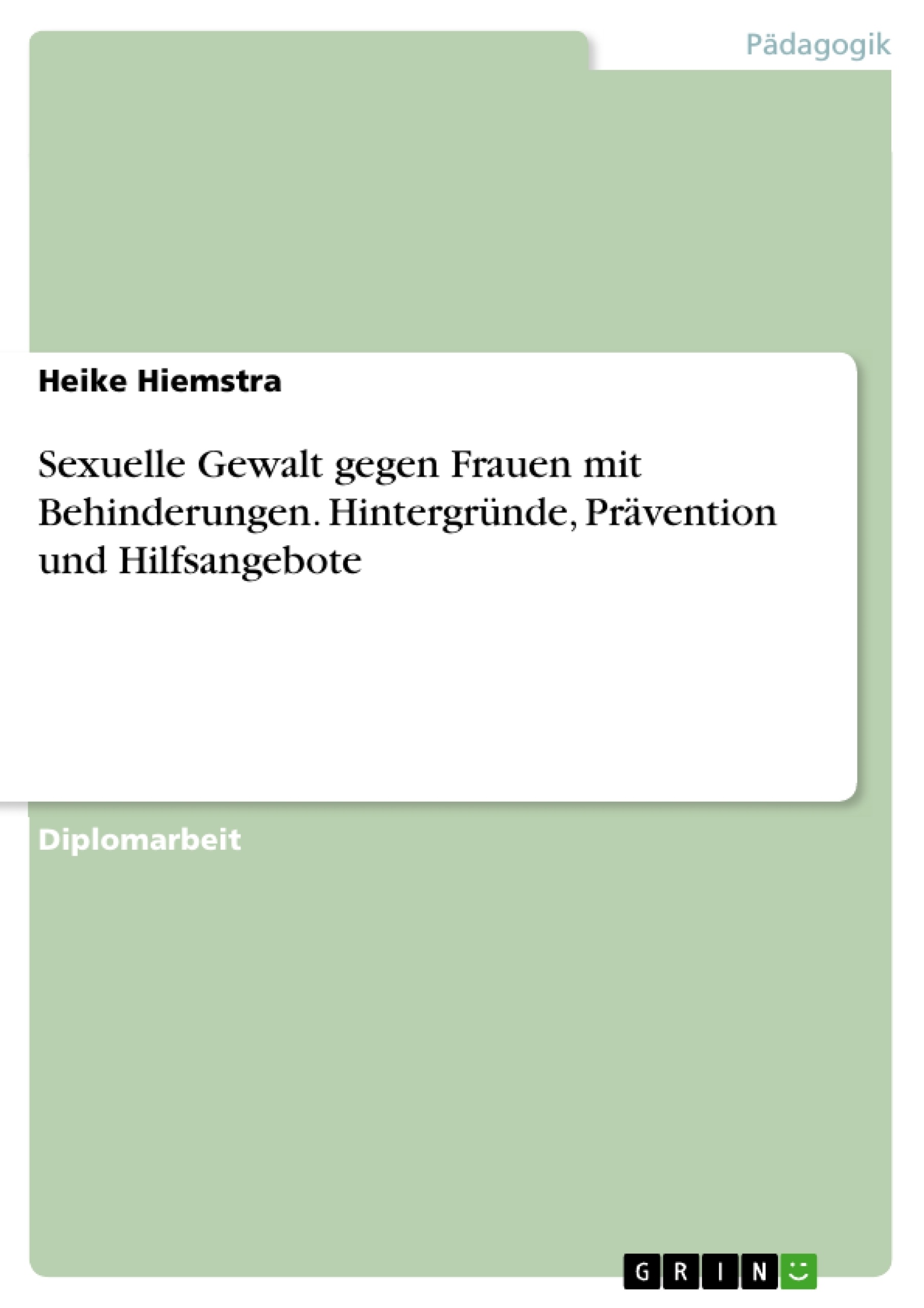

Kommentare