Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Perspektiven auf ,Behinderung‘
2.1 Medizinische und psychologische Betrachtung
2.2 Juristische Betrachtung
2.3 Pädagogische Betrachtung
2.4 Sozial- und kulturwissenschaftliche Betrachtung
3. Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung
3.1 Soziale Kategorisierung und Stereotypisierung
3.2 Ursache und Formen von Vorurteilen
3.3 Soziale Diskriminierung
4. Stigmatisierung und das Stigma
4.1 Entstehung des Begriffs Stigma
4.2 Erving Goffmans Konzept des ,Stigmas'
4.3 Typen von Stigmata
4.4 Die Ursachen und Sinn von Stigmata
4.5 Auswirkungen von Stigmatisierung
5. Stigmatisierungs- und Diskriminierungsprozesse in der Gesellschaft
5.1 Historische Stigmatisierungs- und Diskriminierungsprozesse gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung
5.2 Ursachen und Hartnäckigkeit von Diskriminierungsprozesse gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung
5.3 Aktuelle Diskriminierungen von Menschen mit Beeinträchtigung
6. Entstigmatisierung und Antidiskriminierung
6.1 Rechtliche Mittel
6.1.1 UN-BRK
6.1.2 Bundesdeutsche Gesetzgebung
6.2 Integration und Inklusion
6.3 Selbstbestimmung und Empowerment
6.4 Herausforderungen für die Soziale Arbeit
7. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Sekundärliteraturverzeichnis
1. Einleitung
Menschen mit Beeinträchtigung entsprechen häufig nicht dem normativen Bild, das eine Gesellschaft von sich selbst hat, und es kommt dazu, dass sie ungewollt von der Idealvorstellung abweichen. Eine solche Idealvorstellung findet sich auch auf dem Titelblatt wieder, auf dem eine hübsche Frau abgebildet wurde. Erst der zweite Blick offenbart, dass die Frau an einer körperlichen Beeinträchtigung leidet, wodurch sie nicht mehr die Erwartungen der ,Normalität‘ erfüllt, die hier vom Schatten symbolisiert werden. Der ständige Versuch der Gesellschaft, Menschen mit Beeinträchtigung einer Normvorstellung anzupassen, bewirkt, dass bei
Normabweichung die sogenannten ,normalen Menschen‘ häufig dazu neigen, Betroffene abzuwerten und sie zudem auszugrenzen. Denn eine solche Beeinträchtigung hängt auch immer von den Definitionen im aktuell gültigen Werte- und Normensystem der Gesellschaft ab. Sie können je nach Zeit und Kultur unterschiedliche Formen annehmen. In diesem Sinn hat das Bild auf dem Titelblatt auch für jede Person unterschiedliche Bedeutung, weil die Menschen alle von verschiedenen Vorstellungen und Erfahrungen geprägt sind.
Seit Einsetzen der Inklusionsbewegung in den 1990er Jahren und der unterschiedlichen Ansätze, wie dem Empowerment und den Disability Studies, hat sich auch die Auffassung von Menschen mit Beeinträchtigung erheblich verändert, sodass sie heute vielmehr als Bestandteil der Gesellschaft gelten. Vor allem die Integration hat seit den 1970er Jahren dazu beigetragen, die Betroffenen aus ihrer Nische zu holen und sie den Normvorstellungen der Gesellschaft anzupassen. In einer Gesellschaft, in der nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes ca. 7.615.560 Menschen mit Beeinträchtigung leben, wovon 6.583.463 der Betroffenen ihre Beeinträchtigungen durch eine allgemeine Krankheit erworben haben (vgl. DESTATIS 2015: Online) und angesichts der steigenden Gefahr, infolge der höheren Lebenserwartung selbst in eine solche Situation zu geraten, ist es immer wieder notwendig zu schauen, wie es den Menschen mit Beeinträchtigung in der heutigen Gesellschaft geht.
Trotz aller unbestrittenen Fortschritte läuft nicht alles perfekt. Es ist noch einiges zu verbessern. Genau hier beginnt die Frage dieser Arbeit, indem sie in den Fokus setzt, wie Menschen mit Beeinträchtigung auch heute noch stigmatisiert und diskriminiert werden und welche Lösungen hierbei helfen könnten. Zudem wird erörtert, wie die Soziale Arbeit zur objektiven Verbesserung der Situation von beeinträchtigten Menschen beitragen kann und welche Herausforderungen daraus entstehen.
Um sich diesen Fragen zu nähern, ist vor allem ein theoretischer Rahmen erforderlich, der stärker die einzelnen Aspekte berücksichtigt. Daher behandelt das zweite Kapitel die unterschiedlichen Formen der Beeinträchtigung und zeigt, wie Beeinträchtigung in den medizinischen, psychologischen, juristischen, pädagogischen und sozial- und kulturwissenschaftlichen Diskursen aufgefasst wird und wodurch sich diese Modelle voneinander unterscheiden.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Ursachen der Diskriminierung von Menschen mit Beeinträchtigung. Hier werden zunächst Stereotype vorgestellt und deren Nutzen als Kategorisierungen erörtert. Anschließend werden Vorurteile und deren Bedeutung analysiert. Schließlich wird die soziale Diskriminierung diskutiert und das Auftreten dieser Formen erörtert.
Ergänzend dazu beschäftigt sich das vierte Kapitel mit dem von Erving Goffman geprägten Begriff des Stigmas und untersucht dessen Bedeutung und Sinn und stellt Typologien vor. Dann skizziert es Auswirkungen von Stigmatisierung für die Betroffenen.
Der anschließende Abschnitt (Kapitel Fünf) verbindet die theoretische Diskussion mit der Minderheitengruppe der Menschen mit Beeinträchtigung und gibt somit Aufschluss über die Auswirkung von solchen Stigmatisierungs- und Diskriminierungsprozessen in der historischen und aktuellen Entwicklung. Außerdem erörtert er die Ursachen der Diskriminierung dieser Menschen und skizziert anhand, auf aktuelle Statistiken gestützt, Muster der Diskriminierung, denen Menschen mit Beeinträchtigung privat und institutionell ausgesetzt sind.
Das sechste und vorletzte Kapitel setzt sich mit Modellen zur Bekämpfung von Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit Beeinträchtigung auseinander. Hierzu gehören zunächst die rechtlichen Möglichkeiten. Vor allem die UN-BRK sowie die gesetzliche Entwicklung in Deutschland werden hier vorgestellt. Sodann werden Teilhabe und Inklusion als mögliche Fortschritte der Antidiskriminierung und der Entstigmatisierung kritisch gewürdigt. Abschließend wird in diesem Kapitel näher auf die Herausforderungen für die Soziale Arbeit diesbezüglich eingegangen. Wie kann sie sich einbringen, um Diskriminierung zu verringern oder gar zu unterbinden, und worauf müssen Fachkräfte achten, damit sie nicht selbst in die Diskriminierungsfalle gegenüber ihren Klienten und Klientinnen geraten? Das letzte Kapitel beantwortet die Forschungsfrage und resümiert die Überlegungen.
2. Perspektiven auf ,Behinderung‘
Mit dem Versuch, eine universelle Bezeichnung für sämtliche Betroffenen zu finden geht die Gefahr einher, dass Definitionen und Begriffe zu weit greifen und unpräzise werden. Zudem sind das Verständnis und die Begriffsbestimmung historisch und kulturell variabel (vgl. Dederich 2009: 15).
Hierbei ist der Begriff ,Behinderung' verhältnismäßig jung. Er geht auf das im Jahr 1957 durch den Bundestag verabschiedete Körperbehindertengesetzes zurück. Zuvor herrschte der Begriff des ,Krüppels', der dem steigendem gesellschaftlichen Druck, vor allem durch die Kriegsgeschädigten nicht standhielt, die den Begriff zu Recht als ungeeignet und als diskriminierend empfanden (vgl. Hensle/Vernooij 2002: 8f.).
Schoenberg zu Folge ist eine allgemeingültige anerkannte Definition von ,Behinderung' international weder in der Wissenschaft noch im juristischen Bereich zu finden (Schoenberg 2013: 13, in Anlehnung an Altman 2001: 97/Degener 2006: 1). Es ist nicht verwunderlich, dass viele Ansätze und Begrifflichkeiten unter anderem in den Bereichen der Medizin, Psychologie, Soziologie und Pädagogik existieren, die ,Behinderung' in ihrem Kontext und ihren unterschiedlichen Funktionen zu beschreiben versuchen.
Da das Verständnis von ,Behinderung' von der Perspektive und dem historischen Kontext abhängt, wird diese Arbeit mehrere Sichtweisen vorstellen, um einen ersten Einblick in das Thema und die verschiedenen Ansichten der ,Behinderung' zu geben und die damit einhergehende Unsicherheit, die auch einen Nährboden für Stigmatisierung und Diskriminierung bietet.
2.1 Medizinische und psychologische Betrachtung
Bis weit in das letzte Jahrhundert war der medizinische Ansatz ein gängiges Modell, der die Problematik einer ,Behinderung' bei den Individuen selbst gesucht hat. Infolge dessen wurden Menschen mit Beeinträchtigung anhand medizinischer Normen bewertet. Sie galten dann als beeinträchtigt, wenn sie nicht in der Lage waren gewisse Funktionen aus der medizinischen Sicht zu erfüllen (Schoenberg 2013: 18, in Anlehnung an Hahn 1985: 88).
Diese Auffassung deutet ,Behinderung' als Defizit des Individuums, das deshalb für die Bewältigung seines Alltags bestimmte Unterstützung benötigt (vgl. Lindmeier/Lindmeier 2012: 16). Auch psychologische Betrachtungen ähneln diesem medizinischen Ansatz, welche die Problematik, bei den Betroffenen selbst suchen. Das medizinische Wörterbuch Pschyrembel definiert die psychische ,Behinderung' als:
„durch eine psychische Störung bedingte chronische Beeinträchtigung der Teilhabe an der Gesellschaft (u.a. hinsichtlich Erwerbstätigkeit, Alltagsbewältigung, sozialer Integration). Sie ist rechtlich der körperlichen und geistigen Behinderung (Intelligenzminderung) gleichgestellt. “
(Maier/Pschyrembel 2017, Online)
Laut dieser Definition kann jederzeit aus einer psychischen Störung eine psychische Beeinträchtigung werden. Gimbel und Schartmann wenden gegen diese Sicht ein, nicht jede psychische Störung müsse zwangsläufig in eine psychische Beeinträchtigung münden. Eine psychische ,Behinderung' entstehe erst, wenn eine Chronifizierung des Leidens oder dessen periodischer Verlauf erkennbar wäre. Psychische Beeinträchtigung schränkt die Teilhabe der Betroffenen an der Gesellschaft und im Alltag ein (vgl. Landschaftsverband Rheinland 2015: 13f.).
Zur Diskussion des Komplexes ,Behinderung' ist es notwendig die Formen der Beeinträchtigung, welche durch die medizinische Klassifikation entstanden sind, zu differenzieren. Hierunter fallen zum Beispiel die geläufigsten Arten, wie die körperliche, psychische und geistige Beeinträchtigung. Angesichts der vielen verschiedenen Formen der ,Behinderung' fokussiert sich diese Ausarbeitung auf die bekanntesten Formen, um nicht den Rahmen zu sprengen:
Beeinträchtigungen, die das Hören betreffen, werden unterschieden in Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit. Menschen mit Gehörlosigkeit können akustische Ereignisse nicht wahrnehmen. Hingegen ist bei Menschen mit Schwerhörigkeit nur das Hörorgan geschädigt. Hier kann ein Hörgerät helfen, die Fähigkeit, Geräusche wahrzunehmen, zu erhöhen (vgl. Biewer 2017: 53; Leonhardt 2016: 189f.).
Als Beeinträchtigung des Sprechens ist vor allem die ,Sprachbehinderung' zu benennen. Sie umfasst dabei eine Störung der Sprachentwicklung, wodurch das Reden nur begrenzt möglich ist oder es zu einer Stimmstörung kommt. Beispiele für eine ,Sprachbehinderung' können Stottern, Mutismus oder Sprechangst sein. Ein wesentlicher Aspekt bei der Identifizierung einer ,Sprachbehinderung' ist ihr Alleinstellungsmerkmal, deshalb kann sie keine Folge einer anderen Beeinträchtigung sein (vgl. Biewer 2017: 59; Von Knebel 2016: 186f.).
Eine bekannte Form der Beeinträchtigung ist die ,Lernbehinderung'. Das Individuum hat vor allem Schwierigkeiten beim Lernen, die das Vermögen zu konzentrierten Leistungen beeinträchtigen und auch das Verhalten beeinflussen. Außer der ,Lernbehinderung' wird die Lernstörung als eine temporäre Beeinträchtigung genannt. Zuweilen soll der Begriff der ,Lernschwierigkeit' ein Defizit in den eigenen Möglichkeiten und Zielen beschreiben (vgl. Biewer 2017: 57f.; Wember/Heimlich 2016: 197ff).
Neben der ,Lernbehinderung‘ lässt sich oft die geistige Beeinträchtigung als zu verwechselnde Nebenform identifizieren. Eine solche Beeinträchtigung zeigt sich zwar auch im eingeschränkten Lernvermögen. Jedoch zeichnet sich eine geistige Beeinträchtigung vor allem durch den geringen Intelligenzquotienten (<50/60) aus, was neben sprachliche und geistige auch emotionale Entwicklungsdefizite zur Folgen haben kann (vgl. Biewer 2017: 55; Stinkes 2016: 218f.).
Beeinträchtigungen, die das Sehen betreffen, werden in ,Sehbehinderung‘ und Blindheit unterteilt. ,Sehbehinderte‘ können immerhin noch rudimentär visuelle Informationen aus der Umwelt wahrnehmen. Menschen mit Blindheit sind dazu überhaupt nicht mehr in der Lage. Sie versuchen mit anderen Sinnen, den fehlenden auszugleichen. Wahrnehmungsorgane, deren Leistungsfähigkeit dann oft verbessert ist, sind etwa der akustische oder der haptische Sinn (vgl. Biewer 2017: 52; Walthes 2016: 201f.).
Beeinträchtigungen durch Krankheit werden üblicherweise in psychischen Störungen und somatische Erkrankungen unterteilt. Gerade erstere sind oft nur schwer zu erkennen. Hierzu zählen unter anderem affektive Störungen und Persönlichkeitsstörungen. Als somatische Erkrankungen gelten etwa Hinweise für Herz- und Kreislauferkrankungen (vgl. Steins 2016: 210f.).
Ähnlich zeigt sich die ,Körperbehinderung‘, welche die physische und motorische Entwicklung beeinträchtigen. Sie geht oft einher mit Schädigungen der Stütz- und Bewegungsorgane und kann zu erheblichen Einschränkungen im Alltag führen, was meist mit einem Unterstützungsbedarf einhergeht (vgl. Biewer 2017: 54;
Daut/Lelgemann/Walter-Klose 2016: 212ff.).
Die letzte hier erwähnte Kategorie lässt sich nicht spezifizieren und wird oft als komplexe bzw. schwere Beeinträchtigung bezeichnet. Betroffene haben hohe Komorbidität: etwa eine geistige Beeinträchtigung, die eine psychische Störung zur Folge hat oder eine Beeinträchtigung, welche die Person oder Außenstehende gefährden kann (vgl. Fornefeld 2016: 222ff.).
Vor allem soziologische Modelle kritisieren am medizinisch-psychologischen Ansatz, dass die Ursache für die Beeinträchtigung im Individuum gesucht wird. Dadurch werden die Betroffenen mit dem Rollenverständnis eines ,Kranken‘ assoziiert und mit dem vorrangigen Ziel der Genesung (Schoenberg 2013: 19, in Anlehnung an Mitra 2006: 237).
Eine solche Genesung ist bei einer Beeinträchtigung als Folge vorangegangener Erkrankungen nur schwer erreichbar, weil diese meist dauerhaft sind und oft unheilbar. Auch wenn die medizinische Betrachtung seit Jahren überholt ist, finden sich ihre Elemente weiterhin in vielen Definitionen (z. B. der Gesetzgebung) wieder (Schoenberg 2013: 19, in Anlehnung an Mitra 2006: 237).
Schoenberg vermutet, dass wegen der leicht durchführbaren medizinischen Klassifikation auf Basis des Klassifikationssystems der „internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision“ (ICD-10) eine Erfassung der gesundheitlichen Probleme im medizinischen Sinn einfacher ist, weil hier nur die medizinischen psychologischen Schädigungen betrachtet werden. Vor allem bietet die konkrete Festlegung auf medizinische Probleme eine gute Chance für eine einheitliche Operationalisierung. Solche Aspekte sind höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich, dass der medizinische Ansatz so lange benutzt wurde. Zwar schließt er andere Faktoren aus, indem er die Problematik nur beim Individuum betrachtet. Andererseits ist es auch nicht ratsam, ihn völlig über Bord zu werfen, insbesondere, weil eine medizinische Versorgung auch ohne Genesungschance ratsam für eine gute Förderung ist (vgl. Schoenberg 2013: 20).
Die bereits im letzten Abschnitt erwähnte ICD-10 dient zur Klassifizierung von Gesundheitsproblemen und ergänzt die neu eingeführte „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF), welche sich mit der Funktionsfähigkeit und der ,Behinderung' beschäftigt (vgl. Lindmeier/Lindmeier 2012: 25f.).
Durch die vielen Ansätze, die in den letzten Jahren diskutiert wurden, hat auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Perspektive auf die ,Behinderung' verändert. Im Jahr 2001 wurde die bis dahin geltende „Internationale Klassifikation der Schädigung, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen“ (ICIDH) durch die „Internationale Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) abgelöst. Angesichts der hohen Dichte an Krankheits- und Beeinträchtigungsformen und die dadurch steigende Komplexität gliederte sich, die ICF für eine bessere Erfassung in zwei Teile auf. Während sich der erste Teil mit der Funktionalität und ,Behinderung' beschäftigt, fokussiert der zweite Teil die Kontextfaktoren (vgl. Lindmeier/Lindmeier 2012: 28).
Abbildung 1 Das bio-psycho-soziale Modell der ICF
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (2005: 23)
Wie Abbildung 1 veranschaulicht, setzt sich die Funktionalität aus drei Ebenen zusammen: Zunächst einmal aus der biologischen Ebene des Körpers, welche dessen Funktion und Struktur betrifft. Die psychologische Ebene der Aktivität und die soziale Ebene der Partizipation betrachten die Einzelperson als Individuum und als gesellschaftliches Wesen im Hinblick auf Funktionalität. Als Kontextfaktoren gelten Elemente der Umwelt und der Gesellschaft mit Wirkungen auf das Individuum (vgl. ebd.: 22). Zu den personenbezogenen Faktoren zählen unter anderem ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht oder Erziehung (vgl. ebd.: 16ff.).
Infolge der neuen Deutungen durch das ICF hat sich auch das Verständnis über ,Behinderung' bei der Weltgesundheitsorganisation verändert:
„Eine Behinderung liegt demnach vor, wenn Schädigungen oder Abweichungen von anatomischen, psychischen oder physiologischen Körperstrukturen und -funktionen einer Person mit Barrieren in ihrer räumlichen und gesellschaftlichen Umwelt so zusammenwirken, dass eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft nicht möglich ist.“ (Engels/Engel/Schmitz 2016: 15).
Die Definition des ICF lässt vermuten, dass ,Behinderung' nicht länger als ein von der Norm abweichendes oder gesundheitliches Defizit gilt. Vielmehr soll durch Einbeziehen von verfügbaren Ressourcen die Partizipation einer von der ,Behinderung' betroffenen Person mit ihrer sozialen und materiellen Umwelt befördern. Demnach richtet der aktuelle Teilhabebericht das Hauptaugenmerk auf die erfolgreiche Partizipation der Betroffenen (vgl. ebd.).
Dieser neue Partizipationsgedanke rückt gerade den sozialen Aspekt stärker in den Vordergrund. Lindmeier und Lindmeier zeigen deutlich, dass mit dieser neuen Betrachtung die ,Behinderung' nicht länger als ein Zustand der Person beschrieben wird, sondern vielmehr eine Handlungssituation, in der die Betroffenen existieren (vgl. Lindmeier/Lindmeier 2012: 28).
Die Erweiterung des medizinischen zu einem bio-psycho-sozialen Modell soll helfen, die Lebensumstände der Betroffenen besser zu berücksichtigen und zugleich positive Gelegenheiten für erfolgreiche und selbstbestimmte Partizipation in der Gesellschaft bieten (vgl. DIMDI 2005: 24f.).
2.3 Juristische Betrachtung
Zu den ersten Versuchen einer besseren Ausformulierung der ,Behinderung' zählt das im Jahr 1994 erlassene Gesetz des Benachteiligungsverbots von Menschen mit Beeinträchtigung im Grundgesetz. In der bundesdeutschen Gesetzgebung beschäftigt sich damit vor allem das neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX), dessen Untertitel „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ lautet (vgl. Welti 2005: 58).
Es wurde versucht, durch Einbeziehung des neuen ICF ,Behinderung' gesetzlich angemessen zu formulieren. § 2 Absatz 1 SGB IX definieren ,Behinderung', ähnlich wie der § 3 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG), wie folgt:
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. “
Ergänzt wird diese Ausführung durch den § 2 Absatz 2 SGB IX, der auf den Schweregrad der Beeinträchtigung eingeht und die Teilhabe von Schwerbehinderten Menschen' regelt. Zugleich liefert der Paragraph auch eine Richtlinie zur Differenzierung zwischen ,Behinderung' und ,schwerer Behinderung'. Es gelten Menschen ab einem Grad der ,Behinderung' (GdB) von mindestens 50 Prozent als ,schwerbehindert'. Zudem sind Betroffene mit weniger als 50 Prozent, aber mehr als 30 Prozent den Schwerbehinderten' Menschen gleichgestellt.
SGB IX schuf einen anderen Blick, denn nun werden Betroffene nicht mehr als ,Behinderte', sondern als ,behinderte Menschen' bezeichnet. Durch diese Umformulierung wird den Betroffenen die wesentliche Zugehörigkeit in die Gruppe der Menschen zugesprochen und ihre Beeinträchtigung nur noch als eine Eigenschaft oder eine Situationsbeschreibung angesehen. Sie ist nicht länger ein Hauptfaktor, der die Persönlichkeit ausmacht (vgl. Welti 2005: 58f.)
2.4 Pädagogische Betrachtung
Die pädagogische Betrachtung lässt sich im Allgemeinen nur schwer erfassen, da sich im Laufe der Zeit viele Bereiche aus der allgemeinen Pädagogik entwickelt haben. Hier werden zwei Varianten vorgestellt:
Als erste Variante wird die Ansicht in der dialektisch-materialistischen Pädagogik vorgestellt (vgl. Moser/Sasse 2008: 66ff.). Vor allem Jantzen hat die dialektischmaterialistische Pädagogik durch die mehrdimensionale Betrachtung ergänzt. Er definiert ,Behinderung' wie folgt:
„Behinderung ist ein Prozess der sozialen Beeinträchtigung der Lebensmöglichkeiten menschlicher Individuen, der auf der Basis mangelnder Vermittlungsprozesse zwischen Individuum und Gesellschaft sich als Beeinträchtigung der Persönlichkeit realisiert“. (Jantzen 1990: 380, zit. n. Moser/Sasse 2008: 67)
Hier ist ,Behinderung' weder ein individuelles Merkmal wie beim medizinischen Ansatz noch eines der Umwelt, sondern es wird eher als ein Ergebnis aus dem Austausch von Beziehungen verstanden (Moser & Sasse 2008: 67, in Anlehnung an Jantzen 2002: 322). Betrachtungen, die sich auf Jantzen beziehen, ist gemein, dass sie von , sozialer Isolation' sprechen, die das eigene Selbst und die Interaktion mit der Welt gefährden. Deshalb gehört es zur pädagogischen Aufgabe, den Vermittlungsprozess zu verbessern und seine Umsetzung zu unterstützen (ebd.: 22, in Anlehnung an Jantzen 1996: 22).
Als zweite Variante wird der integrationspädagogische Ansatz beschrieben. Eine ,Behinderung' wird hier wie auch im dialektisch-materialistischen Ansatz nicht als individuelles Defizit verstanden. Vielmehr ist es eine menschliche Existenzform, die Anspruch darauf hat, nicht ausgesondert zu werden. Vor allem das Selektieren von Kindern und Jugendlichen in Bildungsinstitutionen wird kritisiert. Dadurch entsteht die Forderung, nicht nur ,nicht-behinderte' und ,behinderte' Kinder gemeinsam zu unterrichten, sondern eine Schule zu schaffen, die sich auf alle konzentriert und jede individuelle Stärke und Schwäche in die Betrachtung miteinbezieht (ebd.: 104, in Anlehnung an Deppe-Wolfinger 1997).
,Behinderung' ist in diesem Sinne eine Bereicherung der Vielfältigkeit, die schützenswert ist und nicht der ,normalen' Gesellschaft angepasst werden muss. Die integrative Schule soll dazu beitragen, dass kein Konkurrenzkampf entsteht, sondern die Kinder einander unterstützen und helfen (ebd.: 106, in Anlehnung an Deppe- Wolfinger 1997). Deppe-Wolfinger kritisiert das aktuelle Bildungssystem. Der gemeinsame Unterricht sei zwar eine Erweiterung, jedoch keine wirkliche ,Schule für alle' (ebd.: 110, in Anlehnung an Deppe-Wolfinger 2004: 245).
2.5 Sozial- und kulturwissenschaftliche Betrachtung
Während sich das medizinische Modell nicht mehr als zeitgemäß erwiesen hat und viel Kritik erntete, fand der soziale Erklärungsansatz von ,Behinderung' immer mehr Zustimmung. Er geht laut Hermes und Rohrmann davon aus, dass die Problematik eher durch die Gesellschaft bedingt wird. Beispiele hierfür sind der beschränkte Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe und die immer noch vorherrschenden massiven Vorurteile gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung. Mithilfe des sozialen Modells sollen gesellschaftliche Barrieren der Teilhabe erkannt und behoben werden (Hermes 2006: 18ff., in Anlehnung an Oliver 1996: 33; Priestley 2003: 26ff.).
Grundlage des sozialen Modells ist eine strikte Unterscheidung zwischen biologischen Faktoren, die hauptsächlich defizitorientiert sind, und gesellschaftlich-kulturellen Faktoren. Eine derartige Trennung wird heute aufgrund der fehlenden Betrachtung der biologischen Aspekte des Körpers kritisiert (vgl. Köbsell 2012: 40).
Dennoch brachte diese Trennung auch positive Resultate, indem sie dabei half, einen Perspektivwechsel bei den Betroffenen auszulösen. Nun deuteten die Menschen mit Beeinträchtigung ihre ,Behinderung' nicht mehr als ein von Natur aus gegebenes individuelles Problem, sondern sahen sie aus dem soziologischen Blickwinkel (vgl. ebd.). Auf der Basis dieses sozialen Modells entwickelten sich die Disability Studies, als ein interdisziplinärer Ansatz. Waldschmidt erläutert, wie die Disability Studies die ,Behinderung' deuten:
“Behinderung wird nicht als (natur-) gegeben verstanden, im Sinne einer vermeintlich objektiven, medizinischen-biologisch definierbaren Schädigung oder Beeinträchtigung, sondern als ein historisches, kulturelles und gesellschaftliches Differenzierungsmerkmal. “ (Waldschmidt 2007a: 163)
,Behinderung' gilt also nicht länger als ein von Natur aus gegebenes Schicksal, sondern wird erst durch den alltäglichen und wissenschaftlichen Diskurs, der bürokratischen Verfahren sowie durch die subjektiven Gesichtspunkte konstituiert (vgl. ebd.). Der interdisziplinäre Ansatz der Disability Studies integriert unterschiedliche Modelle und Ansichten, sodass zu fragen ist, was genau nun die Disability Studies sind. Zu diesem Zweck formulierte Hermes Grundsätze, um die Disability Studies zusammenzufassen und verständlicher zu machen:
Zu diesen Grundsätzen zählt das Verständnis der ,Behinderung' auf Basis des sozialen Ansatzes, der Beeinträchtigungen eher als ,sozial verliehenen Status' deuten und nicht mehr als eine individuelle, in Stein gemeißelte Eigenschaft (Hermes 2006: 21, in Anlehnung an Gill 1998, Übersetzung G.H.). Zudem deuten die Disability Studies nicht das Individuum als ihren Gegenstand, sondern das ,Phänomen der Behinderung' und also die Erforschung von Beeinträchtigungen (ebd., in Anlehnung an Waldschmidt 2004).
Hermes betont, dass sich die Disability Studies als parteilich verstehen und auch so gesehen werden möchten, besonders, weil sie die Menschen mit Beeinträchtigung als eine Minderheit verstehen, jedoch weniger mit der Absicht der Behebung oder Vermeidung einer Beeinträchtigung. Stattdessen untersuchen Disability Studies die sozialen Bedingungen, die dazu beitragen, dass die Betroffenen diskriminiert und stigmatisiert werden. Sie zielen auf Veränderung sozialer, kultureller und politischer Handlungsweisen, welche Menschen mit Beeinträchtigung ausgrenzen (Hermes 2006: 22, in Anlehnung an Gill 1998, Übersetzung G.H.).
Gleichzeitig betrachten sich die Disability Studies als ,behinderungsübergreifend' und damit nicht auf eine spezifische Beeinträchtigungsart begrenzt, wie zum Beispiel körperliche Beeinträchtigungen, sondern erforschen alle Formen der Beeinträchtigung (vgl. ebd.). Dadurch sind die Disability Studies interdisziplinär ausgerichtet. Die Konstruktion der Beeinträchtigung wird nicht nur aus einem einzelnen Fachgebiet, sondern aus mehreren Perspektiven betrachtet. Zu den Fachrichtungen zählen die Soziologie, Geschichts-, Literatur- und Kulturwissenschaften (ebd., in Anlehnung an Degener 2003). Zudem analysieren die Disability Studies nicht nur den Prozess der Diskriminierung von Menschen mit Beeinträchtigung, sondern sie bemühen sich durch den Forschungsprozess, die ganze Gruppe der Betroffenen in den Fokus zu stellen. Durch solche Vorhaben binden sie die Menschen mit Beeinträchtigung in ihren Forschungsprozess aktiv ein, sodass diese nicht mehr Objekte, sondern Subjekte der Forschung werden (ebd.: 23, in Anlehnung an Gill 1998, Übersetzung G.H.).
Waldschmidt wendet gegen das soziale und das medizinische Modell ein, dass sie ihren Fokus darin vereinen, die ,Behinderung' als ein Problem zu sehen, das beseitigt werden muss, statt sie als kulturellen Zuschreibungsprozess zu verstehen. Sie plädiert dafür, ein kulturelles Modell in die Betrachtung zu integrieren (ebd.: 24, in Anlehnung an Waldschmidt 2004).
Ein ,kulturelles Modell' im strengen Sinn wurde bisher noch nicht etabliert, jedoch haben in den letzten Jahren einige kulturwissenschaftliche Beiträge darauf aufmerksam gemacht. Unter diesem Aspekt wird das kulturelle Netz verstanden, welches sich beispielsweise aus der Moral, dem Brauchtum, dem Glauben, dem Wissen sowie den Normen und Werte der Gesellschaft zusammensetzt (vgl. Waldschmidt 2006: 90f.).
Die kulturwissenschaftliche Betrachtung der ,Behinderung' zeigt, dass sie sich im Kontext zum historischen und kulturanthropologischen Vergleich in ihrer Bedeutung immer wieder verändert hat. Im Lauf der Geschichte sind viele unterschiedliche Sichtweisen und Umgangsformen gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung entstanden, die je nach Epoche stärker oder schwächer ausfielen (vgl. ebd.).
Vor allem veränderte der kulturwissenschaftliche Ansatz die Sichtweise der Forschenden. Indem nicht mehr die Lebenswelt von Menschen mit Beeinträchtigung aus der Sicht der ,Normalen‘ betrachtet wurde, sondern eher die Mehrheitsgesellschaft aus der Sicht der Betroffenen, ließen sich neue Perspektiven und Ansätze entwickeln. Damit lässt sich die Welt vollkommen anders auffassen. So können etwa gesellschaftliche Praktiken der Ein- und Ausschließung sowie der ,Normalität‘ und Abweichungen analysiert werden (vgl. Waldschmidt 2006: 92f.).
Dadurch verdeutlicht Waldschmidt neue Schritte, wie eine Beeinträchtigung bzw. Nicht-Beeinträchtigung zu verstehen ist, indem sie die ,Normalität‘ fokussiert und infrage stellt. Gleichzeitig betont das kulturelle Modell, dass die Gesellschaft Menschen mit Beeinträchtigung nicht als zu integrierende Minderheit ansehen sollte, sondern als bereits bestehenden wichtigen Bestandteil der Gesellschaft. Unter diesem Blickwinkel kritisiert Waldschmidt die integrative Anpassung von Minderheiten zu homogenen Gruppen (vgl. ebd.).
Im Hinblick auf die verschiedenen von den Disability Studies genutzten Modelle wird auch international diskutiert, welche Ansätze und Betrachtungsweisen wirklich integral zu den Disability Studies gehören und welche nicht (vgl. Hermes 2006: 21).
3. Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung
Vorurteile, Stereotype und soziale Diskriminierung begleiten die Menschen in ihrem alltäglichen Leben. Sie finden jeden Tag unmittelbar im sozialen Umfeld statt oder werden den Menschen über Medien, wie zum Beispiel Nachrichten, Filme oder SocialMedia-Seiten vermittelt. Diese Omnipräsenz von Stereotypen und Vorurteilen erschwert ihre Vermeidung, zumal sie unter solchen Voraussetzungen bereits in der Kindheit im Gedächtnis gefestigt werden. Zwar sind die Begriffe „Vorurteil“ und „Stereotyp“ im allgemeinen Sprachgebrauch meist negativ konnotiert. Dennoch haben sie auch eine positive Funktion. Denn sie beeinflusse entscheidend die soziale Interaktion zwischen Menschen (vgl. Petersen/Six 2008: 17).
3.1 Soziale Kategorisierung und Stereotypisierung
Soziale Kategorisierungen, um eine Menschenmenge zu beschreiben, die aufgrund ihrer sozialen Interaktion häufig als eine Gruppe gelten, sind das Fundament für Stereotypisierungen. Derartige Merkmale können zum Beispiel die Hautfarbe oder das Geschlecht sein. Anderseits können auch gemeinsame Interessen wie die Zugehörigkeit zu einer Religion oder eine Partei dazu beitragen, dass Menschen kategorisiert werden (vgl. Klauer 2008: 23).
In einer solchen Betrachtung finden sich Menschen schnell in der ein oder anderen Gruppe wieder. Folglich können sich Menschen sehr schnell in Eigengruppen zuordnen und Fremdgruppen daneben differenzieren. Da sich sämtliche Kategorien auch in Subkategorien unterteilen lassen, kann die Schwierigkeit entstehen, dass es Individuen unmöglich wird, überhaupt einer sozialen Kategorie anzugehören. Zudem hat jede soziale Kategorie auch eigene spezifische Regeln, und jede Gruppe stellt bestimmte interne und externe Erwartungen an ihre Angehörigen, wie zum Beispiel, dass sich Menschen der gleichen Ideologie anschließen oder, dass von außen erwartet wird, das Homosexuelle eine feminine Ader haben (vgl. Werth/Mayer 2008: 403).
Besonders der letzte Punkt verdeutlicht die typische Darstellung eines Stereotyps, das durch Prozesse der Informationsverarbeitung ausgelöst wird. Informationsverarbeitung kann automatisch oder kontrolliert erfolgen, allerdings sind die meisten Stereotype automatisch aus kulturell geprägtem Wissen entstanden, sodass die Menschen bewusst oder unbewusst bestimmte positive oder negative Eigenschaften auf die Personen projizieren oder Erwartungen an sie stellen, die soziales Erleben und eigenes Verhalten beeinflussen (vgl. Schmid Mast/Krings 2008: 33f.). Diese Einteilung, umgangssprachlich als ,Schubladendenken‘ bezeichnet, gehört zur sozialen Interaktion und verschafft Menschen Orientierung (vgl. Klauer 2008: 23).
Doch weshalb kategorisieren Menschen einander? Kognitive Ursachen für die Kategorisierung ist die zunehmende Komplexität der Umwelt. Die Welt entwickelt sich immer schneller, so wachsen die Anforderungen an die einzelnen Menschen, sie zu verstehen. Wenn Individuen bestimmte Fähigkeiten fehlen, können sie diesen Anforderungen nicht vollkommen gerecht werden (vgl. Werth/Mayer 2008: 403). Dann hilft ihnen die Kategorisierung, die Informationen einfacher zu verarbeiten. So können Menschen in Gruppen eingeteilt werden, um das Verhalten der Angehörigen dieser Gruppen vorherzusagen, ohne eine einzelne Person zu kennen. Derartige Prozesse sind täglich beobachtbar, wenn Menschen eineinander begegnen. Ein Kategorisierungsprozess wird bei vielen ausgelöst, und sie teilen andere Menschen nach Hautfarbe, Alter oder ethnischer Zugehörigkeit ein (ebd.: 403f., in Anlehnung an Bargh 1994; Brewer 1988; Fiske/Neuberg 1990; Hamilton/Sherman 1994).
Die Motivation der Kategorisierung entsteht auch aus dem Zugehörigkeitsgefühl zur Eigengruppe und der damit verbundenen Steigerung der eigenen Identität. Abgesehen von der Tendenz der eigenen Gruppe zugehörig zu sein oder dieser Gruppe bei der Gefährdung der eigenen Identität fernzubleiben, hat der Mensch immer die Neigung, die eigene Gruppe besser darzustellen (vgl. Werth/Mayer 2008: 405).
Soziale Kategorisierung und persönliche Vorurteile generieren zwei relevante Effekte: die Vereinheitlichung der Fremdgruppen, auch ,Fremdgruppenhomogenitätseffekt‘ genannt. Das ist die Tendenz, Angehörige von Fremdgruppen homogener zu betrachten und die Individuen der eigenen Gruppen differenzierter. Zudem wird die Eigengruppe bevorzugt bzw. aufgewertet, damit kommt es zur sogenannten ,Eigengruppenaufwertung‘. Beide Effekte tragen zur Entstehung und Akzentuierung von Vorurteilen und Diskriminierung bei (ebd.: 406, in Anlehnung an
Brigham/Malpass 1985; Jones et al. 1981; Park/Rothbart 1982; Wilder 1984).
3.2 Ursache und Formen von Vorurteilen
Alle Menschen haben Vorurteile, im Alltag zuweilen umgangssprachlich als ,Klischees‘ verharmlost, etwa das hartnäckige Vorurteil, Frauen könnten nicht einparken. Auch wenn alle Menschen wissen, dass dies nicht der Wahrheit entspricht, können sie nur schwer von diesem Denken ablassen. Als Vorurteil gilt „eine Einstellung gegenüber Angehörigen einer Fremdgruppe, die allein auf deren Gruppenzugehörigkeit beruht “ (Werth/Mayer 2008: 379).
Werth und Mayer nennen drei wesentliche Komponenten von Vorurteilen:
- Das Stereotyp als kognitive Komponente
Wie bereits im Unterkapitel 3.1 beschrieben, erfolgt bei der Stereotypisierung eine kognitive Entwicklung der Kategorisierung von Gruppen und somit eine Zuschreibung von Eigenschaften und Merkmalen. Es werden die individuellen Eigenschaften der einzelnen Angehörigen der Gruppen überhaupt nicht betrachtet, sondern es werden identische charakterliche Eigenschaften auf die gesamte Gruppe projiziert (vgl. Werth/Mayer 2008: 379).
Cloerkes ergänzt, dass sich dies besonders deutlich in den Überzeugungen, den Wertvorstellungen und dem Urteil einer Person zeigt, die einen vorurteilsbehafteten Menschen oder eine Gruppe betrachtet (vgl. Cloerkes 2007: 104). Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass ein Vorurteil zwar ein Stereotyp als Fundament benötigt, jedoch ein Stereotyp selbst noch kein Vorurteil ist (vgl. Werth/Mayer 2008: 379).
- Die Stereotypakzeptierung als affektive Komponente
Die Stereotypakzeptierung wird auch als ,Gefühlskomponente‘ bezeichnet und umfasst die Intensität der Emotionen, die mit einer Einstellung verknüpft sind. Subjektive Einstellungen können durch positive und negative Gefühle beeinflusst werden (vgl. Cloerkes 2007: 104). Deshalb ist das Akzeptieren eines Stereotyps eine notwendige Voraussetzung dafür, dass sich ein Vorurteil wirklich entwickeln kann (vgl. Werth/Mayer 2008: 379).
- Diskriminierung als Handlungskomponente
Als letzte Komponente dient die konative oder auch als Handlungskomponente bezeichnete Diskriminierung, welche die Intention oder die Bereitschaft bezeichnet, sich gegenüber einer Gruppe oder einem Menschen diffamierend zu verhalten (vgl. Cloerkes 2007: 104). Das bloße Denken, also das Vorurteil, wird nun zu einer ungerechtfertigten negativen oder gar destruktiven Handlung gegenüber Personen wegen deren Zugehörigkeit zu einer Gruppe (vgl. Werth/Mayer 2008: 380).
Vorurteile entstehen, weil Menschen durch soziale Kategorisierungen Gruppen bilden. Dies vereinfacht die Informationsweitergabe und unterstützt die Entwicklung der sozialen Identität, allerdings führt es auch zu Wettbewerb zwischen der eigenen Gruppe und den Fremdgruppen (vgl. ebd.: 403).
Vorurteile sind nicht ausschließlich negativ, denn sie haben auch nützliche Eigenschaften: Menschen können bei einer größeren Gruppe von ähnlichen Tatsachen ausgehen. Dies erleichtert den Umgang mit eigentlich Fremden, sodass Situationen keine Analyse verlangen, sondern sich die Person auf ein Vorurteil verlassen kann, was eine Chance bedeutet, Kapazitäten zu sparen und unter Zeitdruck evtl. ein signifikanter Unterschied ist. So erleichtern Vorurteile Informationsverarbeitung, Entscheidungsfindung und Orientierung im Alltag (Werth/Mayer 2008: 378, in Anlehnung an Bodenhausen/Lichtenstein 1987; Stangor/Duan 1991).
Derartige positive Merkmale verblassen jedoch gegenüber den extremen Folgen von negativen Vorurteilen. Oft führen die negativen Eigenschaften zur Diskriminierung von Minderheiten oder, wie die Geschichte zeigt, zu Verfolgung, Mord oder sogar Völkermord, etwa die Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus oder die Hexenprozesse in der frühen Neuzeit (vgl. Werth/Mayer 2008: 378).
Warum können sich Vorurteile über mehrere Generationen halten? Sie sind auch deshalb so hartnäckig, weil die Faktoren ihrer Entstehung dazu beitragen, dass sie immer wiederkehren. Als weitere Ursachen sind Zusammenhänge zu nennen, die gar nicht der Realität entsprechen und nur den Erwartungen entspringen (illusorische Korrelation) und ihre Legitimierung gegenüber anderen im Versuch, Verhalten der eigenen Gruppe oder einer Fremdgruppe zu erklären oder auf die Gegenwart zu beziehen (attributionale Verzerrungen) (vgl. ebd.: 419).
Wenn ein Mensch nicht dem herrschenden Vorurteil entspricht, das auf einem Stereotyp aufbaut, sorgt der Prozess der Rekategorisierung (subtyping) oft dafür, dass die Menschen das Vorurteil nicht aufheben, sondern die Person einer neuen Kategorie zuordnen. Dank derartiger Rekategorisierungen erhalten Menschen bestehende Vorurteile aufrecht oder festigen sie gar. Dann können abweichende Vorurteile bestätigt werden, obwohl sie der eigentlichen Erfahrung widersprechen (ebd.: 422, in Anlehnung an Kunda/Oleson 1995; Richards/Hewstone 2001).
Zur Bestätigung der Vorurteile tragen darüber hinaus zwei weitere Faktoren bei: Zum einen kann sich das Opfer unbewusst oder bewusst den Erwartungen entsprechend verhalten und so die Vorurteile bestärken (self-fulfilling prophecy) oder das aus Angst machen, einem Stereotyp zu entsprechen (stereotype threat), was genau zum erwarteten Verhalten führt. Als Beispiel lässt sich eine Prüfungssituation nennen, in der die Person wegen des vorherrschenden Stereotyps, dass die Person nicht gut in Mathematik sei, tatsächlich schlechter abschneidet, weil sie sich selbst unter Stress gesetzt hat (vgl. Werth/Mayer 2008: 419f.).
Angesichts der negativen Auswirkungen und der Beständigkeit von Vorurteilen hat sich die Wissenschaft in den letzten Jahren intensiv mit ihnen beschäftigt (vgl. Werth/Mayer 2008: 378f.). Die Untersuchungen ergaben, dass Vorurteile in unterschiedlichen Formen auftreten. Am weitesten verbreitet sind rassistische und sexistische sowie das Alter und äußerliche Merkmale betreffende Vorurteile. Vor allem Minderheiten mit äußerlichen Auffälligkeiten sind Vorurteilen stärker ausgesetzt als andere Bevölkerungsschichten, da sie ,greifbarer‘ für ein Vorurteil zur Verfügung stehen (ebd.: 381, in Anlehnung an Allport 1954).
3.3 Soziale Diskriminierung
Soziale Diskriminierung, eben als Verhaltenskomponente skizziert, definiert Gordon W. Allport wie folgt:
„Diskriminierung liegt vor, wenn einzelnen oder Gruppen von Menschen die Gleichheit der Behandlung vorenthalten wird, die sie wünschen. Diskriminierung umfaßt alles Verhalten, das auf Unterschieden sozialer oder natürlicher Art beruht, die keine Beziehung zu individuellen Fähigkeiten oder Verdiensten haben noch zu dem wirklichen Verhalten der individuellen Person. “
(Allport 1954, zit. n. Petersen/Six 2008: 161)
Diese Beschreibung zeigt, dass Diskriminierung auf sozialen Kategorien aufbaut, neben den Vorurteilen, die als Gefühlskomponente eine Rolle spielen. Diskriminierung als Verhaltenskomponente verursacht negative Handlungen gegenüber anderen, etwa, dass jemand einen Homosexuellen meidet, ihn beschimpft oder ihm vorwirft, er wäre ihm oder ihr sexuell zu nahe getreten. Nach Ansicht von Petersen und Six berücksichtigen neue Ansätze auch die Bevorzugung der Eigengruppe und die Ablehnung der Fremdgruppen, während andere Ansätze Diskriminierung nur als nonkonformes Verhalten gegenüber Normen und Werte deuten (vgl. Petersen/Six 2008: 161).
Auch wenn soziale Diskriminierung eigentlich dem Wertesystem widerspricht, das auf Chancengleichheit, sozialer Fairness und Solidarität aufbaut, besteht in der deutschen Bevölkerung im normalen Alltag kaum ein Bewusstsein darüber, dass Diskriminierung ein tatsächliches Problem ist (Hormel/Scherr 2010: 7f., in Anlehnung an Sinus Sociovision 2008: 5).
Wissenschaftliche Untersuchungen der Ursachen von sozialer Diskriminierung haben viele theoretische Ansätze und Richtlinien hervorgebracht (vgl. Petersen/Six 2008: 161). Ein Unterscheidungsmerkmal, das eine Diskriminierung verdeutlicht, ist meist die bloße Verschiedenheit der Menschen. Dies kann der Klang der Stimme sein, der Kleidungsstil oder die Haarfarbe (Weisser 2010: 308, in Anlehnung an Kreckel 2004: 15).
Obwohl es viele Unterscheidungsmerkmale gibt, gewinnen nicht alle im sozialen Kontext an Bedeutung, sondern meistens schaffen es nur Merkmale, die eine Chance bieten, etwas realistisch umzusetzen (Weisser 2010: 308, in Anlehnung an Kreckel 2004: 15).
Bedauerlicherweise untersuchen nur wenige Studien die Unterformen der sozialen Diskriminierung. Feagin und Eckberg haben im Jahr 1980 begonnen, die Unterformen zu erforschen und haben drei Ebenen unterschieden: ,isolierte Diskriminierung^ Diskriminierung durch Gruppen‘ und ,institutionelle Diskriminierung‘ (Petersen/Six 2008: 161).
Als isolierte Diskriminierung gelten herablassende und negative Verhaltensmuster Einzelner gegenüber anderen Einzelnen. Ursächlich hierfür kann die Beteiligung in einer Fremdgruppe oder in einer sozialen Kategorie sein. Als Beispiel kann die Ablehnung einer Bewerbung durch den Personalchef dienen, weil es sich um eine Frau handelt. Gleichermaßen ist es ein wichtiger Aspekt, dass keine institutionelle Seite daran beteiligt ist. Unter ähnlichen Voraussetzungen kommt es zur Diskriminierung in Gruppen. Im Wesentlichen unterscheidet sich hier nur die Anzahl der Beteiligten. Als institutionelle Diskriminierung gilt Verhalten von Institutionen oder Organisationen, das Benachteiligung verstärkt und aufrechterhält (vgl. ebd.).
[...]
- Arbeit zitieren
- Stefan Schmitz (Autor:in), 2017, Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit Beeinträchtigung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373971
Kostenlos Autor werden



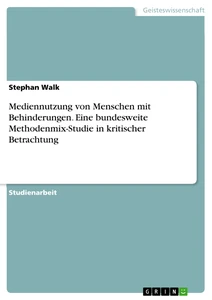











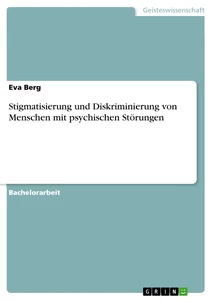






Kommentare