Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretischer Rahmen
2.1. Modernisierungstheorie nach Lipset
2.1.1. Argumentationsstruktur
2.1.2. Kritik
2.2. Akteurstheorie von O’Donnell, Schmitter und Whitehead
2.2.1. Liberalisierung, Demokratisierung und Konsolidierung
2.2.2. Krise eines autoritären Systems
2.2.3. Kritik an der empirisch-deskriptiven Akteurstheorie
2.3. Das Dilemma der Gleichzeitigkeit
2.3.1. Probleme der National- und Staatenbildung
2.3.2. Probleme der Demokratisierung
2.3.3. Probleme beim Umbau der Wirtschaft
2.3.4. Kritik
3. Analyse Weißrusslands
3.1. Modernisierungstheorie am Beispiel Weißrusslands
3.2. Akteurstheorie am Beispiel Weißrusslands
3.2.1. Liberalisierungsphase
3.2.2. Demokratisierungsphase
3.2.3. Konsolidierungsphase
4. Analyse Ungarns
4.1. Modernisierungstheorie am Beispiel Ungarns
4.2. Akteurstheorie am Beispiel Ungarns
4.2.1. Liberalisierungsphase
4.2.2. Demokratisierungsphase
4.2.3. Konsolidierungsphase
5. Dilemma der Gleichzeitigkeit – Analyse Weißrussland und Ungarn
6. Vergleich der Ergebnisse
7. Fazit
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabellenverzeichnis:
1 Klassifikation von stabilen und instabilen Demokratien
2 Indices of Wealth
3 Pro-Kopf Einkommen Weißrusslands in US-Dollar
4 Indices of Industrialization
5 Indices of Education
6 Indices of Urbanization
7 Indices of Wealth
8 Pro-Kopf Einkommen Ungarns in US-Dollar
9 Indices of Industrialization
10 Indices of Education
11 Indices of Urbanization
1. Einleitung
Die Erosion und der darauffolgende Zusammenbruch des Sowjet-Imperiums Ende der 1980er Jahre stellte die Erforschung von demokratischen Übergängen bzw. die Erforschung von Systemwechseln vor neue Herausforderungen. Stand die Forschung bis dato vor allem im Zeichen von Struktur- und Modernisierungstheorie, zu nennen sind hier Parsons (1951; 1969), Lipset (1959), Barrington Moore (1966) und Huntington (1965, 1968), so gewannen Ende der 1980er Jahre auch Akteurstheorien zunehmend an Bedeutung. Vor allem die Arbeiten von O’Donnell und Schmitter (1986), nochmals Schmitter (1992) und auch die Arbeiten von Przeworski (1986; 1991; 1992) setzen hier bis heute geltende theoretische Standards in der empirischen Transformationsforschung[1]. Blickt man auf die vorherrschenden politischen Theorien zu Transformationsprozessen, kommt man nicht umhin festzustellen, dass die großen Paradigmen der politologischen Theoriebildung System und Handeln sind. Doch erst in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren kam es zu einer „gleichgewichtigeren Koexistenz beider Paradigmen“ (Merkel 1996: 303). Dies führte dazu, dass vermehrt Analysen erschienen, „die von einer ausgewogeneren Berücksichtigung funktionalistischer, strukturalistischer und handlungstheoretischer Überlegungen geprägt waren“ (Merkel 1996: 303). Während bis dahin beide Lager für sich beanspruchten, den „Königsweg“ gefunden zu haben, wurde vielen Wissenschaftlern gewahr, dass diese beiden Paradigmen im Einzelnen nicht für eine umfassende Transformationsanalyse genügen, sondern durch andere theoretische Konzepte ergänzt werden müssen, die eventuelle blinde Flecken abdecken (Merkel 2010: 87). Beispiele, in denen funktionalistische, strukturalistische, kulturalistische und handlungsorientierte Ansätze miteinander zu einem Theorem verbunden werden, lassen sich bei Jon Elster (1990) und Claus Offe (1991; 1994) finden, die mit ihrem Konzept des „Dilemmas der Gleichzeitigkeit“ den bis dahin üblichen Theorien den Rücken zukehrten und so versuchten die Transformationen der post-kommunistischen Staaten zu erklären (Merkel 2010: 67).
Das Besondere an diesen Transformationen war, dass nicht nur ein einzelnes Regime fiel, sondern gleich ein ganzes Gesellschaftssystem. Diese Welle von Systemwechseln der kommunistischen Regime in Osteuropa unterschieden sich dabei in vielerlei Hinsicht von denen, der ersten und zweiten Demokratisierungswelle, die Anfang der 1960er endeten. Doch es gibt nicht wenige, die die Transformationsprozesse in den post-kommunistischen Staaten als ein eigenständiges Ereignis begreifen, welches sich aufgrund seiner einzigartigen Dynamik zudem auch von der dritten Demokratisierungswelle, die gemeinhin auch die Transformationen in Osteuropa umfasst, unterscheidet. Diese These wird von Michael McFaul aufgegriffen und so lautet der Titel eines Artikels folgerichtig: „The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative Transitions in the Postcommunist World“ (McFaul 2002). Der Titel impliziert zum einen, dass die Regimewechsel der postkommunistischen Länder sich systematisch von denen der dritten Welle unterscheiden, da er von einer vierten Welle spricht, und zeigt auch, dass sich von 28 postkommunistischen Staaten nur acht zu liberaldemokratischen Regimen entwickelt haben. Merkel stellt hierzu fest, dass „der prinzipielle Unterschied zwischen den osteuropäischen und allen anderen Systemwechseln […] in dem ‚Problem‘, oder schärfer formuliert, dem ‚Dilemma der Gleichzeitigkeit‘“ (Merkel 2010:324) liege. Mit diesem Dilemma haben die beiden Transformationsforscher Jon Elster (1990) und Claus Offe (1991, 1994) den Umstand beschrieben, dass nicht nur das politische System eine Transformation erfuhr, sondern auch das wirtschaftliche und gesellschaftliche System. Die Gleichzeitigkeit auf der einen und die enorme Geschwindigkeit der Veränderungen auf der anderen Seite, führten dazu, dass die Demokratisierung dieser Länder mit erheblichen Problemen zu kämpfen hatte.
In Hinblick auf diese Problematik stellt sich die Frage, ob die klassischen Theorien bei der Beschreibung dieser Transformationen versagen oder ob sie trotz der schwierigen Umstände ihre Erklärungskraft behalten. Um dieser Frage nachzugehen, sollen in dieser Masterarbeit exemplarisch die Modernisierungstheorie von Lipset (1959/1994) und die Akteurstheorie von O’Donnell und Schmitter (1986) gegenübergestellt und anhand von Ungarn und Weißrussland miteinander verglichen werden. Bei der Bewertung der Erklärungskraft der beiden Theorien soll zudem das Dilemma der Gleichzeitigkeit mit betrachtet werden, stellt es doch einen Gegenentwurf zu den monokausalen Theorien dar. Hierbei sollen, mit Blick auf den Umfang der Masterarbeit, die Probleme bei der National- bzw. Staatsbildung, die Probleme der Demokratisierung und die Probleme des Wirtschaftsumbaus, die maßgeblich die Demokratisierung in den postkommunistischen Ländern behinderten, im Fokus stehen.
Der Untersuchungszeitraum für die Analyse in dieser Arbeit wird von 1985 bis 1995 festgelegt. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sind vor allem politische Entwicklungen und Ereignisse, die großen Einfluss auf die Transformationsprozesse der beiden Länder hatten. So steht der 11. März 1985 für die Einleitung einer neuen Epoche in der Sowjetunion, nachdem mit dem 54-jährigen Gorbatschow erstmals ein relativ junges Mitglied des Politbüros Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wurde. Das von ihm begonnene Reformprogramm führte ungewollt dazu, dass die ehemaligen Satellitenstaaten sich vom Einfluss der Sowjetunion lösten und diese 1991 auseinanderbrach, was die Neugründung einer Vielzahl von Staaten, wie z.B. Weißrussland, zur Folge hatte. Die im Anschluss stattfindende Phase der Transformation, sei es nun hin zu einer Demokratie wie im ungarischen oder hin zu einer Autokratie wie im weißrussischen Fall, dauerte bis in die späten 1990er Jahre und beide Systeme können ab 1995 als gefestigt angesehen werden.
Diese Masterarbeit gliedert sich in sieben Unterpunkte. Nach der Einleitung, erfolgt in Kapitel 2 eine ausführliche Beschreibung der Theorien. Hierbei werden sowohl Modernisierungs- als auch Akteurstheorie vorgestellt und mögliche Schwächen ausgelotet. Hinzu kommen noch die Beschreibung des Theorems des Dilemmas der Gleichzeitigkeit und seine Bedeutung für diese Arbeit. Im Anschluss werden die Theorien praktisch auf beide Fallbeispiele angewandt und auf ihre Erklärungskraft hin überprüft werden. In Kapitel 6 erfolgt dann ein Vergleich der Ergebnisse und in Kapitel 7 erfolgt das abschließende Fazit.
2. Theoretischer Rahmen
Seit Ende der 1950er Jahre rückten Probleme des sozialen Wandels durch die Modernisierungsansätze in den Fokus wissenschaftlicher Betrachtung. Vor allem die Modernisierungstheorie von Lipset behielt bis heute ihre Gültigkeit. Dabei beschreibt dieser Ansatz vor allem „eine Vielzahl von sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungsprozessen zu einer Moderne hin, aber auch innerhalb bereits existierender moderner Ordnungen“ (Kollmorgen 2015: 15). Die Moderne ist hierbei ein Produkt westlicher Entwicklung und birgt dabei auch immer einen sozialen Fortschritt. „Modernisierung bedeutet Zunahme der individuellen Freiheit, der individuellen Rechtsgarantien, der demokratischen Mitbestimmung und der ökonomischen Wohlfahrt“ (Kollmorgen 2015: 15). Doch Eurozentrismus, der strikte Fortschrittsglaube und vor allem die Nichtbeachtung von Akteurshandeln führte zu einer kritischen Auseinandersetzung mit diesem Ansatz. In Folge dessen entwickelten sich im Zuge des Paradigmenwechsels in den 1970er Jahren politikwissenschaftliche Ansätze, die vor allem das Akteurshandeln betonten.
„Nicht langfristige sozioökonomische Umwälzungsprozesse determinierten nun die Richtung und Ergebnis der Transformation zu Sozialismus (Marxismus) oder Demokratie (Modernisierungstheorie), sondern das Handeln konkreter Akteure beeinflusst den durchaus kontingenten Ausgang politischer Transition zu Demokratie oder Diktatur“ (Kollmorgen 2015: 15).
Die Grundannahmen beider theoretischer Konzepte sollen in den folgenden Kapiteln dargestellt werden. Zudem wird im Anschluss das Theorem des „Dilemmas der Gleichzeitigkeit“ dargestellt, das explizit aus den Transformationen der post-sowjetischen Staaten hervorgegangen ist.
2.1. Modernisierungstheorie nach Lipset
Aufbauend auf einer Überlegung von Talcott Parsons entwickelte Seymour Martin Lipset 1959 den Klassiker der Modernisierungstheorie, deren grundlegende These folgende ist: „[T]he more well-to-do a nation, the greater the chances that it will sustain democracy” (Lipset 1959: 75). Lipset geht dabei davon aus, dass nur in einer wohlhabenden Gesellschaft, in der nur sehr wenige in echter Armut leben, die Möglichkeit besteht, dass das Gros der Bevölkerung intelligent an der Politik partizipieren kann und die notwendige Selbstbeherrschung entwickelt, um Appellen von Demagogen zu widerstehen (Lipset 1959: 75). Seine These beruht dabei auf der Auswertung von verschiedenen Indizes ökonomischer Entwicklung:
„As a means of concretely testing this hypothesis, various indices of economic development – wealth, industrialization, urbanization and education – have been defined, and averages (means) have been computed for the countries which have been classified as more or less democratic in the Anglo-Saxon world and Europe and Latin America” (Lipset 1959: 75).
Lipsets Hypothese wird durch seine Ergebnisse bestätigt, da die Werte der Indikatoren für Wohlstand, Industrialisierung, Urbanisierung und Bildung bei demokratischen Ländern weit höher ausfallen als bei nicht-demokratischen. Um die europäischen und englischsprachigen Staaten mit lateinamerikanischen Ländern vergleichen zu können, untereilt er diese in zwei Gruppen, in denen er dann nochmal zwischen mehr und weniger demokratischen Systemen unterscheidet (Lipset 1959: 73f.). Wichtig hierbei ist, dass er die Werte nur für die jeweils einzelnen Ländergruppen miteinander vergleicht. Die Argumentationsstruktur Lipsets ist weniger strukturiert und entwickelt sich im Laufe der Artikel eher episodisch. Um diese dennoch greifbar zu machen, erfolgt im folgenden Kapitel eine strukturiertere Wiedergabe.
2.1.1. Argumentationsstruktur
Lipsets grundlegender Kausalzusammenhang ist auf der Makroebene gesellschaftlicher Entwicklung angesiedelt. Er geht davon aus, dass (sozio-)ökonomische Entwicklung Demokratie begünstigt. Dieser recht simplen Annahme liegen jedoch eine Vielzahl von Wirkungszusammenhängen zugrunde, die dazu führen, dass sich die „form of the ‚class struggle‘‘ (Lipset 1959:83) verändert. Hierbei betrachtet er sowohl Transformationen hin zu einer Demokratie als auch die Beibehaltung einer bereits existierenden Demokratie als Folge von Modernisierung.[2] Der Zusammenhang zwischen (sozio-)ökonomischer Entwicklung und Demokratie spaltet sich allerdings in mehrere Bestandteile auf, die von Lipset selbst als „economic development“ (Lipset 1959: 75) bezeichnet werden. Dieses beinhaltet neben wachsendem Wohlstand, eine zunehmende Industrialisierung, Urbanisierung und ein steigendes Bildungsniveau. Diese Komponenten sind es, die im Zusammenspiel dafür sorgen, dass der Klassenkampf entschärft wird und es zu einer politischen Mäßigung kommt (Lipset 1959: 83). Im Folgenden sollen diese Bestandteile näher betrachtet werden.
Die Bildung ist für Lipset einer der entscheidenden Faktoren in Hinblick auf die Etablierung oder Stabilisierung einer Demokratie. Er geht davon aus, dass es die Bildung ist, die es Menschen aus den unteren sozialen Schichten ermöglicht, die Notwendigkeit demokratischer Normen wertzuschätzen (Lipset 1959: 79). Lipset ist der Meinung, dass Bildung nicht nur die Perspektive von Menschen erweitert, sondern sie darüber hinaus auch dazu befähigt, sich der Anziehungskraft von Extrempositionen zu widersetzen und rationale Wahlentscheidungen zu treffen (Lipset 1959:79). Je höher der Bildungsgrad ist, desto einfacher fällt es den Menschen, in demokratische Grundsätze zu vertrauen und demokratische Praktiken zu unterstützen. Bildung ist somit der Ausgangspunkt für Demokratie und hat einen höheren Einfluss als Einkommen oder Erwerbstätigkeit (Lipset 1959:79). Allerdings erfährt die Bildung, in Hinblick auf die empirischen Ergebnisse von Lipset (Lipset 1959: 78 -80), als Faktor für Demokratie insofern eine Einschränkung, als dass sie zwar als notwendige – aufgrund negativer Erfahrungen in Deutschland und Frankreich – aber keinesfalls als hinreichende Bedingung für Demokratie gelten kann (Lipset 1959: 79f.).
„If we cannot say that a ‘high’ level of education is a sufficient condition for democracy, the available evidence does suggest that it comes close to being a necessary condition in the modern world” (Lipset 1959: 80).
Ein weiterer wichtiger Faktor in Lipsets Modernisierungstheorie ist der nationale Wohlstand. Neben einigen strukturellen Veränderungen bringt dieser auch Veränderung auf der Einstellungsebene mit sich. Zum einen sorgt wachsender Wohlstand dafür, dass die ökonomische Unsicherheit, die vor allem die unteren sozialen Schichten betrifft, reduziert wird und zum anderen kann dies die Zuwendung zu extremen Positionen be- bzw. verhindern. Eine Gefahr für die Demokratie sieht Lipset darin gegeben, wenn dieser Wohlstand fehlt und die ökonomische Unsicherheit einer sofortigen Lösung bedarf. In solchen Fällen würden kurzfristige Lösungen präferiert, die häufig von extremistischen Gruppen vertreten werden (Lipset 1983: 90, 106f.). Ein weiteres wichtiges Merkmal von wachsendem Wohlstand ist, dass dieser zu einer gerechteren Einkommensverteilung führt. Damit einhergehend schwinden zunehmend die Statusunterschiede unter den sozialen Schichten, was dazu führt, dass sich eine wehrhafte Mittelklasse herausbildet, die wiederrum die Demokratie befördert und durch den wachsenden Wohlstand extremen Positionen weniger offen gegenübersteht (Lipset 1994: 2; Lipset 1983: 47-50).
„Increased wealth is not only related causally to the development of democracy by changing the social conditions of the workers, but it also affects the political role of the middle class through changing the shape of the stratification structure so that it shifts from an elongated pyramid, with a large lower-class base, to a diamond with a growing middle-class. A large middle class plays a mitigating role in moderating conflict since it is able to reward moderate and democratic parties and penalize extremist groups” (Lipset 1959: 83).
Nicht weniger wichtig ist der Effekt, den wachsender Wohlstand auf das Verhältnis der „upper class“ (Lipset 1983: 51) zu den unteren Schichten hat. Je ärmer ein Land ist und je geringer der absolute Lebensstandard der „lower classes“ (Lipset 1983: 51) sei, desto größer sei der Druck auf die oberen Klassen, die unteren Schichten als „vulgar, innately inferior, a lower caste beyond the pale of human society“ (Lipset 1983: 51) zu behandeln. Daraus resultiert eine Missachtung der politischen Rechte der unteren Schichten, vor allem aber die Missachtung des Rechts auf politische Partizipation. Somit widerstehen die oberen Klassen nicht nur selbst der Demokratie, sondern enthalten diese auch den unteren Klassen vor. Dieses Verhalten intensiviert extremistische Reaktionen auf Seiten der unteren Schichten (Lipset 1983: 51). Ökonomische Modernisierung, wie sie hier beschrieben wurde, führt zu einem Wandel der Klassen- und Sozialstruktur eines Staates. Steigt das Einkommen breiter Bevölkerungsschichten und sinkt damit einhergehend die Existenzangst, mäßigt dies den Klassenkampf und ökonomische Verteilungskonflikte. Während das Gros der Bevölkerung ein Verständnis für Politik entwickelt, ändert sich der Einstellung der Eliten gegenüber der aufstrebenden Mittelschicht, die zunehmend partizipationswürdig erscheint (Lipset 1983: 39-51).
In Hinblick auf die oberen Klassen bzw. die Eliten kommt nach Lipset noch ein Faktor in Betracht, der die Akzeptanz eines demokratischen Systems entscheidend beeinflusst:
„If there is enough wealth in the country so that it does not make too much difference whether some redistribution takes place, it is easier to accept the idea that it does not matter greatly which side is in power” (Lipset 1983: 51).
Je mehr Altnativen zum Staatsdienst demnach vorhanden sind und je weniger groß der Machtverlust der politischen Akteure ist, desto größer wird die Bereitschaft, demokratische Spielregeln zu akzeptieren. Konzentrieren sich die Quellen von Macht, Status und Wohlstand allerdings im Staat, so wird es schwierig eine Demokratie zu etablieren, da der politische Wettbewerb zu einem Nullsummenspiel wird, in dem der Besiegte alles verliert (Lipset 1994: 4). Zudem sei ein gewisses Wohlstandsniveau notwendig, um einen kompetenten öffentlichen Dienst zu gewährleisten. Je weniger ökonomische Ressourcen direkt vom Staat verwaltet werden, desto freier ist die Politik. Dies ist zudem ein Grund, wieso es in ärmeren Staaten verhältnismäßig oft Korruption und Nepotismus herrschen (Lipset 1983: 52; Lipset 1994: 3).
Neben den bereits genannten Effekten ist der nationale Wohlstand auch deshalb förderlich für die Demokratie, da er die Bildung vom Staat unabhängiger Organisationen befördert. Lipset geht hier, der Meinung von Tocqueville[3] folgend, davon aus, dass Bürger, die mehr Ressourcen zur Verfügung haben eher dazu bereit sind, diese für die Bildung von unabhängigen Organisationen zu verwenden, die dann wiederum die politische Partizipation der Bürger steigern, demokratische Werte stärken und den Staat und anderen dominierende Kräfte daran hindern, politische Ressourcen zu monopolisieren und bürgerliche Rechte einzuschränken (Lipset 1994: 2; Lipset 1983: 52; Merkel 2010: 72).
In seinen Ausführungen (Lipset 1983: 100-117) zeigt Lipset im Detail auf, welche Auswirkungen Bildung und Wohlstand auf die soziale Situation der unteren Klassen hat. Fehlen diese beiden Faktoren, so führt dies zum Ausschluss von den Aktivitäten, Kontroversen und Organisationen demokratischer Gesellschaften (Lipset 1983:104). Lipset kommt zu dem Schluss, dass wenig Bildung, ein Mangel an Informationen, niedriger ökonomischer Status und die draus resultierende ökonomische Unsicherheit, in Tateinheit mit isolierten Berufen sowie dem Leben in abgeschiedenen Gebieten die politische Partizipation und das Engagement in Organisationen be- bzw. verhindern und, dass somit Angehörige dieser Schicht keine Chance haben, komplexerer Sichtweisen auf politische Strukturen zu erwerben und demokratische Normen zu verstehen (Lipset 1983: 100-104). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Angehörige der unteren Schichten sich durch ein steigendes Wohlstands- und Bildungsniveau in Verbindung mit Urbanisierung und Industrialisierung aus dieser sozialen Isolation befreien können und vermehrt „cross-pressures“ (Lipset 1983: 50) ausgesetzt sind, die ihre Empfänglichkeit für extreme Positionen verringert (Lipset 1983: 50f., 76-79).
Neben den beschriebenen Wirkungszusammenhängen der einzelnen Faktoren führt Lipset zudem noch ein sozialstrukturelles Argument an. Er geht davon aus, dass sozioökonomische Entwicklung zur Bildung einer breiten Mittelschicht beiträgt, die für Demokratisierungsprozesse und den Erhalt einer bereits vorhandenen Demokratie von entscheidender Bedeutung ist. So sei es vor allem eine ökonomisch abgesicherte Mittelklasse, die sich gegen den Staat zu Wehr setzen und als Quelle unabhängiger Gruppen dient (Lipset 1994: 2f.).
„Increased wealth is not only related causally to the development of democracy by changing the social conditions of the workers, but it also affects the political role of the middle class through changing the shape of the stratification structure so that it shifts from an elongated pyramid, with a large lower-class base, to a diamond with a growing middle-class. A large middle class plays a mitigating role in moderating conflict since it is able to reward moderate and democratic parties and penalize extremist groups” (Lipset 1959: 83).
Abschließend lässt sich festhalten, dass in Lipsets Theorie die sozioökonomische Entwicklung eines Staates bzw. seine Modernisierung dazu führt, dass eine Reihe von strukturellen Veränderungen beginnt, die wiederum Auswirkungen auf das Verhalten der Bürger haben und somit die Ausbildung einer politischen Kultur und der Einhegung des Klassenkonfliktes befördern. Die durch Modernisierung veränderte Klassenstruktur ist zudem förderlich für den Demokratisierungsprozess bzw. den Erhalt einer selbigen.
2.1.3. Kritik
Obwohl die statistische Korrelation von wirtschaftlicher Entwicklung und Demokratie in vielen empirischen Studien seit den 1960er nachgewiesen und untermauert werden konnte, bleibt die Theorie Lipsets bis heute nicht unwidersprochen. Ausgangspunkt Lipsets Theorie ist dabei die Demokratisierung eines autoritären Landes. Wendet man diese auf die Situation in einem eben solchem Land an, ergeben sich einige Schwierigkeiten. Die Kritikpunkte sind dabei sehr vielfältig und sollen hier in Kürze dargestellt werden.
In Hinblick auf den Faktor Bildung stellt Lipset fest, dass diese einen demokratisierenden Einfluss auf die politischen Einstellungen der Bürger hat. Sie würde die Perspektive dieser erweitern und die Notwendigkeit demokratischer Reformen erkennen lassen. Dabei geht Lipset explizit davon aus, dass das Bildungssystem entsprechende Inhalte vermittelt, frei von Manipulation und Indoktrination. Ob diese Situation in einem autokratischen Land so vorzufinden ist, muss zumindest kritisch hinterfragt werden in Anbetracht vieler historischer Beispiele, in denen das Bildungssystem dazu genutzt wurde, den Bestand des Regimes[4] zu legitimieren und zu sichern. Diamond stellt zudem fest, dass Bildung zwar ein wichtiger Bestandteil menschlichen Lebens sei, dies aber neben einem Zugang zu Wasser, sicherem und sauberen Lebensraum und einer grundlegenden medizinischen Versorgung eher eine untergeordnete Rolle spielt (Diamond 1992: 126). Zudem stellt er fest, dass ökonomische Entwicklung per se und insbesondere wirtschaftliches Wachstum nicht die wichtigsten Faktoren zur Förderung demokratischer Strukturen seien. Die eben erwähnten Faktoren, die bereits die Bildung zu einem sekundären Faktor werden lassen, sind es auch, die für eine demokratische Zukunft sorgen. Diamond resümiert, dass die Reduzierung von absoluter Armut und menschlicher Deprivation die eigentlichen Faktoren sind für eine demokratische Perspektive (Diamond 1992: 126).
Ein weiteres Problem tritt in Bezug auf die Einkommensverteilung auf. Lipset geht davon aus, dass wachsender Wohlstand zu einer gerechteren Verteilung der selbigen und zu gemäßigten Ansichten führt, was den Erhalt bzw. das Entstehen einer Demokratie befördert (vgl. Lipset 1994: 2; 1983: 47-50). Stellt man diese Annahme einem autoritären Regime gegenüber, kehren sich die Folgen um. Wenn die Bürger eines Staates mit der Einkommensverteilung zufrieden sind, dann besteht kaum ein Grund sich gegen dieses System zur Wehr zu setzen (Acemoglu/Robinson 2006: 37). Logischer in diesem Fall wäre es demnach, dass das Demokratisierungspotential steigt, wenn die Bürger unzufrieden sind, da sie sich durch einen Regimewechsel Zugewinne erhoffen können und zudem mögliche Versprechen des Regimes auf Umverteilung unglaubwürdiger erscheinen, je ungerechter der Wohlstand verteilt ist (Acemoglu/Robinson 2006: 36f.). Für die machthabenden Eliten ergibt sich ein anderes Bild. Je ungleicher das Einkommen verteilt ist, desto mehr haben sie durch eine Demokratisierung – und einer dadurch eventuell einhergehenden Neuverteilung des Wohlstandes – zu verlieren, sodass für sie repressive Maßnahmen zum Erhalt ihrer Macht attraktiver werden und sie jegliche Art der Demokratisierung verhindern werden (Acemoglu/Robinson 2006: 36f.). Acemoglu und Robinson kommen somit zu folgender These:
„Putting these two pieces of the story together, we find that there is a nonmonotonic (i.e., inverted U-shaped) relationship between inter-group inequality and the likelihood of transition to democracy” (Acemoglu/Robinson 2006: 37).
Gegen die Verbindung zwischen Wohlstand und Demokratisierung, die bei Lipset als Grundannahme gilt, kann ein ähnlicher Einwand geltend gemacht werden. Gerade auf der Individualebene und in autoritären Systemen mit einer elitären Verteilungspolitik kann angenommen werden, dass sich wohlhabende Bürger, die von dem System profitieren, zufriedener sind und somit weniger an einer Demokratisierung interessiert sind als die ärmeren Bürger (Bueno de Mesquita/Downs 2005: 79).
Wolfgang Merkel bezieht seine Kritik an Modernisierungstheorie auf Lipsets klassische Ausführung. Er stellt dabei fest, dass die Theorie „den Modernisierungsstand, bei dem der Übergang zur Demokratie mit hoher Wahrscheinlichkeit beginnt, nur unzureichend“ (Merkel 2010: 75) angeben kann. Dieser Mangel wird auch von Larry Diamond aufgegriffen, der es zwar für bewiesen hält, dass sozioökonomische Entwicklung Demokratie befördert, aber dazu festhält:
„Where democracy does not exist, it leads (sooner or later) to the eventually (if not initially) successful establishment of democracy. However, it is difficult to predict at what point in a country’s socioeconomic or historical development the democratic moment will emerge” (Diamond 1992: 125).
Viele Probleme der Modernisierungstheorie nach Lipset entstehen durch das konsequente Außer-Acht-Lassen von günstigen oder ungünstigen Akteurskonstellationen und die Fixierung auf eine partizipationsbereite und mäßigende Mittelschicht bei der Bewertung der Durchsetzungschancen der Demokratie. Dadurch kann die Theorie auch keine Aussagen über demokratieförderliche bzw. demokratiehinderliche politisch-institutionelle Arrangements machen (Merkel 2010: 75). Doch gerade diese Faktoren sind es laut Diamond, die die Wahrscheinlichkeit der Entstehung einer Demokratie entscheidend beeinflussen (Diamond 1992: 125). Beide Autoren führen zudem an, dass die Theorie die Entwicklung von Demokratien in unterentwickelten Ländern nicht erklären kann. Diamond hält fest, dass Demokratie auch bei einem niedrigen Level von Modernisierung bzw. Entwicklung entstehen kann. Er versteht ökonomisches Wachstum nicht als Vorbedingung für Demokratie. Vielmehr sieht er in diesen Fällen die Entwicklung einer politischen Kultur, die Toleranz, Inklusion, Partizipation und Entgegenkommen betont, als ausschlaggebenden Faktor für die Etablierung und Konsolidierung einer Demokratie (Diamond 1992:127). Einen weiteren Kritikpunkt sieht Merkel in der Tatsache, dass die Theorie bei der Erklärung für den Zusammenbruch von demokratischen Systemen in sozioökonomisch hoch entwickelten Gesellschaften (wie z.B. Deutschland in den 1930er Jahren) keine Erklärung liefert (Merkel 2010: 75).
Abschließend kann man festhalten, dass die Modernisierungstheorie von Lipset vor allem eine extrem signifikante Tendenz angibt, nicht aber einen deterministischen Zusammenhang.
2.2. Akteurstheorie von O’Donnell, Schmitter und Whitehead
Im Gegensatz zu der Modernisierungstheorie von Lipset, deren Analysedimension die Makroebene ist, beschreiben Akteurstheorien die Mikro- und Mesoebene der handelnden Akteure (Merkel 2010:84). Die Bedeutung von strukturellen Faktoren wie nationalem Wohlstand und Bildung wird von der akteurstheoretischen Transformationsforschung nicht bestritten, allerdings werden die Strukturen vielmehr nur als Rahmen begriffen, in dem sich die Befürworter und Gegner der Systemwechsel bewegen (Bos 1996:81; O’Donnell/Schmitter 1986: 4f.; Thieme 2015: 72). Grundsätzlich gehen Akteurstheorien davon aus, dass das Ergebnis von Transformationsprozessen von „subjektiven Einschätzungen, Strategien und Handlungen der relevanten Akteure“ (Merkel 2010: 84) abhängen.
1986 veröffentlichten die Politikwissenschaftler Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter und Laurence Whitehead ihre mehrbändige Studiensammlung mit dem Titel „Transition from Authoritarian Rule“. Hiermit etablieren sie einen akteurstheoretischen Ansatz als neuen Zweig in der Demokratisierungsforschung (Bos 1996: 81). O’Donnell, Schmitter und Whitehead gehören zu den bekanntesten Vertretern der deskriptiv-empirischen Strömung und haben durch die Analyse unterschiedlicher Transformationsprozesse, vor allem in Mittelamerika, allgemeine Feststellungen über das Verhalten von Akteuren aufgestellt, die an einem Systemwechsel beteiligt sind.
Ausgangspunkt der Theorie von O’Donnell und Schmitter ist das Konzept der Unsicherheit, welches an zwei Sachverhalten festgemacht werden kann. Zum einen beschreiben sie Transformationsvorgänge als einen Übergang von einem bestimmten autoritären System zu einem unbestimmten anderen Regime und gehen darüber hinaus davon aus, dass unerwartete Ereignisse und Fähigkeiten der einzelnen Akteure Einfluss auf den Prozess der Transformation nehmen. Die Phase zwischen dem bestimmten Alten und dem unbestimmten Neuen ist also von der Unsicherheit geprägt nichts über den Ausgang zu wissen (O’Donnell/Schmitter 1986: 3).
Die Autoren definieren die Transition[5] als Übergangsphase zwischen zwei politischen Regimen, der Prozess einer Transition ist dann abgeschlossen, wenn ein anderes, neues Regime installiert sei. Dieses neue System kann dann sowohl eine Demokratie als auch ein neues autokratisches Regime sein.
„What we refer to as the ‘transition‘ is the interval between one political regime and another. […] Our efforts generally stop at the moment that a new regime is installed, whatever its nature or type” (O’Donnell/Schmitter 1986: 6).
Kennzeichnend für die Phase der Transition ist das Fehlen von eindeutigen und allgemein anerkannten Regeln und Institutionen. Transformationen stellen laut O’Donnell und Schmitt einen sehr unsicheren Prozess dar, der jederzeit durch einen Akteur unterbrochen werden kann bzw. zum Erliegen gebracht werden kann (O’Donnell/Schmitter 1986: 6). Die Autoren sehen als ein typisches Zeichen für den Beginn einer Transition den Moment, wenn die autoritären Machthaber beginnen, aus welchem Grund auch immer, ihre eigenen Regeln insoweit zu modifizieren, dass diese mehr Sicherheitsgarantien für die Rechte von Individuen und Gruppen beinhalten (O’Donnell/Schmitter 1986: 6). Die Transition gliedert sich dabei in drei Phasen: Liberalisierung, Demokratisierung und Konsolidierung
2.2.1. Liberalisierung, Demokratisierung und Konsolidierung
Zu Beginn einer jeden Transition steht zunächst die Liberalisierung des bestehenden Systems, d.h. der politische Raum wird durch die alten Machtinhaber geöffnet. Kennzeichnend für die Phase ist es, dass bereits hier, oftmals unbeabsichtigt, der Spielraum und Reichweite dieses Prozesses festgelegt wird. Die Autoren gehen beim Prozess der Liberalisierung davon aus, dass hier ein Prozess stattfindet, der effektiv bestimmte Rechte entstehen lässt, die sowohl Individuen als auch soziale Gruppen vor willkürlichen oder illegalen Handlungen des Staates oder durch Dritte schützt.
„On the level of individuals, these guarantees include classical elements of the liberal tradition: habeas corpus; sanctity of private home and correspondence; the right to be defended in a fair trial according to preestablished laws, freedom of movement, speech, and petition; and so forth. On the level of groups, these rights cover such things as freedom from punishment for expressions of collective dissent from government policy, freedom from censorship of the means of communication, and freedom to associate voluntarily with other citizens” (O’Donnell/Schmitter 1986: 7).
Auch wenn diese Sicherheiten nicht lückenlos überprüft werden können, konstituieren sie dennoch einen wichtigen Schritt weg von der Praxis autoritärer Systeme. Durch diese Öffnung entstehen Räume für soziale Gruppen und Individuen, in denen sie nicht der Willkür der herrschenden Machthaber ausgesetzt sind. Ist dieser Prozess erst einmal in Gang gesetzt, inspiriert er auch andere dazu, sich politisch zu betätigen, da man nicht mehr um sein Leben fürchten muss (O’Donnell/Schmitter 1986: 7).
Die zweite Phase des Modells umfasst die Demokratisierung. Die Autoren definieren zunächst den Begriff der Demokratie. Dabei gehen sie davon aus, dass das Leitmotiv der Demokratie die Staatsbürgerschaft sei. Das Minimum demokratischer Verfahren sei dann gegeben, wenn freie, faire und geheime Wahlen, ein passives und aktives Wahlrecht, eine politische Konkurrenz unter den Parteien, freie Betätigung von Organisationen und Vereinen, freien Zugang zu Informationen und eine politische Verantwortlichkeit der Exekutive gegenüber dem Parlament bzw. den Wählern bindend zugesichert würden (O’Donnell/Schmitter 1986: 7f.). Die Demokratisierung stellt für O’Donnell und Schmitter einen Prozess dar, in dem die „rules and procedures of citizenship“ (O’Donnell/Schmitter 1986: 8) institutionalisiert werden.
Liberalisierung und Demokratisierung sind nicht synonym zu verwenden, auch wenn sie historisch eng miteinander verbunden sind. Ohne individuelle und kollektive Freiheit, droht der Demokratisierung das Abrutschen in einen reinen Formalismus. Umgekehrt droht der Liberalisierung allerdings der Missbrauch bzw. ihr Widerruf, wenn sie nicht im Zuge der Demokratisierung institutionalisiert wurde und von einer großen Masse eingefordert werden kann. Trotz dieser Interdependenz gehen die Autoren davon aus, dass diese beiden Phasen während der Transition nicht gleichzeitig auftreten (O’Donnell/Schmitter 1986: 9). So können autoritäre Herrscher den Liberalisierungsprozess billigen oder teilweise unterstützen, in der Hoffnung, dass sie auch ohne Druck auszuüben die autoritären Strukturen beibehalten können. Die Autoren nennen dieses Phänomen „liberalized authoritarianism“ (O’Donnell/Schmitter 1986: 9). Hat die Demokratisierung erstmal begonnen und es ist zu befürchten, dass sich dieser Prozess übermäßig ausweitet, kann es nach den Autoren dazu kommen, dass die Machthaber auf alte oder neue Restriktionen zurückgreifen, um die individuelle oder kollektive Freiheit einzuschränken. In diesen Fällen sprechen O’Donnell und Schmitter von „limited democracy“ (O’Donnell/Schmitter 1986: 9). Festzuhalten bleibt, dass Liberalisierung der Beginn einer Demokratisierung sein kann, deren Ende aber nicht zwangsläufig eine Demokratie sein muss. Allerdings eröffnet ein demokratisches Minimum die Möglichkeit weiterer Transitionswege. Die politische Gleichheit der Demokratie könne auf eine soziale und/oder eine ökonomische Demokratie erweitert werden, die am Ende zu einem sozialistischen Gesellschaftsmodell ausgebaut werden könne (O’Donnell/Schmitter 1986: 11ff.).
Im Anschluss an die Phase der Demokratisierung eines autoritären Systems kommt es, nachdem es zunächst eine Art Übergangsdemokratie gibt, zu einer Phase der Konsolidierung. Diese beginnt mit der Einsetzung einer demokratisch gewählten Regierung und endet, wenn ein stabiler Zustand des demokratischen Systems erreicht ist. Allerdings bleiben die Autoren „klare und operationalisierbare Kriterien“ (Bos 1996: 86) schuldig.
„In any case, the transition is over when ‘abnormality‘ is no longer the central feature of political life, that is, when actors have settled on and obey a set of more or less explicit rules defining the channels they may use to gain access to governing roles, the means they can legitimately employ in their conflicts with each other, the procedures they should apply in taking decisions, and the criteria they may use to exclude others form the game. Normality, in other words, becomes a major characteristic of political life when those active in politics come to expect each other to play according to the rules – and the ensemble of these rules is what we mean by a regime” (O’Donnell/Schmitter 1986: 65).
2.2.2. Krise eines autoritären Regimes
Wodurch Krisen im autoritären System hervorgerufen werden, wird in den Ausführungen der Autoren nur vage umrissen. O’Donnell und Schmitter führen als Hauptgrund die ideologische Schizophrenie der autoritären Systeme an, die unfähig sind, sich nach der Niederschlagung des europäischen Faschismus, auf eine umfassende Ideologie zu stützen.
„They are regimes that practice dictatorship and repression in the present while promising democracy and freedom in the future“ (O’Donnell/Schmitter 1986: 15).
Diese Legitimitätskrise führt dazu, dass sich die autoritären Kräfte nur als „transitional powers“ (O’Donnell/Schmitter 1986: 15) etablieren können, deren primäres Ziel die Errichtung von sozialem Frieden und ökonomischem Fortschritt sei. Letztendlich würden die Regime oftmals an ihren willkürlichen Zielsetzungen bei der Institutionalisierung scheitern. Vor allem aber der fehlende Rückhalt in der Bevölkerung führe dazu, dass autoritäre System sich weniger um den Ausbau des Rechtstaates und mehr um den Aufbau von Kontrollinstrumenten und Repressionen kümmern würden. Die Schizophrenie der Regime führe dann dazu, dass ihre Mängel offensichtlich würden und so dazu führen, dass „those sectors of the population that are excluded and victimized […] can express what often becomes their fundamental demand: the removal of the authoritarian regime and its replacement by a democratic one (O’Donnell/Schmitter 1986: 15).
Werden die Ziele des Regimes nicht erreicht und der schizophrene Charakter wird zum Problem kommt es innerhalb der autoritären Kräfte zu einer Abspaltung in zwei Gruppen: Softliner und Hardliner.
Als Hardliner werden von den Autoren solche Akteure beschrieben, die davon ausgehen, dass die Aufrechterhaltung der autoritären Herrschaft möglich und wünschenswert sei. Wenn dies nicht durch die totale Negierung aller demokratischen Formen möglich ist, dann durch die Errichtung einer (demokratischen) Fassade, hinter der sie ungehindert die hierarchische und autoritäre Natur ihrer Herrschaft bewahren können. Die Gruppe der Hardliner gliedert sich in mehrere Interessensgruppen. Das Herzstück stellen jedoch die dar, die das vermeintliche Chaos der Demokratie ablehnen und daran glauben, dass sie jeden noch so kleinen Anflug von Demokratie eliminieren müssen. Selbst nachdem die Transformation begonnen hat und selbst nachdem die Demokratie eingeführt wurde, bildet diese Gruppe ein hohes Risiko für selbige, da von ihnen stets die Gefahr von Putschen und Verschwörungen ausgeht (O’Donnell/Schmitter 1986: 16).
Die Softliner sind in der ersten reaktiven Phase kaum von den Hardlinern zu unterscheiden. Auch sie könnten die Anwendung von Repressionen befürworten oder Willkürakte von den Sicherheitsdiensten tolerieren. Was sie von den Hardlinern unterscheidet, ist folgendes:
„What turns them into soft-liners is their increasing awareness that the regime they helped to implant […] will have to make use, in a foreseeable future, of some degree or some form of electoral legitimation“ (O’Donnell/Schmitter 1986: 16).
Zudem sehen die Softliner, dass die Einführung bestimmter Freiheiten nicht zu lange warten dürfe, wenn eine eventuelle Legitimation durch Wahlen möglich sei, nicht zuletzt um die Akzeptanz bei der Opposition und der Weltöffentlichkeit zu erhöhen.
Der ideale Zeitpunkt für die Einleitung der Liberalisierung stellt sich als das Hauptproblem der Transformation dar. Idealerweise würde diese nämlich dann beginnen, wenn das Regime weitreichende Erfolge vorweisen kann, die oftmals mit einer guten wirtschaftlichen Situation einhergehen, um diese Effizienz als Schubkraft für die anstehende Veränderung zu nutzen. Problematisch ist dieser Zeitpunkt deswegen, da sich bei Erfolgen die Frage stellt, wieso man diese für schwammige Langzeitziele der Softliner aufgeben solle. Dementsprechend neigen die meisten Regime laut den Autoren dazu, erst dann zu reagieren, wenn sie sich bereits in ernstzunehmenden Krisen befinden, die von einigen Regierenden auch als solche wahrgenommen werden – vor allem von der Opposition. Auf jeden Fall gehen die Maßnahmen des Regimes nur selten über stark kontrollierte Neuerungen hinaus. Doch selbst unter solchen Bedingungen würden sich die Softliner von den Hardlinern durch ihre Forderung nach einer Art von Demokratie unterscheiden. Schmitter spricht davon, dass diese beginnen, die Entbehrlichkeit des Regimes zu akzeptieren. Allerdings verfolgen nicht alle Softliner das gleiche Ziel. Viele sind schlichtweg bestrebt, ihre hervorgehobene soziale Stellung zu sichern. Sowohl diese unterschiedlichen Ziele der Akteure, als auch die Umstände, unter denen sich das Regime etabliert hat, haben einen nicht zu verachtenden Einfluss auf die Ereignisse vor der Transformation. So erscheinen die Hardliner einflussreicher in der Einführungsphase, allerdings gewinnen die Softliner an Bedeutung durch ihren Einwand, dass eine politische Öffnung in der Zukunft unumgänglich sei. Diese Differenzen unter den Akteuren der Führungselite senden zweideutige Signale an potentielle Verbündete und Gegner (O’Donnell/Schmitter 1986: 16f.).
Die Transformation eines autoritären Regimes ist für O’Donnell und Schmitter somit die direkte oder indirekte Konsequenz einer bedeutenden Zweiteilung innerhalb des autoritären Regimes, genauer gesagt entlang der fluktuierenden Linie zwischen Hardlinern und Softlinern und geht somit von oben aus. Eine erfolgreiche Transformation ist dem Argumentationsstrang folgend nur dann möglich, wenn es entsprechend den Kosten-Nutzen Kalkülen der handelnden Akteure rational ist, sich für einen Systemwechsel zu entscheiden (Merkel 2010: 86; O’Donnell/Schmitter 1986:17ff.).
Nach der Aufspaltung der Führungselite eines Regimes beginnen die Softliner den Krisenerscheinungen mittels politischer Zugeständnisse zu begegnen, die dann die oben bereits erwähnte Liberalisierung einleiten. Durch die Integration neuer Gruppen in die Führungselite des Regimes versuchen die Softliner, die Legitimationsbasis der Regimes zu vergrößern. Zudem wird versucht, Partizipationsmöglichkeiten für die Bevölkerung zu vergrößern. Die Akteurstheorie geht hierbei davon aus, dass erfolgreiche Transformationen ihren Anfang bei den führenden Eliten nehmen und nicht von unten, aus dem Volk heraus erfolgen. Die Verhandlungen über eine zunehmende Liberalisierung finden idealtypisch zwischen den Softlinern und der Opposition statt, die in der Lage sind, die Hardliner zu kontrollieren. Im Falle einer erfolgreichen Liberalisierung sieht sich die Führungselite zunehmend mit einem Interessenspluralismus konfrontiert, der zur Folge hat, dass sie sich zwischen Repression und Demokratisierung entscheiden müssen. Die Angst vor einem Putsch und damit einhergehend die Angst davor die Kontrolle, welchen Ausmaßes auch immer, zu verlieren, führt zu einer Kompromissbereitschaft auf Seiten der Softliner (O’Donnell/Schmitter 1986: 20 -25).
Eine Demokratisierung kann der Theorie nach nur dann erfolgen, wenn es zu einer Verständigung oder Kompromissen zwischen den Softlinern und den gemäßigten Kräften der Opposition über grundlegende Fragen der Transformation kommt (Schmidt-Schweizer 2001:45). Diese Verständigungen beruhen laut O’Donnell und Schmitter vor allem auf formellen oder informellen Pakten zwischen den jeweiligen Akteuren. Die Autoren definieren Pakte wie folgend:
„A pact can be defined as an explicit, but not always publicly explicated or justified, agreement among a select set of actors which seek to define (or better, to redefine) rules governing the exercise of power on the basis of mutual guarantees for the ‚vital interests’ of those entering into it” (O’Donnell/Schmitter 1986: 37).
Die Pakte zwischen den Akteuren bilden das Fundament der Verhandlungen, in denen die Institutionen und die neue Verfassung des nachfolgenden Regimes ausgehandelt werden. Diese Pakte sind zwar nicht demokratisch legitimiert, allerdings durchaus wünschenswert, da sie die politischen Konflikte zwischen Opposition und Regime beschränken und somit die Chance einer schnellen demokratischen Konsolidierung erhöhen (Merkel 2010: 85; O’Donnell/Schmitter 1986: 38ff.).
Allerdings wird von O’Donnell und Schmitter angeführt, dass diese Pakte immer brüchig und stets durch das Militär bedroht seien (O’Donnell/Schmitter 1986: 39f.). Zu Beginn einer Transition und bei Pakten spielen vor allem die politischen Eliten eine entscheidende Rolle, welche aber im Verlauf dieses Prozesses zunehmend durch die nun mobilisierte Zivilgesellschaft ausgefüllt wird (O’Donnell/Schmitter 1986: 48). Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Einfluss des Volkes umso höher sei, je kürzer die Transition von autoritären Regimen verlaufe (O’Donnell/Schmitter 1986:48f.; Rüb 2007: 340). Je mehr die Transition voranschreitet desto größer wird die Rolle der Parteien. Spätestens bei den ersten freien Wahlen spielen sie eine wichtige Rolle. Die Phase der Unsicherheit wird laut den Autoren also durch die Schaffung sicherer Institutionen und Regeln abgelöst. Damit endet dann die unsichere Phase der Transition und beginnt die Phase der Konsolidierung einer Demokratie (O’Donnell/Schmitter 1986: 57ff.; Rüb 2007: 341).
Abschließend kann man zusammenfassen, dass O’Donnell und Schmitter in ihrer Theorie vor allem Akteure und deren Interessen und Strategien in den Fokus der Analyse stellen. Folgt man ihren Annahmen so wird deutlich, dass eine erfolgreiche Transition nur dann erfolgen kann, wenn die machthabenden Akteure gewillt sind, einen Liberalisierungsprozess in Gang zu bringen. Schlussendlich unterteilt sich eine Transformation in drei Teilschritte: Liberalisierung, Demokratisierung und Konsolidierung.
2.2.3. Kritik an der empirisch-deskriptiven Akteurstheorie
Der empirisch-deskriptive Ansatz von O’Donnell und Schmitter fasst viele Fakten zusammen und kommt so zu generalisierten Aussagen über die Prozesse einer – den Autoren folgend – Transition. Diese referierten Generalisierungen sind es, die vor allem auf Kritik stoßen. Die Autoren würden die Vorstellung zugrunde legen, dass die politischen Akteure über der Gesellschaft schweben und frei von Beschränkungen handeln, Ereignisse manipulieren, Wandel ver- bzw. behindern, die oben erwähnten Pakte aushandeln und damit die Ergebnisse des politischen Prozesses bzw. der Transition bestimmen können (Bos 1996: 103; Remmer 1991: 485). Kritiker werfen dem Ansatz deswegen Willkür und Beliebigkeit vor. Zudem werden die strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen nicht ausreichend berücksichtigt (vgl. Remmer 1991). Ellen Bos stellt dazu fest, dass dies in Hinblick auf die Generalisierungen zutrifft, jedoch von in den empirischen Studien[6] aufgegriffen werde (Bos 1996:103). Die alleinige Begründung und Erklärung von Transformation in den Akteuren und ihrem Handeln zu suchen wird als eine Reduzierung der Komplexität eines Systemwandels wahrgenommen. Eine Analyse auf dieser Grundlage sieht sich zwangsweise – ähnlich wie die strukturellen Ansätze – dem Vorwurf der Eindimensionalität ausgesetzt. Zudem würde der Ansatz von O’Donnell & Schmitter auf der Mikro- und Mesoeben verharren (Schwanitz 1997: 20). Um diesem Dilemma zu entkommen, erscheint es sinnvoll, eine Synthese vorzunehmen, die nicht nur die Entscheidungen und Interaktionen der Akteure berücksichtigt, sondern auch die strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen bei der Analyse mit einbezieht (Karl 1990: 7f.). Problematisch bei dieser Lösung wäre allerdings die Gewichtung des Einflusses von Akteuren und der von strukturellen und institutionellen Zwängen. In Hinblick auf laufende Transformationsprozesse kommt zudem ein weiteres Problem zum Vorschein. Der empirisch-deskriptive Ansatz lässt sich nur schwer auf noch nicht abgeschlossene Transformationen anwenden. Allein die Identifizierung der relevanten Akteure – so ist sich Ellen Bos sicher – wäre ein kaum lösbares Problem (Bos 1996: 104). Der Ansatz ist dementsprechend vor allem für eine ex post-Analyse nicht aber für eine ex ante-Analyse brauchbar.
Von der Kritik nicht verschont bleibt zudem die Vergleichbarkeit der Ergebnisse. So stellen Kritiker in Frage, ob man Transitionsprozesse aus Lateinamerika, Südeuropa, Osteuropa, Asien und Afrika miteinander vergleichen kann, wenn diese unter sehr unterschiedlichen Bedingungen ablaufen. Hauptkritikpunkt hierbei ist, dass ein Vergleich allenfalls auf einer sehr hohen Abstraktionsebene möglich sei, wodurch die Erklärungskraft der analysierten Prozesse zwangsläufig gering sei. Bos hält dieser Kritik allerdings entgegen, dass erst der Vergleich die Besonderheiten der einzelnen Fallstudien herausarbeiten könne (Bos 1996: 104). Sie sieht in dem akteurstheoretischen Ansatz vor allem für Osteuropa ein probates Analysemittel, da es sich hierbei in vielen Fällen um friedlich ausgehandelte Systemübergänge handelt.
2.3. Das Dilemma der Gleichzeitigkeit
Wie bereits in der Einleitung deutlich gemacht wurde, ist das Theorem des Dilemmas der Gleichzeitigkeit eng mit den Transformationsprozessen in den postsowjetischen Ländern verbunden. Doch was genau versteht man unter diesem Begriff? Der Begriff wurde von den beiden Transformationstheoretikern Jon Elster (1990) und Claus Offe (1991, 1994) geprägt und beschreibt die Problematik, dass mehrere Transformationsprozesse gleichzeitig ablaufen: (1) die politische Transformation, d.h. der Übergang von einer Diktatur hin zu einer Demokratie; (2) die wirtschaftliche Transformation, die in den Beispielen dieser Arbeit den Wechsel von einer Plan- hin zu einer Marktwirtschaft umfassen und (3) in manchen Fällen, dies gilt z.B. für die Ukraine, die staatliche Transformation, die den Zerfall des Sowjetimperiums und die Entstehung neuer Nationalstaaten umfasst (Offe 1991: 281f).
Ein auffälliges Merkmal dieser Prozesse ist „das Fehlen vorab ausgearbeiteter theoretischer und normativer Annahmen einer revolutionären Elite“ (Saliba 2015: 517). Zudem ist ein entscheidendes Problem dieser Transformationsprozesse der Faktor Zeit (Elster 1990: 309; Offe 1991: 282). Claus Offe verweist hierbei darauf, dass die Stufen dieser Prozesse, „die im westeuropäischen ‚Normalfall‘ in einer über Jahrhunderte gestreckten Sequenz (vom Nationalstaat zum Kapitalismus zur Demokratie) bewältigt wurden […] in Osteuropa nahezu synchron durchlaufen werden“ (Offe 1991: 282). Hier zerfällt das sozialistische Projekt innerhalb weniger Jahre und wird ebenso schnell durch das über die vorherigen Jahre konkurrierende Modell der Demokratie und Marktwirtschaft ersetzt. Der Mangel an Vorbildern und dem Fehlen einer ordnenden, externen Kraft führt dazu, dass die Demokratisierung der postkommunistischen Systeme erhebliche Probleme aufwirft (Elster 1990: 311; Merkel 2010: 324f.). Doch nicht nur die Veränderungsprozesse an sich fallen schwer, sondern auch deren Beschreibung. Der Versuch, die mittel- und osteuropäischen Staaten mit denen der dritten Demokratisierungswelle aus Süd- und Mittelamerika, mit Rückgriff auf das bewährte „Instrumentarium der transition -Foschung“ (Offe 1991:280f.), zu vergleichen, hält Offe zwar für naheliegend, führt aber weiterhin aus, dass sich dieser Versuch „als untauglich und irreführend“ (Offe 1991:280) erweist. An diesem Punkt wird mehr als deutlich, dass Offe und Elster der Auffassung sind, dass sich der Charakter der osteuropäischen Transformationsprozesse grundlegend von denen der sogenannten „dritten Demokratisierungswelle“ unterscheidet. Die wichtigsten Problemfelder, die die Demokratisierung der postkommunistischen Ländern erheblich stören, damit einhergehend ihre Beschreibung oder gar ihre Voraussagbarkeit und für diese Arbeit von hoher Relevanz sind:
[...]
[1] Der Begriff Transformation ist zu unterscheiden von dem der Transition. Der Begriff Transition wird „fast ausschließlich [benutzt], um den Übergang von autokratischen zu demokratischen Systemen zu bezeichnen“ (Merkel 2010: 66). Merkel rechtfertigt seinen Widerspruch zu den Autoren O’Donnell und Schmitter (vgl. Kapitel 2.1.2) damit, dass die Transitionsforschung „vor allem mit der politikwissenschaftlichen Erforschung der Demokratisierungsprozesse in Südeuropa und Lateinamerika entstanden [sei] und […] die Untersuchung der Voraussetzungen, Ursachen und Verlaufsmuster der Demokratisierung politischer Systeme zum Gegenstand [hat]“ (Merkel 2010:66) Transformation hingegen „besitzt keine spezifische Bedeutung, sondern wird […] als Oberbegriff für alle Formen, Zeitstrukturen und Aspekte des Systemwandels und Systemwechsel benutzt […]. Er schließt Regimewandel, Regimewechsel, Systemwandel, Systemwechsel oder Transition mit ein“ (Merkel 2010: 66). Dieser Argumentation folgend wird in dieser Arbeit ebenfalls der Begriff der Transformation verwendet.
[2] Lipset unterscheidet hier nicht zwischen „endogener“, d.h. die Transformation zu einer Demokratie, und „exogener“ Erklärung, die wiederrum das Überleben einer existierenden Demokratie beschreibt, wie es seit Mitte der 1990er Jahre Adam Przeworski und seine Kollegen in einer Art konstruktiven Kritik getan haben (vgl. Przeworski, Adam; Alvarez, Michael E.; Cheibub, José A.; Limogi, Fernando (2000): Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. Cambridge: Cambridge University Press).
[3] Lipset bezieht sich hier auf die Ausführungen von Alexis de Tocqueville: Tocqueville, Alexis de (1976): Democracy in America. Vol. 2. New York: Knopf, S. 162 – 216.
[4] Ein gutes Beispiel hierfür ist die Deutsche Demokratische Republik. Weitere Informationen finden sich hier: Bunke, Florian (2005):“Wir lernen und lehren im Geiste Lenins …“. Ziele, Methoden und Wirksamkeit der politisch-ideologischen Erziehung in den Schulen der DDR, http://oops.uni-oldenburg.de/474/1/bunwir05.pdf (26.07.2016).
[5] An dieser Stelle sei nochmal auf die Ausführungen zu Beginn dieser Arbeit verwiesen. O’Donnell und Schmitter haben ein anderes Verständnis des Begriffs als Merkel (2010) in seiner Monographie. Die beiden Autoren haben 1986 eine wesentlich offenere Begriffsdefinition.
[6] An dieser Stelle kann man auf die Fallstudien in den von O’Donnell/Schmitter/Whitehead (1986) herausgegebenen Sammelbänden verwiesen werden.
- Arbeit zitieren
- M.Ed. Christoph Grave (Autor:in), 2017, Die Erklärungskraft von Modernisierungstheorie und Akteurstheorie. Vergleich der politischen Transformationsprozesse in Weißrussland und Ungarn, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373695
Kostenlos Autor werden









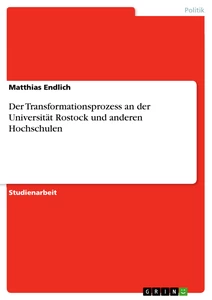












Kommentare