Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Gegenstand und Problemlage
1.2 Zentrale Fragestellung
1.3 Aufbau der Arbeit
2 Theorie und Forschungsstand
2.1 Veränderungen im Bildungssystem
2.2 Kompetenzen und Kompetenzentwicklung
2.3 Kompetenzorientierung in der Mathematik der Primarstufe
2.4 Inhalt und Genese des neuen Kerncurriculums für Hessen
2.5 Selbstreguliertes Lernen
2.6 Lernumgebungen und Lernaufgaben
2.7 Konkretisierung der Fragestellung
3 Kompetenzorientiert und differenziert unterrichten
3.1 Das Problemlösen
3.1.1 Das Problemlösen als prozessbezogene Kompetenz
3.1.2 Das Problem als Ausgangspunkt für das Problemlösen
3.1.3 Der Problemlöseprozess
3.1.4 Bedingungen für das Problemlösen
3.1.5 Förderung von Problemlösefähigkeiten
3.2 Das Problem mit einer Lernumgebung lösen
3.2.1 Schüleraktivität und natürliche Differenzierung
3.2.2 Das Problemlösen in einer Lernumgebung
3.3 Das Bilderbuch als Ausgangspunkt einer Lernumgebung
3.3.1 Das Geheimnis des Bilderbuches
3.3.2 Das Problem aus einem Bilderbuch mit einer Lernumgebung lösen
3.3.3 Existierende Bezüge zwischen Bilderbüchern und
Mathematikunterricht
3.4 „Jan und Julia gehen einkaufen – Arbeit mit der Größe ‚Geld’“
3.5 Konzeption einer kompetenzorientierten Lernumgebung
3.5.1 Rahmenbedingungen und Ziele
3.5.2 Unterrichtspraktische Implikationen
3.5.3 Beschreibung der Lernumgebungen
4 Diskussion und Fazit
5 Ausblick
Literatur
Anlage I
Anlage II
Anlage III
Anlage IV
Anlage V
Anlage VI
Anlage VII
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1. Konkretisierung allgemeiner mathematischer Kompetenzen entnommen aus KMK, 2004, S. 7 f.)
Abb. 2. Allgemeine und inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen und Leitideen (entnommen aus KMK, 2004, S. 8)
Abb. 3. Der Problemlöseprozess und seine Einflussfaktoren (erstellt nach Pólya, 1949)
Abb. 4. Selbsterstellte Hilfsmittel
Tabellenverzeichnis
Tab. 1. Konkretisierung allgemeiner mathematischer Kompetenzen (Quelle: KMK, 2004, S. 7-8)
Tab. 2. Anforderungsbereiche Mathematik (Quelle: KMK, 2005b, S. 13; Walther et al., 2016, S. 21)
Tab. 3. Komponenten selbstregulierten Lernens (Quelle: Eigene Darstellung nach Perels, 2011)
Tab. 4. Am erfolgreichen selbstgesteuerten Lernen beteiligte Lernstrategien (Quelle: Eigene Darstellung nach Killus, o. J.)
Tab. 5. Klassifikationsschema für Offenheit (Quelle: Eigene Darstellung nach Büchter & Leuders, 2014, S. 93)
Tab. 6: Mögliche Lernumgebungen zum Bilderbuch „Jan und Julia gehen einkaufen“
Tab. 7: Entwurf für die erste Klasse: Beträge legen und Wechselgeld
1 Einleitung
1.1 Gegenstand und Problemlage
Mit den Ergebnissen international vergleichender Schulleistungsstudien wie TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) und PISA (Programme for International Student Assessment) hat sich die Zielrichtung der Bildungspolitik in den teilnehmenden Staaten gravierend geändert. Die Befunde der OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD, 2016) haben zu einer erheblichen Intensivierung des Bildungsdiskurses sowie zu kontroversen Debatten in der Bildungsforschung geführt (Becker, 2013). Dies gilt auch für Institutionen, die sich weit abseits der Mauern formaler Bildungseinrichtungen um die Ausgestaltung von Bildungsprozessen bemühen. So werden mit der profanen Feststellung „Bildung ist mehr als Schule“ (BJK, 2002) alle Akteur/innen an dem Thema beteiligt, welche bis vor wenigen Jahren beinahe ausschließlich Schulleiter/innen, Bildungspolitiker/innen und Eltern schulpflichtiger Kinder adressierte (Rauschenbach, 2015). In Verbindung mit wissenschaftlichen Befunden aus der Lehr-Lern-Forschung (u. a. Meyer, 2004; Helmke, 2008; Hattie, 2013) und der Schuleffektivitätsforschung (u. a. Gräsel & Göbel, 2011; Reusser & Pauli, 2010) hat die Diskussion der Befunde in den teilnehmenden Ländern zu einem erheblichen Reformdruck auf die Einzelschulen geführt. Während es in der chronologisch vorgelagerten Reformphase des Bildungswesens noch um die Modernisierung des Lehrplans durch curriculare (Weiter-)Entwicklungen und grundsätzliche Strukturfragen ging, richtet sich die aktuelle Reform genuin auf die Verbesserung schulischer Ergebnisse (Gruschka, 2011). Damit eng verknüpft ist die Entwicklung nationaler Bildungsstandards, die einen Beitrag zur landesweiten Harmonisierung der Ziele der obligatorischen Schule leisten sollen. Diese „evidenzbasierte Bildungspolitik und Schulentwicklung“ (Altrichter & Maag Merki, 2010, S. 35) wird von Wissenschaft und Management als Paradigmenwechsel staatlicher Strategien bezeichnet und als Ergebnis der neuen Steuerung von Bildungsprozessen betrachtet. Kennzeichnend ist die Ablösung der dominanten Input-Steuerung durch die dominante Output-Steuerung:
Den Schulen soll nicht mehr vorgeschrieben werden, was sie zu unterrichten haben, sondern nur noch, was die Schüler am Ende können müssen. Dazu wird den Schulen zurückgemeldet, wo sie mit ihren Ergebnissen stehen. … Fragt man nach dem gemeinsamen Nenner der unterschiedlichen Einzelmassnahmen und Programme, so erhält man als Antwort, dass die Effizienz schulischer Bildung und Erziehung erhöht werden soll. (Gruschka, 2011, S. 8)
Dieser Diskurs steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Diskussion über Kompetenzen, Kompetenzerwerb und Kompetenzentwicklung. Demnach sollen Schüler/innen „nicht mehr nur gelerntes Wissen wiedergeben, sondern nachweisen, dass sie über Lern- und Handlungskompetenzen verfügen“ (Paradies, Wester & Greving, 2005, S. 10). Mit Handlungskompetenzen ist dabei eine komplexe personale Disposition des menschlichen Handelns und Verhaltens gemeint, die verschiedene Lerndimensionen (motorisches Lernen, kognitives Lernen, soziales Lernen) in Anspruch nimmt. Sowohl in der Bildungspolitik als auch in der Scientific Community herrscht Konsens darüber, dass die Kompetenzorientierung als vermittelndes Vehikel zwischen Bildung und qualifikatorischer Ausbildung im Rahmen von Schule zum Tragen kommt. Entsprechende Hinweise darauf finden sich in der sogenannten Klieme-Expertise aus dem Jahre 2007. Diesem Papier folgend findet sich das, was in den PISA-Studien gemessen wurde und wird, in den Curricular der Zukunft wieder: die Orientierung an Kompetenzen (Klieme et al., 2007). Einen entsprechenden Niederschlag hat dies auch in der Lehrplanarbeit im Bundesland Hessen gefunden. Das vorliegende Kerncurriculum unterscheidet sich nicht nur in seinem Gültigkeitsbereich von den bisherigen Lehrplänen, sondern auch in seiner Gestaltung. Während sich Lehrpläne der vorherigen Generation auf die zu unterrichtenden Inhalte beschränkten, werden im neuen Kerncurriculum – ganz im Zeichen der neuen Steuerung – die von den Schüler/innen zu erreichenden Ergebnisse beschrieben. Lernziele und Stoffinhalte werden im neuen Lehrplan durch fachliche, soziale und methodische Kompetenzen ersetzt. Der Unterricht soll dem Erwerb von überprüfbaren Kompetenzen dienen. Bei der Orientierung an Kompetenzen wird vom Ende des Lernprozesses her gedacht, womit sich der Akzent vom Lern-Input zum Leistungs-Output verschiebt (Höfer, Steffens, Diehl, Loleit & Maier, 2010).
Der Paradigmenwechsel, weg von der Input- hin zur Output-Steuerung, sowie die damit einhergehende Kompetenzorientierung stellt besondere Anforderungen an die Konstruktion von Aufgaben sowie an die Gestaltung von Lernumgebungen und erfordert dementsprechend auch angepasste Prüfungsformate (Pfitzner, 2014; Wittmann, 1998). Im Sinne der Kompetenzorientierung, zu verstehen als didaktisch-curriculare Leitidee, sollen sich Aufgaben im Unterricht nach den im Curriculum beschriebenen Kompetenzen richten bzw. diese entsprechend abbilden. In diesem Zusammenhang erhält die Lernumgebung sowie die sich darin zu entfaltende Lernaufgabe – zu verstehen als Medium der Steuerung einer kompetenzorientierten Unterrichtsentwicklung – einen besonderen Stellenwert. Lernaufgaben werden in der Regel aus dem Zieltyp des Lernens heraus entwickelt. Diese bilden verschiedene strukturierte Wege ab, wie sich bei den Schüler/innen der Lernprozess konstituiert und Lernbewegungen (Gruschka, 2011) in Gang gesetzt werden können.
Diese zumeist technokratisch begründeten Forderungen der Formulierung kompetenzorientierter Lernaufgaben und einer Konstruktion von Lernumgebungen, die sich an den Leitlinien einer neuen Lernkultur orientieren (Winter, 2008a), stellen für die Handelnden des Bildungssystems eine besondere Herausforderung dar, gilt es doch, etablierte Begriffe in ein neues Terminologieschema zu überführen und gleichzeitig der pädagogischen Substanz des Unterrichts gerecht zu werden.
1.2 Zentrale Fragestellung
Angesichts der dargestellten Entwicklungen im Bildungssystem und der Notwendigkeit, die Lernumgebung inklusive der damit verbundenen Aufgabenkonstruktionen an die veränderten Rahmenbedingungen des Mathematikunterrichts anzupassen, soll in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen werden, wie ein kompetenzorientierter und differenzierender Mathematikunterricht – basierend auf einer entsprechend konstruierten Lernumgebung – umgesetzt werden kann. Im Sinne des Buchtitels ‚Mathe kann man anfassen!’ (Johnson & Knuffinke, 2008) soll die Unterrichtsgestaltung an die Lebenswelt und Interessen der Kinder anknüpfen, Handlungsmöglichkeiten eröffnen und Freude am Entdecken mathematischer Strukturen vermitteln. Damit gerät eine ermöglichende Lernumgebung in den Blick, welche individuelle Voraussetzungen und Lernleistungen nicht nur berücksichtigt, sondern gezielt unterstützt. Sie bildet einen inhaltlichen Rahmen, in welchem vielfältige Lösungs- und Handlungsprozesse denkbar sind, die von den Schüler/innen genutzt werden können (Hirt & Wälti, 2014). Diese Fragestellung ist dabei dem Kerncurriculum für das Unterrichtsfach Mathematik in der Primarstufe verpflichtet.
1.3 Aufbau der Arbeit
Es handelt sich um eine Literaturarbeit, deren Ziel es ist, die theoretischen Überlegungen in unterrichtspraktische Implikationen zu überführen. Hierfür erfolgt in Kapitel 2.1 die theoretische Grundlegung zu den Veränderungen im Bildungssystem in der Zeit nach den großen Schulleistungsuntersuchungen. Dazu werden Bezugslinien zur Genese der Kompetenzentwicklung im Allgemeinen (Kap. 2.2) und der Kompetenzorientierung im Unterrichtsfach Mathematik im Speziellen hergestellt (Kap. 2.3). Weiterhin wird mit der Darstellung des Inhalts und der Entwicklung des Kerncurriculums des Bundeslands Hessen der curriculare Bezugsrahmen hergestellt (Kap. 2.4). Eine wesentliche Säule der vorliegenden Arbeit stellt das Kapitel 2.4 dar, in dem die Theorie des selbstregulierten Lernens erörtert und auf den Sachkontext Schule bezogen wird. Darauf aufbauend werden theoretische Ausführungen zur Konstruktion von kompetenzorientierten Lernumgebungen und Lernaufgaben vorgenommen (Kap. 2.5). Am Ende des zweiten Kapitels wird die Fragestellung aufgrund der theoretischen Vorüberlegungen konkretisiert (Kap. 2.6).
In Kapitel 3 werden im konsekutiven Stil theoretische Grundlagen erörtert, welche den Zusammenhang zwischen dem Problemlösen (Kap. 3.1), der Lernumgebung (Kap. 3.2) und dem Bilderbuch repräsentieren (Kap. 3.3). Die Konzentration auf die Problemlösekompetenz erfordert eine genauere Beleuchtung des Problemlöseprozesses (Kap. 3.4). Anschließend wird dieser auf die Lernumgebung und deren Merkmale überführt (Kap. 3.5). Ein wichtiger Aspekt für die Gestaltung der Lernumgebung ist das Bilderbuch mit seinen speziellen Funktionen und Merkmalen. Das Bilderbuch „Jan und Julia gehen einkaufen“ wird parallel dazu hinsichtlich dieser Merkmale geprüft und es werden Rückschlüsse zu den Wesenszügen einer Lernumgebung gezogen. Dabei wird die Betrachtung der Größe Geld unter didaktischen Gesichtspunkten und in Bezug auf das Bilderbuch „Jan und Julia gehen einkaufen“ fokussiert. In Kapitel 3.5 erfolgt die Konzeption der Lernumgebung mit dem Ziel der Weiterentwicklung der Problemlösekompetenz unter Berücksichtigung der bereits aufgeführten theoretischen Grundlagen. Zudem werden weitere Bestimmungsmerkmale wie der Einsatz von Materialien, die Zielgruppe und die Aufgaben aufgeführt.
In Kapitel 4 erfolgen eine Diskussion und ein Fazit, und zwar sowohl zu den theoretischen Überlegungen als auch zu den praktischen Implikationen. In Kapitel 5 wird ein Ausblick gegeben.
2 Theorie und Forschungsstand
2.1 Veränderungen im Bildungssystem
Wohl keine anderen Ergebnisse als jene der internationalen large scale Assessments haben die Bildungspolitik und die Schulentwicklung in den deutschsprachigen Ländern zuvor (und auch danach) in diesem Umfang beeinflusst. Trotz unterschiedlicher Resonanz führten die Befunde von TIMSS in den 1990er-Jahren und PISA ab 2000 zu einer umfänglichen Diskussion über Schulleistungen, Bildungschancen, Effizienz und Effektivität des Bildungssystems in der Öffentlichkeit, über die Bildungsadministration, die Bildungspolitik und die Bildungspraxis (Becker, 2013). Auch im Bundesland Hessen erfuhren die Ergebnisse der PISA-Studien aus den Jahren 2000, 2003 und 2006 große Aufmerksamkeit und schlugen sich in der Folge in entsprechenden bildungspolitischen Zielsetzungen nieder (Höfer et al., 2010).
PISA ist eine international vergleichende Schulleistungsstudie, die im Auftrag der OECD im Dreijahresrhythmus durchgeführt wird, um Aussagen über die Qualität und Effektivität von Bildungssystemen, d. h. „den kumulativen Ertrag von Bildungssystemen gegen Ende der Pflichtschulzeit“ (Deutsches PISA-Konsortium, 2000, S. 11), zu erheben (Becker, 2013). Die zum Teil kontrovers geführten Diskussionen um deren Ergebnisse, sowohl in der Bildungspolitik und Bildungsforschung als auch auf der Ebene der Einzelschulen, unterscheiden sich in den einzelnen Bundesländern maßgeblich (Moser, 2009), sodass im Folgenden eine wechselseitige Bezugnahme der jeweiligen Quellen als zulässig erscheint. Insbesondere die im internationalen Vergleich eher durchschnittlichen Testergebnisse in Mathematik und den Naturwissenschaften galten als problematisch. Dies bezieht sich insbesondere auf „den Anteil der Fünfzehnjährigen, die selbst die Minimalziele, die für einen Einstieg ins Berufsleben als unverzichtbar erachtet wurden, nicht erreichen konnten“ (Höfer et al., 2010, S. 2). Den Ergebnissen folgend sind die Jugendlichen oft nicht der Lage, „das Wissen, das sie in allgemeiner Form im Unterricht erworben hatten, in den anwendungsorientierten Tests der Studien (‚Literacy-Konzept‘) erfolgreich zur Problemlösung einzusetzen“ (Höfer et al., 2010, S. 3).
Auch wenn das Interesse an PISA in der Zwischenzeit deutlich zurückgegangen ist und in den Massenmedien nur noch beiläufig über die immer neuen Befunde aus den nachfolgenden Erhebungszyklen, aber auch über die verschiedenen wissenschaftlichen Re-Analysen bereits veröffentlichter Ergebnisse durch einschlägige Bildungsforscher (u. a. Baumert, Bos & Lehmann, 2000; Becker, 2013) in immer höherer Auflösung berichtet wird, hat PISA etwas Bleibendes hinterlassen: die Erkenntnis, dass das Bildungssystem offensichtlich nicht zu den erwünschten Ergebnissen bei allen Schüler/innen führt.
Mit dieser Wahrheit wurden jedoch nicht nur das Bildungssystem und die Einzelschulen selbst in relativer Härte konfrontiert. Die ausgeprägten sozialen und ethnischen Ungleichheiten in den PISA-Befunden führten auch dazu, dass diese Themen erneut in den Fokus entsprechender Wissenschaftsdisziplinen gerieten (z. B. der Soziologie). Sehr viel gravierender waren die Entwicklungen in den empirischen Bildungs- und Erziehungswissenschaften, die mit PISA von der „Illusion deutscher Wertarbeit“ (Buchhaas-Birkholz, 2010, S. 27) befreit wurden. Damit ist die sich in der Folge von PISA vollziehende empirische Wende (Roth, 1971; realistische Wende in der pädagogischen Forschung) in den Sozialwissenschaften gemeint. Borchert (2015) stellt in diesem Kontext fest, dass mit „dem sogenannten PISA-Schock die Empirische (sic!) Bildungsforschung – mit der Erziehungswissenschaft als Leitdisziplin – überhaupt erst wieder zur Beantwortung bildungspolitischer Fragen in das Blickfeld rückte“ (S. 129). Dies ist in Bezug auf die vorliegende Arbeit deshalb relevant, weil die empirische Bildungsforschung im historischen Forschungskontext betrachtet als Beratungswissenschaft für die Bildungspolitik über mehrere Jahrzehnte hinweg schlicht nicht zur Verfügung stand. In diesem Punkt unterscheiden sich die heute erfolgreichen PISA-Länder von den weniger erfolgreichen erheblich. Ihnen ist es einerseits gelungen, frühzeitig die strukturellen Rahmenbedingungen für eine empirisch validierte Leistungs- und Ertragsfeststellung zu etablieren und andererseits entsprechende Förderstrategien zu entwickeln, die eine empirische Wende nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Politik ermöglichten. So belegten die vorderen Plätze vor allem die Staaten (zumeist aus dem skandinavischen und angloamerikanischen Raum), bei denen das Learning Outcome systematisch überprüft wurde (Becker, 2013). Die angesprochenen Förderstrategien setzen eine entsprechend leistungsfähige empirische Bildungsforschung voraus und betreffen im Wesentlichen ein „sinnvoll aufeinander abgestimmtes System von regelmäßigen Schulevaluationen, von nationalen und internationalen Leistungsuntersuchungen, einer wissenschaftlichen, kontinuierlichen nationalen Bildungsberichterstattung sowie einer leistungsfähigen Bildungsstatistik“ (Luther, 2008, S. 26).
Mit dieser Abkehr von der dominierenden Input-Steuerung hin zu einer wissensbasierten und am Output orientierten Systemsteuerung wurde ein weichenstellender Paradigmenwechsel eingeleitet. Sind die Geschicke von Bildung im Schulsystem vorher ausschließlich durch Haushaltspläne, Lehrpläne und Rahmenrichtlinien, Ausbildungsbestimmungen für Lehrpersonen, Prüfungsrichtlinien und weiteren Input gesteuert worden (Klieme et al., 2007), sollte nun vielmehr der Output, das heißt die Leistungen der Schule, in den Blick genommen werden, d. h. insbesondere die Lernergebnisse. Nicht detaillierte Richtlinien und Regelungen, sondern die Definition von Zielen sowie deren Überprüfung sollten für Qualität sorgen. Auf der curricularen Ebene bedeutete dies, dass die bisher geltenden Stoffinhalte und Rahmenlehrpläne durch Lernziele für Schüler/innen sowie durch zu erreichende Leistungen der Schule abgelöst wurden. Kanada lässt sich als gutes Beispiel hierfür heranziehen. Trotz föderaler Strukturen wurden weit vor den ersten PISA-Untersuchungen flächendeckend nationale und internationale Assessment- und Indikatorprogramme eingeführt. In Verbindung mit einer modernen empirischen Bildungsforschung konnten die instrumentellen Grundlagen für eine politische Steuerung gelegt werden. Diesem Trend folgten die Länder im deutschsprachigen Raum mit einem 20-jährigen Zeitversatz, dessen Konsequenzen sich wie bereits beschrieben niederschlugen (Luther, 2008).
Eng verbunden mit diesem Paradigmenwechsel ist die Einführung sogenannter Bildungsstandards und in der Folge die Orientierung an Kompetenzen. Bildungsstandards formulieren Anforderungen an das Lehren und Lernen in Schulen und sie benennen Ziele für die pädagogische Arbeit. Sie definieren Maßstäbe, an denen die tatsächlichen Leistungen von Schülerinnen und Schülern gemessen werden können und somit das Learning Outcome erfasst und bewertet werden kann. Es werden allgemeine Bildungsziele aufgegriffen, an denen sich die Standards orientieren. Bildungsziele formulieren einerseits Erwartungen an die Entwicklung jeder Schülerin und jeden Schülers und verpflichten andererseits die Akteure des Bildungssystems, ihr Handeln an den Zielen auszurichten und entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen (Klieme et al., 2007). Die Ziele werden in Form von Kompetenzerwartungen konkretisiert. Bildungsstandards stützen sich hierbei auf Kompetenzmodelle, die jeweils unterschiedliche Niveaustufen beschreiben. Sie legen fest, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollen beziehungsweise welche Kompetenzstufe erreicht werden soll. Die Kompetenzen werden so konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt werden können. Mithilfe geeigneter Testverfahren kann das erreichte Kompetenzniveau schließlich erfasst werden (Klieme et al., 2007). Für die Entwicklung von Bildungsstandards und die damit angestrebte Qualitätssicherung und -entwicklung an Schulen sind die entsprechenden Beschreibungen von Bildungszielen, die Ausarbeitung von passfähigen Kompetenzmodellen und Aufgabenstellungen sowie geeigneter Testverfahren notwendig (Hummel & Borchert, 2015).
Gute Bildungsstandards müssen einigen Merkmalen genügen, um allen Beteiligten in den Schulen die verbindlichen Ziele und Kompetenzanforderungen möglichst eindeutig zu vermitteln. Klieme et al. (2007) nennt in diesem Zusammenhang die Fachlichkeit, Fokussierung, Kumulativität, Verbindlichkeit, Differenzierung, Verständlichkeit und Realisierbarkeit. Die in der Bundesrepublik von der Kultusministerkonferenz vorgelegten Bildungsstandards beziehen sich auf Kernbereiche des jeweiligen Unterrichtsfaches. Dabei werden sogenannte Basisqualifikationen formuliert, die anschlussfähiges Lernen ermöglichen. Die Bildungsstandards beziehen sich auf ein mittleres Anforderungsniveau, wobei die sogenannten Regelstandards die Kompetenzen beschreiben, die im Durchschnitt erreicht werden sollen (KMK, 2005a).
Damit erfüllen die nationalen Bildungsstandards im Wesentlichen die Überprüfungs- und Entwicklungsfunktion des Unterrichts. Einerseits wird das Erreichen der Bildungsstandards in internationalen Ländervergleichen und nationalen Vergleichsarbeiten überprüft. Andererseits sollen vorliegende empirische Daten systematisch genutzt werden, um den Unterricht weiterzuentwickeln (KMK, 2010). Bildungsstandards dienen der Qualitätssicherung schulischer Bildung, die auch Schulentwicklung sowie interne und externe Evaluation umfasst. Der Nutzen von Bildungsstandards für Lehrerinnen und Lehrer liegt in der Orientierung hinsichtlich Analyse, Planung und Überprüfung ihrer Unterrichtsarbeit. Schülerinnen und Schülern bieten sie eine Orientierung bezüglich der Leistungserwartungen. Neben der Orientierungsfunktion ist die Rückmeldefunktion von zentraler Bedeutung, die zur output-orientierten Steuerung beiträgt. Mithilfe von konkretisierten Testverfahren können Lernergebnisse festgestellt und bewertet werden. Dies ist die Basis zur Weiterentwicklung der Qualität von Schule und Unterricht. Lernergebnisse werden demnach auf zwei Ebenen empirisch erfasst: auf der Ebene des Systems („Bildungs-Monitoring“) und auf der Ebene der Einzelschule („Schulevaluation“). Sie werden den Betroffenen zurückgemeldet und dienen somit der Qualitätssicherung im Bildungssystem (Klieme et al., 2007).
In gleichem Maße wie die Bildungsstandards zu einer objektiven und vergleichbaren Messbarkeit der Leistungen von Lernenden auf fast allen Ebenen des Bildungssystems herangezogen werden (Primarbereich, Sekundarbereich, Tertiärbereich), so kritisch wird diese Form der Effizienz- und Effektivitätsdiagnose betrachtet. Diese Kritik, die im Wesentlichen aus PISA resultiert, richtet sich zum einen an die zunehmende Standardisierung nach ökonomischem Vorbild, welches sich immer auf „ein kleines, gut zu bezeichnendes, öffentlich hoch bewertetes Spektrum von drei Kompetenzen“ (Hentig, 2003, S. 222) bezieht. Nach Klein und Dungs (2010) „bündelt sich die Umstellung der Selbst- und Weltverhältnisse in eine semantische Zauberformel, mit der über zielscharfe Bedarfssteuerung die entgrenzte, risikobehaftete, spätmoderne Lage des Subjekts und seines kulturellen Raumes gemeistert werden soll“ (S. 11). Zum anderen wird die Messbarkeit von Bildung kritisiert, womit gleichsam die Demarkationslinie zwischen den Bildungsexperten und den Bildungs-Hardlinern markiert ist (Liessmann, 2014). Während die erstgenannten (u. a. Köller, 2008) davon ausgehen, dass es nichts gibt, was nicht messbar ist und sich somit auch Bildung der Messbarkeit nicht entziehen kann, sehen die zweitgenannten vor allem Probleme in der Vernachlässigung relevanter Bildungsdimensionen (Reichenbach, 2007). Der Vorwurf der mangelnden Berücksichtigung zielt vor allem auf die Operationalisierung der facettenreichen Dimensionen von Bildung und die Komplexität von Kompetenzen, die „sich so oder so ganz sicher nicht messen lassen würden“ (Reichenbach, 2007, S. 71).
2.2 Kompetenzen und Kompetenzentwicklung
Folgt man den Gedanken Bernsteins (1996), so ist das Konstrukt der Kompetenz bereits seit dem Sputnik-Schock und der Veröffentlichung des revolutionären Buches von Georg Picht (1965) mit dem Titel Die deutsche Bildungskatastrophe in diversen Sozialwissenschaften fest etabliert. Ob in der Linguistik als Sprachkompetenz (Chomsky, 1971), in der Motivationspsychologie als Kompetenz mit Voraussetzungscharakter zur Entwicklung grundlegender Fähigkeiten (White, 1959) oder der Ethnologie als kultureller Kompetenz (Levi-Strauss, 1975): Alle eint das anti-behavioristische Selbstverständnis (Reichenbach, 2007). Ende der 1970er-Jahre wurden diese Entwicklungen von Heinrich Roth (1971) aufgegriffen und in einen Begriffskanon überführt, der bis heute in den Sozialwissenschaften, bei sprachlichen Variierungen, ein hohes Maß an Gültigkeit besitzt. Die Rede ist von den vier Grundkompetenzen der personalen, aktivitätsbezogenen, fachlich-methodischen und sozialkommunikativen Kompetenz (Roth, 1971; Erpenbeck & Sauter, 2016). Wenn auch mit einer ambivalenten Attraktivität verbunden, erfuhr das Konstrukt der Kompetenz mit der Einführung nationaler Bildungsstandards, insbesondere im deutschsprachigen Raum, einen erneuten konjunkturellen Aufschwung. Jedoch sind sich Forscher, trotz der seitdem bestehenden Omnipräsenz des Kompetenzbegriffs in der Bildungslandschaft, über die genaue Bedeutung des Begriffs sowie dessen Verhältnismäßigkeit zu anderen Konstrukten nicht einig (Klieme & Hartig, 2008). Dies wurde auf eklatante Weise bei den PISA-Messungen deutlich, denen ein Konzept zugrunde liegt, „das die wichtigsten Ergebnisse der Kompetenzforschung der letzten zwei Jahrzehnte in skandalöser Weise vollständig ignoriert und einen Kompetenzbegriff benutzt, der mit Fachwissen und Fertigkeiten gleichgesetzt wird“ (Erpenbeck & Sauter, 2016, S. 9).
Exemplarisch kann hier die Diskussion herangezogen werden, wie sie durch Whites (1959) motivationspsychologischen und Chomskys (1971) linguistischen Ansatz geprägt wurde. Beide haben mit den Begrifflichkeiten Kompetenz und Performanz für viele weitere wissenschaftliche Disziplinen Entwicklungsanstöße gesetzt. Der theoretische Grundansatz bei Chomsky (1965) liegt jedoch nicht primär bei den Begriffen Kompetenz und Performanz:
We thus make a fundamental distinction between competence (the speaker-hearer’s knowledge of his language) and performance (the actual use of language in concrete situations). … A record of natural speech will show numerous false starts, deviations from rules, changes of plan in mid-course, and so on. The problem for the linguist, as well as for the child learning the language, is to determine from the data of performance the underlying system of rules that have been mastered by the speaker-hearer and that he puts to use in actual performance. (S. 4)
Chomsky (1965) begründete mit seinem Werk die generative Transformationsgrammatik als formalisierte Theorie, die sowohl die Basis zum Verständnis natürlicher als auch künstlicher Sprachen wurde. Wissenschaftstheoretisch ordnet man die als Standardtheorie von 1965 bezeichnete generative Transformationsgrammatik und die nachfolgenden Erweiterungen dem amerikanischen Strukturalismus zu. Unter anderem mit Bezug auf bildungstheoretische Standpunkte zur Kompetenz gibt es durchaus auch kritische Einwände zu Chomskys Formalisierung. Seine logischen Strukturen erklären Performanz mit dem grammatikalischen Regelwerk aus Kompetenz, aber nicht reflexiv Performanz aus Kompetenz. Anders ausgedrückt: Mit der theoretischen Position Chomskys würde Leistung keine Rückwirkungen auf Kompetenz haben (Stegmüller, 1986). Wenn die strukturalistischen Positionen Chomskys sich vom strukturalistischen Theorienkonzept (in Deutschland u. a.) unterscheiden, so bleibt der gemeinsame Kerngedanke eine Umsetzung der Theorie in logische Strukturen.
Als Essenz dieser Entwicklungen kann entnommen werden, dass es sich bei der Kompetenzorientierung keineswegs um ‚alten Wein in neuen Schläuchen’ handelt. Sie ist auch nicht als Alternative zur Lernzielorientierung der Vergangenheit zu betrachten, sondern versteht sich als Fortführung derselbigen mit dem Unterschied, dass der Fokus in stärkerem Maße als bisher auf den Lernenden als Individuum fällt (Trendel, 2013). Die Kompetenzorientierung ist damit als Perspektivwechsel im besten Sinne des Wortes aufzufassen:
Kompetenzorientierung beschreibt im fachlichen Bereich damit die Anforderung, Lernende in die Lage zu versetzen, mit dem Gelernten in persönlichen und in gesellschaftlichen Zusammenhängen etwas anfangen zu können und zu wollen. Kompetenzorientierung als didaktisches Prinzip erfordert dann, die Lernprozesse so zu planen und zu gestalten, dass Kompetenzen von allen Lernenden möglichst weit entwickelt werden können. (Trendel, 2013, S. 2)
Diese veränderte Perspektive ist in allen deutschen Bundesländern in eine Lehrplangeneration geronnen, welche mehr oder weniger genau beschreibt, „welches Wissen und Können Lernende am Ende eines bestimmten Bildungsabschnittes in der Regel besitzen sollen (Output oder Outcome)“ (Trendel, 2013, S. 2). Damit werden normativ vorgegebene Bildungsziele entsprechend operationalisiert, nach Kompetenzbereichen differenziert und in der Beschreibung inhaltlicher Ziele konkretisiert.
Bezieht man diese Ausführungen auf die Selbstbestimmungstheorie (SBT) nach Deci und Ryan (1993), zu verstehen als Metatheorie der Humanontogenese menschlichen Verhaltens und Handelns, fallen vor allem die mit ihr korrespondierenden Themen in den Blick. Ohne die Theorie an dieser Stelle vollständig ausrollen zu wollen, trifft dies im Kontext einer sich verändernden Lernkultur und der beschriebenen Orientierung an Kompetenzen und Standards im Kontext von Schule auf die in der Theorie verankerten psychologischen Grundbedürfnisse zu (Deci & Ryan, 2004).
Deci und Ryan (1993) gehen von der Annahme aus, dass der Mensch sich stetig entwickelt und in diesem Prozess die psychologischen Bedürfnisse, grundlegenden Fähigkeiten und Interessen eine zentrale Rolle einnehmen. Im Besonderen fungieren die psychologischen Bedürfnisse als energetische Grundlage für Alltagshandlungen sowie die intrinsische und extrinsische Motivation. Konkret wird in diesem Kontext das Bedürfnis nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit als wesentlich für das menschliche Verhalten benannt (Deci & Ryan, 2004). Deci und Ryan (2004) gehen davon aus, dass das Individuum stets seine Bedürfnisse befriedigen und als eigenständiger Initiator seines kompetenten Handelns gesehen werden möchte, der sich überdies in eine soziale Umgebung eingebunden fühlt. Die Autoren gehen also von einer angeborenen motivationalen Tendenz dahin gehend aus, dass der Mensch sich mit anderen Personen in einem sozialen Milieu umgibt, sich wohlfühlt und lernt, in diesem Milieu persönlich, autonom und initiativ zu wirken (Deci & Ryan, 1993). Übertragen auf das Kernthema dieser Arbeit bedeutet dies, dass in einem kompetenzorientierten Unterrichtssetting auch diese drei psychologischen Grundbedürfnisse Berücksichtigung finden müssen. Dies gilt es, bei der Konstruktion von Lern- und Prüfungsaufgaben im Fach Mathematik der Primarstufe zu berücksichtigen.
2.3 Kompetenzorientierung in der Mathematik der Primarstufe
Zu Beginn der bildungspolitischen Diskussion um die Erstellung von fachspezifischen Bildungsstandards standen mit Blick auf die PISA-Ergebnisse die Fächer Deutsch, Mathematik und die erste Fremdsprache, ergänzt um weitere naturwissenschaftliche Fächer, im Vordergrund. Jedoch sind die verstärkten Forderungen einer Kompetenzorientierung im bzw. ist eine grundlegende Reform des Mathematikunterrichts nicht erst mit PISA auf den Plan getreten (Hübner, Kögel & Wunder, 2014). Bereits mit der TIMSS-Studie – deren Planung in den frühen 1990er-Jahren begann – sowie den vorausgehenden Studien ohne deutsche Beteiligung (u. a. First International Mathematics Study, FIMS; Second International Mathematics Study, SIMS) wurde zunehmend eine kontinuierliche Bildungsberichterstattung durch Leistungsüberprüfung mittels standardisierter Methoden betrieben und der empirischen Wende – weg von einer geisteswissenschaftlichen Ausrichtung in der Bildungswissenschaft, hin zu einer empirischen Bildungsforschung – Rechnung getragen (Buchhaas-Birkholz, 2010).
Auf die Unterrichtsentwicklung im Fach Mathematik, bei der vergleichsweise früh die Kompetenzentwicklung durch die Formulierung nationaler Bildungsstandards an spezifischen Schnittstellen des Bildungssystems (Primarbereich; mittlerer Schulabschluss) als verbindliches Kriterium zur Steuerung von Bildungsprozessen tatsächlich mitgedacht wurde (Klieme et al., 2007), hat sich dies dahin gehend ausgewirkt, als in Bezug auf die Beschreibung (allgemeiner) mathematischer Kompetenzen die Begrifflichkeiten Darstellen von Mathematik, Kommunizieren, Argumentieren usw. fest in das Vokabular der Curricular übergegangen sind (siehe Abbildung 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1. Konkretisierung allgemeiner mathematischer Kompetenzen (entnommen aus KMK, 2004, S. 7 f.)
Es gilt als Konsens, dass die in Abbildung 1 dargestellten allgemeinen mathematischen Kompetenzen am Ende der Jahrgangsstufe 4 „von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Nutzung und Aneignung von Mathematik sind“ (KMK, 2004, S. 7). Damit soll eine „kontinuierliche Verbesserung des Mathematikunterrichts erreicht werden“ (Walther, Heuvel-Panhuizen, Granzer & Köller, 2016, S. 19). Im Detail werden diese inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen seitens der KMK wie in Tabelle 1 konkretisiert.
Tab. 1. Konkretisierung allgemeiner mathematischer Kompetenzen (entnommen aus KMK, 2004, S. 7-8)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese standardbezogenen Festlegungen und Konkretisierungen beziehen sich jedoch nicht nur auf die Prozesskompetenzen (u. a. Handeln mit mathematischen Gegenständen), sondern auch auf das grundlegende Wissen und Können im Mathematikunterricht (Bausch, Pinkernell & Schmitt, 2013). Um den Schüler/innen ein grundlegendes Verständnis von wichtigen Termini und Verfahrensweisen der Mathematik sowie „den vernetzten Charakter der Mathematik“ (Walther et al., 2016, S. 19) zu vermitteln, legte die KMK (2004) Standards für inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen fest, die sich an mathematischen Leitideen orientieren (siehe Abbildung 2). Seitens der OECD (2016) wurde in Bezug auf das Fach Mathematik damit intendiert, die Grenzen der traditionellen curricularen Teilgebiete (Arithmetik, Geometrie, Größen, Sachrechnen & Stochastik) aufzuheben. Dem folgend treten einzelne Teilgebiete nicht als eigene Leitidee auf, sondern finden sich integriert in verschiedenen Leitideen wieder. In diesem Konstatieren Walther et al. (2016) wie folgt:
Die mathematische Grundbildung für Schülerinnen und Schüler hängt also wesentlich davon ab, in welchem Maße im Unterricht Anlässe geschaffen werden, selbst oder gemeinsam Probleme mathematisch zu lösen, über das Verstehen und das Lösen von Aufgaben zu kommunizieren, über das Zutreffen von Vermutungen oder über mathematische Zusammenhänge zu argumentieren, Sachsituationen in der Sprache der Mathematik zu modellieren und für die Bearbeitung von Problemen geeignete Darstellungen zu ersinnen oder auszuwählen. (S. 20)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2. Allgemeine und inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen und Leitideen (entnommen aus KMK, 2004, S. 8)
Die dargestellten Leitideen und inhaltsbezogenen Kompetenzen sind auf das Engste verbunden mit den seitens der KMK (2005b) definierten Anforderungsbereichen I, II und III (siehe Tabelle 2). Diese erlauben „eine erfahrungsbasierte Einschätzung von Aufgaben hinsichtlich Angemessenheit, Qualität und Komplexität der von Schülerinnen und Schülern zu erbringenden Leistungen“ (Walther et al., 2016, S. 21) und entsprechen der Idee einer neuen Lernkultur, die einer Anhäufung „toten Wissens“ (Erpenbeck & Sauter, 2016, S. 7) entgegenwirkt. Dahinter verbirgt sich die paradigmatische Grundidee, Wissen präsent und abrufbar zu halten, um es in notwendigen Situationen mobilisieren zu können.
Tab. 2. Anforderungsbereiche Mathematik (entnommen aus KMK, 2005b, S. 13; Walther et al., 2016, S. 21)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.4 Inhalt und Genese des neuen Kerncurriculums für Hessen
Die in den Kapiteln 2.1 bis 2.3 beschriebenen Entwicklungen haben sich letztlich in Bemühungen und Beschlüssen der KMK niedergeschlagen, die Schulsystemsteuerung grundlegend zu reformieren bzw. Impulse zur Qualitätsentwicklung von Mathematikunterricht zu setzen (KMK, 2002). Dies betrifft alle Bundesländer ausnahmslos, sodass sich in den unterschiedlichen Curricula entsprechende Formulierungen finden. Auch im Bundesland Hessen wurden die Beschlüsse der KMK als verpflichtend für die Entwicklung respektive Weiterentwicklung der Kerncurricula übernommen. Dem Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) obliegt die Verantwortung, die vorliegenden KMK-Standards anzuwenden und zu implementieren. Hierzu wurden verschiedene Richtungsentscheidungen getroffen, die im Folgenden dargestellt sind:
- „Bildungsstandards werden nicht nur für die von der KMK ausgewählten, sondern für alle Unterrichtsfächer des Primar- und Sekundarstufe I-Bereichs – längerfristig auch für die Sekundarstufe II – erarbeitet.
- In allen Fächern werden den Standards ergänzende inhaltliche Festlegungen (in Form von Inhaltsfeldern) beigefügt.
- Das hessische Konzept ‚Bildungsstandards und Inhaltsfelder – Das neue Kerncurriculum für Hessen‘ ist auf eine konsistente Kompetenzorientierung ausgerichtet.
- Ihm liegt das Modell eines kumulativen Kompetenzaufbaus von Jahrgangsstufe 1 bis 10 zugrunde.
- Bildungsstandards und Inhaltsfelder werden für alle Fächer, Schulstufen und Bildungsgänge in einem einheitlichen Format verfasst.
- Sie sind kurzgefasst und auf die zentralen Aspekte eines Faches fokussiert.
- Ihnen liegt eine einheitliche Begriffsverwendung zugrunde.“ (Höfer et al., 2010, S. 7)
Der Konzeption des Kerncurriculums liegt der Kompetenzbegriff nach Weinert (2001) zugrunde. Dieser „sieht in den bestehenden und erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Individuums sowie dessen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften die Grundlage individueller Kompetenzen“ (Höfer et al., 2010, S. 8). Diese sind der Herausforderung verpflichtet, Probleme unter Anwendung individuell verfügbarer Strategien erfolgreich lösen zu können und verhaltenswirksam mit den Lösungen umzugehen. Zudem orientiert sich der Kompetenzbegriff im Kerncurriculum Hessen am Ansatz Lersch’s (2007), der Kompetenzen als „kognitiv verankerte Dispositionen für erfolgreiche und verantwortliche Denkoperationen und Handlungen“ (Höfer et al., 2010, S. 8) sieht. Das Kerncurriculum sieht einen systematisch gestuften fachlichen und überfachlichen Kompetenzaufbau der Schüler/innen über den je individuellen Bildungsgang hinweg vor. Dabei sind die von der KMK definierten Standards in Hessen – im Vergleich zu den Curricular anderer Bundesländer (z. B. Rahmenlehrplan Berlin/Brandenburg, 2016) – inhaltsunabhängig formuliert. Damit bricht das Kerncurriculum Hessen nicht nur mit den von der KMK formulierten Bildungsstandards, welche „fachliche Kompetenzen mit inhaltlichen Bezügen“ (Höfer et al., 2010, S. 9) aufweisen, sondern auch mit den theoretischen Annahmen zur Kompetenzentwicklung. Letztere verweisen darauf, dass sich Kompetenzentwicklung immer an einem (Lern-)Gegenstand festmacht (Erpenbeck & Sauter, 2016). Anstelle dessen werden in jedem Fach Inhaltsfelder beschrieben, „in denen wesentliche inhaltliche Zusammenhänge dargestellt sind, die sich an den grundlegenden inhaltlichen Konzepten des jeweiligen Faches ausrichten“ (Höfer et al., 2010, S. 9). Eine entsprechende Konkretisierung sollen Inhaltsfelder dann in der Einzelschule in Form der Erarbeitung schulinterner Curricula (SCHiC) erfahren. Durch die offenen curricularen Vorgaben wird die Schule als pädagogische Handlungseinheit betont und deren Autonomie in den Vordergrund von Schulentwicklung gestellt (LISUM, 2016).
An dieser Stelle ist in Bezug auf den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit eine Schlüsselstelle zu markieren. Denn auf die Frage, wie differenziert und kompetenzorientiert Mathematik in der Primarstufe unterrichtet werden kann, hat das Kerncurriculum an sich keine konkreten Antworten. Diese Fragen müssen auf Ebene der Einzelschule beantwortet werden, wofür der Rahmenlehrplan letztlich ausreichenden juristischen und inhaltlichen Spielraum – im Sinne der Autonomie der Einzelschule – lässt. Nur über die jahrgangsbezogene Aufarbeitung und Zuordnung der Inhalte des Kerncurriculums durch die Fachkonferenzen kann einer stärkeren Kompetenzorientierung Rechnung getragen werden. Das Kerncurriculum Hessen bietet mit der Beschreibung von Bildungsstandards und Inhaltsfeldern ein entsprechendes Grundmuster, welche die wesentlichen Ziele der pädagogischen Arbeit – im Sinne eines kumulativen Kompetenzaufbaus – abstecken und über die SCHiC eine entsprechende Konkretisierung erfahren. Dabei sind die Standards so dargestellt, „dass der Könnensstand trennscharf formuliert ist und dass der Ausprägungsgrad einer Kompetenz erkennbar und – gegebenenfalls auch in einer empirischen Überprüfung – nachweisbar ist“ (Höfer et al., 2010, S. 9).
2.5 Selbstreguliertes Lernen
Bevor die Theorie des selbstregulierten Lernens im Detail besprochen wird, erscheint es dem Autor notwendig und zielführend, die häufig vermischten Begrifflichkeiten des selbstbestimmten Lernens von denen des selbstregulierten und selbstgesteuerten Lernens abzugrenzen. Bereits Weinert (1982) konstatiert, dass in pädagogischen Diskussionen offensichtlich jeder weiß, was gemeint ist, wenn das ‚Selbst’ im Kontext von Lernen thematisiert wird. Dabei ist dieses Begriffspaar nicht erst mit PISA ins Gespräch gekommen. Konkret wird moniert, dass die Begriffe mit Selbst unscharf wären, weil sie auf unterschiedliche Denkgebäude zurückgreifen. Während das selbstbestimmte Lernen – als eine der möglichen Ausprägungen – beinahe selbsterklärend als Gegenpol zum fremdbestimmten Lernen identifiziert werden kann und den konstruktiven Teil des Lehr-Lern-Prozesses (Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung), d. h. die Perspektive des Lernenden, in starkem Maße betont (Faulstich, 2003) sowie die emanzipatorische Leitidee der progressiven Pädagogik darstellt (Siebert, 2009), ist die Abgrenzung zum selbstgesteuerten und selbstregulierten Lernen nicht ganz so deutlich zu treffen. Weinert (1982) warnt davor, dass der Begriff des selbstgesteuerten Lernens Gefahr liefe, „zu einem vieldeutigen, schillernden und ideologieanfälligen Schlagwort zu werden“ (S. 99).
Seinen Ursprung hat dieser im Weimarer Paradigmenstreit („extensive Wissensvermittlung“ vs. „intensive Auseinandersetzung“) und er erlebte – oft auf Umwegen – in sozialhistorischen Kontexten sowie in modernisierter Technologie immer wieder eine (Re-)Thematisierung (Siebert, 2009). In den 1970er-Jahren wurde das Selbst dann als Gegenentwurf zur Verschulung gesehen und mit verschiedenen anderen Begrifflichkeiten ‚gepaart’. In pädagogischen Zusammenhängen sind in diesem Kontext die Selbstverwirklichung (Befreiung aus entmündigten und entfremdenden Strukturen), die Selbsterfahrung (didaktisches Programm eines Lernens in Gesinnungsgemeinschaften) sowie die Selbstorganisation (als Alternative zu den verfestigten bürokratischen Strukturen des öffentlichen Bildungssystems) zu nennen (Siebert, 2009). Betrachtet man die Entwicklungen ab Mitte der 1990er-Jahre, in denen der Programmbegriff des selbstgesteuerten Lernens insbesondere im Zusammenhang mit der globalen Weiterbildungskampagne (Dohmen, 1997), der damit eng verknüpften Etablierung des Begriffs des lebenslangen Lernens (Knoll, 1997) sowie dem computergestützten Lernen beinahe flächendeckend über die gesamte Bildungslandschaft verteilt auftrat, sind die mehr als 35 Jahre zurückliegenden Vorbehalte Weinerts (1982) im Post-PISA-Zeitalter immer noch nachvollziehbar und mit Blick auf die Einzelschule wohl als überwiegend zutreffend einzustufen. Als normative Setzung gilt, dass der Begriff des selbstgesteuerten Lernens grundsätzlich nur in Verbindung mit dem Konzept der Selbstregulation nach Bandura (2004) zu betrachten ist. Ohne die Tür in die Theorie der sozialkognitiven Lerntheorie Banduras allzu weit aufzustoßen (Selbstregulation als terminologische Trias aus Selbstbeobachtung, Selbstbewertung und Selbstreaktion), lässt sich festhalten, dass das selbstgesteuerte Lernen aus kybernetischer Sicht als Extension des selbstregulierten Lernens gesehen werden kann. Demnach bezeichnet Regulation „die Fähigkeit eines Systems, das eigene Verhalten einem vorgegebenen Zielwert anzugleichen“ (Levin & Arnold, 2006, S. 206). In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Definitionen, welche in Teilen beide Begriffe (selbstgesteuertes und selbstreguliertes Lernen) terminologisch und programmatisch vermischen (u. a. Friedrich & Mandl, 1997; Schiefele & Pekrun, 1996; Zimmerman, 2000). Perels (2011) folgend und diese terminologische Unschärfe überwindend werden in Tabelle 3 gemeinsame Nenner identifiziert:
Tab. 3. Komponenten selbstregulierten Lernens (Quelle: Eigene Darstellung nach Perels, 2011)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Darüber hinaus ist die als konsensfähig geltende eher klassische Definition Knowles (1975) zu nennen, welche das selbstgesteuerte Lernen wie folgt umreißt:
In its broadest meaning, ,self-directed learning’ describes a process in which individual stake the initiative, with or without the help of others, in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying human and material resources for learning, choosing and implementing appopriate learning strategies, and evaluating learning outcomes. (S. 18)
Diese Definition gilt deshalb als konsensual, weil sie verschiedene ‚Freiheitsgrade’ der Selbststeuerung des Lernens bedient. Nach Gnahs (2006) lassen sich in diesem Kontext „die Entscheidung für Lernprojekte, die Prioritäten der Lernbedürfnisse und Interessen, die Begründung der Lernziele, der Nutzung der Lernmedien und Lernhilfen, der Bevorzugung von Lernstilen und Lernstrategien sowie in der Bewertung der Lernergebnisse“ (S. 62) als konstituierende Elemente eines selbstgesteuerten Lernprozesses hervorheben. Diese Facetten werden zum Teil mit dem Ansatz des problembasierten Lernens eingelöst, welches sich auf entwicklungspsychologische, denkpsychologische und praktisch-didaktische Aspekte des Lernens stützt (Oerter, 1971). In der Literatur finden sich zahlreiche Hinweise auf die diametralen Positionen, die sich im Modell vereinen (u. a. Jeisy, 2013; Reusser, 2005). Die auf Dewey (1910, zitiert nach Reusser, 2005) basierenden Ansichten sprechen vom entdeckenden Lernen. Im deutschen Sprachraum hingegen wird mit der Ausrichtung auf komplexe Probleme auch vom forschenden Lernen gesprochen. Konsens besteht dahin gehend, dass beim Modell des Problemlösens das Ziel weitestgehend vorgegeben bzw. mit den Lernenden gemeinsam vereinbart wird, der Weg zum verfolgten Ergebnis jedoch offensteht. Dörner (1994) sieht als Bedingung für das Problemlösen die Wahrnehmung eines vorhandenen Istzustandes und eines gewünschten Sollzustandes. Voraussetzung für das problembasierte Lernen ist, dass die Differenz von Ist- und Sollzustand von den Lernenden als Problem bzw. als unerwünschter Zustand empfunden wird (Jeisy, 2014). Voraussetzung dafür ist eine hohe Strukturisomorphie (strukturelle Gleichgestaltung) der Problemstellung. Erpenbeck und Sauter (2016) sprechen in diesem Kontext von einer „emotionalen Imprägnierung“ (S. 26), was bedeutet, dass ein Problem erst dann auch von den Schüler/innen als ein solches wahrgenommen wird, wenn dieses eine emotionale Durchdringung erfahren hat. Der Prozess der Lösungsfindung stellt den Kern des problembasierten Lernens dar. Wie das Problem gelöst werden kann, liegt in der Verantwortung der Lernenden. Die Lösungsstrategien müssen von den Lernenden erprobt und getestet werden. Aufgrund des Vergleichs des erwünschten und des tatsächlichen Outcomes müssen die Lösungswege angepasst werden. Es soll dabei immer eine Rückkopplung mit der Umwelt stattfinden (Jeisy, 2014). Aufgrund der hohen Eigeninitiative, die bei einer problembasierten Aufgabe von den Lernenden verlangt wird, sind eine klare Planung und Strukturierung des Unterrichts im Voraus eingeschränkt. Die zentrale Idee des Problemlösens besteht darin, bestehendes Wissen zu vernetzen und die Strukturen des Wissensnetzes zu verdichten (Wackermann, 2008). Es sollen ein Transfer zur Umwelt sowie eine Generalisierung der Ergebnisse stattfinden. Das vorausgesetzte Wissen zur Lösung des Problems müssen die Lernenden bereits mitbringen. Im Gegensatz zu naturwissenschaftlich geprägten Unterrichtsfächern (z. B. Physik), in denen nach Jeisy (2014) „meist gut strukturierte (well-structured) Probleme zu algorithmischen Lösungen führen“ (S. 237), finden sich z. B. in musischen, ästhetisch-künstlerischen Fächern, aber auch im Sportunterricht, in der Regel schlecht strukturierte komplexe Probleme (ill-structured), die heuristische Lösungsstrategien erfordern und hohe Anforderungen an die Lernenden stellen. Im Falle eines ungenügenden Wissensstandes in Bezug auf die betreffende Aufgabe müssen spezifische Handlungsanweisungen der Lehrperson den Prozess unterstützen. Der Auffassung Osers und Patrys (1990) folgend sollen anhand dieses Basismodells lösungsorientiertes Denken und Handeln gefördert werden. Die Struktur des Lernprozesses steht jedoch offen.
In diesem Kontext werden Unterrichtsformen oder methodische Zugänge bedeutsam, bei denen der Lernende die wesentlichen Entscheidungen, wann, wo und wie gelernt wird, selbst beeinflussen kann (Friedrich & Mandl, 1992). Im Kontext von Schule stellt sich die Frage, welche schulischen Handlungsspielräume für den Lernenden in einer postmodernen, multikulturellen Bildungslandschaft tatsächlich zur Verfügung stehen, selbstgesteuert Lernziele, Lernzeiten und Lernmethoden festzulegen. Ohne Zweifel steht im Mittelpunkt eines selbstgesteuerten Lernprozesses das Ziel, den Lernenden das Lernen selbst beizubringen, d. h., Lernende zu befähigen, „sich relevante Ziele zu setzen, Informationen mit geeigneten Strategien aufzunehmen und zu verarbeiten … den Lernprozess zu planen, zu überwachen“ (Killus, o. J., o. S.). Dazu gehört es auch – im Sinne der Selbstregulation –, das eigene Lernverhalten dem Lernfortschritt anzupassen und Unterstützungsmöglichkeiten effizient einzusetzen.
Den Überlegungen Friedrich und Mandl (1992) folgend kann zwischen Primär- und Stützstrategien unterschieden werden:
Mit Primärstrategien sind kognitive Lernstrategien gemeint, die direkt auf die zu erwerbende und zu verarbeitende Information einwirken, so dass diese besser aufgenommen und verarbeitet werden kann. Demgegenüber beeinflussen Stützstrategien diesen Prozess indirekt, indem sie ihn in Gang setzen, aufrechterhalten und steuern. Beispiele für Stützstrategien sind metakognitive und motivationale Lernstrategien sowie solche, die sich auf die Bereitstellung und Inanspruchnahme externer Ressourcen beziehen. (S. 4)
Dabei sind die primär und sekundär wirkenden Strategien des selbstgesteuerten Lernens auf das Engste verbunden mit den kognitiven, metakognitiven und motivationalen Lernstrategien. Die Sekundärstrategien werden ergänzt um die ressourcenbezogenen Strategien (siehe Tabelle 4).
Tab. 4. Am erfolgreichen selbstgesteuerten Lernen beteiligte Lernstrategien (Quelle: Eigene Darstellung nach Killus, o. J.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Während es sich bei den Memorierungsstrategien um einfach strukturierte Lerntätigkeiten handelt, bei denen vor allem die oberflächliche Informationsverarbeitung im Vordergrund steht, betonen die Elaborations-, Organisations- bzw. Transferstrategien komplexere kognitive Lernstrategien, die auf ein tieferes Verständnis des Lernstoffes ausgerichtet sind (Levin & Arnold, 2006). Differierend dazu ist dies bei den Sekundärstrategien gelagert, die hinsichtlich ihrer Wirkungsweise verschachtelt sind und aufeinander Bezug nehmen. Demnach beschreiben metakognitive Lernstrategien Vorgänge der Planung (Analyse und Formulierung von (Teil-)Zielen), der Überwachung (Überprüfung des Lernverlaufs, des Lernfortschritts und Identifikation von Schwierigkeiten) sowie des Regulierens (Reaktion auf die vorangegangene Einschätzung des Lernverlaufs) und setzen damit den lernpraktischen Anker, wenn der Erwerb von Kompetenzen thematisiert wird. Die metakognitiven Lernstrategien sind jedoch stark von den motivationalen, d. h. intrinsischen, Prozessen und Ressourcen sowie den externen Ressourcen abhängig, die das learning outcome maßgeblich beeinflussen. Lernstrategien sind demnach immer auch im situativen Kontext zu betrachten, der im Wesentlichen von der Konstruktion von Aufgaben, den Bedingungen des jeweiligen Lernsettings sowie den Einstellungen des Lernenden zum Lernen selbst abhängt. In diesem Zusammenhang wird vor allem für den Lehrenden virulent, dass er in der Lage sein muss, verschiedene, interdependente Strategien anwenden und miteinander verknüpfen zu können. Im Zentrum dieser Überlegungen steht dabei die Notwendigkeit, die Strategien nicht nur zu kennen und unterrichtspraktisch wirksam zu machen, sondern die Lernenden auch dazu zu befähigen, diese Strategien im Sinne eines effizienten Kompetenzerwerbs planvoll auswählen und einsetzen zu können (Killus, o. J.).
Artelt (2000) konstatiert in diesem Zusammenhang, dass der Erwerb von Lernstrategien im bundesdeutschen Schulsystem eher implizit erfolgt und die absichtsvolle Nutzung von Lernstrategien erst zum Ende der Sekundarstufe handlungswirksam wird. Nach Baumert und Köller (1996) hat dies dann geringe kompensatorische Effekte, sie verweisen jedoch auf das Lernstrategiewissen als Optimierungsbedingung.
In Bezug auf die konkrete unterrichtspraktische Umsetzung respektive die Förderung selbstgesteuerten Lernens im Sinne der Kompetenzorientierung lässt sich auf die Selbstregulationstheorie von Zimmermann (2000) verweisen, welche drei Phasen beinhaltet, die nacheinander durchlaufen werden:
1. Zielsetzung und Planung: Formulierung von Zielen und Auswahl sowie Erwerb von Lernstrategien und Arbeitstechniken.
2. Handlungs- und volitionale Kontrolle: Monitoring und Verhaltenskontrolle.
3. Selbstreflexion: Evaluation der erreichten Ergebnisse und ggf. Anpassung der Lernstrategie hinsichtlich der variablen Verfügbarkeit für zukünftige Lernepisoden.
Bringt man Zimmermanns Theorie im Kontext von Schule zur Anwendung, so werden schnell Bezugslinien zum erziehungswissenschaftlichen Konzept des reflexiven Lernens nach Dewey (1938) und Schön (1983) deutlich. Beide haben den spezifischen Zusammenhang „zwischen der eigenen Erfahrung, der gezielten Reflexion und der kommunikativen Interaktion für das Lernen herausgestellt“ (Serwe-Pandrick, 2013, S. 100). Produktive leistungsförderliche Reflexivität setzt kognitive Aktivität und gezielte kognitive Aktivierung durch Kontexte und Kopplungen voraus. An dieser Stelle fällt dem Lehrenden die Rolle eines Lernberaters zu, der Lerngelegenheiten schaffen und den Lernprozess in sinnvolle und sinnstiftende Lernsettings einbetten muss. In Bezug auf den Lernenden spricht Kirchhöfer (2004) vom reflexiv handelnden Subjekt, welches er wie folgt beschreibt:
Reflexiv handelndes Subjekt bezeichnet ein Individuum, das nicht mehr durch direkt oder indirekt externe Anforderungen und Möglichkeiten bestimmt wird, sondern durch eine hohe Reflexivität gegenüber den strukturellen Umweltbedingungen und durch Selbstreflexivität gegenüber den eigenen Lebensbedingungen, -prozessen und -entwürfen und den darin enthaltenen Handlungsproblemen, -konflikten und -dilemmata. (S. 44)
Die Vorgänge des Reflektierens, der Selbstreflexion, der Selbstorganisation und Selbststeuerung nehmen in diesem Zusammenhang eine wesentliche Position ein, markieren gleichzeitig aber auch Grenzen. Es gibt viele gewichtige gute Gründe dafür, dass reflexives Lernen als eine wesentliche Bedingung für das Entstehen eines bildenden Lernens verstanden wird (Lederer, 2014). „Reflexivität, so die hier vertretene These, ist diejenige intellektuelle Qualität und Kapazität, die Bildung im Sinne einer Bedingung der Möglichkeit erst konstituiert, zumindest aber mitkonstituiert“ (Lederer, 2014, S. 583). Die große Wertschätzung der Reflexivität für ein bildendes Lernen schlägt sich auch darin nieder, dass in den Bildungswissenschaften Anstrengungen zur theoretischen Modellbildung für die systematische Analyse und Förderung von Reflexionen beim Lernen unternommen werden. Diese schlagen sich in verschiedenen Stufenmodellen des Reflektierens nieder (u. a. Hartmann, 2005). Für das Fördern des Reflektierens werden in der beruflichen Bildung ‚Reflexionswerkstätten’ erprobt und Konzepte für ein ‚Reflexionstraining’ entwickelt. Wesentlich erscheint im Rahmen dieser Stufungen die Differenz zwischen dem Reflektieren beim Handeln und dem Reflektieren über das Handeln unter Einbeziehung unterschiedlicher Wissensformen (Schön, 1983). Diese unterschiedlichen Stufen des selbstgesteuerten Lernens werden von Merziger (2007) wie folgt ausgeformt:
1. Abhängigkeit von Instruktion und Fremdsteuerung
2. Geringe Selbstständigkeit bei starker Abhängigkeit von Fremdsteuerung
3. Dominanz der Selbststeuerung
4. Planvolles Zusammenspiel von Selbst- und Fremdsteuerung
5. Reflexives Zusammenspiel von Selbst- und Fremdsteuerung
Aufgabe des Lehrenden muss es sein, den Erwerb von Strategien des selbstgesteuerten Lernens aufseiten der Lernenden anzubahnen und entsprechende Unterrichtssituationen dafür nutzbar zu machen. Hier fällt der Blick vor allem auf Arbeitsformen mit Phasen des projektorientierten Arbeitens inklusive abschließender Präsentation der Arbeitsergebnisse, Freiarbeitsphasen, die eng mit einem dazugehörigen Wochenplan verknüpft sind, Stationslernen sowie differenzierter und individualisierter Aufgabenstellungen. Diese Formen des Lernens respektive diese besonderen Lehr-Lern-Arrangements sind eng verknüpft mit der Dokumentation des Lernprozesses sowie der Präsentation der Lernergebnisse. Beides zusammengenommen kann eine differenzierte Auskunft über den Erwerbsstatus der Lernkompetenz geben (Bohl, 2009). Allerdings ist zu beachten, dass diese Formen des Lernens – im Sinne der konvergenten Differenzierung nach Bönsch (2000) – nicht von allen Schüler/innen gleichermaßen angenommen werden und bei ihnen auch tatsächlich zu einer höheren Lernkompetenz führen. Vielmehr obliegt es der Verantwortung des Lehrenden, Phasen des selbstgesteuerten Lernens sinnvoll mit denen geschlossener Arbeitsphasen zu verbinden (Merziger, 2007). In diesem Kontext werden anti-behavioristische Theorien des selbstgesteuerten Lernens relevant (Reichenbach, 2007), die beinahe zwangsläufig zum Konstrukt der Kompetenzen und der Kompetenzorientierung im Allgemeinen und der Notwendigkeit der Konstruktion von entsprechenden Lernumgebungen und Lernaufgaben im Speziellen führen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Dennis Heller (Autor:in), 2017, Differenziert und kompetenzorientiert Mathematik in der Primarstufe unterrichten – aber wie?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373603
Kostenlos Autor werden
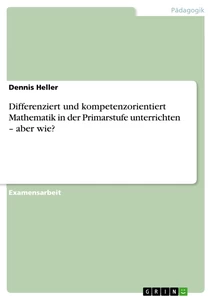



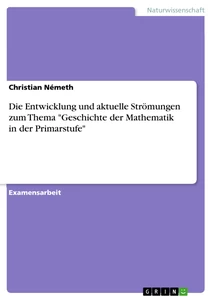









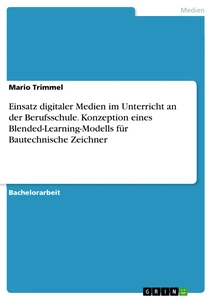







Kommentare