Leseprobe
2.3 Lebenswelt einer suchtkranken Person
4.1 Auswirkungen der Suchterkrankung auf das Familiensystem
4.2 Auswirkungen der elterlichen Suchterkrankung auf die Eltern-Kind-Beziehung
4.3 Einfluss der elterlichen Suchterkrankung auf betroffene Kinder
5 Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von Kindern suchtkranker Eltern
5.2 Unterstützungsbedürftige Lebensbereiche
6 Hilfeangebote für Kinder suchtkranker Eltern in Deutschland
7 Konzeptentwicklung „VerSucht“
7.1 Theoretischer Hintergrund
7.1.1 Zielsetzung
7.1.2 Methoden
7.2 Rahmenbedingungen
7.2.1 Teilnahmebedingungen
7.2.2 Finanzierung
7.2.3 Teilnehmergenerierung
7.2.4 Aufbau der Module
7.2.5 Gruppenleitung
7.2.6 Räumliche Bedingungen
7.2.7 Umgang mit Unpünktlichkeit und unregelmäßiger Teilnahme
7.3 Module
7.3.1 Elternmodul 1
7.3.2 Modul 1 - Kennenlernen und Öffnen in der Gruppe („Kennenlernen“)
7.3.3 Modul 2 – Psychoedukation („Was ist Sucht?“)
7.3.4 Modul 3 - Affektwahrnehmung und -ausdruck („Gefühlschaos“)
7.3.5 Modul 4 – Konfliktlösekompetenzen („Streiten lernen“)
7.3.6 Modul 5 – Ressourcenförderung („Ich kann!“)
7.3.7 Modul 6 – Hilfesystem („Zur Hilfe!“)
7.3.8 Modul 7 - Wiederholung und Abschied („Wiederholung und Abschied“)
7.3.9 Elternmodul 2
7.4 Dokumentation
7.5 Evaluation
8 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhänge
Anhang 1: Terminübersicht für Eltern
Anhang 2: Terminübersicht für Kinder
Anhang 3: Übersicht Modul 1 – Kennenlernen und Öffnen in der Gruppe
Anhang 4: Übersicht Modul 2 – Psychoedukation
Anhang 5: Übersicht Modul 3 – Affektwahrnehmung und -ausdruck
Anhang 6: Übersicht Modul 4 – Konfliktlösekompetenzen
Anhang 7: Übersicht Modul 5 – Ressourcenförderung
Anhang 8: Übersicht Modul 6 – Hilfesystem
Anhang 9: Übersicht Modul 7 – Wiederholung und Abschied
Anhang 10: Wichtige Gruppenregeln
Anhang 11: Informationsblatt zu Suchtmitteln
Anhang 12: Informationsblatt „Wann ist jemand süchtig?“
Anhang 13: Modell „Gefühlsrad“
Anhang 14: Arbeitsblatt „Fünf-Finger-Methode“
Anhang 15: Arbeitsblatt „Meine Oase“
Anhang 16: Arbeitsblatt „Sucht-Quiz“
Anhang 17: Dokumentationsleitfaden
Anhang 18: Evaluationsbogen für teilnehmende Kinder
Anhang 19: Evaluationsbogen für Eltern teilnehmender Kinder
Anhang 20: Evaluationsbogen für durchführende Gruppenleiter*innen
1 Einleitung
„Ich wollte den Fußspuren nachgehen, aber zuerst bückte ich mich, um die Abdrücke genauer zu betrachten. Erst bemerkte ich gar nichts, aber dann fiel mir doch etwas auf. Im linken Absatz war ein Kreuz aus dicken Nägeln, das den Teufel abhalten sollte. In einer Sekunde war ich auf und davon und raste den Hügel hinunter. Alle Augenblicke sah ich über meine Schulter hinter mich, aber ich entdeckte niemanden.“ (Twain, 2011, S. 284[1])
In Mark Twains Roman „Adventures of Huckleberry Finn“ (zu Deutsch „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“) aus dem Jahre 1884 ist Huckleberry der Sohn eines trinkenden Vaters. Dieser lässt seinen Sohn oft über Wochen allein auf der Straße leben und wenn er sich blicken lässt, so verursacht er durch seine Unberechenbarkeit Angst und Schrecken. In dieser Ausgewählten Szene der Geschichte erkennt Huckleberry in den Fußspuren die seines Vaters. Die Erkenntnis über dessen Rückkehr veranlasst ihn zur schlagartigen Flucht.
Auch in weiterer Romanliteratur, wie beispielsweise Charles Dickens „Oliver Twist“ (1838), in dem Oliver unter dem Wechselbad von Zu- und Abneigung durch seinen trinkenden Ziehvater Fagin leidet, findet der Alkohol und sein Einfluss auf das kindliche Leben seit Langem Beachtung (vgl. Dickens, 2012[2]).
In der Fachöffentlichkeit wurde man erst seit den 1990er Jahren verstärkt auf die Kinder suchtkranker Eltern aufmerksam (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 122). Dabei ist die Zahl betroffener Kinder unter 18 Jahren in Deutschland, die mit mindestens einem an einer substanzbezogenen Sucht erkrankten Elternteil aufwachsen, mit etwa 2,6-2,7 Millionen beachtlich hoch (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 8; Klein, Moesgen, Bröning & Thomasius, 2013, S. 12; Homeier & Schrappe, 2012, S. 122; Klein, 2006, S.8). Diese Zahl beschränkt sich zudem noch auf die Abhängigkeit von Alkohol oder illegalen Drogen und lässt medikamentenabhängige Eltern außer Acht[3].
Umso verwunderlicher, dass zwischen 1999 und 2006 im ambulanten Sektor der Bundesrepublik Deutschlands lediglich etwa 50 professionelle Hilfeangebote für Kinder suchtkranker Eltern existierten (vgl. Klein, Moesgen, Bröning & Thomasius, 2013, S. 21-24).
Kinder und Jugendliche, die von einer elterlichen Suchterkrankung betroffen sind, gelten als erstrangige Hochrisikogruppe, später selbst eine Suchterkrankung oder eine andere psychische Störung zu entwickeln (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 8; DHS, 2006a, S. 4; Homeier & Schrappe, 2012, S. 122). Um die Gefahr einer solchen negativen Lebensentwicklung zu verhindern ist es notwendig, möglichst früh entsprechende präventive Hilfemaßnahmen anzubieten.
Um diese spezifischen Hilfeangebote effektiv gestalten zu können, bedarf es der Beantwortung dreierlei Fragen, die der vorliegenden Arbeit als Forschungsfragen zugrunde liegen:
1. Wie wirkt sich eine elterliche Suchterkrankung auf das Familienleben, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kinder, aus?
2. Welche Risikofaktoren beziehungsweise Schutzfaktoren seitens der Kinder gilt es zu verringern oder zu fördern, um einer negativen psychosozialen Entwicklung als Folge der Suchtbelastung durch die elterliche Erkrankung entgegenzuwirken?
3. Welche Formen der praktischen Umsetzung eignen sich in der Sozialen Arbeit besonders, um betroffene Kinder effektiv und gezielt in einer positiven Entwicklung zu unterstützen?
Die vorliegende Arbeit hat dadurch den Anspruch, die Lebenswelt einer suchtbelasteten Familie detailliert zu erfassen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Einfluss der elterlichen Erkrankung auf die betroffenen Kinder liegt. Hier sollen Risiko- und Schutzfaktoren herausgearbeitet werden, die durch adäquate Hilfeangebote entweder gemindert oder gefördert werden sollen, um Kinder suchtkranker Eltern in einer positiven Lebensentwicklung zu unterstützen. Auf der Basis der aus der analytischen Arbeit gewonnen Erkenntnisse wird im Folgenden die Entwicklung eines beispielhaften Konzeptes für ein angemessenes Hilfeangebot im ambulanten Bereich der Sozialen Arbeit angestrebt.
Die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Kreative Gruppenangebote für Kinder suchtkranker Eltern – Analyse & Konzeptentwicklung“ gliedert sich wie bereits im Titel impliziert in zwei Hauptteile: dem analytischen Teil und der Entwicklung eines eigenen Konzeptes.
Mittels deduktiver Methodik wird zunächst eine Analyse der Lebenswelt von Kindern aus suchtbelasteten Familien vorgenommen.
Zu Beginn muss die Suchterkrankung selbst definiert und ihre Auswirkungen auf die erkrankte Person erläutert werden. Im Folgenden liegt der Fokus auf der familiären Lebensweltanalyse. Dabei wird erst der Einfluss der Suchterkrankung auf die gesamte Familie, dann auf die Eltern-Kind-Beziehung und schließlich auf die Kinder selbst betrachtet.
Im Anschluss werden spezifische Faktoren und kindliche Bedürfnisse herausgearbeitet, deren Förderung die positive Lebensentwicklung betroffener Kinder begünstigt.
Am Ende des analytischen Teils findet sich ein Überblick über die verschiedenen Arten der bislang in Deutschland existierenden Hilfeangebote für Kinder aus suchtbelasteten Familien.
Der Teil der Konzeptentwicklung stellt nun einen eigenen konkreten Vorschlag zur Förderung von Kindern suchtkranker Eltern im ambulanten Bereich der Sozialen Arbeit durch die Maßnahme eines kreativen Gruppenangebots dar. Das entstandene Konzept trägt den Titel „VerSucht“.
An dieser Stelle der vorliegenden Arbeit wird zunächst die Entscheidung für diese spezifische Form der Hilfemaßnahme begründet und ein einleitender Überblick über das Gesamtkonzept gegeben. Es schließt sich die Darstellung des dem Angebot zugrunde liegenden theoretischen Hintergrundes und der Rahmenbedingungen an. Nun werden die einzelnen Modulelemente chronologisch erläutert. Zum Schluss wird die Dokumentations- und Evaluationsarbeit beschrieben.
Die Arbeit „Kreative Gruppenangebote für Kinder suchtkranker Eltern – Analyse und Konzeptentwicklung“ schließt mit einem Fazit.
2 Was bedeutet Sucht?
Die vorliegende Arbeit legt den Fokus auf die Arbeit mit Kindern suchtkranker Eltern. Um zu verstehen, wie das alltägliche Leben betroffener Kinder aussieht, ist es notwendig, sich zunächst allgemeine Grundkenntnisse über das Thema „Sucht“ anzueignen. In diesem ersten Kapitel wird daher zunächst eine Begriffsdefinition von „Sucht“ unter Heranziehung klinischer Diagnosekriterien vorgenommen. Es folgt eine Erläuterung über Suchtentstehung und den Einfluss einer substanzbezogenen Sucht auf die Lebenswelt des Erkrankten.
2.1 Definition
Der Begriff „Sucht“ oder „Abhängigkeit“ bezeichnet ein Konsumverhalten, das sich stoffgebunden auf Alkohol, Drogen oder Medikamente und nicht-stoffgebunden auf Verhaltensweisen wie beispielsweise Spielsucht oder Internetsucht beziehen kann (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 119). „Sucht“ in der vorliegenden Arbeit bezieht sich lediglich auf stoffgebundene Abhängigkeiten.
Die Sucht beziehungsweise die Abhängigkeit ist seit 1968 als behandlungsbedürftige Krankheit anerkannt (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 121). Sie ist daher im von der WHO herausgegebenen internationalen Klassifikationssystem der Krankheiten, dem ICD-10 vertreten, welches in Deutschland zur amtlichen Diagnosestellung im ambulanten und stationären Versorgungsbereich Bereich verwendet wird. Die im ICD-10 dargelegte Definition der substanzbezogenen Abhängigkeitserkrankung umfasst sechs Kriterien.
Das erste Kriterium ist der starke Wunsch oder der Zwang die betreffende Substanz zu konsumieren.
Kriterium zwei ist die mangelnde Kontrolle über Beginn, Beendigung, und Menge des Substanzgebrauchs.
Das dritte Kriterium bezieht sich auf körperliche Entzugssymptome. Es ist erfüllt, wenn bei dem*der Betroffenen entweder substanzspezifische, körperliche Entzugssymptome bei Verringerung oder Beendigung des Konsums auftreten, oder er*sie die Substanz konsumiert um ebenjene Entzugssymptome abzumildern oder zu verhindern.
Viertens liegt bei abhängigen Personen häufig eine Toleranzentwicklung bezüglich der konsumierten Substanz vor. Die zu konsumierende Dosis muss also mit der Zeit erhöht werden, um den gleichen Effekt zu erzielen wie zu Konsumbeginn.
Im fünften Kriterium werden im ICD-10 auch die sozialen Folgen in den Fokus gerückt. Menschen, die an einer Substanzabhängigkeit erkrankt sind, vernachlässigen oft ihre Interessen und verwenden immer mehr Zeit auf Beschaffung und Konsum der Substanz, sowie auf die Erholung von den Folgen ebendieses Konsumverhaltens.
Kriterium sechs ist das Fortsetzen des Konsumverhaltens durch den*die Konsument*in, obwohl bereits schädliche Folgen des Substanzkonsums aufgetreten sind, die von der betroffenen Person bewusst als solche wahrgenommen wurden.
Um die klinische Diagnose einer Substanzabhängigkeit nach Kriterien des ICD-10 zu stellen, müssen im Zeitraum der letzten 12 Monate mindestens drei der genannten Kriterien auf Seiten des*der Konsument*in erfüllt sein (vgl. Hautziger & Thies, 2009; Klein, 2005, S. 18f.).
Dabei ist die Sucht selbst ein Entwicklungsprozess, der mit einem Probierverhalten beginnt und sich über Gewöhnung, Missbrauch und Abhängigkeit bis hin zur Krankheit fortsetzt. Um eine Sucht handelt es sich dann, wenn die betroffene Person von ihrem Konsumverhalten so abhängig geworden ist, dass sie beginnt sich auf verschiedene Weise selbst zu schädigen, ohne den Konsum selbstständig einschränken oder beenden zu können (vgl. Wagner, 2006, S. 12).
2.2 Suchtentstehung
Für die Ursachen und Entstehung der Suchtentwicklung gibt es in der Forschung verschiedene Theorien und Ansätze. Diese nennen beispielsweise eine labile oder instabile Persönlichkeit, eine Vererbung der Alkoholsucht oder traumatische Erfahrungen in der Kindheit als mögliche Gründe einer Suchterkrankung. Eine pauschale Erklärung, die auf alle Suchterkrankten zutrifft und wissenschaftlich belegbar ist, wurde bislang allerdings nicht gefunden (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 127). Einige Theorien werden im Folgenden kurz dargestellt.
Der Suchttherapeut Johannes Lindenmeyer beschreibt den Weg in die Abhängigkeit am Beispiel des Alkohols in drei Schritten.
Der erste Schritt ist das „Erste Mal“. Für viele junge Menschen ist der Alkohol das erste Suchtmittel, das sie konsumieren. Die Vorbilder in der Herkunftsfamilie und der Gleichaltrigengruppe haben dabei großen Einfluss darauf, wie die jungen Menschen mit dem Alkoholkonsum umgehen. Besonders ungünstig ist es, wenn die ersten Erfahrungen mit Alkohol außerhalb der Herkunftsfamilie, also ohne elterliche Einflussnahme, und in übermäßiger Form gemacht werden.
Als zweiten Schritt benennt Lindenmeyer die „Gewohnheit“. Da etwa 85-90% der Bundesbürger regelmäßig Alkohol zu sich nehmen, wird es im weiteren Verlauf oft immer „normaler“, Alkohol zu konsumieren. Problematisches Konsumverhalten entsteht dabei dann, wenn der Körper sich mehr und mehr an den Alkohol gewöhnt. Der*Die Konsument*in scheint dann immer größere Mengen offenbar problemlos zu vertragen, was von der Umwelt häufig toleriert oder gar gefördert wird. Dabei kann es passieren, dass der*die Betroffene zunehmend auf den Alkoholkonsum als beispielsweise stressregulierende Verhaltensweise angewiesen ist. Alternative Strategien zur Stressbewältigung werden kaum noch wahrgenommen.
Im dritten Schritt entsteht nun die „Abhängigkeit“. Der Körper beginnt, auf den kontinuierlichen Alkoholkonsum zu reagieren. Wird der Konsum verringert oder eingestellt, so kommt es zu unangenehmen Entzugserscheinungen. Zudem verliert der*die Konsument*in stetig an Kontrolle über sein*ihr Trinkverhalten. Die daraus entstehenden Schuldgefühle versucht der*die Konsument*in mit weiterem Alkoholkonsum zu regulieren, wodurch er*sie in einen Teufelskreis gerät, aus dem er*sie ohne professionelle Hilfe meist nicht mehr auszubrechen vermag (vgl. Lindenmeyer, 2001/2005 zitiert nach Homeier & Schrappe, 2012, S. 127).
Als zusätzliche Risikofaktoren einer Suchtentwicklung nennt Lindenmeyer eine niedrige Frustrationstoleranz und wenig Selbstkontrolle. Zudem kann es suchtfördernd sein, wenn sich der*die Betroffene im nüchternen Zustand unsicher und hilflos fühlt. Auch ein soziales Umfeld, in dem der Alkoholkonsum eine große Rolle spielt, bildet einen zusätzlichen Risikofaktor (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 128).
Dem neurobiologischen Erklärungsansatz liegt die Vermutung zugrunde, Süchtige leiden unter einer Stoffwechselkrankheit. Wissenschaftlich belegt werden konnte dies bislang allerdings nicht. Sicher ist aber, dass kontinuierlicher Alkohol- oder Opiatkonsum die körpereigene Produktion der Endorphine, also der „Glückshormone“, verhindert. Dies veranlasst suchtkranke Menschen dazu, weiterhin die betreffende Substanz zu konsumieren, da dies als die einzige Möglichkeit erscheint, „Glücksgefühle“ zu empfinden. Bei nicht-stoffgebundenen Süchten wie beispielsweise der Spielsucht ist diese Theorie allerdings unbrauchbar (vgl. Wagner, 2006, S. 12).
Die Lerntheorie dagegen geht davon aus, dass das Konsumverhalten der Kinder und Jugendlichen hauptsächlich von ihren Eltern und ihrem sozialen Umfeld abhängt. Alkohol- und Drogenkonsum wird sich hierbei „abgeguckt“ und verinnerlicht. Eine Suchterkrankung entstehe daher durch ein bereits süchtiges Umfeld (vgl. Wagner, 2006, S. 15).
Die Hauptgrundlage für die meisten suchtspezifischen Therapien bildet der psychoanalytische Ansatz. Häufig liegt die Ursache für die spätere Suchtentwicklung demzufolge bereits in der frühen Kindheit. Markante und dramatische Lebenserfahrungen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht produktiv verarbeitet wurden, können zur Entwicklung psychischer Störungen führen. Persönlichkeitsaspekte können nicht weiterentwickelt werden, die Betroffenen können ihre psychischen Probleme nicht mehr eigenständig lösen und versuchen letztendlich, sich den negativen Gefühlen mittels Drogenkonsum zu entziehen und durch angenehme Gefühle zu ersetzen (vgl. Wagner, 2006, S. 14f.).
Eine zusätzliche wesentliche Ursache für die Abhängigkeitserkrankung ist eine starke Unzufriedenheit mit der aktuellen Lebenssituation und die Unfähigkeit, mit dieser angemessen umzugehen. Die Gründe für diese, spezifische oder noch diffuse, Unzufriedenheit können vielfältig sein. Das Spektrum reicht hier von Langeweile über Dauerstress und Überforderung bis hin zu tieferliegenden traumatischen Erfahrungen in der Lebensgeschichte des*der Betroffenen (vgl. Wagner, 2006, S. 12).
Sucht wird also nicht allein durch das Suchtmittel ausgelöst. Sie ist vielmehr die Folge einer Fehlentwicklung, deren Wurzeln häufig schon in der frühen Kindheit liegen. Das daraus resultierende gestörte Sozialverhalten kann in den Bereichen der Kontakt-, Beziehungs- und Konfliktfähigkeit, ebenso wie der Genussfähigkeit und einem Mangel an Selbstwertgefühl und Selbstverantwortlichkeit deutlich werden (vgl. Wagner, 2006, S. 13).
Insgesamt kann das Bedingungsmodell der Sucht als multifaktoriell verstanden werden. Die drei Hauptvariablen sind dabei die Substanz selbst, in ihrer spezifischen Wirkungsweise, das Individuum mit seinen körperlichen und psychischen Eigenschaften und seiner genetischen Disposition, und das soziale Umfeld mit interpersonalen und sozialisierenden Beziehungen (vgl. Klein, 2005, S. 16).
2.3 Lebenswelt einer suchtkranken Person
Obwohl es in dieser Arbeit speziell um jenen Aspekt der Suchtkrankheit geht, der vorwiegend das Eltern- und Familie-Sein behandelt, sehen sich auch suchtkranke Eltern allen Folgen ihrer Abhängigkeit entgegengestellt, die eine solche Erkrankung auch bei Betroffenen ohne Kinder mit sich bringt (vgl. Kunz, Steier & Kampe, 1994, S. 218). Die Konsequenzen einer Suchterkrankung auf der psychischen, körperlichen, sozialen, juristischen und familiären Ebene werden im Folgenden genauer dargestellt.
Die psychischen Folgen des kontinuierlichen Konsums sind oft substanzspezifisch. Kokain und Amphetamine können beispielsweise zu Ängsten und tiefen Depressionen führen, während Ecstasy, Cannabis und LSD psychoseähnliche Zustände auslösen können. Häufig bringen die Betroffenen ihre psychischen Probleme über längere Zeit gar nicht mit dem Substanzkonsum in Verbindung. Dabei gilt, je häufiger solche psychotischen Zustände auftreten und je länger sie andauern, desto schwieriger wird es, sie erfolgreich zu behandeln (vgl. Mende, 2003d).
Generell leiden viele Suchtkranke unter schweren Depressionen, bis hin zu Selbstmordgedanken. Auch kann der langfristige Konsum die Persönlichkeit des*der Betroffenen erheblich verändern. So werden chronische Cannabiskonsumenten oft antriebs- und interesselos und haben Konzentrationsschwierigkeiten. Auch Heroinabhängige leiden häufig unter Antriebsarmut und erscheinen weinerlich. Kokain- und Amphetaminkonsumenten hingegen entwickeln ein steigendes Aggressionspotenzial und werden selbstsüchtig (vgl. Mende, 2003d).
Des Weiteren kann ein dauerhafter Konsum von beispielsweise Alkohol oder Ecstasy Nervenzellen dauerhaft zerstören. Sind diese erst einmal geschädigt, so erholen sie sich kaum noch. Bei langfristigem Konsum vermindert sich folglich das geistige Leistungsvermögen des*der Konsument*in erheblich (vgl. Wagner, 2003d).
Auch haben Suchtkranke oft Probleme, ihre emotionalen Zustände differenziert wahrzunehmen und auszudrücken. Die genaue Benennung von Gefühlen wie Wut, Trauer, Langeweile und Niedergeschlagenheit beziehungsweise Freude, Zuneigung und Zufriedenheit gelingt ihnen dann nur unzureichend (vgl. Steier, Kunz & Kampe, 1994, S. 219).
Die Liste der möglichen körperlichen Folgeschäden langfristigen Alkohol- oder Drogenkonsums ist lang. Alkohol wirkt beispielsweise auf alle Körperzellen und kann deshalb auf jedes Körperorgan schädlich wirken. Zu den bekanntesten Folgen des kontinuierlichen Alkoholkonsums zählt die Leberschädigung, die bis hin zum Tod durch Leberzirrhose führen kann. Körperliche Folgen von Drogenkonsum reichen von Herzschäden und der Zerstörung der Lunge über Lähmungen und Nierenversagen zu einer Schädigung des körpereigenen Abwehrsystems. Zusätzlich schädigend wirken meist noch die in den Drogen enthaltenen Streckmittel. Werden Drogen intravenös konsumiert, so besteht ebenfalls die Gefahr der Ansteckung mit Hepatitis-Viren, HIV oder anderen Krankheitserregern (vgl. Mende, 2003b).
Für Menschen, die an einer substanzbezogenen Sucht erkrankt sind, dreht sich das ganze Leben nur noch um das Suchtmittel. Aktivitäten, die nicht mit dem Konsum zusammenhängen, treten oft in den Hintergrund. So werden soziale Kontakte und Freundschaften nicht mehr gepflegt und Hobbies aufgegeben. Auch im Beruf werden sie unzuverlässig, machen Fehler und sind häufiger krank. Oft kommt es zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses und zu Scheidungen. Das soziale Gefüge der Betroffenen wird stets brüchiger. Viele Suchtkranke leben sozial vereinsamt. Sie haben kaum noch Kontakt zu anderen Menschen oder nur noch zu solchen, die ebenfalls an einer Suchterkrankung leiden. Diese Kontakte unter Süchtigen stellen dabei meist lediglich Zweckbeziehungen dar. Suchtkranke Menschen leben in einem ständigen Kreislauf aus Suchtmittelbeschaffung und -konsum, aus dem sie nur selten eigenständig ausbrechen können (vgl. Mende, 2003e). Zudem ist die Sucht als solche in unserer Gesellschaft noch immer eine hoch stigmatisierte Erkrankung. Als Ursache für die gesellschaftliche Ächtung von Suchtkranken kann die vorherrschende Vorstellung gesehen werden, die Betroffenen tragen individuell Schuld und ihre Sucht sei Ausdruck eines persönlichen Versagens. So sind Suchtkranke gezwungen, ihr Leiden zu verheimlichen und es dauert oft Jahre, bis ihre Erkrankung offensichtlich wird (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 7; Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 8; Mende, 2003a).
Eine substanzbezogene Sucht hat für die Betroffenen nicht selten auch juristische Folgen. Während Alkohol von Erwachsenen in Deutschland legal konsumiert werden darf, ist der Besitz der meisten anderen Suchtmittel, wie beispielsweise Heroin, Kokain und Amphetaminen, illegal. Strafrechtlich geregelt ist dies im BTMG. Man unterscheidet hier zwischen der primären und der sekundären Beschaffungskriminalität. Unter die primäre Beschaffungskriminalität fällt der bloße Erwerb und Besitz illegaler Suchtmittel. Wird man mit einer größeren Menge oder wiederholt mit Kokain, Heroin oder Ähnlichem erwischt, so drohen lange Haftstrafen. Durch die Illegalisierung dieser Substanzen werden die Preise auf dem Schwarzmarkt in die Höhe getrieben, was den langfristigen Konsum sehr kostenintensiv für den*die Suchtkranke*n werden lässt. Um dies zu finanzieren, kommt es oft zur sekundären Beschaffungskriminalität in Form von Diebstählen, Einbrüchen, Raubdelikten und anderem (vgl. Mende, 2003c; Ostendorf, 2010).
Auch auf der familiären Ebene hat eine Suchterkrankung weitreichende Folgen. Im familiären Kontext steht der*die Suchtkranke im Mittelpunkt und bekommt viel Aufmerksamkeit und Zuwendung. Auch bricht er*sie jene Regeln, die alle anderen einhalten müssen. In dem Maße, in dem er*sie in allen anderen Bereichen stetig die Kontrolle über sein*ihr Leben verliert, gewinnt er*sie hier die Kontrolle über seine*ihre Familie (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 9f.).
Oft behaupten suchtkranke Eltern mit großer Überzeugung, ihre Kinder haben, besonders in jüngerem Alter bis zu zwölf Jahren, von ihrer Erkrankung nichts mitbekommen. Eigentlich wissen sie aber sehr wohl, wie sehr ihre Kinder die elterliche Abhängigkeit zu spüren bekommen haben. Sie fühlen sich schuldig und schämen sich so sehr, dass sie diese Tatsache verdrängen und vor sich selbst und anderen leugnen (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 12f.)
Tatsächlich besteht bei suchtkranken Eltern oft eine erhebliche Einschränkung in der die Kindererziehung betreffenden Handlungskompetenz. Der Einfluss der elterlichen Suchterkrankung auf deren Erziehungsverhalten und damit auf die Familie insgesamt, die Eltern-Kind-Beziehung und die Kinder selbst wird in Kapitel 4 der vorliegenden Arbeit näher erläutert.
3 Epidemiologie
Um die Relevanz des Hilfebedarfs von Kindern suchtkranker Eltern zu verdeutlichen folgt in diesem Kapitel ein Überblick über die Epidemiologie der Sucht in der Bundesrepublik Deutschland mit besonderem Blick auf Kinder suchtkranker Eltern. Hierzu wird zunächst dargelegt, wie viele Menschen in Deutschland an einer substanzbezogenen Sucht erkrankt sind und wie viele davon eigene Kinder haben. Es schließen sich statistische Daten über die Risikogruppe „Kinder suchtkranker Eltern“ an, in denen die Entwicklung einer eigenen Suchterkrankung oder anderer psychischer Störungen seitens ebenjener Kinder betrachtet wird.
In der Bundesrepublik Deutschland sind etwa 1,7-1,8 Millionen Menschen an einer Alkoholabhängigkeit erkrankt (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 6). Bei etwa 290 Tausend Menschen liegt eine Drogenabhängigkeit, vor allem von Cannabis, Opioiden, Kokain und Amphetaminen, vor (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 119). Ungefähr 1,3-1,4 Millionen Menschen gelten in Deutschland als medikamentenabhängig. Dabei handelt es sich meist um eine Abhängigkeit von Schlaf- und Beruhigungs-, sowie Anregungs- und Schmerzmittel (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 6; Homeier & Schrappe, 2012, S. 119).
Etwa 2,6 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Deutschland haben mindestens einen Elternteil, bei dem die Diagnose „Alkoholmissbrauch“ oder „Alkoholabhängigkeit“ vorliegt (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 8; Homeier & Schrappe, 2012, S. 122; Klein, Moesgen, Bröning & Thomasius, 2013, S. 12). Bei ungefähr 40.000-60.000 Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland ist mindestens ein Elternteil vom Missbrauch oder von der Abhängigkeit von illegalen Drogen betroffen (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 8; Homeier & Schrappe, 2012, S. 122; Klein, 2006, S.8; Klein, Moesgen, Bröning & Thomasius, 2013, S. 12). In Prozentzahlen ausgedrückt sehen sich etwa 10-15% aller Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren in Deutschland mit einer elterlichen Alkoholabhängigkeit und etwa 0,1-0,5% mit einer Drogenabhängigkeit der Eltern konfrontiert (vgl. Schulze et al., 2014, S. 5).
Kinder und Jugendliche, die mit mindestens einem suchtkranken Elternteil aufwachsen, gelten als erstrangige Hochrisikogruppe, später selbst eine Suchterkrankung oder eine andere psychische Störung zu entwickeln. Mehr als 30% der betroffenen Kinder werden selbst krank, oft schon im Jugendalter oder als junge Erwachsene. Neben der Entwicklung einer eigenen Suchtstörung treten bei Kindern suchtkranker Eltern besonders häufig Angststörungen, Depressionen oder andere Persönlichkeitsstörungen auf (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 8; DHS, 2006a, S. 4; Homeier & Schrappe, 2012, S. 122).
Verglichen mit nicht betroffenen Kindern haben Kinder, die zumindest zeitweise mit mindestens einem alkoholabhängigen Elternteil aufgewachsen sind, ein bis zu sechsfach höheres Risiko, später selbst eine Alkoholabhängigkeit zu entwickeln (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 122). Mehr als 50% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 21 Jahren, die bereits in diesem Alter einen missbräuchlichen Alkoholkonsum oder sogar eine Abhängigkeit entwickelt haben, stammen aus einer Familie mit mindestens einem alkoholkranken Elternteil (vgl. DHS, 2006a, S. 4; Homeier & Schrappe, 2012, S. 123). Betrachtet man die Gesamtgruppe aller alkoholabhängigen Menschen, unabhängig von deren Alter, so geben immer noch etwa 30,8% an, ihrerseits mindestens einen Elternteil mit einer eigenen Alkoholabhängigkeit zu haben. In der psychiatrisch unauffälligen Bevölkerungsgruppe trifft dies nur auf ungefähr 7,4% zu (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 123).
4 Sucht und Familie
Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage nach dem Einfluss einer elterlichen Suchterkrankung auf die Familie und besonders auf die betroffenen Kinder folgt nun die Lebensweltanalyse des suchtbelasteten Familiensystems in deduktiver Form. Zunächst wird das Familiensystem in seiner Gesamtheit betrachtet, dann liegt der Fokus auf der Eltern-Kind-Beziehung und schließlich auf der Lebenswelt der Kinder selbst.
4.1 Auswirkungen der Suchterkrankung auf das Familiensystem
Eine elterliche Suchterkrankung wirkt sich auf verschiedene Weisen und in mehreren Bereichen auf das Familiensystem aus. Zunächst herrscht in suchtbelasteten Familien eine oftmals ungesunde Familiendynamik. Zudem bestehen meist unausgesprochene Regeln, die die individuelle Persönlichkeitsentwicklung aller Familienmitglieder hemmen oder gar blockieren. Schlussendlich ist eines der am häufigsten vorkommenden Phänomene die Entwicklung von Co-Abhängigkeit der nicht-suchtkranken Familienmitglieder. Sie entwickeln hierbei Verhaltensmuster, die der Suchterkrankung des Betroffenen entgegensteuern sollen, im Endeffekt aber, ohne dass die co-abhängige Person es bemerkt, genau das Gegenteil bewirken und das Fortbestehen der Suchterkrankung sogar unterstützen.
4.1.1 Familiendynamik
In einer Familie mit einem oder mehreren suchterkrankten Mitgliedern ist die Familiendynamik oft schwer gestört.
Eine elterliche Suchterkrankung hat einen umfassenden Veränderungsprozess zur Folge, der das gesamte Familiensystem mitbetrifft. Die Familienentwicklung und die Prozesse der Abhängigkeit stehen dabei in Wechselwirkung zueinander (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 9).
Die Sucht und die damit verbundene familiäre Belastung werden zum Mittelpunkt allen Geschehens in der Familie. Allen Familienmitgliedern fehlt die Möglichkeit, diesem zentralen Geschehen auszuweichen (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 124). Die Atmosphäre in einer Suchtfamilie ist meist geprägt von einer ängstlich-angespannten Erwartungshaltung, Instabilität, Willkür, Unruhe und einem Mangel an Geborgenheit (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 15; Homeier & Schrappe, 2012, S. 124).
Darüber hinaus erleben viele suchtbelastete Familien nicht nur vermehrte innerfamiliäre Streitigkeiten, sondern auch schwerwiegende Krisen mit. Hierzu zählen beispielsweise die soziale Isolation, finanzielle Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit und eine immer schlechter werdende elterliche Partnerschaft, bis hin zur Trennung oder Scheidung. Die Schuld an diesen krisenhaften Ereignissen sucht der suchtkranke Elternteil oft nicht bei sich, sondern schiebt sie dem*der Ehepartner*in, den Kindern oder äußerlichen Faktoren zu (vgl. Bertenghi, 1997, S. 157f.; DHS, 2006a, S.6; Homeier & Schrappe, 2012, S. 124). Die übrigen Familienmitglieder hingegen suchen die Schuld eher bei sich und schämen sich gleichzeitig für ihre aggressiven Gefühle dem suchterkrankten Familienmitglied gegenüber (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 10).
Während der abhängige Elternteil die Kontrolle über sein Leben im Laufe der Suchterkrankung zunehmend verliert, gewinnt er in gleichem Maße die Kontrolle über die Familie. Hier steht er im Mittelpunkt, bekommt Aufmerksamkeit und Zuwendung und darf Regeln verletzen, die andere Familienmitglieder rigide einhalten müssen (vgl. Bertenghi, 1997, S. 157f.).
Oft sind auch die innerfamiliären Grenzen und die Rollenaufteilung nicht klar getrennt und verlaufen ineinander. So nimmt der suchtkranke Elternteil oft eine kindliche Rollenposition ein, währen die Kinder selbst Verantwortung und Aufgaben übernehmen, die von den Eltern nur noch unzureichend oder gar nicht mehr erfüllt werden. Durch die Sucht gehen so vitale Erziehungsleistungen der Eltern verloren (vgl. Broich, 1994, S. 113f.; Homeier & Schrappe, 2012, S. 124).
Ein zentraler Faktor in der Dynamik eines suchtbelasteten Familiensystems ist die unbedingte Geheimhaltung der elterlichen Suchterkrankung. Durch die gesellschaftliche Stigmatisierung der Sucht und der eigenen Scham- und Schuldgefühle begibt sich die gesamte Familie in eine kontinuierliche soziale Isolation. Meist wird das Thema „Sucht“ auch innerfamiliär streng tabuisiert (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 14; Bertenghi, 1997, S. 160; Homeier & Schrappe, 2012, S.124f.; Michaelis, 2006, S.33).
Ähnlich wie der Suchtkranke verschiedene Phasen der Abhängigkeit durchlebt, lassen sich auch für die suchtbelastete Familie Phasen herausarbeiten, in denen die Familie versucht, mit der Erkrankung des Familienmitgliedes und den damit verbundenen Schwierigkeiten umzugehen. Köppl und Reiners entwickelten 1987 ein Modell mit insgesamt sieben Phasen, deren Durchleben der Familie als Selbstschutz dient. Zunächst wird die Krankheit des abhängigen Familienmitglieds vor sich selbst und anderen verleugnet. In der zweiten Phase wird das Problem offensichtlich und es werden Anstrengungen zu dessen Bewältigung unternommen. Es kommt daraufhin zu einer Störung und Verwirrung innerhalb der Familie. Im Folgenden wird ein Versuch unternommen, die Familie zu reorganisieren. In Phase fünf versuchen die Familienmitglieder, das Problem auf den*die Abhängige*n einzugrenzen. In der sechsten Phase reorganisiert sich die Familie ohne den*die Abhängige*n. Die siebte und letzte Phase beschreibt die Genesung des suchterkrankten Mitglieds. Viele Familien kommen allerdings nicht über die Phasen drei, vier oder fünf, also Verwirrung, Organisationsversuche oder Begrenzung, hinaus (vgl. Köppl und Reiners, 1987 zitiert nach Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 7).
Doch selbst wenn einem Familienmitglied die physische Ablösung aus der Familie gelingt, so muss es oft feststellen, dass die schmerzlichen Gefühle, die Feindseligkeiten und der defensive Lebensstil ein fester Bestandteil seiner Persönlichkeit geworden sind. So besteht die Gefahr, dass er*sie selbst abhängiges Verhalten entwickelt oder co-abhängige Beziehungen (siehe Kapitel 4.1.3) eingeht und so die verinnerlichten Familienstrukturen weiter fortführt (vgl. Rennert, 1990[4] zitiert nach Arenz-Greiving, 2007, S. 10).
4.1.2 Familienregeln
Wie auch in Familien ohne suchtkrankes Mitglied gelten für die Kinder suchtkranker Eltern Regeln, die das Alltagsleben bestimmen und nach denen sich ihr Verhalten richten soll. In diesen Familien sind jene Regeln aber häufig nicht entwicklungsförderlich. Eher wird durch die bestehenden Familienregeln den Kindern vermittelt, sie seien mit ihren Wünschen, Bedürfnissen, Sorgen und Nöten auf sich allein gestellt. Denn die Äußerung und Versuche zur Durchsetzung eigener Bedürfnisse würde das Familiensystem in weiteres Chaos stürzen und das Zusammenleben noch komplizierter gestalten (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 18).
Verschiedene Autor*innen arbeiteten insgesamt sechs Familienregeln heraus, die im Folgenden näher erläutern werden. Die Ausprägungen der einzelnen Regeln sind dabei von Familie zu Familie individuell unterschiedlich (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 18).
Die erste Regel lautet: „Rede nicht!“. Sie beinhaltet, dass weder innerhalb noch außerhalb der Familie über Probleme gesprochen werden darf. Aufkommende Schwierigkeiten werden verleugnet, verdrängt oder ihre Ursache auf andere projiziert. Die Suchtkrankheit wird geheim gehalten und das Fehlverhalten des abhängigen Elternteils relativiert. Dass Probleme unaussprechbar bleiben, vermittelt den Kindern, dass es keine Hoffnung auf Hilfe oder Besserung gibt. Die Kinder nehmen die innerfamiliären Schwierigkeiten deutlich wahr, beginnen aber, an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln, da die Probleme von den Eltern dauerhaft verleugnet werden (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 23, Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 18; Bertenghi, 1997, S. 141).
„Fühle nicht!“ bildet die zweite Regel im suchtbelasteten Familiensystem. Gefühle zu unterdrücken dient der Vermeidung von Schmerzempfinden und verhindert eine zusätzliche Belastung der Eltern durch emotionale Schwierigkeiten ihrer Kinder. Dauerhaftes Leugnen der eigenen Gefühle führt dabei dazu, dass Kinder und Eltern den Zugang zum emotionalen Erleben verlernen. So werden den Familienmitgliedern auch positive Gefühle fremd (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S.24; Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 18f.).
Als dritte Familienregel kann „Traue nicht!“ formuliert werden. Wie bereits erwähnt wird die Wahrnehmung der Kinder, dass etwas in der Familie nicht in Ordnung ist, durch die Eltern und oft auch durch die älteren Kinder kontinuierlich geleugnet. So lernen sie, weder sich selbst, noch anderen zu trauen. Der Alltag in einer suchtbelasteten Familie ist zudem geprägt durch eine Vielzahl an Lügen. So lügt der abhängige Elternteil, um seine Sucht zu verheimlichen, der nicht-abhängige Partner, um den Süchtigen vor negativen Folgen seiner Erkrankung zu bewahren und die Kinder, um sich selbst zu schützen. Außerdem wird es durch die Abhängigkeitserkrankung oder durch die eigene Co-Abhängigkeit für die Eltern zusehends schwieriger, ein zuverlässiges und für die Kinder nachvollziehbares Handeln an den Tag zu legen. Die Kinder lernen daraus, dass sie sich auf niemanden verlassen können. Sie verlieren das Vertrauen nicht nur in sich, sondern auch in andere Menschen (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S.25; Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 19; Bertenghi, 1997, S. 143).
Die vierte Regel kann als „Du musst Dich ganz kontrollieren!“ formuliert werden. In suchtbelasteten Familien müssen die Kinder oft früh Aufgaben übernehmen, zu denen die Eltern nicht mehr oder nur noch unzureichend in der Lage sind. Sie müssen daher schnell erwachsen werden, ihre kindlichen Bedürfnisse nach Spielerischem unterdrücken und regressives Verhalten schnell ablegen. Da den Kindern vermittelt wird, dass der kindliche Teil ihrer Persönlichkeit von den Eltern nicht erwünscht ist, wird dieser von ihnen so gut es geht verleugnet (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 24; Bertenghi, 1997, S. 143).
„Sei nicht egoistisch!“ lautet die fünfte Regel, die den Kindern in einer suchtbelasteten Familie häufig auferlegt wird. Um den anderen gerecht zu werden verleugnen die Kinder ihre eigenen Wünsche, Gefühle und Bedürfnisse. Ihnen wird vermittelt, dass es ihnen dann besser gehe, wenn die Bedürfnisse der anderen erfüllt und deren Probleme gelöst sind. (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 25; Bertenghi, 1997, S. 142).
Die sechste und letzte Regel lautet „Alles muss so bleiben, wie es ist!“. Die strikte Einhaltung der Familienregeln ist essenziell zur Wahrung der familiären Balance, welche durch die gleichsame Belastung aller Familienmitglieder zustande gekommen ist. Indem alles so belassen wird, wie es ist, wird das Aufkommen von Unruhe in der Familie verhindert. Jeder Versuch zur Veränderung und jedes nicht regelkonforme Verhalten wird daher rigide unterbunden. Verhindert wird dadurch allerdings auch jegliche Chance auf Besserung und ein Ende der bedrückenden Lebensumstände (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 26; Bertenghi, 1997, S.143).
Die dargestellten Familienregeln, nach denen sich alle Familienmitglieder richten müssen, werden meist indirekt, also beispielsweise durch Blicke und Gesten kommuniziert und nicht offen ausgesprochen (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 26). Zwar haben die aufgestellten Regeln einen schützenden Effekt, führen aber auch zur Vereinsamung eines jeden Familienmitglieds. Je länger die Kinder diesem Regelsystem ausgesetzt sind, desto weniger können sie alternative Lebens- und Verhaltensweisen wahrnehmen. Die eigene Persönlichkeitsentwicklung der Kinder wird so blockiert. Ein Leben nach diesen Regeln führt zur Verinnerlichung der daraus gezogenen Lektionen, auf denen sich dann das eigene Verhalten aufbaut. Da die Regeln in einem durch eine elterliche Suchterkrankung dysfunktionalen Familiensystem meist der gesunden Entwicklung der Kinder nicht förderlich sind, können sich die Folgen einer solchen Erziehung bis ins Erwachsenenalter fortsetzen, wenn keine Möglichkeiten zur Bearbeitung und zum „Neu-Lernen“ gegeben sind (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S.26, Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 18; Bertenghi, 1997, S.144).
4.1.3 Co-Abhängigkeit
In einem Familiensystem hängen alle Familienmitglieder gleichsam miteinander zusammen wie die Teile in einem Mobilée. Erkrankt eines dieser Teile an einer Sucht, so beeinflusst dies zwangsläufig auch alle übrigen Familienmitglieder (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 129). Während der abhängige Elternteil agiert, reagieren die übrigen Familienmitglieder. Aus den menschlichen Grundbedürfnissen nach Wertschätzung, Anerkennung und Geborgenheit heraus fallen diese Reaktionen, obschon sie aus guter Absicht passieren, oft unbewusst suchtfördernd statt suchtbehindernd aus (vgl. Michaelis, 2006, S. 33f., S. 37). Gleichzeitig hat das Zusammenleben mit der suchtkranken Person für die Angehörigen häufig die Entwicklung eigener, stressbedingter körperlicher Erkrankungen und eine hohe Beeinträchtigung in der Persönlichkeitsentwicklung zur Folge (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 12). Die Zusammensetzung aus diesen beiden Teilphänomenen wird auch als „Co-Abhängigkeit“ bezeichnet.
Die Autor*innen Arenz-Greiving, Erger, Körtel und Krasnitzky-Rohrbach gliedern die Co-Abhängigkeit in drei Phasen. In der ersten Phase, der Beschützerphase, glauben die Angehörigen, das suchtkranke Familienmitglied durch Liebe und Fürsorglichkeit heilen zu können. Auch schützen sie ihn*sie vor Situationen, die eine Konfrontation mit der Realität hervorrufen würden (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 14). Unbeabsichtigt wird durch dieses Verhalten verhindert, dass dem abhängigen Elternteil die Folgen seines Suchtverhaltens und deren tatsächliches Ausmaß bewusst werden. Er muss für sein Fehlverhalten nicht einstehen und hat daher keinen Anreiz zur Verhaltensänderung (vgl. Michaelis, 2006, S. 37). Als zweite Phase benennen genannte Autor*innen die „Kontrollphase“. Hier versuchen die Angehörigen, den abhängigen Elternteil in seinem Suchtverhalten zunehmend zu kontrollieren. Auf das Scheitern der Kontrollversuche folgt die dritte Phase, bezeichnet als „Anklagephase“. Das suchtkranke Familienmitglied sieht sich nun von den übrigen Familienmitgliedern ständig mit Klagen und Vorwürfen konfrontiert. Dieser erhöhte Stress führt dazu, dass die Mutter oder der Vater ihr oder sein Suchtverhalten fortsetzt (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 14).
Meist handeln die nicht-abhängigen Familienmitglieder aus der Angst heraus, die Familie könne auseinanderbrechen, wenn sie nicht die Kontrolle übernehmen. Sie versuchen durch ihre Bemühungen, Krisen zu verhindern und tragen so zur Erhaltung des Status quo der Familie bei. Dass eine Krise auch zu einer konstruktiven Veränderung der Situation führen könnte realisieren sie nicht (vgl. Bertenghi, 1997, S. 145f., S. 169). Da jegliche Veränderung als existenzielle Bedrohung gewertet wird, fehlt den co-abhängigen Familienmitgliedern die Fähigkeit zur Wahrnehmung alternativer Verhaltensmöglichkeiten (vgl. Rennert 1989 zitiert nach Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 12).
Auf emotionaler Ebene empfinden die co-abhängigen Familienmitglieder sowohl Schmerz und Trauer über die Erfolglosigkeit ihres Handelns, als auch Schuld- und Schamgefühle, da sie selbst zur Aufrechterhaltung des suchtbelasteten Systems beitragen (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 130).
4.2 Auswirkungen der elterlichen Suchterkrankung auf die Eltern-Kind-Beziehung
„Suchtkranke Eltern wollen in der Regel genauso gute Eltern sein wie nicht Suchtkranke. Ihr Dilemma besteht meist darin, dass sie gerade aufgrund ihrer Suchterkrankung scheitern. […] Die zu beobachtenden Phänomene der Leugnung und Bagatellisierung sind suchttypische, also krankheitsimmanente Verhaltensweisen“ (Michael Klein zitiert nach Homeier & Schrappe, 2012, S. 128)
Klein meint hier, dass die Wirkung des Suchtmittels selbst das Verhalten und damit auch das Verhältnis in der Eltern-Kind-Interaktion beeinflusst. Der stetige Alkohol und/oder Drogenkonsum beeinträchtigt die Wahrnehmung und das Bewusstsein des Suchtkranken. Häufig wird in der Folge die eigene Hemmschwelle gesenkt und Fehlverhalten heruntergespielt (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 13).
Allgemein gilt, dass eine gute Erziehung, die Selbstsicherheit und Vertrauen fördert, dann stattfindet, wenn das elterliche Verhalten beständig, konsequent und in sich schlüssig ist. In suchtbelasteten Familien ist das elterliche Verhalten jedoch oft durch Wechselhaftigkeit und Widersprüchlichkeiten geprägt (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 126). Während der aktiven Konsumphasen erleben die Kinder den süchtigen Elternteil als unzuverlässig und in der Erziehung sehr rigide. Es kommt zu gewalttätigen Übergriffen und übermäßiger Härte, was bei den Kindern zu ständiger Enttäuschung und Verletztheit führt. In drogen- bzw. alkoholfreien Phasen versucht dieser Elternteil dann, sein Fehlverhalten durch Verwöhnung und übertriebene Fürsorge zu kompensieren. Das inkonsequente Verhalten löst bei den betroffenen Kindern häufig ein grundlegendes Misstrauen und ambivalente Gefühle für diesen Elternteil aus. Die Kinder verspüren durch die kontinuierliche Enttäuschung zwar einerseits den Wunsch, sich abzugrenzen, doch wird der überfürsorgliche Anteil im elterlichen Verhalten von ihnen überbetont, wodurch sie eine tatsächliche Abgrenzung als Verrat empfinden (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 17f.; Broich, 1994, S. 114; Homeier & Schrappe, 2012, S.125).
Auch dem nicht-süchtigen Elternteil gegenüber haben die Kinder meist ambivalente Gefühle. Sie sehen diesen Elternteil in seiner ständigen Überforderung und Erschöpfung einerseits und als Mitschuldigen an der Suchterkrankung des anderen Elternteils sowie als jemanden, der oft für die eigenen Kinder keine Zeit oder Kraft hat, andererseits (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 18; Rennert 1990 in Bertenghi, 1997, S. 162).
Zudem geraten Kinder immer wieder in Loyalitätskonflikte zwischen den Eltern. Elterliche Streitigkeiten bringen die Kinder in die vermeintliche Situation, sich zwischen ihnen entscheiden zu müssen. Das Kind fühlt sich den Aufträgen beider Elternteile verpflichtet. Da diese aber häufig zueinander gegensätzlich sind, gerät es in einen Zwiespalt (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 17f.)
Um Konflikten zu entgehen und aufkommenden Problemen entgegenzuwirken versuchen die Kinder, jede Situation genau zu analysieren, das Verhalten der Eltern genau zu beobachten und ihr eigenes darauf abzustimmen (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 15). Da die unterschiedlichen Reaktionen der Eltern aber oft nicht im Verhalten der Kinder, sondern beispielsweise im Alkoholspiegel des suchtkranken Elternteils begründet sind, wachsen in den Kindern Schuld- und Versagensgefühle. Sie glauben häufig, dass etwas mit ihnen nicht in Ordnung sei und sie verantwortlich für die belastende Familiensituation sind (vgl. Bertenghi, 1997, S. 162).
4.3 Einfluss der elterlichen Suchterkrankung auf betroffene Kinder
Um betroffenen Kindern adäquate Hilfeangebote bieten zu können, ist es zunächst essenziell zu verstehen, in welcher Lebenswelt die Kinder sich bewegen und welche Faktoren ihren Alltag prägen. In diesem Kapitel wird daher zunächst die Lebenswelt betroffener Kinder selbst umfassend erläutert. Daraufhin folgt die Darstellung verschiedener Rollen, die in suchtbelasteten Familien typischerweise von den Kindern übernommen werden. Das Kapitel schließt mit der Erörterung möglicher langfristiger Folgen des Aufwachsens mit mindestens einem suchtkranken Elternteil.
4.3.1 Lebenswelt
Kinder aus suchtbelasteten Familien sehen sich vielfältigen Herausforderungen entgegen, müssen nicht altersgerechte Aufgaben bewältigen, und dabei stets bemüht sein, das Familiengeheimnis der elterlichen Sucht zu wahren. Im Folgenden werden einige signifikante Einflussfaktoren und Merkmale des Alltags eines Kindes dargestellt, welches in einem Haushalt mit mindestens einem suchtkranken Elternteil aufwächst.
So wie jede suchtkranke Person und jede suchtbelastete Familie immer als individuell verschieden betrachtet werden müssen, sind auch die Lebenswelten der betroffenen Kinder nie identisch[5]. Einige Merkmale treten jedoch so häufig auf, dass man sie als typisch für die Lebenswelt eines Kindes aus einer suchtbelasteten Familie bezeichnen kann. Hierzu zählen zentrale Gefühle wie Desorientierung, Scham- und Schuldgefühle, Isolierung und Redeverbot (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 8).
Da eine Suchterkrankung in unserer Gesellschaft noch immer hoch stigmatisiert und moralisierend betrachtet wird, ist die elterliche Sucht meist ein gut gehütetes Familiengeheimnis (vgl. Bauer et al., 2006b, S. 47f; DHS, 2006a, S. 7). Für die Kinder bedeutet dies, dass sie sich selbst Dinge versagen, die die Enthüllung dieses Geheimnisses bedeuten könnten. Dazu zählt auch, Freunde spontan mit nach Hause zu nehmen. Den Kindern fehlen dadurch der Erfahrungsaustausch mit Gleichaltrigen und der Erwerb sozialer Kompetenzen. Auch die Entwicklung der Selbstachtung und das Ansprechen von Konflikten werden erschwert ((vgl. Bertenghi, 1997, S. 138f.)). Sie sehen sich einer zunehmen sozialen Isolation gegenüber (vgl. DHS, 2006a, S. 7).
In einer Familie, in der ein oder beide Elternteile an einer Sucht erkrankt sind, nimmt diese Sucht so viel Raum in Anspruch, dass für die Erfüllung der kindlichen Bedürfnisse oft kein Platz mehr bleibt. Erfahrungen von Geborgenheit, Sicherheit und Bindung sind rar. An ihre Stelle treten Unsicherheit, Kälte und das Gefühl, allein gelassen zu sein (vgl. Flügel & Lindemann, 2006, S. 25f.).
Die Kinder erleben ihre Eltern häufig in beängstigenden Zuständen, zum Beispiel im Rausch, stark depressiv oder wütend. Ihre Eltern werden dadurch zu unzuverlässigen Ansprechpartnern. Zu der Angst, den Eltern könnte etwas Schlimmes geschehen, kommt oft finanzielle Not. Für die Kinder wird es immer schwerer, einfach Kind zu sein. Es kommt zu einer stetigen Überforderung des Kindes, auch weil die Eltern ihm oft zu verstehen geben, dass es „alles ist, was ich noch habe“ (vgl. Bertenghi, 1997, S. 138.).
Sehr früh müssen die Kinder daher lernen, die Versorger- und Kontrolleursrolle einzunehmen und jene Aufgaben zu erfüllen, zu denen die suchtkranken oder co-abhängigen Eltern nicht mehr in der Lage sind. Sie verspüren das Bedürfnis, sich ständig in der Nähe ihrer Eltern aufzuhalten, was ihre soziale Isolation noch vorantreibt (vgl. Arenz-Greiving, 1994, S. 38). Die Ablösungsprozesse von der Familie werden durch die Verantwortungsgefühle der Kinder erschwert oder vollständig blockiert, die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt oder gar nicht mehr wahrgenommen (vgl. Broich, 1994, S. 133f.).
Dazu kommt, dass die Eltern häufig nicht in der Lage sind, miteinander über ihre Probleme zu sprechen und sie daher das Kind sowohl als Vermittler als auch als Partnerersatz gebrauchen. Das Kind ist mit dieser Aufgabe zwar überfordert, doch das Gefühl der Anerkennung, welches es dadurch bekommt, den Eltern ein gleichwertiger Gesprächspartner zu sein, überwiegt und lässt es in der überfordernden Rolle verharren (vgl. Bauer et al., 2006c, S. 59).
Die Gefühlswelt der Kinder ist sowohl ihren Eltern als auch sich selbst gegenüber von einem ständigen Auf und Ab geprägt. Sie erleben Angst um und Angst vor dem suchterkrankten Elternteil, empfinden Scham und Ekel bezüglich der suchtbedingten Entgleisungen. Es findet ein stetiger Wechsel zwischen Vorwürfen und Mitgefühl für den suchtkranken Elternteil statt. Zudem gerät das Kind in Loyalitätskonflikte, in denen es glaubt, entweder mehr zum süchtigen oder zum nicht-süchtigen Elternteil halten zu müssen. Da die Eltern häufig in ihrer Erziehung zwischen den Extremen „Verwöhnung“ und „Vernachlässigung“ schwanken, sieht sich das Kind einem immerwährenden Wechsel von Liebe und Zuneigung zu Enttäuschung und Verletzung entgegengestellt. Es entstehen Gefühle der eigenen Wertlosigkeit, ein Mangel an Freude bis hin zu Formen der kindlichen Depression (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 126). Betroffene Kinder sind meist nicht in der Lage, die Abhängigkeit ihrer Eltern verstehen zu können. Viele entwickeln Schuldgefühle und leben in dem Glauben, die Eltern nähmen Drogen oder tränken Alkohol, weil mit ihnen, den Kindern, etwas nicht in Ordnung sei oder sie etwas falsch machen würden (vgl. Bertenghi, 1997, S.153).
Zusätzlich kommt es in suchtbelasteten Familien immer wieder zu psycho-sozialen Einschnitten, die das gesamte Familiensystem betreffen. Beispiele hierfür sind der Verlust des Arbeitsplatzes, die Trennung der Eltern oder Klinikaufenthalte des erkrankten Elternteils. Gegebenenfalls macht die häusliche Situation eine vorübergehende oder längerfristige Fremdunterbringung des Kindes notwendig. Diese Umstände verlangen von den betroffenen Kindern ein hohes Maß an Aushalten-Können und Flexibilität. Daraus entstehende Einschränkungen hinsichtlich grundlegender Lebenskomponenten verursachen eine große Verunsicherung auf Seiten des Kindes. In ihrem Alltag herrscht ein Mangel an Kontinuität, Verlässlichkeit und an Ausweichmöglichkeiten, um den schwierigen Situationen, zumindest vorübergehend, zu entkommen (Schulze et al., 2014, S. 4).
In Familien mit mindestens einem suchterkrankten Elternteil ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder einer Form von Gewalt ausgesetzt sind, Schätzungen zufolge doppelt bis dreifach so hoch wie in Familien ohne Suchtbelastung. Es kommt hierbei sowohl zu emotionalen, als auch zu körperlichen oder sexuellen Grenzüberschreitungen[6]. Kinder sind, besonders bei sexueller Gewalt, oft ohne Chance, sich gegen solche Übergriffe zur Wehr zu setzen. Um das Erlebte zu ertragen spalten sie ihre Gefühle ab und verleugnen das Geschehene. Zudem ist diese Form von Zuwendung oft die einzige, die sie von ihren Eltern erfahren (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 16f.).
Konkrete Folgen dieser fortwährenden vielfältigen Überforderung können sein, dass Kinder aus suchtbelasteten Familien im schulischen Kontext häufiger mangelnde Leistungen erbringen und durch unangemessenes Verhalten auffällig werden. Sie zeigen vermehrt Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen, sowie Störungen im Sozialverhalten. Außerdem weisen viele von ihnen mehr Ängste und depressive Symptome auf und neigen zu somatischen oder psychosomatischen Symptomen (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 10). Obwohl Kinder aus suchtbelasteten Familien von klein auf dazu gezwungen sind, an einem sich immer mehr zuspitzenden Familiendrama teilzunehmen, reagieren nicht alle von ihnen darauf mit sichtbaren Störungen. Viele Kinder wirken zunächst eher unauffällig und angepasst, sind still und hilfsbereit. Einige entwickeln erst im Erwachsenenalter ein Bewusstsein dafür, welchen ungesunden Regeln sie in ihrer Kindheit ausgesetzt waren (vgl. DHS, 2006a, S. 6).
4.3.2 Rollenübernahme
Als wichtigster Sozialisierungsarm der Gesellschaft werden in jeder Familie die grundlegenden Geschlechts-, Eltern-, Kinder- und andere Rollen entworfen, gelehrt und verstärkt (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 27). In jeder Familie nehmen dabei die Familienmitglieder bestimmte Rollen ein, die in ihrem Zusammenspiel für einen Gleichgewichtszustand in der Familie sorgen. In einem funktionalen Familiensystem sind diese Rollen flexibel, können von den Einzelnen ausprobiert und immer wieder getauscht werden (vgl. DHS, 2006a, S. 8). Da die Familie selbst neben dem Teil des gesellschaftlichen Systems ein eigenes komplexes System darstellt, welches ihren Mitgliedern Sicherheit, Sinnhaftigkeit und Befriedigung verschaffen soll, entwickelt jede Familie ihre eigene individuelle Rollenstruktur. Diese kann dabei mit der Sozialisierungsfunktion der Familie harmonieren oder in Konflikt stehen. (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 27).
Durch den oft über Jahre andauernden Stress- und Überforderungszustand, der in suchtbelasteten Familien herrscht, stellt die Rollenübernahme hier hauptsächlich den Versuch dar, der belastenden Umweltsituation durch aktives Handeln entgegenzutreten (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 132). Sie dient der Stressabwehr und wird zu einer Art „Überlebensstrategie“, die es den Kindern und Erwachsenen ermöglicht, mit dem engen Regelkorsett der Familie zurechtzukommen und Gefühle auszuschalten, die dem Familienzusammenhalt zuwiderlaufen. Die Rollenübernahme verläuft dabei weitgehend unbewusst, langsam und von den Familienmitgliedern unbemerkt (vgl. Bertenghi, 1997, S. 145).
Häufig wird die übernommene Rolle für die Kinder aus suchtbelasteten Familien im Laufe der Zeit zum festen Bestandteil ihrer Persönlichkeit, den sie ohne fremde Hilfe nicht mehr ablegen können. Die betroffenen Kinder sind auf eine Weise von ihrer Rolle abhängig, die der Abhängigkeit der Eltern/des Elternteils vom Alkohol oder anderen Drogen ähnelt. Sie haben keine Verhaltensalternativen gelernt und verharren so in ihrer starren Rolle (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 27f.). So schaffen es viele Kinder selbst im Erwachsenenalter nicht, sich von dem rigiden Rollenmuster zu lösen, da es ihnen ein Gefühl von Schutz und Sicherheit gibt (Bertenghi, 1997, 145).
In der Fachliteratur wurden meist vier Rollenmuster herausgearbeitet, deren Übernahme typisch für Kinder aus suchtbelasteten Familien ist[7]. Es handelt sich bei diesen Rollen im Wesentlichen um typische Verhaltens- und Beziehungsmuster, die im Lebensalltag der Kinder zur Gewohnheit werden und die sie in ihrer Kindheit, Jugend und oft auch im Erwachsenenalter besonders auf kritische Situationen anwenden (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 131).
Im Folgenden werden die vier Rollenmuster detailliert beschreiben, die im Großteil der diesbezüglich vorhandenen Fachliteratur herausgearbeitet worden sind[8].
a. Das Heldenkind
Häufig wird die Rolle des Heldenkindes vom erstgeborenen Kind oder einem Einzelkind übernommen (vgl. Bertenghi, 1997, S. 28; Zobel, 2008, S. 46).
Diese Kinder zeigen eine hohe Bereitschaft, familiäre Verantwortung zu übernehmen. Sie erledigen Aufgaben, die von Vater und/oder Mutter nur noch unzureichend oder gar nicht mehr wahrgenommen werden. Heldenkinder erbringen zudem oft hohe schulische und sportliche Leistungen. Sie werden als besonders vernünftig, fleißig, selbstständig und frühreif bezeichnet und erhalten für ihre erbrachten Leistungen von ihrer Umwelt und den Eltern viel positive Anerkennung (vgl. Bertenghi, 1997, S. 28f.; Homeier & Schrappe, 2012, S. 131; Flügel & Lindemann, 2006, S. 21; Zobel, 2008, S. 46).
Durch das Übernehmen der Rolle des Heldenkindes haben diese Kinder die Möglichkeit, Fähigkeiten wie Selbstvertrauen, Selbstgenügsamkeit, Übernahme von Verantwortung, Beharrlichkeit und soziale Intelligenz zu erwerben. Allerdings laufen sie Gefahr, vom Lob und der Anerkennung der Umwelt abhängig zu werden, einen zwanghaften Ehrgeiz zu entwickeln, sich Fehler zu verbieten und zu glauben, für alles die Verantwortung übernehmen zu müssen (vgl. Arenz-Greivig, 2007, S. 29; Flügel & Lindemann, 2006, S. 21). Des Weiteren bleiben die kindlichen Bedürfnisse des Heldenkindes durch sein Verhalten weitgehend unerfüllt und es beraubt sich selbst der Möglichkeit, sich an Autoritäten anzulehnen (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 28f.). Da sich trotz all seiner Mühen an der Familiensituation meist nichts ändert, leidet das Heldenkind häufig unter starken Minderwertigkeits- und Schuldgefühlen (vgl. Arenz-Greiving, 2007, 38).
b. Das rebellische Kind
Diese Rolle wird oft von zweitgeborenen oder mittleren Kind übernommen. Im Gegensatz zum Heldenkind, welches sein Aufmerksamkeitsbedürfnis mittels positiver Anerkennung zu erfüllen versucht, wird dem rebellischen Kind durch sein ausagierendes, oft „unangemessenes“ Verhalten viel negative Aufmerksamkeit zuteil. Es verhält sich in Beziehungen konfrontativ, ist feindselig und trotzig (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 30f.).
Durch seine „Sündenbockfunktion“ lenkt das rebellische Kind vom eigentlichen Problem der Familie, der Sucht eines oder beider Elternteile, ab und nimmt somit auch eine entlastende Rolle ein, obwohl es zunächst eher den Eindruck einer zusätzlichen Belastung der Familie vermittelt. Es übernimmt sozusagen die Schuld an allen Familienproblemen, was zu einer seelischen Überbelastung es Kindes führt. Die dadurch erneut entstehenden Schuldgefühle und Verletzungen werden wiederum durch abweichendes Verhalten kompensiert (vgl. Arenz-Greiving, 2007, 30f.; Flügel & Lindemann, 2006, S. 21f.; Homeier & Schrappe, 2012, S. 131; Zobel, 2008, S. 46f.).
c. Das Träumerkind
Die Rolle des Träumerkindes wird oft vom drittgeborenen Kind übernommen. Da das Heldenkind schon die positive und das rebellische Kind die negative Aufmerksamkeit für sich beansprucht haben, kann das Träumerkind keines von beiden auf sich beziehen. Es verhält sich daher still und fügsam. Diese Kinder leben oft zurückgezogen, versuchen weder etwas zu verhindern noch für die Familie Verantwortung zu übernehmen. Träumerkinder behalten ihre Bedürfnisse für sich und versuchen der Familie durch möglichst unauffälliges Verhalten nicht zur Last zu fallen. Konflikte werden gemieden, Situationen akzeptiert und eine stille Anpassung erfolgt. Die Kinder geraten in zunehmende Isolation (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 32). Sie haben oft wenig Freund*innen, Probleme mit Entscheidungen und leiden an Übergewicht. In der Schule verhalten sie sich still und schüchtern, sind also oft typische Einzelgänger*innen. (vgl. Flügel & Lindemann, 2006, S. 22). Durch sein oft als „pflegeleicht“ bezeichnetes Verhalten entlastet das Träumerkind die Familie, läuft aber auch Gefahr, schlichtweg „vergessen“ zu werden (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 32). Um dem unkontrollierbaren und unberechenbaren Verhalten der Eltern zu entgehen, zieht sich das Träumerkind mehr und mehr in seine eigene Welt zurück (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 131).
Die Gefühlswelt der Träumerkinder ist durch Verlassenheit, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit und Minderwertigkeitsgefühle geprägt. Sie haben Schwierigkeiten im sozialen Kontakt und zeigen konfliktscheue Verhaltensweisen (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 32; Homeier & Schrappe, 2012, S. 131; Zobel, 2008, S. 47).
d. Das Clownkind
Die Rolle des Clownkindes wird meist vom letztgeborenen Kind übernommen. Signifikante Charakterzüge eines Clownkindes sind seine Offenheit und sein Sinn für Spaß und Humor. Es versucht, die Familie zum Lachen zu bringen und so von der negativen, belastenden Grundstimmung, der elterlichen Suchterkrankung und den damit zusammenhängenden Problemen abzulenken. Neben der Ablenkung finden diese Kinder durch ihr Verhalten einen Weg, positive Aufmerksam auf sich zu ziehen (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 33; Flügel & Lindemann, 2006, S. 22; Homeier & Schrappe, 2012, S. 131; Zobel, 2008, S. 47).
Durch ihren Humor erreichen Clownkinder viele Lacherfolge, erfreuen sich großer Beliebtheit und können so ihr Selbstwertgefühl aufwerten. Aus Angst vor dem Verlassen-Werden entsteht jedoch ein innerer Zwang zum Lustig-Sein und es fällt diesen Kindern schwer, die Grenzen zum Aufhören zu erkennen. So werden sie unfähig, ernst zu bleiben und ihre negativen Gefühle auszudrücken. Ihr Harmonie- und Anerkennungsbedürfnis ist besonders hoch. Zudem wirken Kinder, die im Familiensystem die Rolle des Clownkindes übernehmen, häufig hyperaktiv, unreif, ängstlich und wenig belastbar. Auch Lernstörungen und eine kurze Aufmerksamkeitsspanne sind sichtbare Zeichen (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 33; Flügel & Lindemann, 2006, S. 22; Homeier & Schrappe, 2012, S. 132).
Zusammenfassend fällt auf, dass allen Rollen ein hohes Maß an Unehrlichkeit, Perfektionismus, Verleugnung, Kontrollverhalten und Selbstbezogenheit eigen ist. Alle Rollen beinhalten zunächst auch positive Effekte, können aber zu vielfältigen negativen Folgen führen, wenn sie die einzige, rigide einbehaltene Rolle des Kindes bleiben (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 34).
Ebenso wird in allen Rollen die eigene Gefühlswelt verleugnet. Die Gründe hierfür sind dabei unterschiedlich: das Heldenkind versucht, sein vermeintliches Versagen nicht zu spüren, das rebellische Kind leugnet seine Verletztheit, das Träumerkind möchte seine innere Verwirrung und Einsamkeit nicht wahrnehmen und das Clownkind versucht, seine Angstgefühle nicht Überhand nehmen lassen. Dadurch, dass sich die Kinder in eine verzerrte Wahrnehmung flüchten, ist es ihnen nicht möglich, zu erkennen, dass die Ursache für die negativen Gefühle bei den Folgen der elterlichen Abhängigkeitserkrankung liegt und nicht, wie sie häufig glauben, bei sich selbst (vgl. Bertenghi, 1997, S. 180).
4.3.3 Langfristige Folgen
Häufig werden die Belastungen aus der Kindheit erst im Erwachsenenalter in Form von psychischen Spätfolgen sichtbar (vgl. Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 10).
Erwachsene, die in einer suchtbelasteten Familie aufgewachsen sind, entwickeln oft Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen und am Arbeitsplatz. Sie sind häufiger Klienten medizinischer und psychosozialer Institutionen oder entwickeln eine eigene Abhängigkeitserkrankung. Auch die Selbstmordrate unter Betroffenen und die Zahl der psychischen Erkrankungen ist erhöht (vgl. DHS, 2006a, S. 8). Besonders häufig treten Angststörungen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen und eigene Suchterkrankungen auf (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 7).
Begründen lässt sich dies damit, dass die Erfahrungen, die ein Mensch in den ersten Lebensjahren macht sich am tiefsten einprägen und später am wenigsten relativierbar und korrigierbar sind (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 11). Die während der Kindheit übernommenen Rollen und die erlernten rigiden Regeln und Verhaltensmuster können im Erwachsenenalter hinderlich für den Aufbau von Beziehungen zu sich selbst und anderen sein. Zwar stellten sie in der Vergangenheit wichtige Hilfsmittel dar, mit denen die belastende Familiensituation erträglicher wurde, doch um ein selbstbestimmtes und -verantwortliches Leben als Erwachsener führen zu können, müssen diese abgelegt werden (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 41f.). Da sich viele erwachsene Kinder aus suchtbelasteten Familien noch immer einen Teil der Schuld für die elterliche Suchterkrankung geben, fällt ihnen die Ablösung vom Elternhaus schwer. Sie befürchten eine Verschlimmerung der Situation, wenn sie die Familie allein lassen. So behindern sie sich selbst darin, Verantwortung für das eigene gegenwärtige Handeln zu übernehmen und selbstbestimmte Ziele zu verfolgen, leben gedanklich in der Vergangenheit und erhalten ihre Schuldgefühle aufrecht (vgl. Arenz-Greiving, 2007, S. 42).
Auch wenn die Kinder aus suchtbelasteten Familien es im Erwachsenenalter schaffen, sich äußerlich zu lösen, haben sie die Beziehung zu ihren Eltern und die damit verbundene Co-Abhängigkeit tief verinnerlicht. Das führt dazu, dass diese Menschen oft eine Beziehung mit einem suchtkranken Partner eingehen. So finden sie sich in vertrauten Strukturen wieder und können die bereits gelernten Überlebensstrategien weiter anwenden. Jedoch wird durch dieses Verhalten auch die andauernde Überforderung, die eine Co-Abhängigkeit mit sich bringt, aufrechterhalten. Um diesem kontinuierlichen Stresszustand zu entkommen, flüchten sich viele betroffene Personen in Alkohol, Medikamente oder andere Drogen und entwickeln eine eigene Suchterkrankung[9] (vgl. Bertenghi, 1997, S. 186).
5 Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von Kindern suchtkranker Eltern
Nicht alle Kinder aus suchtbelasteten Familien entwickeln in ihrem späteren Leben ein eigenes Suchtverhalten oder leiden unter psychischen Erkrankungen. Einige von ihnen leben auch im Erwachsenenalter vergleichsweise unbelastet. Es gilt herauszufinden, welche Merkmale diese Kinder innehaben, die eine solche Resilienzentwicklung unter Umständen begünstigen. Die erarbeiteten Merkmale stellen dann Orientierungspunkte für effektive Präventionsarbeit mit Kindern suchtkranker Eltern dar (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 132f.; Lindemann, 2006, S. 17). Der Ausarbeitung der Resilienzfaktoren schließt sich eine Darstellung weiterer Lebensbereiche betroffener Kinder an, die der besonderen Förderung bedürfen, um ihnen den Umgang mit der belastenden familiären Situation zu erleichtern und diesen gegebenenfalls sogar dauerhaft zu verbessern.
5.1 Resilienz
Der Begriff „Resilienz“ bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern bezüglich biologischer, psychologischer und psychosozialer Entwicklungsrisiken. Resilienz ist also die hohe Widerstandskraft gegen Stress, die den Kindern stark ausgeprägte Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. Homeier & Schrappe, 2012, S. 132; Klein, 2005 zitiert nach Arenz-Greiving, Erger, Körtel & Krasnitzky-Rohrbach, 2007, S. 23).
- Arbeit zitieren
- Hanna Meyer (Autor:in), 2017, "VerSucht". Präventive Hilfsangebote für Kinder suchtkranker Eltern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373191
Kostenlos Autor werden




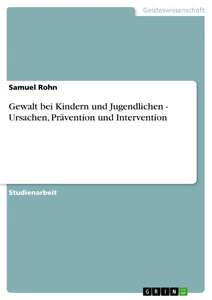







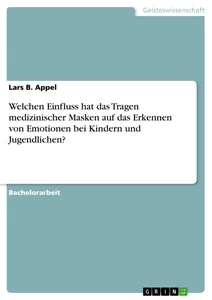








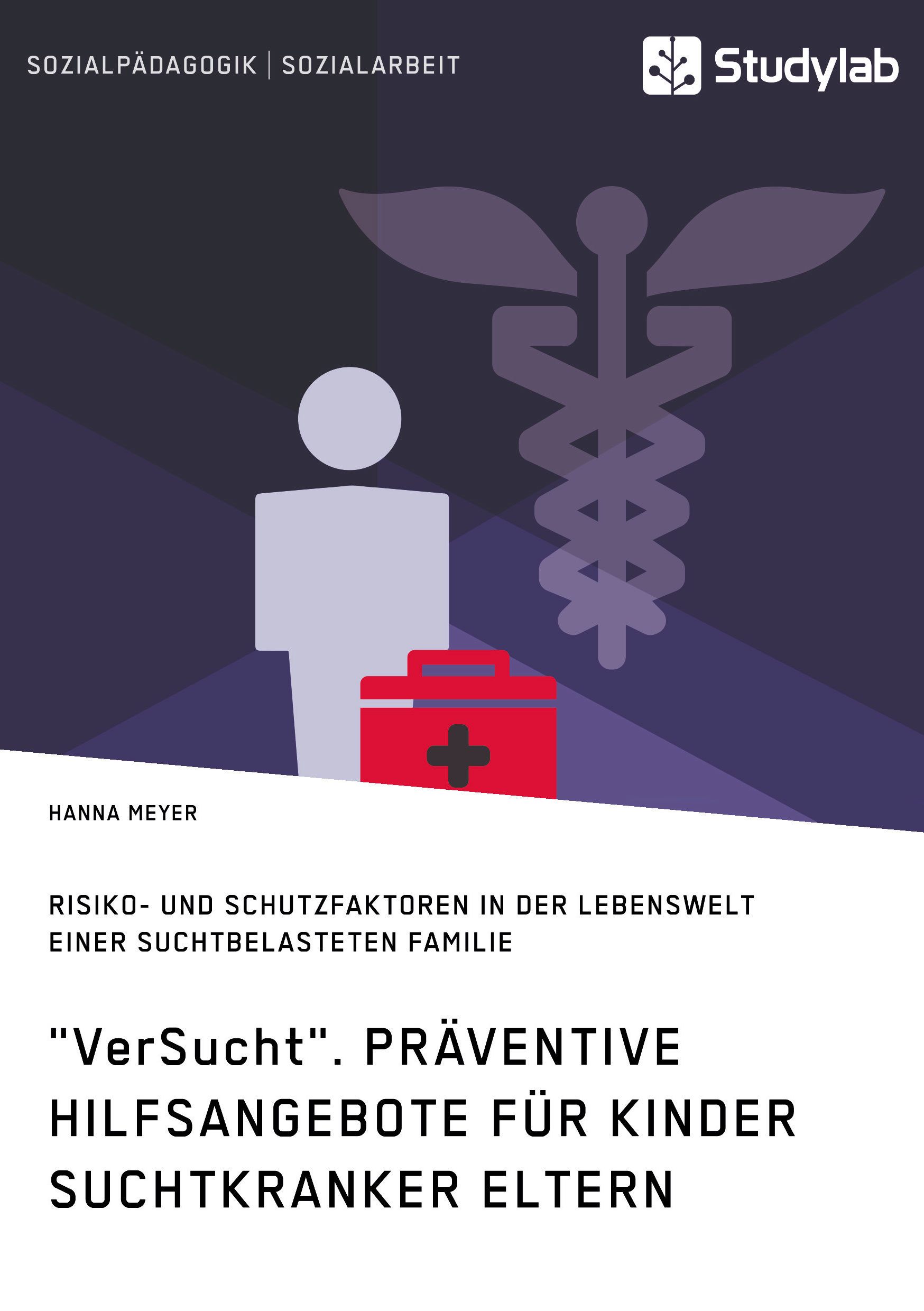

Kommentare