Leseprobe
Linksradikale schreien nach Bildung für „die dummen Pegida-Assis“ und tragen dabei Jogginghosen. Zeit-Leser echauffieren sich über die Borniertheit Trump wählender „Rednecks“ und tragen dabei flauschige Karohemden. Bedienen sich Antifas und linke Intellektuelle kulturimperialistischer Mittel um sich nicht nur nach „oben“, sondern auch nach „unten“, abzugrenzen? Und das, obwohl sie doch diejenigen sind, die die Ungeheuerlichkeiten des Kapitalismus nicht länger hinnehmen können, die ihn als Zumutung empfinden und mitunter ihr Leben danach ausrichten ihn zu überwinden. Verachten sie, die solidarisch sein wollen mit den „Verdammten dieser Erde“, insgeheim die Arbeiter*innenklasse? Dieser Vorwurf zieht sich durch einige aktuellere Publikationen und bedarf dringend einer Reflexion. Da sich die Autorin selbst diesem Milieu zugehörig fühlt, sind viele der zur Veranschaulichung der Argumentation angeführten Beispiele an direkte Erfahrungen gebunden, was nicht zuletzt dem Zweck einer selbstkritischen Auseinandersetzung innerhalb dieser sozialen Zusammenhänge dienlich sein könnte.
Balibar hat in seinen Gedanken zum Krisenrassismus zurecht angemerkt, dass Rassismus nicht ein Problem mangelnder Bildung ist. Etliche empirische Studien belegen, dass er sich durch sämtliche Milieus moderner westlicher Staaten zieht. Für die Wahl der Nationalsozialisten waren mehr Mittelschichtsangehörige als Arbeiter*innen verantwortlich1. Bei Pegida laufen nur 12% Prekäre mit, wohingegen fast die Hälfte der Teilnehmenden ihre eigene Lage als „gut bis sehr gut“ einschätzt2. Dennoch hält sich die stereotype Vorstellung vom „bildungsfernen“ „Proll“, der seine Frau* schlägt, vor allem fleischiges Fast Food isst und betrunken vorm Flüchtlingsheim pöbelt. Inzwischen ist es auf Anti-Nazi-Demonstrationen angekommen, dass man die politischen Gegner nicht mehr als „Nazifotzen“ beschimpft - „Sexismus gegen Rechts ist echt uncool, Alder“. Offenbar genießt der „Naziproll“ (oder wahlweise „Nazi-Ork“3 ) einen besseren Ruf als die „Nazifotze“. Angenommen Intersektionalität oder Transversalität würde ernst genommen, müssen sich linke Mittelschichtssprösslinge fragen lassen, ob Klassismus gegen Rassismus nicht dieselbe Logik bedient.
Wenn der Anwaltssohn Marx in seinen Briefwechseln mit Engels4 unverhohlen über Arbeiter*innen (diese „Esel“) herzieht, denen er keinerlei emanzipatorische Handlungen zutraut, sollte spätestens das einem doch zu denken geben. Nachdenken über die eigene Verstricktheit. Man schafft es ja inzwischen auch, das eigene Freiwilligenjahr in einem „Entwicklungsland“ zu hinterfragen und Frauen* keine Werkzeuge mehr aus der Hand zu reißen.
Die „Prolls“ scheinen für Linke tatsächlich etwas nebulös Abstoßendes an sich zu haben, was sie für emanzipatorische Zwecke ungeeignet macht. Es wird unterstellt, sie seien so unreflektiert, dass es schon eine harte Bürde wäre, sie zu politisieren. Moment - white men's burden reloaded? Sookee rappt, „wir haben ein Buch mit und ihr habt nur Muckis, wir bringen euch bei, dass langsam mal Schluss ist“. So sehr diese Zeilen feministisch motiviert sind, sie bedienen dennoch das Klischee vom ewig misogynen Unterschichtsangehörigen. Paradoxerweise geht es im Rest des Tracks um einen sehr belesenen Antifa, der seinen Sexismus gegenüber den die reproduktiven Tätigkeiten im Jugendzentrum ausführenden Frauen* hinter seiner feministischen Bildung verstecken kann. Schließlich wisse er über den gemachten Mann zu referieren und sei total „poly und so“. Hier offenbart Sookee ein Muster, das auf den zweiten Blick in sämtlichen Diskriminierungsformen zu finden ist: Bildung macht seltsam unangreifbar.
Was ist es, was diese vermeintliche Unangreifbarkeit ausmacht? Die Logik darin scheint funktional nicht weit entfernt von unserem vorgeblich auf Leistung beruhendem, hoch selektiven Bildungssystem zu liegen: Diejenigen, denen Asse im Ärmel versteckt wurden, werden dafür gefeiert, welch grandioses Spiel sie abliefern. Sie merken lange bis gar nicht, dass sie diese Asse dort erstens nicht selber deponiert haben und zweitens, dass es eben dadurch ein Spiel unter ungleichen Voraussetzungen ist. Oft glauben sie selbst dann noch fest an ihr einzigartig überlegenes Können im Fair Play der Chancengleichheitsideologie, nachdem ihnen jemand ihr Erfolgsgeheimnis zugeflüstert hat. Die „PC-Roboter“ werden angehimmelt, während sie sich durch selbstreflexives, und natürlich voll und ganz ironisches, intellektuelles Redenschwingen vor dem Abwasch drücken können.
Ich finde die Untersuchungsergebnisse Sarah Specks zu Frauen* als Haupternährerinnen plausibel, nach denen sich kontraintuitiv gerade in „bildungsnahen“ Milieus traditionelle Strukturen geschlechtlicher Arbeitsteilung finden lassen. Individualistische Werte wie Autonomie und Selbstverwirklichung sind hier dominant gegenüber egalitären Ansprüchen an heterosexuelle Partner*innenschaft. Dieser Umstand führt zur Dethematisierung realer Ungleichheiten. Kann nicht sein, was nicht sein darf? Die Abhängigkeiten verschleiernde Inszenierung der eigenen Autonomie wird einerseits von Männern* selbst eingefordert um Statusverluste auszugleichen, als auch auf der Ebene sexueller Attraktion an sie herangetragen. Wollen bürgerlich-feministische Hetero-Frauen* nach Arbeit lieber den Haushalt alleine schmeißen oder an rassifizierte Frauen* weiterreichen, damit sie sich an der Illusion ihres lonesome Stadt-Cowboys aufgeilen können? Haben linke Männer* so viel Angst vor männlichem* Statusverlust, dass sie auf Kosten von Frauen* lieber „ihr Ding machen“, anstatt ihre tatsächlichen Abhängigkeiten anzunehmen? Offenbar haben Paare in Milieus mit klassischen familialistischen Werten weniger ein Problem damit, wenn Frauen* die Haupternährerinnen sind, weil ihnen Zusammenhalt wichtiger ist als individuelle Verwirklichung. Das Scheitern an der praktischen Umsetzung der eigenen ideellen Werte von Egalität und das Kaschieren desselben ist bereits ein erster guter Hinweis darauf, wie sich der Klassismus hartnäckig in sich als aufgeklärt verstehenden Milieus halten kann.
Was der Bourdieusche Begriff „Klassenrassismus“ betont, ist die Essentialisierung und damit Festschreibung von Klassenunterschieden analog der biologisierten angeblichen „Rasse“- Unterschiede. Das ist ein spannender Gedanke, bei dem es sich sicher lohnt, inne zu halten. Wenn Wei ß e ihre privilegierte Stellung gegenüber Nicht- Wei ß en essentialisieren und sie damit rechtfertigen, finden sich viele Stimmen, die das als furchtbar rassistisch betiteln. Dafür lassen sich überzeugende Argumente nennen, keine Frage. Aber wenn sportlich gekleidete Studierende - Weiß oder nicht Weiß - in Dresden Neustadt in die S-Bahn steigen um 9 Stationen nach Heidenau zu fahren und beginnen ebenfalls Jogginghosen tragenden Fußgänger*innen (mit Lidl-Tüte in der Hand anstelle des Turnbeutels um die Schulter) „Drecksnest“ und „Scheiß Pack“ entgegen zu brüllen, nachdem auch dort eine Notunterkunft für Geflüchtete angegriffen wurde, ist das scheinbar etwas anderes. Irgendwie muss die Wut nun einmal raus. Irgendwo muss sie hin.
Das ist doch eine interessante Bewältigungsstrategie, die die Soziologie Studierenden unter den Vermummten vielleicht systemtheoretisch als „Komplexitätsreduktion“ oder sozialpsychologisch als „Projektion“ einordnen würden - würden sie diese bei den Leuten mit der Lidl-Tüte beobachten. Zwei Begriffe, die in die Alltagssprache einer Mehrheit dieser Demonstrierenden übergegangen sind, mit denen sich die schwer fassbare offene Menschenverachtung der überzeugten Rassist*innen irgendwie begreifbar machen und sich die eigene, ebenso unfassbare, währenddessen klammheimlich abtrennen, umlenken und kaschieren lässt. Nach Kemper brauchen „[d]ie privilegierten Klassen (...) in Deutschland die Biologisierung, damit sie sich nicht der freien Konkurrenz mit den beherrschten Klassen stellen und diesen gegenüber einmal wirklich für ihre Stellung rechtfertigen müssen.“5 Es wäre folglich eine spannende Frage an gebildete Menschen, die das Privileg inne haben in hippen Hausprojekten preisgünstige Zimmer zu belegen und ihr relativ großes soziales und kulturelles Startkapital nun in Form von Soft Skills und Self-Management an diesen Orten weiter mehren, was sie selbst für innere (Rechtfertigungs-)Überlegungen darüber anstellen, wie sie zu diesen begehrten Zimmern gekommen sind. Oder warum sie eigentlich außerhalb der eigenen vier Wände Jogginghosen tragen. Mal davon abgesehen, dass die echt bequem sind, wird offen ein antibürgerliches Statement bezweckt. Es ist gleichzeitig ein Versuch, sich gegen die eigene privilegierte soziale Herkunft zu stellen (für die man sich teilweise schämt), der von anderer Seite allerdings wie eine Vernebelungstaktik dieser interpretiert werden kann. Weil man keine Ahnung hat, wie der Kapitalismus jetzt konkret abgeschafft werden und wie wirksame Solidarität aussehen kann - oder durchdachte Bemühungen ins Leere laufen - intensiviert man identitäre Ausdrucksformen des eigenen Anspruchs. Ich denke, der auch in anderen Zusammenhängen - z.B. „Critical Whiteness“ - geäußerte Vorwurf des Kulturimperialismus ist eine vielfach verständliche Ermächtigungsstrategie, birgt jedoch die Gefahr einer Reessentialisierung des Kulturbegriffs. Es stellt sich die Frage, was das letzte Ziel dieser Strategie ist - abgetrennte Kulturen und Klassen, die sich auf ewig nur einer traditionellen Kleidung und Musik bedienen dürfen? Und wer legt die Grenzen des Erlaubten fest? Die schwulen Jamaikaner ohne Dreadlocks, die den Sexismus der Rastafari-Sekte nicht mehr ertragen wollten und in die USA emigrierten? Eine App, die deine Hautfarbe erfasst, nach einer Skala einordnet und dir sagt, ob du Dreads tragen darfst? Die soziale Herkunft „linker Wohlstandskinder“ als unumstößliche, quasi magische innere Eigenschaft zu betrachten, trägt meines Erachtens zur Zementierung von Klassenspaltungen bei. Nicht nur schwingt eine essentialistische und somit deterministische Subjektauffassung mit, es wird zudem leicht die ökonomische Dimension aus den Augen verloren. Denn das Perfideste ist doch nicht, dass Menschen sich an „indigenen“ Stoffmustern oder Rap erfreuen - was sogar mit einer gewissen Anerkennung einhergeht -, sondern dass damit Profit erwirtschaftet wird, der nicht bei den prekarisierten Erfinder*innen ankommt. Es mag einem dennoch aus einer bestimmten Perspektive heraus zynisch vorkommen, wenn „Zecken“, die bei der Uno Karriere machen könnten, sich Stoffhosen bedrucken um möglichst „Assi“ auszusehen. Wem nützt das real etwas?
Menschenverachtende Einstellungen vor allem „Prolls“ zuzuschreiben läuft wie gesagt jeder sozialwissenschaftlichen Empirie zuwider. Es höhle den Begriff des Rassismus jedoch relativierend aus, wenn man ihn auch auf die eigene, bereits reflektiertere, Haut anwendete, ist an der Stelle ein Argument, das bis zu einem gewissen Grad einleuchtet. Es kann sogar in „unemanzipatorische“ Abwärtsspiralen führen, wenn sich in religiöser Manier permanenter Selbstgeißelung zerfleischt wird und sich keine Zeit mehr für Trivialitäten wie Selbstfürsorge genommen wird. Sich die soziale Welt moralisch aufzuteilen, was an der Stelle eben ziemlich leicht möglich ist und im Zuge der notwendigen Komplexitätsreduktion auch nicht ganz vermeidbar, ist gefährlich. Es ist zwar vorher nicht ganz klar, wer gut und wer böse sein wird. Das mag aufregender sein als ein klassischer Actionfilm, ist dafür ziemlich unentspannt. Am Ende gehört man selbst wahrscheinlich doch wieder zu den Guten, aber muss sich sehr anstrengen das Gutsein nach außen und innen aufrecht zu erhalten. Eine nachhaltigere Strategie als der dauerhafte Drahtseilakt auf der Achse des Guten scheint mir zu sein, sich genauer anzuschauen, was für Faktoren bei einer selbst dazu geführt haben, sich politisch weiter zu entwickeln. Denn sich selbst unter den Guten wähnen und sich von den schlechten Menschen abgrenzen zu wollen, kommt zynischer Weise einer Widerspiegelung des viel kritisierten Extremismus-Vorwurfs der selbst ernannten „Mitte“ an Linke gleich: „Wir“ sind dabei noch im Rahmen, die „anderen“ sind schon rassistisch genug um so benannt zu werden - durch uns.
Niemand von uns wurde „so geboren“6. Wir alle könnten uns doch, wenn wir ehrlich sind, köstlich, wenn auch peinlich berührt, über Dinge amüsieren, die wir früher gedacht haben. Schlummert nicht noch irgendwo ein Palituch im Schrank? Es sollte klar sein, dass die meisten Menschen in 300 Jahren vieles, was wir zur Zeit fabrizieren, komplett unverständlich und lächerlich, vielleicht sogar falsch finden werden. Das ergibt sich nicht zuletzt aus einem enormen Wissensvorsprung sowie veränderten Subjektivierungsprozessen uns gegenüber, die wir analog gegenüber den Menschen vergangener Jahrhunderte haben. Diese Erkenntnis könnte bedeuten, dass man es als menschlich anerkennt, sich auf die Welt einen Reim machen zu wollen und Komplexitätsreduktion nicht als etwas betrachtet, dass nur „dumme“ Leute benötigen. Das 2. Semester Soziologie macht das Angebot, diesen Prozess als Eigenschaft psychischer (und anderer) Systeme generell zu werten. Auch das Gehirn ein*er Professor*in für Atomphysik wird nicht den Tag damit verbringen, sämtliche Umweltreize oder das Verhalten ihrer Mitarbeiter*innen jedes Mal von Grund auf zu interpretieren. Hierin liegt die Hoffnung, dass Menschen im Übergang der Moderne zu etwas Neuem ihre Ersatzreligionen abstreifen könnten und in Folge weniger moralisch mit sich und anderen umgehen und offenere, dafür solidarischere Lernprozesse versuchen. Aus den Antworten auf die Frage, was uns einmal zum Umdenken gebracht hat, ließen sich bestimmt noch ein paar neue Strategien ableiten. Dabei wäre es nur tragisch, die Asse im Ärmel zu vergessen.
Soziale Kämpfe aller Art könnten sich in diesem Sinne darauf fokussieren, dass sämtliche Lohnabhängigen irgendwann keinen Anlass mehr dazu haben, ihren Frust in essentialisierte Form zu gießen um die vermeintlich draußen Stehenden damit zu übergießen. Es gibt bereits Ansätze inklusorisch oder transversal konzipierter Demonstrationen und Projekte, die dazu einladen, mitzuwirken.
Bei der Suche nach den Gründen des Klassismus sollte eine unangenehme Frage nicht ausgespart bleiben, nämlich die der Sympathie. Unsere soziale Klassenzugehörigkeit, deren habituelle Codes wir uns in unserem Sozialisationsprozess unbewusst aneignen, prägt nicht nur welche Sprachmuster wir später verwenden oder ob wir Drehtabak oder Pfeife rauchen. Sie beeinflusst auch, was wir witzig finden und mit wem wir uns „gut verstehen“. Es geht beim „Sich mit jemandem Verstehen“ eben nicht nur um die gleiche Sprache. Menschen können sich auf einer Party unter Fremden tendenziell spontan besser aufeinander einlassen, wenn sie ähnliche Musik hören, ähnliche politische Einstellungen habe und ähnliche Kleidung tragen. In einem zauberhaften Moment stellt sich später am Abend heraus, dass die sympathische, witzige Person nicht nur in der gleichen Boulderhalle klettert, sondern ebenfalls studiert, in einem ähnlich langweiligen Viertel aufgewachsen ist und Eltern mit solidem Einkommen hat, die vielleicht keine Ärzt*innen, dafür aber Ingenieur*innen sind. Es lohnt sich nicht Illusionen darüber zu machen, warum in WG- Castings oder Vorauswahlgesprächen für einen Studiengang wie „Internationale Beziehungen“ bestimmte Menschen kaum Erfolgschancen haben. Studierende Arbeiterkinder müssen sich, wie nicht nur Christian Baron an seiner Biografie nachvollziehbar darlegt, in einem jahrelangen habituellen Anpassungsprozess zurecht formen, damit irgendwann niemand mehr merkt, welcher Seite der Verhältnisse sie entstammen. Dabei wirkt ein anhaltender Druck, sich nicht „ertappen zu lassen“, während das Unbehagen „Klassenverrat“ zu begehen, konsequent bei Seite geschoben werden muss. Leute, die das geschafft haben, verstehen sich dann gut mit denen, die sich dafür nicht anstrengen mussten - sogar auf Augenhöhe.
Sicherlich wäre es eine merkwürdige Strategie von Bewohner*innen von WGs oder Wohnprojekten, mit Menschen zusammen zu wohnen, mit denen sie „nichts anfangen“ können um die ausschließenden Strukturen zu untergraben. Nur, dieser tatsächlich diskutierte Gedanke birgt in sich schon Klassismus. Denn der, wenn nicht ausgesprochen, dann mitgedachte Nebensatz „...oder denen noch antisexistische Basisregeln beigebracht werden müssten“ verrät eindeutig, was man von „Prolls“ erwartet. Auch sein Gegenteil, „soziale Klassendurchmischung würde uns wunderbar bereichern“ - Diversity Management lässt grüßen - enthält diese Distinktionslogik. Kaum bestreiten lässt sich, dass nicht zwangsläufig weniger Verachtung aus der Erhöhung der Arbeiter*innenklasse durch einen Großteil linker Strömungen in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts spricht. Die paradoxe Praxis von einerseits entmündigenden Opfer- und andererseits pathetischen Helden-Zuschreibungen weist Ähnlichkeiten mit der Homogenisierung und Polarisierung des Rassismus auf, die nicht nur ahistorisch, sondern auch positiv diskriminierend sind.
Das ist die handlungspraktische Zwickmühle der Anerkennung, in die jede*r gerät, möchte sie*er Privilegien hinterfragen, und die selbst in der fragwürdigen „Interkulturellen Pädagogik“ inzwischen Gegenstand der Reflexion ist. Ansätze dieser Art lassen sich denke ich nach einer Überarbeitung durchaus auf andere Anti-Diskriminierungsansätze übertragen. Nach dem entspannten Motto „wir alle wollen uns unbeabsichtigt, meist in mehrere Richtungen, von anderen abgrenzen um uns selbst aufzuwerten, 'get over it' “, scheint es möglich, einen Schritt weiter in Richtung einer Differenzen akzeptierenden Anerkennungspraxis zu gehen, in der die Subjekte es nicht nötig haben das „Andere“ abzuwerten, da sie erkennen, dass eine einzelne Perspektive, ergo die eigene eingeschlossen, niemals vollständig die Wirklichkeit begreifen kann.
In den USA gibt es eine offene Debatte darüber, ob das Justizsystem eigentlich eher rassistisch oder eher klassistisch ist. Denn in den Gefängnissen finden sich zwar gemessen an Bevölkerungsanteilen weit überproportional viele Nicht- Wei ß e, darunter v.a. Schwarze, aber ebenso überproportional viele Arme - darunter eben auch sogenannter „White Trash“. Das ist zum Haare Raufen, wobei ein gewisser Witz daran sich schwer verneinen lässt - es wird darüber gestritten, welche Gruppe mehr benachteiligt ist. Populärsoziologe Baron macht sich teils zurecht über die makabere Absurdität dieser „Unterdrückungsolympiade“ lustig, übersieht jedoch, dass man an der Stelle auch einfach sagen könnte: beides, Race und Klasse, sind Geraden, die im Gefängnishof aufeinander treffen. Nur müssten progressive Identitätspolitiker*innen auch allen anderen Geraden ihre Berechtigung zugestehen, auch wenn einige davon ihre eigenen schneiden. Das ist es, was in dieser internen Debatte blockiert, nicht, dass Menschen für die Anerkennung ihrer eigenen Identitäten kämpfen. Vereinfacht (und zugegebenermaßen leicht) gesagt: Betroffenengruppen lassen sich manchmal wunderbar gegeneinander ausspielen anstatt sich zusammen zu raufen.
Der Rassismus als „Ideologie der Zwischenklassen“ relativiert laut Balibar Klassenspaltungen. Das bedeutet, er überwindet sie nicht, sondern dethematisiert sie, lässt sie in den Hintergrund eines gesellschaftlichen Konsenses treten. Eine brandgefährliche Entwicklung: Gut verdienende Individualist*innen diskriminierter Gruppen motzen über Teile der Arbeiterklasse im mittleren Westen, die einen milliardenschweren korrupten Geschäftsmann gewählt haben, der ihnen ihre Krankenkasse wieder nehmen wird, dafür aber ihre früheren industriellen Normalarbeits-Jobs nicht wieder aus dem Toupet zaubern kann. Es glauben sicherlich viele davon, an ihrer prekarisierten sozialen Lage seien Immigrant*innen (und Individualist*innen) schuld - und nicht etwa die neoliberale Politik sämtlicher Regierungen seit den Anfängen der Akkumulationskrise in den 70ern oder gar Kapitalismus und Nationalstaaten im Allgemeinen. Rassismus schadet wie hier deutlich wird, nicht „nur“ sämtlichen Rassifizierten, sondern auch den Deklassierten. Auch? Das ist genau der Punkt: es gibt Überschneidungen und Kreuzungen der Geraden. Denn wer sind die Deklassierten? Es sind nicht die wei ß en Arbeiter*innen allein. Es sind anhand schwer veränderlicher Merkmale Herabgesetzte, bei den einen ist es der Bildungsabschluss, bei den anderen der Nachname, beim nächsten beides und bei der nächsten fügt sich noch das Geschlecht ein. Es ließe sich daher nicht klar beantworten, ob die USA nun ein eher rassistisches oder klassistisches Justizsystem haben, wo doch Schwarze, Latin*s, PoCs und andere durch Rassismus öfter als Wei ß e von Klassismus betroffen sind.
Klar sein sollte, dass es nicht Trump als einzelner Charismat geschafft hat, die USA wie mit einem kleinen Zauberstab zu spalten wie derzeit durch die Feuilletons hindurch verzweifelt nahegelegt wird. Wenn mit der Unterstützung neoliberaler Ideologie und Deindustrialisierung- bzw. Tertiärisierungsdynamiken ökonomisch als auch im Identitätsranking Aufgestiegene den Rassismus wei ß er Industrie- und Land-Arbeiter mit klassistischen Mitteln beantworten, klingt das nach „Wie du mir, so ich dir“, einer nachvollziehbaren Reaktion auf Wei ß e und männliche* Dominanz der letzten Jahrhunderte. Um Dominanzverhältnisse zu kritisieren werden auch hier andere reproduziert und vertieft.
Fazit
Die Verachtung der Arbeiter*innenklasse(n) hat zweifelsohne eine lange Tradition, auch in der akademischen Linken. Bemitleidet man sie nicht bevormundend oder instrumentalisiert sie für elitäre Gesellschaftsentwürfe, wirft man ihr vor, aus unbelesenen Arbeitsfetischist*innen zu bestehen. Einige Gründe für dieses seltsame Phänomen liegen wie besprochen in der internalisierten „Aufwertung durch Abwertung“-Strategie sozial Privilegierter, im Prozess der Komplexitätsreduktion, in Projektionen aufgrund dichotom-hierarchischer Denkstrukturen und innerer Abspaltungen, in der ungeschickten essentialisierenden Überidentifikation derer, die an der Umsetzung der eigenen Ideale scheitern, in der Zwickmühle der Anerkennung und in der „Unterdrückungsolympiade“.
Absurd bleibt dennoch, wenn Linke „Prolls“ verachten, obwohl die in coolen Jogginghosen herumlaufen, mit denen offensichtlich keine bürgerliche Selbstverwertung angestrebt wird. Leute, die freiwillig wochenlang in einer muffigen Uni-Bibliothek 12 Stunden durcharbeiten, weil das Geschriebene einfach noch nicht perfekt ist, erscheinen mir da beinah als die größeren Arbeitsfetischist*innen. Im Gehacke um gut bezahlte 20-Stunden-Stellen und entspannte Positionen im sozialen Feld unterliegen auch sie mitunter der Relativierung von Klassenspaltungen. „Die sollen sich nicht so anstellen, diese besorgten Rassisten, arbeiten ist eh Mist und wer braucht schon Geld - man kann Essen auch im Müll finden und trampen.“ Trotz der Arroganz, die aus Aussagen wie diesen spricht, muss eine essentialisierende Pauschalkritik an „den Linken“ im Stile Barons zurück gewiesen werden. Es gibt zwar einen erheblichen Anteil Studierender, doch die sind ebenso von Lohnarbeitszwang betroffen, müssen in der neoliberalen Arena ihre Asse im Ärmel verteidigen und ihre Self-Management-Skills täglich unter Beweis stellen.
Dürfen wir Menschen nach ihrer Nützlichkeit für „die Emanzipation“ bewerten? Wenn wir uns dabei ertappen, hat die Verwertungslogik ihre Hausaufgaben gemacht. In diesem Sinne könnten wir Sorgen von Besorgten ernst nehmen, nicht nur weil sie ernste Folgen haben können, sondern auch, weil es zweifelhaft ist, eigene emanzipatorische Partikular-Interessen über die anderer zu stellen. Würden soziale Bewegungen die Klassenspaltungen wieder mehr in den Fokus bekommen, wären breitere Bündnisse zwischen Beherrschten - Schwarze und rollstuhlfahrende Angestellte gemeinsam mit alleinerziehenden Sexarbeiterinnen gegen Abtreibungsverbote oder Queere, die streikende wei ß e Arbeiter bei der Infrastruktur unter die Arme greifen7, vielleicht keine Seltenheit mehr.
Literaturauswahl
Baron, Christian 2016: Proleten, Pöbel, Parasiten. Warum die Linken die Arbeiter verachten. Berlin Bourdieu, Pierre 2014: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 24.Aufl. Frankfurt am Main
Jones, Owen 2013: Prolls. Die Dämonisierung der Arbeiterklasse. London
Koppetsch, Cornelia, Speck, Sarah 2015: Wenn der Mann kein Ernährer mehr ist. Geschlechterkonflikte in Krisenzeiten. Berlin
1 http://hup.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2008/9/chapter/HamburgUP_Schlaglichter_Hitler.pdf
2 http://www.demokratie-goettingen.de/blog/pegida-2016-studie
3 https://www.vice.com/de/article/asylbewerber-der-nazi-ork-aus-hellersdorf
4 Die Brüder Akstinat (Hrsg.) 2008: Marx & Engels intim. Harry Rowohlt und Gregor Gysi aus dem unzensierten Briefwechsel. Track 5. Berlin
5 https://www.heise.de/tp/features/Vom-Rassismus-und-Sexismus-zum-Klassismus-3387173.html
6 Irie Révoltés 2010: Antifaschist. Mouvement Mondial, Track 8. Ferryhouse
7 Sehenswert ist der Film „Pride“, 2014, BBC films
- Arbeit zitieren
- Nora Molinari (Autor:in), 2017, Welche Jogge darf es heute sein? Klassistische Kontinuitäten in linken Milieus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372465
Kostenlos Autor werden

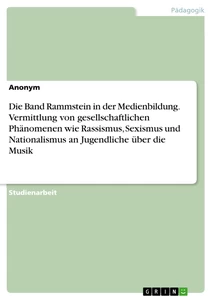


















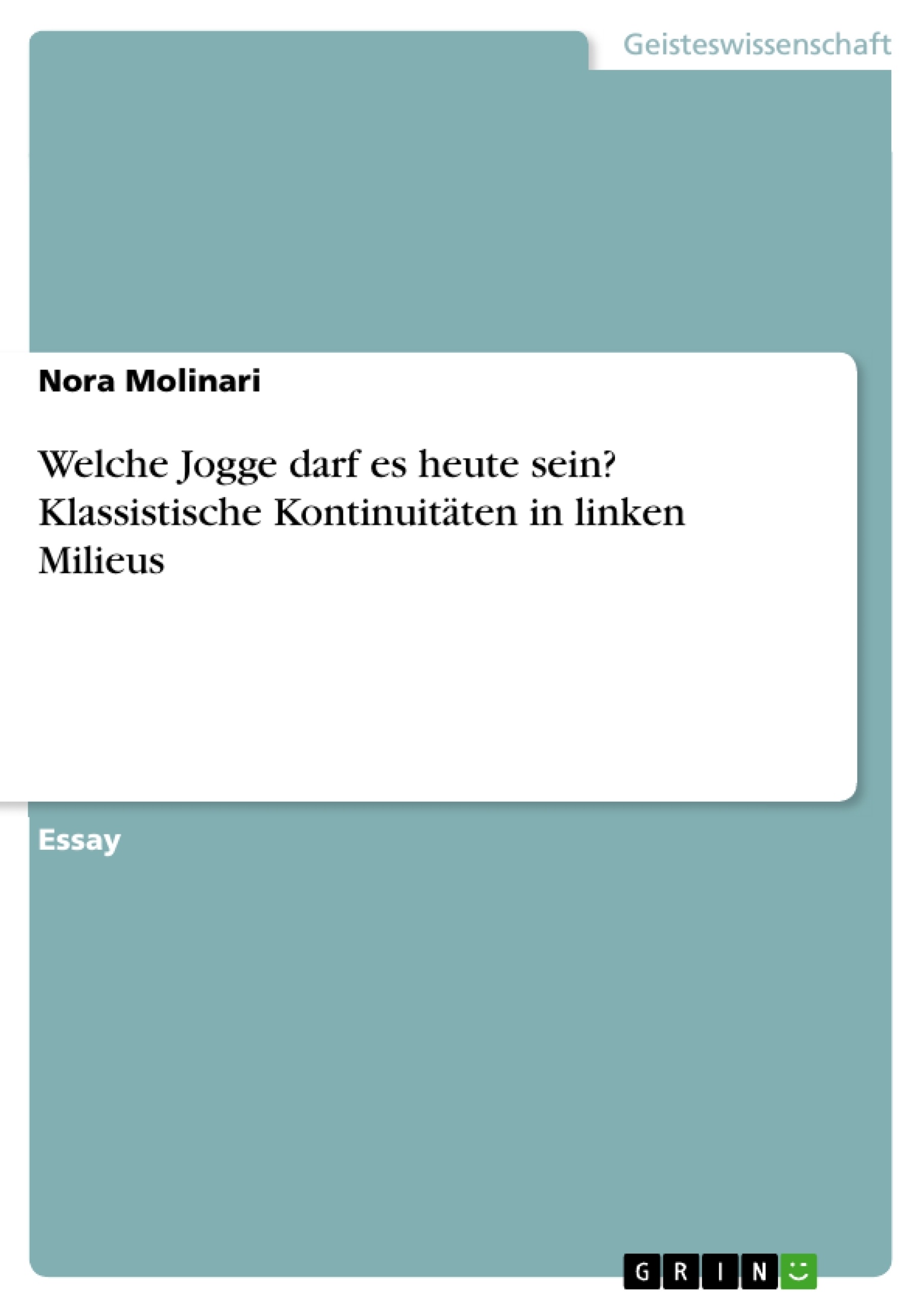

Kommentare