Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hintergrund und Einordnung in den Gesamtkontext
2.1 Die UN-Behindertenrechtskonvention
2.2 Inklusion aus soziologischer und systemtheoretischer Sicht
2.3 Betrachtung und Abgrenzung der Begriffe Integration und Inklusion
2.4 Zwischenfazit
3. Umgang in der Kinder- und Jugendhilfe mit seelischer Behinderung
3.1 Die Anwendung des § 35a SGB VIII
3.2 Entwicklung der Fallzahlen und gesellschaftlicher Bedarf
3.3 Zuständigkeiten und Schnittstellen gegenüber anderen Rechtskreisen
3.4 Empirische Umfrage bei Jugendämtern und Trägern im Rheinland
3.5 Zwischenfazit
4. Am Horizont: Die „Große Lösung im SGB VIII“
4.1 Chancen und Herausforderungen
4.2 Überlegungen zur Realisierung
4.3 Aktueller Stand der Planung und Umsetzung
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungen und Grafiken
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Diese Ausarbeitung in Form einer Master-Thesis widmet sich der Inklusion von Menschen mit Behinderung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und den damit verbundenen Chancen, Herausforderungen und Perspektiven. Die Auswahl des Themas ist in dessen Aktualität und Tragweite für die Soziale Arbeit und das Sozialmanagement im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe begründet. Ausgangspunkt der Arbeit ist die Annahme, dass die Umsetzung der Inklusion grundsätzlich ein erstrebenswertes Vorhaben ist, welches sich trotz vieler Hürden und Herausforderungen realisieren lässt, wenn die erforderlichen Rahmenbedingungen gegeben sind. Ob und wie das Ideal der Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe zu einem realistischen Ziel werden kann und welche Kernaspekte dabei zu berücksichtigen sind, wird im Verlauf der folgenden Kapitel dargestellt.
Durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat die Inklusionsdebatte in Deutschland in den vergangenen Jahren viel Aufwind bekommen und weite Kreise gezogen. Da diese Konvention den Hintergrund und eine wichtige Basis für die vorliegende Ausarbeitung darstellt, wird sie zu Beginn als Einstieg in das Thema in den Fokus gerückt. Um die verschiedenen Standpunkte innerhalb der Fachdiskussion nachvollziehen zu können, ist es im nächsten Schritt erforderlich, den Begriff und das Konzept der Inklusion differenzierter zu betrachten und zu diskutieren. Dabei finden systemtheoretische und soziologische Perspektiven Beachtung und die Schlagworte Inklusion und Integration werden gegenübergestellt und inhaltlich verglichen und bewertet. Auf diesem Weg erhält der Leser über allgemein bekannte Medienstimmen hinaus einen vertieften Einblick in die Facetten der Thematik und das Spannungsfeld zwischen theoretischem Anspruch und praktischen Umsetzungsmöglichkeiten der Inklusion.
Im dritten Kapitel wird der Ist-Zustand der Eingliederungshilfe für (seelisch) behinderte Kinder und Jugendliche im SGB VIII betrachtet. Nach einem Blick auf die historische Entwicklung wird dargestellt, wie Jugendämter im Rheinland mit Anträgen und Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe verfahren. Die bestehenden Missstände und die Schnittstellenprobleme mit anderen Rechtskreisen werden im Zuge dessen identifiziert und auf den Punkt gebracht. Abgerundet wird diese fachtheoretische Betrachtung mit Rückmeldungen und Einschätzungen aus der Praxis, die in Form einer Umfrage erhoben wurden. Dazu beantworteten sowohl mehrere Jugendämter, als auch Einrichtungen, die Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche durchführen, einen Fragebogen zu diesem Thema.
Daran anschließend wird der Blick nach vorne gerichtet auf die Idee einer sogenannten „großen Lösung“ im SGB VIII. Dieses Vorhaben, bei dem Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen - mit und ohne Behinderung - unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe zusammengefasst werden, ist nicht neu, aber aktueller denn je. Neben Chancen und Herausforderungen im Zusammenhang mit der großen Lösung werden im 4. Kapitel Überlegungen zur Realisierung diskutiert. Dadurch wird verdeutlicht, welche Kernaspekte bei einer praktischen Umsetzung dieses Ansatzes zu berücksichtigen sind. Als Ausblick auf die weiteren Entwicklungen wird der aktuelle Stand der Planung, der politischen Vorhaben und der Umsetzungsstrategien (zum Zeitpunkt der Abgabe der Arbeit) zusammengefasst.
Abschließend werden die zentralen Aussagen und Erkenntnisse in einem Fazit auf den Punkt gebracht. Dort wird zudem festgehalten, welche weiteren Perspektiven und Forschungsansätze im Zusammenhang mit Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe im Blick behalten werden sollten, aber im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden konnten.
2. Hintergrund und Einordnung in den Gesamtkontext
In den Medien und in der gesamten Gesellschaft kursiert seit einigen Jahren der Begriff der Inklusion. Hintergrund und Triebfeder der damit verbundenen aktuellen Debatte ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das auch als UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) bezeichnet wird. Als Hinführung zum Thema im Sinne einer deduktiven Herangehensweise soll daher zu Beginn ein Blick auf den Inhalt und die Zielsetzungen dieser Konvention geworfen werden.
2.1 Die UN-Behindertenrechtskonvention
Zur Vereinheitlichung der Rechte von Menschen mit Behinderung entwickelten die Vereinten Nationen in mehreren Beratungen und Arbeitstreffen einen völkerrechtlichen Vertrag, in dem internationale Vorgaben zur Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung formuliert sind. Daran beteiligt waren nicht nur Regierungsdelegationen, sondern auch viele Mitglieder von anderen Organisationen, da die Entwicklung der Konvention unter dem Motto „Nichts über uns ohne uns“ erfolgte und betroffene Personen aktiv mit einbezogen werden sollten. Die Behindertenrechtskonvention wurde von Deutschland am 30. März 2007 unterzeichnet und sie trat in der Bundesrepublik am 26. März 2009 in Kraft. Die einzelnen UN-Mitgliedsstaaten unterschrieben die Ratifikation zu unterschiedlichen Zeitpunkten und standen bzw. stehen im nächsten Schritt vor der Herausforderung, nationale Pläne und Gesetzgebungen zur Umsetzung der Konvention zu erarbeiten. In Deutschland wurde der entsprechende Aktionsplan im September 2011 veröffentlicht. Die UN-BRK ist auf der Basis vorheriger Menschenrechtskonventionen aufgebaut, auf die Bezug genommen wird. Sie beinhaltet neben der Betrachtung einzelner Rechte in erster Linie einen internationalen gesellschaftlichen Perspektivwechsel zu Gunsten von Menschen mit Behinderung. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass diese Personengruppe in vorherigen Menschenrechtserklärungen bei der Formulierung nicht berücksichtigt wurde (BMAS 2011, S. 1; Behindertenbeauftragte 2014, S. 3; Lee 2010, S. 185-187).
In der UN-BRK ist der Grundsatz formuliert, dass alle Menschen – egal ob mit oder ohne Behinderung – eine zu achtende Würde innehaben und allen ein gleichberechtigter Zugang zu Menschenrechten und Grundfreiheiten zusteht, den es zu fördern und zu schützen gilt. Auf Grundlage dessen leiten sich Pflichten für die einzelnen Staaten zur Umsetzung dieser Menschenrechte ab. Zur Differenzierung, welche Personengruppen in der UN-BRK als Menschen mit Behinderung verstanden werden, heißt es:
„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“
(s. BMAS 2011, Artikel 1).
Neben der Präambel besteht die Konvention aus 50 Artikeln, wobei die Artikel 1-30 den Schwerpunkt bilden. In Artikel 3 werden die folgenden, allgemeinen Grundsätze des Übereinkommens aufgeführt:
a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit;
b) die Nichtdiskriminierung;
c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft;
d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit;
e) die Chancengleichheit;
f) die Zugänglichkeit;
g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau;
h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.
(s. BMAS 2011, Artikel 3)
Bringt man die Kernanliegen auf den Punkt, wird durch die UN-BRK formuliert, dass für Menschen mit Behinderung ein Anspruch auf Diskriminierungsfreiheit, Chancengleichheit, Selbstverwirklichung und gesellschaftliche Teilhabe besteht, den es durchzusetzen gilt. Aus den allgemeinen Grundsätzen des Artikel 3 leiten sich im weiteren Verlauf der Konvention speziellere Bereiche ab. Als Beispiel für einen solchen speziellen Bereich kann der gleichberechtigte Zugang zu Kommunikation und Medien für Menschen mit Hörbeeinträchtigung dienen, der z.B. durch den Einsatz von Gebärdensprache erreicht wird.
Herauszustellen ist, dass dieses Übereinkommen der Vereinten Nationen ein Verständnis von Behinderung zu Grunde legt, bei dem Behinderungen ein normaler Bestandteil im menschlichen und gesellschaftlichen Leben sind und einen Ausdruck der Vielfalt darstellen. Eine Behinderung soll nicht pauschal als negatives Defizit angesehen werden, sondern der behinderten Person sollen Wertschätzung und Anerkennung ihrer Würde entgegengebracht werden. Bei dieser Sichtweise geht es nicht darum, dass die jeweilige Person sich anpassen muss und dazu eine individuell erforderliche Hilfestellung erhält. Vielmehr ist die gesamte Gesellschaft dazu aufgefordert, sich vom Grundsatz her anzupassen, zu öffnen und umzugestalten, um Menschen mit Behinderung barrierefreie Zugänge und Teilhabemöglichkeiten zu verschaffen. Bei der Planung und der Umsetzung entsprechender Schritte sollen Menschen mit Behinderung laut Artikel 4 Absatz 3 gezielt und aktiv beteiligt werden (Deutscher Bundestag Drucksache 17/12200, S. 370; Behindertenbeauftragte 2014, S. 3, 17).
Die Vorgaben im Übereinkommen der Vereinten Nationen richten sich an verschiedenste Lebensbereiche von der Frühförderung über das Arbeitsleben und kulturelle Angebote bis hin zum Gesundheitssystem. Mit Blick auf das Kinder- und Jugendalter, das im Rahmen dieser Ausarbeitung betrachtet wird, ist speziell auf den Bereich Erziehung und Bildung hinzuweisen. Laut der UN-BRK haben alle Kinder und Jugendlichen ein Recht darauf, Zugang zu Erziehung und Bildung innerhalb des allgemeinen Bildungssystems zu erhalten (BMAS 2011, Artikel 24; Deutscher Bundestag Drucksache 17/12200, S. 370). Dies stellt seit Inkrafttreten der Konvention insbesondere das Schulsystem in Deutschland vor neue Herausforderungen. Die Öffnung der Regelschulen für Kinder- und Jugendliche mit verschiedenen Behinderungen bringt diverse Herausforderungen und Schwierigkeiten zu Tage, die bei der praktischen Umsetzung der UN-BRK entstehen. Neben dem Schulsystem sind die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe gemäß SGB VIII ein zweiter umfassender Bereich, der für Kinder und Jugendliche im Zuge der Rechte von Menschen mit Behinderungen auf Grundlage der Konvention zukünftig radikal umgestaltet werden muss. Der 14. Kinder- und Jugendbericht fordert eine erneute Auseinandersetzung mit der Zusammenführung von - bislang nach Behinderungsarten getrennten - Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in ein einheitliches System im Rahmen eines Sozialgesetzbuches (Deutscher Bundestag Drucksache 17/12200, S. 370). Dieser großen Lösung im SGB VIII widmet sich das Kapitel 4 dieser Ausarbeitung.
Mit einem etwas distanzierteren Blick auf die UN-Behindertenrechtskonvention und deren Hintergründe ist zu beachten, dass es sich dabei grundlegend betrachtet nicht um nationale Optimierungsansätze handelt, sondern um die globale Durchsetzung grundlegender Menschenrechte und entsprechender (Mindest-) Standards. Lenkt man den Fokus weg von westlichen EU-Ländern und hin zu ärmeren Staaten, wird schnell deutlich, dass es weltweit betrachtet auch grausame und menschenunwürdige Umgangsformen mit behinderten Menschen gibt, die zum Teil keinerlei Rechte und Schutz erhalten und an den äußersten Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Beispielweise wird kriegsversehrten Kindern in einigen afrikanischen Ländern der Zugang zum Schulsystem verwehrt. An diese und ähnliche Missstände knüpft die UN-BRK an, um weltweit ein notwendiges Maß an Schutz, Würde und Gleichberechtigung für die Betroffenen zu erreichen. Auf der Basis dessen entstehen in den verschiedenen Ländern nationale Entwicklungen und Trends. Diese sind in weiten Teilen auf die jeweilige Übersetzung der UN-BRK und auf die nationalen Aktionspläne der Staaten zurückzuführen. Michael Winkler, Professor für Pädagogik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, vertritt dazu den Standpunkt, dass es im Bereich Bildung im Rahmen der Konvention vor allem um die Sicherstellung des Zugangs von behinderten Menschen zum Bildungssystem geht – unabhängig davon, ob es sich dabei um besondere Einrichtungen (Förderschulen) handelt. Er weist zudem darauf hin, dass die (deutsche) Konvention selbst den Begriff der Inklusion vermeidet. Das Wort „inclusion“ findet sich in der englischen Version der UN-BRK und wird in der deutschen Fassung mit „Integration“ übersetzt (Winkler 2014, S. 113-114).
Die Übertragung des Inklusionsbegriffs aus den angloamerikanischen Länden in die Bundesrepublik Deutschland erfolgt z.B. durch das Konzept von Andreas Hinz. Er baut seine Ansätze darauf auf, dass Menschen mit Behinderung nicht funktionsgemindert sind, sondern zu einer Minderheit (von vielen Minderheiten) gehören. Die Inklusion berücksichtige aus der Sicht von Hinz alle Formen von gesellschaftlicher Heterogenität, basiere auf Bürgerrechtsbewegungen und wirke einer Marginalisierung von Behinderungen entgegen. Daraus leitet er insbesondere Ideen und Perspektiven für ein inklusives Schulsystem ab, das sich an alle Schüler richtet und Sondereinrichtungen in Form von Förderschulen abschaffen soll. Dabei bleibt allerdings unberücksichtigt, dass die gesellschaftliche Lage und die Rahmenbedingungen im angloamerikanischen Sprachraum anders sind als in Deutschland und daher die dortigen Ansätze der Inklusion nicht 1:1 übernommen werden können. In Deutschland werden entsprechende Themen und Konzepte bereits seit vielen Jahren im Rahmen der Integrationspädagogik diskutiert (Lee 2010, S. 48-49, 193). Die Debatte um das Thema Inklusion muss also im internationalen Vergleich differenziert betrachtet werden. Die jeweiligen nationalen Auslegungen mit den entsprechenden Aktionsplänen basieren auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ausgangssituationen.
Der genaueren Betrachtung des Begriffs Inklusion und der Analyse aus soziologischer Sicht widmet sich das folgende Unterkapitel.
2.2 Inklusion aus soziologischer und systemtheoretischer Sicht
Inklusion ist ein großes Wort und ein internationales Vorhaben, bei dem jedoch bislang nur wenig geklärt und kaum transparent ist, welche praktischen Konsequenzen sich daraus ergeben. Der Bezug auf den Begriff Inklusion gehört inzwischen zur „political correctness“ und die Debatten um dieses Thema werden mit viel Emotionalität und unter normativen sowie moralischen Gesichtspunkten geführt. Gerade in Deutschland scheint es mit Rückblick auf die Geschichte des zweiten Weltkriegs nun bzgl. der Inklusion eine Art vorauseilenden Gehorsam zu geben. Als Grundvorstellung und Zielsetzung der Inklusion wird mit Bezug auf die UN-BRK ein Umdenken der gesamten Gesellschaft gefordert, bei dem Behinderungen als normaler (nicht defizitärer) Bestandteil unserer Gesellschaft gesehen werden. Es wird davon ausgegangen, dass sie als Quelle für kulturelle Vielfalt und Bereicherung verstanden werden können, was auch als Diversity-Ansatz bezeichnet wird. Im Zuge dessen soll in der Gesellschaft ein Verständnis und ein Bewusstsein für die Entwicklung von Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den barrierefreien Zugang zu allen gesellschaftlichen Bereichen für Menschen mit Behinderung selbstverständlich ermöglichen. Aus dieser Sichtweise wird eine Behinderung nicht als eine individuelle Eigenschaft von Personen verstanden, sondern als ein Konstrukt mit Bezug auf den jeweiligen Kontext. Individuelle Beeinträchtigungen werden erst dann relevant, wenn sie durch Wechselwirkungen mit gesellschaftlichen Umweltfaktoren negative Resultate für die Betroffenen hervorrufen. Das bedeutet, dass eine Person eine Benachteiligung haben kann (z.B. Kleinwüchsigkeit), aber nur dadurch eine Behinderung entsteht, wenn die Umwelt nicht so organisiert ist, dass darauf Rücksicht genommen wird (z.B. Höhe von Bildschirm und Tastenfeld eines Geldautomaten). Entsprechende Barrieren in verschiedenster Hinsicht sollen im Zuge der Inklusion abgebaut werden, damit sich Menschen mit Behinderung aus eigener Kraft und selbstbestimmt in unserer Gesellschaft zurechtfinden können (Wiesner 2014, S. 61; Behindertenbeauftragte 2014, S. 3; Winkler 2014, S. 108; Lee 2010, S. 190 f.). Um es an einem weiteren Beispiel zu verdeutlichen: eine Person, die im Rollstuhl sitzt, ist regelmäßig an Bordsteinkanten auf Hilfe angewiesen, um diese zu überwinden. Das Ziel der Inklusion ist es in dieser Metapher, flächendeckend Bordsteine abzusenken, damit Rollstuhlfahrer barrierefrei und aus eigener Kraft überall Zugang bekommen und ihre Wege verfolgen können.
Diese Idee und Zielsetzung der Inklusion bringt zunächst viel Plausibilität und Legitimität mit sich. Auch die moralischen Komponenten dieser Debatte tragen dazu bei, dass sich vermutlich niemand pauschal und grundsätzlich dem Konzept der Inklusion entgegenstellt. Es ist allerdings wichtig und sinnvoll, diesen Begriff und die praktischen Folgen in der Umsetzung der Inklusion differenziert zu betrachten und auch begründete kritische Stimmen in den Blick zu nehmen.
Betrachtet man sachlich und neutral die begriffliche Bedeutung von Inklusion, lässt sie sich als Einschluss oder Zugehörigkeit definieren. Das Gegenstück dazu ist die Exklusion, welche demnach Ausschluss oder Nichtzugehörigkeit bedeutet. Inklusion und Exklusion sind ein Begriffspaar, das gemeinsam betrachtet werden muss und nicht einseitig diskutiert werden kann, denn Inklusion ist nur dann als Thema erforderlich, wenn ein Ausschluss stattfindet. Der Soziologe Niklas Luhmann diskutierte Inklusion und Exklusion anhand seines Ansatzes der Systemtheorie. Aus dieser Perspektive bedeutet Zugehörigkeit in modernen Gesellschaften nicht die Verortung in Klassen, Familien, Schichten oder Milieus, sondern Zugehörigkeit entsteht dadurch, dass ein Individuum in die gesellschaftliche Kommunikation eingebunden ist. Die Systemtheorie versteht eine Gesellschaft als komplexes und umfassendes System, das sich in viele differenzierte Subsysteme und soziale Gebilde untergliedert. Diese Subsysteme stehen untereinander in ständigem Austausch und in Interdependenz-Zusammenhängen. Luhmann formulierte die Hypothese, dass jeder Mensch, der als Adressat in gesellschaftliche Kommunikationsabläufe eingebunden ist, bereits durch diesen Aspekt als Teil der Gesellschaft in Form eines Rollenträgers definiert ist. Aus dieser Perspektive ließe sich ableiten, dass Inklusion in Deutschland längst stattfindet, da auch Menschen mit Behinderung formal gleichberechtigte Kommunikations-Adressaten in Bereichen wie Politik (Teilnahme an Wahlen und aktives Engagement), Wirtschaft (als zahlende Konsumenten in marktwirtschaftlichen Systemen) und Recht (als gleichberechtigte Rechtssubjekte) sind. Somit besteht aus systemtheoretischer Sicht in Deutschland bereits eine inklusive Kommunikationsbasis, die sich an alle Individuen richtet und für alle zugänglich ist - egal, ob mit oder ohne Behinderung. Diesen Gedanken kann man theoretisch dahingehend fortführen, dass in modernen und funktional differenzierten Gesellschaften eine Exklusion in Reinform gar nicht stattfinden kann. Würden durch Ausschlusstendenzen Personengruppen exkludiert, hätte dies schnell eine gesellschaftliche Diskussion und Aufmerksamkeit der Medien usw. zur Folge, wodurch diese Gruppen automatisch wieder in den Fokus gerückt würden (Weber 2010, S. 283-285; Lee 2010, S. 26). Ein aktuelles Beispiel dafür sind Flüchtlinge, die als benachteiligte Individuen mit existenziellen Problemen einer Exklusionsdrift ausgesetzt sind und an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Dies zieht die Aufmerksamkeit der Medien auf sich, was zur Folge hat, dass sich trotz bislang fehlender flächendeckender politischer Lösungen aus der Gesellschaft heraus Hilfesysteme entwickeln, um diese Menschen zu unterstützen und zurück in die Mitte der Gesellschaft zu holen.
Das systemtheoretische Modell kann dazu dienen, sich dem Thema Inklusion mit einem anderen Blickwinkel zu nähern. Allerdings ist dieser Ansatz sehr abstrakt und theoretisch. Bringt man die oben beschriebenen Annahmen mit der Praxis in Einklang, tauchen schnell Unstimmigkeiten auf. Im realen gesellschaftlichen Leben lassen sich Exklusionstendenzen nicht einfach mit der o.g. Argumentation „wegdiskutieren“. Auch Luhmann selbst relativierte seine Sichtweise mit der Zeit, als er in späteren Veröffentlichungen darauf einging, dass es - am Beispiel der Favelas in Brasilien - im täglichen Leben doch zu gesellschaftlichen Ausschlüssen und Elend jenseits theoretischer Erklärungen und soziologischer Modelle kommt (Lee 2010, S. 26 f.; Weber 2010, S. 290 f.).
Im Zuge der Inklusion geht es einerseits um formale Gleichbehandlung für alle, andererseits wird eine Personengruppe (die der Menschen mit Behinderungen) besonders hervorgehoben und in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Diese positive Diskriminierung (betrachtet man Diskriminierung ohne negative Konnotation lediglich als „Abgrenzung“ oder „Unterscheidung“ nach dem lateinischen Verb „discriminare“) läuft der grundlegenden Idee der Inklusion jedoch bereits zuwider. Die begriffliche Überwindung von Separationen durch die neue Vokabel „Inklusion“ führt nicht automatisch dazu, dass eine tatsächliche Überwindung dessen stattfindet. Das theoretische Vorhaben, einzelne gesellschaftliche Gruppierungen zukünftig nicht mehr speziell berücksichtigen und unterstützen zu müssen (im Sinne von Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung), kollidiert mit grundlegenden Aspekten der Soziologie. Zwar soll eine Gleichstellung aller Menschen erfolgen, jedoch kann die Bildung von exkludierenden Organisationen und Gruppierungen in einer Gesellschaft nicht negiert werden. Dies gilt grundsätzlich und ist nicht nur auf den Kontext der Menschen mit Behinderung bezogen. Von entsprechenden Schwierigkeiten können sich auch das Bildungssystem und die Soziale Arbeit nicht freisprechen. Es wird mit rhetorischen Wendungen immer wieder versucht, z.B. nicht von „sozial schwachen“ oder „bildungsfernen“ Personen zu sprechen, aber bereits die halbwegs neutrale Beschreibung von „Risikogruppen“ geht mit einer Ausgrenzung einher. Die sozialen Kontexte, in denen sich Menschen bewegen, sind stets davon geprägt, dass wir uns soziologisch betrachtet in Gruppierungen bewegen und uns dort aufgehoben fühlen. Diese Gruppen entstehen durch Zugehörigkeit auf der einen Seite und Abgrenzung auf der anderen. Das gilt vom Sportverein bis hin zur Fangemeinde einer Fußballmannschaft. Soziale Gruppierungen definieren sich und sichern ihre Existenz dadurch, dass es Mitglieder und Nicht-Mitglieder gibt. Auf diesem Weg entsteht die Identität einer Gruppe und dies führt zur Identifikation von deren Mitgliedern. Somit lässt sich aus soziologischer Sicht festhalten, dass es ein Spannungsverhältnis zwischen Identität und Inklusion gibt (Winkler 2014, S. 109-110). Jenseits dieser soziologischen Sichtweise warnt der Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Bernd Ahrbeck deutlich davor, die Benennung von Beeinträchtigungen und Behinderungen pauschal zu vermeiden. Er sieht einen zentralen Irrtum der Inklusionsdebatte in der Annahme, dass die bloße Feststellung von Unterschieden zwischen Menschen automatisch einen (ab-) wertenden Charakter hat. Um Kinder und Jugendliche mit Behinderung angemessen fördern zu können, muss zunächst diagnostiziert und beschrieben werden, welcher Förderbedarf vorliegt. Eine Dekategorisierung, bei der versucht wird, aus falscher Scheu jegliche Etikettierung (im Sinne einer Beschreibung der Realitätswahrnehmung) zu vermeiden, würde die Fachleute in der beruflichen Praxis nahezu handlungsunfähig machen (Der Spiegel 2014, S. 38-40).
Eng mit dem Inklusionsgedanken verbunden sind Begriffe wie Freiheit, Selbstbestimmung und Autonomie. Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht bedeutet Freiheit auf der einen Seite, als freier Bürger sein Glück selbst gestalten zu dürfen. Dies bringt aber auch die Verpflichtung mit sich, eigenverantwortlich und mit eigenen Mitteln für sein Auskommen zu sorgen, wofür Geld benötigt wird. Da dieses begrenzt und nicht frei verfügbar ist, entsteht beim Streben nach Geld eine Konkurrenz, die sowohl Gewinner, als auch Verlierer nach sich zieht (z.B. auf dem Arbeitsmarkt). Die Tatsache, dass behinderte Menschen im Zuge der UN-BRK mehr formale Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und Freiheitsrechte zugesichert bekommen, führt dazu, dass sie an der gesellschaftlichen Konkurrenz teilhaben dürfen und sich in ihr bewähren müssen. Dies ist jedoch nicht automatisch mit einem Glücksversprechen gleichzusetzen. Der Staat schafft durch Chancengleichheit und Freiheitsrechte die Voraussetzungen und die Möglichkeiten, damit jeder sein eigenes Glück verfolgen kann und darf. Ob dies gelingt, ist jedoch eine andere Frage (Cechura 2016, S. 19-27).
Die Inklusion wird in den Medien und Publikationen oft an Beispiele und Personen gekoppelt, die trotz einzelner (kompensierbarer) Beeinträchtigungen durch Inklusionsprozesse Fortschritte erlangen und ihre Ziele erreichen. Es dürfte jedoch klar sein, dass es innerhalb der Menschen mit Behinderungen nicht nur Personen gibt, die sich im Zuge der Inklusion selber - aus eigener Kraft - verwirklichen und für sich und ihre Belange sprechen können. Viele Formen der Behinderung haben zur Folge, dass besondere und spezielle Unterstützungen von Nöten sind, die über Dinge wie Rollstuhlrampen oder barrierefreie Internetseiten hinausgehen. Hier bedarf es trotz des Vorhabens der Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung besonderer und individueller Maßnahmen, die nicht ohne eine Etikettierung und spezielle Hilfen auskommen. Für die Unterstützungsleistungen, die in solchen Situationen (z.B. bei frühkindlichem Autismus) erforderlich sind, benötigt es Expertenwissen und spezielle Angebote, die jedoch wiederum eine Exklusion und einen „Sonderstatus“ gegenüber Regelangeboten darstellen (Lee 2010, S. 27, 188 f., 197 f.). Bei solchen Hilfen besteht dann im Zuge der Inklusionsidee die Herausforderung, dass es sich dabei nicht nur defizitorientiert um Kompensationen oder Korrekturen von Abweichungen und Defekten handeln soll.
Im Zuge der aktuellen Inklusionsdebatte kann der Eindruck entstehen, dass dieser Trend neu ist und erst seit wenigen Jahren verfolgt wird, was jedoch nicht der Fall ist. Bei der momentanen Inklusionsbewegung handelt es sich zwar um einen neuen Begriff, der mit dem Anspruch und der Hoffnung verbunden ist, einen Paradigmenwechsel auf den Weg zu bringen. Der Gedanke und die Zielsetzung sind jedoch im Kern nichts Neues. Bereits 1981 engagierten sich bundesweit Aktivisten und Behinderteninitiativen mit dem Motto „Keine Reden, keine Aussonderung, keine Menschenrechtsversetzung“ und 1985 forderten diverse überregionale Elterninitiativen für behinderte Kinder „Gemeinsam leben, gemeinsam lernen“. Seit über 30 Jahren herrschen in Deutschland also Bestrebungen, die in die gleiche Richtung weisen, wie die aktuelle Inklusionsdebatte. Diese waren lediglich mit jeweils anderen Begriffen versehen, wie „Selbstbestimmung“ und „Integration“. Eckhard Rohrmann, Professor am Institut für Erziehungswissenschaft der Philipps-Universität Marburg, äußert die Sorge, dass nach Wellen von Diskussionen um Begriffe wie „Integration“ und „Selbstbestimmung“ bald auch der Begriff der Inklusion eine Inflation erfährt, inhaltlich aufgeweicht wird und sich zu einem inhaltsleeren Modebegriff entwickelt (Rohrmann 2014, S. 162-163). Wenn bisherige sonder- oder heilpädagogische Angebote - die qualitativ und fachlich durchaus gut sein können - zukünftig einfach nur als inklusive Maßnahme betitelt werden, ohne weitere Entwicklungen vorzunehmen, erhält man lediglich das, was sprichwörtlich als „alter Wein in neuen Schläuchen“ bezeichnet wird.
Auf der einen Seite bedeutet die Forderung nach Inklusion, dass Parallelstrukturen und Sondereinrichtungen (z.B. Förderschulen oder WfbM) abgeschafft werden. Dies kann - wenn überhaupt - jedoch nur über einen längeren Zeitraum und mit hohem personellem und finanziellem Aufwand in der Praxis erreicht werden. Solche Sondereinrichtungen stecken in einer Paradoxie-Falle. Sie haben spezialisiertes Wissen zur Unterstützung ihrer Zielgruppe, das jedoch dazu eingesetzt werden soll, die Klienten im Zuge der Inklusion zu Nicht-Klienten zu machen, in Regelsysteme zu überführen und sich dadurch selber - als Organisation - perspektivisch unnötig werden zu lassen. Man soll also als Sondereinrichtung darauf hinarbeiten, die eigene Arbeitsleistung in der bestehenden Form selbst abzuschaffen. Vor dem Hintergrund müssen sich entsprechende Einrichtungen immer wieder die Kritik gefallen lassen, dass sie selber den Bedarf erzeugen, wecken und aufrechterhalten würden, mit dem sie ihre Daseinsberechtigung begründen. Allerdings ist es ein Faktum, dass man in Sondereinrichtungen die spezielle Professionalität, das Wissen und die positiven Synergieeffekte im fachlichen Handeln findet, auf die viele Klienten im Rahmen der sozialpädagogischen und heilpädagogischen Hilfen angewiesen sind.
Auf der anderen Seite ist in der UN-BRK jedoch auch die Rede von Unterstützungen, die individuell angepasst sind und von sonderpädagogischer Förderung als Bestandteil von integrativer Bildung. Daher kann der Fortbestand von entsprechenden Sondereinrichtungen nicht pauschal als Verstoß gegen die Inklusion und gegen die Behindertenrechtskonvention betrachtet werden (Weber/Wagner 2015, S. 132; Lee 2010, S. 197-200).
Beachtenswert ist die Tatsache, dass die im Zusammenhang mit der Inklusion entstehenden Kosten streng budgetiert werden. In den Zielen des Bundesteilhabegesetzes, das in Deutschland mit Bezug auf die UN-BRK auf den Weg gebracht werden soll (siehe dazu auch Kapitel 4), heißt es: „ Die Neuorganisation der Ausgestaltung der Teilhabe zugunsten der Menschen mit Behinderung wird so geregelt, dass daraus keine neue Ausgabendynamik entsteht “ (s. BMAS 2015b, Flyer Bundesteilhabegesetz). Wenn sich inklusionsorientierte Hilfen - allgemein statt am Einzelfall ausgerichtet - im Zuge einer pauschalen Ressourcenzuweisung unter dem Druck zur Einhaltung gesetzter Budgets etablieren, besteht das Risiko, dass individuelle und einzelfallorientierte Kostenübernahmen nicht mehr obligatorisch sind, sondern optional werden (Lee 2010, S. 206; Wiesner 2014, S. 62).
Mit etwas Abstand betrachtet bezieht sich die Inklusion aus politischer Sicht strikt darauf, dass Menschen mit Behinderung alle Zugänge zu Institutionen des Rechtsstaats ohne Einschränkungen gewährt werden. Hier geht es darum, welche Rolle Menschen mit Behinderung als Adressaten gesellschaftlicher Kommunikation spielen. Ausschlaggebend sind im Zuge der Inklusion aus politscher Sicht die Zugangsmöglichkeiten und (formalen) Chancengleichheiten behinderter Menschen in gesellschaftlichen Systemen im Sinne eines Rechts auf Teilhabe an der gesellschaftlichen Konkurrenz. Dabei geht es darum, Freiheiten zu eröffnen und Teilhabe zu ermöglichen. Mit Freiheit ist auf der anderen Seite jedoch auch Eigenverantwortung verbunden. Der hier angesprochenen Zielgruppe soll aus politischer Sicht im Zuge der Inklusion ein höheres Maß an Optionen, Zugängen und Freiheiten ermöglicht werden. Es geht also darum, etwas zu dürfen. Mit Blick auf die Praxis ist es jedoch auch von grundlegender Relevanz, Dinge auch zu können, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, etwas, was man darf, auch tatsächlich umzusetzen (Weber 2015, S. 129; Winkler 2014, S. 112). Hier endet jedoch der Anspruch der Inklusion, der sich vorrangig auf Freiheiten, Chancengleichheiten, Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und Diskriminierungsverbote bezieht. Es ist daher erforderlich, neben dem Begriff der Inklusion auch den Begriff der Integration im Folgenden genauer zu betrachten und beide Perspektiven gegenüberzustellen.
2.3 Betrachtung und Abgrenzung der Begriffe Integration und Inklusion
Der Begriff Integration geht auf das lateinische Wort integratio zurück, welches Wiederherstellung oder Erneuerung bedeutet. Es geht dabei also semantisch betrachtet um die Wiederherstellung einer (gesellschaftlichen) Einheit, was voraussetzt, dass zuvor eine Ausgrenzung stattgefunden hat. Die Wiedereingliederung im Zuge von Integration ist also ein Prozess, der eine unerwünschte Ausschlusssituation oder einen Rückstand durch individuelle Hilfsangebote beheben soll. Das Konzept der Inklusion geht hingegen davon aus, dass von Beginn an niemand ausgegrenzt wird und daher keine Integration erforderlich sei (Lee 2010, S. 23-25). Zur Veranschaulichung dessen werden häufig Grafiken wie z.B. Abbildung 1 verwendet, um die Unterschiede der Begrifflichkeiten zu visualisieren:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Abbildung 1, Info-Grafik Aktion Mensch)
Die Erläuterung dieser Abbildung lässt sich am Beispiel des Schulbesuchs von Kindern und Jugendlichen vornehmen. Wenn Schülern der Zugang zur allgemeinen Regelschule verwehrt wird, findet eine Exklusion statt, bei der sie nur auf den Besuch einer Förderschule zurückgreifen können. Bei der Integration werden Schüler/innen mit Behinderung als Personengruppe in das System der Regelschule mit aufgenommen. Sie gehören zu dieser Institution, haben jedoch einen Sonderstatus, da sie sich z.B. in speziellen Klassen für gemeinsamen Unterricht befinden und Förderangebote erhalten, die vielfach außerhalb des Klassenzimmers mit räumlicher Trennung stattfinden. Beim Ansatz der Inklusion wird das Ziel verfolgt, dass gemeinsamer Unterricht nicht die Ausnahme, sondern die Regel darstellt und eine Durchmischung aller Schüler/innen in allen Klassen stattfindet.
Im Zuge der Entwicklungen hin zur Inklusion findet man häufig die Aussage, dass Integration als Vorstufe gesehen wird, die nun durch die (qualitativ „höherwertige“) Inklusion abgelöst werden soll. Damit geht es dann bei der Auseinandersetzung mit Begriffen wie Exklusion, Separation, Integration und Inklusion um eine Art Stufenmodell mit qualitativ aufeinander aufbauenden Schritten. Dieser Logik folgend wird die Umsetzung der Inklusion in Anlehnung an normative und moralische Gesichtspunkte gefordert und mit Bezug auf die UN-BRK mit Hochdruck vorangetrieben. Befürworter der Inklusion argumentieren damit, dass sowohl Integration, als auch Inklusion von der Zielsetzung her auf den gleichen Horizont zusteuern. Die Integration verfolge jedoch in der praktischen Umsetzung einen falschen und überholten Ansatz, sodass sie nun durch die Inklusion abgelöst werden müsse. Dabei besteht die Gefahr, dass unter Zeitdruck Tatsachen und Rahmenbedingungen geschaffen werden, aber die inhaltlichen und praktischen Ausgestaltungen dem nicht Schritt halten können, wie es derzeit z.B. bundesweit im Schulsystem diskutiert wird (Weber 2010, S. 289; Lee 2010, S. 24 f.).
Zwischen den Begrifflichkeiten und den Handlungsansätzen der Integration und der Inklusion gibt es deutliche Unterschiede und beide Konzepte haben zukünftig ihre Daseinsberechtigung. Die Integration sollte nicht pauschal durch einen neuen Ansatz abgelöst und als überholt deklariert werden.
Inklusion ist darauf ausgerichtet, dass alle Menschen einen Zugang zu allen Systemen der Gesellschaft erhalten. Der Zugang, das entsprechende Recht, die formale Chancengleichheit und die Nichtdiskriminierung sind dabei die zentralen Bezugspunkte. Damit setzt Inklusion an einem makro-soziologischen Punkt aus der Sicht der Politik und der Gesellschaft an. Integration hingegen ist ein Begriff, welcher der klassischen Soziologie entstammt und darauf abzielt, dass Individuen eine normativ-soziale Einbindung in die Gesellschaft erhalten. Dabei geht es jenseits von formalen Zugangsmöglichkeiten um Zugehörigkeit, Teilhabe (im Sinne der Partizipation) und Anerkennung in der sozialen Umwelt. Integration hat also eine mikro-soziologische Perspektive aus der Sichtweise der einzelnen Individuen und sie betrachtet deren subjektives Empfinden (Weber/Wagner 2015, S. 129 f.).
Bei den Zielen wie Chancengleichheit und Zugangsmöglichkeiten gilt es zu differenzieren zwischen dem „mitmachen dürfen“ (was durch die Inklusion ermöglicht wird) und dem „dazu gehören“. Um zu einer sozialen Gemeinschaft dazu zu gehören, ist es erforderlich, sich an deren Norm- und Wertvorstellungen anzupassen. Dies kann bei den jeweiligen Individuen jedoch mit Einschränkungen in den grundsätzlichen Freiheiten (z.B. Denkweisen und Handlungsmuster) verbunden sein. Wer dazu gehören möchte, muss sich zu einem gewissen Grad anpassen. Dieser Anforderung, sich selber anzupassen, sollen Menschen mit Behinderung im Zuge der Inklusion zukünftig entbunden werden, indem die Anpassung nun der Gesellschaft als Anforderung auferlegt wird. Dies kann jedoch in der Praxis nur teilweise und kaum in Reinform gelingen. Von der Kindertagesstätte über die Schule, die Jugendarbeit bis hin zum Arbeitsleben müssen sich die Individuen zu einem Mindestmaß in organisationsbezogene und soziale Gegebenheiten einfügen. Die dazu individuell erforderlichen Hilfen liefern die Angebote der Integration (Weber/Wagner 2015, S. 131).
Um Menschen mit Behinderung nicht zu bevormunden, sondern ihnen Entscheidungsoptionen zu eröffnen, sollte man ihnen die Wahl lassen, ob sie Inklusionsmöglichkeiten in Anspruch nehmen wollen (Zugang zu allgemeinen Regelsystemen), oder ob sie auf Freiheitsgrade verzichten möchten, um stattdessen in Sondereinrichtungen ein höheres Maß an Integrationsleistungen zu erhalten. Ein Schüler mit Autismus oder ein handwerklicher Arbeitnehmer mit geistiger Behinderung kann z.B. in einer Förderschule oder einer WfbM ein hohes Maß an Wertschätzung, Zugehörigkeitsgefühl und sozialer Eingebundenheit erfahren. Dort würde Integration gelingen, aber Inklusion auf der Strecke bleiben. In einer Regelschule oder einem Handwerksbetrieb auf dem ersten Arbeitsmarkt erhalten diese Beispielpersonen Zugangsmöglichkeiten, Entwicklungschancen und Teilhabeangebote in Regelsystemen. Dies führt aber nicht automatisch dazu, dass sie sich dort auch zugehörig und wohl fühlen. Sie könnten z.B. stets mit der Wahrnehmung konfrontiert werden, eine Ausgrenzung durch andere Personen zu fühlen, den Leistungsanforderungen nicht gerecht werden zu können und weniger Wertschätzung und sozialen Status zu erfahren. Dann läge ein gelungener Inklusionsschritt bei misslungener Integration vor. Die verschiedenen Ansätze der Inklusion und der Integration müssen also - anstatt einer Ablösung - weiterhin gleichberechtigt nebeneinander existieren und sich ergänzen (Weber/Wagner 2015, S. 131 f.)
Bei der Wahl zwischen diesen Optionen ist es erforderlich, mit individuellem Bezug auf den jeweiligen Einzelfall zu überlegen, welche Angebote sich am besten eignen. Diese Auswahl- und Verteilungsentscheidungen werden durch die Einführung der Inklusion nicht automatisch mitgeregelt. Die alleinige Tatsache, dass Schüler mit Behinderung inzwischen einen Anspruch auf einen Platz an einer Regelschule haben, heißt nicht automatisch, dass dort auch für jeden ein passendes bzw. besseres Lernumfeld vorliegt. Die Einbeziehung in den gemeinsamen Unterricht an einer Regelschule kann einerseits dazu führen, dass sich kognitive Leistungen der Schüler erhöhen und vorhandene Ressourcen besser genutzt und ausgebaut werden. Genauso kann es jedoch in anderen Fällen auch dazu führen, dass es zu Frustrationserfahrungen, Ausgrenzung und Abwertung bei den Betroffenen kommt, da real existierende Separationen und Gruppendynamiken nicht alleine dadurch überwunden werden, dass sie durch die Einführung des neuen Begriffs Inklusion und durch die Öffnung eines Systems in der Theorie „quasi-abgeschafft“ werden. Kommt in einem solchen Fall z.B. noch die zieldifferente Beschulung hinzu, da abzusehen ist, dass der/die Schüler/in das curricular gesetzte Klassenziel (z.B. Hauptschulabschluss) aufgrund der individuellen Beeinträchtigungen nicht erreichen kann, reduziert sich der Inklusionsanspruch schnell nur noch auf ein räumliches Beisammensein im Klassenzimmer. Tatsächliche und praktische Inklusionsprozesse finden dann bestenfalls nur noch beim Spielen in der Pause auf dem Schulhof statt.
Über den Bereich der Schule hinaus lassen sich entsprechende Chancen und Risiken ebenso auf andere Kontexte, wie z.B. Frühförderung, Jugendarbeit oder die Teilhabe am Arbeitsleben, projizieren. Die Inklusion bietet die Chance, verschiedene Räume des gemeinsamen sozialen Miteinanders für alle zu öffnen – unabhängig davon, ob Behinderungen oder Beeinträchtigungen einzelner Personen vorliegen. Diese Räume und Angebote müssen dann im Gegenzug jedoch auch angemessen genutzt und ausgestaltet werden, wozu etablierte Angebote der Integration erforderlich sind. Der Gradmesser für Erfolg und Wirkung entsprechender Schritte sollten die individuellen Verbesserungen von Chancen, Ressourcen und Handlungsspielräumen bei gleichzeitiger Berücksichtigung der subjektiv empfundenen Lebensqualität der betroffenen Personen sein. Zur Betrachtung dessen eignet sich z.B. der Capability-Approach nach Amartya Sen und Martha Nussbaum (Weber/Wagner 2015, S. 131-137; Lee 2010, S. 24)[1].
2.4 Zwischenfazit
Die Betrachtung der UN-BRK zeigt, dass sie von Grundsatz her darauf ausgerichtet ist, (Mindest-) Standards der internationalen Menschenrechte für Menschen mit Behinderung zu verbessern. Die nationale Umsetzung dessen ist gekoppelt an die Übersetzung der Konvention und an die Ausgestaltung der jeweiligen Aktionspläne. In Deutschland wird diese Diskussion mit vielen moralischen und normativen Aspekten angefüttert. Inklusion bedeutet jedoch nicht pauschal den „Schlüssel zum Glück“, sondern - viel grundlegender - das Recht auf Teilhabe an verschiedensten Konkurrenzsituationen in der Gesellschaft. Jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Behinderung, hat ein Recht auf Teilhabe, auf Anerkennung seiner Person und auf Achtung seiner Würde. Dies soll durch die UN-BRK und die Inklusion bekräftigt und gefördert werden. Vor diesem Hintergrund soll auch im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe allen jungen Menschen die bestmögliche und passendste Form der Förderung in dieser Lebensphase zuteilwerden. Dennoch muss losgelöst davon berücksichtigt werden, dass nicht alle Menschen das gleiche Maß an Leistung erbringen können. Hier lassen sich Differenzierungen nicht abschaffen und spätestens an der Schwelle zum Arbeitsmarkt, der per se nicht sozial ausgerichtet ist, sondern rational und ökonomisch nach der Verwertbarkeit von Arbeitskraft fragt, prallen Anspruch und Wirklichkeit der Inklusionsvorhaben in der Praxis aufeinander.
Die neutrale Perspektive der systemtheoretischen Sichtweise geht davon aus, dass Inklusion in modernen Gesellschaften bereits stattfindet und Exklusion in Reinform nicht vorkommt. Diese Theorie greift jedoch zu kurz, da es in der gesellschaftlichen Praxis de facto zu Ausgrenzungen kommt, denen entgegengewirkt werden muss. Die soziologische Betrachtung zeigt, dass das Postulat einer allumfänglichen Inklusion jedoch nicht umsetzbar ist, da sich Systeme der Gesellschaft und soziale Gruppierungen stets durch Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit, also durch Inklusion und Exklusion, definieren. Rhetorische und praktische Etikettierungen und Abgrenzungen von Personen bzw. Gruppen sind faktisch ein Bestandteil des alltäglichen Lebens in unserer Gesellschaft. Inklusion sollte moderat und schrittweise erfolgen in einer Art und Weise, bei der die Praxis und die Gesellschaft Zug um Zug mitgenommen werden, anstatt sie (z.B. durch neue Gesetze) vor vollendete Tatsachen zu stellen.
Die Ziele der Inklusion sind im Kern nicht neu, jedoch werden sie unter diesem Begriff neu diskutiert und erhalten durch die UN-BRK ein anderes Gewicht. Einige Personen legen die Umsetzung des Inklusionsgedankens so aus, dass Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderung im Zuge dessen ihre Daseinsberechtigung verlieren. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass dort gebündeltes Spezialwissen zu finden ist, auf das viele behinderte Menschen angewiesen sind. Der Anspruch der Inklusion richtet sich nicht nur an Personen mit eher geringen Beeinträchtigungen, sondern auch an mehrfach-schwerstbehinderte Menschen, die auf entsprechende Sondereinrichtungen angewiesen sein können und dort die für sie passende Form der Teilhabe und Förderung erfahren. Sondereinrichtungen sollten verringert werden, aber ihr Fortbestand verstößt nicht grundsätzlich gegen die Vorgaben der UN-BRK.
Ähnlich verhält es sich bei der Gegenüberstellung von Inklusion und Integration. Es gibt dort nicht ein pauschales „richtig oder falsch“ bzw. „besser oder schlechter“. Beides hat seine Vor- und Nachteile und seine Daseinsberechtigung. Mit Blick auf die Partizipation der Betroffenen muss im Rahmen der Inklusion stets ihr Standpunkt berücksichtigt werden. Dies gilt auf der einen Seite für die gesellschaftliche Debatte auf der Meta-Ebene, die nicht alleine aus der Perspektive der Politik geführt werden darf. Auf der anderen Seite gilt dies für Überlegungen zur praktischen Anwendung von Inklusion im individuellen Einzelfall. Die Inklusion von Menschen mit Behinderung in gesellschaftliche Regelsysteme sollte nicht grundsätzlich mit „gut“ oder „schlecht“ bewertet werden, sondern es muss heißen „es kommt drauf an“. Für die Suche nach passenden Rahmenbedingungen und erforderlichen Hilfestellungen im Einzelfall bedarf es einer fachlichen und unabhängigen Beratung. Im Zuge dessen lassen sich die Optionen identifizieren, bei denen Chancen, Ressourcen und Handlungsspielräume der Betroffenen ausgebaut werden können unter gleichzeitiger Berücksichtigung ihrer sozialen Einbindung und der subjektiven Lebensqualität. Beachtenswert ist auch die Frage nach den Kosten, die mit der Inklusion verbunden sind. Es werden höhere finanzielle Aufwendungen entstehen, die nicht alleine durch die Kommunen getragen werden können. Auch Bund und Länder müssen die Finanzierung entsprechender Maßnahmen mittragen. Im Zuge dessen ist es kritisch zu betrachten, dass der Bund bereits im Vorfeld darauf hinweist, dass die finanziellen Ausgaben im Rahmen zukünftiger Teilhabeangebote möglichst gering gehalten werden sollen.
3. Umgang in der Kinder- und Jugendhilfe mit seelischer Behinderung
Wie im vorherigen Kapitel dargestellt wurde, leitet sich aus der UN-BRK das Ziel und der Anspruch ab, mehr Chancengleichheit, eine Nichtdiskriminierung und gleiche Zugangsmöglichkeiten für alle Menschen zu entwickeln. Dabei handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Bei den Überlegungen, wie diesen theoretischen Vorgaben in der Praxis begegnet werden kann, ist zunächst der Ist-Stand zu betrachten, der aus den Büchern des Sozialgesetzbuches hervorgeht. Da sich diese Ausarbeitung speziell der Altersgruppe der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen widmet, steht das SGB VIII im Zentrum der Betrachtung. Auf den folgenden Seiten sollen die aktuelle Situation, die rechtliche Lage und die praktische Umsetzung von Leistungen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung thematisiert werden. Im SGB VIII sind entsprechende Regelungen für Personen mit Behinderung im § 35a zu finden, der sich auf die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bezieht. Diesen Paragraphen gibt es jedoch erst seit dem Jahr 1993 und dem Zusatz „a“ kann entnommen werden, dass er nachträglich in das SGB VIII aufgenommen wurde. Bislang ist die Kinder- und Jugendhilfe lediglich für den Bereich der seelischen Behinderungen zuständig und nicht für andere Behinderungsformen.
Seelischen Behinderungen und psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen wurde erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nennenswerte Aufmerksamkeit geschenkt. Dort entstanden die ersten speziellen Einrichtungen für „psychopathische“ Kinder und Jugendliche, die von der christlichen Kirche getragen wurden. Das Bewusstsein dafür, dass psychische und seelische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen nicht mit denen von Erwachsenen gleichzusetzen und anders zu behandeln sind, schritt nach und nach voran und 1927 eröffnete die erste spezielle psychiatrische Klinik für Kinder und Jugendliche. Der erste Universitätslehrstuhl für den Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde 1957 eingerichtet. Im Zuge dessen hielten die Rehabilitationsleistungen für seelisch behinderte Menschen Einzug in die Gesetzgebung. Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) folgte auf die Reichsfürsorgepflichtverordnung und im Jahr 1969 wurden im 2. Änderungsgesetz des BSHG zum ersten Mal Leistungen und Ansprüche für Menschen mit seelischer Behinderung benannt, während zuvor nur körperliche und geistige Behinderungen berücksichtigt wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurde jedoch noch nicht zwischen seelischen Behinderungen bei Erwachsenen und Kindern bzw. Jugendlichen unterschieden. Im Jugendhilferecht gab es noch keinerlei Regelungen bzgl. Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Seelische Entwicklungsstörungen wurden stets mit erzieherischen Defiziten in Verbindung gebracht (Schwengers 2008, S. 41-43).
Im Jahr 1973 stand im Zuge der Überarbeitung des Jugendhilfegesetzes bereits zur Diskussion, ob alle jungen Menschen mit Behinderung in den Bereich der Jugendhilfe aufgenommen werden. Dies kann als früher Auftakt für die Überlegungen einer „großen Lösung“ betrachtet werden, die in Kapitel 4 eingehend betrachtet und diskutiert wird. Entsprechende Vorschläge konnten sich jedoch noch nicht durchsetzen. Mehrere Jahre später wurde 1989 bei einem neuen Gesetzentwurf vorgeschlagen, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in den Bereich der Jugendhilfe aufzunehmen. Auch hier taucht im Referentenentwurf wieder die Option auf, über den Personenkreis der seelisch behinderten jungen Menschen hinaus auf Landesebene die Möglichkeit zu bieten, dass alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderung der Jugendhilfe zugeordnet werden. Erneut wurde diese große Lösung jedoch abgelehnt und der Gesetzgeber etablierte im Zuge der Einführung des SGB VIII die „kleine Lösung“ im Jahr 1991. Dabei wurde die Jugendhilfe erstmals explizit für Hilfeleistungen gegenüber seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen zuständig, was zu diesem Zeitpunkt durch die Einführung des Absatz 4 im § 27 SGB VIII noch den Hilfen zur Erziehung zugeordnet wurde. Der Grund, warum der Ansatz einer großen Lösung zu diesem Zeitpunkt scheiterte, lag in Befürchtungen und Widerständen von Eltern- und Behindertenverbänden (LVR 2014, S. 7; Schwengers 2008, S. 43-45; Wiesner 2014, S. 57).
Als im Jahr 1991 das SGB VIII als Nachfolger des deutschen Jugendwohlfahrtsgesetzes (JWG) eingeführt wurde, war die Kinder- und Jugendhilfe also erstmals mit Ansprüchen und Leistungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche konfrontiert. Die Leistungen für junge Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung wurden der Sozialhilfe zugeordnet – eine Trennung, die bis heute in dieser Form Bestand hat. Dem Ziel des Gesetzgebers, Abgrenzungsschwierigkeiten verschiedener Rechtskreise durch die klare Zuordnung von Leistungen bei seelischer Behinderung zur Jugendhilfe zu verringern, traten in der Praxis jedoch schnell Schwierigkeiten und Streitfragen bei der Auslegung entgegen. Da die Eingliederungshilfen im Absatz 4 des § 27 SGB VIII den allgemeinen Hilfen zur Erziehung zugeordnet wurden, stellte sich die Frage, ob die Tatbestandsvoraussetzungen für Hilfen zur Erziehung (erzieherisches Defizit) auch Voraussetzung für die Rechtsfolge einer Eingliederungshilfe im Fall von seelischer Behinderung sind. Vielfach vertraten Jugendämter die Ansicht, dass bei einem Fehlen erzieherischer Defizite die Sozialhilfe auch bei seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen für Leistungen der Eingliederungshilfe zuständig sei. Diesen Auslegungsschwierigkeiten wurde dadurch begegnet, dass am 01.04.1993 der § 35a SGB VIII als neue Vorschrift in das Kinder- und Jugendhilfegesetz Einzug hielt und die Eingliederungshilfen nun nicht mehr unter den allgemeinen Hilfen zur Erziehung subsumiert wurden. Seitdem besteht der § 35a als eigenständiger und zweigliedriger Leistungstatbestand, der die Gewährung von Eingliederungshilfen an eine Abweichung der seelischen Gesundheit und Beeinträchtigungen bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben knüpft. Allerdings zog auch diese Abkoppelung viele kritische Stimmen in der Praxis nach sich. Es wurde z.B. kritisiert, dass durch die gesonderte gesetzliche Verankerung eine Stigmatisierung der Betroffenen erfolgt. Außerdem entstand eine Auseinandersetzung um Kompetenzen und Ressourcen zwischen der Jugendhilfe und der Jugendpsychiatrie bezüglich des Begriffs der seelischen Behinderung, da die beiden Berufsgruppen dem Thema mit unterschiedlichen Sichtweisen und Handlungsschritten begegnen (LVR 2014, S. 7-8; Schwengers 2008, S. 45-48).
[...]
[1] Zum Weiterlesen: Literaturhinweis bzgl. Capability-Approach: Nussbaum, Martha (2015): Fähigkeiten schaffen: Neue Wege zur Verbesserung menschlicher Lebensqualität. Verlag Karl Alber, Freiburg.
- Arbeit zitieren
- Dennis Rothstein (Autor:in), 2016, Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe. Chancen, Herausforderungen und Perspektiven für den Rechtskreis SGB VIII, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367443
Kostenlos Autor werden

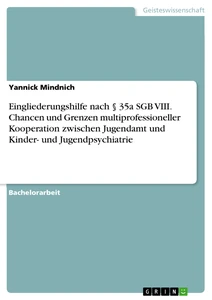



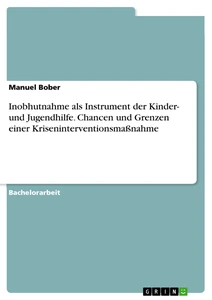

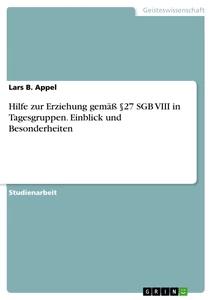










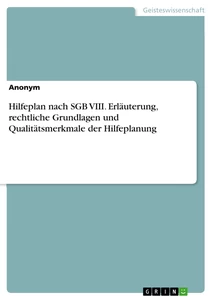

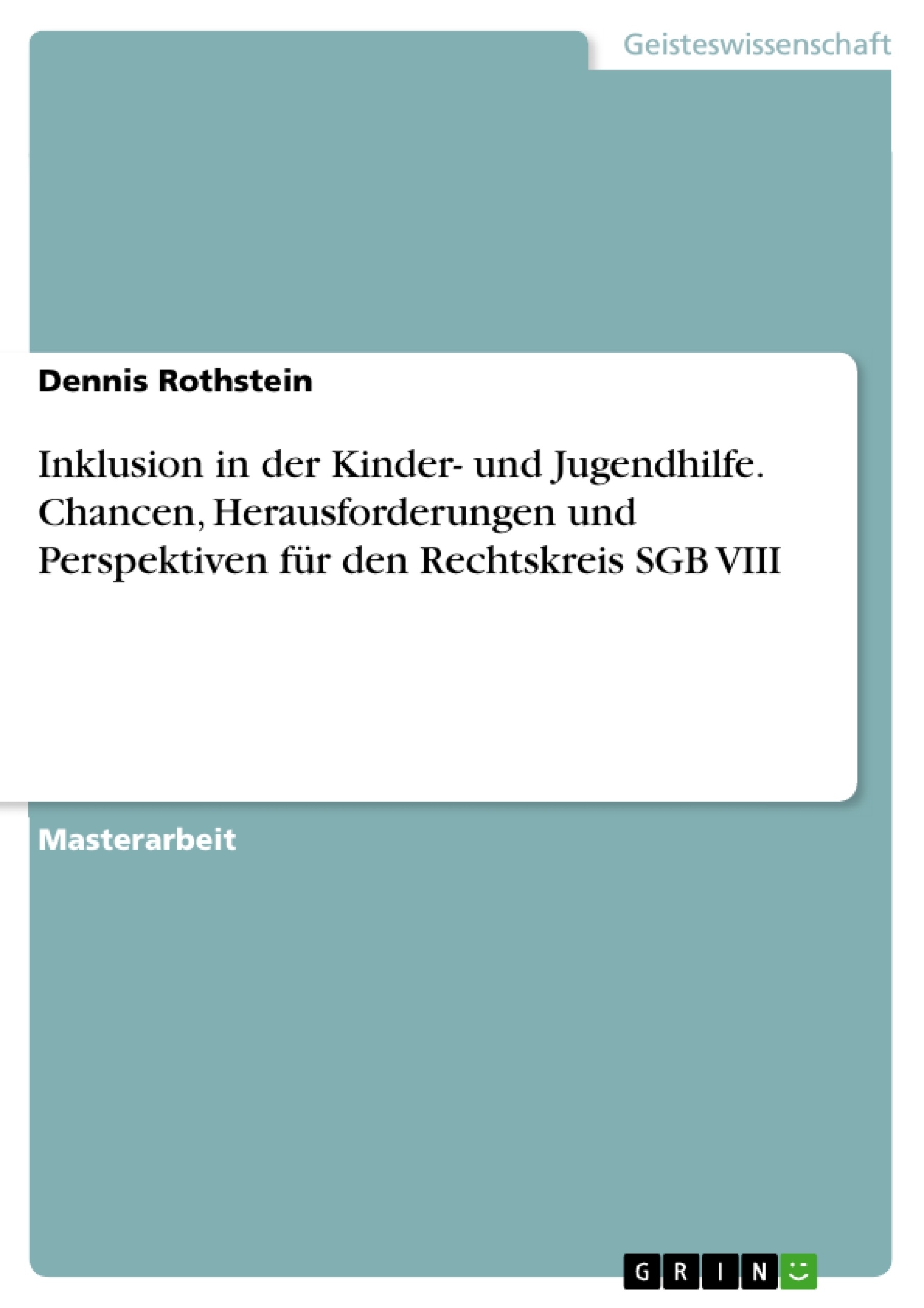

Kommentare