Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
II Abbildungsverzeichnis
III Tabellenverzeichnis
Danksagung
1 Was ist hier eigentlich los und was ist die Frage?
2 Konzeptioneller Rahmen der empirischen Erhebung
2.1 Die neue Moderne
2.1.1 Visuelle Medienkultur
2.1.2 Theatralität in den Medien
2.1.3 Einordnung
2.2 Klassische Wirkungsmodelle
2.2.1 Elaboration Likelihood Modell nach Petty/Cacioppo
2.2.2 Konsumentenverhalten nach Trommsdorff
2.2.3 Kritische Betrachtung
2.3 Die Bedeutung und Relevanz der Visualität im Rahmen der Unternehmenskommunikation
2.3.1 Was ist ein Bild?
2.3.2 Bedeutungsgenerierung in der visuellen Kommunikation
2.3.3 Besonderheiten des Bewegtbildes
2.3.4 Geschichtliche Einordnung des Werbefilms
2.3.5 Anforderungen an die visuelle Zielgruppe und an Konstrukteure von visuellen Inhalten
2.4 Visuelle Wissenssoziologie
2.4.1 Wissensformen
2.4.2 Relevanz und geschichtliche Einordnung der Wissenssoziologie
2.4.3 Relevanz und Besonderheiten der visuellen Wissenssoziologie
2.4.4 Körperlichkeit als Ausdruck des Habitus
2.4.5 Ansätze und Problematik der visuellen Wissenssoziologie
2.5 Bedeutung für die nachfolgende Forschung
3 Empirische Erhebung
3.1 Das Forschungsobjekt
3.1.1 Relevanz und Eignung
3.1.2 Inhaltsanalyse des Videos
3.2 Forschungsmethodik
3.2.1 Datenerhebung
3.2.1.1 Sampling
3.2.1.2 Gruppendiskussion
3.2.1.3 Transkription
3.2.2 Auswertungsmethode
3.3 Ergebnisse der empirischen Analyse
3.3.1 Warum Videos bevormunden können
3.3.2 Warum Videos kränken können
3.3.3 Warum Versicherungen verunsichern können
3.3.4 Zusammenfassung – Wissen als Grundlage für die Bedeutungsgenerierung
4 Konklusion aus Theorie und Empirie: Die überschätzte Macht des Visuellen
4.1 Der perzeptorische Umgang mit Videos
4.2 Bedeutung für die visuelle Unternehmenskommunikation
5 Fazit und Ausblick
5.1 Kritische Würdigung
5.2 Implikation für die Forschung
IV Literaturverzeichnis
V Anhang
II Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: The Idea of Imagery – „Familienstammbaum“ der Bilder (Quelle: Mitchell [1990], S. 20)
Abb. 2: Halls Encoding/ Decoding Modell (Quelle: Krotz [2009], S. 216)
Abb. 3: Wissensgenerierung in der hermeneutisch-interpretativen Forschung (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Neuweg [1999], S. 10)
Abb. 4: Fragebogen (Quelle: Eigene Darstellung)
Abb. 5: Kodierparadigma: Visualisiertes Wissen (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Strauss/Corbin [1996], S. 78 ff.)
Abb. 6: Kodierparadigma: Visuelles Wissen (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Strauss/Corbin [1996], S. 78 ff.)
Abb. 7: Kodierparadigma: Alltagswissen (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Strauss/Corbin [1996], S. 78 ff.)
Abb. 8: Kodierparadigma: Wissen (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Strauss/Corbin [1996], S. 78 ff.)
III Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Sequenzielle Einteilung und subjektive Deutung des Videos
Tab. 2: Ergebnisse des Fragebogens Gruppe 1
Tab. 3: Ergebnisse des Fragebogens Gruppe 2
Zusammenfassung
Die hier vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen Video und versucht zu klären, inwiefern es Unternehmen möglich ist, unter Rückgriff auf Visualisierungen auf die Wissensstrukturen des Rezipienten Einfluss zu nehmen. Im ersten Schritt wird zunächst die derzeitige mediale Welt vorgestellt, um dann mögliche Interdependenzen zwischen Mensch und Medien zu untersuchen. Nach der Erläuterung der aktuellen Theatralitätstheorie wird die Annahme getroffen, dass Medien in unbestimmter Form Einfluss auf die Rezipienten nehmen können. Daher erfolgt im Anschluss ein kurzer Einblick in die klassischen Wirkungsmodelle. Es kann aufgezeigt werden, dass diese in unserer heutigen Zeit kaum ihre Gültigkeit behalten können und Modelle benötigt werden, die von einem aktiven Rezipienten ausgehen. Aufgrund dessen widmet sich das darauffolgende Kapitel den Bildwissenschaften. Hier zeichnen sich erste Hinweise auf die (Rahmen-)Bedingungen eines Rezeptionsprozesses ab. Die Vermutung, dass bspw. Sinnstrukturen beim Rezipienten eine entscheidende Rolle bei der Interpretation des Bildes spielen, wird auch ihm Rahmen des Bewegtbildes analysiert. Ähnliche Eigenschaften zwischen Film und Video werden deutlich, da beide einer Syntax folgen können. Es kann letztendlich die Annahme getroffen werden, dass Rezipienten über unbestimmte Wissensstrukturen verfügen, die den Interpretationsprozess des Videos maßgeblich beeinflussen. Daher werden im anschließenden Kapitel zunächst die Wissensformen implizit und explizit und die speziellen Formen visuell und visualisiert vorgestellt. Dies führt zu den Ansätzen der Wissenssoziologie und im Speziellen zu der visuellen Wissenssoziologie. Auch hier zeigt sich, dass das Wissen des Rezipienten bspw. in Form von Erfahrungen eine essenzielle Rolle bei der Bedeutungsgenerierung spielt. Innerhalb der anschließenden empirischen Untersuchung wird deutlich, dass bei der Rezeption eines Videos, der Thematik große Relevanz beigemessen wird. Das visualisierte Wissen wird zwar verstanden und auch im Sinne des Unternehmens interpretiert, dennoch fällt die Kritik am Video negativ aus. Dies kann bspw. schlechten Erfahrungen mit der Thematik und anderen Rezeptionsgewohnheiten zugesprochen werden.
Letztendlich kann die Hypothese aufgestellt werden, dass Rezipienten sowohl auf visuelles Wissen als auch auf Alltagswissen zurückgreifen, um das Video zu deuten. Das Video spielt in dem vorliegenden Fall eine untergeordnete Rolle, sodass die Wissensstrukturen des Rezipienten bei der Analyse von visuellen Wirkungsmechanismen in den Vordergrund treten.
Abstract
This master thesis discusses the phenomenon video and tries to clarify whether it is possible for companies to influence recipients’ knowledge structures by means of visualisations.
The first section introduces the current media environment in order to examine possible interdependencies between Man and Media. The theatre studies make the assumption that media can influence recipients in an undetermined fashion. This calls for a short but critical perspective on classical effect models, where one can show that these cannot hold under today’s circumstances. This calls for models assuming an active recipient.
The second section hence elaborates on visual studies. These take first steps towards defining general conditions of the reception process. We examine the assumption that latent structures of meaning can play a decisive role for a recipient’s interpretation of an image even in the context of moving images. Structural similarities between film and video exist, as both can follow syntax. Finally, one can make the assumption that recipients have undetermined knowledge structures that significantly influence the process of interpreting a video.
The third section proceeds to introduce explicit and implicit knowledge forms as well as the special forms visual and visualised, leading to knowledge-sociological and in particular visual knowledge-sociological approaches. These, too, show that the recipient’s knowledge, for example in the shape of previous experiences, plays an essential role in the generation of meaning. The ensuing empirical analysis shows that the topic is highly relevant for the reception of a video. While the visualised knowledge is being understood and interpreted according to the intentions of the company, the critique of the video may still be negative. This can be attributed to for example negative experiences with the topic as well as other reception habits.
Finally, one can hypothesise that recipients access both visual as well as everyday knowledge to interpret a video. This master thesis provides an example where the video itself plays a smaller role and the recipient’s knowledge structures come to the fore.
Danksagung
Zuallererst möchte ich meinem Erstprüfer Michael Roslon meinen Dank aussprechen. Das fachliche Wissen, der kreative Input und die konstruktive Kritik haben das Schreiben dieser Arbeit zu einer echten Herausforderung gemacht, aber auch erleichtert.
Als Nächstes möchte ich mich bei unserem Studiendekan und meinem Zweitprüfer Professor Jan Rommerskirchen für zwei wirklich tolle Jahre bedanken. Ich spreche bestimmt auch im Namen meiner Kommilitonen, wenn ich Ihnen für den gemeinsamen Schritt zur Meta-Ebene danke. Mit Ihrer Hilfe haben wir uns sicher nicht nur fachlich weiterentwickeln können.
Auch meine engsten Vertrauten dürfen natürlich nicht fehlen. Ich danke meiner Familie, die jeden zweiten Tag einen Hilferuf entgegennehmen musste (entschuldigt bitte!) und die mich in der Zeit meiner Zwangspause im Krankenhaus mit viel Liebe beruhigt und unterstützt hat. Ihr wart meine Luft zum Atmen!
Ich danke meinen lieben Freunden, insbesondere Wiebke Kaiser. Ihr wart (und seid) mein Fels in der Brandung und habt mir durch euren Zuspruch die ein oder andere schlaflose Nacht erspart.
Ein weiterer Dank gilt außerdem meinen Probanden ohne deren Hilfe diese Arbeit wohl nicht die unerwartete und entscheidende Wendung genommen hätte.
Zuletzt sind noch meine tollen Arbeitskollegen der Video-Content-Agentur make/c zu nennen. Eure unbändige Geduld und euer großes Verständnis für meinen Ehrgeiz haben diese anstrengende Zeit mit Masterarbeit und Job wesentlich entspannter gemacht. Auch der entscheidende Hinweis zum Forschungsgegenstand stammt aus einem gemeinsamen Brainstorming. Vielen Dank!
Wenn ich diese Zeilen symbolisch ausdrücken sollte, würde ich ein Herz wählen. Denn das würde wohl am besten die Liebe zu meiner Familie und meinen Freunden sowie das Herzblut, das in diese Arbeit geflossen ist, ausdrücken.[1]
1 Was ist hier eigentlich los und was ist die Frage?
In der alltäglichen Welt ist die Präsenz von Videos enorm. Diese Beobachtung fällt nicht schwer und ist für jeden ersichtlich. Die Medien sind stark visualisiert, und selbst textlastige Medien, wie Tageszeitungen, Kunden- und Mitarbeiterzeitschriften sowie Magazine, bedienen sich online dem Bewegtbild. Es entwickeln sich immer neue Medienformate, z. B. Snapchat und Facebook-Live, die Videos eine Plattform und damit weitreichende Verbreitungsmöglichkeiten geben. Aufgrund dieser technischen Entwicklung sehen sich Rezipienten einer visualisierten Informationsflut gegenüber.[2] Bereits 2011 schätzten 84 Prozent der deutschen Unternehmen die Entwicklung der Nachfrage nach Bewegtbildwerbung als „stark zunehmend“ ein.[3] Mittlerweile werden die Ausgaben für Bewegtbildwerbung für das Jahr 2021 auf 614 Millionen Euro geschätzt, was einen Anstieg von 230 Prozent in sechs Jahren bedeuten würde.[4]
Diese Entwicklungen und Einschätzungen begünstigen die starke Fokussierung der Unternehmen auf Bilder und im Speziellen auf Bewegtbilder. Daher ist auch zu beobachten, dass immer mehr sogenannte Video-Content-Agenturen gegründet werden oder sich Content-Agenturen mit dem Thema Video beschäftigen. Vermutlich liegt dies an den vermeintlich vielen Vorteilen, die Videos bieten. Befragte werbetreibende Unternehmer gaben an, dass sie Videos als sehr geeignet finden, um Aufmerksamkeit und somit eine Werbewirkung zu generieren.[5] Die Agenturen selbst können nur sehr vage beschreiben, was genau beim Konsumenten bei der Betrachtung eines Videos passiert. So geben sie beispielsweise an, dass Videos generell mehr Aufmerksamkeit erzeugen, dass Botschaften besser durch Videos übertragen werden können und dass Bewegtbild den Betrachter eher dazu animiert, Inhalte online zu teilen. Hierbei ist aus wissenschaftlicher Sicht jedoch zu vermuten, dass es sich lediglich um intuitive Behauptungen der Agenturen handelt, die den Erfolg von Videos an rein numerischen Kennzahlen, wie Klickraten und Verweildauer, festmachen.[6]
Entscheidend für die vorliegende Arbeit ist der Aspekt, dass 48 Prozent der Unternehmen davon ausgehen, sie könnten Involvement bei der Zielgruppe erzeugen. Dies impliziert die Möglichkeit der Einflussnahme des Unternehmens auf die Alltagswirklichkeit des Rezipienten. Neben den neuen Verbreitungsplattformen könnte Involvement einer der Hauptgründe für den „Boom“ von Videos sein. Das Erzeugen von Involvement im wissenschaftlichen Sinne wird in der vorliegenden Arbeit als die Auswirkung eines konstruierten Inhaltes auf den Rezipienten angesehen. Ob dies mithilfe von Videos gelingen kann, ist Gegenstand der Untersuchung. Es ergibt sich somit folgende Forschungsfrage: Inwiefern können Videos in die Wissensstrukturen des Rezipienten eingreifen?
Zur Vorbereitung und Einleitung beschäftigt sich der erste Teil dieser Arbeit verstärkt mit der Bedeutung der Medien für die Gesellschaft im Allgemeinen. Ziel ist es herauszuarbeiten, welche Funktionen Medien innerhalb der Gesellschaft haben in einer Zeit, die sich stetig verändert. Im nächsten Schritt wird die These der Theatralität aufgezeigt. Sie gibt einen kurzen Einblick in den neusten Stand der Forschung.
Nach diesen Ausführungen werden zunächst die klassischen Wirkungsmodelle Elaboration-Likelihood -Modell und das Modell nach Trommsdorff beschrieben und in den Zusammenhang der Medienkultur eingeordnet. Dies dient vor allem dazu, die Diskrepanz der Ansätze der klassischen Werbewirkungsforschung und der Mediatisierungsforschung aufzuzeigen und die Mängel der Werbewirkungsforschung darzulegen.
Im nächsten Schritt werden die Ausführungen der Bildwissenschaften näher beleuchtet. Es gilt zu klären, was ein Bild ist, welche Funktionen es haben kann und inwiefern es Bedeutungen generieren kann. Folglich werden dann die Besonderheiten des Bewegtbildes herausgearbeitet, um letztendlich die Ansprüche an die Rezipienten und Konstrukteure von visuellen Inhalten darzulegen. Dieses Kapitel dient dann als Überleitung zur Wissenssoziologie.
Auf dem Kapitel visuelle Wissenssoziologie liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit. Die hierzu vorgestellten Ansätze geben einen Hinweis darauf, inwiefern Bewegtbilder innerhalb mediatisierter Welten wirken können. Außerdem liefern sie Anhaltspunkte für den Umgang mit dem Forschungsobjekt Video.
Die für die Forschung bedeutsamen Erkenntnisse aus den theoretischen Überlegungen werden in einem abschließenden Kapitel kurz zusammengefasst. Anschließend erfolgen die Auseinandersetzung mit dem Forschungsobjekt Video der HDI Versicherung – Einkommensschutz und die Vorstellung der Methodik der empirischen Untersuchung. Die Forschung dient vor allem dazu, die von den Agenturen aufgestellten Behauptungen kritisch zu reflektieren.
In dieser Arbeit geht es zusammenfassend darum, die bisherigen Ansätze der Wirkungsforschung, der Bildwissenschaften und der visuellen Wissenssoziologie aufzuzeigen. Es wird der Versuch unternommen, die Übertragbarkeit in die Praxis zu überprüfen. Getätigte Vermutungen über die Wirkung von Bewegtbildern sollen empirisch aufgearbeitet werden. Darüber hinaus gilt es Ansatzpunkte für weitere Forschungen aufzuzeigen.
2 Konzeptioneller Rahmen der empirischen Erhebung
Das nachfolgende Kapitel der Arbeit soll einen konzeptionellen Rahmen schaffen, den empirischen Teil vorbereiten und die theoretische Fundierung der Forschung charakterisieren. Zunächst werden die Herausforderungen der heutigen mediatisierten Welt herausgearbeitet, dabei wird besonders auf die Visualität eingegangen. Hierzu wird die Theatralitätstheorie vorgestellt und im Anschluss daran ein Zwischenfazit gezogen, das die Notwendigkeit einer konkreten Auseinandersetzung mit dem Thema Visualität betont.
Im zweiten Schritt werden die klassischen Wirkungsmodelle in den Rahmen der Medialität und der vorher gewonnenen Erkenntnisse eingeordnet. Dies dient vor allem dazu, die Unzulänglichkeiten dieser Modelle darzustellen und die unzeitgemäßen Ansichten dieser aufzuzeigen. Hierzu werden exemplarisch das Elaboration-Likelihood-Modell und Trommsdorffs Modell vorgestellt.
Im dritten Teil sollen die Besonderheiten des Formates Bewegtbild herausgearbeitet werden. Hierbei werden zunächst die Eigenschaften des Bildes im Allgemeinen eruiert, um den Begriff der Visualität näher zu beleuchten. Erst im zweiten Schritt geht es darum, den Begriff Bewegtbild zu charakterisieren und somit die Eigenschaften des Bewegtbildes zu veranschaulichen. Zudem wird auf die notwendige visuelle Medienkompetenz des Rezipienten eingegangen. Dieser Teil leitet das folgende Kapitel visuelle Wissenssoziologie ein. Hier wird zunächst die Bedeutung dieses speziellen Forschungsansatzes im geschichtlichen Kontext analysiert. Anschließend werden konkrete Ansätze der visuellen Wissenssoziologie genauer betrachtet.
Abschließend werden die erarbeiteten Erkenntnisse vereint und die Bedeutung für die darauffolgende Forschung wird expliziert. Somit werden die Definitionen einzelner Begriffe aus der Theorie abgleitet. Dieser Abschnitt dient als kurzes Zwischenfazit und zur Vorbereitung auf den empirischen Teil dieser Arbeit.
2.1 Die neue Moderne
In diesem Kapitel wird ein Einblick in die derzeitigen Entwicklungen der Gesellschaft geschaffen. Es dient dazu, die derzeitigen Strömungen aufzugreifen und zu verstehen, in welcher „Welt“ sich die audiovisuellen Medien und die Konstrukteure von audiovisuellen Inhalten und Interpreten bewegen. Da die Vermutung naheliegt, dass die Medien immer mehr einer Bühne ähneln und dies als neuer Ansatz für ein Verständnis visueller Kommunikation dient, geht das Kapitel außerdem auf die Besonderheiten der Theatralität in modernen Medien ein.
Es ist offensichtlich, dass sich in den letzten Jahren die Medien rasant entwickelt haben. Dabei sind es nicht nur die Eigenschaften der Medien, die sich verändert haben, z. B. die verwendeten Zeichen, Signale und den ermöglichten Kontakt zu diesen,[7] sondern auch die Funktionen. So wandelt sich „die Verständigung über Inhalte (über Wahrnehmungen, Phantasien und Abstraktionen), sowie die soziale und personale Funktion“[8]. Durch die variablere und reichhaltigere Verwendung der Medien verändert sich die Welt, in der sich die Rezipienten und Medien befinden.[9] Vermutlich können Medien immer mehr zu Trägern von Kultur werden, was wiederum den Schluss zulässt, dass sie die Welt repräsentieren und präsentieren können. Spahel vermutet, dies sei mithilfe von symbolischen Sinnwelten oder auch gänzlich neuen Welten, die die Medien kreativ konstruieren, möglich.[10] Der Frage, inwiefern dies gelingen kann, widmet sich die hier vorliegende Arbeit.
Diese sich scheinbar verändernden Gegebenheiten innerhalb der Gesellschaft bedürfen einer näheren Betrachtung. Beck widmet sich zusammen mit Bonß und Lau der Theorie der reflexiven Moderne. Es geht ihnen hierbei vor allem um die Frage, inwiefern sich eine „neue Art des Kapitalismus, eine neue Art von Arbeit, eine neue Art globaler Ordnung, eine neue Art von Gesellschaft, eine neue Art von Natur, eine neue Art von Subjektivität, eine neue Art alltäglichen Zusammenlebens“[11] auf die Menschen und Institutionen auswirken.[12] Der in den letzten Jahren vollzogene „Meta-Wandel“, bei dem sich grundlegende Strukturen (Leitideen und Basisinstitutionen) verändert haben, „betrifft alle Bereiche der Gesellschaft“[13] und ist als grundlegend anzusehen.[14] Die aktuelle Lebenswelt, die durch die Globalisierung geprägt ist, ermöglicht große Freiheiten für die Menschen. Beck nennt dies Individualisierung.[15] Jedem Individuum ist es gleichermaßen freigestellt die Möglichkeiten dieser zu nutzen.[16] Die Entwicklungen bringen jedoch auch Risiken mit sich, die er als „kontrollierbare, kalkulierbare Unsicherheiten“[17] bezeichnet. Menschen sehen sich somit dem Konflikt gegenüber, die Optionen der reflexiven Moderne zu nutzen und gleichzeitig die größtmögliche Sicherheit zu erwirken.[18]
Dies führt zu der Annahme, dass auch die Bereiche der Kommunikation von diesen Konflikten betroffen sind. Um eben diese Konflikte zu verstehen, soll zunächst ein Einblick in die sich verändernde mediale Landschaft gewährt werden. Heutzutage ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es im 21. Jahrhundert einen enormen Anstieg der Bildquantität im Alltag der Menschen gibt. Bilder haben an Bedeutung gewonnen. Medientheoretiker Belting spricht von einem optischen Zeitalter, da „die Bilder die zeitgenössische Kultur in einem Maße durchdringen und beherrschen, dass man von einer visuellen oder visuell geprägten Kultur sprechen kann, die durch die Massenmedien inzwischen globalisiert worden ist“[19]. Es zeigt sich, dass bei dem derzeit ablaufenden Metaprozess der Visualisierung Bilder an kultureller Bedeutung gewinnen. Da über die modernen Medien Bilder vermittelt werden, könnte dies darauf hinweisen, dass Mediatisierung und Visualisierung untrennbar zusammenhängen. Der Mediatisierungsprozess muss bei der Betrachtung des Visualisierungsprozesses stets mit untersucht werden.[20]
Die Bedeutung der Medien und ihre möglichen Einflüsse auf die Gesellschaft sind Themen der folgenden Kapitel.
2.1.1 Visuelle Medienkultur
Um einen Einblick in die Bedeutung von Medien in der Gesellschaft zu bekommen, beschäftigt sich der folgende Abschnitt mit der Medienkultur. Dem breiten Feld der Medienkultur kann somit ein Rahmen verschafft werden. Im Folgenden wird anhand des Beispiels der Fernsehserie Tatort die visuelle Medienkultur erklärt. Dieses Beispiel eignet sich besonders gut, da es sich bei dieser Serie hinsichtlich der Wechselwirkung zwischen Kultur und Medium um ein vielfältig untersuchtes Forschungsobjekt handelt. Die Serie liefert einen guten Zugang zu der Thematik und erleichtert das Verständnis der Forschungsansätze.
Die Fernsehserie Tatort blickt auf eine über 45-jährige TV-Geschichte zurück und wird in der Forschung häufig als „populäres Gedächtnis der Gegenwartskultur“[21] bezeichnet. Es zeigt sich, dass die Serie vermutlich als Abbild der deutschen Kultur angesehen werden kann und auch die gesellschaftliche Relevanz der Reihe in der Soziologie eine bedeutende Rolle spielt.[22] Der Tatort ist laut den Forschern dazu in der Lage, die Veränderungen des Alltags, z. B. in Bezug auf Geschlechterrollen und/oder gesellschaftlichen Leitthemen, festzuhalten und zu archivieren.[23] Die Serie gilt somit als mögliches Reflexionsmedium, innerhalb dessen es der Gesellschaft möglich ist, mit sich selbst in einen Dialog zu treten. Weber bezeichnet den Tatort daher als „kommunikative Figuration“[24] Die Serie sei dazu fähig, gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen und zu reproduzieren.[25]
Wolber stellt in ihrem Vortrag „Entscheidungsprozesse in der Redaktion“ die gesellschaftsbildende Komponente der Serie heraus, mit der sich im Folgenden auch Hepp beschäftigt. Sie beschreibt die unterschiedlichen Tatort- Folgen und spricht ihnen Charakteristika zu (z. B. Konstanzer Tatort: ruhig, landschaftsbezogen).[26] Wolber nimmt an, dass diese Charakteristika von den Rezipienten übernommen werden könnten. Auch nimmt der Tatort eine bedeutende Rolle bei der Bildung einer gesamtdeutschen Identität ein. Welke erörtert, dass der Fokus auf die Differenz zwischen Ost und West im Dresdner Tatort einer Betonung der deutschen Einheit gewichen sei. Es ist anzunehmen, dass dies im Zuge der Globalisierung eine von der ARD bedachte Entscheidung war.[27]
An diesem Beispiel zeigt sich bereits deutlich, inwiefern die Medien auf die Alltagswelt Einfluss nehmen und in ihr Veränderungen hervorrufen können bzw. inwiefern die Alltagswelt auf die Medien einwirkt. Es handelt sich hierbei jedoch um beobachtete Phänomene und nicht um wissenschaftliche Erklärungen.
Mit der Frage nach dem Stellenwert der Medien bei dem Wandel von Kulturen beschäftigten sich bereits zahlreiche Wissenschaftler. Bereits 1903 untersuchte Löbl, welche Relevanz die Presse bei dem Kulturwandel der Moderne hat.[28] Das sogenannte Riepl‘sche Gesetz, das 1913 durch die Arbeiten von Riepl geprägt wurde und noch heute seine Gültigkeit besitzt, besagt, dass neue Medien niemals ein altes Medium vollständig verdrängen oder ersetzen können. Die alten Medien würden sich lediglich einem Wandel unterziehen und Eigenschaften der neuen Medien annehmen.[29] Somit würden sich bspw. Zeitschriften der Visualität der Videoplattformen bedienen und selbst Videos herstellen. Der Zusammenhang zwischen der Kultur und der Komplexität der Medien wurde von Riepl untersucht.[30] Hier wird wiederum deutlich, dass es niemals nur eine Medienform gibt, sondern, wie es auch Hepp heute sagt, es sich immer um ein komplexes Netzwerk aus Medien handelt. Diese Ansätze wären eine gute Grundlage für eine weiterführende Theorieentwicklung gewesen, jedoch folgten nur bedingt Arbeiten, die sich mit der Beziehung zwischen Medien und Kultur befasst haben. Mit der möglichen, hochkomplexen Interdependenz hat sich Hepp letztendlich tiefergehend beschäftigt. Hepp analysiert in seinem Buch „Mediatisierung von Kultur“ die bestehenden deskriptiven Ansätze zu dieser Thematik und stellt dabei zwei wesentliche Stränge fest, die hier kurz erläutert werden sollen.[31]
Mediumstheoretische Ansätze gehen davon aus, dass „mit jedem Medium eine bestimmte Normierung von Kommunikation verbunden“[32] sei. Das würde bedeuten, dass nicht nur die Kultur/Gesellschaft von der Kommunikationsform beeinflusst wäre, sondern diese auch auf die personelle Interaktion einwirkte. Poe entwarf eine erste überprüfbare Theorie zur Beziehung zwischen Medienwandel und Kulturwandel. Sie stellt die gegensätzliche Push- und Pull -Funktion von Medien heraus. Nach Poe entstehen Medien aufgrund der Bedürfnisse der Menschen. Sobald sich diese als fester Bestandteil der Medienwelt durchgesetzt haben, könnten sie jedoch Wirkungsmechanismen aufzeigen. Die Wirkung könne einen möglichen Medienwandel bestätigen.[33] Die Annahmen dieser Theorie liegen nahe, sind aber nach Hepp nicht ausreichend und komplex genug. Der reine und unbedingte Einfluss von Leitmedien auf die Gesellschaft (push) zweifelt Hepp an.[34]
Der zweite Strang beinhaltet die evolutionstheoretischen Ansätze. Einer der entscheidendsten Wissenschaftler hierzu ist Stöber. Seinen Annahmen zufolge schafft sich der Mensch kulturelle Umwelten, an die sich dann die Medien anpassen, um weiterhin bestehen zu bleiben.[35] Durch ihn wurden zwei wesentliche Begriffe geprägt: zum einen die Konvergenz und zum anderen die Institutionalisierung. Unter Konvergenz versteht er, dass bestimmte zwingende Umweltbedingungen auf die Medien wirken und diese sich entsprechend anpassen, also konvergieren. Dies geschieht automatisch und bei allen Medien in der gleichen Form.[36] Jedoch ist noch unklar, ob es eine wechselseitige Beeinflussung zwischen Medien und Umweltbedingungen gibt oder ob der Einfluss nur von einer Seite ausgeht.[37] Bei der Institutionalisierung läuft laut Stöber ein Prozess ab. Bei der Invention verbessern sich zunächst die alten Medien, um sich dann schließlich zu neuen Medien zu verändern (Emergenz). Medien passen sich also an die Umwelt an, um dann eine gänzlich neue Form anzunehmen.[38] Diese Konvergenzthese wurde in neueren Forschungen jedoch widerlegt.[39]
Aus den Überlegungen zu den verschiedenen Herangehensweisen an die Medienkultur zieht Hepp ein klares Fazit. Hepp selbst bezeichnet die Medienkultur als „die Kultur mediatisierter Welten“[40]. In Anlehnung an Luckmann versteht Hepp unter mediatisierten Welten sogenannte „spezifische kleine Lebenswelten“[41]. Diese werden durch die Informationen, die von den Medien vermittelt werden, konstruiert und finden im Alltag ihre Artikulation.[42] Diese Definition lässt darauf schließen, dass es laut dem Theoretiker durch die Veränderung der Medien auch einen Wandel in der Kultur der Gesellschaft geben kann. Das bedeutet konkret, dass die Art der Medien und auch die Kombination aus mehreren verschiedenen Medien und deren Nutzung den Alltag des Einzelnen beeinflussen. Hepp nennt dies den „Zusammenhang von medienkommunikativem und soziokulturellem Wandel“[43]. Dies würde bedeuten, dass die Kultur kaum durch ein einzelnes Medium beeinflusst würde und dass das Ineinandergreifen von verschiedenen Medien bei der Erforschung nicht außer Acht gelassen werden sollte. Beide oben genannten Ansätze sind nicht ausreichend für die Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Medien und Kultur. Hepp beschreibt daher den Begriff Mediatisierung, um die Wechselbeziehung zwischen medienkommunikativem und soziokulturellem Wandel zu erklären. Bei der Mediatisierung handelt es sich folglich „um ein spezifisches Konzept, das die Rolle von Medienkommunikation im weitergehenden soziokulturellen Wandlungsprozess reflektiert“[44].
Es ergibt sich dementsprechend die Frage, inwiefern sich dieses Wechselverhältnis im Alltag der Menschen widerspiegelt.[45] Mithilfe seiner Erkenntnis erweitert Hepp den Begriff Mediatisierung:
„[Mediatisierung ist der] Prozess sozialen und kulturellen Wandels, der dadurch zustande kommt, dass immer mehr Menschen, immer häufiger und differenzierter ihr soziales und kommunikatives Handeln auf immer mehr ausdifferenzierte Medien beziehen.“[46]
Daraus ergibt sich die Annahme, dass die Medien von den Menschen in ihren Alltag integriert werden, sodass sie nicht mehr fremd erscheinen und sich nahtlos in diesen einfügen. Ihre Alltagshandlungen wären dann von den Medien beeinflusst, da diese einen konkreten Platz in ihrem Leben haben und an Selbstverständlichkeit gewinnen (Domestizierungsansatz).[47] Krotz schließt daraus, dass Mediatisierung den kulturellen Wandel bestärke und vorantreibe, und legt ein besonderes Augenmerk auf die sich verändernde Kommunikation. Mediatisierung hat somit Einfluss auf die zwischenmenschliche Kommunikation, aber auch gleichzeitig auf „kommunikativ konstruierte Wirklichkeiten“[48], was dazu führt, dass sich auch der Alltag, die Identität und die gesamte Gesellschaft verändern können.[49] Diese Veränderungen werden durch weitere Megatrends begünstig, wie Digitalisierung und Globalisierung. Auch der Visualisierungsprozess kann als Grund für einen möglichen kulturellen Wandel angesehen werden.[50]
Wie sich in der Definition von Krotz zeigt, ist die Medienentwicklung nicht rein technisch zu betrachten, sondern vor allem als soziales Konstrukt. Dies würde bedeuten, dass nicht allein die Konstruktion von Medieninhalten Beachtung fänden, sondern dass auch die Art und Weise der Rezeption der Empfänger in den Vordergrund rückten.[51] Da Bilder die Alltagswelt dominieren und Menschen mithilfe dieser vermutlich miteinander kommunizieren können, „bedeutet [das,] dass unsere Welt, unsere gesellschaftliche Wirklichkeit durch Bilder nicht nur repräsentiert wird, sondern auch konstituiert wird“[52].[53] Resümierend betrachtet, rückt die Notwendigkeit einer Analyse der Wirkung des Bildes auf den Rezipienten in den Vordergrund.
Darüber hinaus wird sowohl den materiellen als auch den symbolischen Facetten von Kommunikation eine hohe Bedeutung beigemessen. Die oben beschriebenen mediatisierten Welten enthalten „verbindliche und intersubjektive Wissensvorräte und kulturelle Verdichtungen“[54], die vermutlich bei der Interpretation von Kommunikation als Symbol eine wesentliche Rolle spielen.[55] Ein wichtiger Punkt hierbei ist die sich ergebende Überschneidung von mediatisierten Welten. Strauss sagte bereits 1978, dass „sich soziale Welten durchkreuzen und dies unter verschiedenen Bedingungen“[56]. Nach Strauss müssen also auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Welten untersucht werden.[57] Dabei sollte die subjektive Seite nicht außer Acht gelassen werden. Menschen bewegten sich in vielen unterschiedlichen Welten mit unterschiedlichen Wissensvorräten, die nicht homogen seien und sich zum Teil auch widersprechen könnten. Dieser Aspekt ließe sich auch auf die Nutzung von Medien beziehen. Auch diese könne kontrovers und unstrukturiert sein.[58]
Hieraus ergibt sich die Annahme, dass die Gesellschaft folglich nicht nur aus einzelnen, voneinander strikt zu trennenden Welten besteht, sondern aus vielen unterschiedlichen mediatisierten Welten. Individuen bedienen sich unterschiedlicher Medien in unterschiedlichen Welten, in denen Interdependenzen herrschen. Dementsprechend gebe es eine mediatisierte Welt der Schule, der Politik usw., deren Existenzen sich überschneiden können. Somit ergebe sich ein komplexes System mediatisierter Welten.[59]
Abschließend lässt sich sagen, dass es sich bei der Mediatisierung scheinbar nicht um eine simple Ursache-Wirkungs-Beziehung handelt. Die verschiedenen mediatisierten Welten sind anscheinend vielschichtig und komplex und bedürfen einer umfassenden Analyse.
Hepp weist darauf hin, dass kein Medium separiert voneinander betrachtet werden könne. Jedoch konzentriert sich die folgende Arbeit aufgrund von Komplexitätsreduktion auf das Medium Bewegtbild.[60]
Summa summarum wird deutlich, dass die von Hepp und Krotz aufgezeigte Interdependenz zwischen Medien und Rezipienten allgegenwärtig ist. Anhand des Beispiels Tatort ließ sich zeigen, wie sich die Fernsehserie im Laufe der Jahre mit dem Wandel der Gesellschaft verändert hat. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Serie dabei sowohl an bestehenden Elementen aus der Gesellschaft als auch an Trends und z. B. an den sich verändernden politischen Verhältnissen orientiert hat. Es ist nun zu konstatieren, dass die Serie über eine abbildende Funktion verfügt und somit als Quelle ihrer Zeit angesehen werden kann. Die dargestellten Themen lassen Rückschlüsse auf die damaligen sozialen Strukturen zu. Da jedoch anzunehmen ist, dass es sich um eine Wechselwirkung zwischen Medium und Rezipienten handelt, muss auch die mögliche Wirkung des Mediums auf den Rezipienten betrachtet werden. Diesen Prozess stellt die vorliegende Arbeit in den Fokus. Das folgende Kapitel beschäftigt sich daher mit dem Begriff Theatralität als neuen Ansatzpunkt zur Erläuterung von visueller Medienwirkung.
2.1.2 Theatralität in den Medien
In diesem Kapitel wird herausgearbeitet, welche Überschneidungen Theatralität und Medien haben. Es wird hierzu die These der Theatralität vorgestellt, um diese dann im Anschluss in den Kontext mediatisierter Welten einzuordnen. Theatralität ist ein entscheidender und viel diskutierter Aspekt bei der Betrachtung des Einflusspotentials von Medien.
Zunächst wird erneut anhand des Beispiels der Fernsehreihe Tatort die Medientheatralität erläutert. Weber geht in seinem Vortrag „Die Tatort -Reihe als kommunikative Figuration. Figurenprofile der Protagonisten im Wandel der Zeit“ auf die Möglichkeit der Gesellschaft, mithilfe der Serie mit sich selbst ins Gespräch zu treten, ein. So stellen die abgebildeten Ermittler für ihn nicht realistische Figuren dar, sondern Identifikationsfiguren.[61] Bspw. spiegle sich der Trend der Individualisierung deutlich in diesen Figuren wider, so rückten die individuellen Probleme der Ermittler mehr und mehr in den Vordergrund.[62] Heinze weitet diese Erkenntnis zu einer Rollenidentifikation aus, indem er die Protagonisten als Rollenträger bezeichnet, die sich unterschiedlichen Rollenkonflikten gegenübersehen. Auch das Thema Wissenstransfer[63] spielt bei der Betrachtung des Tatorts eine wesentliche Rolle. So sei es möglich, abstraktes Wissen über brisante Sachverhalte sichtbar und kognitiv erfahrbar zu machen. Dies zeigt sich vor allem auch in der Veränderung im Umgang mit der Darstellung des Todes. So werden Leichen heutzutage wesentlich detaillierter dargestellt und naturwissenschaftliche Aspekte rücken in den Vordergrund, sodass „die medialen Erfahrungen die reale Lebenswirklichkeit flankieren“[64].[65] Laut Parr lässt sich dies auch an der Darstellung des Autos festmachen. So habe das Auto eine räumlich dramaturgische Funktion, welche die dargestellte Region hervorheben oder bestimmte Erzählstränge voneinander abgrenzen könne. Dem Zuschauer sei es möglich, anhand solcher Aspekte Situationen zu verstehen, da sie intuitiv aus dem Alltag jener übernommen wurden.[66]
Medien können demnach in der Lage sein, mithilfe von Theatralität Identifikation zu schaffen und somit in einer unbestimmten Weise Einfluss auf die Rezipienten zu nehmen. Doch zunächst soll sich im Allgemeinen mit dem vielfach diskutierten Begriff Theatralität auseinandergesetzt werden, um eine soziologisch fundierte Betrachtung gewährleisten zu können.
Die Definition des Begriffs Theatralität ist noch nicht hinreichend geklärt. Um dem Begriff dennoch eine Kontur zu geben, werden im Folgenden kurz die vier Kategorien von Fischer-Lichte in Bezug auf die ursprünglichen Funktionen und Erscheinungsformen von Theatralität erläutert. Diese bilden den Rahmen und die Grundvoraussetzungen einer Aufführungssituation und beschreiben die besondere Räumlichkeit des Theaters: Mit der Inszenierung ist die Organisation aller Elemente der Bühne gemeint, wie Dekoration oder Licht. Die Körperlichkeit/Verkörperung bezeichnet ähnlich der Kategorie „Inszenierung“ die Organisation der Personen.[67]
Die Wahrnehmung befasst sich mit der „Relation zwischen Bühne und Zuschauerraum“[68] und somit mit der Ausprägung der Grenze zwischen beiden. Sie beeinflusst maßgeblich die Perzeption und Rezeption des Dargestellten. Diese drei Begriffe werden zum Begriff Performanz zusammengefasst, was das Zusammenspiel der drei Komponenten meint. Die Performanz ist somit die einheitliche Wirkung aus Inszenierung, Körperlichkeit und Wahrnehmung.[69]
Theatralität zeigt sich hier dementsprechend als Dispositiv.[70] Dies würde bedeuten, dass die Körperlichkeit, d. h. das Schauspiel der Personen auf der Bühne, und die Inszenierungs- und Wahrnehmungsformen interferierten. Diese Interferenz sei je nach kulturellem und historischem Kontext unterschiedlich ausgeprägt. Dies lässt den Schluss zu, dass somit Unterschiede bzgl. der Wahrnehmung der Performanzen je nach Kulturkreis herrschen können.[71]
Kotte geht noch einen Schritt weiter und sagt, dass neben der eigenen Mediengeschichte des Theaters auch das Theater selbst mit seiner Theatralität ein fester Bestandteil der medienhistorischen Phasen (auch das Kulturzeitalter der elektronischen Medien) sei und diese komplementiere.[72] Es bestehe demnach ein Zusammenhang zwischen der Mediengeschichte des Theaters und den medienhistorischen Phasen. Theatralität spielt aufgrund der von Fischer-Lichte definierten Eigenschaften somit eine wichtige kulturhistorische Rolle.[73] Dies zeigt sich vor allem dann, wenn die Relation zwischen Raum und Wahrnehmung nochmals genauer betrachtet wird. Im Mittelalter waren die Grenzen zwischen Aufführungsraum und Publikum sehr verschwommen, nicht klar gezogen. Erst in der frühen Neuzeit wurde eine strikte Trennung vorgenommen und durch Elemente wie den Vorhang symbolisiert. Das Theater war somit eine Bühne, auf der Darsteller ein Stück vorführten. Folglich war das Publikum nicht mehr Teil des Schauspiels.[74]
Die hier implizierte Frontalität des Theaters wurde von Haß jedoch revidiert. Sie nennt hierzu die Praxis des „körperlosen Auges“, die bei der Konstruktion des Bühnenbildes beachtet wird und dem Betrachter ermöglicht, sich als Teil des Raumes zu sehen. Die Frontalität ist somit trotz strikter Trennung aufgehoben. Darüber hinaus stellt Haß die Vermutung auf, dass es trotz Trennung möglich sei, am Geschehen auf der Bühne teilzunehmen, sodass sich das auf der Bühne Gezeigte in die kulturelle Lebenswelt des Zuschauers einfügt und dessen Erfahrungsschatz erweitert. Das Theater könne somit bspw. zur Legitimation politischer Handlungen dienen und diese erklären.[75]
Im nächsten Schritt wird ein weiterer Ansatz zur Definition des Theatralitätsbegriffs geliefert, der die Ausführungen von Fischer-Lichte um den soziologischen Aspekt erweitert.
Goffmann prägte die Theorie der Theatralität in seinem Werk „The Presentation of Self in Everday Life“ als Begriff der Soziologie und entwickelte mikrosoziologische Ansätze und Konzepte, in denen er die Rituale und das strategische Handeln der Menschen untersuchte. Hiermit legte er den Grundstein für die Erforschung eines soziologischen Theatralitätsbegriffs.[76] Gemäß Goffmann wohnt dem Menschen ein grundlegender Zwang inne, sich selbst darzustellen und sich selbst zu inszenieren. Dies impliziert die Möglichkeit und die daraus resultierende Notwendigkeit der Theatralität. Daraus schlussfolgernd, betrachtet er diese Erkenntnis jedoch nicht nur aus anthropologischer Sicht, sondern auch auf der Ebene des Sozialsystems. Die Interaktion zwischen den Akteuren auf einer Bühne sieht er analog zum Sozialen.[77] Dies würde bedeuten, dass Schauspieler auf der Bühne gleich Akteuren in der Gesellschaft sind und diese somit Rollen spielen. Theatralität sei somit auch Realität.[78] Goffmann erläutert daraufhin weiter, dass Theatralität als Gerüst gesehen werden könne, das ermögliche, die soziale Welt und das Theater zu vergleichen, wodurch die soziale Welt erforschbar gemacht werde. Modelle wie dieses dienen als Hilfsmittel, um die Realität analytisch zu erfassen.[79]
Goffmann beschränkt sich nicht auf die einfache Aufzählung von Aspekten, die den Theatralitätsbegriff ausmachen, sondern versucht, diese in einen sinnhaften Kontext einzubetten. Die von Fischer-Lichte definierten Begriffe der Theatralität können nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen in einem „sozialen Sinnkontext“[80] studiert werden.[81] Er beschreibt Theatralität daher nicht nur als dramaturgischen Begriff, sondern auch als sinntypologischen. So geht er davon aus, dass es dem Zuschauer erst dann möglich sei, die Realität der Theatralität wahrzunehmen, wenn er den sinnhaften Zusammenhang aller Komponenten auf der Bühne verstanden habe. Der Betrachter müsse dazu imstande sein, die Performanz sinnhaft einzuordnen.[82] Goffmann nimmt an, dass Handlungen auf der Bühne mit denen der Adressaten korrelieren müssten. Somit könnten sie einen starken Ankerpunkt sowohl für den Akteur als auch für das Publikum bilden. Hierbei sei wichtig zu beachten, dass „ihre [Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskategorien] Lesbarkeit und Durchschlagskraft umso größer sind, je direkter sie auf implizite oder explizite Erwartungen antworten, die die Rezipienten prinzipiell ihrer Erziehung durch das Elternhaus und ihren sozialen Bindungen (...) verdanken“[83].[84] Für den Erfolg der Theatralität stehen laut dem Wissenschaftler die Fähigkeiten des Akteurs im Vordergrund, die Inszenierung so zu gestalten, dass die Gewohnheiten des Publikums beachtet werden. Die Einhaltung dieser Rezipientengewohnheiten sei ausschlaggebend für ein mögliches Wirken von Inszenierungen.[85]
Die Erklärungsansätze der Theatralität weisen deutlich auf ein mögliches Reflexions- und Erklärungspotenzial des Theaters hin. Die Forscher nehmen an, dass das Theater maßgeblichen Einfluss auf die Lebenswelt des Publikums nimmt. Die für diese Arbeit relevante Frage ist jedoch die nach der Übertragbarkeit auf aktuelle Formate wie den Film. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Film über ähnliche Möglichkeiten verfügt wie das Theater. An dieser Stelle müssen die folgenden Ausführungen reichen, um die Ähnlichkeit zwischen Film und Theater zu rechtfertigen. Da sich die vorliegende Arbeit insbesondere mit den Eigenschaften des Bewegtbildes beschäftigt, erfolgt eine genaue Definition in den späteren Kapiteln. Zu den Eigenschaften des Theaters gehören die oben genannten Aspekte des Schauspiels durch die Akteure und die Gestaltung der Bühne. Im Film werden diese jedoch durch die Kameraführung erweitert.[86] Diese Bühnenausschnitte, die der Zuschauer sieht, erzeugen eine extreme Grenze zwischen der Bühne und dem Zuschauerraum, da sich Zuschauer und Spiel nicht mehr in einem Raum befinden.[87] Durch die Kamera wird jedoch die Perspektive des Zuschauers beweglicher. Bazin nimmt an, dass dadurch mehr Flexibilität in der Interpretation aufseiten des Rezipienten entstehen könne als bei einem Theaterbesuch. Der Zuschauer könne, bedingt durch die bewegte Kamera, noch intensiver am Geschehen teilnehmen.[88]
Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass der hier erläuterte Begriff Theatralität ein Dispositiv aus Medien und Körpern beschreibt. Die Elemente sind nach Fischer-Lichte in einer bestimmten Weise zueinander angeordnet und übernehmen bestimmte Funktionen.[89] Die Theoretiker nehmen an, dass diese maßgeblichen Einfluss auf die kulturellen Räume des Zuschauers haben könnte. Es stellt sich nun die Frage nach der Übertragbarkeit dieser Erkenntnisse auf das Bewegtbild innerhalb mediatisierter Welten.
Die hier aufgezeigten möglichen Zusammenhänge zwischen Theatralität und Film lassen den Schluss zu, dass unter der Annahme einer mediatisierten Welt von einer Medienbühne gesprochen werden kann, die es ermöglicht, kulturelle Performanzen darzustellen. Medien befinden sich somit auf einer Bühne, die Platz lässt für Darstellung von Inhalten. An dieser Stelle soll nun auf die Eigenschaften des Gebiets der Medientheatralität eingegangen werden. Newcomb und Hirsch bezeichnen die Medienbühne als Konzept des kulturellen Forums, das sowohl beinhaltet, dass die Akteure auf die Sinn- und Wissensbestände des Publikums zurückgreifen sollten, als auch die Annahme, dass es innerhalb der Medien möglich ist, mit der Kultur zu „spielen“, und dieser somit ein Bedeutungsfreiraum zugesprochen wird.[90] Die Wissenschaftler versuchen herauszuarbeiten, inwiefern Medien eine gesonderte Rolle bei der Verwendung von Bewegtbild zuteilwird. Medien könnten somit die Wissensbestände des Rezipienten erweitern. Der werbliche Film bspw. ist jedoch eingeschränkt. Marktstrukturen und die Attraktivität des Medienprodukts limitieren das Spiel der Medien.[91]
Medienakteure können nach Newcomb und Hirsch zwar in gewisser Weise mit den kulturellen Wissensbeständen[92] flexibel umgehen, jedoch müssen sie sich immer auch als Symbolverkäufer verstehen, die Symbole in Handlungszusammenhänge einbauen und ihnen somit Bedeutungen zuweisen.[93] Newcomb und Hirsch gehen folglich davon aus, dass das Wissen, das die Verkäufer konstruieren, in essenzieller Weise von den Wissensstrukturen, Einstellungen und Ideologien des Publikums abhängt. Der oben genannte kulturelle Spielraum ermögliche es zwar, den Käufer zu überraschen, dennoch dürfe der Käufer keinesfalls aus den Augen verloren werden.[94]
Resümierend lässt sich sagen, dass einiges darauf hindeutet, dass sich Theatralität in den Medien wiederfindet. Es lassen sich zwei Ansätze finden, die voneinander abzugrenzen sind. Zum einen werden Medien als Plattform (Bühne) für die Inszenierung von Symbolen angesehen. Die Rezipienten können auf diese Symbolik zugreifen, wenn sie ihnen bekannt ist. Es handelt sich hierbei um die passive Übernahme eines Symbolsystems aus der Gesellschaft. Das Verstehen der Symbolik auf der Bühne und das Erkennen ihrer Sinnhaftigkeit sind nur innerhalb dieses Systems möglich (vgl. vertiefend Kapitel 2.1.2) Auch die Annahmen von Goffmann werden als systemtheoretischer Ansatz angesehen. Die Theatralität des Einzelnen kann nur von seinem Gegenüber verstanden werden, wenn ihm die verwendete Symbolik bekannt ist.
Zum anderen zeigt sich ein Identifikationsansatz. Vor allem die neuen Ausführungen zum Thema Tatort zeigen die Annahme, dass sich die Rezipienten mit den auf der Medienbühne befindlichen Darstellern identifizieren können, indem sie sich in den Rollen wiederfinden. Außerdem gehen diese neueren Ansätze davon aus, dass zumindest fachliches Wissen in unbestimmter Weise übertragen werden kann.
2.1.3 Einordnung
In einer sehr stark visualisierten Welt, in der die Quantität der Bilder enorm zunimmt, wird der Suche nach Antworten auf die Frage nach Wirkungsprozessen und Mechanismen von Bewegtbildern immer größere Bedeutung beigemessen. Die Mediatisierungstheorie gibt erste Hinweise auf eine mögliche Interdependenz zwischen Medien und ihren Rezipienten. Die Theatralitätstheorie weitet diese Annahme aus und ergänzt sie um die Symbolik. Die Medienbühne verbindet letztendlich beide Annahmen, indem sie davon ausgeht, dass auf ihr Performanzen in einem medialen Rahmen eingebettet stattfinden können. Dabei greifen die konstruierenden Akteure die Wissensbestände des Publikums auf. Die Zuschauer sollen dann die Konstruktionen der Symbolverkäufer annehmen und in ihrem spezifischen Wissensbestand einbauen.
Aufgrund dieser Erkenntnisse ergeben sich weitere Fragen. Diese beziehen sich auf die Klärung von Interpretationsprozessen hinsichtlich der erzeugten Bilder auf dieser Bühne. Auch die kommunikative Bedeutung von Bildern, also inwiefern überhaupt Kommunikation mithilfe von Symbolen stattfinden kann, muss untersucht werden. Außerdem gilt es im Verlauf der Arbeit zu klären, welche Rolle die spezifischen Wissensbestände des Rezipienten spielen und wie sich diese auf den möglichen Interpretationsprozess auswirken.
Die Wissenschaft hat zu dieser Vielzahl an Fragen in der Vergangenheit mehrere Ansätze entwickelt. Zu den bekanntesten Ansätzen zählen das Stimulus-Response-Modell und das Stimulus-Organism-Response-Modell. Diese beiden werden im folgenden Kapitel näher erläutert.
2.2 Klassische Wirkungsmodelle
Unter klassischen Wirkungsmodellen werden in dieser Arbeit alle Modelle verstanden, die von einem passiven Konsumenten ausgehen. Die zu untersuchenden Modelle nehmen an, dass eine Persuasion seitens des Unternehmens möglich und systematisch erfassbar ist. Die Modelle versuchen, die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Konsumenten aufgrund variierender psychischer Zustände dieser zu erläutern. In diesem Kapitel wird beispielhaft für die Stimulus-Organismus-Response-Modelle (SOR-Modelle) das Konsumentenverhalten nach Trommsdorff und Petty/Cacioppo erklärt. SOR-Modelle gehen davon aus, dass es möglich ist, Rezipienten zu konditionieren, wodurch Verhaltensweisen erlernt werden können. Der Mensch (Organismus) ist im Gegensatz zu den Annahmen der Stimulus-Response-Modelle keine Blackbox mehr, sondern gilt als intervenierende Variable, die in einer unbestimmten Weise in den Prozess eingreift.[95] Die erläuterten Modelle dienen im Marketing dazu, das Verhalten der Rezipienten zum einen zu erklären und zum anderen auch vorhersagbar zu machen.[96]
In den nachstehenden Kapiteln werden die Modelle kurz dargestellt, um sie anschließend kritisch in die Mediatisierungsforschung einzuordnen. Aufgabe ist es, die Frage nach der Gültigkeit und Relevanz solcher Modelle für die Bewegtbildwerbung zu klären. Unter den Bedingungen der Mediatisierung ist anzunehmen, dass neue Theorien mit aktiven und bedeutungsgenerierenden Rezipienten notwendig sind. Dieser Problematik widmet sich Kapitel 2.1.1 widmen.
2.2.1 Elaboration Likelihood Modell nach Petty/Cacioppo
Das Elaboration-Likelihood-Modell wurde 1986 von den Psychologen Petty und Cacioppo entwickelt. Das Modell erklärt die Prozesse der persuasiven Kommunikation und erläutert deren Effektivität in Bezug auf die Überzeugungskraft der Information. Den Psychologen ist es besonders wichtig, mithilfe dieses Modells eine allgemeingültige Theorie abzubilden, die den Ablauf der Einstellungsveränderungen beim Empfänger nach dem Erhalt einer Information erläutert.[97] Petty und Cacioppo verstehen unter Einstellungen die Beurteilungen anderer Menschen, Objekte und Themen durch den Rezipienten. Diese Bewertungen entstehen aus unterschiedlichen Erfahrungswerten, bspw. bezüglich eines bestimmten Verhaltens oder einer besonderen kognitiven Erfahrung einer Person, und sind in der Lage, das Verhalten und die ablaufenden Prozesse zu beeinflussen.[98] Petty und Cacioppo gehen von zwei Arten (Routen) der Informationsverarbeitung aus, die sich antagonistisch zueinander verhalten. Je nachdem wie hoch die kognitiven Fähigkeiten, das Interesse an der Information und die Motivation einer Person sind, wird die Information auf der zentralen oder der peripheren Route verarbeitet.[99] Werden die hier genannten Aspekte als besonders hoch eingestuft, bspw. ist das Interesse der Empfänger an den Informationen dementsprechend ausgeprägt, dann werden diese auf der zentralen Route verwertet. Der Überzeugungsprozess ist auf dieser Route mit einer kritischen Auseinandersetzung aufseiten des Rezipienten verbunden. Dieser betrachtet vornehmlich die Fakten der Information und setzt sich lediglich mit den für ihn relevanten Faktoren auseinander.[100]
Die gegensätzliche Route ist die periphere Route. Die Ausgangssituation des Rezipienten ist geprägt durch eine niedrige Motivation und ein geringes Interesse an der Information. Laut Petty und Cacioppo beruft sich der Adressat bei der Bewertung und Einordnung der Information auf einige wenige heuristische Entscheidungsregeln. Diese beziehen sich bspw. auf das Charisma des Informationssenders, die Komplexität der Information selbst. Die Qualität der faktischen Argumente ist nur nebensächlich.[101]
Es ist anzumerken, dass die beiden von Petty und Cacioppo entworfenen Routen idealisierte Extreme der Informationsverarbeitung darstellen.[102] In der Realität wäre es durchaus möglich, dass bspw. eine Variation in der Stärke der Argumentation den Grad der Einstellungsänderung auch auf der peripheren Route beeinflussen könnte. Dies bedeutet, dass Beeinflussungsgrößen der zentralen Route durchaus in der Lage wären, auf die Persuasion auf der peripheren Route einzuwirken.[103] „This tradeoff creates the possibility that, at intermediate levels of elaboration, both central and peripheral route might operate.“[104]
Resümierend ermöglicht das Elaboration-Likelihood-Modell, zwei grundlegende Annahmen bezüglich des kommunikativen Persuasionsprozesses zu treffen. Zum einen konnten Unterschiede in Bezug auf die Einstellungsintensität des Rezipienten festgestellt werden. Die Ausprägungen der Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema variieren, sodass der Erfolg der angestrebten Persuasion unterschiedlich groß ausfällt.[105] Zum anderen ist es möglich, dass die einflusshabenden Faktoren (Charisma des Senders, Stärke der Argumente usw.) wechselhafte Rollen bei der Persuasion spielen. So könnten diese sowohl den Grad und die Wertigkeit der Einstellungsintensität verändern als auch als periphere wie zentrale interferierende Variable fungieren. Die Variablen könnten je nach Situation ihre Effektivität verändern. Folglich kann das Elaboration-Likelihood-Modell für das Verständnis persuasiver Kommunikation eine Rolle spielen und die möglichen ablaufenden Prozesse plakativ darstellen.[106]
Wie die Modelle in den hier vorliegenden Kontext der Mediatisierung eingeordnet werden können, zeigt Kapitel 2.1.3.
2.2.2 Konsumentenverhalten nach Trommsdorff
Trommsdorff geht in seinem Modell davon aus, dass kommunikative Prozesse auf unterschiedliche Zustände beim Rezipienten treffen könnten. Diese Zustände bezeichnet er als „verhaltenswissenschaftliche Konstrukte (psychischer und sozialer Art), welche die Theorie als statische Erklärungsgrößen interessieren“[107]. Trommsdorff versucht somit, eine Begründung für den Kauf eines Produktes zu geben.[108] Im Gegensatz zu den Zuständen handelt es sich bei den Prozessen um dynamische Erklärungsgrößen, die untersucht werden sollen. Ziel ist es folglich, bspw. die ablaufenden Prozesse innerhalb eines Verkaufsgesprächs zu verstehen und somit z. B. die sich verändernde Aufmerksamkeit des Rezipienten zu erfassen. Diese Unterscheidung (Zustände/Prozesse) soll aufzeigen, dass die Anpassung des Unternehmens an die Zustände des Konsumenten passiv und der Beeinflussungsprozess bedingt durch seine dynamische Veränderlichkeit aktiv ist.[109]
Im Folgenden werden die verschiedenen Zustände und Prozesse kurz erläutert. Für diese Arbeit ist es relevant, die Aussagen Trommsdorffs bzgl. der Einflussnahme von Wissen herauszuarbeiten, daher wird auf diesen Teil des Modells ein besonderer Fokus gelegt.
Trommsdorff definiert sechs Konstrukte (Zustände) des Modells, die nach ihrer „zunehmende[n] Komplexität und kognitive[n] Anreicherung“[110] angeordnet sind: Involvement, Gefühl, Motiv, Einstellung, Wert und Lebensstil. Das Involvement ist die innere Bereitschaft des Rezipienten, sich mit einer Information auseinanderzusetzen. Sie ist bedingt durch unterschiedliche äußere (z. B. Tageszeit) und innere (z. B. Nachdenken) Aspekte.[111] Eine Voraussetzung für Trommsdorffs Modell stellt die Einstellung als Zustand dar. Dies bedeutet, dass die Einstellungsänderung im Rahmen des gesamten Informationsverarbeitungsprozesses geschieht. Das Gefühl oder auch die Emotion ist ein besonderer Zustand der inneren Erregung und wird genau wie das Involvement durch verschiedene innere und/oder äußere Reize beeinflusst. Dieses Konstrukt ist besonders bedeutend für das Verhalten der Rezipienten, da die Auswirkung auf die Kaufentscheidung enorm ist. Ein weiterer Zustand beschreibt das Motiv oder auch das Bedürfnis. Trommsdorff unterscheidet zwei Arten der Bedürfnisse: Werden Entscheidungen durch ein spontanes Gefühl ausgelöst, handelt es sich um Affekte, basieren die Entscheidungen jedoch auf kognitivem Wissen, spricht er von Zielen. Die Einstellung eines Rezipienten wird in diesem Modell als „die Bereitschaft, sich in einer bestimmten Situation einem bestimmten Gegenstand (auch einer Idee) gegenüber annehmend oder ablehnend zu verhalten“[112] verstanden. Eine größere Anzahl an Einstellungen zu unterschiedlichen Themen, die kulturell beeinflusst sind, werden in diesem Modell als Werte bezeichnet.[113] Diese verfügen über eine sehr hohe normative Verbindlichkeit und sind daher nur schwer veränderbar. Die bis jetzt vorgestellten Konstrukte lassen sich unter dem Begriff Lebensstil zusammenfassen. Es handelt sich um den „ganzheitlich-komplexe[n] Zustand charakteristischer Gefühls-, Wissens-, Motiv-, Einstellungs-, Werte-, Verhaltensmuster und (...) der psychischen Eigenschaften einer Person“[114].[115]
Die hier beschriebenen Konstrukte werden durch Wissen beeinflusst. Hier ist anzumerken, dass es sich bei der Definition von Wissen im Sinne Trommsdorffs lediglich um verbalisierbares Wissen handelt. Das Wissen hat die Funktion, die Konstrukte anzureichern und sie in ihrer Komplexität zu verändern. Bei Wissen handelt es sich um eine abgespeicherte Information, die das Kaufverhalten beeinflusst, da sie bspw. mit einer neuen Information verglichen und somit in Relation gesetzt werden kann.[116] Dieses Konstrukt beinhaltet sowohl abgespeicherte Informationen als auch in der Situation wahrgenommene Eindrücke. Das heißt, das Wissen deckt eine Vielzahl an Inhalten ab (z. B. Bewertungen, Schemata, Düfte, Klänge). Das Konstrukt Wissen ist somit Teil aller anderen bisher beschriebenen Konstrukte, da es diese anreichert. Selbst das Involvement ist durch Wissen beeinflusst, und somit wird auch das Gefühl zu einer Art Wissen. Trommsdorff differenziert außerdem zwischen Wissen von Information und Daten/Fakten. Wissen sind für ihn bereits verarbeitete Daten.[117]
Trommsdorff definiert für die hier beschriebene Funktion von Wissen zwei Prozesse. Zum einen nennt er den Informationserwerb.[118] Bei diesem Prozess werden Informationen aufgenommen und gespeichert. Die Aufnahme erfolgt hierbei durch einen gesendeten Reiz, der auf einen oder mehrere Sinne des Rezipienten trifft. Dieser Reiz wird dann in die weiter oben beschriebenen Zustände transformiert, die kurzfristiger oder langfristiger Natur sein können. Bei der Speicherung werden die Informationen gelernt und können später wieder abgerufen werden (Wissen). Zum anderen erläutert Trommsdorff den Prozess der Informationsverarbeitung. Dieser Prozess wird als Verknüpfungsprozess angesehen. Die vorhandenen Informationen dienen der Assoziation, dem Vergleich, der Bewertung und Entscheidung.[119]
Abschließend lässt sich sagen, dass Trommsdorff mit seinem Modell versucht hat, allgemeingültige Aussagen über das Konsumentenverhalten zu tätigen. Sein Modell dient dazu, Marketingmaßnahmen in ihrer ökonomischen Wirkung besser einschätzen und abwägen zu können. Die Kaufwahrscheinlichkeit spielt hierbei eine essenzielle Rolle. Trommsdorff geht hierbei davon aus, dass sich diese berechnen lasse – der Organismus somit auf einen Reiz mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in einer bestimmten Weise reagiere.[120]
2.2.3 Kritische Betrachtung
In den vorangegangenen beiden Kapiteln wurden exemplarisch zwei Wirkungsmodelle vorgestellt, die in die Kategorie der SOR-Modelle einzuordnen sind. Beide Modelle gehen von dem Aspekt aus, es gäbe kein interpretierendes Bewusstsein, das Verhalten des Rezipienten würde stattdessen lediglich unbewusst ausgelöst werden. Dies impliziert, dass es für jedes Verhalten einen bestimmten Auslöser gäbe und dementsprechend klar definierte Ursache-Wirkungszusammenhänge bestünden. Vor dem Hintergrund der bereits erläuterten Theorien zur Mediatisierung und Theatralisierung lässt sich sagen, dass die Aushandlung von Bedeutungen seitens der Rezipienten wenig bzw. gar nicht berücksichtigt wird. So wird bspw. die Bedeutung von Markenprodukten in unterschiedlichen Kaufsituationen nur bedingt erläutert, und auch die Entwicklung von besonders populären Marken, die ihre Kunden dauerhaft an sich binden, ohne einen nennenswerten Mehrwert zu haben, findet kaum Erklärung. Auch zufällige Kaufentscheidungen können mit den vorliegenden Theorien kaum begründet werden.
Des Weiteren spielt vor allem beim Elaboration-Likelihood-Modell die Relevanz des Themas für den Rezipienten nur eine geringe Rolle. Trommsdorff widmet sich zwar ausgiebig den Eigenschaften der intervenierenden Variable (Rezipient), jedoch ist bspw. das Wissen bei ihm sehr explizit ausgelegt. Dies würde bedeuten, dass mögliche spezifische Interpretationsprozesse aufgrund individueller Wissensvorräte weitestgehend außer Acht gelassen werden. Es kann indes vermutet werden, dass sich Trommsdorff in seinem Modell ungekennzeichnet mit eben solchen Wissensvorräten beschäftigt hat, da auch Gefühls-, Motiv-, Einstellungs-, Werte- und Verhaltensmuster möglicherweise zum Wissen gezählt werden können (vgl. vertiefend Kapitel).
Auf Basis der Mediatisierungsforschung, in welcher der Rezipient aktiv die Bedeutung von Inhalten in den Medien mitbestimmt, kann die Gültigkeit und Verwendbarkeit in der Praxis der oben erläuterten Modelle infrage gestellt werden. Die Theorie, dass der Mensch passiver Rezipient von Reizen ist, auf die er in kalkulierbarer Weise reagiert, ist mit den Erkenntnissen der Mediatisierungsforschung und der Theorie der Theatralisierung kaum zu vereinbaren. Es bestätigt sich somit die anfängliche Vermutung, dass für ein komplexes Verständnis von visuellen Wirkungsmechanismen neue Theorien mit aktiven und bedeutungsgenerierenden Rezipienten vonnöten sind. Das nachfolgende Kapitel wird daher im Rahmen der Bildwissenschaften einen Hinweis auf mögliche ablaufende Interpretationsprozesse bei der Rezeption von visuellen Inhalten geben
2.3 Die Bedeutung und Relevanz der Visualität im Rahmen der Unternehmenskommunikation
Im folgenden Kapitel wird ein Einblick in die Geschichte und kulturelle Einbettung der Visualität gegeben. Hierzu wird zunächst geklärt, was eigentlich ein Bild ist und welche Besonderheiten es vorweisen kann. Im darauffolgenden Schritt wird auf die Bedeutungsgenerierung bei der Rezeption von visuellen Inhalten eingegangen. Visuelle Inhalte werden unter Rückgriff auf bildwissenschaftliche Elemente, wie die Ikonizität und Semiotik, untersucht. Aufbauend darauf werden die Besonderheiten des Bewegtbildes herausgearbeitet, die essenziell für die vorliegende Arbeit sind. Im Anschluss wird der Werbefilm historisch eingeordnet, um die Bedeutung des Films für Unternehmen über die Jahre darzustellen. Letztendlich wird der Fokus auf die Anforderungen an die Rezipienten von visuellen Inhalten gelenkt. Dies dient vor allem dazu, die Komplexität einer möglichen visuellen Kommunikation zu verstehen, um dann im Anschluss die visuelle Wissenssoziologie in ihrer Relevanz besser einordnen zu können.
2.3.1 Was ist ein Bild?
In diesem Kapitel wird eine kurze Definition des Bildes geliefert, die grundlegend für die vorliegende Arbeit ist. Zuerst wird jedoch kurz die Geschichte des Bildes (Pictoral Turn) erläutert, um die empirische Bedeutung dessen herauszuarbeiten.
Der Kunsthistoriker Mitchell erläuterte 1992 mit seinem Beitrag zum Pictoral Turn die Wende hin zum Bild und weg von einer linguistisch geprägten Wissenschaft. Auch Boehm zählt mit seinen Ausführungen zum Iconic Turn zu den Leitfiguren dieses Umbruchs. Im Aufbau ihrer Ausführungen orientieren sich beide am Linguistic Turn.[121] Dieser wurde im Jahr 1967 durch Rorty bekannt und beschreibt eine allgemeine Hinwendung zum Gebrauch der Sprache. Wissenschaftler forderten eine genauere Untersuchung der sprachlichen Verwendungsformen und stellten die Objektivität der Sprache infrage. Es kam zu der Annahme, dass Wissen und Erkenntnis in der Sprache ihren Ausdruck finden und durch diese strukturiert würden.[122]
In den 1960er-Jahren erreichte der Linguistic Turn auch die Soziologie. Aus dieser Entwicklung heraus entstand die Sprachsoziologie. Mit ihr wurde in der Wissenschaft verstärkt der Fokus auf die Sprache gelegt, „deren Erforschung alleine es ermöglichen sollte, die Probleme der Erkenntnis, des Handelns und damit auch der gesellschaftlichen Ordnung zu analysieren“[123]. Die Bedeutung der Sprache trat in den Vordergrund.[124] Zu den wichtigsten Sprachwissenschaftlern gehört Luckmann. In seinem Werk „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ erarbeitete er zusammen mit Berger die Rolle der Sprache im Alltag. Ihre Theorie beschäftigt sich daher mit dem Gebrauch der Sprache.[125] Nach der Auffassung der Wissenschaftler eignet sich Sprache am besten, um Wirklichkeit zu erschaffen und gleichzeitig abzubilden. Sprache sei dazu fähig, Wissen über die Wirklichkeit zu reflektieren. Gleichzeitig könne mithilfe der Sprache die Wirklichkeit gedeutet werden, wodurch sie wirklich werde. Da Sprache somit als Symbol fungiert, kann sie als eigene wichtige Institution angesehen werden. Sprache ist nach der Auffassung von Berger und Luckmann also eine Instanz, die zwischen Individuum und der Gesellschaft zu vermitteln vermag. Diese Instanz ist erforschbar (vgl. vertiefend Kapitel 2.4.2).[126] Daher liefern die Ausführungen von Berger und Luckmann eine Grundlage zur empirischen Erforschung der Sprache. Dies stellt die Aufgabe der Sprachwissenschaften dar.[127]
Wie oben bereits erwähnt, rückte im Laufe der Zeit das Bild als Forschungsgegenstand in den Blick der Wissenschaftler.[128] Die Macht der Sprache als einzige Kommunikationsform wurde angezweifelt. Brandt formulierte dies wie folgt: „Der iconic turn will [...] in der alten Gigantomachie das Obere zuunterst stürzen und die Herrschaft des logos durch die der Bilder ersetzen.“[129] Diese sehr drastische Aussage relativiert Brandt später selbst, indem er verdeutlichte, dass die Sprache niemals durch Bilder gänzlich zu ersetzen sei. Doch aufgrund der bis dahin getätigten Annahmen bzgl. der Macht der Bilder blieb der empirische Blick auf das Bild. Dies hängt vermutlich auch mit dem enormen Anstieg der Bildquantität zusammen, wie in dem vorherigen Kapitel zur Medienkultur erläutert.[130]
Zum Pictoral Turn, zur Visualisierung und zum Bild gibt es einige kommunikationswissenschaftliche Ansätze, die im Folgenden vorgestellt werden.
Simmel bspw. schreibt dem Auge die Möglichkeit der Interaktion zu.[131] Für ihn ist der Blick einer Person eine Selbstoffenbarung, denn in ihrem Blick gibt sie Dinge von sich preis, welche die andere Person wahrnimmt. Mithilfe des Sehens ist es außerdem möglich, Dinge gleichzeitig und in vielfältiger Form wahrzunehmen. Beim Hören werden die Dinge lediglich nacheinander erfasst. Das Besondere stellt für ihn das Zusammenspiel beider dar, denn er erkennt hier eine Wechselwirkung der Sinne.[132]
Auch Mead stellt die Bedeutung von Visualität im Rahmen von Kommunikation in seinen Ausarbeitungen heraus. Sein Kommunikationskonzept baut auf der Annahme auf, dass „das Auge dem Handelnden eine Reihe visueller, unzusammenhängender Eindrücke [biete], die jedoch durch die dauerhafte Kontakterfahrung der Hand zusammengeführt werden können“[133]. Visuelle Wahrnehmung ist daher so lange wirkungslos, bis sie in der Situation erlebt wird. Er betont dabei, dass der Akt des Wahrnehmens nicht passiv, sondern aktiv geschehe. Das Sehen ist für ihn lediglich Teil einer Handlung. Das Wahrnehmen geschieht innerhalb einer spezifischen Situation, in der sich Sehen und Gesendetes verbinden.[134] Visualität liegt für die hier vorgestellten Autoren im Sehen seines Gegenübers und ist dementsprechend Teil von Kommunikation.
Die Wissenschaft erkannte folglich die Bedeutung der Bilder für die Kommunikation sehr früh. Aus diesem Grund erfolgte eine Hinwendung zur Untersuchung einer möglichen Bildsprache. Zunächst wurde jedoch eine differenzierte Definition des Begriffs Bild benötigt. Hierzu liefert Mitchell hilfreiche Ansatzpunkte. Als Grundlage für eine Forschung stellte Mitchell fünf Kategorien von Bildern fest: grafische, optische, perzeptuelle, geistige und sprachliche Bilder.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: The Idea of Imagery – „Familienstammbaum“ der Bilder (Quelle: Mitchell [1990], S. 20)
Für Mitchell tragen viele Objekte zwar den Namen „Bild“, dies bedeutet jedoch nicht, dass sie auch ähnliche oder gleiche Eigenschaften besitzen müssen.[135] Er versucht, dieses Phänomen mithilfe des Familienstammbaumes der Bilder darzustellen, und betont somit die unterschiedlichen Entwicklungen der einzelnen Bildfacetten. Jeder Zweig repräsentiert eine andere Forschungsdisziplin. So sind bspw. die Mental Images (geistige Bilder) Forschungsgegenstand der Psychologie, und die Graphic Images (grafische Bilder) lassen sich in den Bereich der Kunstgeschichte einordnen.[136] Der Bildbegriff zeigt sich als sehr ausdifferenziert und komplex. Daher schlägt Mitchell vor, dass sich jede Disziplin ausschließlich mit ihrem Bildbegriff befasse und ein übergeordneter Bildbegriff für alle Forschungsbereiche sinnlos sei.[137] Für die Kommunikationswissenschaft muss nun geklärt werden, welcher Begriff der passende und geeignete ist. Sachs-Hombach liefert hierzu einen entscheidenden Hinweis. Für ihn sind Bilder „artifiziell hergestellte oder bearbeitete, flächige und relativ dauerhafte Gegenstände [...], die in der Regel innerhalb eines kommunikativen Aktes zur Veranschaulichung realer oder auch fiktiver Sachverhalte dienen“[138]. Diese Definition impliziert den Ausschluss flüchtiger und nicht artifizieller Bildphänomene. Seine Definition eignet sich für die Kommunikations- und Medienwissenschaft, da sich diese hauptsächlich mit der Verbreitung von Inhalten mithilfe technischer Medien befasst.[139] Das Bild wird hier nun als Informationsträger angesehen.[140] Für die Erforschung der kommunikativen Fähigkeiten des Bildes sind folglich nur Bilder geeignet, die reproduzierbar bzw. materieller Gestalt sind.[141]
Zurückblickend auf Mitchells Bildfamilie können die grafischen Bilder als Forschungsobjekt der Kommunikationswissenschaft angesehen werden. Jedoch ist unter dem Gesichtspunkt der Theatralität und der visuellen Medienkultur anzunehmen, dass das Forschungsobjekt der Kommunikationswissenschaften grafischer Natur ist, jedoch die geistigen (mental) und sprachlichen (verbal) Bilder aufseiten der Rezipienten ebenso eine Rolle in der Kommunikation spielen.
Um diesen möglichen Einfluss genauer zu untersuchen, widmet sich das folgende Kapitel den in kommunikativen Prozessen vorkommenden Bildern.
2.3.2 Bedeutungsgenerierung in der visuellen Kommunikation
Im Folgenden wird der Ansatz der Semiotik näher erläutert, der die Funktionsweise von Bildern innerhalb des Kommunikationsprozesses darstellt. Hierzu wird außerdem auf die sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen des Prozesses eingegangen.
Unter dem Begriff Semiotik wird „die Wissenschaft von den Zeichenprozessen in Kultur und Natur“[142] verstanden. Zeichen können dabei Bilder, Wörter und/oder Gesten sein oder auch eine Kombination aus diesen.[143] Die sogenannten Zeichenprozesse beinhalten die Konstituierung, Produktion, Verbreitung und Rezeption von Zeichen. Diese Prozesse werden auch als Semiose bezeichnet und ohne sie wären Kommunikation, Kognition und kulturelle Bedeutung kaum möglich. Das Bild wird folglich als Zeichen verstanden, das über visuelle Codes verfügt.[144] Die hier vorliegende Arbeit nutzt einen semiotischen Zeichenbegriff, da er den bildwissenschaftlichen Aspekt und die Kommunikationswissenschaften miteinander verbindet. Aus diesem Grund eignet er sich zudem dazu, mögliche Parallelen und Unterschiede zur sprachlichen Kommunikation herauszuarbeiten.[145]
Bildliche Zeichen, so Michel, zeichnen sich im Allgemeinen durch zwei Charakteristika aus. Zum einen sei der Interpretationsspielraum bspw. einer Fotografie durch die Konkretheit des eingefangenen Wirklichkeitsausschnittes beschränkt, zum anderen lasse sie jedoch einen großen Freiraum zu, der vielschichtige Deutungsmöglichkeiten offeriert.[146] Dies würde bedeuten, dass der hier genannte Ausschnitt der Wirklichkeit zwar ein vollständiges Abbild dieser darstellte, jedoch sollte dabei immer auch die Zeichenhaftigkeit des Bildes beachtet werden. Folglich nimmt Michel an, dass das Bild ein Zeichen sei, das nicht identisch mit der Wirklichkeit sei, sondern lediglich auf diese deute.[147] Dieser bildliche Verweis auf einen Wirklichkeitsausschnitt ist wiederum vielschichtig interpretierbar. Der Ausdruck und der Inhalt könnten somit getrennt betrachtet werden.[148] Peirce geht in seinen Ausführungen jedoch noch einen Schritt weiter und benennt den Interpretanten als Verbindung zwischen dem Ausdruck und dem Inhalt. Der Interpretant sei dazu in der Lage, einen dynamischen Prozess der Interpretation anzustoßen. Dies bedeutet, dass er den Interpretationsprozess unterstützt und dem Bild einen Interpretationsrahmen verleiht (bspw. beschreibender Text unter einem Bild).[149]
Somit ergibt sich die Annahme, dass ikonische Zeichen je nach Kontext unterschiedlich ausgelegt werden und sich durch eben diese Ikonizität deutlich von schriftlichen Ausführungen unterscheiden können.[150] Laut Barthes vermittelt die Ähnlichkeit von Zeichen zu dem, was sie darstellen, den Eindruck, dass Informationen direkt und unmittelbar erhalten werden können. Diese Illusion geschehe dann, wenn Bilder nicht als künstlich wahrgenommen werden und schlicht als Ausschnitt aus der Wirklichkeit betrachtet würden. Hier würden somit eigentlich vorhandene Codes missachtet.[151]
Halawa fordert in seinem Buch „Wie sind Bilder möglich?“ eine einheitliche Bewertung ikonischer, indexalischer und symbolischer Zeichen. Passfotos bspw. haben eine ikonische Funktion, da sie die Identität einer Person abbilden sollen. Fotografien aus Gefängnissen sind Ikone, da sie auf etwas hinweisen, und das Abbild eines Totenschädels steht in der Kunst für den Tod (Symbol).[152] Diese Annahme unterstreicht die kommunikative Funktion der Bilder und macht deutlich, dass Zeichen kommunikative Elemente sein können. Gemäß Halawa verfügt jede Bildart über symbolische, somit über kommunikative Fähigkeiten.[153]
Sobald von Kommunikation gesprochen wird, rücken soziale Prozesse in den Vordergrund. Hierzu nimmt Halawa an, dass Zeichen nie universell und transparent seien, sondern immer einer spezifischen kulturellen Umgebung unterlägen. Zeichen würden somit immer auch von spezifischen Kulturen beeinflusst.[154] Insofern ist davon auszugehen, dass bei der Bedeutungsgenerierung mehrere sogenannte Sinnstrukturen beteiligt sind.[155] Hall hat zur Darstellung von Massenkommunikationsprozessen ein Modell entwickelt, das sich auch zur Besprechung der visuellen Bedeutungsproduktion, -vermittlung und -rezeption eignet.[156] Außerdem kristallisiert sich in seinem Modell die von Halawa beschriebenen, unterschiedlichen Umgebungen heraus. Der Ort der Rezeption und der Ort der Produktion werden in diesem Modell separiert voneinander betrachtet. Da innerhalb dieser Arbeit der Interpretationsprozess von visuellen Inhalten aufseiten des Rezipienten untersucht werden soll, erscheint dieser Ansatz als wichtig und wird daher kurz erläutert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Halls Encoding/ Decoding Modell (Quelle: Krotz [2009], S. 216)
Unter Encoding versteht Hall die Übersetzung von spezifischen Sinnstrukturen in multimodale Zeichenformen. Dieser Prozess werde durch die Produktionskultur (Wissensrahmen, Produktionsverhältnisse, technische Infrastruktur) beeinflusst.[157] Die Kulturen, also die Bedingungen der Produktion, unterscheiden sich je nach Tätigkeitsfeld stark in ihren Werten, Vorstellungen und Leitideen. So sei bspw. die Werbung im Gegensatz zum Journalismus eher darum bemüht, künstliche Bilder zu erschaffen. Dies nennt Hall Programm als „sinnhafter Diskurs“.[158]
Die im Encoding entstandenen Codes können nun von den Rezipienten decodiert werden. Dieser Vorgang kann auf drei unterschiedlichen Wegen ablaufen.[159] Die erste und im Sinne der Werbung vorteilhafteste Art der Decodierung ist die dominant hegemoniale Lesart. Hier erfolgt eine vollständige und transparente Entschlüsselung der konnotierten Bedeutungen. Des Weiteren nennt Hall die ausgehandelte Lesart, die sich vor allem mit dem Aushandeln von Bedeutungen beschäftigt. Rezipienten können den Codes entweder zustimmend oder ablehnend gegenüberstehen und die Haltung je nach eigener Situation anpassen. Bei der oppositionellen Lesart versteht der Rezipient zwar die Aussage / den Code, er legt sie/ihn jedoch gegensätzlich aus.[160]
[...]
[1] Diese Fragestellung gilt als wegweisend für die wissenssoziologische Hermeneutik. Es gilt Phänomene zu beobachten und eine passende Fragestellung zu finden (vgl. Reichertz/Englert [2010], S. 10.). Die Frage nach der Frage steht somit im Mittelpunkt dieser Einleitung (vgl. Marquard [1982], o. S.).
[2] Vgl. Schnettler [2007], S. 190.
[3] Vgl. BVDW [2017], o. S.
[4] Vgl. Statista [2017], o. S.
[5] Vgl. InteractiveMedia [2017], o. S.
[6] Vgl. TWT [2017], o. S.
[7] Vgl. Boeckmann [1994], S.34.
[8] Spanhel [2010], S. 50.
[9] Vgl. Spanhel [2010], S. 50.
[10] Vgl. Spanhel [2003], S. 91 ff.
[11] Beck/Bonß/Lau [2001], S. 13.
[12] Vgl. Beck/Bonß/Lau [2001], S. 13 f.
[13] Beck/Bonß/Lau [2001], S. 13.
[14] Vgl. Beck/Bonß/Lau [2001], S. 13 ff.
[15] Vgl. Beck [2008], S. 303.
[16] Beck [2008], S. 303.
[17] Beck [1986], S. 29.
[18] Vgl. Beck [1986], S. 29 f.
[19] Belting [2008], S. 9.
[20] Vgl. Lobinger [2012], S. 18.
[21] Wenzel [2000], S. 7.
[22] Vgl. Wenzel [2000], S. 7.
[23] Vgl. Wenzel [2000], S. 7 ff.
[24] Weber [2016], o. S.
[25] Vgl. Weber [2016], o. S.
[26] Vgl. Wolber [2016], o. S.
[27] Vgl. Wolber [2016], o. S.
[28] Vgl. Löbl [1903], o. S.
[29] Vgl. Riepl [1972], S. 4 f.
[30] Vgl. Riepl [1972], S. 4 f.
[31] Hepp [2011], S. 182 ff.
[32] Hepp [2011], S. 182.
[33] Poe [2010], S. 23.
[34] Hepp [2011], S. 182.
[35] Vgl. Stöber [2008], S. 139 ff.
[36] Vgl. Stöber [2008], S. 139 ff.
[37] Vgl. Maier [2001], S. 70 ff.
[38] Vgl. Stöber [2008], S. 139 ff.
[39] Vgl. bspw. Koltsova [2008], S. 51 ff.
[40] Hepp [2011], S. 63.
[41] Luckmann [1970], S. 581.
[42] Vgl. Hepp [2011], S. 63.
[43] Hepp [2011], S. 179.
[44] Hepp [2011], S. 185.
[45] Vgl. Hepp [2011], 179 ff.
[46] Krotz [2008], S. 53.
[47] Vgl. Hartmann [2007], S. 403.
[48] Krotz [2005], S. 39.
[49] Vgl. Krotz [2008], S. 52.
[50] Vgl. Lobinger [2012], S. 22.
[51] Vgl. Krotz [2008], S. 53.
[52] Bohnsack [2003], S. 242.
[53] Vgl. Bohnsack [2003], S. 242.
[54] Hepp [2011], S. 188.
[55] Vgl. Hepp [2011], S. 188 ff.
[56] Strauss [1978], S. 119.
[57] Vgl. Strauss [1978], S. 119.
[58] Strauss [1978], S. 119 ff.
[59] Strauss [1978], S. 119 ff.
[60] Hepp [2011], S. 187.
[61] Vgl. Weber [2016], o. S.
[62] Vgl. Weber [2016], o. S.
[63] An dieser Stelle muss kurz auf den hier verwendeten Wissensbegriff eingegangen werden. Es ist festzuhalten, dass Heinze sich auf fachliches Wissen bezieht, das mithilfe des Tatorts dargestellt wird. Der Zuschauer wird über bestimmte Sachverhalte informiert. (Vgl. Heinze [2013], o. S.)
[64] Heinze [2013], o. S.
[65] Vgl. Heinze [2013], o. S.
[66] Vgl. Parr [2013], o. S.
[67] Vgl. Fischer-Lichte [2001], S. 269 ff.
[68] Kramer/Dünne [2009], S. 16.
[69] Vgl. Fischer-Lichte [2001], S. 269 ff.
[70] Vgl. Begriff nach Baudry [2003], 41 ff.
[71] Vgl. Kramer/Dünne [2009], S. 15 ff.
[72] Vgl. Kotte [2005], S. 260.
[73] Vgl. Kotte [2005], S. 260 ff.
[74] Vgl. Kotte [2005], S. 260 ff.
[75] Vgl. Haß [2005], S. 61.
[76] Vgl. Goffmann [1969], o. S.
[77] Vgl. Goffmann [1969], S. 232.
[78] Vgl. Goffmann [1969], S. 232.
[79] Vgl. Goffmann [1969], S. 232.
[80] Goffmann [1969], S. 124.
[81] Vgl. Goffmann [1969], S. 124.
[82] Vgl. Goffmann [1969], S. 124 ff.
[83] Bourdieu [1998], S. 169.
[84] Vgl. Bourdieu [1998], S. 169 ff.
[85] Vgl. Willems [2009], S. 87.
[86] Vgl. Burch [1973], S. 17 ff.
[87] Vgl. Burch [1973], S. 17 ff.
[88] Vgl. Bazin [1977], S. 63 f.
[89] Vgl. Fischer-Lichte [2001], S. 269 ff.
[90] Vgl. Newcomb/Hirsch [1986], S. 177 ff.
[91] Vgl. Newcomb/Hirsch [1986], S. 177 ff.
[92] Bei dem hier verwendeten Wissensbegriff ist anzunehmen, dass es sich um Alltagswissen handelt, das den Rezipienten ermöglicht, Inhalte zu interpretieren. Da sich die vorliegende Arbeit in vielfältiger Weise mit dem Wissensbegriff beschäftigt, soll diese Definition an dieser Stelle ausreichen.
[93] Vgl. Newcomb/Hirsch [1986], S. 177 ff.
[94] Vgl. Newcomb/Hirsch [1986], S. 177 ff.
[95] Vgl. Trommsdorff [2009], S. 147 ; Kroeber-Riel/Gröppel-Klein [2013], S. 696.
[96] Vgl. Gröppel-Klein/Weinberg [2000], S. 666.
[97] Vgl. Petty/Cacioppo [1986], S. 125.
[98] Vgl. Petty/Cacioppo [1986], S. 127.
[99] Vgl. Petty/Cacioppo [1986], S. 125.
[100] Vgl. Petty/Cacioppo [1986], S. 125.
[101] Vgl. Petty/Cacioppo [1986], S. 125.
[102] Vgl. O’Keefe [2008], S. 1477 ff.
[103] Vgl. O’Keefe [2008], S. 1477 ff.
[104] O’Keefe [2008], S. 1477.
[105] Vgl. O’Keefe [2008], S. 1477 ff.
[106] Vgl. O’Keefe [2008], S. 1479 f.
[107] Trommsdorff [2009], S. 31.
[108] Trommsdorff [2009], S. 31.
[109] Vgl. Trommsdorff [2009], S. 31 f.
[110] Trommsdorff [2009], S. 31.
[111] Vgl. Trommsdorff [2009], S. 31.
[112] Trommsdorff [2009], S. 33.
[113] Vgl. Trommsdorff [2009], S. 33 f.
[114] Trommsdorff [2009], S. 33.
[115] Vgl. Trommsdorff [2009], S. 32 f.
[116] Vgl. Trommsdorff [2009], S. 33.
[117] Vgl. Trommsdorff [2009], S. 79 f.
[118] Vgl. Trommsdorff [2009], S. 31 f.
[119] Vgl. Trommsdorff [2009], S. 34.
[120] Vgl. Trommsdorff [2009], S. 25 ff.
[121] Vgl. Belting [2007], S. 11 ff.
[122] Vgl. Stierstorfer [2004], S. 147 f.
[123] Knoblauch [2000], S. 46.
[124] Vgl. Knoblauch [2000], S. 46
[125] Vgl. Berger/Luckmann [2009], S. 1 ff.
[126] Vgl. Berger/Luckmann [2009], S. 1 ff.
[127] Vgl. Knoblauch [2000], S. 48 f.
[128] Vgl. Tuma/Schmidt [2013], S. 13.
[129] Vgl. Brandt [2008], o. S.
[130] Vgl. Bachmann-Medick [2008], S. 10.
[131] Vgl. Simmel [1992], S. 724.
[132] Vgl. Simmel [1992], S. 725.
[133] Tuma/Schmidt [2013], S. 14.
[134] Vgl. Mead [1969], S. 111.
[135] Vgl. Mitchell [1990], S. 19.
[136] Vgl. Mitchell [1990], S. 19 f.
[137] Vgl. Mitchell [1990], S. 22.
[138] Sachs-Hombach [2003], S. 74.
[139] Vgl. Halawa [2008], S. 75 ff.
[140] Vgl. Knieper [2005], S. 37.
[141] Vgl. Przyborski [2008], S. 82.
[142] Deutsche Gesellschaft für Semiotik [2017], o. S.
[143] Vgl. Deutsche Gesellschaft für Semiotik [2017], o. S.
[144] Vgl. Deutsche Gesellschaft für Semiotik [2017], o. S.
[145] Vgl. Lobinger [2012], S. 55.
[146] Vgl. Michel [2006], S. 46.
[147] Vgl. Michel [2006], S. 47.
[148] Vgl. Volli [2002], S. 27.
[149] Vgl. Messaris [1997], S. viii; Nöth [2000] S. 62
[150] Vgl. Paech [2005], S. 82.
[151] Vgl. Barthes [2001], S. 7.
[152] Vgl. Halawa [2008], S. 75.
[153] Vgl. Halawa [2008], S. 75.
[154] Vgl. Kress/van Leeuwen [2006], S. 4.
[155] Vgl. Halawa [2008], S. 64.
[156] Vgl. Lobinger [2012], S. 55 f.
[157] Vgl. Pirker [2010], S. 158.
[158] Vgl. Grittmann [2007], S. 399 f.
[159] Vgl. Hall [1999], S. 106.
[160] Vgl. Hall [1999], S. 106.
- Arbeit zitieren
- Anna-Christin Buck (Autor:in), 2017, Visuelle Unternehmenskommunikation. Der Einfluss von Videos auf Wissensstrukturen in Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367340
Kostenlos Autor werden



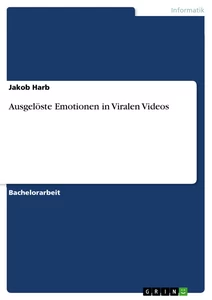







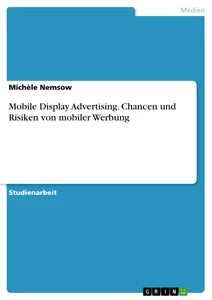

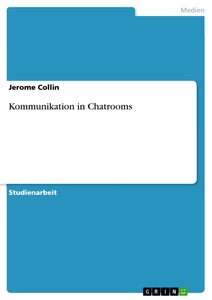






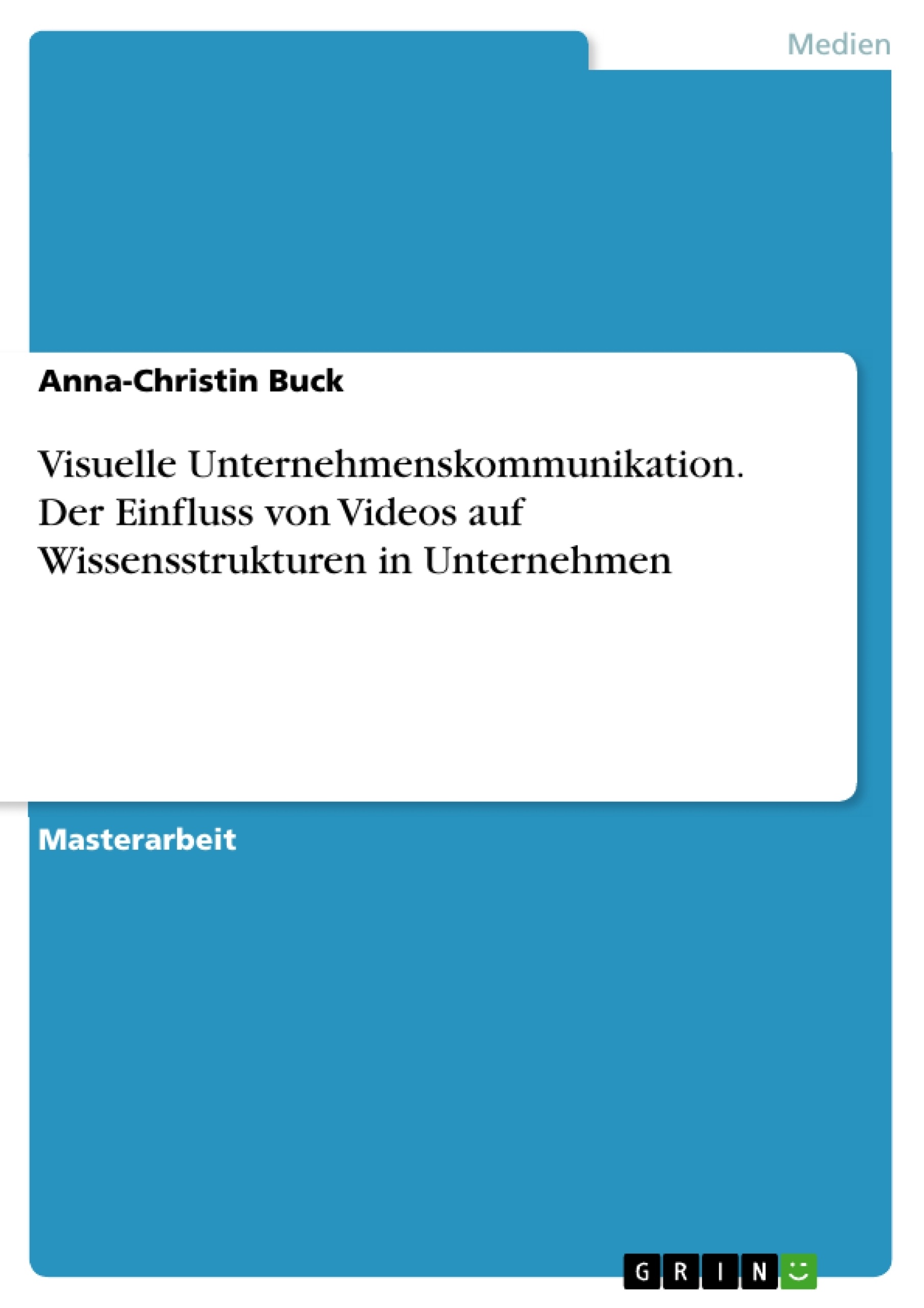

Kommentare