Leseprobe
Inhalt
1 Einleitung: Zum methodischen Umgang mit Nietzsches (Anti)system
1.1 Zur Terminologie im Umfeld des Subjekts
2 Erkenntniskritik + Sprache – Restriktion der Begrifflichkeit
2.1 Über den Ursprung der Sprache
2.2 Rhetorik
2.3 Intonation
2.4 Semiotik
3 Subjekttheorie bei Nietzsche
3.1 Die Konstrukte Subjekt und Objekt
3.1.1 Das Zerwürfnis mit dem Ich
3.2 Krisis und Erlösung: Das tanzende, singende, dichtende Selbst
3.3 Nietzsches fragwürdiger Ich-Erzähler
3.4 Die Maskerade des Selbst
4 Stil und Ästhetik als angewandte Sprachphilosophie
4.1 Aphorismen
4.2 Dialoge
4.3 Rhythmus
5 Nietzsches unauflösbare Widersprüche
5.1 Widerspruch versus Perspektivismus und Dialektik
5.2 Das Rätsel der Paradoxien
5.3 Die Methode hinter den Paradoxien
6 Das zurück gewonnene Selbst im Kunstideal
6.1 Der ideale Künstler und sein ideales Schaffen
7 Nietzsches postuliertes Subjekt
Glossar
Literaturverzeichnis
1 Einleitung: Zum methodischen Umgang mit Nietzsches (Anti)system
Ich bin nicht bornirt genug zu einem System – und nicht einmal zu meinem System...[1]
Wir würden Friedrich Nietzsche nicht annähernd gerecht, wenn wir ihn nur als Philosophen rezipierten. Neben seiner offiziellen Stellung als Philologe[2] ist er vor allem Dichter und Musiker[3]. Die sich daraus ergebenden Eigenschaften kommen nicht partikular zum Vorschein, sondern ziehen sich als Gesamtes durch seine Werke. Ein kurzer Blick auf sie genügt, um festzustellen, dass wir keineswegs einen stringent und logisch argumentierenden Philosophen antreffen. Vielmehr begegnet uns ein Dichter und Poet, der nicht argumentieren, beweisen und dadurch überzeugen, sondern vor allem verführen will. Dies gelingt Nietzsche, indem er neben dem Gebrauch paralingualer Elemente die Bedeutung seiner Schriften mittels eines metaphorischen oder metonymischen Stils zu einer Vieldeutigkeit verdichtet, die sich einer konventionellen Deduktion verschließt. Wie können wir uns Nietzsche dann aber nähern und sein Programm nachzuvollziehen hoffen, wenn er sich einem systematischen Diskurs entzieht und diesen sogar für verwerflich erachtet?[4]
Es wäre damit eine Hybris, hinter Nietzsches Werken dann eben das System entdecken zu wollen, dem er gezielt „ausgewichen“[5] ist. Dennoch lässt sich ein Prinzip ausmachen, das sich durch alle Werke zieht und es als roter Faden zu einem Gesamtwerk[6] verknüpft: die thematische und stilistische Unbeständigkeit. Unbeständigkeit als beständiges Merkmal, diese These erscheint auf den ersten Blick wie missglückte Dialektik, mittels der man das Unfassbare zu erfassen sucht. Doch verwirklicht sich in dieser nietzsche-typischen Methode die für ihn bis zuletzt gültige Lehre des Heraklit, dass sich alles stets im Fluss befindet und sich daher fortlaufend verändert.[7]
Mit diesem Einheit stiftenden Unterbau im Hinterkopf scheint nun doch ein wissenschaftlicher Diskurs möglich, wenn uns als Leitfaden all dies dient, was vordergründig als Mangel der Schriften Nietzsches anmutet: die Sprung- und Wechselhaftigkeit seines Schreibstils, die im zweiten Teil dieser Arbeit einen Rekurs auf Nietzsches sprachphilosophische Überlegungen verlangt und im vierten Teil die Erforschung ihrer konkrete Umsetzung nach sich zieht.
Eine der wohl deutlichsten Diskrepanz in Nietzsches Werken zeigt sich in dem Widerspruch aus dem von ihm als Konstrukt und Illusion gebrandmarkten ‚Ich’ und der scheinbar unbekümmert verwendeten Ich-Erzähler-Haltung. Diese Diskrepanz zieht im dritten Teil dieser Arbeit die Frage nach sich, wer da eigentlich worüber schreibt.
Die in dieser Arbeit zentral zu behandelnden Widersprüche in Nietzsches Theorien, Proklamationen, Aussagen, und Postulaten führen uns schließlich in den letzten beiden Teilen zu dem alles erhellenden Punkt, an dem auch die Frage beantwortet werden kann, wie der Begriffsverächter Nietzsche, der die Musik zum eigentlichen und ultimativen Medium des sich äußernden Selbst erhebt[8], dem Schreiben so viel Musik einzuhauchen vermag, dass der Text als ebenbürtiges Medium erstrahlt.
Auf dem Weg zur Auflösung der Widersprüche begegnet uns dann der Problemhorizont des sich durch alle Werke hindurch ziehenden Fragmentarischen als ein nur zunächst unüberwindlich scheinendes Hindernis zum wissenschaftlichen Umgang mit Nietzsches schriftlichem Produkt. Vor dem historischen Hintergrund der antiken Mythologie, in der Dionysos zerstückelt und über den ganzen Kosmos verteilt wird, gewinnt Nietzsches fragmentarischer Stil jedoch an intentionaler Bedeutung, in der wir das „erste Wissen, die dunkle Erfahrung“ wahrnehmen können, „in der sich das Werden in seiner Beziehung auf das Diskontinuierliche und sein Spiel entdeckt“[9] Das Partikulare und Unzusammenhängende gibt daher eine erste Vorstellung von dem, was wir hinter dem Text zu erblicken hoffen: das sich in den allegorischen Masken des Zarathustra und Dionysos zeigende Selbst des Autors; dieser ist jedoch weit davon entfernt, sich verbergen oder verschleiern zu wollen. Allerdings vermag die begriffliche Sprache in konventioneller Anwendung zunächst nicht auszudrücken, was, als das fortlaufend Unbeständige, den fixierten Text generiert.
Die vorliegende Arbeit widmet sich also in einem ganz entscheidenden Maße der Suche nach Nietzsches Idee des sich zum Ausdruck bringenden Subjekts. Ein Zugang zu seiner Vorstellung eröffnet sich dabei auf zwei Wegen: zum einen durch Nietzsches (leider nur sehr marginal) theoretische Abhandlungen zum ‚Subjekt’; zum anderen durch Nietzsches eigenes Schaffen, das sein Subjekt-Verständnis exemplifiziert.[10] Dabei können biographische Daten jedoch nur eine verschwindende Rolle spielen, da die noch darzulegende Sprachskepsis Nietzsches jegliche Wahrhaftigkeit beanspruchende Faktizität in Abrede stellt und stattdessen davon ausgeht, „dass eine preiswürdigere Wahrhaftigkeit in jedem kleinen Fragezeichen liegen dürfte“[11] Daher gilt, Nietzsche in der Maske des Künstlers und damit über sein künstlerisches Produkt auszumachen.
Eine adäquate Annäherung an Nietzsche bedarf daher einer interdisziplinären Vorgehensweise, in der die Sprachphilosophie sowie die Linguistik Aufschluss über Ursprünge und Implikationen einer generativen Grammatik geben; darüber hinaus verlangt das von Nietzsche präferierte Medium nach einer literaturwissenschaftlichen Abhandlung, der die Anwendung des theoretischen Überbaus erforscht. In einem abschließenden ethisch-moralischen Diskurs konkretisiert sich dann das Bild des postulierten Subjekts, wenn untersucht wird, welche moralischen (Um)Wertungen Nietzsche für dessen Verwirklichung vorsieht.
1.1 Zur Terminologie im Umfeld des Subjekts
Das Forschungsziel dieser Arbeit, das von Nietzsche in Frage gestellte und daraufhin umgewertete Subjekt zu ergründen, macht eine deutliche Differenzierung aller sich auf dieses in seinen Werken beziehenden Begriffe unabdingbar. Dabei ergibt sich die besondere Schwierigkeit, dass Nietzsche seinem Sprachverständnis entsprechend nicht beständig und verbindlich mit Begriffen verfährt und es damit unmöglich macht, ein Glossar aus seinen Werken abzuleiten. Daher können die folgenden Ausführungen immer nur vorläufige Periphrasen darstellen, die uns – gleich Leuchtfeuern – als vorläufig verbindliche Hilfskonstruktionen zwischen Leser und Autor zur besseren Orientierung in Nietzsches Sprachwelt verhelfen sollen.
Da wir in seinen Werken allerdings auch keine dezidierten Darlegungen darüber finden können, wie das Subjekt, das Ich, das Selbst, sowie das Individuum grundlegend aufzufassen und zu begreifen sind, erscheint eine zunächst negierende Abgrenzung sinnvoll, in der darzulegen ist, was diese Begriffe nach Nietzsches Auffassung nicht zu leisten vermögen: nämlich als beständige und verlässliche Termini sowohl reflektierend, als auch vermittelnd jederzeit eine Vorstellung von dem zu liefern, was wir uns als zuverlässige Einheit – zusammengefasst unter ‚Person’, ‚Persönlichkeit’, bzw. ‚Charakter’ – zu erblicken und später wieder zu erkennen hoffen.[12] Ferner drückt Nietzsche durch den Zweifel an der Berechtigung abendländischer Logik sein tiefes Misstrauen gegenüber einem Subjekt aus, das dem irrigen Glauben erlegen ist, sich im „Ich“ eine Instanz für einen freien Willen erschaffen[13] zu haben:
Was den Aberglauben der Logiker betrifft: so will ich nicht müde werden, eine kleine kurze Thatsache immer wieder zu unterstreichen, welche von diesen Abergläubischen ungern zugestanden wird, - nämlich, daß ein Gedanke kommt, wenn "er" will, und nicht wenn "ich" will; so daß es eine Fälschung des Thatbestandes ist, zu sagen: das Subjekt "ich" ist die Bedingung des Prädikats "denke".[14]
Ginge man auf diese Überlegung dergestalt ein, nicht das Subjekt als die den Gedanken erwirkende Instanz, sondern an seiner statt den Verstand – oder religiös motiviert die Seele – anzunehmen, so hielte Nietzsche dem entgegen, dass „Sinn und Geist“ uns überreden möchten, „sie seien aller Dinge Ende: so eitel sind sie. Werk- und Spielzeuge sind Sinn und Geist: hinter ihnen liegt noch das Selbst“[15]. Doch was sollen wir uns unter diesem ‚Selbst’ vorstellen? Es ist bezeichnend für Nietzsche, dass die fast definitorisch-verbindlichen Äußerungen über das ‚Selbst’ ausschließlich im fiktiven Werk aus dem Munde einer Figur[16] erfolgen: Zarathustra erhebt das ‚Selbst’ zu dem hinter allen innerlichen Vorgängen des Menschen stehenden Prinzip: „Das Selbst sucht auch mit den Augen der Sinne, es horcht auch mit den Ohren des Geistes. Immer horcht das Selbst und sucht: es vergleicht, bezwingt, erobert, zerstört. Es herrscht und ist auch des Ich's Beherrscher.“[17]
Müssen wir also in diesem Selbst einfach die Alteration oder Variation des vormals alles beherrschenden Subjekts[18] annehmen? Wenn ja, was wäre dann gewonnen? Denn schließlich erscheint das Selbst zunächst nur als das nutzlose Substitut dessen, was von Nietzsche als Konstrukt abgelehnt wird. Sprechen wir dem Selbst jedoch die jedem Begriff eigentlich zugrunde liegende Beständigkeit ab und erklären es zum principium versationis, so erhellt sich Zarathustras dann folgende Gleichsetzung des Selbst mit dem Leib[19], wenn wir es mit dem Triebpolypen der Morgenröthe in Zusammenhang stellen:
Wie weit Einer seine Selbstkenntnis auch treiben mag, Nichts kann doch unvollständiger sein, als das Bild der gesammten Triebe, die sein Wesen constituiren. [...] die Gesetze ihrer Ernährung bleiben ihm ganz unbekannt. [...] Und in Folge dieser zufälligen Ernährung der Theile wird der ganze ausgewachsene Polyp etwas ebenso Zufälliges sein, wie es sein Werden ist.[20]
Daher ist der Mensch als das Korrelat zum Subjekt sowohl in seinem nur ganz momentanen Sein, als auch in seinem beständigen Werden nicht zu erfassen[21]. Das lässt den Schluss zu, dass Begriffe wie Subjekt, Ich, Person etc. nur Vorurteile und mitunter Hybris einer das Selbst verleugnenden Anschauung sein können, die nicht wahrnimmt, dass man „das Zeug zu mehreren Personen im Leibe [trägt]“ und „für ‚Charakter’ [hält] was nur zur ‚Person’, zu Einer unserer Masken, gehört.“[22]
Während sowohl ‚Subjekt’ als auch ‚Ich’ ein durch Grammatik und Gewöhnung entstehende Konstrukte sind, verweist das ‚Selbst’ bei Nietzsche auf das Wesen und den mannigfachen Willen eines Menschen[23], der sich als Triebpolyp entweder seinen Weg zur Macht bahnt und darin seine Erfüllung erfährt, oder in fortlaufender Selbstverleugnung – meist verursacht durch eine bestehende falsche Moral – stagniert, bzw. verkümmert. Die Mannigfaltigkeit des durch die Metapher des Triebpolypen ausgedrückten Inneren eines Menschen deutet bereits an, dass sich uns das dort verborgene Selbst nicht durch direkte Betrachtung und ausgeleuchteter Anschauung offenbaren wird. Es verlangt vielmehr nach einem peripheren Blick, der nicht das statische Sein zu fassen sucht, sondern all jene bewegten Ungereimtheiten verspürt, welche das Selbst in seinen Widersprüchlichkeiten auszeichnen.
Die folgenden Aufgaben können daher nur darin bestehen, einerseits die Ursachen für die umrissene Skepsis Nietzsches gegenüber dem Subjekt zu untersuchen, als auch die daraus erwachsenen Konsequenzen für den Einzelnen darzulegen.
Entgegen seiner strikten Ablehnung verbindlicher Termini sollten die wesentlichen Subjekt-Begriffe zumindest innerhalb dieser Arbeit dennoch so weit eingegrenzt und bestimmt werden, dass sich daraus eine wesentliche Erleichterung und bessere Orientierung für den Umgang mit Nietzsches Subjektverständnis ergibt. So wollen wir für diese Arbeit annehmen, dass das Subjekt durch zwei entgegen gesetzte Kräfte determiniert ist: Das Selbst stellt das Unbewusste und eine sich stetig wandelnde Kraft dar, die sich nicht logisch erfassen lässt. Das Ich wiederum ist ausschließlich im Bewusstsein situiert und herrscht in einer wechselseitigen Beziehung mit dem Verstand. Die Ausprägung und Gestalt eines Subjekts resultiert dann aus dem Kräfteverhältnis der beiden Prinzipien, die den Einzelnen zu einem Individuum formen.
2 Erkenntniskritik + Sprache – Restriktion der Begrifflichkeit
Die Überlegungen zu den Problematiken der Sprache sind ebenso alt wie die Philosophie. Dennoch etabliert sich die Sprache als philosophischer Terminus erstaunlich spät in der Philosophiegeschichte. So gilt Francis Bacon weithin als Begründer der bis heute reichenden Disziplin der Sprachphilosophie durch die konstitutive Trennung einer literarischen von einer philosophischen Grammatik: während erstere dem schnelleren Spracherwerb dienlich sein sollte, widmet sich das philosophische Pendant der Analogie zwischen Worten und Sachen; ein Problemfeld, das wir erstmalig in der Aristotelischen Unterscheidung zwischen der natürlichen Bedeutung beseelter Laute und der arbiträren Bedeutung symbolischer menschlicher Laute als Resultat von Kompositionen und Konventionen strukturiert finden. Durch diese Strukturierung verschiebt sich das Interessenfeld der Philosophie vom Nomos hin zur Proposition des Satzes und gibt Raum für die nun beginnende Sprachlogik, die der Frage nachgeht, ob und wie viel Wahrheit ein Deklarativsatz beherbergen kann. Sie führt jedoch nicht stringent zu der gegenwärtigen Form von Sprachphilosophie und Sprachkritik, da die Stoiker und Scholastiker zunächst noch an der platonischen Ideenlehre festhalten, welche sich in der Sprache als Vorstellung des unkörperlichen und daher unveränderlichen lektón [24] ausdrückt. Dieses Gesagte oder Sagbare kann aufgrund seiner Stellung als veritas aeterna nicht einem kritischen Diskurs unterworfen werden. Die so aus unantastbaren Begriffen bestehende Medium der Geisteswissenschaften erlaubt daher eine reine Wissenschaftlichkeit, in der begriffliches Denken und Sein auch durch historische und natürlich kritische Aspekte der Sprache nicht berührt werden.
Es bedurfte erst der Aufklärung, die das Individuum zum Zentrum der Erkenntnis erhob, um schließlich die Vorstellung von einer Sprache zu überwinden, die zuforderst dem Erfassen von natürlichen und endgültigen Sachverhalten dient. Denn nun ist das Urteilen über die Welt nicht mehr durch die Beziehung zwischen dem Objekt und dem Subjekt dergestalt determiniert, dass ein An-sich auf sein Erblicken durch den Einzelnen ausgerichtet ist. Vielmehr erzeugt jede Wahrheit nun ein zu verhandelndes
Spannungsfeld zwischen verschiedenen Subjekten, die sich als Individuen in Gemeinschaft, d.h. in Identität und Differenz, mit anderen Individuen bilden und zwischen denen [...] erst das entstehen kann, was man im philosophischen Sinn des Wortes ‚Welt’ zu nennen pflegt und was Humboldt, um die Unhintergehbarkeit ihrer perspektivischen Vielfalt zum Ausdruck zu bringen, Weltansicht nennt.[25]
Bemerkenswert für Nietzsches darauf aufbauenden Umwertungen ist, dass das durch die emanzipierte Vernunft[26] erstarkte Subjekt zwar als elementarster Wegbereiter für die moderne Sprachphilosophie auftritt; damit wird es aber auch zugleich zum Initial einer Selbst-Krise, die vielleicht in seinem eignen Untergang endet. Denn das Individuum, das sich selbst und die Welt erst durch das Medium der Sprache erschaffen hat[27], sieht sich dann nicht nur mit der Frage konfrontiert, wie das sprachlich generierte Subjekt innerhalb eines arbiträren Systems zu begreifen ist. Wagt es sich auch noch bis zu jenem Abgrund vor, an dem das gesamte System zu kippen droht, wird die Frage unausweichlich, was dann vom Subjekt übrig bleiben wird.
2.1 Über den Ursprung der Sprache
Die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch die Aufklärung initialisierte Verhandelbarkeit von Sprache brachte zugleich ein von jeher bestehendes Bestreben der Philosophen und Philologen auf den Plan: Die Ergründung des immer noch mysteriösen Ursprungs der Sprache. Von ihr versprach man sich ein Verständnis des Mysteriums Sprache selbst – und damit einhergehend ein Verständnis für das sprachlich determinierte Subjekt des Menschen. Viele Vorstellungen und Theorien mussten im Laufe der Geschichte überwunden, korrigiert oder gänzlich revidiert werden, so z.B. die der christlichen Religion, die das Wort noch vor Gott stellt und der Sprache eine generierende Kraft zuschreibt. Damit knüpft das Christentum an die antike Vorstellung an, das Wort habe ähnlich der Musik und Einbildung (phantásmata) gefährliche Macht über die Seele und müsse vom Verstand kontrolliert werden. Von einem sprachlichen Impetus überzeugt ist es dann nur noch ein kleiner Schritt hin zum Glauben an die Allmacht der begrifflichen Sprache und an ihr Vermögen als Werkzeug zur Erkenntnis.
Die Suche nach einem Ursprung setzt immer ein Verlangen nach Wahrheit und das Bewusstsein über einen gegenwärtig verfremdeten Zustand voraus. So auch in der Sprachwissenschaft, die allerdings trotzt aller Bemühungen das Wunder der Sprachgenese bis heute nicht zu lösen vermochte und sich seit Platon immer noch nicht einig ist, ob Sprache nun Physei oder Thesei sei.
Deutliche Fortschritte hingegen machte die Sprachwissenschaft in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als zahlreiche Preisschriften an Akademien ausgelobt wurden, um befriedigende Antworten auf das Mysterium Sprachursprung zu erhalten. Eine solche Preisschrift verfasste Johann Gottfried Herder 1770 für die Berliner Akademie und wendet sich in ihr sowohl gegen das Zurückführen der Sprache auf einen göttlichen Ursprung als auch gegen eine Herleitung der Sprache aus reinen Empfindungslauten. Zwar stimmte er mit Condillac überein, dass der Mensch originär Empfindungen durch Laute artikuliere, dies würde jedoch allenfalls die Entwicklung einer onomatopoetischen Sprache erlauben.[28] Der entscheidende Vorstoß Herders ist nun die Überlegung, dass der Mensch einen Laut und die Idee mit Besonnenheit verknüpft. Damit ist für ihn das Bewusstsein nicht etwa das Resultat der Sprache, sondern dem Menschen a priori zu eigen:
Der Mensch in dem Zustand von Besonnenheit gesetzt, der ihm eigen ist, und diese Besonnenheit zum ersten Mal frei wirkend, hat Sprache erfunden. [...] Diese Besonnenheit ist ihm charakteristisch eigen und seiner Gattung wesentlich: So auch Sprache und eigene Erfindung der Sprache.[29]
Dass Sprache entstehen konnte, bedingt sich für Leibniz aus der Annahme einer Notwendigkeit der wechselseitigen Beziehungen von inneren (Bewusstsein) und äußeren (Ding verursacht Nervenreiz) Ursachen. Er stellt fest, dass ohne innere Kraft sowohl nichts ist als auch nichts geschieht. Doch kann auch nichts aus sich selbst heraus geschehen und bedarf somit der äußeren Anregung. Der aus der Physiologie Albrecht Hallers entliehene Begriff der Reizkausalität gestattet Herder, die Sinne als Grundlage aller Erkenntnismöglichkeit zu begründen, ohne in „sensualistischer Weise das Denken aus den Sinneswahrnehmungen herleiten zu müssen.“[30] Damit erfährt das Bewusstsein auf axiomatische Weise seine natürliche Notwendigkeit.
In Analogie zur Schöpfungsgeschichte entwickelt Herder sieben Ursprünge der Sprache, um das Wunder der Sprachentwicklung aufzuschlüsseln: erstens bedarf jegliche Wahrnehmung Empfindungen (sensibilitas); zweitens entwickelt jede besondere Gattung von Sinneswesen ihre eigene Natursprache (sensibilitas specifica); drittens benötigt jede Sprache nicht nur einen Sender, sondern auch einen Empfänger (con-sensibilitas); im vierten Schritt überwindet der Mensch die entscheidende Hürde, ein Symptom zu einem Zeichen, ein Gegenwärtiges zu einem Allgemeinen und einen Eindruck zu einem Begriff zu transformieren, indem er alles mit Besonnenheit[31] tut; fünftens wählt der Mensch durch seine (nur auf Gott zurückzuführende) Besonnenheit ein Merkmal an einem Gegenstand aus, das seine Seele am meisten berührt. Dies ist der Ton;[32] sechstens muss der Mensch nun auf das tönende Merkzeichen mit seinem eigenen Empfindungslaut reagieren, um zu einem Wort zu gelangen; im Augenblick der Artikulation vollzieht sich nun der siebte Schritt, indem das artikulierte Zeichen durch seinen engen Bezug zum produzierenden Menschen Bestand erhält. Das gemerkte Zeichen kann von nun an als Merkwort, Erinnerungswort und vor allem als Mitteilungswort verwendet werden.
Daran anschließend drängt sich die Frage auf, wie der Mensch zu Begriffen gelangen konnte, deren Signifikat keine tönenden Merkmale besitzt. Diese Problematik löst Herder mittels der Synästhesie: Ein nicht akustisches Merkmal wird auf Hörbares mittels Analogie übertragen:
Natürlich wird’s ein Wort machen, das durch Hilfe des Mitgefühls dem Ohr die Empfindung des Urplötzlichschnellen gibt, die das Auge hatte – Blitz! – Die Worte: Duft, Ton, süß, bitter, sauer usw. tönen alle, als ob man fühlte.[33]
Neben dem sicherlich kritikwürdigen Ansatz der bereits durch de Saussure widerlegten onomatopoetischen Erläuterung lässt sich dennoch ein wesentlicher Aspekt der herderschen Beweisführung extrahieren: Die Sprache ist in ihren Ursprüngen an Empfindungen und Instinkte gebunden; sie ist sowohl in ihrem Beginn, als auch in ihrer Entwicklung ganz und gar sinnlich. In der Hierarchie der Sinne wird das Hören zuoberst angesiedelt. Akustische Signale sprechen die menschliche Seele am tiefgreifendsten an. Der originäre Umgang mit der Sprache war ein künstlerischer: Begriffe teilen zwar keine Identität mit dem Bezeichneten, die Sprache ist aber den Klängen der Natur nachgeahmt.
Von diesem Standpunkt aus gelingt uns nun der Sprung zu Nietzsches Sprachauffassung und zu seiner Forderung nach einer Hinwendung zu einem archaischen Sprachumgang: Die Äußerung eines Lautes ist dann für Nietzsche authentisch, wenn sie auf einer Empfindung beruht und sich ohne einen Umweg über kodierte Zeichen individuell artikuliert. Doch wie begründet Nietzsche seine Forderung nach einem archaischen Umgang mit der Sprache? Ein entscheidendes Moment für den Beginn von Nietzsches Sprachskepsis war seine Basler Rhetorikvorlesung, die er im Wintersemester 1872/73 hielt. Die zentrale, von Gustav Gerber[34] adaptierte, These[35] geht davon aus, dass die begriffliche Sprache im wesentlichen metaphorisch und ihr ursprünglicher Charakter künstlerisch ist. Die primäre Fehlentwicklung der Sprache hin zu einem kodierten Zeichensystem sieht Nietzsche daher in den anthropologisch gedeuteten Ursprüngen der Sprache begründet: Der Mensch als das schwächste Tier in der Natur musste eine Kommunikationsform entwickeln, um den „ bellum omnium contra omnes “[36] zu beenden. Dies konnte jedoch nur durch das „Gleichsetzen des Nicht-Gleichen“[37] geschehen, damit auch das schwächste Mitglied des sozialen Gefüges, dessen Kooperation für das Überleben Aller im gleichen Maße von Bedeutung war, mit einbezogen werden konnte. Dem anthropologischen Ansatz der Kooperation entspricht ebenso die folgende Überlegung in Anlehnung an Evolution und Selektion:
Wer zum Beispiel das ‚Gleiche’ nicht oft genug aufzufinden wusste, in Betreff der Nahrung oder in Betreff der ihm feindlichen Thiere, [...] hatte nur geringere Wahrscheinlichkeit des Fortlebens als Der, welcher bei allem Aehnlichen sofort auf Gleichheit rieth. Der überwiegende Hang aber, das Aehnliche als gleich zu behandeln, ein unlogischer Hang – denn es giebt an sich nichts Gleiches -, hat erst alle Grundlage der Logik geschaffen.[38]
Hier finden wir nun den entscheidenden Ansatz für Nietzsches Sprachskepsis vor, der leicht zu überlesen ist und daher näherer Erläuterung bedarf: Beseelt von der tiefen Überzeugung, dass sich die Welt in heraklitischer Weise in stetigem Wandel befindet[39] und jeglicher Beständigkeit widerspricht, fasst Nietzsche jede Abstraktion als ein Vorurteil auf, da sie von etwas zeugen möchte, das nicht existiert. Ein Begriff tut nun genau dies: Er fasst singuläre Erscheinungen, die nicht nur voneinander, sondern auch im Wandel der Zeit von sich selbst völlig verschieden sind, aufgrund ihrer ähnlichen Merkmale zu einer Gruppe zusammen. So veranlasst uns beispielsweise das Wort „Baum“ an ein selbständiges Etwas zu glauben, das wir in der Natur auch wieder zu entdecken meinen, obwohl wir niemals den selben ‚Baum’ – sprich die individuelle und unwiederbringlich einmalige Wahrnehmung – noch einmal wiederholen können.[40] Das Gleichsetzen durch Abstraktion von Nichtgleichem, also von individuellen und einmaligen Erscheinungen, bedeutet für Nietzsche die Entfremdung von einer ursprünglichen Wahrnehmung und von einem ursprünglichen Ausdruck:
damit der Begriff der Substanz entstehe, der unentbehrlich für die Logik ist, ob ihm gleich im strengsten Sinne nichts Wirkliches entspricht, - lange Zeit das Wechselnde an den Dingen nicht gesehen, nicht empfunden worden sein; die nicht genau sehenden Wesen hatten einen Vorsprung vor denen, welche Alles „im Flusse“ sahen.[41]
Denn in dem erst durch Begriffe ermöglichten Denken verschafft sich der Mensch Herrschaft über die sich im Chaos fortwälzende Natur, insofern er sie nicht mehr nur als Phaenomena aufnimmt, sondern durch Abstrakta erst strukturierend, schließlich auch in sie formend eingreift[42] ; dies allerdings zu dem Preis der Entfremdung von der Natur. Und so stehen sich Natur und Sprache als unverbrüderliche Gegensätze gegenüber, da sich der Mensch in den Begriffen ganz der Illusion des eigenmächtig gesetzten Beständigen hingibt[43] ; die Natur jedoch setzt ihr Spiel aus Entstehen und Vergehen unbekümmert fort. Dem entgegengesetzt setzt sich in der Romantik der Glaube durch, Natur und Sprache wieder zu ihrer Vereinigung führen zu können, insofern in der Poesie noch ein Medium vermutet wird, mittels dem eine metaphysische und absolute Wahrheit hinter der wahrnehmbaren Welt erfahrbar sein soll. Nietzsche verwirft im Laufe von Menschliches Allzumenschliches jegliche Metaphysik, erkennt aber die besondere Fähigkeit der Poesie ebenfalls dergestalt, dass er ihre supralexikalischen Elemente – Rhythmus und Melodie bzw. Intonation – zu den Trägern einer authentischen Sprachform erhebt: „Nun aber ein neues Element: die Wortfolge soll Symbol eines Vorgangs sein: die Rhythmik, die Dynamik, die Harmonie werden wieder die der Potenz nöthig. [...] Die Poesie beginnt, ganz in der Herrschaft der Musik.“[44]
2.2 Rhetorik
Alle rhetorischen Figuren sind logische Fehlschlüsse. Damit fängt die Vernunft an![45]
Wie sehr Nietzsche der Sprache misstraute, zeigt sich nicht zuletzt auch in seiner Adaption der Gerberschen Annahme, Sprache sei Rhetorik. Damit verschärft er die Theoreme Herders und Humboldts, die der Sprache zwar einen metaphorischen Charakter nachweisen, aber nicht ihre gänzliche Qualität zur Verführung erkannten. Sie bezieht sich dabei „ebenso wenig wie die Rhetorik, auf das Wahre, auf das Wesen der Dinge, sie will nicht belehren, sondern eine subjektive Erregung und Annahme auf andere übertragen.“[46] Dies gelingt ihr, insofern sich jeder Teilnehmer einer Kommunikation gezwungen sieht, den per Konvention festgelegten Code nicht nur zu akzeptieren, um das jeweilige Gegenüber zu verstehen, sondern ihn auch selbst zu benutzen, um sich verständlich zu machen. Begriffe entstehen immer aus einem gemeinsamen Nenner, aus dem Vernachlässigen und Verleugnen des persönlichen Bezugs zu einem Signifikanten zugunsten einer Abstraktion; sie können also niemals adäquater Ausdruck einer individuellen Empfindung sein, da sie immer ein Allgemeingut darstellen.
Die Beschäftigung mit der Rhetorik ist bei Nietzsche nach der Geburt der Tragödie nicht mehr von historischem Interesse; sie bedeutet vielmehr in philologischer Hinsicht, den Nachweis zu erbringen, dass die Sprache selbst Rhetorik ist und darüber nicht hinauskommt. Es geht Nietzsche nun darum, die figuralen und gelegentlich tropischen Strukturen der Sprache zu brandmarken. Ferner strebt er an, sie gegen die Philosophie und deren wissenschaftlichen Anspruch anzuwenden, indem er ihre ablehnende Haltung gegenüber Mythos, Dichtung und jedem anderen doxischen Gebrauch von Sprache als einen zum Scheitern verurteilten Anspruch deklassiert; dies insofern, da jeder Gebrauch von Sprache zwangsläufig dóxa und nicht episthmh ist. Denn nicht die Dinge, wie sie in der Wirklichkeit vorhanden sind, treten in unser Bewusstsein, „sondern die Art, wie wir zu ihnen stehen, das piqanón.“[47]
Diese Entfremdung lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Ein Gegenstand (Ding an sich) verursacht beim Betrachter einen Nervenreiz, welcher wiederum eine Empfindung auslöst. Nun artikuliert der Betrachter einen Laut, um dem Drängen seiner Empfindung zu entsprechen. Dieser Laut manifestiert sich zu einer Vorstellung, ist somit erstmalig fixiert. In der Vorstellung verliert der Laut seinen Klang und wird daraufhin zum Symbol unserer Vorstellung und zur Sprachwurzel. Auf das Symbol der Vorstellung referierend entsteht in der Artikulation ein Wort, dass dann, gebunden an einen Konsens zugunsten der allgemeinen Verständigung, zu einem kodierten Begriff wird. Ostentativ problematisch an dieser Entwicklung ist die Entfremdung der Vorstellung von dem ursprünglichen Empfinden ebenso wie der Irrglaube, die Welt mittels der Sprache erfassen zu können. Zwei Argumente sprechen gegen diesen Glauben: die begriffliche Sprache kann den Dingen nicht gerecht werden, da sie in einem anderen Medium agiert; ferner wird in der Äußerung nicht das Individuelle der Empfindung zum Ausdruck gebracht, das sie zugunsten der allgemeinen Verständigung auf ein allgemeines Merkmal reduziert wird. Und ebenso, wie „Von Natur ... der Mensch nicht zum Erkennen da.“[48] ist, so ist die begriffliche Sprache auch nicht dazu bestimmt, die Wahrheit zu offenbaren.
Man könnte nach diesen gewonnen Erkenntnissen über die Verfremdung des Ausdrucks durch die begriffliche Sprache sicherlich in Lord Chandos Lamento einstimmen, dass einem „die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muß, um irgend welches Urtheil an den Tag zu geben, [...] im Munde wie modrige Pilze“[49] zerfallen, wenn Nietzsche nicht auch Ansätze zur Überwindung des Sprachproblems bereithielte, denen das anschließende Kapitel gewidmet ist.
2.3 Intonation
Im Verhältniß zur Musik ist alle Mittheilung durch Worte von schamloser Art; das Wort verdünnt und verdummt; das Wort entpersönlicht; das Wort macht das Ungemeine gemein.[50]
Nachdem das Dilemma der Sprache aus Nietzsches Sicht hinlänglich erläutert wurde, wollen wir nun an eine mögliche Lösung des Problems herantreten und untersuchen, welche Elemente der Sprache verbleiben, mittels derer ein wahrhaftiger Ausdruck zu realisieren ist. Hilfreich ist hierzu die Einbeziehung der Intonationsforschung, die sich auf phonetischer Basis mit der Strukturierung von Äußerungen beschäftigt, indem sie diese in Tonhöhe, Verlauf und Dauer von Segmenten kategorisiert. Die Forschung benennt drei Bereiche als Betätigungsfelder:
Eine Äußerung kann einerseits nach ihren Syntaktischen und grammatikalischen Funktionen in interrogative, terminale oder progrediente Sätze unterteilt werden.
Ferner kann ein und derselbe Satz durch verschiedene Intonationen unterschiedliche informations- oder diskursstrukturierende Funktionen erhalten: „Ích habe éin bláues Áuto geséhen“ (vgl. die unterschiedlichen semantischen Bedeutungen bei unterschiedlicher Betonung).
Drittens kann anhand der Intonation die emotionale oder affektive Haltung des Sprechers ausgemacht werden. In diesem Fall ist die Intonation nicht diskret, sondern kontinuierlich. Will man in diesem Bereich zu Strukturierungen gelangen, müssen in einer empirischen Studie Probanden herangezogen werden, die Äußerungen in Kategorien wie fröhlich, überrascht, ängstlich, erschrocken oder ähnliches einordnen. Um nicht durch den Satzinhalt beeinflusst zu werden, werden die Sätze von Personen andere Herkunft und Sprache als die der Probanden gesprochen.[51] In den vor Georg Heike durchgeführten Versuchen fand man heraus, dass eine übergroße Übereinstimmung in der Zuordnung der Sätze bei den Probanden vorzufinden war. Dies Ergebnis zeugt von der relativ universalen Verständlichkeit von Intonation.
Im Folgenden soll uns nur dieser dritte Bereich der Intonationsforschung beschäftigen, der aufgrund seines suprasegmentalen und nicht diskreten Charakters nur noch intuitiv rezipiert werden kann. Dabei soll der Nachweis erbracht werden, welche besondere Qualität die Tonalität in der Sprache besitzt und wie diese sie zu einer kommunikativen Ersatzform zur begrifflichen Sprache macht. Die Tonalität in der Sprache ist mit der Musik gleichzusetzen und wird ab hier begrifflich auch nicht mehr von dieser getrennt aufgefasst.
Für Schopenhauer, auf den Nietzsche in seinen Anfängen stark referierte, ergibt sich eine vorherrschende und überragende Stellung der Musik gegenüber der begrifflichen Sprache, indem die Begriffe nur die allererste aus der Anschauung abstrahierten Formen, gleichsam die abgezogene äußere Schale der Dinge enthalten, also ganz eigentlich abstracta sind; die Musik hingegen den innersten aller Gestaltungen vorhergängigen Kern oder das Herz der Dinge gibt.[52]
In der von Schopenhauer entwickelten Dualität aus Wille und Vorstellung steht die Welt der Vorstellung für unsere empirisch zu erfassende Welt. Sie ist durch unsere Benennung der Dinge in der begrifflichen Sprache manifestiert und schließlich auch fixiert. Die im Gegensatz dazu stehende Welt des Willens kann weder durch unseren sensorischen Apparat noch durch unseren Geist erfasst werden. Einzig die Musik soll befähigt sein, uns die Welt des Willens erfahrbar zu machen, indem sie „auf den Willen, d.i. Gefühle, Leidenschaften und Affekte des Hörers unmittelbar einwirkt“[53], denn nur „die Musik [...] wirkt so mächtig auf das Innerste des Menschen, wird dort so ganz und so tief von ihm verstanden als eine ganz allgemeine Sprache“[54]
Ein tieferes Verständnis für diese Polarität erlaubt uns Nietzsches Schopenhauer-Adaption in der Geburt der Tragödie. Dort repräsentieren Apollon und Dionysos die beiden wettstreitenden Kräfte. Apollon, Gott der Mantik und der Künste, nimmt den Platz der Vorstellung ein: seine Kunstgattung ist ursprünglich die Plastik und die Malerei. Nietzsche ordnet ihm auch die Sprache zu, da sie nur die äußere Hülle, aber nicht das Wesen der Dinge erfasst. Die Schrecken des Daseins werden mit der schönen und strahlenden Aura dieser Gottheit verhüllt. Der Mensch erfährt einen Trost für das Jammertal des Lebens durch die Betrachtung des schönen Scheins. Und so kann er nach Schopenhauer selbst im Angesicht des eigenen drohenden Untergangs gelassen bleiben:
Wie auf dem tobenden Meere, das, nach allen Seiten unbegrenzt, heulend Wasserberge erhebt und senkt, auf einem Kahn ein Schiffer sitzt, dem schwachen Fahrzeug vertrauend; so sitzt, mitten in einer Welt von Qualen, ruhig der einzelne Mensch, gestützt und vertrauend auf das principium individuationis.[55]
Dionysos, Gott sowohl der Fruchtbarkeit als auch der Vernichtung, symbolisiert bei Nietzsche den Willen. Seine Kunstgattung ist die Musik, mit deren Hilfe der Mensch das Bewusstsein und das eigene Subjekt überwindet, um Anteil an dem Leben an sich zu erfahren und um daraus einen metaphysischen Trost zu erlangen.
[...]
[1] KSA XII, S.538 (Herbst 1887 10[146])
[2] Der Philologie widmet er sich jedoch auch nicht alleine fachspezifisch, da „Nietzsches Beschäftigung mit Sprachlichem [...] ein philologisches Philosophieren oder eine philosophierende Philologie [ist], mit sprachmelodischen wie sprachkritischen Einschlägen, voller Entwürfe zu einer philosophisch ausgerichteten Kulturgeschichte, die gleichzeitig Kulturkritik wurde.“ Vgl.: Sonderegger, Stefan: Friedrich Nietzsche und die Sprache. In: N-St., Bd. 2, 1973, S. 30
[3] Bereits im Vorwort zur Geburt der Tragödie kündigt sich an, dass der Philologe in Nietzsche nach diesem Werk schon überwunden und durch den Dichter und Musiker ersetzt war: „hier sprach [...] etwas wie eine mystische und beinahe mänadische Seele, die mit Mühsal und willkürlich, fast unschlüssig darüber, ob sie sich mittheilen oder verbergen wolle, gleichsam in einer fremden Zunge stammelt. Sie hätte singen sollen, diese „neue Seele“ – und nicht reden! Wie schade, dass ich, was ich damals zu sagen hatte, es nicht als Dichter zu sagen wagte“ KSA I, S.15 (GT, Versuch einer Selbstkritik)
[4] „Ich misstraue allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit.“ KSA VI, S.63 (GD, Sprüche und Pfeile 26)
[5] KSA XII, S.450 (N, Herbst 1887 9[187])
[6] Die vorliegende Arbeit kann sich daher auch nicht auf einzelne Werke Nietzsches beschränken, da der gesamte Mensch hinter dem Text erst durch das gesamte Werk seine Vollständigkeit erfährt. Dabei gilt jedoch, nicht der Bequemlichkeit der „schlechtesten Leser“ zu verfallen, die „wie plündernde Soldaten verfahren: sie nehmen sich Einiges, was sie brauchen können, heraus, beschmutzen und verwirren das Uebrige und lästern auf das Ganze.“ KSA II, S.436 (MA II, Vermischte Meinungen und Sprüche 137)
[7] „Der Intellekt hat ungeheure Zeitstrecken hindurch Nichts als Irrthümer erzeugt; [...] Solche irrthümliche Glaubenssätze, die immer weiter vererbt und endlich fast zum menschlichen Art- und Grundbestand wurden, sind zum Beispiel diese: daß es dauernde Dinge gebe, daß es gleiche Dinge gebe, daß es Dinge, Stoffe, Körper gebe, daß ein Ding Das sei, als was es erscheine, ...“ KSA III, S.469 (FW, Drittes Buch 110)
[8] So lautet einer seiner vielen Wertschätzungen der Musik: „Hat man bemerkt, dass die Musik den Geist frei macht? Dem Gedanken Flügel giebt? dass man um so mehr Philosoph wird, je mehr man Musiker wird?“ KSA VI, S.14 (DFW, Turiner Brief vom Mai 1888 1)
[9] Maurice Blanchot: Nietzsche und die fragmentarische Schrift. In: Nietzsche aus Frankreich. S. 56
[10] Dieser Ansatz wäre in der Tradition der Germanistik selbstredend dann kritisch, wenn wir versuchten, einen Erzähler oder Protagonisten mit dem Autor gleich zu setzten. Doch Nietzsches Werke bewegen sich außerhalb eines fiktiven Rahmens, der ausschließlich literaturkritisch zu behandeln wäre. Sein literarisches Schaffen ist als eine Kunst angelegt, welche nicht nur die Probleme des Subjekts inhaltlich thematisiert, sondern deren Lösung durch Dichtung, Poesie und musikalische Elemente zugleich auch vorgibt.
[11] KSA V, S.42 (JGB, Zweites Hauptstück: der freie Geist 25)
[12] Nietzsches generelle Sprachskepsis gegenüber Begriffen gepaart mit der einleitend erwähnten Überzeugung der fortlaufenden und fließenden Veränderung markiert damit einen Übergang zur beginnenden Krise des Subjekts, die sich in der Industrialisierung sowie in den totalitären Systemen des Faschismus und Kommunismus verschärft und schließlich im globalisierten Kapitalismus der Post-Moderne ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht.
[13] Die Personifikationen des Subjekts, die in diesem Satz eine Handlungsmöglichkeit präsupponiert, welcher im nächsten Satz widersprochen wird, sollen hier bereits exemplarisch die Restriktion der Sprache veranschaulichen, die im Umgang mit dem Subjekt zumeist im unendlichen Regress endet.
[14] KSA V, S.31 (JGB, Erstes Hauptstück: von den Vorurtheilen der Philosophen 17)
[15] KSA IV, S.40 (Z, Von den Verächtern des Leibes)
[16] Neben der Einschränkung durch den fiktionalen Rahmen erfahren diese klaren Aussagen über Gestalt und Wirkung des Selbst eine weitere Fragwürdigkeit, wenn Nietzsche im selben Jahr der Fertigstellung des Zarathustra den Begriff des Selbst in einem Fragment schon wieder ad absurdum führt: „Selbst-Bekenntnisse: Im Grunde ist mir das Wort zu feierlich: ich glaube bei mir weder an das Bekennen noch an das Selbst.“ KSA XI, S.423 (N, April – Juni 1885 34[1])
[17] KSA IV, S.40 (Z, Von den Verächtern des Leibes)
[18] Zur Vertiefung dieser Kritik verweise ich auf 3.1
[19] „Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser – der heisst Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er. Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe, als in deiner besten Weisheit. [...] Dein Selbst lacht über dein Ich und seine stolzen Sprünge“ KSA IV, S.40 (Z, Von den Verächtern des Leibes)
[20] KSA III, S.111 (M, Zweites Buch, Erleben und Erdichten 119)
[21] „Das, was den Menschen so schwer zu begreifen fällt, ist ihre Unwissenheit über sich selber, von den ältesten Zeiten bis jetzt! [...] Noch immer lebt der uralte Wahn, dass man wisse, ganz genau wisse, wie das menschliche Handeln zu Stande komme, in jedem Falle. [...] Die Handlungen sind niemals Das, als was sie uns erscheinen!“ KSA III, S.108 f. (M, Zweites Buch, Die unbekannte Welt des „Subjects“ 116)
[22] KSA XI, S.248 (N, Sommer – Herbst 1884 26[370])
[23] Das Ich verleiht dem einzelnen jedoch nicht, wie zunächst anzunehmen wäre, seine Individualität, sondern vermag das genaue Gegenteil, indem es ihn im Gegensatz zum Selbst durch Gleichsetzung in eine Herde aus vielen Ichs einpfercht: „Ursprünglich Herde und Herden-Instinkt; das Selbst als Ausnahme, Unsinn, Wahnsinn von der Herde empfunden.“
KSA X, S.83 (N, Sommer – Herbst 1882 3[1] 255)
[24] Im Gegensatz zu den physischen und daher veränderlichen Phänomenen des phoné (Stimme), der phantasía (Vorstellung), sowie des hormé (Trieb)
[25] Borsche, Tilman: Klassiker der Sprachphilosophie, S.11
[26] Im Gegensatz zur geschichtlich zuvor angenommenen reinen Vernunft: „eine reine Vernunft ohne Sprache ist auf Erden ein utopisches Land [...] Sprache ist der Charakter unsrer Vernunft, durch welchen sie allein Gestalt gewinnet und sich fortpflanzet“ Herder, J.G.: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Buch 9, Kap. 2, S.347 f.
[27] „Die Sprache ist das Mittel, durch welches der Mensch zu gleich sich selbst und die Welt bildet oder vielmehr seiner dadurch bewusst wird, daß er eine Welt von sich abscheidet.“ Seidel, S. (Hg.): Der Briefwechsel zwischen Friedrich Schiller und Wilhelm von Humboldt. Bd. 2, S.207
[28] „Die Ausrufe, die den Onomatopoetika sehr nahe stehen, geben Anlass zu entsprechenden Bemerkungen und gefährden unsere These ebenso wenig. Man ist versucht, in ihnen einen spontanen Ausdruck des Sachverhaltes zu sehen, der sozusagen von der Natur diktiert ist. Aber bei der Mehrzahl von ihnen besteht ebenfalls kein natürliches Band zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem. Es genügt, unter diesem Gesichtspunkt zwei Sprachen zu vergleichen, um zu erkennen, wie sehr diese Ausdrücke von einer zu anderen wechseln [...]“ de Saussure, F.: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaften, S.81
[29] Heintel, E. (Hg.): Sprachphilosophische Schriften.
[30] Borsche, Tilman: Natur-Sprache; Herder-Humboldt-Nietzsche. S.121
[31] Diese allerdings nicht eine entwickelte Leistung, sondern eine axiomatische Feststellung eines Tatbestandes ohne Ursache.
[32] Zum tieferen Verständnis für die besondere Bedeutung des Tones in der Sprache verweise ich auf den Intonationsteil dieser Arbeit.
[33] Heintel, E.: Ebd. S.40
[34] Gerber, Gustav: Die Sprache als Kunst
[35] Erst später sollte sich herausstellen, dass besagte Rhetorikvorlesung inhaltlich und oftmals sogar wörtlich von Gustav Gerber übernommen worden war.
[36] KSA I, S.877 (WL 1, Absatz 4)
[37] KSA I, S.880 (WL 1, Absatz 6)
[38] KSA III, S.471 f. (FW, Drittes Buch 111)
[39] Ein Glaube, den Nietzsche bereits in jungen Jahren durch das Studium von Schopenhauers „Die Welt als Wille und Vorstellung“ adaptierte und der sich durch all seine Werke als roter Faden verfolgen lässt.
[40] Heraklit sagte sinngemäß, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann. Und selbst dieser Lehrsatz verdeutlicht die Widersprüchlichkeit der begrifflichen Sprache: Man unterstellt dem Fluss durch seine Benennung als ‚Fluss’ Beständigkeit und intensiviert sein fortlaufendes konstantes Sein durch das Adjektiv „der selbe Fluss“
[41] KSA III, S.472 (FW, Drittes Buch 111)
[42] „Das Uebersehen des Individuellen und Wirklichen giebt uns den Begriff, wie es uns auch die Form giebt, wohingegen die Natur keine Formen und Begriffe, also auch keine Gattungen kennt.“ KSA I, S.880 (WL, 1)
[43] Neben der anthropologischen Begründung für die Sprachentstehung erkennt Nietzsche auch noch eine psychologische Implikation: „Etwas Unbekanntes auf etwas Bekanntes zurückzuführen, erleichtert, beruhigt, befriedigt, giebt ein Gefühl von Macht.“ KSA VI, S.93 (GD, Die vier grossen Irrthümer 5)
[44] KSA VII, S.64 (N, Winter 1869-70 – Frühjahr 1870 3[16])
[45] KSA VII, S.486 (N, Sommer 1872 – Anfang 1873 19[215])
[46] Nietzsche, F.: Vorlesungsverzeichnis (WS 1871/72-WS 1874/75). In KGA, Abt.II, Bd. IV, S.426
[47] Ebd.
[48] KSA VII, S.474 (N, Sommer 1872-Anfang 1873 19[178])
[49] Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. In: Erzählungen, Erfindungen, Gespräche und Briefe, Reisen. S. 465
[50] KSA XII, S.493 (N, Herbst 1887 10[60])
[51] Zum genauen Versuchsaufbau und seinem Ergebnis vgl. Heike, Georg: Suprasegmentale Analyse. S.102 ff. oder Scherer, Klaus (Hg): Vokale Kommunikation, S.311 ff.
[52] Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung I, S.367
[53] Ebd. Buch II, S.574
[54] Ebd. Buch I S.357
[55] Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung. S.416
- Arbeit zitieren
- Brian Trenaman (Autor:in), 2004, Das verlorene Ich. Subjektivität bei Friedrich Nietzsche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359299
Kostenlos Autor werden





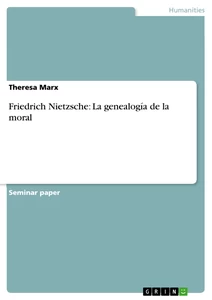
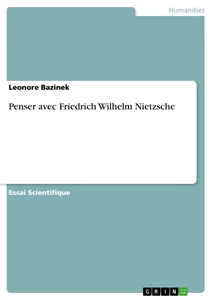













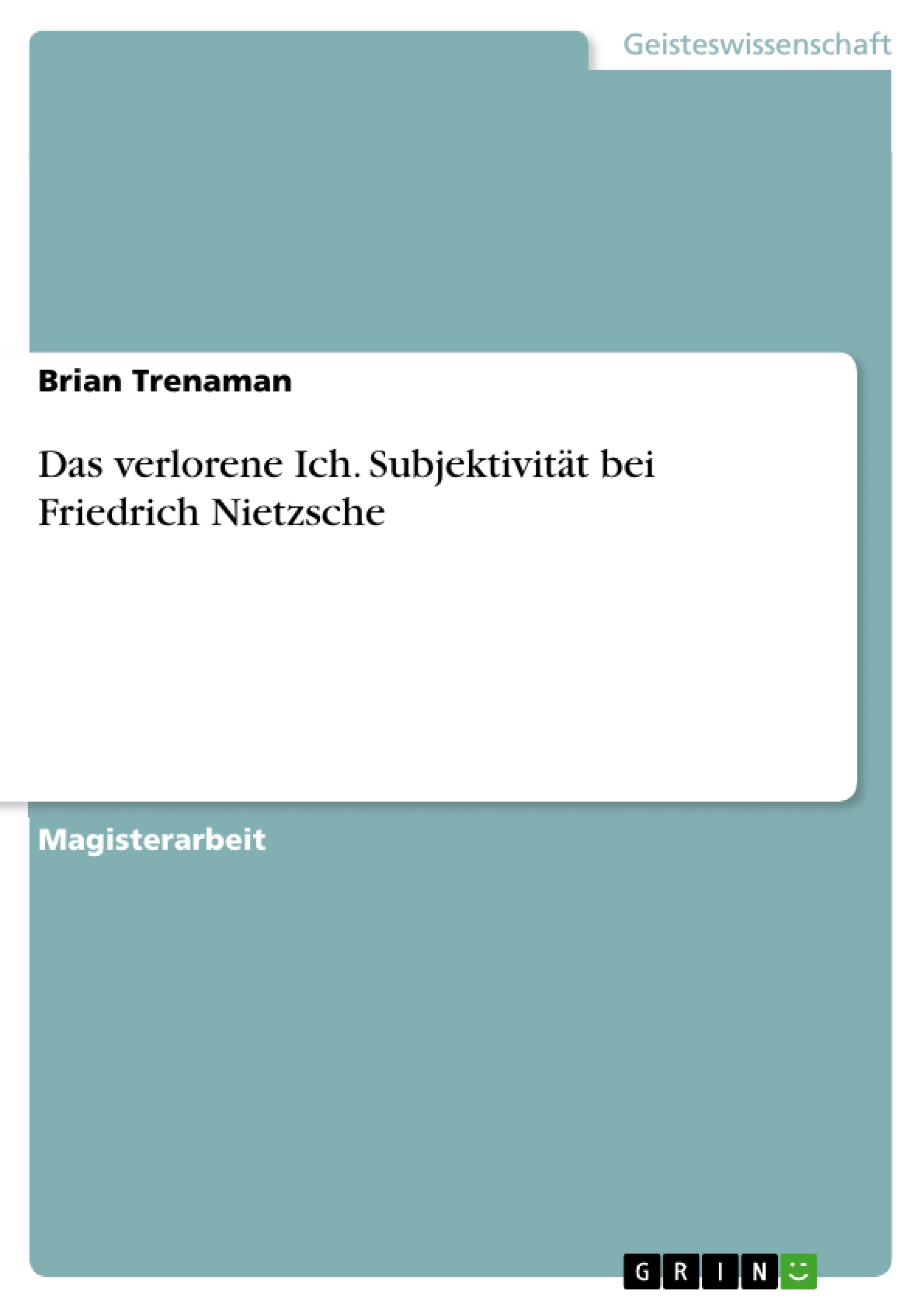

Kommentare