Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungs Verzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
2. Status Quo
2.1 Bestandteile und Funktionsweise
2.2 Ziele und Absichten
2.3 Kritik am Ehegattensplitting
2.3.1 Verteilungswirkung
2.3.2 Anreizwirkung
3. Familiensplitting
3.1 Varianten des Familiensplittings
3.1.1 Tarifsplitting
3.1.2 Realsplitting
3.2 Empirische Untersuchungen der Reformalternativen
3.2.1 Französisches Modell
3.2.2 Familienteilsplitting
3.2.3 Familienvollsplitting
3.2.4 Eherealsplitting
3.2.5 Familienrealsplitting
4. Zusammenfassung und Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Rechtsquellenverzeichnis
Rechtsprechungsverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 50 Seiten
- Arbeit zitieren
- Markus Steiger (Autor:in), 2016, Ehegattensplitting versus Familiensplitting. Bietet ein Familiensplitting eine Option zur Reform der Familieneinkommensbesteuerung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355062
Kostenlos Autor werden
✕
Leseprobe aus
50
Seiten
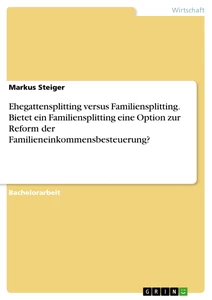
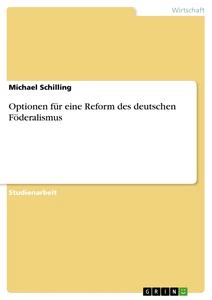
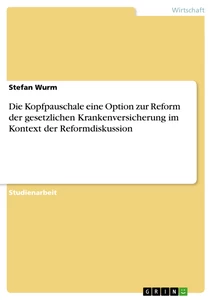
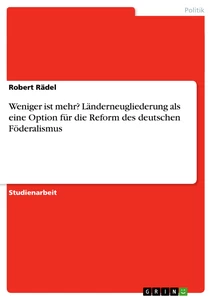
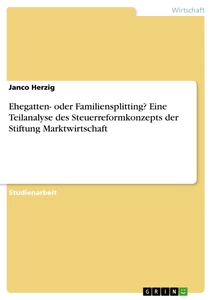
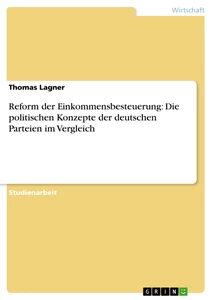
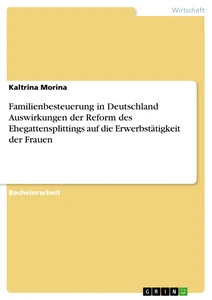
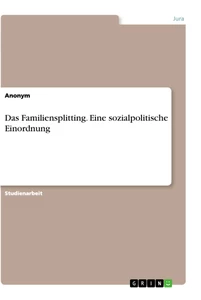
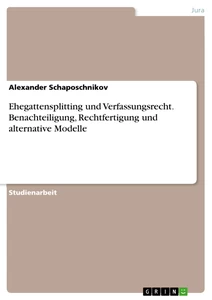
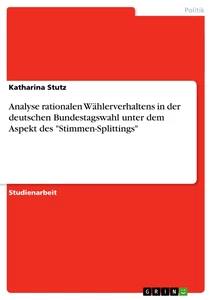
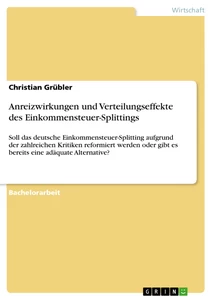



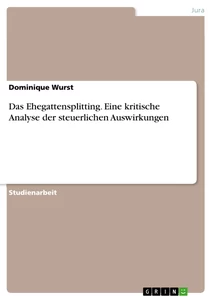
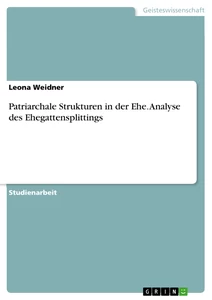
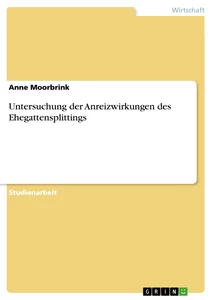
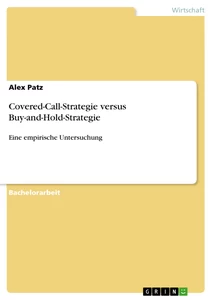
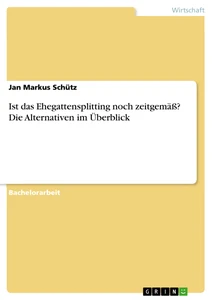
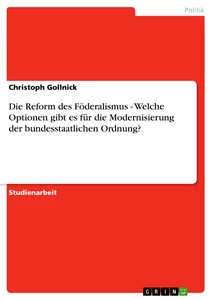
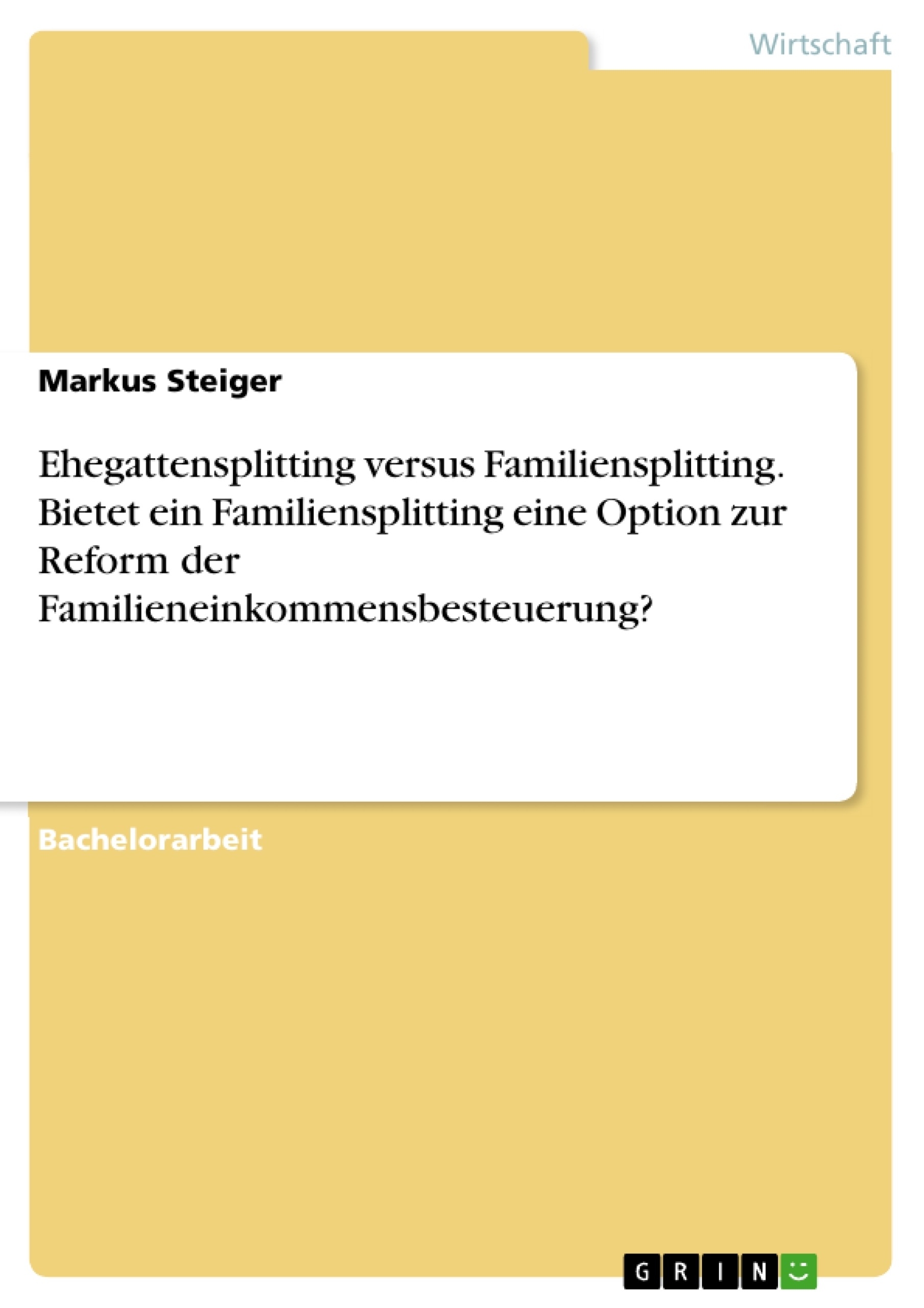

Kommentare