Leseprobe
Inhalt
1. Theorieteil
1.1. Diagnostisches Verfahren bzw. Psychodiagnostik:
1.2. Der Normbegriff
1.2.1. Die statistische Norm
1.2.2. Die ideale Norm
1.2.3. Die funktionale Norm
1.3. Die Verhaltenstherapie
1.3.1. Das klassische Konditionieren
1.3.2. Das operante Konditionieren
1.3.3. Modelllernen
1.3.4. Techniken auf der Grundlage des klassischen Konditionierens
1.3.4.1. Die Gegenkonditionierung und systematische Desensibilisierung
1.3.4.2. Die Reizüberflutung
1.3.5. Techniken auf der Grundlage des operanten Konditionierens: die Verhaltensformung
1.3.6. Techniken auf der Grundlage des Modelllernens
1.4. Die klientzentrierte Gesprächspsychotherapietechnik
1.4.1. Paraphrasieren & Verbalisieren
1.5. Die Psychoanalyse
1.5.1. Die freie Assoziation
1.5.2. Die Traumdeutung
1.5.3. Widerstand
1.5.4. Übertragung
1.5.5. Gegenübertragung
1.6. Die Dynamik der Instanzen
1.6.1. Ich-Stärke
1.6.2. Ich-Schwäche
1.6.3. psychoanalytische Abwehrmechanismen
2. Praxisteil
2.1. Diagnostische Verfahren während der Therapie
2.1.1. Inhalt der Anamnese und Exploration
2.1.2. Diagnose der Therapeutin
2.1.3. Anwendung weiterer Methoden während der Therapie
2.2. Der Normbegriff angewandt bei Betty
2.3. Bettys Therapie
2.3.1. Anteile der Verhaltenstherapie sowie der Psychoanalyse
2.3.2. Paraphrasieren & Verbalisieren während der Therapie
2.3.3. Widerstand, Übertragung und Gegenübertragung
2.3.4. Die Funktion von Märchen in einer Spieltherapie
2.4. Sigmund Freuds Persönlichkeitstheorie
2.4.1. psychoanalytische Abwehrmechanismen bei Betty
2.4.2. Dynamik der Instanzen
Literaturverzeichnis
1. Theorieteil
1.1. Diagnostisches Verfahren bzw. Psychodiagnostik:
Die Psychodiagnostik ist ein Messverfahren der wissenschaftlichen Psychologie zur Messung und Erfassung der Persönlichkeit des Menschen, das ein Minimum an Irrtum und ein Maximum an Genauigkeit gewährleistet. Ziel des diagnostischen Verfahrens ist also das Erstellen eines möglichst genauen Bild der untersuchten Person, ihren Persönlichkeitsmerkmalen sowie ihrer Verhaltensbereitschaft mit Hilfe von wenigen, aber dennoch verlässlichen und gut ausgewählten Daten. Dabei werden die Fragen, inwieweit, in welchem Ausmaß und warum sich eine Person in einer bestimmten Situation so und nicht anders verhält und auch in Zukunft verhalten wird, behandelt (Hobmaier, 2008). Um benötigte Informationen zu erhalten, werden verschiedenste Methoden angewandt, die jedoch alle folgenden Gütekriterien unterliegen müssen:
- Gültigkeit (= Validität): Es wird tatsächlich das beobachtet bzw. gemessen, was auch zu beobachten bzw. messen angegeben wurde (ebd., 2008, S. 51).
- Zuverlässigkeit (= Reliabilität): Das, was zu beobachten bzw. messen angegeben wurde, wird auch genau und exakt beobachtet bzw. gemessen (ebd., 2008, S. 51).
- Objektivität: Die Beobachtung bzw. Untersuchung darf in ihrer Durchführung, Auswertung und Interpretation nicht von der Person des Forschers abhängig sein (ebd., 2008, S. 52).
Zusammenfassend lässt sich die Psychodiagnostik also als ein Vorgehen der wissenschaftlichen Psychologie definieren, bei dem mit Hilfe verschiedenster Methoden unter Beachtung wissenschaftlicher Gütekriterien eines oder mehrere Merkmale der Persönlichkeit erhoben werden. Die Methoden der Persönlichkeitsmessung sind dabei:
- die Anamnese, bei dem in einem Gespräch Daten über die bisherige Lebensgeschichte einer Person und die Entstehung eines Problems erfragt werden,
- die Exploration (bzw. das Tiefeninterview), bei dem in einem Gespräch gezielte Fragen zur aktuellen Lebenssituation einer Person (z.B. familiäre und wirtschaftliche Verhältnisse, soziale Bindungen, Probleme und Störungen) gestellt werden,
- die schriftliche Befragung, die eine Technik zur Erfassung von Daten mit Hilfe der Beantwortung von Fragen, die einer/einem Person/Personenkreis gestellt werden, darstellt, und mit Hilfe eines Fragebogens geschieht,
- das Interview, das eine ebenfalls eine zweckgerichtete, jedoch mündliche Befragung zur Erhaltung bestimmter Daten darstellt, bei dem der Interviewer seine Fragen den Besonderheiten des Befragten und der jeweiligen Situation anpasst,
- die Verhaltensbeobachtung, bei der geplant, gezielt sowieso systematisch ein bestimmter Teilbereiche der Wirklichkeit mit dem Ziel, diesen Bereich möglichst genau zu erfassen und festzuhalten, beobachtet wird, und somit Informationen über das offen gezeigte Verhalten einer Person erhalten werden,
- und verschiedenste Formen von Tests (z.B. Persönlichkeitsfragebögen, Leistungstests oder projektive Tests) bei denen individuelle Ausprägungen eines oder mehrerer psychischer Merkmale eines Menschen festgestellt werden.
- Projektive Tests werden in der Persönlichkeitsmessung allerdings nur begrenzt und abgesichert durch andere Verfahren eingesetzt, da sie nicht immer die oben genannten wissenschaftlichen Gütekriterien erfüllen. Sie gehen von der Grundlage aus, dass die Person ihre eigenen Probleme und Stimmungen in die Außenwelt und damit auch in das Testmaterial einfließen lässt, und die Antworten der Person somit Rückschlüsse auf ihre eigenen Konflikte und ihre Persönlichkeitsstruktur zulassen (vgl. Hobmaier, 2008).
Verwendung findet die Psychodiagnostik vor allem in der Beratung und Therapie, wo mögliche Ursachen von Störungen ermittelt werden und somit gezielte Maßnahmen eingeleitet werden können, der Eignungsuntersuchung, bei der die Fähigkeiten einer Person ermittelt werden, und bei der Überprüfung von Hypothesen und Persönlichkeitstheorien zum theoretischen Zweck.
1.2. Der Normbegriff
Um eine psychische Störung zu diagnostizieren, muss zunächst festgelegt werden, was „normal“ und was „nicht normal“ ist – eine Bezugsgröße ist also nötig; eine Norm. Die Normvorstellung ist also von entscheidendem Wert. Die Verhaltenserwartung bzw. der Maßstab, an dem das Verhalten und Handeln einer Person dann gemessen wird, wird als soziale Norm bezeichnet. Dabei bedeutet Normalität die relative Übereinstimmung mit den für gültig gehaltenen Normen. Es lassen sich drei Arten von Normen unterschieden (vgl. Hobmaier, 2008):
1.2.1. Die statistische Norm
Hier erfährt der Normbegriff eine statistische Betrachtungsweise. Es wird die Verhaltensweise als normal deklariert, die am häufigsten vorkommt. Es entsteht also ein statistisch errechneter Durchschnittswert des Verhaltens einer Bezugsgruppe bzw. der Gesellschaft. Demnach ist jedes Verhalten, das selten ist, nicht normal. Da als Grundlage hier objektiv überprüfbare Fakten zu Grunde liegen, spricht man von einem objektiven Kriterium.
1.2.2. Die ideale Norm
Hier erfährt der Normbegriff eine gesellschaftliche Betrachtungsweise. Normalität wird demnach mit dem gleichgesetzt, was den allgemein akzeptierten gesellschaftlichen Regeln bzw. den in dieser Gesellschaft herrschenden Idealvorstellungen entspricht. Da solche Vorstellungen stets in einem soziokulturellen Zusammenhang zu sehen sind, spricht man von einem soziokulturellen Kriterium.
1.2.3. Die funktionale Norm
Hier erfährt der Normbegriff eine persönliche, subjektive Betrachtungsweise. Normalität wird also anhand der Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Verhalten der Person und ihren persönlichen Vorstellungen beurteilt. Normal ist also das Verhalten, dass keine Beeinträchtigung des körperlichen, geistigen psychischen oder sozialen Funktionierens des Individuums nach sich zieht. Da hier die subjektive Einstellung der Person ausschlaggebend ist, spricht man von einem subjektiven Kriterium.
1.3. Die Verhaltenstherapie
„Es gibt keine Neurose, die dem Symptom zugrunde liegt, sondern nur das Symptom selbst. Man beseitige das Symptom und hat die Neurose zum Verschwinden gebracht“.
Dieses Zitat von Eysenck und Rachman (1973) beschreibt die Grundlage der Verhaltenstherapie als psychotherapeutisches Verfahren gut: es geht um die Veränderung des problematischen Verhaltens selbst, und nicht um die Veränderung der Ursache (wie z.B. in der Psychoanalyse). Basis für diese Psychotherapie sind Lerntheorien wie z.B. das klassische und operante Konditionieren sowie das Lernen am Modell. Wenngleich muss an dieser Stelle berücksichtigt bleiben, dass unter Eysencks und Rachmanns klassischer Sichtweise tragende Bestandteile von Störungen unberücksichtigt bleiben (bspw. die Entstehung, Entwicklung der Neurose, Abwehrmechanismen oder das Erleben der Neurose; (vgl. Schulte & Tölle, 2013) ).
1.3.1. Das klassische Konditionieren
Das klassische Konditionieren ist eine Lerntheorie die davon ausgeht, dass ein Verhalten dann erlernt wird, wenn ein Reiz, der noch keine bestimmte Reaktion auslöst, mehrmals zeitlich und räumlich gleichzeitig mit einem anderen Reiz, der schon ein bestimmtes Verhalten auslöst, auftritt. Dadurch entsteht zwischen den beiden Reizen eine Verknüpfung, und der Reiz, der zunächst zu keiner bestimmten Reaktion führte, löst dann die gleiche Reaktion aus, wie der andere Reiz (Hobmaier, 2008).
1.3.2. Das operante Konditionieren
Beim operanten Konditionieren wird die Häufigkeit eines Verhaltens durch seine angenehmen bzw. unangenehmen Konsequenzen nachhaltig verändert. In der Alltagssprache ist das „Lernen am Erfolg“ oder „Lernen durch Belohnung/Bestrafung“. D.h. also dass Verhaltensweisen, die öfter zum Erfolg führen, wieder gezeigt und erlernt werden, und Verhaltensweisen, die öfter zum Misserfolg führen, nicht wieder gezeigt und damit nicht erlernt oder verlernt werden. Ein Erfolg hat dabei denselben Effekt wie die Hervorrufung oder Aufrechterhaltung eines angenehmen Zustandes bzw. die Beseitigung, Vermeidung oder Verringerung eines unangenehmen Zustandes (Hobmaier, 2008).
1.3.3. Modelllernen
Das Lernen am Modell bezeichnet eine Lerntheorie, bei der ein Lernvorgang auf der Beobachtung eines Verhaltens von menschlichen Vorbildern, also Modellen, beruht. Das Modelllernen nach Albert Bandura verläuft in vier Phasen, die sich jeweils in zwei grobe Phasen der Aneignung und Ausführung unterteilen. Bei der Aneignungsphase wählt der Beobachter aus der Fülle der Informationen, die ihm das Vorbild bietet, die für ihn wichtigen Bestandteile aus und beobachtet genau. Danach setzt der Gedächtnisprozess ein, bei dem der Lernende das Beobachtete in Gedächtnisstrukturen umformt. Er legt also ein neues Schema an bzw. erweitert ein bereits vorhandenes. Diese kann er als Erinnerung wieder aktivieren. Nun beginnt die Ausführungsphase. Als erstes setzten die motorischen Reproduktionsprozesse ein, bei dem der Lernende sich erinnert und versucht, das Beobachtete zu reproduzieren. Bei dem gesamten Komplex des Modelllernens spielt die Motivation eine entscheidende Rolle. Es wird nur dann ein Verhalten beobachtet und erlernt, wenn der Lernende sich davon Erfolg verspricht bzw. Misserfolg abzuwenden glaubt (Bandura, 1999; Hobmaier, 2008).
1.3.4. Techniken auf der Grundlage des klassischen Konditionierens
In der Verhaltenstherapie wird also von der Grundannahme ausgegangen, dass jedes Verhalten erlernt ist und auch wieder verlernbar ist. Das Symptom wird also als ein Ergebnis fehlender oder falscher Lernprozesse angesehen, das durch entsprechende neue Lernvorgänge korrigiert und verbessert werden kann. Das Ziel der Verhaltenstherapie ist es also demnach das unerwünschte bzw. unangepasste Verhalten, d.h. die psychische Störung, abzubauen und erwünschtes Verhalten durch gezielte Lernhilfen aufzubauen. Voraussetzung dafür ist eine genaue Verhaltensanalyse. Ist dies erfüllt, kann ein Vorgehensplan für die Verhaltensänderung, also die Verhaltensmodifikation, ausgearbeitet werden. Dafür gibt es, je nach angewandter Lerntheorie, verschiedene Techniken (vgl. Hobmaier, 2008):
1.3.4.1. Die Gegenkonditionierung und systematische Desensibilisierung
Die Gegenkonditionierung stellt die Konditionierung auf einen neuen Reiz dar, um eine schon erworbene Reiz-Reaktions-Verbindung abzubauen. Nicht erwünschte Reaktionen, z.B. Angst, werden also abgebaut, indem der Therapeut den Reiz, der die negative emotionale Reaktion zur Folge hat, mehrmals mit einem Reiz koppelt, dessen Reaktion mit dieser emotional negativen Reaktion unvereinbar ist. Angsterregende Reize werden also mit positiven, angenehmen Reizen verbunden. Man spricht also von einer Gegenkonditionierung, wenn durch eine erneute Konditionierung ein bedingter Reiz eine andere, der ursprünglich bedingten Reaktion entgegengesetzte Wirkung erzielt. Ziel ist es, die alte Reiz-Reaktions-Verbindung durch eine neue zu ersetzen. Dieser Prozess sollte schrittweise Ablaufen, weswegen diese Vorgehensweise auch als systematische Desensibilisierung bezeichnet wird. Dies ist also das allmähliche Verlernen von negativen emotionalen Reaktionen, wobei der Klient zunächst mit dem ursprünglich schwächsten und schließlich mit dem stärksten Reiz, der diese negative emotionale Reaktion auslöst, schrittweise konfrontiert wird (Hobmaier, 2008).
1.3.4.2. Die Reizüberflutung
Die Reizüberflutung stellt das Gegenteil zur systematischen Desensibilisierung dar, denn hier wird der Klient gleich zu Beginn der Therapie mit sehr starken Reizen konfrontiert, die die negativen Emotionen hervorrufen, um ihm zu zeigen, dass seine Befürchtungen unbegründet sind und nicht eintreten (Hobmaier, 2008).
1.3.5. Techniken auf der Grundlage des operanten Konditionierens: die Verhaltensformung
Die Verhaltensformung bzw. das Shaping ist der schrittweise Aufbau eines Verhaltens, der dadurch gekennzeichnet ist, dass bereits kleine Schritte in Richtung des Endverhaltens systematisch verstärkt werden. Dies kann z.B. durch Wertmarken (=Tokenprogramm) geschehen, die man erhält, wenn man erwünschtes Verhalten zeigt. Ab einer bestimmten Anzahl von Wertmarken können diese gegen reale Belohnungen wie Spielzeug oder Kinobesuche eingetauscht werden. Das Verhalten wird also mit Hilfe von gezielter Darbietung von angenehmen Konsequenzen bzw. der Aufhebung unangenehmer Konsequenzen verstärkt (Hobmaier, 2008).
1.3.6. Techniken auf der Grundlage des Modelllernens
Diese Technik geht davon aus, dass der Therapeut ein angemessenes Verhalten vorführt, und der Klient durch die Nachahmung und Üben dieses Verhalten erlernt und im eigenen Leben ausführen kann. Der Therapeut stellt also hier das Modell dar, über das der Klient lernt (Hobmaier, 2008).
1.4. Die klientzentrierte Gesprächspsychotherapietechnik
Die klientzentrierte Beratung basiert auf der personenzentrierten Theorie von Carl Rogers. Dabei versetzt sich der Therapeut bzw. der Berater hier in die emotionale Welt des Klienten. Der Therapeut konzentriert sich nicht auf bestimmte Störungen und Symptome sondern versucht vielmehr, das Selbstkonzept und die Wahrnehmung der Wirklichkeit des Klienten zu verändern. Dabei soll der Therapeut drei Verhaltensmerkmale aufweisen: einfühlendes Verstehen, Echtheit bzw. Selbstkongruenz und hohe Wertschätzung. Dabei werden emotionale Wärme und Wertschätzung durch Mimik, Gestik, Stimme und die Körperhaltung, also das nonverbale Verhalten, signalisiert (Hobmaier, 2008; Rogers, 1959).
1.4.1. Paraphrasieren & Verbalisieren
Der Punkt des einfühlenden Verstehens wird oft durch die Technik des aktiven Zuhörens des Therapeuten erfüllt. Er bringt also verbal durch eine unterstützende Beteiligung des Gesprächs zum Ausdruck, dass er dem Klienten genau zuhört und den Klienten versteht. Dies kann durch Paraphrasieren, also durch die Wiederholung der Aussagen des Klienten mit eigenen Worten, sowie durch Verbalisieren, also dem Widerspiegeln der persönlich-emotionalen Erlebniswelt des Klienten, geschehen (Hobmaier, 2008).
1.5. Die Psychoanalyse
Die Psychoanalyse bezeichnet ein Therapieverfahren das versucht, Konflikte, die aus der frühen Kindheit stammen und für das neurotische Verhalten verantwortlich sind, aufzudecken und zu bearbeiten. Es geht also um die Veränderung innerpsychischer Ursachen. Die Psychoanalyse strebt eine umfassende und grundlegende Veränderung derer an, erfordert meistens von zwei bis drei Sitzungen pro Woche bis einer Sitzung alle zwei Wochen, und ist auf Jahre angelegt. Dabei gibt es zwei maßgebende Methoden, die Zugang zum Verdrängten Material schaffen: die freie Assoziation sowie die Traumdeutung (Hobmaier, 2008). Diese werden nachfolgend kurz dargestellt sowie daraus resultierende Effekte erläutert.
1.5.1. Die freie Assoziation
Bei der freien Assoziation wird der Patient aufgefordert, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen und alle Gefühle und Gedanke zu äußern, ohne Rücksicht darauf, wie unwichtig, persönlich oder beschämend sie ihm erscheinen (ebd., 2008).
1.5.2. Die Traumdeutung
Zur Grundlage der Traumdeutung lässt sich folgendes sagen: Es wird angenommen, dass im Traum unbewusste Bedürfnisse und Konflikte auftauchen, die sonst nicht zugelassen werden, da sie Angst erzeugen. Somit tauchen sie im Traum verschlüsselt und symbolhaft auf, sodass sie der Träumende nicht versteht. Nun wird bei der Traumdeutung der Patient aufgefordert, von seinen Träumen zu berichten. Somit schildert der Patient den manifesten Inhalt seiner Träume, also das Traumgeschehen, an das er sich erinnert. Im Anschluss wird der Patient nochmals aufgefordert, frei zu seinen Träumen zu assoziieren – also alles auszusprechen, was ihm zu den Ereignissen oder Personen im Traum einfällt. Dies stellt für den Therapeuten den latenten Trauminhalt dar, also unbewusste Bedürfnisse sowie Ängste und Konflikte, die hinter dem manifesten Trauminhalt verborgen sind (ebd., 2008).
1.5.3. Widerstand
Der Therapeut wird nun das aus den Träumen sowie der freien Assoziation gewonnene Material deuten. Dabei werden dem Patienten vom Therapeuten bestimmte Symbole übersetzt und Zusammenhänge aufgezeigt. Dies darf allerdings erst dann geschehen, wenn der Patient auch dazu in der Lage ist, diese Deutung anzunehmen und zu verarbeiten. Hat er dieses Stadium noch nicht erreicht und der Therapeut teilt ihm seine Deutung trotz dessen mit, wird der Patient diese Deutung mit Widerstand ablehnen. Widerstand ist also die Abneigung gegen die Bewusstmachung unbewusster psychischer Inhalte. Dieser kann nun erneut vom Therapeuten gedeutet und interpretiert werden. Allerdings ist der Abbau eines solchen Widerstandes unter Umständen äußerst langwierig und schwierig (Hobmaier, 2008).
1.5.4. Übertragung
Während der fortschreitenden psychoanalytischen Therapie kommt es oft zu einer starken emotionalen Reaktion des Klienten auf den Therapeuten. Dabei identifiziert der Klient den Therapeuten mit einer Person, die früher im Mittelpunkt seines Konfliktes stand. Es werden also alte Gefühle, Einstellungen und Erwartungen, die man gegenüber einer früheren Bezugsperson hatte, unbewusst auf neue soziale Beziehungen (z.B. den Therapeuten) übertragen und reaktiviert werden. Der Klient verhält sich also dem Therapeuten gegenüber so, wie er es gegenüber der Bezugsperson in seiner Kindheit getan hat. Dabei kann es sowohl zu einer positiven als auch zu einer negativen Übertragung kommen. Bei der positiven Übertragung werden dem Therapeuten Gefühle der Zuneigung und Bewunderung entgegengebracht. Bei der negativen Übertragung werden dem Therapeuten Gefühle der Feindseligkeit und Ablehnung entgegengebracht, die aus der Beziehung zu früheren Bezugspersonen stammen (ebd., 2008).
1.5.5. Gegenübertragung
Bei der Gegenübertragung reagiert der Therapeut selbst mit bestimmten Gefühlen oder Wünschen auf den Patienten. Zwar sollte der Therapeut emotional unvoreingenommen sein, jedoch lässt sich nicht vermeiden, dass jeder Therapeut auf seine ganz persönliche Art auf die Probleme des Patienten eingeht. Aus naheliegenden Gründen wurde die Gegenübertragung früher verpönt, da sie als unorthodox und unangemessen sowie als Störfaktor innerhalb der Therapie galt. Allerdings wird sie heute als eine übliche Erscheinung in der Therapie akzeptiert, die nicht unterdrückt, sondern bewusst verarbeitet werden sollte. Somit tragen Übertragung und auch Gegenübertragung zum Therapiegeschehen bei, denn der Therapeut kann z.B. erkennen, dass das Verhalten des Patienten ähnliche Gefühle in ihm auslöst wie früher bei den Bezugspersonen des Patienten. Somit können Rückschlüsse auf die Reaktionen gewonnen werden, die der Patient vermutlich früher bei seinen Bezugspersonen auslöste.
Dieser Übertragungsprozess stellt den Kern der ganzen Psychoanalyse dar. Der Patient macht nämlich die Erfahrung, dass der Therapeut, also eine neue Person, anders auf ihn reagiert als seine früheren Bezugspersonen. Die Bearbeitung dessen und des Gegenübertragungsprozesses erst ermöglichen eine emotionale „Umerziehung“ des Patienten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Therapeut die Gegenübertragung erkennt und richtig aufarbeitet. Um dazu in der Lage zu sein, muss er in seiner Ausbildung eine Eigenanalyse durchlaufen haben, die ihn befähigt, solche Übertragungsgefühle zu erkennen (ebd., 2008).
1.6. Die Dynamik der Instanzen
Die Dynamik der Persönlichkeit bezeichnet die Wechselwirkung zwischen den drei Instanzen der Persönlichkeit eines Menschen, ES, ICH und ÜBER-ICH und den Anforderungen der Umwelt. Dieses Modell der Instanzen entwickelte Freud, um verschiedene Teilaspekte der Persönlichkeit in ihrer engen Wechselbeziehung darzustellen. Das ES vertritt dabei die Instanz der Triebe, Wünsche und Bedürfnisse. Es kündigt diese an, und das ÜBER-ICH bewertet diese anschließend. Das ÜBER-ICH vertritt also das Moralitätsprinzip, denn es umfasst Wert-, Moral- sowie Normvorstellungen und reguliert das Verhalten des ICHs im Sinne der Moral. Das ICH ist also der Vermittler zwischen ÜBER-ICH und ES und stellt die Instanz des bewussten Lebens und der Realitätsauseinandersetzung dar. Somit überprüft das ICH auch die Realität bezüglich der Frage, inwieweit eine Befriedigung der Triebe möglich ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Dynamik der Persönlichkeit durch das Wechselspiel zwischen den Wünschen des ES, den moralischen Bewertungen des ÜBER-ICHs, den Anforderungen der Realität und den Vermittlungs- und Anpassungsleistungen des ICHs auszeichnet (Freud, 1910, 1971; Hobmaier, 2008).
1.6.1. Ich-Stärke
Eine ICH-starke Person kann selbstbestimmt entscheiden. Es ist in der Lage, einen gerechten Interessenausgleich zwischen dem ES und dem ÜBER-ICH entsprechend der in der Umwelt gegebenen Anforderungen herbeizuführen. Somit wird es manchmal Wünsche und Triebe zulassen, und ein anderes Mal den Trieb unterdrücken bzw. aufschieben. Außerdem kann eine ICH-starke Person seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen und sie vor anderen Menschen selbstbewusst vertreten. Gleichzeitig kann sie jedoch auf Bedürfnisse anderer Rücksicht nehmen und Kompromisse eingehen. Wenn sich die Person aus eigener Überzeugung von moralischen Prinzipien, wie z.B. Fairness, für den Triebverzicht entscheidet, tut sie dies autonom und nicht auf Anordnung des ÜBER-ICHs (Freud, 1910; Hobmaier, 2008).
[...]
- Arbeit zitieren
- B. Sc. Melissa Quantz (Autor:in), 2013, Diagnostik und Therapie in "Betty: Protokoll einer Kinderpsychotherapie" von Anneliese Ude-Pestel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354718
Kostenlos Autor werden


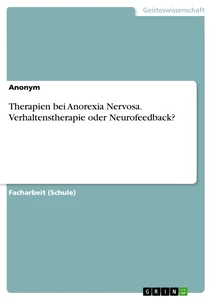









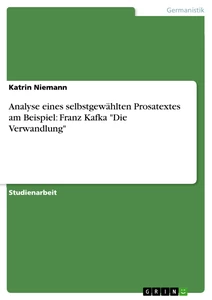




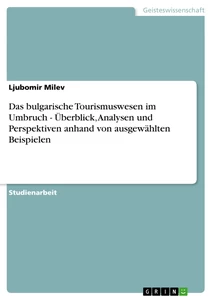


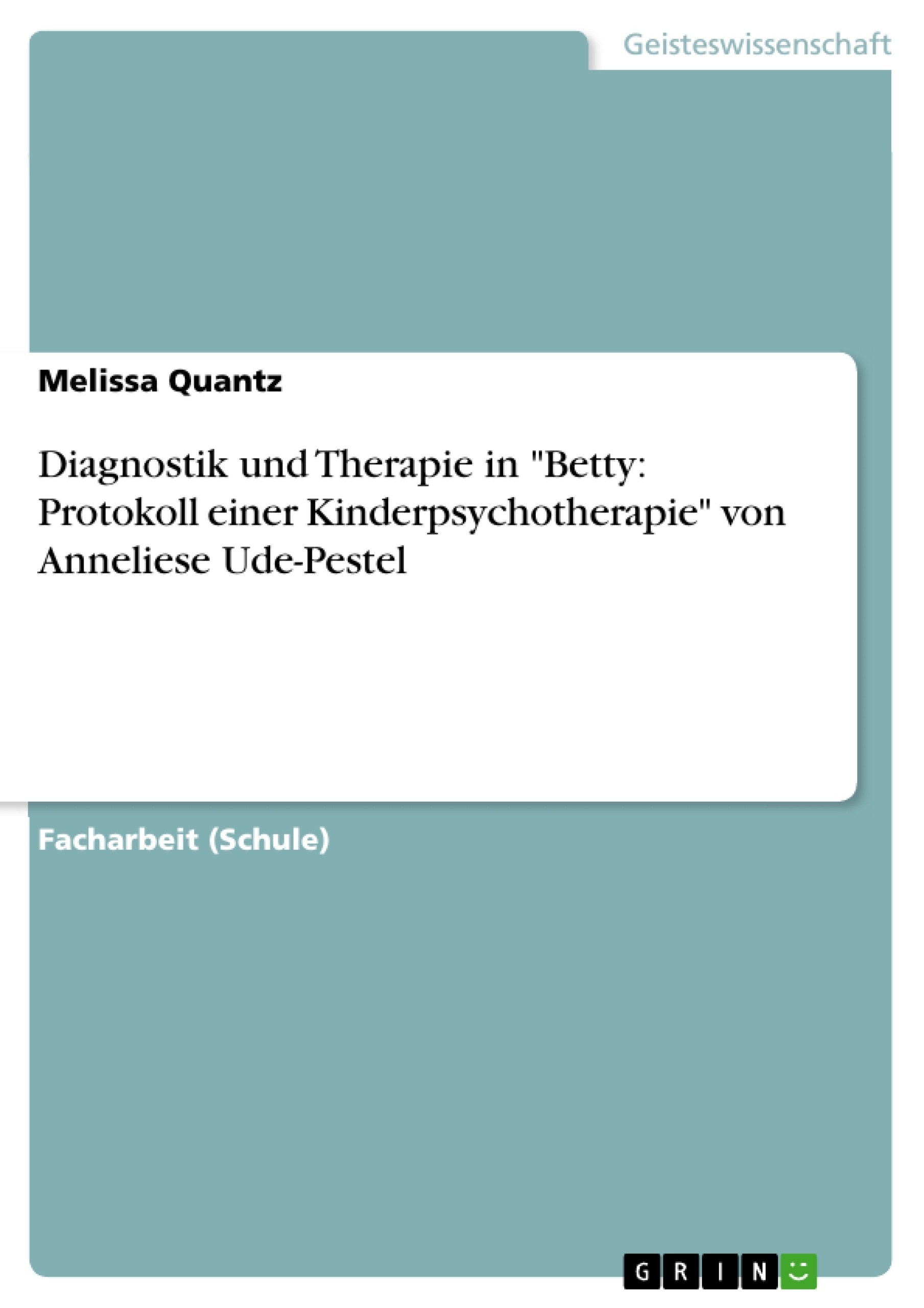

Kommentare